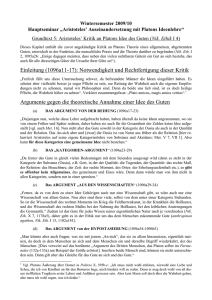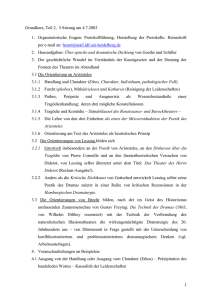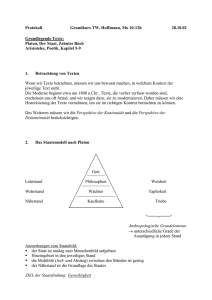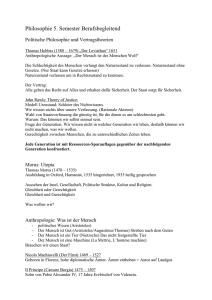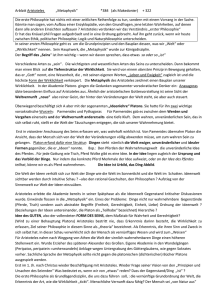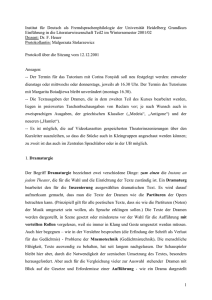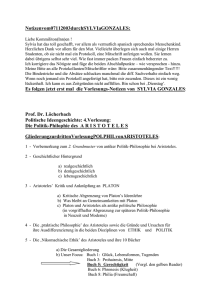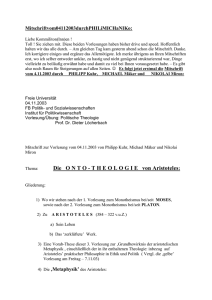Maß, Ordnung und Mitte bei Platon und Aristoteles
Werbung

DieNikomachischeEthikvonAristoteles Einführungsveranstaltung von Prof. Dr. László Tengelyi EinBeitragzurInterpretationdessechstenBuches Maß,OrdnungundMittebeiPlatonundAristoteles (Veröffentlicht: László Tengelyi, „Ordnung, Maß, Mitte bei Platon und Aristoteles“, Phänomenologische Forschungen, Felix Meiner Verlag, Hamburg Jahrgang 2003, S. 39–53.) Daß man bei Aristoteles so etwas wie eine Phänomenologie avant la lettre finde, ist ein Satz, der allem Anschein nach bereits in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts als Gemeinplatz galt. Als einen solchen behandelt ihn z. B. H. J. Krämer. Er versucht in einer ganzen Reihe grundlegender Arbeiten zu zeigen, “daß manches, was bei Aristoteles auf den ersten Blick als Ergebnis einer ursprünglich gehandhabten »phänomenologischen« Methode wirkt, in Wahrheit durch die philosophische Problemlage und durch das schon erarbeitete Denkniveau der Akademie vorbestimmt war.”1 Er faßt die Grundüberzeugung, die ihn in seiner jahrzehntelangen Auseinandersetzung mit der herkömmlichen Ansicht über das Verhältnis von Platon und Aristoteles geleitet hat, in die folgenden Worte: “Die Macht der Denktradition ist groß, und in der »phänomenologischen« Analyse verbirgt sich nicht selten ein ungeformtes Bruchstück zertrümmerter Metaphysik.”2 Mit dieser Grundüberzeugung nähert sich Krämer bereits in seiner groß angelegten Dissertation Arete bei Platon und Aristoteles der berühmten Bestimmung der ethischen Trefflichkeit als einer Mitte zwischen einem Mangel und einem Übermaß. Er gibt zwar zu, daß dieser Bestimmung letzten Endes die gemeingriechische Maßethik zugrunde liegt. Doch besteht er darauf, daß die Lehre von der richtigen Mitte, wie wir sie vor allem aus den ethischen Schriften des Aristoteles kennen, sich keineswegs auf ihre gemeingriechischen Ursprünge zurückführen läßt. Damit will er jedoch wiederum nicht gesagt haben, daß die philosophische Weiterbildung dieser Lehre von Aristoteles selbst stammt. “Sie geht vielmehr” – so behauptet er – “in ihrem wesentlichen Teil auf Platon […] zurück, aber nicht auf vereinzelte Hinweise der Dialoge, sondern auf das Kernstück der platonischen Philosophie überhaupt, die Prinzipienlehre.”3 Im Ausgang von dieser Grundthese bestimmt er dann das Verhältnis von Platon und Aristoteles in der Ethik wie folgt: “Die gemeingriechische Maßethik ist […] durch die platonische Philosophie hindurchgegangen und in ihr im Doppelsinne des Bewahrens und Erhebens aufgehoben. Der Durchstoß Platons zur Höhe der idealen Norm ist geschichtlich einmalig. Aristoteles hat ihn nicht preisgegeben, um seinerseits von unten her eine neue Normenlehre aufzubauen, sondern hat – bei aller Verschiedenheit des ontologischen Ansatzes – die vorgegebenen Positionen kontinuierlich weiter entfaltet.”4 Dieses Verhältnis – setzt er noch hinzu – “ist paradigmatisch für jene »Phänomenologie von oben«, welche im intuitiven Vorgriff das Ganze, die Totalität des 1 Siehe H. J. Krämer, “Zur geschichtlichen Stellung der Aristotelischen Metaphysik”, Kant‐Studien 58 (1967), S. 313–354. Das Zitat ist auf S. 354 zu finden. 2 Ebd. 3 H. J. Krämer, Areté bei Platon und Aristoteles, Carl Winter Universitätsverlag, Heidelberg 1959, S. 357. 4 Ebd. Wesens, überschaut, um dann erst, vom Vorverständnis des umfassenden Entwurfs her, sich rückwirkend der Gliederung des Details zu versichern.”5 Damit ist die “phänomenologische Leistung des Aristoteles” deutlich umschrieben: Sie besteht darin, die “eminente Kraft der Realitätsbewältigung, die in der universalen ontologischen Konzeption Platons gespeichert ist”, “für die differenzierende und individualisierende Durchdringung der empirischen Wirklichkeit” freizusetzen.6 Sie erschöpft sich also darin, die großen Scheine einer halb erkannten, halb nur erahnten Metaphysik, die nunmehr Platon und seiner Schule zugeschrieben wird, sozusagen in ethisches Kleingeld eingewechselt zu haben. Es sollen im folgenden einige Überlegungen dargelegt werden, die diese Bestimmung des Verhältnisses von Platon und Aristoteles, sowie überhaupt die Idee einer ‘Phänomenologie von oben’, in Frage stellen. Es geht dabei keineswegs einfach um eine Ehrenrettung von Aristoteles, obgleich sie auch nicht ganz unnötig wäre, da die Aristotelische Lehre von der Mitte bei Krämer offenkundig zu kurz kommt. Es heißt ja an einer Stelle von Arete bei Platon und Aristoteles zusammenfassend: “Weder die philosophische Thematisierung noch die anthropologische Anwendung noch auch die prinzipielle Differenzierung der normativen Mitte ist eigentlich aristotelisch.”7 Gleichwohl kommt es mir an dieser Stelle eher darauf an, bei Aristoteles einen phänomenologischen Zugangsweg zur Ethik herauszustellen, der sich keineswegs als eine Fortsetzung oder Anwendung der platonischen Metaphysik der normativen Mitte verstehen läßt, vielmehr einen entscheidenden Bruch mit dieser Metaphysik voraussetzt. 1. Der Zusammenhang von Ordnung und Mitte bei Platon und Aristoteles Das Hauptergebnis von Krämers groß angelegter Platon‐Deutung soll im folgenden allerdings nicht angetastet werden. Daß den Dialogen Platons die gleiche Prinzipienlehre zugrunde liegt, die in seiner sogenannten ungeschriebenen Lehre, das heißt in seinen mündlichen Vorträgen über das Gute dargelegt und erörtert wurde, ist eine fruchtbare Hypothese, die sich jedoch in Ermangelung weiterer Quellen nur bis zu einem gewissen Grad erhärten läßt. Das eigentliche Verdienst von Krämers Dissertation besteht aber wohl eher darin, im Ausgang von dieser Prinzipienlehre, die kaum je anders als eben nur umrißhaft nachzuzeichnen sein wird, eine neue Auslegung von den Dialogen selbst vorgelegt zu haben. Es wird im Buch Arete bei Platon und Aristoteles bekanntlich gezeigt, wie sich die Frage nach der Vorzüglichkeit der Dinge und der Trefflichkeit des Menschen durch das ganze geschriebene Werk Platons hindurchzieht; wie dabei im Frühwerk die Areté vornehmlich als Ordnung, als Taxis und Kosmos, gesehen wird8; wie sich dazu im Spätwerk die nähere Bestimmung der Areté als eines Metrion und Meson, als eines Maßvollen und Mittleren zwischen zwei Äußersten, gesellt9; wie schließlich dabei die richtige Mitte immer mehr “den Charakter eines Weltprinzips”10 annimmt. An all dem soll hier nicht gerüttelt werden. Wir können vielmehr davon ausgehen, daß Platon tatsächlich so etwas wie eine Metaphysik der richtigen Mitte entwickelt hat. 5 A. a. O., S. 357 f. 6 A. a. O., S. 358. 7 A. a. O., S. 361. 8 A. a. O., S. 67–70 (zu Gorg. 506 C–507 C). 9 A. a. O., S. 159–163 (zu Politikos, 283 C–285 C). 10 A. a. O., S. 241. 2 Es soll gleichfalls zugegeben werden, daß sich Aristoteles dem Einfluß dieser platonischen Lehre nicht einmal in der Nikomachischen Ethik ganz entziehen kann. Daß in diesem Werk tatsächlich manche ‘Bruchstücke zertrümmerter Metaphysik’, um diesen schon herangezogenen Ausdruck Krämers zu gebrauchen, zu finden sind, steht außer Zweifel. Es genügt hier wohl, diese Behauptung durch zwei besonders bedeutungsvolle Beispiele zu belegen. Erstens behauptet Aristoteles in seiner Betrachtung über die Selbstliebe im neunten Buch der Nikomachischen Ethik, daß der Noûs das wahre Selbst des Menschen sei und daß einzig und allein das auf dieses wahre Selbst hin angelegte Leben die Bewahrung der inneren Ordnung durch die ethische Trefflichkeit, also durch die richtige Mitte, erzielen kann. Bereits die englischen Kommentatoren (namentlich Burnet und Ross) haben erkannt, daß es sich dabei um einen platonischen Grundgedanken handelt. Krämer kann aber hinzufügen, daß hier die “Summe aller einzelnen Mitten […] die Ordnung des Ganzen [verbürgt]” und eben deshalb die richtige Mitte, genauso wie bei Platon selbst, sich “als Element und Grund aller Ordnung” erweist.11 Damit bestimmt er näher, um welchen platonischen Gedanken es dabei geht. Nicht weniger bedeutsam ist das zweite Beispiel. Am Anfang und am Ende der Nikomachischen Ethik weist Aristoteles der Staatskunst im allgemeinen und der Gesetzgebung im besonderen die Aufgabe zu, Areté zu bewirken. Es ist längst erkannt worden, daß in dieser engen Verbindung von Ethik und Politik platonische Einflüsse zum Ausdruck kommen. Es läßt sich aber im Ausgang von Krämers Betrachtungen wieder einmal bestimmter und gezielter behaupten, daß Aristoteles auch an diesen Stellen nur den platonischen Gedanken von der richtigen Mitte als dem Element und Grund aller Ordnung weiterführt. Der einzig wichtige Unterschied zwischen den beiden Beispielen ergibt sich daraus, daß es sich im ersten Falle um die Ordnung der Seele, im zweiten um die Ordnung des Staates handelt. In beiden Fällen wird aber die richtige Mitte als das Prinzip der jeweils ins Auge gefaßten Ordnung bestimmt. Krämer, der das Grundanliegen der platonischen Metaphysik gerade darin sieht, diesen Zusammenhang zwischen Ordnung und Mitte herauszustellen, kann eben deshalb behaupten, daß hier auf “die Kontinuität der Lehre von der richtigen Mitte von Platon zu Aristoteles […] ein bemerkenswertes Licht [fällt]”.12 Allerdings werden dabei auch die tatsächlichen Unterschiede zwischen Platon und Aristoteles deutlich. Ein erster Unterschied springt sogleich ins Auge. Er besteht darin, daß Ethik und Politik bei Aristoteles – trotz dem grundsätzlichen Festhalten an ihrer platonischen Verbindung – in zwei verschiedene “Pragmatien” zerfallen. Ein anderer, vielleicht noch tieferer Unterschied darf gleichfalls nicht unbeachtet bleiben. Krämer sagt: Die Normenlehre Platons “greift über die ethikè areté hinaus und bezieht die physis selber, die Aristoteles ausklammert, mit voll ein.”13 Er zieht daraus die Schlußfolgerung, daß die Bestimmung der Arete als mesótes bei Aristoteles “eine gewichtige Verengung [erfährt]”.14 Gegen dieses Urteil erheben sich jedoch ernsthafte Bedenken. Denn alles weist darauf hin, daß das irreführende Wort ‘Verengung’ ungeeignet ist, das wahre Verhältnis von Platon und Aristoteles zu erfassen. 11 A. a. O., S. 363. 12 A. a. O., S. 171. 13 Ebd. 14 Ebd. 3 2. Die aristotelische Kritik an der platonischen Idee des Guten Alles kommt hier darauf an, der aristotelischen Kritik an der platonischen Idee des Guten das ihr gebührende Gewicht zurückzugeben. Denn Krämer schwächt diese Kritik ab, indem er in ihr nicht einmal eine Abtrünnigkeit, sondern eher nur ein Zeichen der Erschlaffung der Kräfte, ein unwillkürliches Zurückbleiben hinter der einmaligen Wirklichkeitsbewältigung Platons sieht. Er sagt: “[…] der entscheidende geschichtliche Ansatz Platons, das Werthafte, die Arete […] als das Seiende zu denken und als Seiendes in ihrem wesenhaften Bestand auf den Seinsgrund als das Maß, die Norm aller Dinge zurückzuführen, tritt […] bei Aristoteles in den Hintergrund. Hier liegt die tiefere Ursache für die Aussonderung der normhaft‐ praktischen Wissenschaften aus der Ontologie, das Hauptbeispiel der Pragmatientrennung. Die Divergenz von Sein und Wert, Ontologie und Normenlehre, Theorie und Praxis ergibt sich konsequent aus einem Ansatz, der die Totalität des Seienden nicht mehr, wie bei Platon und den Früheren, radikal aus der Einheit des Ursprungs heraus zu denken versucht.”15 Tatsächlich versucht Aristoteles im Gegensatz zu Platon keineswegs, das Seiende ‘auf den Seinsgrund als das Maß, die Norm aller Dinge’ zurückzuführen. Es liegt ihm fern, eine Prinzipienlehre, die, wie Krämer sagt, “Seiendheit, Arete und Wahrheit im Eins‐sein und zuletzt im Einen Grunde [zu] gründen”16 und einheitlich als das Gute17 zu bestimmen sucht, auch nur anzustreben. Seine Ablehnung dieser Prinzipienlehre stützt sich aber, wie es aus dem vierten Kapitel des ersten Buches der Nikomachischen Ethik hervorgeht, auf Einsichten, die sich keineswegs ohne weiteres vom Tisch abstreifen lassen. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um zwei Einsichten. Erstens stellt Aristoteles fest, daß das Wort ‘Gutes’ – ebenso wie das Wort ‘Seiendes’ – in verschiedenen Bedeutungen gebraucht wird, die zwar alle auf eine erste Bedeutung zurückweisen, ohne sich jedoch auf sie zurückführen und miteinander in einem Begriff vereinigen zu lassen. Es ist nicht schwer, in diesem Gedanken die Grundeinsicht der aristotelischen Ontologie, das pollachôs légetai tò óv, zu erkennen. Aristoteles geht in der Nikomachischen Ethik so weit, das Gute und das Seiende in eine strenge Analogie miteinander zu stellen. Es heißt: “Nachdem »gut« in ebensoviel Bedeutungen ausgesagt wird wie »ist« – es wird in der Kategorie der Substanz ausgesagt, z. B. von Gott und der Vernunft, in der Kategorie der Qualität, z. B. von ethischen Vorzügen, in der Kategorie der Quantität, z. B. vom richtigen Maß, in der Relation, z. B. vom Nützlichen, in der Zeit, z. B. vom richtigen Augenblick, in der Kategorie des Ortes, z. B. vom gesunden Aufenthalt usw. – kann »gut« unmöglich etwas Übergreifend‐allgemeines und nur Eines sein.” (EN, 1096 a 23–29.) Die erste Einsicht läßt sich demnach folgendermaßen zusammenfassen: “»Das Gut« als etwas Gemeinsames im Sinne einer einzigen »Idee« gibt es also nicht.” (EN, 1006 b 25–26.) Dazu kommt die zweite Einsicht, die nicht aus der Ontologie stammt, sondern bereits eindeutig ethisch orientiert ist: “[…] selbst wenn es »das Gut« gäbe, das eines ist und in übergreifender Weise ausgesagt wird oder das getrennt und an sich existierte” – heißt es in der Nikomachischen Ethik –, “so ist es klar, daß ein solches »Gut« 15 A. a. O., S. 565. 16 Ebd. 17 Vgl. Philebos, 64 E–65 A: Bestimmung der Idee des Guten durch die drei Ideen von Alétheia (Wahrheit oder auch Seiendheit), Symmetria (Arete) und Kallos (Schönheit). 4 durch menschliches Handeln nicht verwirklicht und auch nicht erreicht werden könnte. Nun ist es aber gerade ein solches Gut, das wir suchen.” (EN, 1006 a 32–35.) Gadamer hat bereits in seinem frühen Platon‐Buch, das in seinem zweiten Teil selbst dem Platonischen Philebos, diesem von der metaphysischen Prinzipienlehre durchdrungenen Dialog, eine phänomenologische Interpretation abzugewinnen vermochte, mit Recht festgestellt, daß die eigentliche Geschichte der europäischen Ethik mit dieser Abkehr des Aristoteles von der Idee des Guten beginnt. Diese Abkehr vom Allgemeinen läßt nämlich das Eigentümliche der ‘normhaft‐praktischen Wissenschaften’, um mit Krämer zu reden, überhaupt erst hervortreten. Denn dieses Eigentümliche besteht, wie Aristoteles oft – und auch an der soeben herangezogenen Stelle – darauf hinweist, in der Erfassung des Einzelnen, Einmaligen, des konkreten Falles (vgl. EN, 1007 a 14: kath’hekaston). Gadamer sagt erläuternd: “Die Fragen nach dem Guten im Tun und Sein des Menschen findet das menschliche Dasein jeweils schon vor konkrete Aufgaben gestellt vor, innerhalb deren das, was jeweils das Gute ist, zu wählen ist. Nicht aus einer allgemeinen Idee des Guten (selbst wenn es sie gäbe) ist diese konkrete Frage zu beantworten. Sofern das Handeln des Menschen immer im konkreten Jetzt einer Situation steht, ist freilich die Wahl des jeweils Guten überhaupt nicht durch eine (notwendig auf allgemeine und sich gleichbleibende Seinsverhältnisse beschränkte) Wissenschaft dem Handelnden abzunehmen.”18 Das ‘Hauptbeispiel der Pragmatientrennung’, nämlich ‘die Aussonderung der normhaft‐ praktischen Wissenschaften aus der Ontologie’, begründet sich also durch echte aristotelische Einsichten. Ja, man kann sogar behaupten, daß es sich dabei um Einsichten ersten Ranges handelt, um Einsichten, denen eine geradezu stiftende Rolle im Aufbau der jeweiligen Disziplinen zukommt. Allerdings führen diese Grundeinsichten sowohl in der Ontologie als auch in den normhaft‐ praktischen Wissenschaften zu beinahe – oder nicht einmal beinahe, sondern ganz und gar – unüberwindlichen Schwierigkeiten. Daß die Einheitlichkeit der Aristotelischen Wissenschaft vom Sein bis ins Letzte hinein problematisch bleibt, wurde besonders deutlich von P. Aubenque in seinem großartigen Buch über die Aristotelische Ontologie und Theologie gezeigt.19 Mit den ‘normhaft‐praktischen Wissenschaften’ hat es eine ähnliche Bewandtnis. Das Problematische an diesen ‘Wissenschaften’ – in Anführungszeichen – geht bereits daraus hervor, daß sie einen notwendigen Bezug auf den jeweiligen Einzelfall haben. Aristoteles ist ja – übereinstimmend mit Platon – der Ansicht, daß es keine Wissenschaft vom Einzelnen gibt. Aber auch darüber hinaus scheint die Situationsbedingtheit alles Praktischen das Normhafte der Wahl des jeweils Guten von vornherein in Frage zu stellen. Diese letztere Problematik steht im Mittelpunkt des Kommentars von Franz Dirlmeier zur Nikomachischen Ethik. Es ist lehrreich, auf seine Betrachtungen in diesem Zusammenhang kurz einzugehen. 18 H.‐G. Gadamer, Platos dialektische Ethik, in: Gesammelte Werke, J. C. B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen 1985, Bd. 5, S. 157. 19 P. Aubenque, Le problème de l’être chez Aristote, P. U. F., Paris 21991 (11962). 5 3. Normativität und Normalität bei Aristoteles Dirlmeier exponiert das Grundproblem auf folgende Weise: “Keine Ethik kann ohne die Präzisierung einer Norm auskommen. Die transzendente Idee schied für Aristoteles, wie wir sahen, aus. Was trat an die Stelle?”20 Er beantwortet diese Frage, indem er auf die Aristotelische Figur des spoudaîos anér verweist – ein Ausdruck, den er im Deutschen durch die etwas umständliche und bieder‐schwerfällige Formel ‘vollendeter Repräsentant alles Edlen’ umschreibt. Er fügt hinzu: “Für uns ist die Grenze zwischen dem Satz des Protagoras »Der Mensch ist das Maß aller Dinge« […] und der Erhebung des höchstwertigen Menschen zur ethischen Norm erschreckend schmal. [Denn] für uns ist die Frage unabweisbar, an welcher Norm zu entscheiden wäre, wer ein solch hochwertiger Mensch ist.”21 Aristoteles gibt aber kaum Anhaltspunkte zur Entscheidung dieser Frage. “So werden wir uns” – zieht Dirlmeier die Schlußfolgerung aus seinen Betrachtungen – “zunächst mit der Antwort begnügen: letzte Norm sind für Aristoteles in der Nikomachischen Ethik die edelsten Traditionen seines Volks.”22 Das dabei verwendete Wörtchen ‘zunächst’ verspricht allerdings weitere Überlegungen. Tatsächlich findet man in Dirlmeiers Kommentar eine ganze Reihe von Anmerkungen zu diesem Grundproblem, die nicht so sehr einen einheitlichen Gedankengang bilden, als vielmehr Bruchstücke eines fortgesetzten, ja unausgesetzten Brütens und Nachsinnens darstellen. Man verfolgt jedoch vergebens den Leitfaden dieser zusammengehörigen Anmerkungen bis zum Ende, man kann auch aus der letzten Einzelerörterung noch immer nur dieselbe Lehre ziehen wie aus der ersten: Bei Aristoteles wird das Problem der Norm nicht gelöst, vielmehr wird bei ihm die Normativität durch Normalität ersetzt. An einer Stelle sagt Dirlmeier: “Es gab für Aristoteles gar keine andere Möglichkeit, nachdem das [platonische] Eidos gefallen war, der Ethik ein Fundament zu geben[,] als Natur und hellenische Tradition, Physis […] und Nomos.”23 Dirlmeier läßt keinen Zweifel darüber aufkommen, welche Möglichkeit Aristoteles nach ihm gewählt hat: Wiederholt hebt er hervor, wie Aristoteles “auf den paradeigmatischen Schatz der Überlieferung seines Volkes [verweist]”.24 Edle Tradition, paradeigmatische Überlieferung: all das läuft auf Nomos, Konvention, also auf Bräuche und Sitten hinaus, die eine praktische Normalität umschreiben, ohne eine ethische Normativität begründen zu können. Daran ändert selbst der Begriff des berühmten orthòs lógos nichts, der von Aristoteles selbst in die Definition der ethischen Trefflichkeit aufgenommen wird und mit der zunächst die Regel richtigen Handelns, also gerade so etwas wie die gesuchte Norm, gemeint zu sein scheint. Denn wie kommt dieser Begriff in der erwähnten Definition vor? Bekanntlich bestimmt Aristoteles die sittliche Werthaftigkeit (Areté) als “eine feste, auf Entscheidung hingeordnete Haltung”; dann setzt er hinzu: “sie liegt in jener Mitte, die die Mitte in bezug auf uns ist”; schließlich kommt er noch einmal auf diese Mitte zurück, um deutlich zu machen, daß sie durch denjenigen lógos festgelegt ist, mit dessen Hilfe der Einsichtige sie festlegen würde”. (EN, 1106 b 36–1107 a 1–2.) Hier finden wir wieder einmal einen Hinweis 20 Aristoteles, Nikomachische Ethik, übersetzt und kommentiert von F. Dirlmeier, Akademie‐Verlag, Berlin 1979, S. 284 (zu 18, 1) . 21 Ebd. 22 Ebd. 23 A. a. O., S. 568 (zu 217, 1). 24 A. a. O., S. 312 (zu 37, 2). 6 auf eine Menschenfigur. Diesmal handelt es sich jedoch nicht mehr einfach um den Hochwertigen (spoudaîos), sondern um den Einsichtigen (phrónimos). Aus den angeführten Worten erhellt aber sogleich, daß die Bestimmung der richtigen Mitte ganz dem Einsichtigen anheimfällt. Er allein bestimmt den orthòs lógos; er allein legt mithin die richtige Mitte fest; er allein stellt also die Norm dar, wenn hier überhaupt noch von Norm die Rede sein kann. Vermag aber der Phronimos, der einst bei Platon noch auf das Eidos, die Idee des Guten, hinschauen (apoblépein) konnte, ohne diesen Hin‐Blick der Bestimmung der Mitte die Richtigkeit zu gewährleisten? Statt ausdrücklich zu antworten, spricht Dirlmeier von einer “uns erschreckenden Basierung der ganzen Welt der ήθη auf den Einsichtigen”.25 Andernorts setzt er erläuternd hinzu: “Klammern wir das [platonische] Eidos aus, so sagt also Aristoteles: man muß hinhören auf jene Erfahrenen, die »einsichtig« geworden sind.”26 Uns kann dieser Hinweis auf die Erfahrung der Einsichtigen – meint Dirlmeier – gewiß nicht befriedigen, wohl aber den Aristoteles, und zwar deshalb, weil in der Erfahrung, die er im Auge hat, “die Sicherheit griechischer Lebensbewältigung steckt”.27 Dieser Standpunkt ist für eine bestimmte Aristoteles‐Rezeption in Deutschland bezeichnend. Nicht einmal Gadamer kann sich dem Einfluß einer derartigen Sichtweise entziehen, wenn er in seinem Aufsatz “Über die Möglichkeit einer philosophischen Ethik” das von Aristoteles dargestellte ‘ethische Sein’ dem moralischen Bewußtsein Kants gegenüberstellt. In Wahrheit fordert aber Dirlmeier mit seiner Auffasung von der ethischen Norm bei Aristoteles den Widerspruch gegen sich geradezu heraus. Der erste Einwand, der einem einfällt, wenn man seinen Standpunkt näher bedenkt, ist, daß er das Fehlen einer allgemeinen Regel für das Fehlen einer richtigen Regel nimmt. In der Tat stellt Aristoteles keine allgemeine Regel zur Bestimmung der richtigen Mitte auf. Es handelt sich ja bei ihm um diejenige Mitte, die ‘die Mitte in bezug auf uns’ ist. Doch hält Aristoteles daran fest, daß der Einzelne die für ihn maßgebende Mitte auf die einzig richtige Weise zu bestimmen hat. Eben deshalb betrachtet er die sittliche Vortrefflichkeit nicht nur als eine Mitte zwischen zwei Extremen (‘Mesótēs’), sondern er beschreibt sie bekanntlich zugleich als einen Gipfel (‘Akrótēs’), der “nach Wert und gültiger Leistung” (katà to áriston kaì tò eû) unübersteigbar bleibt. In Wahrheit ist aber dieser Unterschied zwischen allgemeinem Gesetz und Individualnorm Dirlmeier keineswegs ungeläufig. Nur daß er dabei nicht zu begreifen vermag, wie sich die Lehre von dieser Individualnorm gegen die Gefahr eines protagoreischen Relativismus behaupten kann. An diesem Punkt gewinnt die Kritik, der P. Aubenque die Ansicht Dirlmeiers unterzieht, eine besondere Bedeutung. “Der Fehler von Dirlmeier, der in dieser Hinsicht W. Jaeger zu folgen scheint” – behauptet Aubenque in seinem zweiten Aristoteles‐Buch – “besteht in dem Glauben, die Preisgabe der Ideenlehre habe den Aristoteles jedes objektiven Kriteriums, jedes Anhaltspunkts in der nunmehr dem Zufall ausgelieferten Welt […] beraubt.”28 Anders gewendet, besagt dieser zweite Einwand, daß Aristoteles mißdeutet wird, wenn man seine Ablehnung der Ideenweisheit als einen Verzicht auf jeden Vernunftgrund ethischer Haltung 25 A. a. O., S. 311 (zu 37, 2). 26 A. a. O., S. 467 (zu 136, 4). 27 A. a. O., S. 441 (zu 122, 2). 28 P. Aubenque, La prudence chez Aristote, P. U. F., Paris 21997 (11963), S. 49. 7 versteht.29 Aubenque versucht in der Tat zu zeigen, daß Aristoteles den sokratisch‐platonischen Intellektualismus in der Ethik keineswegs kurzerhand verwirft, sondern eher durch eine neue Gestalt von Intellektualismus zu ersetzen sucht. Es ist kaum überraschend, wenn für diese neue Gestalt in einem französischen Buch, das zum ersten Mal im Jahre 1963 erscheint, der Ausdruck ‘intellectualisme existentiel’ geprägt wird.30 Mir scheint jedoch, daß man hier mit ebensoviel Recht ganz einfach von Phänomenologie sprechen könnte – zumindest wenn man unter Phänomenologie nicht so sehr eine Lehre von Bewußtseinserlebnissen als vielmehr eine Lehre von Erfahrungseinsichten versteht. 4. Erfahrungseinsicht als ethischer Maßstab Man kennt die bedeutsame Stelle aus dem sechsten Buch der Nikomachischen Ethik, an der Aristoteles behauptet, daß die Vernunft (Noûs) “auf das Letztgegebene in beiden Richtungen bezogen” ist: auf “die obersten Begrifflichkeiten sowohl wie [auf] die letzten Einzelgegebenheiten”; “im Rahmen des wissenschaftlichen Beweisverfahrens erfaßt [sie] die unveränderlichen und obersten »Grenzmarken«, während [sie], im Gebiete des Handelns sich entfaltend, das letztlich Einzelgegebene, Veränderliche und den Untersatz erfaßt.” (NE, 1143 a 35–1143 b 3). Hier wird das Festhalten an einem Vernunftgrund ethischen Handelns ebensosehr deutlich wie die Unterscheidung zwischen zwei Formen von Vernunft. Es ist schon merkwürdig, daß Aristoteles an dieser Stelle das Wort ‘Vernunft’ in diesen zwei ungleichartigen Bedeutungen gebraucht; sonst behält er es zur Bezeichnung der Erfassung oberster Grundsätze vor. An einer Stelle behauptet er von der praktischen Einsicht, daß sie im Gegensatz zur Vernunft steht: antíkeitai […] dēè tô nô (NE, 1142 a 25.) Hier will er aber betonen, daß die Wahrnehmung der letzten Einzelgegebenheiten ihre eigene Vernünftigkeit hat. Es handelt sich dabei allerdings um eine völlig eigenartige Vernünftigkeit, die nichts mit dem wissenschaftlichen Beweisverfahren zu tun hat, weil sie sich immer auf den Einzelfall bezieht, von dem es ja nach Aristoteles gerade keine Wissenschaft gibt. Man sagt von dieser eigentümlichen Vernünftigkeit zu wenig, wenn man sie einfach als praktische Einsicht der Ideenweisheit Platons gegenüberstellt. Es ist gewiß wahr, daß der Terminus ‘Phronesis’ im Übergang von Platon zu Aristoteles einen tiefen Bedeutungswandel erfährt, der dazu führt, daß die praktische Einsicht bei Aristoteles nicht mehr mit dem obersten Eidos, der Idee des Guten, sondern nur noch mit den letzten Einzelgegebenheiten zu tun hat. Es ist aber nicht weniger wahr, daß die normgebende Rolle dieses Restbegriffs von Phronesis keineswegs von vornherein einleuchtend ist. Hier bedarf es offenbar weiterer Erläuterungen. Die Fortsetzung der angeführten Textpassage gibt uns dazu einen Wink. Hier stellt sich heraus, daß die “Erfahrenen” die “einsichtigen Männer” sind, auf deren Aussprüche und Anschauungen wir, wie es heißt, genau so hören sollen wie auf Beweise, selbst wenn sie ohne Beweis vorgetragen werden. Denn weil diese Männer – setzt Aristoteles hinzu auf das Platonische ómma tēês psychēês (‘Auge der Seele’, Rep. 533 d 2; 518 b 6–519 a 6) anspielend – “durch ihre Erfahrung ein Auge bekommen haben, sehen sie 29 Ebd.: “[…] il s’agit encore et toujours, quoique sous une nouvelle forme, d’un fondement intellectuel.” 30 Ebd. 8 die Dinge richtig”: dià gàr tò échein ek tēês empeirías ómma horôsin orthôs. (EN, 1143 b 11– 14.) Aus dem Platonischen Auge der Seele, die auf die höchste Idee hinschaut, wird also bei Aristoteles ein Auge, das einzig und allein durch die Erfahrung geschärft wird. An dieser Veränderung läßt sich der Abstand ermessen, der die beiden Denker voneinander trennt. In der Nikomachischen Ethik erwächst die normstiftende Kraft der praktischen Einsicht aus der Erfahrung des Einsichtigen. Diese maßbestimmende Rolle der Erfahrung bei Aristoteles deutlich gemacht zu haben, ist ein Verdienst von P. Aubenque. Er versammelt in seinem zweiten Aristoteles‐Buch die spärlichen Stellen aus der Nikomachischen Ethik, an denen Aristoteles einen Einblick in diese grundlegende Funktion der Erfahrung gewährt, und weist zugleich darauf hin, daß mit ‘Erfahrung’ hier zwar eine Art von Erkenntnis, aber keineswegs eine Vorstufe von Wissenschaft gemeint ist: Es handelt sich dabei – betont er – “eher um ein erlebtes als ein erlerntes Wissen”, und er setzt hinzu: ein derartiges Wissen “erkennen wir denen zu, die wir als als »die Erfahrenen« bezeichnen”.31 Erfahrung in diesem Sinne des Wortes beruht keineswegs bloß auf “einer unbestimmt‐unendlichen Wiederholung des Einzelfalles”.32 Sie geht also keineswegs aus einer bloßen Verallgemeinerung und Zusammenfassung hervor. Ähnlich wie das wissenschaftliche Wissen, ist sie durch eine gewisse Beständigkeit gekennzeichnet; aber ihre Beständigkeit ist anderer Natur als die des wissenschaftlichen Wissens. Sie schlägt sich als eine Haltung nieder. Diese Haltung ist nichts anderes als was wir ‘Erfahrenheit’ nennen. Aubenque hebt hervor, daß der Erfahrung im Sinne dieser Erfahrenheit die allgemeine Mitteilbarkeit abgeht; zugleich verweist er aber darauf, daß dieser Mangel an allgemeiner Mittelbarkeit “nur die Kehrseite unersetzlicher Einzigkeit” ist: “jeder Einzelne hat sich ja” die Erfahrung in diesem Sinne des Wortes “in Geduld und Arbeit zu erwerben”.33 Man versteht jetzt, warum Aubenque von einem ‘existentiellen Intellektualismus’ gesprochen hat. Tatsächlich deutet er die Erfahrung in der Nikomachischen Ethik als eine Grundhaltung, die das Leben, die Existenz, das ganze Dasein des Menschen bestimmt. Man könnte sagen, daß die aristotelische ‘Phronesis’ in seiner Interpretation nichts anderes als die Trefflichkeit oder Vorzugsstufe dieser existentiellen Grundhaltung ist. Wir können aber einen Schritt weitergehen, wenn wir beachten, daß der praktischen Einsicht bei Aristoteles nicht nur diese Bedeutung einer Grundhaltung zukommt, sondern daß sie in einem anderen Sinne auch als eine “Wahrnehmung” (NE, 1143 b 5; vgl. 1142 a 23– 30) und gleichfalls als eine “zutreffende Erfassung” (NE, 1142 b 34) beschrieben wird. In diesem zweiten Sinne des Wortes ist die Einsicht im Handeln ein Akt und nicht eine Haltung – sie ist, richtiger noch, ein Ereignis. Wir müssen auch dieses Ereignis berücksichtigen, um die Eigenart der Erfahrung, die Aristoteles hier im Auge hat, noch deutlicher hervortreten zu lassen. Damit gehen wir von einer existenzialphilosophischen Interpretation zu einer phänomenologischen über. Die Phänomenologie aber, die uns dabei entgegentritt, ist keineswegs eine ‘Phänomenologie von oben’ im Sinne H. J. Krämers. Es soll vielmehr gezeigt werden, wie Aristoteles im Ausgang von der Erfahrung, also gleichsam von unten auf, dazu kommt, einen ethischen Maßstab zu begründen. 31 A. a. O., S. 59. 32 Ebd. 33 Ebd. 9 Der Ausgangspunkt unserer phänomenologischen Interpretation besteht darin, die aristotelische Phronesis als eine Erfahrungseinsicht zu begreifen. Dieser Einsicht fällt im Handeln bekanntlich die Rolle zu, der Entscheidung die Richtigkeit zu gewährleisten, und zwar “in Hinsicht auf das, was zu dem Ziele führt”. (NE, 1142 b 32–33.) Deshalb hat Aristoteles an einer schon herangezogenen Stelle gesagt, die Einsicht im Handeln bestimme den Untersatz des praktischen Syllogismos, während der Obersatz, der dem Handeln das Ziel setzt, durch die ethischen Trefflichkeiten vorgegeben sei. Es ist aber eine alte Beobachtung – die besonders von Gadamer geltend gemacht wird –, daß die Rolle der praktischen Einsicht bei Aristoteles doch nicht damit erschöpft ist, die Mittel zu einem vorgegebenen Zweck zu bestimmen. Es wird ihr darüber hinaus die Aufgabe zugewiesen, den Zweck selbst auf den Einzelfall zu beziehen. Es ist zwar für den Tapferen kennzeichnend, sich im geeigneten Fall für die Tapferkeit zu entscheiden und dabei die Tapferkeit um ihrer selbst willen zu wählen. Was es aber im jeweiligen Einzelfall heißt, tapfer zu sein, wird durch die praktische Einsicht bestimmt. Sie allein vermag den Sinn richtig zu erfassen, den das ethische Ziel im Einzelfall annimmt. Das ist einerseits deshalb so, weil jeder Einzelfall einmalige Züge aufweist, die sich, wie Aristoteles nicht müde wird zu betonen, durch allgemeine Feststellungen nur umrißhaft vorwegnehmen lassen; andererseits aber auch deshalb, weil das ethische Ziel von jedem Einzelnen verlangt, eine Mitte zu treffen, die ihm selbst eigentümlich ist. Für beides muß man ein geschärftes ‘Auge’ haben, das einem nie anders als auf Grund je eigener Erfahrungen zuteil wird. Jede zutreffende Erfassung eines Einzelfalles der Handlung ist dabei ein eigenes Ereignis, das einen neuen Sinn schon bekannter Vorzüglichkeiten zugänglich macht, ja, gelegentlich auch neue Vorzüglichkeiten erblicken läßt, für die in der Umgangssprache selbst noch die Namen fehlen. Dieses Ereignis bestimmt die erste Bedeutung des Wortes ‘Phronesis’ bei Aristoteles; es verweist auf die Entstehung einer neuer Einsicht, die aus einer einmaligen Erfahrung erwächst. Diese Einsicht stiftet aber zugleich eine Grundhaltung der Erfahrenheit, die mit den ethischen Vorzüglichkeiten, wie Aristoteles es am Ende des sechsten Buches der Nikomachischen Ethik zeigt, zur Einheit verwachsen kann. Daraus versteht man, wie irreführend es ist, wenn man sich in der Deutung der aristotelischen Lehre von den Trefflichkeiten des Charakters nur an die berühmte etymologische Ableitung des θος vom έθος hält. Die Gewohnheiten, die Bräuche, die Sitten bestimmen nichts mehr als die Ausgangslage des Einzelnen, der sich auf einen je eigenen Erfahrungsweg begibt. Deshalb sind Jünglinge als Hörer ethischer Vorträge selbst dann nicht geeignet, wenn sie unter guten Sitten aufgewachsen sind. Denn sie haben “noch keine Erfahrung im wirklichen Leben”. (EN, 1095 a 2.) Diese Überlegungen lassen das Verhältnis von Normalität und Normativität in neuem Licht erscheinen. Unstreitig bleibt die Normalität des Hochwertigen bei Aristoteles vorausgesetzt. Doch ist diese Normalität für den Einsichtigen nicht so sehr ein Grund und Boden als vielmehr nur ein Sprungbrett. Der Einzelne sieht sich auf seinem Erfahrungsweg dazu gezwungen, von dieser Normalität immer wieder abzuweichen. Die Abweichungen sind aber keine bloßen Anomalien. Sie sind – zumindest in manchen Fällen – durch Erfahrungseinsichten vorgezeichnet. Dabei sind diese Vorzeichnungen nicht beliebig, denn sie gründen sich auf eine Grundhaltung der Erfahrenheit, die sich auf einem Erfahrungsweg im Regelfall immer mehr verfestigt. Diese Grundhaltung schreibt dem Einzelnen Handlungsregeln vor, die selbst dann einen Anspruch auf Richtigkeit erheben, wenn sie einzig und allein für ihn bestimmt sind. Der orthòs lógos des Aristoteles ist kein allgemeines 10 Gesetz, aber auch kein willkürlicher Maßstab, den der Einzelne sich nach Belieben zurechtlegt, sondern eine Individualnorm, die sich auf der Probe je eigener Erfahrung bewährt hat. Zwar begründet diese Erfahrung keine allgemeinverbindliche Antwort auf die Frage, wie man leben soll. Dennoch begründet sie ein verbindliches Urteil darüber, ob der Einzelne richtig gewählt hat. Denn die Erfahrungseinsichten, die der Einzelne auf seinem eigenen Weg gewonnen hat, sind grundsätzlich für jeden anderen nachvollziehbar, der bereit ist, den betrachteten Erfahrungsweg Schritt für Schritt zu verfolgen. Wir können aus unseren Betrachtungen eine wichtige Schlußfolgerung ziehen: Es liegt keine Übertreibung in der Behauptung, daß man bei Aristoteles neben Bruchstücken zertrümmerter Metaphysik einen Ansatz – ja, sogar einen weitgehend ausgeführten Ansatz – zu einer phänomenologischen Begründung der Ethik findet. Zum Abschluß soll aber noch darauf hingewiesen werden, daß dieser Ansatz zu einer Schwierigkeit führt, die er allem Anschein nach nicht zu bewältigen vermag. Es handelt sich um eine Schwierigkeit, die mit der Eigenart ethischer Erfahrung zusammenhängt. Aristoteles läßt durchaus deutlich werden, worin diese Eigenart besteht. Einerseits ist die ethische Erfahrung nach ihm nicht bloß ein zunehmendes Vertrautwerden mit den letzten Einzelgegebenheiten der Welt, sondern zugleich ein ständiger Umgang mit dem eigenen Streben und Begehren, mit derjenigen Órexis, von der am Anfang des sechsten Buches der Nikomachischen Ethik am ausführlichsten die Rede ist. Dabei ist hier unter Umgang keineswegs etwa so etwas zu verstehen wie ein kantischer Kampf der Vernunft mit den Neigungen. Im Gegenteil, die Trefflichkeit des Charakters ist bei Aristoteles durch eine Gesinnung getragen, die sich für diese Trefflichkeit um ihrer selbst willen entscheidet, dabei aber ihrem Wesen nach noch immer ein Streben, wenn auch ein “von Überlegung gestreuertes Streben”, bleibt. (EN, 1139 a 23.) Hier erhebt sich die Frage: Woher stammt oder wie kommt das Streben zustande, das dieser Gesinnung der ‘Vorzugswahl’ (prohaíresis) zugrunde liegt? Als Antwort auf diese Frage genügt keineswegs ein Hinweis auf Überlegung und Erfahrungseinsicht. Denn andererseits ist die ethische Erfahrung bei Aristoteles gerade dadurch charakterisiert, daß sie sich von vornherein auf diese Gesinnung der Vorzugswahl stützt. Sonst könnte sie keine Phronesis, sondern nur eine ‘Deinótēs’, keine praktische Einsicht also, sondern nur eine intellektuelle Gewandtheit begründen. So entsteht hier aber ein Zirkel, aus dem, wie es scheint, nicht herauszukommen ist: Streben und Begehren dienen der Gesinnung der Vorzugswahl erst dann zur Grundlage, wenn sie bereits durch zutreffende Überlegung und sittliche Einsicht gestreuert sind; zutreffende Überlegung und sittliche Einsicht erwachsen aber nur dann aus dem Erfahrungsumgang mit dem Streben und Begehren, wenn dieser sich von vornherein auf die Gesinnung der Vorzugswahl stützen kann. Um diesen Zirkel zu durchbrechen, sieht sich Aristoteles dazu gezwungen, sich auf Gewöhnung, Brauch und Sitte zu berufen; ja, er geht so weit, sogar die Gesetzgebung des Staates zu Hilfe zu rufen. Er entfernt sich dadurch erst recht von der platonischen Ideenweisheit, während er an der durch diese Ideenweisheit begründeten Einheit von Ethik und Politik dennoch festhält. Wenig ist jedoch damit gewonnen. Denn die je eigene Erfahrung des Einzelnen läßt sich weder durch die Sitten eines Gemeinwesens noch auch durch die Gesetzgebung eines Staates ersetzen. 11 Diese unbewältigte Schwierigkeit macht auf einen Mangel in der Nikomachischen Ethik aufmerksam: Eine phänomenologische Auseinandersetzung mit dem Streben und Begehren, das die ethische Erfahrung trägt, bleibt in diesem Werk aus. Während wir jedoch die Tatsache dieses Mangels feststellen, dürfen wir eine andere Tatsache keineswegs aus den Augen verlieren: den Umstand nämlich, daß Aristoteles selbst uns die Denkmittel bereitstellt, die dazu erforderlich sind, diesen Mangel nicht nur überhaupt spürbar zu machen, sondern sogar als einen Mangel, aus dem eine Aufgabe für das Denken hervorgeht, begrifflich zu erfassen. 12