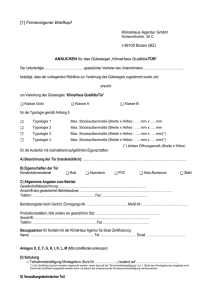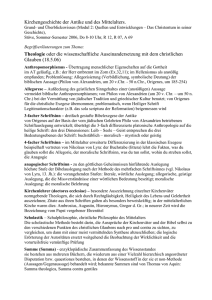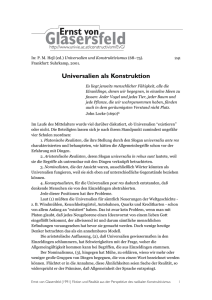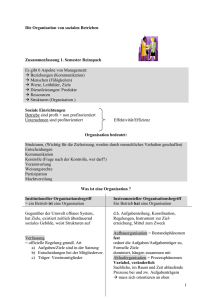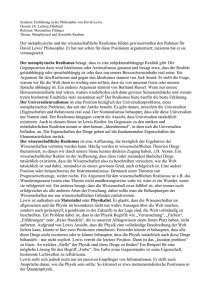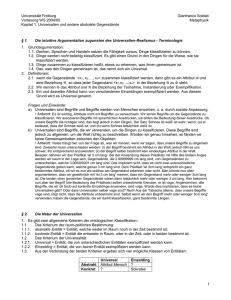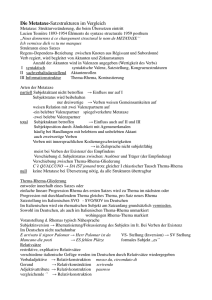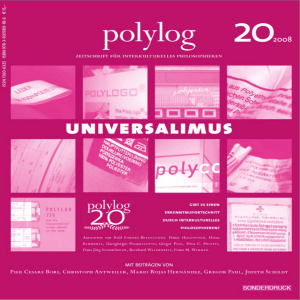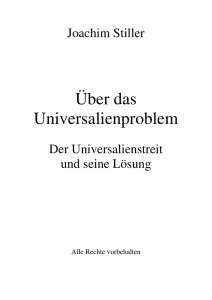Vorlesung: Sprachtypologie und Sprachvergleich
Werbung

Gisela Zifonun Vorlesung: Sprachtypologie und Sprachvergleich Universität Mannheim Sommersemester 2003 Literatur Es gibt zwei gute englischsprachige Übersichtsarbeiten, die ich empfehlen möchte und auf die ich mich in vieler Hinsicht, aber nicht ausschließlich, stütze: Croft, William (1990): Typology and Universals. Cambridge: Cambridge University Press. (Cambridge Textbooks in Linguistics) Whaley, Lindsay J. (1997): Introduction to Typology. The Unity and Diversity of Language. Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage. 1. Einführender Teil Warum eigentlich sprechen wir nicht eine Sprache? Wie Sie wissen, bietet die Bibel uns einen Mythos an, der die Vielzahl menschlicher Sprachen erklärt: die babylonische Sprachverwirrung. Nach 1. Moses 11 war dies die Strafe Gottes für die Hybris des Menschen, die sich in der Absicht einen himmelhohen Turm zu bauen äußerte. Dort heißt es: Zum Zitat auf Folie 1 Nicht nur die "Erfinder" dieses Mythos, auch wir mögen uns, mit unserem anders gelagerten Wissen, mit unserer anders gelagerten Mentalität fragen, warum Menschenstämme, -ethnien, gruppen trotz identischer genetischer Ausstattung, trotz gemeinsamen Ursprungs in den Steppen Afrikas (wie man heute vermutet), trotz gleicher kognitiver Fähigkeiten zu so unterschiedlichen Kommunikationsinstrumenten gelangen. Sicher werden wir keine mythische Erklärung suchen, sondern eher eine "evolutionäre". 2 Dennoch noch einmal zurück zum Mythos: Das Verfügen über eine gemeinsame Sprache erscheint dort als gewaltiges Gut, als (bedrohlicher) Vorteil, Sprachverwirrung (schon an der Bezeichnung ablesbar) als Makel, als Strafe, als Nachteil. Das Thema ‚Sprachverwirrung’, so führt U. Eco in seinem einschlägigen Buch „Die Suche nach der vollkommenen Sprache“ (1994) aus, „und der Versuch, ihr durch Wiederentdeckung oder Erfindung einer allen Menschen gemeinsamen Sprache abzuhelfen, durchzieht die Geschichte aller Kulturen“, nicht nur die jüdisch-christliche Tradition. Sehen wir das auch so? Ist Sprachenvielfalt ein Makel, ein Verderben? (nach: Trabant, Future 2/2000) Und auch in den Zeiten nach dem Mythos wurde immer wieder gefragt, ob es denn gut sei oder schlecht, dass die Menschheit verschiedene Sprachen spricht. Der heilige Stephan, König von Ungarn, schreibt zu Beginn des 11. Jhs., es sei ein armes und bedauernswertes Land, in dem nur eine Sprache gesprochen werde und in dem nur eine Sitte herrsche. Dagegen war es Teil des Gedankenguts der französischen Revolution, dass nur eine gemeinsame Sprache den gleichberechtigten Austausch zumindest in einem Land, einer Nation hinreichend fördere. Nach Kräften drängten sie und in ihrem Gefolge auch andere europäische Machthaber die Mehrsprachigkeit in Frankreich zurück. Vielsprachigkeit Segen und Fluch, lassen wir es dabei. Unser Thema soll im Folgenden ja weder die Entstehung der menschlichen Vielsprachigkeit sein, noch die Versuche, diese zu korrigieren oder zu überwinden. Vielmehr setzen wird als gegeben voraus, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Sprachen gibt, und fragen nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden dieser Sprachen sowie nach den Prinzipien für Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Dies ein erster Versuch zur Gegenstandsbestimmung, die wir weiter präzisieren werden. 1.1. Beispiele: Verschiedenheit auf verschiedenen Sprachebenen Um die Verschiedenheit der menschlichen Sprachen anschaulich zu machen, zeige ich Ihnen einige Beispiele für Sätze aus Sprachen aus ganz verschiedenen Weltecken, die alle dasselbe bedeuten. Sehr beliebtes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das Vaterunser, das in sehr viele Sprachen übersetzt wurde (Bibelübersetzungen gibt es für 2103 Sprachen). Ich werde ein anderes Beispiel wählen, nämlich den Satz ‚mir tut der Kopf weh’/’mein Kopf tut weh’ (Lehmann: dir. und indir. Partizipation, S. 64). Unsere Beispiele [siehe Folie 2] stammen aus folgenden Sprachen: 3 Folie 3 Yukatekisch: ist die Mayasprache der Halbinsel Yukatan im Südosten von Mexiko (Maya, nördliche Amerindsprache) Bété: wird an der Elfenbeinküste gesprochen (Ost-Kru-Sprache, Niger-Kongo) [Tamil: wird in Südindien und Sri Lanka gesprochen (drawidische Sprache)] Türkisch: wird hauptsächlich in der Türkei gesprochen (altaische Sprache) Samoanisch: wird auf Samoa und in Neuseeland gesprochen (ost-austronesische Sprache) Vietnamesisch: wird vor allem in Vietnam gesprochen (austroasiatische Sprache) Schon aus diesen wenigen Beispielen erkennen wir, dass Sprachverschiedenheit sich auf ganz unterschiedliche Ebenen des Sprachsystems beziehen kann: Beginnen wir mit dem, was wir nicht sehen können: Unterschiede im Lautsystem. Das Phoneminventar von Sprachen ist durchaus unterschiedlich. Schon quantitativ: Im Schnitt liegt die Anzahl der Phoneme bei 30, die afrikanischen Khoisansprachen haben mit 141 Phonemen das umfangreichste Inventar überhaupt. In eben diesen Khoisansprachen, die z.B. von den Buschmännern der Kalahari gesprochen werden, gibt es auch Laute, die in anderen Sprachen der Welt nicht (oder nicht mehr) vorkommen: sogenannte Schnalzlaute. (Hörbeispiele im Internet: http://www.zeit.de/2003/14/urlaute) Etwas Derartiges ist bei unseren Beispielsprachen nicht dabei. Aber doch etwas anderes Exotisches, nämlich Töne oder auch Toneme. Drei der hier genannten Sprachen sind sog. Tonsprachen, nämlich Yukatekisch, Bété und Vietnamesisch. In Tonsprachen ist die relative Höhe (Yukatekisch) oder die Tonbewegung, also Veränderungen in der Tonhöhe, eines Sonoranten (Vokals) phonologisch distinktiv. Es macht also einen Unterschied, ob ich z.B. ein [a] ohne Tonhöhenveränderung ausspreche (flach) oder mit steigender Tonkurve, fallender Tonkurve usw. Bekannteste Tonsprache ist das Chinesische (in unserer Gruppe nicht vorhanden). Folie 4a Dort: /mā/ ‚Mutter’, /má/ ‚Hanf’, /mă/ ‚Pferd’, /mà/ ‚schimpfen’ 4 Wie man sieht, werden die Töne/Toneme in der Schrift durch eine Art ‚Akzente’ wiedergegeben. Wir sehen in B78 drei solche Akzente; das Bété besitzt insgesamt vier distinktive Töne; einer fehlt hier also. In B81 sehen wir ebenfalls Akzente, das Vietnamesische hat sogar sechs distinktive Töne. Gehen wir noch kurz auf Unterschiede im segmentalen Bereich ein. Hier nehmen wir das Türkische als Beispiel: Das Türkische hat 8 Vokalphoneme, während beim Dt. ca. 14 Vokalphoneme (strittiger Punkt) angenommen werden. Greifen wir nur einen hervorstechenden Punkt heraus: Das Türkische hat in der Reihe der hohen/geschlossenen Vokale [+hoch] folgende Phoneme: Folie 4b [-hinten], [-rund]: [-hinten], [+rund]: [+hinten], [-rund]: [+hinten], [+rund]: [i] [y] [¨] [u] fehlt im Deutschen Kommen wir zum Sichtbaren, das heißt zum Schriftsystem. Was wir hier vorfinden in unseren Beispielen, sind alles Alphabetschriften, auf der Basis des lateinischen Alphabets. Daneben gibt es ja noch andere Alphabetschriften und ganz andere Schriftsysteme, denken Sie etwa an das Chinesische. Wie Sie sehen, gibt es aber auch in diesem Rahmen Unterschiede. Dies liegt, da Alphabetschriften und Lautsysteme immer (mehr oder weniger eng) zusammenhängen, zum Teil an den unterschiedlichen Lautsystemen. Nehmen wir das Beispiel des Türkischen. eine Umschrift von B79 in die Lautschrift des IPA ergibt: Folie 4c B79 Baş-ım ağr-ıyor. IPA [baS¨m] [ar¨jor] Hier sehen wir: • Für den Laut [¨], den wir im Deutschen nicht kennen, steht ein Buchstabe, den wir nicht kennen <ı>. 5 • Für zwei Laute, die wir im Deutschen sehr wohl kennen, weicht die türkische Schreibung von der deutschen ab: Zum einen geht es um [S], dafür steht ein Graphem, das wir nicht kennen, nämlich <ş>. Wir schreiben dafür die Buchstabenkombination <sch>. Zum anderen steht im Türkischen für den Laut [j] der Buchstabe <y>, wir schreiben <j>. • Eine Besonderheit ist das Graphem <ğ>, das „weiche g“. Lautlich entspricht ihm ein kon- sonantisches Segment, das in der Standardsprache in der Regel heute nicht (mehr) gesprochen wird, aber gewisse phonologische Effekte hat. Kommen wir zur Ebene der Morphologie: Greifen wir Türkisch und Vietnamesisch heraus: Im Türkischen wird für mein (im Deutschen ein selbstständiges Wort), an das Substantiv für Kopf, ein Suffix angehängt, das Possessoraffix der 1. Ps. An das Verb für schmerz(en) wird ein Progressivaffix angehängt (vgl. Englisch), das ausdrückt, dass dieser Zustand gerade andauert. Ein Suffix für die Person fehlt. Das besagt, dass es sich um eine 3. Ps. Sg. handelt; damit wird Person- und Numerus-Kongruenz mit dem Subjekt ausgedrückt, wie im Deutschen, aber auf andere Art. Im Vietnamesischen haben wir keine Affixe. Selbstständige Wörter, freie Morpheme werden hier aneinander gereiht. Die Ebene der Syntax wollen wir mal aussparen. Stattdessen wollen wir einen kurzen Blick auf die semantische Strategie werfen. Beginnen wir mit dem Deutschen. Da haben wir drei Möglichkeiten: Folie 5 a) Ich habe Kopfschmerzen. b) Mein Kopf tut weh. c) Mir tut der Kopf weh. Die Sätze a), b) und c) sind nicht ganz synonym. Dieses Faktum klammern wir mal einen Moment aus. Fall a) zeigt die Strategie, bei der der Mensch in einer HABEN-Relation zu dem Schmerz an einem Körperteil steht. 6 Fall b) zeigt die Strategie, bei der der einem Menschen zugehörige Körperteil als Verursacher von Schmerzempfindungen charakterisiert wird. Fall c) zeigt die von Fall b) minimal verschiedene Strategie, bei der der Körperteil so charakterisiert wird, dass er dem Menschen Schmerzempfindungen verursacht. In allen Beispielen aus den anderen Sprachen wird Strategie b) verfolgt. Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich anderes in diesen Sprachen nicht möglich wäre. Wir können aber festhalten, dass Strategie b), diejenige mit so genanntem „externem Possessor“, besonders in Europa verbreitet ist, und hier auch nicht überall gleich, z.B. kaum an den Rändern Europas, z.B. im Englischen. Wir haben nun gesehen, dass Sprachen auf ganz unterschiedlichen Ebenen des Sprachsystems verschieden sein können. 1.2. Morphologische Typologie als Beispielfall Zur Folie 6 Wir wollen jetzt, auch zunächst beispielhaft, erläutern, was es heißen kann, Sprachtypologie zu betreiben. Typologie, eine exaktere Definition folgt später, fragt danach, wie man Sprachen oder sprachliche Erscheinungen typisieren, klassifizieren kann. Man kann z.B. Sprachen nach ihrer Morphologie typisieren. Diese Art der typologischen Arbeit spielte vor allem im 18./19. Jahrhundert die bedeutendste Rolle, und ist auch heute noch wesentlich. Sprachen werden hier nach den Möglichkeiten klassifiziert, wie einzelne lexikalische Konzepte miteinander in Sätzen verbunden werden, um eine Satzbedeutung zu erzeugen. Es geht also m die Varianz in Ausdruck relationaler Bedeutung. Friedrich von Schlegel legte 1808 ("Über die Sprache und Weisheit der Indier“) zunächst eine Aufteilung in die zwei Typen der „Sprachen durch Flexion“ (flektierende, später fusionierende Sprachen) und der „Sprachen durch Affixa“ (agglutinierende Sprachen) vor, die von A.W. Schlegel (1818) um einen dritten Typ der „isolierenden Sprachen“ und dann durch W. von Humboldt 1836 um den vierten der "einverleibenden", inkorporierenden (polysynthetischen) Sprachen, letztlich auch um einen 5. Typ der introflexiven Sprachen ergänzt wurde. Diese vollständige Fünfer-Gliederung liegt dann bei dem tschechischen Typologen Skalička (1979; siehe Wurzel) vor. Zu Beispielen auf Folie 7 Als fusionierend werden z.B. indoeuropäische Sprachen wie Sanskrit, Latein, Griechisch eingestuft, auch mit gewissen Abstrichen das Deutsche. In einer fusionierenden Sprache sind 7 (nach Whaley 1997, S. 134) die Grenzen zwischen den (grammatischen) Morphemen schwer zu bestimmen. Man kann auch sagen, in fusionierenden Sprachen ist das Verhältnis zwischen Ausdrucksseite und Inhaltsseite von grammatischen Morphemen/Morphen: mehr-mehrdeutig: D.h. eine nicht mehr zerlegbare Ausdruckseinheit kann mehrere grammatische Informationen tragen und umgekehrt: eine grammatische Information kann in unterschiedlichen Ausdrucksformen erscheinen. Nehmen wir ein lateinisches Beispiel: Die Wortform horti können wir segmentieren in den Stamm hort- und das grammatische Morph –i. hort-i: Garten-Nom.Pl. hort-i: Garten-Gen.Sg. Fusioniert zum Ausdruck kommen hier die grammatischen Informationen zu Kasus und Numerus. Ein Ausdruck trägt zwei Informationen, und dies nicht einmal eindeutig. Fragen wir umgekehrt nach den Realisierungsmöglichkeiten für jede dieser Einzelinformationen, so zeigt sich, dass auch hier mehrere Möglichkeiten bestehen: Nominativ-Plural-Formen sind z.B. auch feminae ‚Frauen’ (zu femina), templa ‚Tempel’ (zu templum) usw. Als agglutinierend gelten z.B. das Ungarische oder das Türkische, aber auch sehr viele Sprachen etwa der nativen Bevölkerung Amerikas. In agglutinierenden Sprachen sind die Morphemgrenzen innerhalb von Wörtern leicht erkennbar, einzelne grammatische Morphe sind leicht isolierbar. Die Beziehung zwischen Ausdrucks- und Inhaltsseite grammatischer Morphe ist der Tendenz nach: ein-eindeutig. D.h. eine nicht mehrzerlegbare Ausdruckseinheit trägt eine bestimmte grammatische Information und umgekehrt: Eine bestimmte grammatische Information wird regelmäßig durch eine bestimmte Ausdruckseinheit kodiert. Ich übernehme ein Beispiel aus Whaley 1997, 133. Es handelt sich um eine uto-aztekische Sprache aus Mexiko, das „Michoacan Nahautl“. no-kali ‚mein Haus’ no-pelo ‚mein Hund’ no-kali-mes ‚meine Häuser’ mo-pelo ‚dein Hund’ mo-kali ‚dein Haus’ mo-pelo-mes ‚deine Hunde’ i-kali ‚sein Haus’ i-pelo ‚sein Hund’ Ähnliches können und werden wir auch für das Ungarische oder das Türkische zeigen. 8 Eine isolierende Sprache ist z.B. Mandarin, die wichtigste Sprache Chinas sowie viele andere südostasiatische Sprachen (auch das Vietnamesische). In einer idealen isolierenden Sprache bestehen alle Wörter aus nur einem Morphem, es gilt also idealiter eine: ein-eindeutige Beziehung zwischen Morphem und Wort. Ein Beispiel aus dem Mandarin (Whaley 1997, S. 127): tā zài túshūguăn kàn bào he at library read newspaper He’s at the library reading a newspaper. In einverleibenden, inkorporierenden bzw. polysynthetischen Sprachen wird extremer Gebrauch von Affixen gemacht. Nicht nur grammatische Informationen wie Kasus, Tempus, Aspekt usw. werden an einem Stamm zum Ausdruck gebracht, sondern es werden häufig auch mehrere Stämme zusammen mit grammatischen Morphemen zu einem Wort zusammengebunden, nicht im Sinne von Wortbildung, sondern im Sinne der Konstruktion z.B. einer Verbalphrase. Ein Beispiel aus der Sprache „Southern Tiwa“ einer in den USA vertretene indigene Sprache Nordamerikas): Ti-khwian-mu-ban 1Sg-Hund-seh-Prät ‚Ich sah den Hund.’ In introflexiven Sprachen, wie etwa den semitischen Sprachen (Arabisch, Hebräisch) geschieht Flexion nicht durch Affixe, sondern durch Veränderungen im Wortstamm bzw. der Wurzel selbst. Beispiel aus dem ägyptischen Arabischen: ‚schreiben’ Perfektiv: kátab Imperfektiv: yí-ktib ‚verstehen’ Perfektiv: fíhim Imperfektiv: yí-fham (Matthews 1991, S. 138) Hier wird deutlich, dass die "Wurzel" jeweils aus einer Art "Konsonantenskelett" C-C-C besteht: k-t-b bzw- f-h-m. Vokale und Silbenstruktur hingegen wechseln je nach auszudrückender grammatischer Information. Auf der Basis des Skeletts k-t-b kann man z.B. auch Numerus-Morphologie oder lexikalische Morphologie (Wortbildung) betreiben: kitáab ‚Buch’, kútub ‚Bücher’ usw. 9 Ein vergleichbares Phänomen gibt es übrigens auch in der Flexionsmorphologie indoeuropäischer Sprachen. Auch z.B. im Deutschen oder im Englischen, unterscheiden sich bei bestimmten Verben, den starken Verben, Präsens-Stamm, Präteritum-Stamm und ggf. Partizipial-Stamm durch die Stammvokale: sing – sang –sung. Wir stellen bereits an diesem Beispiel fest, dass Sprachen in aller Regel keine reinen Typen im Sinne der 5 genannten verkörpern, sondern Mischungen. Ihre Einstufung z.B. als fusionierend beim Deutschen richtet sich nach den Typcharakteristika, die überwiegen. Merkmale anderer Sprachtypen sind damit nicht ausgeschlossen. Ich habe Ihnen mit diesen 5 Typen eine Klassifikation vorgestellt, die in ihren Wurzeln zurückgeht auf die großen Gründerfiguren der Sprachtypologie und die auch heute noch weit verbreitet ist. Wenn man sie aber genauer betrachtet, ist sie nicht wirklich konsistent. In ihr sind zwei morphologische Parameter vermischt. Ich nenne sie im Anschluss an Bernard Comrie und Lindsay Whaley (S. 128ff) den Synthese-Index und den Fusions-Index (zur Folie 8). Letztlich geht diese Unterscheidung zurück auf den amerikanischen Linguisten Edward Sapir ("Language" zuerst veröff. 1921, Ausgabe von 1949, S. 136). Die Differenzierungen bei Sapir sind jedoch äußerst komplex und ich greife auf die Vereinfachung in Whaley zurück. Bei dem Parameter der ‘Synthese’ geht es um den Grad an zulässiger morphologischer Komplexität von Wörtern. Dieses Kriterium führte zu der Dichotomie ‘synthetische’ versus ‘analytische’ Sprachen (Sapir unterscheidet hier noch; dies wollen wir mit Whaley vernachlässigen.), ist aber in Wahrheit ein gradientes Phänomen, ein Mehr oder Weniger. In der idealen isolierenden Sprache sind alle Wörter monomorphemisch. Dieser Parameter spielt in der 5-erKlassifikation eine Rolle beim isolierenden und polysynthetischen Typ. Würde man aber nur diesen Parameter zugrundelegen, so stünden die isolierenden Sprachen (wie Chinesisch, Vietnamesisch, Thai) allen übrigen gegenüber (die insgesamt synthetisch sind, sich aber im Grad der Synthese und in anderen Merkmalen noch unterscheiden. Bei dem Parameter 'Fusion' geht es um die Separierbarkeit der Morpheme im Wort. Er führt zu der Dichotomie 'agglutinierende' versus 'fusionierende' Sprachen, ist aber ebenso graduell wie der andere Parameter. Dieser Parameter spielt in der 5-er-Klassifikation eine Rolle bei den beiden so benannten Typen. Würde man aber nur diesen Parameter zugrundelegen, so fallen zunächst die isolierenden heraus; sie sind weder fusionierend noch agglutinierend. Die introflexiven Sprachen wären eher dem fusionierenden Typ zuzuschlagen. Polysynthetische Sprachen sind (schon aus logischen Gründen) in der Regel agglutinierend. 10 2. Eine kurze Geschichte der Sprachtypologie Wie oben bereits angedeutet, kann man die Anfänge ernsthafter sprachtypologischer Theoriebildung mit dem Beginn des 19. Jhs. ansetzen, etwa mit Friedrich Schlegels 1808 veröffentlichter Schrift „Über die Sprache und Weisheit der Indier“, die allgemein als erster Schritt zu der morphologischen Typologie, die wir oben skizziert haben, gewertet wird. Allerdings gibt es auch hierfür Vorläufer im 17. und 18. Jh. Dabei spielte vor allem die Vorstellung eine Rolle, dass ebenso wie einfache Ideen in der Entwicklung des menschlichen Geistes den komplexen Ideen vorangingen, strukturell einfache Wörter historisch früher anzusetzen sind als komplexe Wörter. Aus dieser Vorgeschichte der Typologie sind zu nennen etwa: der Philosoph John Locke, der Abbé Gabriel Girard und vor allem Adam Smith, der als Moralphilosoph und einer der Gründerväter der Volkswirtschaftslehre bekannt ist, der aber mit seiner Schrift „Dissertation on the origin of languages“ von 1761 das Nachdenken über Sprache ganz nachhaltig beeinflusst hat. Er hat bereits zwei Sprachtypen (den „uncompounded“ und den „compounded“ type) unterschieden und damit Schlegels Unterscheidung vorgeprägt. Bereits bei ihm war die Unterscheidung von Sprachtypen mit einer evolutionären Interpretation verknüpft: Der „uncompounded type“, worunter der flektierend-fusionierende Typ zu verstehen ist, gilt als einfach, älter, aber auch also „reiner“ bzw. „purer“. Der „compounded type“, d.h. der analytische Sprachtyp, bei dem grammatische Relationen mit syntaktischen Mitteln ausgedrückt werden, gilt als komplex, moderner und weniger rein, d.h. durch Sprachmischung entstanden. Diese Idee einer Bewertung von Sprachen im Sinne einer Historie von Aufwärtsentwicklung und (möglicherweise) Verfall sollte die folgende Zeit dominieren. Dabei galt im Zeichen der damals neu entdeckten vergleichenden Sprachbetrachtung, die die Verwandtschaft der indoeuropäischen Sprachen nicht nur aufdeckte, sondern in grandiosen Rekonstruktionen wissenschaftlich zu erforschen sich anschickte, allgemein der flektierend-fusionierende Sprachtyp, der sich in Sanskrit und den klassischen Sprachen verkörpert, als Höhepunkt der Sprachentwicklung. Dies kann in vielen Schriften nachgelesen werden. Ich greife hier nur den einflussreichsten und vielleicht bedeutendsten heraus, nämlich Wilhelm von Humboldt: In seiner Schrift „Über das Entstehen der grammatischen Formen und ihren Einfluss auf die Ideenentwicklung“ von 1822 schlug Humboldt vor, dass Sprachen sich von einer puren Referenz auf Dinge über die Agglutination von Hilfswörtern weiterentwickelten zu echter Flexion wie in Sanskrit, Griechisch und Latein. Zum Zitat auf Folie 9: Humboldt, S. 54/55 11 Formabbau, wie er mit der Reduktion agglutinierender Affixe zu Flexionsaffixen verbunden ist, bedeutet in den Augen Humboldts eine Aufwärtsentwicklung des menschlichen Geistes. In dem Maße, wie der menschliche Geist Freiheit erringt, in dem Maße befreit er sich von überflüssigen Fesseln der Form, auch der sprachlichen Form. Insofern seien zwar alle Sprachen „vollendet“, aber nicht als „vollkommen“. Dem Ideal der vollkommenen Sprache seien, wie gesagt, die flektierend–fusionierenden Sprachen am meisten angenähert. Verbunden mit dem im Denken der deutschen Romantik verbreiteten Konzept des „Volksgeistes“, der sich jeweils in der „inneren Form“ einer Sprache widerspiegle, führte diese zu einer Auffassung von Sprache, Sprachtyp, Denken und Nation, die in der Folge in sehr anfechtbarer Weise weitergeführt und ausgedeutet werden konnte. Dabei möchte ich, u.a. weil ich darüber nicht genug weiß, keineswegs andeuten, dass Humboldt selbst in einem negativen Sinne kurzschlüssig national überhöhte oder gar nationalistische Ideen verfolgte. Vielmehr verwahrte er sich dagegen, die Überlegenheit einer Kultur über andere ableiten zu wollen. Dies wäre auch ein eigenes Thema. Ich beschränke mich auf eine, aus meiner Sicht interessante Rezeption, die sich in dem englischsprachigen Typologie-Einführungsbuch von Whaley findet. Dort heißt es: Zum Zitat auf Folie 10: Whaley S. 21-22. Der Strukturalismus insgesamt brachte die typologische Forschung im Wesentlichen nur indirekt voran. Eine Ausnahme bildet die Prager Schule, die an die holistische morphologische Typologieforschung anzuknüpfen versteht und die den sog. „charakterologischen“ Ansatz von Mathesius brachte und die mit der Typologie von Skalička die primär morphologische zu einem Höhepunkt und gewissen Abschluss brachte. Skalička bezieht in seinen Arbeiten in den 50er und 60er Jahren bereits die Verbindung oder Korrelation mehrerer unterschiedlicher morphologischer und syntaktischer Merkmale ein, die jeweils bei einem Sprachtyp miteinander auftreten bzw. mit großer Wahrscheinlichkeit zusammen auftreten. Er bereitet damit die Positionen der modernen syntaktischen Typologie im Sinne Greenbergs vor. Joseph Greenberg kann als Begründer der eigentlichen modernen Typologieforschung betrachtet werden. Ich nenne stichwortartig die wichtigsten Verdienste und Neuerungen, die seine Arbeiten gebracht haben: 12 Folie 11 1. Er hat den quantitativen Ansatz (ähnlich wie Skalička) endgültig in der Typologie etabliert. So hat er eine Strategie zur Quantifizierung des Grades, in dem eine Sprache einen morphologischen Typ verkörpert, entwickelt. 2. Er hat die Idee einer repräsentativen Datenbasis in die Typologie eingeführt, also von „Samples“ von Sprachen, die keine genetische oder areale Verzerrung mit sich bringen, wenn aus ihnen Aussagen über die Sprachen der Welt abgeleitet werden sollen. Zwar hat Greenberg nur ein Sample von 30 Sprachen aus verschiedenen Sprachfamilien zugrundegelegt, was sich später insgesamt als unzureichend erwies. Aber er hat den wichtigen Schritt zu einer soliden Methodologie gemacht. 3. Seine wichtigste theoretische Neuerung war, dass er den im Prager Strukturalismus schon vertretenen Gedanken, dass bestimmte einzelne Eigenschaften von Sprachen notwendig miteinander zusammenhängen („korrelieren“), aufgegriffen und zu dem Beschreibungsinstrument der „implikativen Universalien“ ausgebaut hat. Dies geschah in seiner berühmtesten und äußerst einflussreichen Schrift „Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful Elements“ (1963/1966), wo er 45 solcher implikativer Universalien formulierte. Wir kommen darauf im systematischen Teil zurück. 4. Er betont die Bedeutung des Sprachwandels für die typologische Analyse. In dieser Hinsicht scheint er an Gedanken der älteren Typologie anzuknüpfen. Er gibt dieser historischen Sehweise aber eine ganz neue, nicht evaluative Bedeutung: Für ihn sind Sprachwandelphänomene möglicher Weg zu einer Erklärung sprachlicher Gesetzmäßigkeiten oder Universalien. 5. Schließlich markiert Greenberg den Übergang von einer holistischen, also aufs Ganze einer Sprache abzielenden Typologie zu einer konstruktionsbasierten Typologie. Während vorher also z.B. Aussagen im Vordergrund standen wie: „Das Deutsche ist eine fusionierende Sprache mit starken analytischen Anteilen, während das Englische nur noch in Resten fusionierend ist“ geht es jetzt um Aussagen wie „Im Deutschen gibt es ein flektierendes Relativpronomen, im Englischen neben einem (rest-)flektierenden Relativpronomen eine nicht-flektierbare Relativpartikel.“ 13 Heute gibt es eine Koexistenz verschiedener Schulen und schulenübergreifende gemeinsame Anstrengungen: Folie 12 − nordamerikanische Schule in direkter Nachfolge Greenbergs (Westküste): Comrie, Keenan; mit explizit ‘funktional-typologischem’ Ansatz: Givón, Haiman, Hopper/Thompson, Bybee, Croft − Leningrader Typologengruppe: (seit frühen 60ern): Gründer Alexander A. Xolodovič. Vertreter: V.P. Nedjalkov, V. Litvinov, Sil’ničkij (Smolensk), E.S. Geniušienè (Vilnius): ‘kollektive Methode der Typologie’ − Kölner UNITYP-Gruppe: Begründer Hansjakob Seiler (um 1972), Vertreter: Seiler, Christian Lehmann, Günter Brettschneider, Ulrike Mosel: Universalienforschung, konzeptuell-deduktiver Ansatz − EUROTYP-Projekt (Typology of Languages in Europe, gefördert von der ESF, Projektzeitraum 1990-1994): Paradebeispiel einer übergreifenden Forschungsanstrengung. Geplante EUROTYP-Veröffentlichungen zu insgesamt neun Bereichen: Diskurspragmatik, Konstituentenordnung (erschienen), Komplementsätze, Aktanz und Valenz (ersch.), Adverbialkonstruktionen, Tempus und Aspekt, NP-Struktur (ersch.), Syntax der Klitika (ersch.), Wortprosodische Struktur. Alle drei hier beispielhaft genannten Schulen sind im weiteren Sinne funktional, sie sind alle der Vorstellung verpflichtet, Sprache sei in erster Linie ein Instrument der Kommunikation und der sozialen Interaktion und dieser ihr Zweck bestimme auch ihre Form. Damit finden sie sich in einem gewissen Gegensatz zur Chomsky-Schule, wo Sprache vor allem unter der biologischen Perspektive eines genetischen Programms gesehen wird. Allerdings, so denke ich, ist im Augenblick – zumindest in den USA – eine Annäherung zwischen dem ChomskyParadigma und typologischer Interessenrichtung zu beobachten. In der konkreten Theoriebildung und in der Methodologie gibt es durchaus Unterschiede. Die amerikanische Schule zumindest in der Darstellung von Croft, auf die ich mich berufe, betrachtet -entsprechend einem weitverbreiteten neodarwinistischen Wissenschaftstrend - Sprache als ein adaptives evolutionäres Phänomen. Sie werde durch die evolutionären Kräfte der Umwelt geprägt. Die Aufgabe, Information, Emotion und soziale Rollen sprachlich zu übermitteln, erzwinge entsprechend adaptive Formen der Sprachgestalt. Dabei erhalten dann diejenigen Lösungen den Vorzug, die einen evolutionären Vorteil bieten, also Lösungen die im Mitteleinsatz ökonomisch sind oder auch Lösungen, die mit bereits bestehenden kognitiven Verfahren in wesent- 14 lichen Punkten übereinstimmen, z.B. deren Struktur abbilden, ikonisch sind. Diese bringen eine Reduktion von Komplexität, also einen adaptiven Effizienzgewinn. Die Leningrader Schule zeichnet sich durch eine besonders sorgfältige Methodologie aus. Sie arbeitet mit empirisch orientierten Experten für einzelne Sprachen oder Sprachgruppen, die unabhängig von den theoretischen Typologen die Daten erheben und beschreiben. Besonderer Wert wird auf die Datenerhebung mittels Fragebögen und eine explizit induktive Methodologie gelegt. Es wird also nicht von zugrundegelegten begrifflichen Kategorien ausgegangen wie etwa ‘Kausativität’, sondern es werden Manifestationen und Merkmale von übereinzelsprachlicher Gültigkeit zusammengetragen, die insgesamt eine komplexes taxonomisches Raster möglicher Merkmalskombinationen im Skopus einer Kategorie wie Kausativität ergeben. Bekannte Arbeiten: Nedjalkov (Hg.) (1988): Typology of Resultative Constructions. Amsterdam/Phil. Benjamins. Geniušienè (1987): The Typology of Reflexives. Berlin etc. Mouton de Gruyter. Das Kölner UNITYP-Projekt ist am stärksten universal-konzeptuell ausgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass abstrakte konzeptuelle Muster existieren, die in den Sprachen der Welt instatiiert werden, etwa das Muster der direkten und der indirekten Partizipation, also Teilhabe an Sachverhalten. Man unterscheidet (1) eine kognitive Ebene der allen Menschen verfügbaren Konzepte, (2) eine interlinguale Ebene als eigentlich typologischer Gegenstand, und (3) eine einzelsprachliche Ebene. 3. Systematischer Teil: Theorie und Methodik 3.1. Die Sprachen der Welt in Übersicht. Wie sind sie eingeteilt? Ich möchte Ihnen jetzt eine ganz grobe Übersicht darüber geben, wie man die über 6000 Sprachen der Welt genetisch einteilt, also nach gemeinsamer Herkunft oder Abstammung. Dabei muss ganz klar sein, dass diese genetische Einteilung keine typologische Einteilung ist. Dazu ein Beispiel: Deutsch und Englisch sind genetisch nah verwandt. Es sind germanische Sprachen innerhalb der größeren Gruppe der indoeuropäischen Sprachen. Typologisch sind sie aber (zumindest in 15 gewissen Hinsichten) nicht so nah bei einander: Wir haben schon gehört, dass Englisch stärker isolierend als synthetisch ist, während das Deutsche eher zum synthetischen Typ gehört. Wir halten also fest: Typologische Zusammengehörigkeit ist im Prinzip unabhängig von genetischer Zusammengehörigkeit. Andererseits wird bei der typologischen Arbeit immer von der genetischen Klassifikation ausgegangen. D. h. die genetische Klassifikation ist eine Art Input für die typologische Klassifikation. Die Vorstellung, die hinter einer “genetischen” Klassifikation steckt, ist die, dass Sprachen untereinander verwandt sein können. Man spricht dann von Sprachfamilie. Was wiederum heißt, dass sie auf eine gemeinsame “Ursprache“ zurückgehen müssen, so wie Familienmitglieder (Blutsverwandte) einen gemeinsamen Vorfahren haben müssen. Diese Ursprachen sind uns in der Regel nicht überliefert. Vielmehr versucht man, aufgrund von Ähnlichkeiten zwischen und bekannten Entwicklungen in den verwandten Sprachen eine hypothetische Ursprache (in bestimmten Teilen) zu rekonstruieren. Wie Sie sicher wissen, ist die bekannteste solche Rekonstruktion die des „Indogermanischen/Indoeuropäischen“, die letztlich auf das Jahr 1786 zurückgeht, als Sir William Jones, britischer Richter in Kalkutta, die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Sanskrit, Lateinisch, Gotisch und Persisch zum ersten Mal klar erkannte und formulierte. Der Rekonstruktion der Ursprache (Protosprache) mit wissenschaftlichen Methoden (u.a. mithilfe so genannter Lautgesetze) ist eine ganze heute noch intensiv betriebene sprachwiss. Teildisziplin, die Indogermanistik, gewidmet. Heute ist die Existenz einer ganzen Reihe von Sprachfamilien unbestritten, neben der indoeuropäischen: die afroasiatische (früher: hamito-semitische: semitische Sprachen und weitere Spr. Nordafrikas), uralische Sprachfamilie (uralisch-yukagirisch: Finnisch, Ungarisch u.a.). Andere sind stark umstritten. Hier können wir wieder Joseph Greenberg ins Spiel bringen, der in den 60er Jahren des letzten Jhs. begonnen hat, die Sprachen Afrikas in nur vier Makrofamilien zusammenzufassen: Afroasiatisch, Khoi-San, Niger-Kordofanisch/Niger-Kongo und Nilo-Saharanisch. Er hat dabei nicht nur einzelne Wörter miteinander verglichen, sondern einen Massenvergleich angestellt, also sehr viele Daten und Faktoren berücksichtigt. Greenberg vertritt dabei sozusagen das Lager der „Vereinheitlicher“, dem das Lager der „Spalter“ zum Teil heftig widerspricht. Trotzdem haben vor allem durch den Greenberg-Anhänger Merritt Ruhlen die „Vereinheitlicher“ deutlich an Boden gewonnen: [Merritt Ruhlen: A Guide to the World’s Languages. Vol 1: Classification.: Lon- don/Melbourne/Auckland: Edward Arnold: 17 Makrofamilien.] 16 Greenberg hat dann seine Methode auch auf die indigenen Sprachen der beiden Amerika angewandt und dort nur 3 Makrofamilien identifiziert: Eskimo-Aleutisch und Na-Dené (anerkannt), Restklasse Amerindisch (umstritten). In der folgenden Karte sind die genannten Markofamilien angenommen: Zur Karte auf Folie 13: Spektrum Wissenschaft, S. 8 Es gibt sogar noch den Versuch, Makrofamilien zu Superfamilien zusammenzufassen wie etwa die so genannte „nostratische“: Indoeuropäisch + Afroasiatisch + andere. Das folgende Schaubild verdeutlicht, nach welcher Methode Merritt Ruhlen (in einem anderen Werk über den Ursprung der Sprachen) bei dem Versuch der Klassifikation von Sprachen vorgeht: Er untersucht den Grundwortschatz von Sprachen und lässt den Leser selbst analysieren. Zum Schaubild auf Folie 14: Spektrum der Wissenschaft, S. 17 Er kommt so zu einer einzigen hypothetischen Ursprache, für die er 20 Wurzeln annimmt: KUAN ‚Hund’, TEKU ‚Bein’, TIK ‚Finger’ usw. Viele Sprachwissenschaftler protestieren heftig: Sie sagen, dass man es sich mit den Ähnlichkeiten nicht zu leicht machen darf. Nach ihnen darf man Ähnlichkeiten nur dann als Indiz für Verwandtschaft nehmen, wenn sie regelmäßig auftreten. D.h. lat. pes/ped darf man nur dann als verwandt mit dt. Fuß, betrachten, wenn auch in vielen anderen alten Wörtern, also regelmäßig einem lat. /p/ ein dt. /f/ entspricht, was ja tatsächlich der Fall ist. Man hat nun, um die Hypothese der Makrofamilien zu stützen, versucht, genetische und sprachwissenschaftliche, ebenso auch archäologische Befunde zusammenzubringen. Die Grundidee ist dabei, Sprachverwandtschaften und genetische Verwandtschaften ihrer Sprecher zu parallelisieren. Zum Teil können hier tatsächlich Befunde geltend gemacht werden. So kann man zeigen, dass die Basken, die eine von anderen europäischen Sprachen völlig verschiedene Sprache sprechen, auch genetisch deutliche Unterschiede gegenüber den übrigen Europäern aufweisen. Andererseits ist aber eine einfache Parallelisierung sicher völlig falsch. Der Wechsel von einer Sprache kann z.B. durch Eroberung und Herrschaft in wenigen Generationen vonstatten gehen. So ist z.B. Frankreich/Gallien in relativ kurzer Zeit romanisiert worden; die Kelten sind aber nicht ausgerottet worden. Andererseits kann eine gegenüber ihrer Umgebung „fremde“ Sprache erhalten bleiben, obwohl keine genetischen Unterschiede bei der Bevölkerung auszumachen sind, wie etwa bei den Ungarn gegenüber anderen Europäern. Am bekanntesten für den Versuch einer Korrelation zwischen dem Stammbaum menschlicher 17 Populationen und der genetischen Systematik von Sprachen ist der Biologe Luigi-Luca Cavalli-Sforza: Er versucht mit der Methode der genetischen Distanz die Entwicklung von Populationen und ihren Sprachen von den Ursprüngen her nachzuweisen. Er glaubt zeigen zu können, dass die Menschheitsgeschichte ihren Ursprung in Afrika nahm, von wo sie zunächst nach Asien kamen und von dort in mehreren Schüben einerseits nach Europa, andererseits nach Amerika und in den pazifischen Raum. Zum Schaubild auf Folie 15: Spektrum der Wissenschaft: Sprachfamilien S. 24/25, genetische Verwandtschaft 3.2. Gegenstand der Sprachtypologie und des Sprachvergleichs, Definitionen Nachdem nun eine Abgrenzung gegenüber einer genetischen, historischen Klassifikation von Sprachen erfolgt ist, wollen wir genauer den Gegenstand der Sprachtypologie bestimmen. Folie 16a Nach Whaley, S. 7 ist Sprachtypologie so bestimmt: (Def) Sprachtypologie ist die Klassifikation von Sprachen oder Komponenten von Sprachen auf der Basis geteilter formaler Charakteristika. Croft, S. 1 spricht von zwei möglichen Interpretationen von Sprachtypologie: (a) Typologische Klassifikation: Klassifikation von Sprachen nach strukturellen Typen. Sprachtypologie besteht in der Definition von Sprachtypen und einer Klassifikation der Sprachen nach diesen Typen. Nach dieser Definition gehört jede Sprache zu einem bestimmten Typ. (holistische Typologie) (b) Sprachübergreifende Muster: Erforschung von sprachlichen Mustern, die nur durch den Sprachvergleich aufgedeckt werden können. Wichtigstes Muster: das implikative Universale. 18 Beispiel für (b): Wenn das Demonstrativum dem Kopf-Substantiv folgt, folgt auch der Relativsatz dem Kopf-Substantiv. Eine solche Aussage kann nur durch Sprachvergleich zustande kommen. In der Bestimmung von Croft werden die beiden bei Whaley durch „oder“ zusammengefassten Aspekte auseinandergenommen: (a) Klassifikation von Sprachen, (b) Klassifikation von Komponenten/Mustern. Wir kommen auf die zusammenfassende und insofern allgemeinere Definition von Whaley zurück. Whaley führt aus, dass in seiner Def. drei Aussagen verborgen sind, die man wie folgt herauspräparieren kann: Folie 16b: (zu-Def.1) Sprachtypologie beinhaltet Sprachvergleich. (zu-Def.2) Ein typologischer Ansatz beinhaltet die Klassifikation von a) Komponenten von Sprachen oder b) von Sprachen selbst. Whaley demonstriert a) anhand einer Untersuchung der oralen Verschlusslaute wie [p] und [g]. Erstes sprachvergleichendes Ergebnis ist, dass alle Sprachen mindestens einen solchen Laut haben. Diese Erkenntnis führe zu einer „ontologischen“ Frage, nämlich der nach dem „Warum“. Weiterhin könne festgestellt werden, dass etwa 50 verschiedene orale Verschlusslaute existierten, Sprachen aber nur jeweils einen Teil davon besäßen. Die am weitesten verbreiteten seien [p], [t] und [k]. Außerdem gäbe es „gaps“: Verschlusslaute, die man durch Kontaktierung der unteren Zahnreihe mit der Oberlippe zustandebringen könnte, gäbe es – obwohl physiologisch möglich – nicht. Nun kurz zur Warum-Frage. Letztendlich gehe es in der Typologie natürlich um eine Erklärung dafür, warum Sprachen so sind, wie sie sind. Bei Lauten sei die menschliche Anatomie ein guter Ansatzpunkt für Erklärungen. So seien [p], [t] und [k] möglicherweise deshalb so verbreitet, weil sie „aerodynamisch effizient“ seien, und weniger artikulatorischen Aufwand erforderten als bei der Produktion anderer Verschlusslaute. Whaley warnt aber auch vor allzu schnellen effizienzorientierten Erklärungen. Wenn Effizienz der einzige leitende Faktor bei der Evolution von Lautsystemen wäre, könne nicht erklärt werden, wie und warum überhaupt ineffiziente Laute, die es unbestreitbar gibt, in die Sprachen kämen und sich dort auch hielten. 19 Nach der entwickelten Vorgabe kann man nun auch Sprachen klassifizieren. Whaley, S. 11: Folie 16c (zu-Def.3): Typologie befasst sich mit der Klassifikation auf der Basis formaler Merkmale von Sprachen. Whaley will damit den Gegenstand der Typologie abgrenzen gegenüber anderen Klassifikationsmöglichkeiten: der genetischen (kennen wir bereits) und der arealen. Die Beziehungen zwischen genetischer und typologischer Klassifikation seien in der Regel klar erkennbar: „The typological similarity of the two languages (of Spanish and French) is a function of their genetic association.“ Dagegen sei die Verbindung zwischen arealer und typologischer Klassifikation weniger klar. Es werde noch untersucht, wie stark die Grammatiken von Sprachen von denen ihrer Umgebungssprachen beeinflussbar seien. Bekanntes Beispiel ist der so genannte Balkan-Sprachbund (Albanisch, Bulgarisch, Rumänisch). Diese stammen aus ganz verschiedenen Zweigen des Indoeuropäischen, haben aber viele gemeinsame Züge, z.B. Definitheitssuffixe. Folie 17 Albanisch mik-u ‚Freund-der’ Bulgarisch trup-at ‚Körper-der’ Rumänisch om-ul ‚Mann-der’ Diese Strategie ist in keiner der Sprachfamilien sonst verbreitet. Ihr Ursprung bleibt mysteriös. Schließlich können auch demografische Faktoren zur Klassifikation herangezogen werden; etwa nach der Anzahl der Sprecher, nach der Homogenität oder nach Mehrsprachigkeit. Dabei spielt vor allem der Mehrsprachigkeitsfaktor eine große Rolle: Unbestreitbar beeinflussen sich die Grammatiken von Sprachen wechselseitig, wenn in einer Gesellschaft ein hoher Grad von Mehrsprachigkeit herrscht. 20 Noch ein Kommentar zu „formale Merkmale“: Das ist etwas problematisch. Vielleicht sollte man besser sagen: nach innersprachlichen Merkmalen. Denn häufig wird in der Sprachtypologie als Ausgangspunkt der sprachübergreifenden Untersuchung kein im engeren Sinne formales Merkmal gewählt, sondern ein semantisches bzw. funktionales. Dies ist das tertium comparationis, das überhaupt Vergleichbarkeit garantieren soll. Wir kommen darauf zurück. Abschließend noch eine Folie zur Definition von ‚Sprachtypologie’ von Stromsdörfer/Vennemann 1995. Sie greift ganz ähnliche Gesichtspunkte auf wie die beiden bisher erörterten. Zur Folie 18 Wie steht es nun mit Sprachvergleich im Gegensatz zu ‚Sprachtypologie’? Sprachvergleich ist zunächst ein unspezifischer Terminus. Sprachvergleich kann Bestandteil unterschiedlicher linguistischer Teildisziplinen und unterschiedlicher theoretischer und methodischer Ansätze sein. Sprachvergleich geschieht selbstverständlich auch im Rahmen typologischer Forschung; dies haben wir gesehen. Sprachvergleich war und ist auch die Basis der Indogermanistik (historisch-vergleichende Sprachwissenschaft). Im engeren Sinne versteht man unter ‚Sprachvergleich’ auch die so genannte kontrastive Linguistik bzw. kontrastive Grammatik. Diese Teildisziplin entstand in den 60er Jahren des vergangenen Jhs. aus dem Bestreben heraus, eine bessere Grundlage für den Fremdsprachenunterricht zu schaffen. Man wollte einen systematischen Vergleich zwischen Muttersprache (L1) und zu erlernender Fremdsprache (L2) anstellen. Die Grundidee war, dass L2 auf der Basis von L1 erlernt wird und dass deshalb Gemeinsamkeiten das Erlernen erleichtern (positiver Transfer), Unterschiede aber das Lernen erschweren (Interferenz). Die hoch gesteckten Erwartungen in eine verbesserte Praxis des Fremdsprachenunterrichts haben sich nicht unbedingt erfüllt. Es gab eine sehr intensive Kontroverse zwischen den Anhängern und den Kritikern dieser Konzeption von kontrastiver Linguistik. Als Fazit schlägt E. König König, Ekkehard (1990): Kontrastive Linguistik als Komplement zur Typologie. In: Gnutzmann, Claus (Hg.) (1990): Kontrastive Linguistik. Frankfurt am Main u.a.: Lang. 117131. (= Forum Angewandte Linguistik 19) König, Ekkehard (1996): Kontrastive Grammatik und Typologie. In: Lang, Ewald/Zifonun, Gisela (Hg.) (1996): Deutsch - typologisch. Jahrbuch 1995 des Instituts für Deutsche Sprache. Berlin/New York: de Gruyter. S. 31-54. vor, die kontrastive Linguistik aus ihrem engen Bezug auf den Fremdsprachenunterricht zu lösen. Wir kommen gleich darauf zurück. Zunächst noch einige Hinweise zu kontrastiven Grammatiken, an denen das Deutsche beteiligt ist. 21 Im Bereich der kontrastiven Grammatiken zu Sprachenpaaren, von denen das Deutsche ein Element ist, verfügt das IDS über eine vergleichsweise reiche Tradition. Am IDS oder in Kooperation mit dem IDS wurden kontrastive Grammatiken zu den Sprachenpaaren Deutsch – Französisch (Zemb 1978), Deutsch – Serbokroatisch (Engel/Mrazović 1986), Deutsch – Spanisch (Cartegena/Gauger 1989), Deutsch – Rumänisch (Engel et al. 1993), Deutsch – Polnisch (Engel et al. 1999) erarbeitet. Zum Sprachenpaar Englisch – Deutsch liegt mit Hawkins 1986 eine typologisch-vergleichende Grammatik vor. Abraham 1994 und Glinz 1994 konfrontieren das Deutsche, mit durchaus unterschiedlicher Akzentsetzung, mit mehreren anderen europäischen Sprachen. Folie 19 Abraham, Werner (1994): Deutsche Syntax im Sprachenvergleich. Grundlegung einer typologischen Syntax des Deutschen. Tübingen: Narr. (= Studien zur deutschen Grammatik 41) Glinz, Hans (1994): Grammatiken im Vergleich. Deutsch - Französisch - Englisch - Latein. Tübingen: Niemeyer. Engel, Ulrich/Mrazović, Pavica (1986): Kontrastive Grammatik Deutsch-Serbokratisch. München: Sagner. (= Sagners slavistische Sammlung 10) Engel, Ulrich/Isbaşescu, Mihai/Stanescu, Speranta/Nicolae, Octavian (1993): Kontrastive Grammatik Deutsch-Rumänisch. Heidelberg: Groos. Engel, Ulrich et al. (1999): Deutsch-polnische kontrastive Grammatik. 2 Bände. Heidelberg: Julius Groos Hawkins, John (1986): A Comparative Typology of English and German. Unifying the Contrasts. London: Croom Helm. Zemb, Jean-Marie (1978): Vergleichende Grammatik Französisch-Deutsch. Mannheim: Bibliographisches Institut. (= Duden Sonderreihe vergleichende Grammatiken 1) Ziel der kontrastiven Linguistik ist nun nach König "ein umfassender Vergleich zweier Sprachen", der "grundsätzlich nicht gerichtet ist" (König 1996, 32). Nicht gerichtet sein heißt, nicht zwischen Ausgangs- und Zielsprache (Übersetzungswissenschaft) unterscheiden, oder zwischen Erst- und Zweitsprache (Sprachkontaktforschung) oder Mutter- und Fremdsprache (Fremdsprachenunterricht). Neuere kontrastive Grammatiken wie etwa die dt-polnische folgen in gewisser Weise bereits diesem Prinzip, sie sind als reversible Grammatiken gedacht. Sie können in die eine oder die andere Richtung benutzt werden. 22 Ein Ziel der allgemeinen Sprachtypologie ist dagegen nach König der systematische Vergleich möglichst "vieler Sprachen entlang weniger Parameter der Variation" (König a.a.O.). Kontrastive Linguistik und Sprachtypologie stehen somit in einem Verhältnis der Umkehrung zueinander. Kontrastive Linguistik kann sich aber auch als "Grenzfall der Typologie" (König 1996, S. 32) erweisen, wenn die kontrastiven Merkmale, die die verglichenen Sprachen unterscheiden, als Ausdruck unterschiedlicher genereller und einander wechselseitig bedingender Strukturprinzipien begriffen werden, die jeweils auf unterschiedliche typologische Eigenschaften zurückzuführen sind. Einer so verstandenen "komparativen Typologie" ist beispielsweise Hawkins 1986 verpflichtet. Darüber hinaus ergänzen beide Disziplinen einander; die kontrastive Linguistik ist auch "Komplement zur Typologie" (König 1990). Insbesondere ist es für den kontrastiven Vergleich eine ganz wesentliche Information, wie der ermittelte Kontrast hinsichtlich eines Phänomens P zwischen zwei (oder mehr) Sprachen im Hinblick auf "die Sprachen der Welt" einzuordnen ist: Handelt es sich um einen singulären Kontrast oder stehen die beiden Sprachen jeweils für eine ganze Klasse mit vergleichbaren Lösungen? Gibt es weitere Lösungen für P, welche, wieviele usw.? 3.3. Wie geht man vor beim Sprachvergleich? Wie geht der Typologe vor? Ich will zwei Aspekte betrachten: die heuristische Vorgehensweise und die Datenbasis. heuristische Vorgehensweise Beim gerichteten Sprachvergleich in der kontrastiven Grammatik ist die Sache vergleichsweise einfacher: Man geht von der Kategorien der Ausgangssprache aus und fragt nach deren Realisierung in der Zielsprache. Man nimmt also z.B. bei Deutsch als Ausgangssprache das Passiv des Deutschen als Ausgangspunkt und fragt danach, was dem Passiv z.B. im Polnischen entspricht. Dabei wird man feststellen, dass das dt. Passiv im Polnischen nicht immer durch das Passiv wiedergegeben wird, sondern häufig durch unpersönliche Konstruktionen oder durch Konstruktionen mit dem Reflexivpronomen. Als Beispiel ziehe ich die dt-poln. Grammatik von Engel et al. heran. Wir haben bereits gehört, dass diese Grammatik sich als reversible kontrastive Grammatik versteht. Trotzdem scheint das Dt. als Ausgangssprache die Kategorien vorzugeben. So heißt es im Inhaltsverzeichnis zum Passiv: 23 Folie 20 4.8. Passivkomplexe 4.8.1. Allgemeines 4.8.2. Das werden-Passiv und seine polnischen Äquivalente 4.8.3 Das gehören-Passiv und seine polnischen Äquivalente 4.8.4. Das bekommen-Passiv und seine polnischen Äquivalente 4.8.5. Das sein-Passsiv und seine polnischen Äquivalente 4.8.6. Konkurrenzformen zum Passiv Beim Sprachvergleich allgemein und bei der Sprachtypologie, die nach formalen/strukturellen/innersprachlichen Kriterien vorgeht, gibt es aber ein grundsätzliches Problem: Wenn Sprachen formal verschieden sind, wie kann man sie vergleichen? Dabei geht es um die Frage nach dem tertium comparationis. Bei der Suche nach einem tertium entsteht eine Art paradoxale Situation: Folie 21 a. Erkennt man grundsätzlich an, dass Einzelsprachen die Aufgabe der Zuordnung von Sprachform und Sprachfunktion in je spezifischer Weise lösen, verbietet es sich von vornherein, die Kategorien einer der Vergleichssprachen unbesehen als tertium zu akzeptieren. b. Versucht man über den Sprachvergleich zu einem "übergreifenden" Kategorieninventar zu gelangen, so muss zumindest als Basis, die Vergleichbarkeit garantiert, für jeden Untersuchungsbereich eine Art "Anfangstertium" gegeben sein. Dabei muss die Klippe umschifft werden, dass, um den Vergleich durchzuführen, Kategorien benötigt werden, die erst durch den Vergleich gewonnen werden können. c. Andererseits kann auch ein deduktiv gewonnenes "übereinzelsprachliches" Begriffsraster nicht wirklich greifen, weil Kategorien, die zur Sprachbeschreibung taugen sollen, auch aus der Sprachanalyse gewonnen sein müssen. 24 Die moderne Sprachtypologie in der Nachfolge Greenbergs glaubt, das Dilemma aufbrechen zu können, wenn semantische oder funktionale Gesichtspunkte als Anfangstertium gewählt werden. Dazu ein Zitat aus Croft (1993, S. 11): Folie 22 The essential problem is that languages vary in their structure to a great extent; indeed, that is what typology (and more generally, linguistics) aims to study and explain. But the variation in structure makes it difficult if not impossible to use structural criteria, to identify grammatical categories across languages. Although there is some similarity in structure ("formal" properties) that may be used for cross-linguistic identification of categories, the ultimate solution is a semantic one, or to put it more generally, a functional solution. Etwas konkreter wird das nochmals ausgeführt in folgender Passage aus einer sehr wichtigen typologischen Arbeit: Keenan, Edward L./Comrie, Bernard (1977): Noun Phrase Accessibility and Universal Grammar. In: Linguistic Inquiry, S. 63-99. Zitat Croft S. 12 oben. Daraus ist nach Croft folgende Standard-Forschungsstrategie abzuleiten: Folie 23: 1. Bestimme die spezifische semantisch(-pragmatisch)e Struktur oder den Situationstyp, den du untersuchen willst. 2. Untersuche die morphosyntaktische Konstruktion oder die Konstruktionen, die gebraucht werden, um diesen Situationstyp auszudrücken. 3. Suche nach Abhängigkeiten zwischen den Konstruktionen, die für diese Situation gebraucht werden, und anderen sprachlichen Faktoren (anderen strukturellen Merkmalen, anderen externen Funktionen, die durch die fragliche Konstruktion ausgedrückt werden, oder beidem). 25 Am Beispiel einer sprachübergreifenden Identifikation des „Subjekts“. Man wird feststellen, dass sprachübergreifend das Subjekt strukturell auf verschiedene Weise ausgedrückt wird: z.B. durch Kasusmarkierung oder Markierungen durch Adpositionen, durch Kongruenz am Verb (wie im Dt.: Das finite Verb stimmt in Person und Numerus mit dem Subjekt überein.) oder durch Wortstellung, oder auch durch mehrere Mittel in Kombination. Aber woher weiß man das? Nur, weil man eine heuristische Definition zugrunde legt, die die externe Funktion einschließt, wozu ein Begriff wie „Agens einer Aktion“ oder „Satztopik“ oder ähnliches gehört. Im Prinzip klingt das nun relativ klar. Im Einzelnen aber ist es sehr schwierig, wirklich gute tertia ausfindig zu machen. Datenbasis Man kann annehmen, es wäre das beste, bei einer typologischen Untersuchung alle Sprachen der Welt heranzuziehen. Das geht natürlich nicht, zum einen aus praktischen Gründen. Zum anderen ist ja gar nicht ganz klar, was nun wirklich alles als Sprache zählt. Croft erwähnt das Schwäbische. Oder denken wir an das Schweizerdeutsche. Rein strukturell könnte Schwäbisch oder Schweizerdeutsch auch als eigene Sprache gelten, wären da nicht soziolinguistische, gesellschaftliche und historische Faktoren, die dagegen sprechen. Außerdem wandeln sich Sprachen, neue bilden sich heraus (Sprachdynamik!). Man ist also gezwungen, sich mit so genannten samples zu begnügen. Wir haben schon gehört, dass Greenberg zunächst ein sample von 30 Sprachen benutzte. Ein solches sample kann nicht repräsentativ sein. Es hat notwendigerweise eine Unausgewogenheit zugunsten einer genetischen oder arealen Gruppe. In Greenbergs sample waren fast ein Drittel der Sprachen indoeuropäisch und fast ein Viertel wurde in Afrika gesprochen. Deshalb sind einige seiner Ergebnisse suspekt. Für die Erstellung repräsentativer samples gibt es drei Vorschläge: 26 Folie 24 1. Jede Sprachfamilie soll nach Maßgabe der Anzahl ihrer Mitglieder, also der in ihr versammelten Einzelsprachen, im sample repräsentiert werden. z.B. wenn ein sample 10% aller Sprachen erfassen soll, dann sollen 10% der bekannten indoeuropäischen Sprachen, 10% der Nili-Kardofan-Sprachen vertreten sein usw. Problem: Größe der Sprachfamilien hängt oft von historischen und gesellschaftlichen Gegebenheiten ab. 2. Es soll ein sample von (genetisch und areal) unabhängigen Sprachen erstellt werden. Auf diese Weise wurde von den Typologen Bybee und Perkins ein sample von 50 Sprachen zusammengestellt. Hier spielt die Größe einer Sprachfamilie keine Rolle. Jeweils nur 1 Mitglied wird aufgenommen. Problem hier: Möglicherweise ist es unmöglich, ein sample von 50 areal unabhängigen Sprachen zu erstellen, weil „linguistic areas“ oft sehr ausgedehnt sein können. 3. Matthew Dryer schlägt eine sehr umfangreiche Datenbasis von 625 Sprachen vor. Diese werden in genera gruppiert (≈ Sprachfamilien) und dann zu 6 großen Arealen zusammengefasst. Um behaupten zu können, dass ein bestimmtes Muster statistisch signifikant ist, muss es in den genera aller 6 Areale vorhanden sein. Beispiel Greenbergs Universale 18: Wenn eine Sprache das Demonstrativum nach dem Substantiv platziert, platziert sie auch das Adjektiv danach. Ergebnis nach dieser Methode bestätigt: Das Universale ist statistisch valid. 27 Folie 25 Whaley S. 40: NDem Afr Eura A-NG NAm SAm Total 28 14 8 8 5 63 1 2 0 1 0 4 und NAdj NDem und AdjN Kritik: Gruppierung in genera ist oft problematisch. Außerdem ist es unheimlich schwer, ein solch großes sample zusammenzustellen. Wie werden nun Daten überhaupt aquiriert? Der Forscher kennt ja die meisten der untersuchten Sprachen seines samples nicht. Er zieht also Grammatiken, Handbücher usw. heran. Das Problem dabei ist, dass viele Details so nicht erschlossen werden können. Die zweite Quelle sind Fragebögen. Dies ist allerdings eine sehr aufwändige, z.-T. auch kostspielige Methode, die allerdings viel detailliertere Informationen liefern kann als Handbücher und Grammatiken. 3.4. Universalien In der Typologie strebt man nach Aussagen über fundamentale Eigenschaften von Sprachen; also Aussagen die möglichst für alle Sprachen gelten sollen. Man spricht hier von Universalien. Es gibt verschiedene Typen von Universalien: 28 Folie 26 Typen von Universalien Universalien absolute nicht-absolute (statistische) Beispiele (nach Whaley, S. 32): absolute Universalien: - Alle Sprachen haben Konsonanten und Vokale. - Alle Sprachen unterscheiden zwischen Nomina und Verben. - Alle Sprachen verfügen über Mittel, um Fragen zu formulieren. nicht-absolute Universalien: - Die meisten Sprachen haben den Vokal [i] wie in dem englischen Wort feet. - Die meisten Sprachen haben Adjektive. - Sprachen bedienen sich gewöhnlich ansteigender Intonation, um ja/nein-Fragen zu signalisieren. Folie 27a Universalien uneingeschränkte implikative Uneingeschränkte Universalien klassifizieren Sprachen nach nur einem Parameter: Beispiele, siehe oben. Außerdem Folie 27b uneingeschränktes nicht-absolutes Universale (Greenbergs Universale 1): Folie 27 • In Aussagesätzen mit nominalem Subjekt und Objekt ist die dominante Reihenfolge fast immer eine, in der das Subjekt dem Objekt vorangeht. 29 Später wurde gezeigt, dass dieses Universale für ca. 95% der Sprachen gilt. Implikative Universalien sprechen über mindestens zwei strukturelle Merkmale oder Parameter. Sie halten fest, dass es eine Abhängigkeit zwischen diesen gibt. Damit wird festgehalten, dass es eine Beschränkung für die logisch möglichen Sprachtypen gibt. Wir greifen eines der Wortstellungs-Universalien auf (diesmal nicht von Greenberg selbst, sondern von Hawkins), das wir schon kennen und das als implikatives Universale formuliert ist: Folie 27c Implikatives Universale (Hawkins 1983) (Hawkins, John (1983): Word order universals. New York: Academic Press.) • Wenn das Demonstrativum dem Kopf-Substantiv folgt, folgt auch der Relativsatz dem Kopf-Substantiv. Man erkennt leicht, dass jedes der strukturellen Merkmale (Parameter) hier zwei Werte hat: NDem bzw. DemN; NRel bzw. RelN. Es ergibt sich: Folie 27d NDem NRel möglich DemN NRel möglich NDem RelN unmöglich DemN RelN möglich NDem DemN tetrachorische Tafel: NRel x x RelN – x 30 Folie 28 allgemeine Form eines einfachen implikativen Universales: Folie 28 ∀L (P(L) → Q(L)) 'Für alle Sprachen gilt: Wenn eine Sprache L das strukturelle Merkmal P hat, dann hat sie auch das strukturelle Merkmal Q' Beispiel: ∀L (NDem(L) → NRel(L)) Implikative Universalien haben die logische Form eines Konditionals (einer wenn-dannBeziehung, logische Implikation). Wahrheitstafel: NDem(L) NRel(L) (NDem(L) → NRel(L)) W W W F W W W F F F F W Typisch für ein implikatives Universale, ist somit, dass von den vier möglichen Konstellationen (Wahrheitswerten) nur eine nicht belegt ist. Es gibt auch sozusagen eine Verstärkung dieser Beziehung. In der Logik nennt man sie Bikonditional (oder auch logische Äquivalenz). Folie 29 Beispiel (Greenbergs Universale 2): • In Sprachen mit Präpositionen folgt der Genitiv fast immer dem Kopf-Substantiv nach, während er in Sprachen mit Postpositionen fast immer vorausgeht. tetrachorische Tafel: Präp Post NGen x – GenN – x 31 Wahrheitstafel: Präp(L) NGen(L) Präp(L)↔NGen(L) W W W W F F F W F F F W An der tetrachorischen Tafel für ein implikatives Universale (1 Leerstelle) kann man zwei Eigenschaften ablesen (so schon Greenberg) Folie 30 Dominanz: Dominant ist der Wert des strukturellen Merkmals, der mit beiden Werten des anderen strukturellen Merkmals kombiniert werden kann. Rezessiv ist derjenige Wert, der nur mit einem der beiden Werte des anderen Merkmals kombiniert werden kann. Dominant sind im Beispiel DemN und NRel. Rezessiv sind: NDem und RelN. Dominante Werte sind diejenigen, die präferiert/vorzugsweise vorkommen. Harmonie: Harmonisch ist der Wert eines Parameters mit einem Wert des anderen P.s, wenn er nur mit diesem Wert des anderen P. vorkommt, und nicht mit dem anderen Wert. RelN ist harmonisch mit DemN, NDem ist harmonisch mit NRel. Harmonie ist immer bezüglich der rezessiven Werte definiert. Mithilfe von Dominanz und Harmonie können die Wortstellungsuniversalien, die Greenberg und Hawkins formulieren, in eine Ordnung gebracht werden: Zur Folie 31: Croft, S.56 Dieses Schaubild zeigt (in der linken Spalte) das Dominanz-Muster, und außerdem zwei Harmonie-Muster, das erste das OV-Muster, das zweite das VO-Muster. Wir kommen ggf. noch darauf zurück, wenn wir uns mit dem Dt. und anderen europäischen Sprachen befassen. Implikative Universalien sagen etwas über die Möglichkeiten und Grenzen der Sprachvariation, während uneingeschränkte Universalien etwas über die Einheitlichkeit/Uniformität von Sprachen sagen. Implikative Unversalien beschreiben Abhängigkeiten zwischen mindestens zwei unabhängigen Parametern. 32 allgemeine Form eines komplexen implikativen Universales: ∀L (P1 * ... *Pn) → (Q1 * ... *Qm) mit '*' für beliebige aussagenlogische Verknüpfungen und Pi, Qi (1 ≤ i ≤ n, m) für beliebige strukturelle Merkmale bzw. implikative Universalien Beispiel: ∀L (SOV(L) → (AN(L) →GN(L))) 'Für alle Sprachen gilt: Wenn eine Sprache L 'Subjekt-Objekt-Verb' als dominante Stellungsfolge hat, dann geht, wenn das attributive Adjektiv dem Nomen vorausgeht, auch der attributive Genitiv dem Nomen voraus' (Hawkins 1983, S. 64). Mithilfe komplexer implikativer Universalien können Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen strukturellen Merkmalen hergestellt werden. Solche Zusammenhänge können sich auf eine grammatische Domäne beziehen (wie hier die Wortstellung), sie können aber auch auf unterschiedliche grammatische Domänen beziehen, wie etwa Wortstellung und Kasusmarkierung usw. In manchen Fällen haben solche Zusammenhänge, wie bereits angedeutet, nicht den abgesicherten Status logischer Implikationen, sondern eher den von statistischen Wahrscheinlichkeiten. Etwa wenn es um einen Zusammenhang zwischen Grundform- und Stammformflexion geht. Sprachen mit Grundformflexion neigen zu Agglutination, Sprachen mit Stammflexion neigen zu Fusion. In anderen Fällen hingegen können implikative Beziehungen zwischen Kategorien auch die komplexe Form sog. "implicational maps" annehmen. Ich erläutere dies im Anschluss an Haspelmath 1997 an den Indefinitpronomina. Bei Indefinitpronomina kann man eine Reihe unterschiedlicher Verwendungen beobachten, z. B. die spezifische Referenz gegenüber der unspezifischen, die Verwendung in sog. negativen Polaritätskontexten usw. Es gibt jedoch universal gültige Beschränkungen für die Verteilung von Klassen von Indefinita auf die einzelnen semantischen Typen, die in Haspelmath 1997, S. 4/59 ff. durch folgende ImplikationsStruktur ("implicational map") erfasst werden (zur Folie 32). 33 Folie 33 Typen indefiniter Referenz [1] spezifisch, Referent ist dem Sprecher bekannt Somebody called while you were away: guess who! Bei spezifischer indefiniter Referenz setzt der Sprecher die Existenz und Identifizierbarkeit des Referenten voraus; in Fall [1] ist die Identität des Referenten dem Sprecher auch bekannt. [2] spezifisch, Referent ist dem Sprecher nicht bekannt I heard something, but I couldn' t tell what kind of sound it was. Das als existent und identifizierbar vorausgesetzte Referenzobjekt ist dem Sprecher nicht bekannt. [3] nicht-spezifisch, Irrealis-Kontext Please try somewhere else. He wants to marry someone nice. Fälle [3] - [9]: Die Existenz und Identifizierbarkeit eines Referenten wird nicht vorausgesetzt. [4] Entscheidungsfrage Did anybody tell you anything about it? [5] Konditionalsatz (Antezedens) If you see anything, tell me immediately. [6] indirekte Negation I don't think that anybody knows the answer. [7] direkte Negation Nobody knows the answer. [8] Vergleichsstandard In Freiburg the weather is nicer than anywhere in Germany. [9] Zufallswahl Anybody can solve this simple problem. Die Implikationsstruktur formuliert implikative Universalien über die Indefinitpronomina in Form einer geometrischen Figur: Sie besagt, dass ein Indefinitpronomen, das die Funktionen a und b, z.B. Funktion [1] und Funktion [4], hat, auch alle Funktionen, die in der Struktur zwischen a und b liegen, haben muss, also im Beispiel die Funktionen [2] und [3]. Indefinitpronomina einer bestimmten Gruppe ("Serie", vgl. unten) decken demzufolge immer einen zusammenhängenden Bereich der Implikationsstruktur ab, nicht etwa inkohärente Bereiche. So deckt die morphologisch manifesteste deutsche Indefinitserie, die irgend-Serie, den kohären- 34 ten Bereich der Funktionen [2] bis [8] ab, die englische any-Serie den kohärenten Bereich der Funktionen [4] bis [9] usw. 3.5. Markiertheit Das Konzept der Markiertheit stammt aus der Prager Schule (Trubetzkoy schon in 30er Jahren: Phonologie Jakobson: Morphosyntax). Sowohl generative als auch typologische Ansätze bauen in ganz unterschiedlicher Weise darauf auf. Bei dem typologischen Konzept handelt es sich um eine paarweise asymmetrische Beziehung zwischen Kategorien, die in paradigmatischer Beziehung zueinander stehen (Kategorien zu einer Kategorisierung). Allgemein kann man sagen: Die unmarkierte Kategorie ist die allgemeine, die markierte Kategorie die besondere. Diese Asymmetrie verbindet Markiertheit mit den Universalien (vgl. Dominanz versus Rezessivität) und auch mit den Hierarchien. Folie 34 Beispiel die Numeruskategorien Singular und Plural. Formulierung als implikatives Universale: • Wenn in einer Sprache der Singular durch (mindestens) ein spezifisches Morphem ausge- drückt wird, wird auch der Plural durch (mindestens) ein spezifisches Morphem ausgedrückt. (Version a) oder: • Wenn in einer Sprache der Plural durch das Nicht-Vorhandensein eines spezifischen Mor- phems ausgedrückt wird, wird auch der Singular durch das Nicht-Vorhandensein eines spezifischen Morphems ausgedrückt. (Version b) Resultat: Plural ist die markierte Kategorie zur Kategorisierung Numerus, Singular ist die unmarkierte. tetrachorische Tafel: Singularmorphem vorhanden nicht Singularmorphem vorhanden Pluralmorphem vorhanden x (Englisch) x (Litauisch) Pluralmorphem nicht vorhanden x (Mandarin) – 35 Generelle Formulierung der Markiertheitsverhältnisse grammatischer Kategorien durch ein implikatives Universale: • Wenn die markierte Kategorie durch das Nicht-Vorhandensein eines Morphems ausge- drückt wird, wird auch die unmarkierte Kategorie so ausgedrückt. Folie 35 Kriterien für Markiertheit (nach Croft 1990, zurückgehend auf Greenberg): • strukturelles Kriterium: Die markierte Kategorie einer grammatischen Kategorisierung wird durch mindestens ebenso viele Morpheme ausgedrückt wie die unmarkierte. Singular unmarkierte Numeruskategorie, Plural markierte, Aktiv unmarkierte Genus-verbiKategorie, Passiv markierte • Flexionsverhalten: Wenn die markierte Kategorie eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Formen in einem Flexionsparadigma hat, hat die unmarkierte mindestens ebenso viele. Plural der Personalpronomina 3. Person häufig (in germanischen und slavischen Sprachen) keine Genusunterscheidung, weniger Formen, also Plural markierter • distributionelles Verhalten: Wenn die markierte Kategorie in einer bestimmten Anzahl unterschiedlicher grammatischer Kontexte (Konstruktionstypen) vorkommt, kommt die unmarkierte in mindestens eben diesen Kontexten vor. Präsens unmarkiert, Futur markiert; maskuline Personenbezeichnungen unmarkiert, movierte Feminina markiert • sprachübergreifendes Verhalten: Wenn die markierte Kategorie in einer bestimmten Anzahl unterschiedlicher Sprachtypen vorkommt, kommt die unmarkierte Kategorie in mindestens eben diesen Sprachtypen vor. Plural gegenüber Dual unmarkiert • Frequenz (sprachvergleichend und textbezogen): Die unmarkierte Kategorie kommt mindes- tens ebenso häufig vor wie die markierte. sprachvergleichend: Die unmarkierte Kategorie kommt in mindestens ebenso vielen Sprachen (in einem gegebenen sample) vor wie die markierte. DemN ist dominant, d.h. unmarkiert gegenüber NDem. Dem N ist insgesamt (auch in sehr großen samples) häufiger als Ndem. textbezogen: Die unmarkierte Kategorie kommt mindestens ebenso häufig in einem gegebenen Textkorpus vor wie die markierte. Welches Textkorpus: informeller Stil, am besten mündliche Erzählungen: Passiv eindeutig seltener als Aktiv.