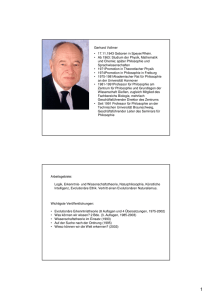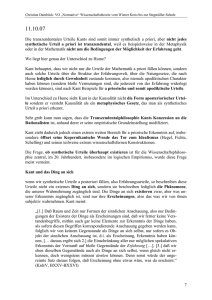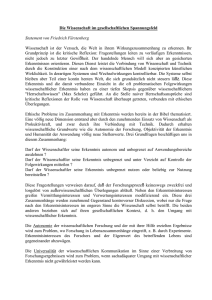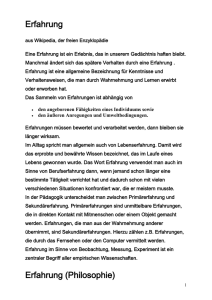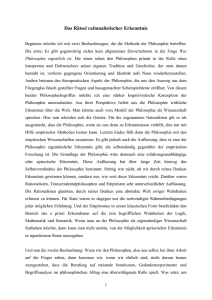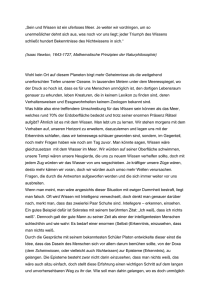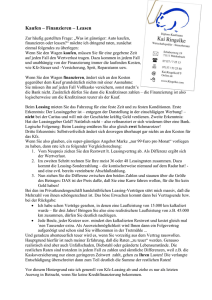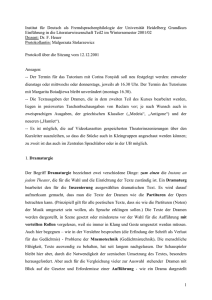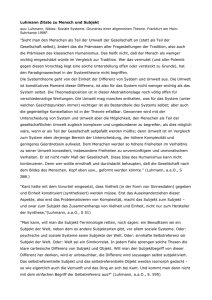Gibt es Erkenntnis aus reiner Vernunft?
Werbung

Gibt es Erkenntnis aus reiner Vernunft? Probleme und Perspektiven Die Frage, ob wir durch bloßes Nachdenken, ganz unabhängig von jeder sinnlichen Wahrnehmung, oder – wie man auch zu sagen pflegt – rein a priori die Welt erkennen können, gehört seit alters her zu den Grundfragen der Philosophie, weil mit ihr auch die Philosophie selbst auf dem Spiel zu stehen scheint. Betrachtet man die Geschichte der Philosophie filmtechnisch gesprochen aus der Totale, dann waren sich bis vor kurzem nahezu alle ihre Vertreter darin einig, dass die Philosophie zumindest zu einem ganz wesentlichen Teil durch ihre apriorische Methode ausgezeichnet ist. Diese Behauptung mag Sie zunächst vielleicht überraschen, denn schließlich gab es neben Rationalisten immer auch Empiristen, und zwar nicht erst seit Beginn der Neuzeit. Aber wenn man sich das explizite Selbstverständnis der Philosophen ansieht, dann haben eben auch, und zwar ganz dezidiert, die Empiristen (insbesondere in der Phase des Logischen Empirismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts) stets aufs Neue betont, dass die Philosophie eine apriorische Wissenschaft ist, auch wenn sich für sie der Umfang apriorischen Wissens auf die Logik (einschließlich der Mathematik) und die Semantik beschränkt, und sie deshalb die Philosophie nur in einer Art Schwundform betrieben haben. Aus der Perspektive nicht weniger Erfahrungswissenschaftler und so genannter Alltagsmenschen, die sich immer wieder auf das schwankende und unübersichtliche Meer der Empirie hinausbegeben müssen, um etwas über die Welt zu erfahren, verhält es sich dagegen mit dem apriorischen Erkenntnisanspruch der Philosophie, wie moderat und vorsichtig er auch immer formuliert sein mag, ähnlich wie mit demjenigen, der die Welt zu kennen glaubt, ohne je seinen Fuß vor die eigene Haustür gesetzt zu haben – es handelt sich um einen hoffnungslosen Fall. Es ist der erst kürzlich verstorbene amerikanische Philosoph W.V.O. Quine gewesen, der das herkömmliche Verständnis der Philosophie als apriorischer Wissenschaft mit kraftvollen Argumenten und nachhaltiger Wirkung zerstört hat. Aus seiner Sicht hat jede Wissenschaft – eben auch die Philosophie, die Logik, die Mathematik und die Semantik – den Status einer empirischen Theorie, die sich an der Erfahrung bewähren muss und gegebenenfalls auch durch sie widerlegt werden kann. Diese Radikalisierung des Empirismus hat zu einer Aufhebung der Grenzen zwischen der Philosophie und den Naturwissenschaften geführt und mündet in Quines Projekt einer Naturalisierung der Philosophie, nach der Philosophie und Naturwissenschaften in letzter Konsequenz einfach zusammenfallen. Quines naturalistische 1 Revolution des Philosophieverständnisses hat zumindest in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine ungeheure Wirkung ausgeübt. Auch wenn nicht jeder Quines Argumenten gegen die Möglichkeit apriorischer Erkenntnis sofort zustimmte, kamen die Anhänger einer solchen Erkenntnis doch unter starken Druck, und zwar selbst diejenigen, die als gemäßigte Empiristen nur am apriorischen Status der Logik und der Semantik festhalten wollten. Vor allem im Kontext der analytischen Philosophie wurde Quines Methodenverständnis der Philosophie weithin beherrschend. Interessanterweise haben die Philosophen jedoch, selbst wenn sie Quines Kritik am Apriori offiziell zustimmten, in der Praxis weiterhin dieselben Methoden angewandt wie zuvor. So spielt die apriorische Begriffsanalyse in der Erkenntnistheorie (beispielsweise im Zusammenhang mit der Klärung dessen, was Wissen oder Wahrheit ist) oder in der Philosophie des Geistes (etwa bei der Klärung der Natur des Geistigen oder in den Debatten über die Kompatibilität von Freiheit und Determinismus) weiterhin eine prominente Rolle. Das ließe sich, wenn ich mehr Zeit hätte, paradoxerweise sogar für Quine selbst und seinen bekanntesten Schüler, Davidson, zeigen. Seit einigen Jahren lässt sich nun im Bereich der analytischen Philosophie eine gewisse Trendwende, nämlich die Renaissance des Apriori beobachten, und zwar nicht nur in Form eines gemäßigten Empirismus mit Sinn für rein intellektuelle Erkenntnis im Bereich der Logik und Semantik, sondern als Rückkehr eines Rationalismus in durchaus klassischer Form.1 In meinem Vortrag möchte ich die Probleme und Perspektiven eines solchen Rationalismus in neuem Gewand ausloten. Ich werde zunächst – im ersten Teil – einen Vorschlag machen, wie man apriorische Erkenntnis aus reiner Vernunft auffassen sollte und wie nicht. Ich möchte dabei zeigen, dass und warum die transzendentalphilosophische Grundlegung des Apriori durch Kant letztlich nicht überzeugen kann. Und ich möchte auch dafür argumentieren, dass apriorische Erkenntnis nicht die Rolle eines letzten Fundaments aller Erkenntnis übernehmen kann, sondern aus anderen Gründen relevant für unser kognitives Bild der Welt ist. In einem zweiten Teil werde ich meine Konzeption apriorischer Erkenntnis in Auseinandersetzung mit einer Reihe von Einwänden präzisieren und zu verteidigen versuchen. I 1 Ich möchte hier nur – stellvertretend für andere – George Bealer, Laurence BonJour, Frank Jackson, Christopher Peacocke und Ernest Sosa nennen. 2 Der klassische Rationalismus (etwa bei Leibniz und Wolff) lässt sich durch die vier folgenden Thesen charakterisieren: Erstens gibt es eine erfahrungsunabhängige Quelle der Rechtfertigung, nämlich die rationale Intuition (R 1). Zweitens liefert uns die rationale Intuition Wissen über notwendige Tatsachen (R 2).2 Drittens wird der Gegenstandsbereich apriorischen Wissens in einem realistischen Sinne verstanden – die Tatsachen, von denen dieses Wissen handelt, sind also objektiv und vom Subjekt unabhängig (R 3). So sagt Descartes in der „Fünften Meditation“ beispielsweise mit Bezug auf Tatsachen der Geometrie im platonischen Geiste: „Wenn ich mir (…) ein Dreieck bildlich vorstelle, so mag vielleicht eine solche Figur nirgends in der Welt außer meinem Bewusstsein existieren, noch je existiert haben, dennoch hat sie fürwahr eine bestimmte Natur oder Wesenheit oder Form, die unveränderlich und ewig ist, die weder von mir ausgedacht ist, noch von meinem Denken abhängt.“ Und viertens beruhen die rationalen Intuitionen auf einer Einsicht in das Verhältnis der beteiligten Begriffe – es handelt sich also in moderner Terminologie um eine analytische Erkenntnis (R 4). Die Empiristen haben insbesondere an zwei dieser Thesen Anstoß genommen. Für sie ist es vollkommen unerklärlich, wie wir durch reines Denken (also durch rationale Intuition) eine unabhängig von diesem Denken existierende Welt erkennen können. Denn anders als bei der sinnlichen Erfahrung gibt es keinerlei kausale Einwirkung der Realität möglicher Weltverläufe auf unser Denken. Nur was aktual ist, kann auch wirksam sein. Es bleibt also in der Konzeption des Rationalisten rätselhaft, warum die Resultate unseres Denkens mit der Wirklichkeit übereinstimmen sollten. Und zweitens können wir durch Begriffsanalyse nichts über die Welt erkennen, sondern nur etwas über das Verhältnis unserer mentalen Begriffe oder das Verhältnis der Bedeutungen der Wörter unserer Sprache. Gemäßigte Empiristen können aber sehr gut mit den ersten beiden Thesen des Rationalismus leben, nämlich dass wir notwendige Wahrheiten a priori erkennen können, nur verstehen sie diese Wahrheiten eben als rein begrifflich oder linguistisch. Kant gibt dieser empiristischen Kritik am klassischen Rationalismus zwar grundsätzlich Recht, versucht aber, die Möglichkeit apriorischer Erkenntnis der Welt gleichwohl 2 Descartes weicht von dieser Konzeption des klassischen Rationalismus ab, insofern seine klaren und deutlichen Vorstellungen (die rationalen Intuitionen) auch Aussagen über kontingente Wahrheiten rechtfertigen, beispielsweise über die eigene Existenz oder die Existenz eigener mentaler Zustände. Solche Aussagen sind vielleicht im cartesianischen Sinne evident und gewiss, aber sicherlich nicht notwendig, denn ich und meine mentalen Zuständen hätten auch nicht existieren können, selbst wenn es unzweifelbar gewiss ist, dass ich jetzt existiere und gerade die besagten mentalen Zustände habe. 3 transzendentalphilosophisch zu retten. Die a priori erkennbare Welt ist nach Kant gerade nicht vollkommen unabhängig vom Denken, sondern durch eben dieses Denken teilweise konstitutiert, so dass wir am Ende von den Dingen in der Welt „nur das a priori erkennen, was wir selbst in sie legen.“ (B XVIII) Kants These, dass die formale Struktur der Welt durch unser Denken konstituiert und konstruiert wird, ist der transzendentale Idealismus. Wenn die Welt durch unser eigenes Denken geformt wird, dann können wir natürlich mittels der Strukturen dieses Denkens die Struktur der Welt erkennen. Aber diese Erklärung hängt eben entscheidend von der idealistischen Annahme ab, dass die Grundstruktur der Welt von unserem Denken abhängt. Auch dem zweiten Einwand der Empiristen gegen den klassischen Rationalismus trägt Kant Rechnung. Wir können durch bloße Begriffsanalyse die Welt nicht erkennen. Analytische Sätze verraten uns nichts über diese Welt; es handelt sich um bloße Erläuterungsurteile. Wenn wir also eine apriorische Erkenntnis der Welt verteidigen wollen, dann muss es sich um eine synthetische Erkenntnis a priori handeln. Kants Rettungsversuch apriorischer Erkenntnis über die Welt beruht auf einer Kombination aus transzendentalem Idealismus und einem Plädoyer für den synthetischen Charakter des Apriori. Sehen wir uns zunächst Kants transzendentalen Idealismus an. Im Grunde besagt er nichts anderes, als dass die Welt, die wir in unseren alltäglichen oder wissenschaftlichen Aussagen meinen, ein durch intersubjektiv übereinstimmende Denkstrukturen geformtes Ensemble unserer eigenen mentalen Zustände ist. Bei Kant heißt es: „Nun sind aber äußere Gegenstände (Körper) bloß Erscheinungen, mithin auch nichts anders, als eine Art meiner Vorstellungen, deren Gegenstände nur durch diese Vorstellungen etwas sind, von ihnen abgesondert aber nichts sein.“ (A 370) Diese Reduktionsthese lässt sich jedoch m.E. nicht begründen. Sie entspricht nicht unserem realistischen Verständnis der Bedeutung unserer eigenen Aussagen, wonach die Außenwelt und ihre Eigenschaften gerade vom Subjekt unabhängig ist. Und sie folgt auch nicht aus der Einsicht, dass alle Gegenstände meiner Vorstellung von mir vorgestellt werden müssen. Denn es ist nicht zu sehen, warum ich nicht etwas vorstellen kann, was auch von dieser Vorstellung unabhängig existieren würde. M.E. beruht der transzendentale Idealismus letztlich auf dem repräsentationalistischen Bild des Geistes, wonach dieser unmittelbar auf nichts anderes als seine eigenen inneren Zustände bezogen ist. Doch dieser Repräsentationalismus ist heute zumindest fragwürdig geworden. Ich möchte nun Ihr Augenmerk auf den anderen Aspekt in Kants transzendentaler Begründung des Apriori lenken. Kant möchte beweisen, dass wir synthetische Erkenntnisse a 4 priori über die Welt haben. Dabei lässt er sich von dem folgenden Grundgedanken leiten: Die unmittelbare Annahme synthetischer Erkenntnis a priori wäre dogmatisch. Um die Möglichkeit solcher Erkenntnis sicher zu stellen, muss stattdessen gezeigt werden, dass der Weltbezug der Erfahrung, den ja auch der Empirist einräumen muss, nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt möglich ist, oder genauer, dass der Weltbezug unserer Erfahrung den erfahrbaren Objekten bestimmte apriorische Bedingungen auferlegt, von denen wir deshalb a priori wissen können, dass die Objekte unserer Erfahrung sie erfüllen. Apriorische Erkenntnis über die Welt soll also auf dem Umweg über die Erkenntnis der apriorischen Bedingungen unserer intentionalen Bezugnahme auf die Welt bewiesen werden. Damit wird etwas Problematisches (apriorische Erkenntnis über die Welt) auf etwas scheinbar Unproblematisches (die Erkenntnis apriorischer Bedingungen des Weltbezugs) zurückgeführt. Aber sieht man genauer hin, dann greift Kants Beweis auf genau die Art von Erkenntnis zurück, die er eigentlich erst beweisen soll. Zum einen müssen die Prämissen eines Beweises synthetischer Erkenntnis a priori selber synthetische Erkenntnis a priori enthalten. Zum anderen müssen diese Prämissen auch etwas über die Welt aussagen, wenn durch den Beweis synthetische Erkenntnis a priori über die Welt begründet werden soll. Und das tun sie auch. Kant muss nämlich zeigen, dass die Objekte der Erfahrung selbst bestimmte Eigenschaften haben müssen, um für uns erfahrbar zu sein. Und das ist selbst auch eine Erkenntnis über die Welt. Das Problem der Kantischen Beweisstrategie liegt also darin, dass sein Beweis der Möglichkeit synthetischer Erkenntnis a priori über die Welt genau diese Art von Erkenntnis bereits voraussetzen muss und deshalb zirkulär ist. Ich möchte somit folgendes Ergebnis festhalten: Kants Verteidigung der Möglichkeit apriorischer Erkenntnis über die Welt überzeugt nicht wirklich, weil sein transzendentaler Idealismus mit unseren semantischen Intuitionen über die Bedeutung unserer Aussagen über die Welt in Konflikt gerät und weil seine transzendentale Grundlegung apriorischer Erkenntnis sich am Ende in einen Zirkel verwickelt. Ich komme zu einer weiteren Abgrenzung. Seit alters her wurden der apriorischen Vernunfterkenntnis zwei sehr unterschiedliche Funktionen zugeschrieben. Zum einen sah man in ihr ein letztes (d.h. nicht weiter begründungsbedürftiges), voraussetzungsloses Wissen, dass als autonome Basis oder als Fundament allen anderen Wissens dienen konnte. Dieser Gedanke liegt Platos Liniengleichnis zugrunde, er steht aber auch hinter Descartes’ erkenntnistheoretischem Fundamentalismus, wurde in der Grundsatzdiskussion des Deutschen Idealismus verfolgt und mit der Idee einer Letztbegründung von Karl-Otto Apel in der 5 Gegenwart wieder aufgegriffen. Hier kommen prinzipiell zwei Möglichkeiten in Betracht. Entweder alles Wissen wird aus einem rationalistischen Prinzip abgeleitet (dann gibt es streng genommen gar kein empirisches Wissen) oder die Erfahrung allein wird als unzureichend betrachtet, um den Aufbau unseres gesamten Wissens zu ermöglichen, dazu sind weitere Brückenprinzipien erforderlich, die a priori begründet sein müssen. Die zweite Alternative lässt Raum für empirisches Wissen, macht es jedoch abhängig von rationalistischen Prinzipien. Descartes ist beispielsweise der Auffassung, dass der Schluss von unseren Sinneserfahrungen auf die Außenwelt durch den rationalistischen Beweis eines wohlwollenden Gottes ohne betrügerische Absichten gestützt werden muss. Und Kant hat deutlich gesehen, dass sowohl kausale als auch streng allgemeine Gesetzesaussagen über den Inhalt der Sinneswahrnehmung hinausgehen. Wenn wir diese Aussagen dennoch auf die Wahrnehmung stützen, dann bedarf dieser gehaltserweiternde Schluss nach Kant einer zusätzlichen apriorischen Begründung. Neben dieser wissensfundierenden Rolle hat man der Vernunfterkenntnis jedoch auch noch eine ganz andere Aufgabe zugesprochen. Danach ermöglicht uns die Vernunft einen Blick hinter den Schleier der Oberflächeneigenschaften der Dinge, direkt ins Wesen, in die Essenz der Dinge. Apriorische Erkenntnis wäre demnach die Methode der Metaphysik (wenn wir diese als Ontologie verstehen). Auch für diese Idee hat natürlich Platon Pate gestanden mit seinen ti-estin-Fragen danach, was Tugend, was Wissen oder was Gerechtigkeit eigentlich ist. Fragen, die er eben nicht für empirisch beantwortbar hielt, sondern nur durch erfahrungsunabhängige Anamnesis. Die rationalistische Methode der Metaphysik verschwand jedoch spätestens mit Kants Metaphysikkritik. Historisch sind beide Funktionen apriorischer Erkenntnis – also als Wissensbegründung und als Methode der Metaphysik – oftmals Allianzen eingegangen, etwa bei Leibniz und Wolff. Systematisch betrachtet gibt es jedoch einen schwerwiegenden und m.E. entscheidenden Einwand gegen die Idee der apriorischen Wissensbegründung, den ich etwas ausführlicher entwickeln möchte. In unseren alltäglichen und wissenschaftlichen Aussagen stützen wir uns in der Regel auf empirische Gründe, also auf Sinneserfahrungen. Nun geht der Gehalt unserer Aussagen aber in vielen, um nicht zu sagen allen, Fällen über den Gehalt unserer Erfahrungen hinaus. Wir sehen nur einen Aspekt (beispielsweise die Vorderseite) eines Dinges, behaupten aber, dass das ganze Ding da ist. Wir sehen nur, was sich aktual ereignet, behaupten aber, dass sich bestimmte kausale Abläufe abspielen, und das impliziert Aussagen über etwas, was 6 geschehen muss, - etwas, was wir offensichtlich nicht sehen können. Schließlich sehen wir immer nur einzelne Dinge oder Ensembles von einzelnen Dingen, niemals aber alles. Dennoch stützen wir auf die Erfahrung Theorien, die allgemeine Gesetzesaussagen beinhalten. Ein überwiegender Teil unseres empirisch gestützten Wissens beruht also auf gehaltserweiternden (nicht-deduktiven) Schlüssen. Das Problem solcher Schlüsse besteht darin, dass die Wahrheit der Prämissen (in diesem Fall die Sinneserfahrung) die Wahrheit der Konklusion nicht erzwingt. Es mag zwar sein, dass unsere nicht-deduktiven Methoden des empirischen Wissenserwerbs tatsächlich zuverlässig zur Wahrheit führen, aber wir wollen eben zusätzlich auch noch Gründe dafür haben, dass die Methoden zuverlässig sind. Doch es liegt in der Natur der Sache, dass die Zuverlässigkeit erfahrungstranszendierender Schlüsse nicht mehr durch die Erfahrung begründet werden kann. Eine apriorische Begründung dieser Schlussverfahren scheint also unabdingbar. Doch wenn wir die Anforderung ernst nehmen, dass wir uns auf epistemische Methoden (in diesem Fall nicht-deduktive Schlussverfahren) nur dann verlassen dürfen, wenn wir mit Hilfe unabhängiger Gründe ihre Zuverlässigkeit einsehen, dann müssen wir das auch auf die Methode apriorischer Rechtfertigung selbst anwenden. Wir dürfen uns also auf rationale Intuitionen über modale Tatsachen nur dann verlassen, wenn wir mit Hilfe unabhängiger Gründe einsehen, dass sie die modale Wirklichkeit zuverlässig wiedergeben. Daraus folgt jedoch unmittelbar, dass auch die apriorischen Gründe keine letzte Quelle epistemischer Autorität sein können. Es ergibt sich das folgende Dilemma: Wenn die Methoden empirischen Wissenserwerbs nicht autonom sind, sondern einer unabhängigen Begründung bedürfen, dann gilt das auch für die Methoden apriorischen Wissenserwerbs und alle weiteren Methoden. In diesem Fall ist also eine Fundierung unseres empirischen Wissens unmöglich. Wenn andererseits die Methoden apriorischen Wissenserwerbs autonom sind (also keiner unabhängigen Begründung mehr bedürfen), dann gilt dasselbe auch für die empirischen Methoden. In diesem Fall ist eine Fundierung unseres empirischen Wissens unnötig. Es gibt im Grunde nur eine einzige Möglichkeit, skeptische Konsequenzen zu vermeiden – wir müssen die Anforderung aufgeben, dass wir uns nur auf Methoden stützen dürfen, deren Zuverlässigkeit wir mit Hilfe unabhängiger Gründe einsehen können. Diesen Weg beschreitet der erkenntnistheoretische Externalismus. Danach reicht die tatsächliche Zuverlässigkeit einer Methode aus, um ihr Rechtfertigungskraft zu geben. Eine weitere Begründung dieser Zuverlässigkeit ist nicht erforderlich. Doch wenn wir den externalistischen Weg beschreiten, dann erweist sich das ganze Projekt einer apriorischen Wissensbegründung als überflüssig. In 7 diesem Fall hängt die rechtfertigende Kraft der Erkenntnisquellen allein von ihnen selbst ab, nämlich davon, ob sie de facto zuverlässig sind oder nicht. Welche Konsequenzen ergeben sich aus den bisherigen Überlegungen? Ich habe zunächst dafür argumentiert, dass der Gegenstandsbereich apriorischer Rechtfertigung, wenn es sie denn überhaupt gibt, realistisch verstanden werden muss. Wir rechtfertigen mit Hilfe der reinen Vernunft Urteile über modale Tatsachen, die ontologisch unabhängig von unseren Strukturen des Denkens sind. Deshalb greift der transzendentalphilosophische Ansatz m.E. zu kurz, wenn er von der ontologischen Abhängigkeit der erkennbaren Realität ausgeht. Anschließend habe ich zu zeigen versucht, dass apriorische Erkenntnis nicht die Rolle eines absoluten Wissensfundaments übernehmen kann. Wenn Rechtfertigung aus reiner Vernunft autonom ist, dann ist es die empirische Rechtfertigung gleichermaßen. Erklären lässt sich beides nur durch einen externalistischen Ansatz in der Erkenntnistheorie. Sowohl apriorische als auch erfahrungsbasierte Rechtfertigungsverfahren haben ihre rechtfertigende Kraft allein deshalb, weil sie zuverlässig die Wahrheit indizieren. Doch wie sieht die Methode apriorischer Rechtfertigung konkret aus und welche Rolle spielt sie genauer? Ich möchte mich bei der Beantwortung dieser Frage heute auf die Methode und Funktion apriorischer Rechtfertigung innerhalb der Philosophie beschränken. Aus meiner Sicht bilden GEDANKENEXPERIMENTE die Basis apriorischer Rechtfertigung. Doch was ist ein Gedankenexperiment? Meines Erachtens versuchen wir Annahmen oder Hypothesen darüber zu bestätigen oder zu widerlegen, welche notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür bestehen, dass etwas (ein beliebiger Fall) ein X ist – ein Anwendungsfall eines bestimmten Begriffs wie etwa Wissen, Wahrheit, Geist, Gerechtigkeit usw. Wenn wir diese Bedingungen kennen, verstehen wir besser, was Wissen, Wahrheit, Geist usw. der Sache nach sind – wir gewinnen ein analytisches Verständnis der besagten Eigenschaft. Unsere Annahmen über notwendige und hinreichende Bedingungen für X überprüfen wir an unserer Bewertung kontrafaktischer Einzelfälle. Wenn wir uns einen bestimmten Fall ausdenken, dann erscheint er uns unwillkürlich als möglicher Anwendungsfall von X oder nicht. Darauf können wir zunächst unsere Urteile über das, was möglich ist, stützen und diese wiederum als Basis der Überprüfung von Hypothesen über notwendige Bedingungen nehmen. Was nämlich notwendig ist, muss von jedem möglichen Fall erfüllt sein. So übernimmt die intellektuelle Erscheinung möglicher Fälle bei der Rechtfertigung und Bestätigung von Urteilen über Notwendigkeit eine ähnliche Rolle wie die empirische Beobachtung bei der Rechtfertigung 8 und Bestätigung empirischer Theorien. Es handelt sich in beiden Fällen um eine induktive Rechtfertigung von Urteilen. In diesem Sinne ist der Begriff des Gedankenexperiments absolut treffend. Es handelt sich um ein Experiment, weil wir kontrollieren können, welche kontrafaktischen Fälle wir bewerten, genau wie wir durch den Versuchsaufbau kontrollieren können, was empirisch beobachtet wird. Aber in beiden Fällen – sowohl im empirischen als auch im Gedankenexperiment – stellt sich das Ergebnis des Experiments unwillkürlich und unkontrollierbar ein. Nur handelt es sich im einen Fall um empirische Experimente, die auf Sinneserfahrung beruhen, und im anderen Fall um intellektuelle Experimente, die auf rationaler Intuition beruhen. Ich möchte das Verfahren des Gedankenexperiments anhand eines Beispiels illustrieren. Seit Platons Überlegungen im Menon bis in die jüngste Vergangenheit galt die Annahme als gut begründet, dass Wissen gerechtfertigte wahre Meinung ist. Wenn wir Fälle von Wissen haben, dann handelt es sich notwendigerweise um gerechtfertigte wahre Meinungen. Und wenn wir Fälle von gerechtfertigter, wahrer Meinung haben, dann muss es sich um Wissen handeln. Alle rationalen Intuitionen bezüglich möglicher Fälle schienen genau das zu bestätigen bis Gettier kam. Edmund Gettier war Anfang der 60er Jahre ein junger, nicht besonders bekannter Nachwuchswisenschaftler an der renommierten amerikanischen Wayne State University, der ernsthaft um seine akademische Zukunft besorgt war. Er hatte zu wenig publiziert, um eine Lebenszeitstelle als Professor zu bekommen. Da fielen ihm, so die Legende, an einem Wochenende einige ungewöhnliche Fälle ein, die als Gegenbeispiele gegen die klassische Wissensdefinition geeignet waren. Seine Überlegungen wurden in einem eineinhalbseitigen Artikel veröffentlicht und führten im Nu zu einer Revolution in der Erkenntnistheorie. Gettier wurde über Nacht berühmt, bekam seine Lebenszeitstelle und hat nie mehr etwas Nennenswertes publiziert. Nachwuchswissenschaftler nur Eine noch Bilderbuchkarriere, träumen können. von Unter der Gettiers heutige neuer Versuchsanordnung ergaben sich plötzlich rationale Intuitionen, die nicht mit der klassischen Wissenskonzeption in Einklang gebracht werden konnten. In Bezug auf Situationen, in denen die Wahrheit einer gerechtfertigten Meinung zufällig eintritt, stellt sich nicht die Intuition ein, dass Wissen vorliegt. Stellen Sie sich folgenden Fall vor: Ich habe gerade eben nach meinem Haustürschlüssel in meiner Jackentasche gesucht und konnte ihn trotz intensiver Suche nicht finden. Ich muss wohl oder übel annehmen, dass ich ihn verloren habe, und bin zu dieser Annahme berechtigt. Wenn ich meinen Schlüssel verloren habe, dann gilt natürlich auch, dass jemand in diesem Saal seinen Schlüssel verloren hat. Ich bin also auch berechtigt, dies zu 9 glauben. Tatsächlich habe ich nicht genau genug nachgesehen, in irgendeinen Winkel meiner Jackentasche hat sich mein Schlüssel unbemerkt verkrochen. Doch jemand von Ihnen (vielleicht Herr Speer) hat seinen Schlüssel verloren und es noch gar nicht bemerkt. In diesem – hoffentlich kontrafaktischen - Fall ist meine Meinung, dass jemand in diesem Saal seinen Schlüssel verloren hat, wahr und berechtigt. Dennoch würde mir niemand Wissen zuschreiben, weil die Tatsache, die für die Wahrheit meiner Meinung verantwortlich ist, mit meinen Gründen für sie nur zufällig zusammenhängt. Andererseits stellt sich in Bezug auf Situationen, in denen eine nicht-zufällig wahre Meinung ohne Rechtfertigung vorliegt, überraschenderweise die Intuition ein, dass Wissen vorliegt. Damit wurde die klassische Konzeption des Wissens durch Gedankenexperimente Gettiers und seiner Nachfolger falsifiziert. Bleibt die zweite Frage nach der Funktion und Rolle der philosophischen Rechtfertigung durch reine Vernunft. Ich hatte gesagt, dass ich diese Rolle im Rahmen der Metaphysik sehe. Offensichtlich können wir empirisch sagen, was Anwendungsfälle eines Begriffs sind. Wir rechtfertigen ja mit Hilfe von Erfahrung Aussagen, die von Wissen, Wahrheit oder geistigen Zuständen handeln. Dafür brauchen wir die notwendigen und hinreichenden Bedingungen der Begriffsanwendung nicht explizit zu kennen. Insoweit ist dem späten Wittgenstein Recht zu geben, wir können Begriffe verwenden, ohne ein explizites Verständnis ihrer notwendigen und hinreichenden Bedingungen zu haben. Wir können die empirisch als Fälle von Wissen, Wahrheit oder geistigen Zuständen klassifizierten Gegenstände auch mittels der Erfahrung weiter untersuchen. Dennoch können wir die notwendigen und hinreichenden Bedingungen auch nicht aus der Erfahrung einfach abstrahieren. Eine Kenntnis dessen, was die in Rede stehende Sache eigentlich ist bzw. welcher Natur die betreffende Eigenschaft ist, wird von den empirischen Wissenschaften weder vorausgesetzt noch ist sie ein Resultat empirischer Forschung. Das ist Sache der Metaphysik, die sich – wenn ich Recht habe – apriorischer Methoden bedienen muss. Es beginnen sich die Umrisse einer Konzeption apriorischer Rechtfertigung abzuzeichnen, die dem Bild des klassischen Rationalismus ziemlich nahe kommen. Dieses Bild muss im Lichte der kantischen und nachkantischen Metaphysikkritik als eine Provokation erscheinen. Ich glaube dennoch, dass es in Grundzügen richtig ist. Im zweiten Teil meines Vortrags möchte ich den Versuch unternehmen, die von mir vorgeschlagene Konzeption apriorischer Rechtfertigung gegen Einwände zu verteidigen. 10 II Ein wichtiger Einwand gegen den Rationalismus besagt, dass alle Rechtfertigung fehlbar und (wenn Quine Recht hätte) sogar empirisch anfechtbar ist. Da eine apriorische Rechtfertigung Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit beansprucht, ist sie mit Fehlbarkeit oder gar empirischer Anfechtbarkeit unverträglich. Also gibt es keine apriorische Rechtfertigung. So lautet der Einwand. Sehen wir uns zunächst die These der universellen Fehlbarkeit und empirischen Anfechtbarkeit an. Ich halte diese These für sehr überzeugend. Denken Sie nur daran, dass selbst in den Disziplinen, die als Vorbilder eines Höchstmaßes an Gewissheit gelten, nämlich in der Logik und in der Mathematik, offenbar Erkenntnisfortschritt stattfindet (etwa im Übergang von der klassischen aristotelischen zur modernen Fregeschen Logik) und folglich Fehler nicht ausgeschlossen sind, ganz abgesehen davon, dass Rechenfehler in mathematischen und logischen Beweisen immer vorkommen können. Häufig wird der Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch als Beleg dafür angeführt, dass es zumindest einen unbezweifelbaren Satz gibt. Doch auch hier bin ich nicht völlig überzeugt. Denn können wir jemals absolut sicher sein, dass dieser Satz durch keine schwächere oder konkurrierende Alternative ersetzt werden kann? Seit Aristoteles wurde immer wieder der Versuch unternommen, den Satz als semantische Bedingung jeglicher Behauptung (also auch der Bestreitung des Satzes) oder jeder Form von Rationalität zu etablieren. Aber selbst wenn derjenige, der den Satz vom Widerspruch leugnet, seine Geltung zumindest für die eigene Behauptung anerkennen müsste, könnte er dennoch konsistent seine generelle Geltung bestreiten. Und was die Geltung des Widerspruchssatzes als Prinzip der Rationalität betrifft, so hat die parakonsistente Logik zeigen können, dass Rationalität auch unter eingeschränkter Zulassung von Widersprüchen möglich ist. Quine ist ja bekanntlich noch weiter gegangen und hat in seinem berühmten Aufsatz Two Dogmas of Empiricism behauptet, dass jeder Satz unter bestimmten Bedingungen durch Erfahrung widerlegbar sei. Um diese These zu rechtfertigen, könnte man darauf verweisen, dass die Axiome der newtonschen Physik und der euklidischen Geometrie, die Kant für apriori hielt, empirisch durch Einstein widerlegt wurden. Aber darauf wird üblicherweise entgegnet, dass das eben nur Einzelfälle seien, die nicht zeigen würden, dass alle Sätze, die als 11 a priori gerechtfertigt erscheinen, empirisch widerlegbar sind. Deshalb möchte ich ein allgemeines Argument für die These der empirischen Widerlegbarkeit präsentieren. Wenn es stimmt, dass nur solche Sätze a priori gerechtfertigt sind, die von notwendigen Tatsachen handeln, dann ist diese Rechtfertigung allein deshalb empirisch anfechtbar, weil etwas, das notwendig ist, auch in der aktualen Welt der Fall sein muss. Wenn wir also mit Hilfe rationaler Intuition ein Notwendigkeitsurteil rechtfertigen und es sich empirisch herausstellt, dass die Tatsachen davon abweichen, dann hätten wir einen empirischen Anfechtungsgrund. So etwas scheint im Prinzip immer möglich zu sein. Die Fehlbarkeit und empirische Anfechtbarkeit aller Rechtfertigung kann also kaum bestritten werden. Doch impliziert die Möglichkeit apriorischer Rechtfertigung tatsächlich, dass Unfehlbarkeit und empirische Unanfechtbarkeit vorliegen? Nur dann wäre der Nachweis der universellen Fallibilität und empirischen Anfechtbarkeit ein Einwand gegen die Möglichkeit apriorischer Rechtfertigung. Es gibt ein Argument für die Unfehlbarkeit apriorischer Rechtfertigung und ein davon abweichendes Argument für die empirische Unanfechtbarkeit apriorischer Rechtfertigung. Keines dieser Argumente ist jedoch überzeugend. Wie ist man auf die Idee gekommen, Unfehlbarkeit für apriorische Rechtfertigung zu verlangen? Man ist davon ausgegangen, dass es sich bei den apriori gerechtfertigten Urteilen um notwendige Urteile handelt. Notwendige Urteile sind jedoch gewiß und unbezweifelbar und folglich infallibel. So das Argument. Hier liegt jedoch eine Verwechselung zwischen dem Inhalt und dem erkenntnistheoretischen Status des Urteils vor. Apriori gerechtfertigte Urteile beziehen sich auf notwendige Tatsachen. Sie beanspruchen, in allen möglichen Welten wahr zu sein. Aber das heißt nur, dass diese Urteile in jeder Welt wahr sind, wenn sie wahr sind, und dass sie in jeder Welt falsch sind, wenn sie falsch sind. Das betrifft den metaphysischen Status der betreffenden Tatsachen. Etwas ganz anderes ist die Frage, wie stark unsere Gründe für ein Urteil sind. Wenn sie unfehlbare Gewissheit liefern, dann erzwingen die Gründe die Wahrheit des Urteils. Nun lässt sich leicht einsehen, dass inhaltliche Notwendigkeit und epistemische Unfehlbarkeit vollkommen unabhängig voneinander sind. Es gibt mathematische Sätze, wie Goldbachs Vermutung, dass sich jede gerade Zahl als Summe zweier Primzahlen darstellen lässt, von denen wir wissen, dass sie entweder notwendig wahr oder notwendig falsch sind (also in jedem Fall notwendig), auch wenn wir keinerlei zwingenden Beweis für ihre Wahrheit haben haben. Andererseits gibt es Urteile wie das cartesianische „Ich existiere denkend“, die unbestreitbar gewiss sind und dennoch von einer 12 kontingenten Tatsache handeln. Ich hätte zweifellos auch nicht existieren können, wenn meine Eltern den Wunsch gehabt hätten, keine Kinder zu bekommen, was glücklicherweise nicht der Fall war. Sollte es also definierend für die apriorische Rechtfertigung sein, dass sie Urteile über metaphysisch notwendige Sachverhalte stützt, dann folgt daraus keinesfalls, dass diese Rechtfertigung zwingend oder unfehlbar sein muss. Betrachten wir nun das Argument dafür, dass apriori gerechtfertigte Urteile nicht empirisch anfechtbar sein dürfen. Dahinter steht die Idee, dass apriorische Erkenntnis empirische Erkenntnis allererst fundiert. Wenn das tatsächlich der Fall wäre, dann könnte es keine empirischen Anfechtungsgründe apriori gerechtfertigter Urteile geben, denn diese Anfechtungsgründe würden so ihre eigene Legitimität, die ja von der Rechtfertigung apriori abhängt, unterminieren. Ich habe jedoch bereits Gründe genannt, die gegen die Idee einer apriorischen Letztbegründung empirischen Wissens sprechen. Auch ganz unabhängig davon ist jedoch klar, dass apriorische Rechtfertigung keinesfalls dadurch definiert sein kann, dass sie empirisches Wissen fundiert. Sie wird vielmehr durch ihre nicht-empirische (intellektuelle) Methode oder Quelle definiert. Und daraus folgt die Bedingung empirischer Unanfechtbarkeit nicht. Das lässt sich leicht einsehen. Wenn ich der Meinung bin, dass sich ein Exemplar der KrV bei mir im Büro befindet, dann ist diese Meinung dadurch gerechtfertigt, dass ich mich daran erinnere, sie vor einiger Zeit dort gesehen zu haben. Meine Meinung ist also durch Erinnerung gerechtfertigt. Nun ist es zweifellos möglich, dass ich das empirisch überprüfe, und es ist auch möglich, dass ich bei einer solchen Beobachtungsüberprüfung feststelle, dass meine Erinnerung mich getäuscht hat und sich meine KrV doch nicht im Büro befindet, sondern in meinem Arbeitszimmer bei mir zuhause. Durch Erinnerung gerechtfertigte Meinungen sind also im Prinzip durch Beobachtung anfechtbar. Aber solange ein solcher Anfechtungsgrund nicht tatsächlich vorliegt, bleibt meine Meinung durch Erinnerung gerechtfertigt. Analoges muss auch für die Rechtfertigung durch reine Vernunft gelten. Wenn ich auf sie eine Meinung stütze, dann ist sie a priori gerechtfertigt, auch wenn prinzipiell nicht ausgeschlossen werden kann, dass meine Rechtfertigung empirisch angefochten wird. Meine Antwort auf den ersten Einwand lautet also, dass es eine plausible Definition apriorischer Rechtfertigung gibt, die weder die Infallibilität noch die empirische Unanfechtbarkeit meiner rationalen Gründe impliziert. Die universelle Fehlbarkeit und die 13 generelle empirische Anfechtbarkeit aller Gründe werfen also kein grundsätzliches Problem für die Möglichkeit apriorischer Rechtfertigung auf. Es gibt jedoch einen zweiten Einwand gegen die Möglichkeit apriorischer Erkenntnis über die Welt, der vor allem von empiristischer Seite erhoben wird. Es mag sein, dass Methoden allein aufgrund ihrer tatsächlichen Zuverlässigkeit rechtfertigen können und dass in dieser Hinsicht empirische und apriorische Methoden gleichgut dastehen könnten. Dennoch pocht der Empirist darauf, dass eine prinzipielle Asymmetrie zwischen beiden Methoden besteht. Wir können nämlich erklären, warum die Sinneswahrnehmung eine zuverlässige Quelle von Erkenntnissen über unsere Umwelt ist. Die Umwelt drückt der Sinneswahrnehmung durch ihre kausale Einwirkung auf unsere Sinnesorgane einfach ihren Stempel auf. Und dass es dabei nicht zu allzu großen Verzerrungen kommt, wird durch die Evolution erklärt. Wir hätten als biologische Art nicht überlebt, wenn wir uns bei der Nahrungssuche und Fortpflanzung nicht zuverlässig mit Hilfe der Wahrnehmung in unserer Umwelt hätten orientieren können. Eine solche Erklärung der Zuverlässigkeit rationaler Intuition kann der Rationalist nur geben, wenn er – wie Kant – die notwendigen Tatsachen zum Produkt unserer Denktätigkeit macht. Ich habe jedoch schon auf die unplausiblen Konsequenzen eines solchen Idealismus hingewiesen. Für den Realisten bezüglich modaler Tatsachen ist die Zuverlässigkeit unserer rationalen Intuition dagegen „eine geheimnisvoll unerklärbare Tatsache“, wie Alfred Ayer es genannt hat.3 Kurz: ein vollkommenes Rätsel. Was in aller Welt könnte die Übereinstimmung unseres reinen Denkens mit einer von ihm völlig unabhängig existierenden Realität erklären? Notwendigkeiten und Möglichkeiten wirken auf unser Denken nicht kausal ein. Und es ist auch keine evolutionäre Erklärung der Zuverlässigkeit unserer modalen Erkenntnisansprüche in Sicht. Möglichkeiten und Notwendigkeiten sind nicht das Brot, das uns ernährt. Es besteht also – zumindest für den modalen Realisten – eine Erklärungslücke bezüglich der Zuverlässigkeit unserer rationalen Intuition. In dieser Hinsicht schneidet er entschieden schlechter ab als der Empirist, der die von ihm propagierten Erkenntnisse auch erklären kann. Doch selbst wenn man diese Asymmetrie einräumt, was ist so schlimm daran? Ich glaube, man kann sich schnell davon überzeugen, dass diese Asymmetrie verheerende Konsequenzen für den Rationalismus hat. Sobald man nämlich entdeckt, dass man die Zuverlässigkeit einer Erkenntnisquelle nicht erklären kann, raubt diese Entdeckung der Quelle ihre Legitimität.4 Denken Sie an folgendes Beispiel. Jemand vertraut auf die hellseherischen Fähigkeiten einer bestimmten Person, weil er festgestellt hat, dass diese Person wiederholt mit ihren Prognosen 3 4 Ayer, Sprache, Wahrheit und Logik, S. 95. Vgl. Field 1989, S. 232f. 14 über die Zukunft richtig gelegen hat. Sobald er sich jedoch klar macht, dass die Hellseherei im Rahmen unseres wissenschaftlichen Weltbildes keinerlei mögliche Erklärung findet, genügt das, um dieser Quelle trotz der bisherigen positiven Bilanz die Glaubwürdigkeit zu rauben. Dasselbe sollte für rationale Intuition gelten. Sobald wir gewahr werden, dass sie unerklärlich ist, verliert sie auch ihre Rechtfertigungskraft. Auf diesen Einwand kann der realistisch gesonnene Rationalist unterschiedlich reagieren. Er könnte versuchen, doch noch eine Erklärung für die Zuverlässigkeit rationaler Intuition zu finden. Diesen Versuch halte ich jedoch aus den bereits genannten Gründen für ziemlich aussichtslos. Ich glaube, man muss den Einwand anders parieren. Die besagte Erklärungslücke wirft meines Erachtens nur dann ein Problem für die Legitimität rationaler Intuition als Quelle der Rechtfertigung notwendiger Urteile auf, wenn sie ein Erklärungsdefizit benennt. Und ein solches Defizit liegt nur dann vor, wenn die Suche nach einer Erklärung im gegebenen Fall überhaupt Sinn macht. Genau das möchte ich aber bestreiten. Es liegt in der Logik der Erklärung, dass nur kontingente Tatsachen erklärt werden können. Wenn wir nach einer Erklärung eines Faktums suchen, dann wollen wir herausfinden, warum es sich so und nicht anders verhält. Wenn eine Tatsache jedoch notwendig ist, d.h. wenn es keine möglichen Alternativen zu ihr gibt, dann ist sie auch nicht erklärbar. Ich muss also nur nachweisen, dass rationale Intuitionen, wenn sie zuverlässige Quellen modaler Wahrheiten sind, notwendigerweise zuverlässig sind. In diesem Fall wäre die Zuverlässigkeit rationaler Intuitionen nicht einmal erklärungsbedürftig. Das Fehlen einer Erklärung wäre also auch kein Defizit. Der erforderliche Nachweis ist relativ einfach. Tatsächlich zuverlässige Belege könnten nur dann unzuverlässig sein, wenn die Tatsachen, von denen die auf sie gestützten Urteile handeln, anders wären, als sie es tatsächlich sind. Das ist bei kontingenten Tatsachen offensichtlich der Fall. Bei notwendigen oder möglichen Tatsachen ist es jedoch per definitionem ausgeschlossen. Beide sind notwendigerweise so wie sie sind. Die rationale Intuition ist also, wenn sie zuverlässig ist, notwendigerweise zuverlässig. Und deshalb ist die Suche nach einer Erklärung ihrer Zuverlässigkeit sinnlos. Der Empirist hat also zwar Recht mit seiner Behauptung, dass wir die Zuverlässigkeit der Sinneswahrnehmung erklären können, die Zuverlässigkeit der rationalen Intuition jedoch nicht; er begeht aber einen Fehler, wenn er annimmt, daraus folge ein Legitimitätsdefizit rationaler Intuition. Wer überhaupt nach einer Erklärung der Zuverlässigkeit rationaler Intuition sucht, hat bereits einen 15 Kategorienfehler begangen, weil er modale Wahrheiten analog zu kontingenten Wahrheiten behandelt. Auf diese Weise lässt sich also auch der zweite Einwand ausräumen, und zwar auch dann, wenn man einen modalen Realismus vertritt. Doch es gibt weitere Probleme mit dem Rationalismus. Legt man Kants klassische Definition zugrunde, dann wird apriorische Erkenntnis nur rein negativ charakterisiert als „ein (…) von der Erfahrung und selbst allen Eindrücken der Sinne unabhängiges Erkenntnis“ (B 2). Diese Definition lässt die Frage offen, wie die Methode apriorischer Rechtfertigung positiv beschrieben werden muss und – schlimmer noch – ob es hier überhaupt eine homogene Methode gibt oder ob es sich schlicht um einen Sammelbegriff handelt. Bereits bei Kant sind die Quellen apriorischer Erkenntnis sehr unterschiedlicher Natur – unser Begriffsverständnis als Quelle analytischer Urteile, die reine Anschauung als Basis der Mathematik und der Beitrag unseres Verstandes zur Erfahrung als Quelle kategorialer Gegenstandserkenntnis. Neuere Autoren wie Tyler Burge verstehen bestimmte Arten der Erinnerung, das Verstehen anderer sowie das nicht nach dem Modell innerer Wahrnehmung konzipierte Selbstwissen als erfahrungsunabhängig und in diesem Sinne a priori. Ich möchte mich dagegen für eine nicht-inflationäre positive Charakterisierung des Apriori aussprechen. Meines Erachtens beruht jede apriorische Rechtfertigung letztlich auf unserem Verständnis der in den Urteilen vorkommenden Begriffe. Es handelt sich in diesem erkenntnistheoretischen Sinne um ausschließlich analytische Erkenntnis modaler Tatsachen. Das gilt sowohl für die philosophischen Gedankenexperimente als auch für logische und mathematische Erkenntnis. Spätestens jetzt dürften bei Ihnen die Warnsirenen aufheulen. Hier wird also wieder einmal der Vorschlag gemacht, apriorische Erkenntnis auf analytische Erkenntnis zurückzuführen – ein Vorschlag, der angesichts der langen Liste von bekannten Einwänden geradezu naiv erscheint. Ich kann hier und heute selbstverständlich nicht auf alle diese Einwände eingehen. Dennoch möchte ich drei von ihnen herausgreifen, die aus meiner Sicht besonders gravierend sind. Erstens sagen analytische Erkenntnisse, die auf unserem Begriffsverständnis beruhen, gar nichts über die unabhängig bestehende Realität aus, sondern nur etwas über das Verhältnis unserer Begriffe oder der Bedeutung unserer sprachlichen Ausdrücke. Um substantielle Einblicke in die Natur der Dinge zu gewinnen wäre die von mir vorgeschlagene Methode folglich ungeeignet. Zweitens ist es zweifelhaft, ob eine Erkenntnis, die durch unser 16 Begriffsverständnis erzeugt wird, streng genommen wirklich erfahrungsunabhängig ist. Denn Begriffe werden aufgrund von Erfahrung erworben, egal ob das durch das Lernen des einzelnen oder eine stammesgeschichtliche Aneignung geschieht. Schließlich sind unsere Begriffe drittens so flüchtig, wandelbar und relativ zu verschiedenen Weltbildern, dass sie als zuverlässige Quelle der Erkenntnis gar nicht geeignet sind. Die genannten Einwände besagen also in umgekehrter Reihenfolge, dass unser Begriffsverständnis keine Quelle zuverlässiger Erkenntnis ist, und selbst wenn das der Fall wäre, würde es sich nicht um eine Quelle apriorischer Erkenntnis handeln, und selbst wenn das der Fall wäre, würden wir durch sie keine Erkenntnis über die Welt gewinnen. Zunächst: Ist es richtig, dass analytische Erkenntnis nicht von der Welt handelt? Es gibt eine Reihe von Urteilen, die wir allein aufgrund unseres Verstehens der in ihnen enthaltenen Begriffe für wahr halten. Wenn ein solcher Fall vorliegt, dann sprechen wir von einem analytischen Urteil. Diese Urteile werden jedoch zunächst gar nicht durch die Natur der für ihre Wahrheit verantwortlichen Tatsachen charakterisiert, sondern allein durch die Natur unserer Gründe für sie. Analytische Erkenntnisse sind also solche Wahrheiten, die wir durch unser Begriffsverständnis rechtfertigen. Eine solche erkenntnistheoretische Charakterisierung ist zunächst völlig neutral gegenüber der Frage, ob die auf diese Weise gerechtfertigten Urteile von der Welt oder von Begriffs- bzw. Bedeutungsrelationen handeln. Nur wenn man eine verifikationistische Semantik vertritt, wird man geneigt sein, die Bedeutung mit der Art und Weise unserer Rechtfertigung gleich zu setzen. Der semantische Realismus – von dem ich ausgehe - ist zu diesem Schritt nicht gezwungen. Sieht man sich nun typische Kandidaten für analytische Wahrheiten an wie „Junggesellen sind unverheiratete Männer“, „Wissen ist nicht-zufällig wahre Meinung“, „Körper sind ausgedehnt“ oder „Etwas kann nicht zugleich ganz rot und ganz grün sein“, dann fällt auf, dass diese Sätze nichts über Bedeutungen oder Begriffe aussagen (wie Sätze der Art „’Junggeselle’ bedeutet ‚unverheirateter Mann’“ oder „’Wissen’ bedeutet ‚nicht-zufällig wahre Meinung’“), sondern dass sie direkt über Dinge in der Welt sprechen, nämlich Jungesellen, Wissen und Körper. Es gibt also keinen Grund, analytische Urteile als Urteile ohne Weltbezug zu interpretieren. Doch wenn analytische Urteile von der Welt handeln, wovon in dieser Welt handeln sie genau? Meines Erachtens sagen sie etwas über Eigenschaften und ihre notwendigen oder möglichen Relationen aus. Was immer z. B. die Eigenschaft hat, ein Junggeselle zu sein, hat notwendigerweise auch die Eigenschaft, ein 17 unverheirateter Mann zu sein. Wenn dieser Satz wahr ist, dann ist er in allen Welten wahr, also auch in der aktualen Welt. Er sagt in jedem Fall etwas über die Welt aus, wie restriktiv man diese Bezeichnung auch immer auslegen mag. Es ist also weder nötig noch überhaupt plausibel, analytische Urteile als „wahr aufgrund von Bedeutung“ zu verstehen, wie es sowohl die empiristische Tradition als auch Kant getan haben. Analytische Urteile sind auf charakteristische Weise durch unser Begriffsverständnis gerechtfertigt, gleichwohl handeln sie von der modalen Realität, wobei ganz offen bleiben kann, wie diese Realität möglicher Welten ontologisch interpretiert werden muss. Sehen wir uns den zweiten Einwand genauer an: Er besagt, dass Begriffe letztlich immer empirisch erworben werden, sei es durch das Individuum direkt oder auf dem Umweg über angeborene Begriffe, deren evolutionäre Aneignung am Ende aber auch auf empirischem Wege erfolgt. Wenn wir nun unsere Urteile auf unser Verständnis von Begriffen stützen, die letzten Endes ihrerseits empirisch erworben wurden, dann scheint unsere Rechtfertigung empirisch zu sein, auch wenn wir im konkreten Einzelfall keine zusätzlichen Erfahrungen machen müssen, um das Urteil zu rechtfertigen. Vielleicht hilft hier eine Unterscheidung zwischen a priori aus naher und a priori aus weiter Perspektive. Eine Rechtfertigung ist a priori aus naher Perspektive, wenn sie von einer Person zu einem bestimmten Zeitpunkt erbracht werden kann, ohne dass diese Person gezwungen ist, zu diesem Zeitpunkt neue Erfahrungen zu berücksichtigen. Eine Rechtfertigung ist dagegen a priori aus weiter Perspektive, wenn die Rechtfertigung auf keinerlei Erfahrung zu irgendeinem Zeitpunkt angewiesen ist. Wenn wir uns also bei der Rechtfertigung von Urteilen auf Lehrbücher, Experten oder unsere Erinnerung stützen, dann ist diese Rechtfertigung aus naher Perspektive a priori, aber aus weiter Perspektive a posteriori, da die Lehrbücher, Experten und die eigene Erinnerung natürlich auf Erfahrung angewiesen sind. In diesem Sinne ist auch die analytische Erkenntnis aus naher Perspektive a priori, aber aus weiter Perspektive und damit im strengen Sinne a posteriori. So lautet der Einwand. Darauf könnte man natürlich entgegnen, dass zumindest nicht alle Begriffe empirisch erworben werden. Kein modaler Begriff, darunter auch der der Kausalität, referiert auf etwas, das unmittelbar in der Erfahrung gegeben ist. Doch diese Entgegnung ist einerseits zu abstrakt (weil sie unerklärt lässt, wie diese Begriffe dann erworben werden, denn eine Berufung auf den Nativismus hilft ja, wie wir eben gesehen haben, auch nicht weiter), andererseits ist diese Entgegnung zu schwach, weil sie dann zugestehen würde, dass es keine apriorische 18 analytische Erkenntnis gibt, die empirische Begriffe (wie ‚Junggeselle’ oder ‚Körper’) enthält – ein Fall, den wenigstens Kant als unreine Erkenntnis a priori zulässt. Ich möchte deshalb etwas anders auf den Einwand reagieren. Empirische Begriffe werden zwar aufgrund von Erfahrung gebildet, aber sie legen offenbar nicht nur fest, auf welche Dinge in der aktualen Welt sie zutreffen, sondern sie legen auch fest, worauf sie in jeder möglichen Welt zutreffen. Das ist sicher keine Information, die aus der Erfahrung einfach abgeleitet wird. Auch empirische Begriffe werden also nicht einfach aus der Erfahrung entnommen, sondern enthalten modale Aspekte, die über jede Erfahrung hinausweisen. Der Prozess der empirischen Begriffsbildung enthält offenkundig einen produktiven (nicht-empirischen) Aspekt. Und durch diesen Aspekt wird die Bewertung kontrafaktischer Fälle bestimmt. Wenn das richtig ist, dann gilt selbst für die analytische Erkenntnis, die auf empirischen Begriffen beruht, dass sie auch aus weiter Perspektive betrachtet nicht a posteriori gerechtfertigt ist. Denn die Aspekte der empirischen Begriffe, die für die Rechtfertigung entsprechender modaler Urteile verantwortlich sind, sind selbst nicht mehr aus der Erfahrung abgeleitet. Damit komme ich zum dritten Einwand gegen analytische Erkenntnis a priori: Ist es nicht wahrscheinlich, dass unsere Begriffe historisch wandelbar und relativ zu einzelnen Personen oder zumindest verschiedenen Kulturen sind? Das wäre insbesondere dann der Fall, wenn unsere Begriffe von unserem Hintergrundswissen, unseren Zielen und unseren Interessen abhängig wären. Unter diesen Umständen wäre die Zuverlässigkeit von Urteilen, die sich unseren Begriffen verdanken, zumindest sehr unsicher – vielleicht zu gering, um überhaupt Erkenntnisansprüche zu legitimieren. Diesem Einwand könnte man am besten durch eine ausdifferenzierte Begriffstheorie begegnen, die zeigen würde, dass unsere Begriffe von unseren Hintergrundtheorien und – interessen weitgehend unabhängig sind. Ich glaube tatsächlich, dass das so ist. Aber dafür kann ich hier nicht ausführlich argumentieren. Ich möchte stattdessen einige Differenzierungen vornehmen, die helfen können, die Relativität unserer Begriffe einzuschränken, und damit auch die Gefahr der Unzuverlässigkeit begrifflicher Erkenntnis bannen. Selbstverständlich sind natürliche Sprachen wandelbar und selbstverständlich enthalten sie ein gewisses Element willkürlicher Klassifikation. Aber die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke muss sorgfältig von der Bedeutung mentaler Begriffe unterschieden werden. In der Sprache spielt nämlich das Moment der Konventionalität eine Rolle, die es bei mentalen Begriffen nicht hat. Aber selbst unsere mentalen Begriffe sind mit unserem sich 19 verändernden Verständnis der Welt historisch wandelbar und mitunter idiosynkratisch. Das möchte ich nicht leugnen. Das gilt jedoch offensichtlich nicht für alle Begriffe gleichermaßen. Bei Begriffen wie Wahrheit, Geist, Wissen, Aktualität, Möglichkeit und Notwendigkeit scheint für Divergenz relativ wenig Spielraum zu bestehen. Und wenn auch in diesen Fällen immer noch der Eindruck von Divergenz besteht, dann muss dieser Eindruck nicht unbedingt auf tatsächlich divergierende Begriffe zurückgeführt werden. Unser Begriffsverständnis besteht nämlich zunächst nicht in einer expliziten Kenntnis der notwendigen und hinreichenden Bedingungen für die Begriffsverwendung, sondern in unserer Fähigkeit, auch kontrafaktische Fälle daraufhin bewerten zu können, ob sie unter den fraglichen Begriff fallen. Eine Divergenz lässt sich, wie im Fall des Wissensbegriffs, zunächst nur in Bezug auf unser explizites Verständnis der Sache feststellen. Und eine solche Divergenz muss nicht damit erklärt werden, dass die Beteiligten über unterschiedliche Begriffe verfügen. Meistens liegt die Differenz im expliziten Verständnis nur daran, dass unterschiedliche kontrafaktische Situationen berücksichtigt wurden, die Beteiligten aber bei der Bewertung derselben kontrafaktischen Fälle durchaus übereinstimmen. Aber selbst wenn auch bei den zentralen Begriffen ein letzter Rest von Divergenz bestehen bleibt, hat das nur zur Folge, dass die auf sie gestützten Urteile über Möglichkeiten und Notwendigkeiten fehlbar sind; es muss die Zuverlässigkeit analytischer Erkenntnis nicht generell kompromittieren. Ich fasse zusammen: Wir haben eine Fähigkeit, modale Aussagen über Möglichkeiten und Notwendigkeiten aufgrund unserer Bewertung rein gedanklich konstruierter Situationen zu treffen und diese Fähigkeit besitzen wir, weil wir unsere eigenen Begriffe in dem Sinne verstehen, dass wir sie anwenden können. Diese Fähigkeit haben wir a priori. Sie ist fehlbar, aber dennoch zuverlässig. Warum sie zuverlässig ist, können wir nicht erklären. Aber dieses Faktum bedarf auch keiner Erklärung. Aber ist unsere apriorische Fähigkeit, kontrafaktische Situationen zu bewerten, tatsächlich zuverlässig? Zweifel daran kommen auf, wenn man sich überlegt, dass unser Begriffsverständnis häufig stark reduziert ist. Denken Sie an unseren Wasser-Begriff, den paradigmatischen Fall eines Begriffs einer so genannten natürlichen Art. Wenn wir für einen Moment unser empirisches Wissen über die chemische Struktur des Wassers ausblenden und nur auf unsere apriorischen Kriterien der Verwendung dieses Begriffs reflektieren, dann wenden wir den Wasserbegriff auf all die Flüssigkeiten an, die trinkbar, geruchlos, durchsichtig sind und in Flüssen, Seen und Meeren vorkommen. Aber was Wasser seinem Wesen nach ist, wird nicht durch diese Kriterien allein festgelegt, sondern durch die tatsächliche chemische Beschaffenheit des Stoffes, der bei uns diese Kriterien 20 erfüllt. Wenn wir nun rein a priori und ohne zusätzliches empirisches Wissen über unsere tatsächliche Welt eine kontrafaktische Welt bewerten würden, in der ein Stoff vorkommt, der dieselben Kriterien wie Wasser bei uns erfüllt, aber tatsächlich eine andere chemische Struktur hat als Wasser bei uns, dann würden wir auch diesen Stoff als „Wasser“ klassifizieren. Wir kämen aufgrund der Bewertung vieler vergleichbarer kontrafaktischer Fälle zu dem Urteil, dass es für Wasser notwendig und hinreichend wäre, die Kriterien für wässrigen Stoff zu erfüllen. Aber das wäre ein Fehler, weil die Essenz natürlicher Arten durch die tatsächliche Mikrostruktur bestimmt wird, die nur empirisch entdeckt werden kann. Unsere a priori nahegelegten Modalurteile würden uns in diesem Fall also in die Irre führen. Wenn also alle unsere Begriffe wie Natürliche-Arten-Begriffe funktionieren würden, dann wären unsere a priori fundierten modalen Intuitionen klarerweise unzuverlässig. Aber das ist nicht der Fall. Es gibt andere Begriffe, wie etwa Wissen, Wahrheit oder Geist, die wir vollständig oder zumindest nahezu vollständig verstehen. Unsere diesbezügliche analytische Erkenntnis lässt sich nicht empirisch, wie im Fall des Wassers, korrigieren. Wir wissen nicht einmal, wie wir empirisch untersuchen sollten, was Wissen, Wahrheit oder Geist wesentlich ist. Wir können empirisch nur die tatsächliche Extension dieser Begriffe bestimmen und Gegenstände untersuchen, die in diese Extension fallen. Das metaphysische Wesen von Eigenschaften dieser Art lässt sich aber nicht wie die Mikrostruktur eines gegebenen Stoffes empirisch auffinden. Es gibt also einen Bereich von zentralen Eigenschaften, die, wenn überhaupt, nur apriorischer Analyse zugänglich sind. Allein im Fall der Natürliche-ArtenBegriffe schlägt diese Analyse fehl. Ein genereller Zweifel an der Zuverlässigkeit analytisch fundierter modaler Erkenntnis lässt sich hingegen gar nicht konsistent rechtfertigen. Das geht aus folgender Überlegung hervor: Damit skeptische Argumente überhaupt in Gang gesetzt werden können, muss ein Skeptiker zumindest dafür argumentieren, dass skeptische Hypothesen möglich sind. Es muss möglich sein, dass unsere kognitiven Methoden global in die Irre führen. Auf den vorliegenden Fall bezogen müsste der Skeptiker behaupten, dass es möglich ist, dass die modale Realität möglicher und notwendiger Tatsachen radikal von dem abweicht, was wir aufgrund unseres Begriffsverständnisses für möglich oder notwendig halten. Doch woher weiß der Skeptiker, dass dies möglich ist? Es gibt nur eine mögliche Erklärung. Der Skeptiker stützt sich dabei auf sein Verständnis der Begriffe modaler Realität und Denkbarkeit. Doch dann hat der Skeptiker in seiner Begründung der skeptischen Hypothese bereits in Anspruch genommen, 21 dass wir die modale Realität mit Hilfe begrifflicher Überlegungen erkennen können. Er würde sich also in einem epistemischen Selbstwiderspruch verwickeln, wenn er mit Hilfe dieser Methode dafür argumentieren wollte, dass sie keine Erkenntnis liefert. Wir müssen also versuchen, Fehlerquellen analytischer Erkenntnis auszuschließen (wie im Fall einer analytischen Erkenntnis aufgrund von Natürliche-Arten-Begriffen), aber es besteht kein Grund zu genereller Skepsis. Die Antwort auf meine Ausgangsfrage lautet also: Ja, es gibt Erkenntnis aus reiner Vernunft über die Welt. Allerdings hat sie andere Quellen und eine andere Bedeutung als von der Transzendentalphilosophie angenommen wurde und wird. Ich sehe die Rolle apriorischer Erkenntnis soweit es die Philosophie betrifft primär im Bereich der Metaphysik. In einem großen Bereich von Eigenschaften können wir mit Hilfe begrifflicher Erkenntnis klären, welches die Natur dieser Eigenschaften ist. Eine Antwort auf diese Frage können die empirischen Wissenschaften nicht geben. Allerdings ist eine solche Antwort für den reibungslosen Ablauf des wissenschaftlichen Alltags auch nicht nötig. Dort reicht es aus, dass wir tatsächliche Fälle klassifizieren können, und dafür ist eine Kenntnis notwendiger und hinreichender Bedingungen nicht nötig. Wären wir also mit apriorischer Blindheit geschlagen, so käme es nicht gleich zu einer kognitiven Global-Katastrophe – wir könnten uns weiterhin in unserer Umwelt orientieren und erfassen, wie die in ihr tatsächlich existierenden Dinge beschaffen sind. Was uns aber vollkommen fehlen würde, wäre ein Verständnis der Eigenschaften, deren Natur nicht durch die aktuale Welt bestimmt wird, sondern sich erst im Raum der Möglichkeiten konstituiert. Und an genau diesen Eigenschaften haben wir als Philosophen besonderes Interesse. Mit dem intellektuellen Sinn würde uns also der philosophische Sinn abhanden kommen. 22