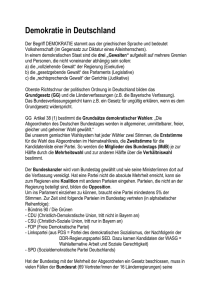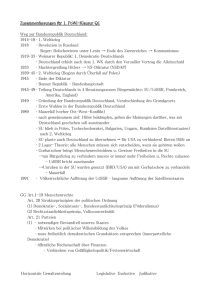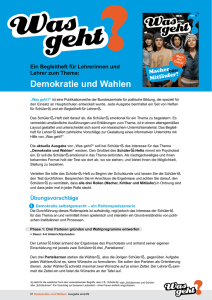„Es reicht nicht zu sagen, wir haben eine gute Demokratie
Werbung
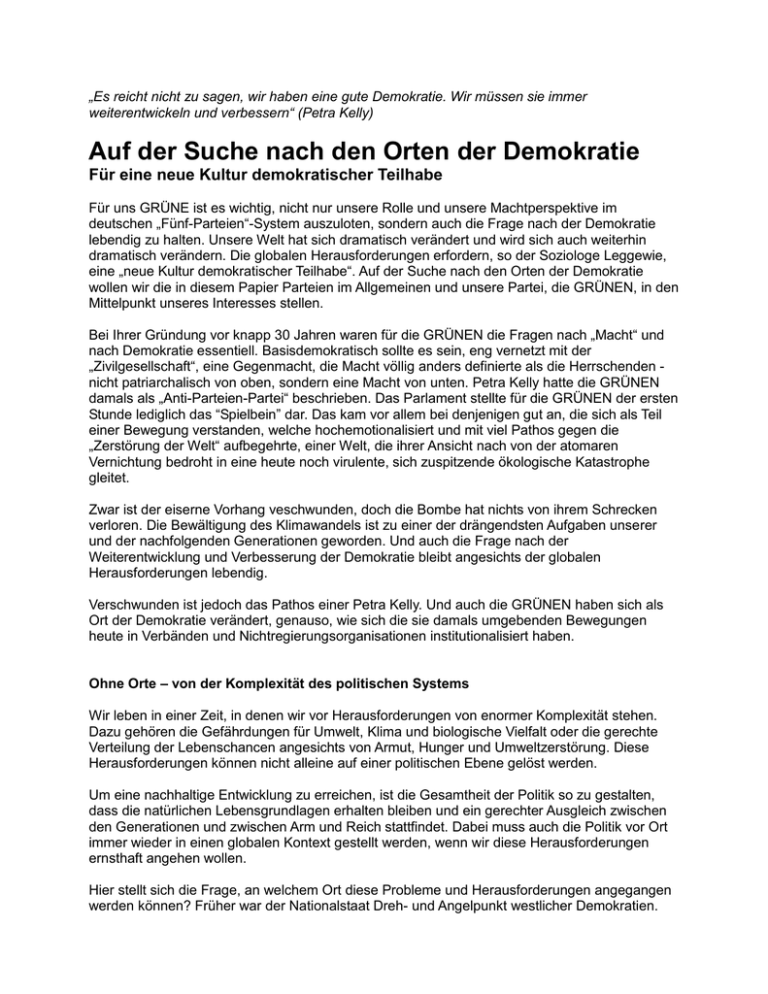
„Es reicht nicht zu sagen, wir haben eine gute Demokratie. Wir müssen sie immer weiterentwickeln und verbessern“ (Petra Kelly) Auf der Suche nach den Orten der Demokratie Für eine neue Kultur demokratischer Teilhabe Für uns GRÜNE ist es wichtig, nicht nur unsere Rolle und unsere Machtperspektive im deutschen „Fünf-Parteien“-System auszuloten, sondern auch die Frage nach der Demokratie lebendig zu halten. Unsere Welt hat sich dramatisch verändert und wird sich auch weiterhin dramatisch verändern. Die globalen Herausforderungen erfordern, so der Soziologe Leggewie, eine „neue Kultur demokratischer Teilhabe“. Auf der Suche nach den Orten der Demokratie wollen wir die in diesem Papier Parteien im Allgemeinen und unsere Partei, die GRÜNEN, in den Mittelpunkt unseres Interesses stellen. Bei Ihrer Gründung vor knapp 30 Jahren waren für die GRÜNEN die Fragen nach „Macht“ und nach Demokratie essentiell. Basisdemokratisch sollte es sein, eng vernetzt mit der „Zivilgesellschaft“, eine Gegenmacht, die Macht völlig anders definierte als die Herrschenden nicht patriarchalisch von oben, sondern eine Macht von unten. Petra Kelly hatte die GRÜNEN damals als „Anti-Parteien-Partei“ beschrieben. Das Parlament stellte für die GRÜNEN der ersten Stunde lediglich das “Spielbein” dar. Das kam vor allem bei denjenigen gut an, die sich als Teil einer Bewegung verstanden, welche hochemotionalisiert und mit viel Pathos gegen die „Zerstörung der Welt“ aufbegehrte, einer Welt, die ihrer Ansicht nach von der atomaren Vernichtung bedroht in eine heute noch virulente, sich zuspitzende ökologische Katastrophe gleitet. Zwar ist der eiserne Vorhang veschwunden, doch die Bombe hat nichts von ihrem Schrecken verloren. Die Bewältigung des Klimawandels ist zu einer der drängendsten Aufgaben unserer und der nachfolgenden Generationen geworden. Und auch die Frage nach der Weiterentwicklung und Verbesserung der Demokratie bleibt angesichts der globalen Herausforderungen lebendig. Verschwunden ist jedoch das Pathos einer Petra Kelly. Und auch die GRÜNEN haben sich als Ort der Demokratie verändert, genauso, wie sich die sie damals umgebenden Bewegungen heute in Verbänden und Nichtregierungsorganisationen institutionalisiert haben. Ohne Orte – von der Komplexität des politischen Systems Wir leben in einer Zeit, in denen wir vor Herausforderungen von enormer Komplexität stehen. Dazu gehören die Gefährdungen für Umwelt, Klima und biologische Vielfalt oder die gerechte Verteilung der Lebenschancen angesichts von Armut, Hunger und Umweltzerstörung. Diese Herausforderungen können nicht alleine auf einer politischen Ebene gelöst werden. Um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen, ist die Gesamtheit der Politik so zu gestalten, dass die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten bleiben und ein gerechter Ausgleich zwischen den Generationen und zwischen Arm und Reich stattfindet. Dabei muss auch die Politik vor Ort immer wieder in einen globalen Kontext gestellt werden, wenn wir diese Herausforderungen ernsthaft angehen wollen. Hier stellt sich die Frage, an welchem Ort diese Probleme und Herausforderungen angegangen werden können? Früher war der Nationalstaat Dreh- und Angelpunkt westlicher Demokratien. Heute spielen trans- und supranationale Organisationen eine immer größere werdenden Rolle. Mittlerweile gibt es, vom Bezirksbeirat bis zur UNO fünf, sechs oder mehr politische Ebenen, die untereinander mehr oder weniger gut vernetzt sind und deren Kompetenzen nicht mehr so klar abgegrenzt werden können, wie beispielsweise in den Zeiten des kalten Krieges. Der Nationalstaat ist schon lange nicht mehr der politische Rahmen für alle Entscheidungen in einer global vernetzten Welt. Für uns muss der Grundsatz gelten, dass die Lösung der globalen Probleme vor allem demokratisch erfolgen muss. Doch die demokratische Bewältigung der Komplexität ist gerade für die politischen Parteien eine Herausforderung. Manche Parteien haben aufgegeben, in den Wahlkämpfen die politische Entscheidungsreichweite der entsprechenden Ebene genau in den Fokus zu nehmen. Doch die einzelnen PolitikerInnen von heute können nur in einem recht eng gestecktem Rahmen und auf einer der politischen Ebenen agieren. Zudem ist eine Politik, die diese Herausforderungen in ihrem Bereich ernst nimmt, mit Zumutungen für die Bürgerinnen und Bürger verbunden. Wo können Parteien heute ansetzen, wenn sie solche Probleme angehen wollen? Wieviel Pragmatismus, wie viel Pathos und wie viel Idealismus verträgt die Politik einer Kreispartei? Wie kann es gelingen, komplizierte politische Sachverhalte und Problemlagen zu erklären ohne sie auf inhaltsleere Schlagworte zu verkürzen? Wie kann es gelingen, auch auf kommunaler Ebene Lösungsansätze zu entwickeln, die die globalen Herausforderungen im Blick behalten? Wieviel Experten verträgt die Demokratie? Durch die vermeintliche Komplexität politischer Entscheidungsprozesse kam es zu einer zunehmenden Professionalisierung des politischen Personals. Für ehrenamtliche PolitikerInnen, aber auch für BerufspolitikerInnen, wurde es immer schwieriger, Politik zu erklären sowie Entscheidungen zu begründen und in einen größeren Kontext zu stellen. Beispielsweise in der Kommunalpolitik: Die Vergabe von Bauaufträgen und die Gestaltung von Ausschreibungen sind dadurch, das sowohl EU-Recht, als auch Landes- und Bundesrecht zu beachten sind, hochkompliziert. Warum ein Bauvorhaben oder eine Ausschreibung gerade so und nicht anders ausgeführt werden kann, ist manchmal nicht einmal der Verwaltung klar. Ein weiteres Beispiels ist das Cross-Boarder-Leasing Ende der 90er Jahre und Anfangs des neuen Jahrhunderts. Hier stimmten kommunale Parlamente Vertragstexten zu, die für sie nicht einsehbar waren oder aus kurzen Zusammenfassungen bestanden. Eine öffentliches Interesse verhinderte nur vereinzelt Verkäufe und wurde erst in den letzten Jahren wirklich geweckt als die katastrophalen Auswirkungen sichtbar wurden. Um die enorme Komplexität in der Politik zu bewältigen, entstand eine immer größer werdende Kaste von ExpertenInnen und BerufspolitikerInnen. Diese, zumeist sehr gut ausgebildeten Menschen, bewegen sich, wie der Politikwissenschaftler Collin Crouch formulierte, in einem postdemokratischen Zirkel. Sie steigen – ohne in den regionalen Parteigliederugen sozialisiert zu sein – schnell ein und auf. Oft beginnt der Karriereweg als Berater für einen Abgeordneten, eine Fraktion oder einen politischen Wahlbeamten. Von dort aus kommt der Wechsel in eine NGO, der Wechsel in die Führung, die PR- oder die Lobbyabteilung eines Unternehmens, in einen Think Tank oder in die erste Reihe der Politik. Matthias Berninger, Sven Giegold oder Matthias Wissmann stehen exemplarisch für die Biographien der politischen Expertenkaste. Die lokalen Parteigliederungen stehen diesen Experten manchmal kritisch, manchmal blind gläubig gegenüber. Kritisch, weil sie den bis in die 80er Jahre geltenden, klassischen Karriereweg in einer politischen Partei in Frage stellt, der über überdurchschnittliches Engagement in der jeweiligen Parteigliederung in den Gemeinderat, das Landesparlament und letzten Endes in den Bundestag führte. Blind gläubig, weil viele aufegegeben haben, selbst Lösungen für drängende politische Probleme zu suchen und sich von den Experten "instantLösungen" erhoffen. Die Professionalisierung hat auch einen Entfremdungsprozess zwischen Basis und „denen in Berlin“ ausgelöst. Die nicht in der Partei sozialisierten Experten tun sich mit der politischen Kultur der Basis schwer – allein schon das „Du“ ist für viele eine Hürde. Umgekehrt regt sich in den lokalen und überregionalen Führungsgremien der Parteien der Verdacht, dass die Aktivisten nicht einmal für die Stammwählerschaft repräsentativ sind. Und da die Aktivisten sich freiwillig engagieren, anstatt gewählt oder nach repräsentativen Kriterien zusammengestellt werden, enstpricht dies vermutlich sogar der Wahrheit1. Zudem versuchen die Parteien neue Wählerschichten zu erschließen, die der Basis jedoch fremd bleiben. Ein Beispiel ist der Versuch der GRÜNEN, neben dem großstädtisch-bürgerlichen Millieu auch konservativ-gemäßigte Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Der blinde Glaube an das Expertentum sorgte dafür, dass wichtige Entscheidungen, die unser Zusammenleben betreffen, technokratisch entwickelt und durchgesetzt wurden. Ein Beispiel sind die HartzIV-Reformen, die größte Reform der sozialen Sicherungssysteme in der Bundesrepublik seit den 80er Jahren, die nach dem Leiter der Experten-Gruppe, dem damaligen Personal-Vorstand der Volkswagen AG, benannt wurden. Die Identifikation mit politischen Entscheidungen wird nicht allein durch die technokratische Sprache der “Experten” schwierig gemacht. Die Allmachtsphantasien von Verwaltungen, Expertengruppen und Kommissionen legitimierten sich bisher durch ihren “Ouput”. Stimmte das Ergebnis fragte keiner mehr danach, wie eine Entscheidung zustande gekommmen ist. Diese Fehler, die vor allem in der Zeit der rot-grünen Bundesregierung gemacht wurden, dürfen sich so nicht wiederholen. Es gilt, mehr das Augenmerk darauf zu richten, wie Entscheidungen zustande kommen, wer dabei mitgenommen werden soll, mit wem man redet. Solche Prozesse sind aufwendig, sie erfordern ein hohes Maß an kommunikativer Kompetenz. Wie schaffen wir bei der Professionalisierung Raum für politische Partizipation? Wie kann eine Partei sich öffnen, ohne ihre Grundwerte aus dem Auge zu verlieren und ohne beliebig zu werden? Wie kann eine von einer Partei aus initiierte politische Partizipation aussehen? Wer soll daran beteiligt werden? Und wo sind die Orte für eine solche demokratische Auseinandersetzung? Orientierung und Kompaß Die Demokratie des 21. Jahrhunderts darf ihren Kompaß nicht verlieren. Sie muss sich an Grundwerten orientieren statt in Ideologien zu verharren. Damit dies keine hohle Phrase bleibt, müssen diese Grundwerte immer wieder ins Bewußtsein geholt und diskutiert werden, ohne jedoch dabei in Dogmatismus zu erstarren oder beliebig zu werden. Die Realität sieht anders aus. Statt sich mit Grundwerten durch den Dschungel des komplexen politischen Systems zu manövrieren, treten viele PolitikerInnen den Rückzug in Pragmatismus und Beliebigkeit an. Man scheut die Mühe, politische Sachverhalte ausreichend aufzuarbeiten, ihrer Komplexität gemäß zu kommunizieren und mit Betroffenen und Interessierten zu diskutieren. Man verharrt bei Schlagzeilen und in Pressemitteilungen verknappten Botschaften. 1 Crouch 2008, 92 Den Parteien geht damit der Kompaß verloren. Politische Entscheidungen und politische Kommunikation driften auseinander – die Glaubwürdigkeit von Politik wird weiter beschädigt. So gerierte sich Merkel auf internationaler Ebene als Klimakanzlerin, konterkarierte dieses PR-Spiel jedoch in jenem Moment, wo es darum ging, auf nationaler und europäischer Ebene einen klaren Rahmen für eine ökologische Wende zu setzen. Die Abrackprämie war ein Ergebnis und das EU-Klimapaket blieb nicht nur dank Merkel hinter dem Notwendigen zurück. Begründung hierfür waren Protektoinismus und vermeintlicher Pragmatismus. Allgemein geraten bei den Parteien nach der Systemauseinandersetzung zwischen Ost und West die Grundwerte, auf denen ihre Politik basiert, ins Hintertreffen. Den Liberalismus muß man bei der FDP teilweise mit der Lupe suchen. Der neoliberale „Reformkurs“ der Union, den sie anläßlich der Bundestagswahl 2002 einschlug, hat mit der Bewahrung und Erhaltung guter Politik, also einem gesund verstandenen Konservativismus, wenig zu tun. Mit der Transformation unseres Wirtschaftssystems ist der SPD die Arbeiterklasse abhanden gekommen, die bis in die späten 80er Jahre ideologischer Fokus ihrer Politik war. Eine Außnahme bilden die GRÜNEN, die bereits während des kalten Krieges weder im Kapitalismus noch im Kommunismus ihr Heil suchten, sondern stärker als viele andere auf einem „dritten Weg“ beharrten, der nicht ein Kompromiß zwischen beiden Systemen sein sollte, sondern jenseites beider Ideologien lag und dessen Pfade noch gesucht werden müssen. Obwohl dieser besondere „dritte Weg“ bei den GRÜNEN nicht mehr im aktuellen Bewußtsein ist, fällt es den GRÜNEN nicht schwer, ihre Politik auf die Basis von Grundwerten zu stellen statt auf die Basis einer überkommenen Ideologie. Nicht umsonst postuliert das GRÜNE Grundsatzprogramm: „Uns eint, uns verbindet ein Kreis von Grundwerten und nicht eine Ideologie“. Auch wenn man sich manchmal wünschen mag, das diese Grundwerte im politischen Tagesgeschäft stärker durchscheinen mögen. Gerade dieser gewachsene Kreis an Grundwerten verschafft den GRÜNEN einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Parteien, die sich den großen Ideologien des 19. Jahrhunderts – Konservativismus, Sozialsismus und Liberalismus verpflichtet fühlen. Wie lebendig bei den GRÜNEN die Transformation von Ideologien in Grundwerte und die Diskussion um eben jene Grundwerte ist, lässt sich am Beispiel des Grundwertes „Gewaltfreiheit“ zeigen, der Pazifismus als Ideologie ablöste. Selbst bei den Gegner des Afghanistaneinsatzes wurde auf dem berühmten Göttinger Parteitag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN millitärische Gewalt als letztes Mittel nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Vielmehr wurde über die Angemessenheit und über das WIE von ISAF und OEF diskutiert. Auch ohne Anlehnung an eine “große” Ideologie fehlt es den Grünen nicht an langfristigen Zielen und Idealen. Zum Beispiel war und ist die Kritik an der Fetischisierung des Wachstums als Selbstzweck ein zentraler Baustein grünen Denkens. Der Green New Deal als Basis einer wirtschaftlichen ökologischen Transformation war hier ein erster richtiger Schritt, aber sicher nicht der Letzte, weshalb offene Diskussionen mit eine regelmäßigen Überprüfung der eigenen Argumente notwendig ist, denn auch politische und gesellschaftliche Konzepte erfüllen keinen Absolutheitsanspruch. So wichtig der Bezug auf Grundwerte ist, so notwendig ist eine notwendige Offenheit und Diskussionsbereitschaft gegenüber der Progressivität der Realität. Wie kann es gelingen, bei politischen Entscheidungen immer wieder einen von Grundwerten geleiteten Faden durchscheinen zu lassen? In welcher Form müssen langfristige Konzepte aufgebaut und erarbeitet werden? Wie schaffen wir es, unsere langfristigen Konzepte auch mehrheitsfähig und machbar zu gestalten? Kapitel II: Parteien als Orte der Demokratie Konstituierendes Element und Herzkammern unserer parlamentarischen Demokratie sind Parteien. Sie bestimmen, wer in die Parlamente gewählt werden kann. In Wahlen spielen Parteien die Hauptrolle – egal ob durch politische Programme, Themen oder Köpfe. Sie verhandeln Koalitionen und bilden damit letztlich Regierungen. Die Parteien haben sich seit der Gründung der Bundesrepublik verändert. Früher galt, in der Mitgliedschaft einer Partei repräsentiere sich mehr oder weniger ein Querschnitt der Bevölkerung. Vor der Erfindung der Meinungsumfragen konnten die Parteimitglieder dies auch ohne weiteres in Anspruch nehmen. Doch mittlerweile bilden Parteimitglieder schon lange keinen repräsentativen Querschnitt. Ältere Menschen, Angestellte des öffentlichen Dienstes, sowie Männer dominieren in der Mitgliedschaft aller Parteien – auch bei den GRÜNEN. Glaubt man den immer wiederkehrenden Debatten um Parteien-, Politik oder Politikerverdrossenheit, befinden sich Parteien ohnehin in einer akuten Krise. Den Parteien laufen WählerInnen und Mitglieder davon. Schlimmstenfalls werden Parteien nicht mehr als Kräfte wahrgenommen, die sich um das Gemeinwohl sorgen, sondern als Institutionen, in denen sich eine Funktionärselite abschottet, um möglichst ungestört ihre Pfründe zu verteilen, wie der SPIEGEL-Korrespondent Gabor Steingart in seinem Buch „Die Machtfrage – Ansichten eines Nichtwählers“ nahelegt. Ist an dieser Kritik etwas darn oder handelt es sich lediglich um Polemik vom pubilizistischen Stammtisch? Ein Indikator für die angebliche Parteienverdorssenheit ist die Wahlbeteiligung, die in Deutschland stetig sinkt. Doch Vergleicht man die Wahlbeteiligung zum Deutschen Bundestag, so liegt diese seit 1990 im Schnitt nur 8% niedriger als in den ersten vier Jahrzehnten der Republik. Das ist nicht dramatisch, vergleicht man diese Zahlen mit Ländern, wie der Schweiz oder der USA, bei denen die Wahlbeteiligung mehr als 20% niedriger ist als bei uns. Doch kann die sinkende Wahlbeteiligung auch als Ausdruck von Normalisierung begriffen werden. Viele Nichtwähler geben an, sie würden sich schlicht und einfach nicht für Politik interessieren und zumindest 2005 sahen sich nach einer Nachwahlstudie des WZB über 70% der Bevölkerung durch eine Partei oder durch Politiker repräsentiert. Die SPD hat seit 1980 die Hälfte ihrer Mitglieder verloren und auch bei der CDU sinken die Mitgliederzahlen seit 1990 kontinuierlich. Bei uns GRÜNEN stagnieren die Zahlen oder weisen einen - wenn auch leichten - Trend nach oben auf. Doch auch hier fällt auf: die Volatilität ist hoch, viele Austritte werden durch Eintritte wieder wettgemacht. Doch sagt die Mitgliederentwicklung wenig über eine Krise der Parteien aus. Vielmehr spiegelt sich in ihr die Tendenz, sich nicht über einen längeren Zeitraum binden zu wollen. Vor allem in der jungen Generation wird dies sichtbar. Häufige Ortswechsel, individuellen Freizeitgestaltung und brüchige Erwerbsbiographien legen nahe, dass eine Bindung an eine regionale Parteigliederung über einen längeren Zeitraum schwierig ist. Davon sind nicht nur Parteien betroffen: Kirchen, Sport-, Jugend- und Musikvereine klagen gleichermaßen über Nachwuchsmangel. Vor allem aktive Mitglieder finden sich nur wenige. Die derzeit sinkende Wahlbeteiligung und der Mitgliederschwund der Parteien belegen noch keinesfalls, dass sich die Parteien in der Krise befinden. Sie bleiben trotzdem eine Herausforderung für die Parteien, die sie nicht ignorieren sollten. Wie gut Parteien letztlich ihre Aufgabe als Herzkammern der Demokratie erfüllen, ob sie tatsächlich, wie das Grundgesetz formuliert, maßgeblich an der Willensbildung mitwirken und vor allem, wie Parteien einer „neuen Kultur der demokratischen Teilhabe“ (Leggewie) gerecht werden können – diese Fragen lassen sich nicht allein mit Zahlen und Umfragen beantworten. Sie erfordern eine ins grundsätzlich gehende Diskussion, ein intensives Nachdenken über eine Kultur demokratischer Teilhabe – auch über die Parteien hinaus. Über Aktualität und Realität der Parteien “Gerade in Zeiten des Lobbyismus und des Verbandswesens sind Parteien noch am ehesten Orte, an denen sich so etwas wie Interpretationen vom Gemeinwohl und der Streit zwischen ihnen organisieren können – oder zumindest sollten. In der dieser Funktion als Transformationsriemen zwischen Gesellschaft und Institutionen [...] liegt die Bedeutung und die Aktualität des Parteigedankens”, formulierte die Gruppe “Realismus und Substanz”, eine parteiinterne Gruppe junger Menschen, die sich grundsätzlichen Diskussionen verpflichtet fühlt – und trifft damit den Nagel auf den Kopf. Diesem Anspruch steht jedoch die Realität in den Parteien gegenüber. Auf den Mitgliederversammlungen der Parteien dominieren Amts- und Mandatsträger. Echte Diskussionen finden kaum statt, die Funktionäre sind mit der Politik der jeweiligen Gliederung vertraut, politische Beschlüsse werden im Rahmen der lokalen Parteigliederungen kaum gefasst, Positionspapiere oder Anträge selten verabschiedet. Dies führt zu einer Verengung des Parteilebens auf eine kleine Gruppe von Funktionären. Auch bei den GRÜNEN, die einen solchen Mechanismus früher mit der Trennung von Amt und Mandat begegnen wollten, finden sich solche Gegebenheiten. Oft diskutieren selbst die lokalen Parteivorstände kaum politisch, sondern stellen die Parteiorganisation in den Vordergrund ihrer Arbeit – Infostände wollen besetzt, Podien organisiert sein. Ein weiteres Ergebnis der Trennung von Amt und Mandat ist, dass vor allem bei den GRÜNEN die informellen nicht den formalen Machtstrukturen entsprechen. Joschka Fischer, der nie ein Parteiamt bekleidete, aber die Politik der GRÜNEN fast zwei Jahrzehnte prägte, steht exemplarisch dafür. Zudem ist die Zusammenarbeit zwischen den professionalisierten Fraktionen auf der einen und den Parteigliederungen auf der anderen recht mühevoll, bedeutet doch die Kommunikation und Diskussion einzelner Konzepte und Beschlüsse in der Partei und in der Öffentlichkeit viel Arbeit. Wenn die Parteien wieder ein Stück des Vertrauens zurückgewinnen wollen, müssen sie zu lebendigen Orten der Demokratie werden, die für politisch interessierte Menschen leicht zugänglich sind. WIE sie das erreichen können, ist die Aufgabe, der wir uns als junge Parteimitglieder stellen müssen. Wo stehen die GRÜNEN? Die GRÜNEN haben sich etabliert – für manche ist das ein Vorwurf, andere sind wiederum stolz darauf, Mitglied einer „normalen“ Partei zu sein. Waren die GRÜNEN aufgrund ihrer vielschichtigen Herkunft aus den Bewegungen früher stark mit Bürgerinitiativen und NGOs verknüpft und einer nie näher ausformulierten, alternativen Politikvorstellungen verpflichtet, bedeutete spätestens die Regierungsbeteiligung 1998 einen Bruch. In der Gründungsphase der GRÜNEN war das "starre, sterile Parlament voller inkompetenter, elitärer Männer im Pensionsalter" (Petra Kelly) noch ein Feindbild. Otto Schily, damals einer der Fraktionssprecher, sagte anlässlich des Einzuges in der Bundestag 1983: "Außerparlamentarische Aktionen sind für uns wichtiger als das Parlament." Folgerichtig wurde das Parlament als Spielbein, die „Bewegungen“ als Standbein betrachtet. In der langen Auseinandersetzung zwischen „Fundis“ und „Realos“ schälte sich jedoch ein Bekenntnis zur parlamentarischen Demokratie heraus: „Es war damals ganz klar: Wir wollen in den bayerischen Landtag, wir wollen Alternativen zur herrschenden Politik aufzeigen und Kritik an der Staatsregierung, an der CSU üben und wir wollen das auch parlamentarisch machen. Es gab bestimmt noch eine verschwindende Minderheit bei den Grünen, die gefragt hat, ob man diesen parlamentarischen Weg überhaupt beschreiten soll.“, kommentierte die bayrische Landesvorsitzende Theresa Schopper rückblickend den Einzug der GRÜNEN in den bayrischen Landtag. Spätestens mit der Regierungsbeteiligung in Hessen wollte eine immer größer werdende Mehrheit bei den GRÜNEN Politik auch in Regierungen gestalten. Spätestens an diesem Punkt machten sich die GRÜNEN auf den Weg, eine “Konzeptpartei” zu werden – bloßes opponieren war nicht mehr gefragt, die “alternative Politik” sollte konkreter werden. “Heute steht unsere Partei also vor einem neuen Schritt den sie tun muss: von der Protestpartei hat sie nach einem Jahrzehnt schwerster innerparteilicher Kämpfe sich zur Konzeptpartei entwickelt, und nun muß sie den Schritt zur Gestaltungspartei machen”, sagte der damalige Fraktionssprecher der GRÜNEN im Bundestag Joschka Fischer 1995. Gestaltungspartei sein, das hieß für Fischer, dass beim Ausformulieren der Konzepte neben Ideen und Visionen auch die “Mühsal der Machbarkeit und der Mehrheitsfähigkeit” mitgedacht werden müssten. Mit der Regierungsbeteiligung 1998 wurde der Anspruch begannen viele NGOs das Verhalten der GRÜNEN zu kritisieren: der Atomausstieg gehe nicht schnell genug, die Umweltgesetze waren nicht entschlossen genug, die Sozialreformen neoliberal, der Einsatz der NATO im Kosovo kriegstreiberisch. Die GRÜNEN gingen vielen Kompromisse mit der SPD ein und wurden so zur beliebten Zielscheibe. Mit als Reaktion darauf wurde der Dreiklang aus Visionen, Machbarkeit und Mehrheitsfähigkeit zugunsten der Machbarkeit verschoben – auf allen Ebenen. Trotz der Verabschiedung eines Grundsatzprogrammes 2002 drohte der GRÜNEN Politik der Referenzrahmen verloren zu gehen und der Pragmatismus dominierte das politische Geschehen. Eine neue Kultur demokratischer Teilhabe bei den GRÜNEN einzufordern heißt jedoch, die reine Lehre des Pragmatismusses hinter sich zu lassen und den Dreiklang von Mehrheitsfähigkeit, Machbarkeit und Vision wieder zum tönen zu bringen. Das bedeutet jedoch nicht, wie für so manchen in der GRÜNEN Partei, die Rückkehr zur Konzeptpartei der 80er Jahre. Gerade dort, wo die GRÜNEN die Mehrheit stellen, ist es wichtig, das Thema Demokratie wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Mit dem hohen Zuspruch der Wählerinnen und Wähler verbindet sich ein hohes Maß an Verantwortung. Es wäre falsch, die GRÜNEN in ihren Hochburgen zu “Volksparteien” zu erklären. Doch auch, wenn wir nicht Volkspartei sind, muss der Anspruch aufrecht erhalten werden, zwischen den Interessen möglichst aller Bürgerinnen und Bürger einer Gemeinschaft zu moderieren und abzuwägen. Das geht nur mit und nicht gegen die Betroffenen. Parteimitglieder in der Demokratie des 21. Jahrhunderts? Für eine Partei erfordert erfolgreiche politische Kommunikation die Konzentration auf wenige Themen, welche möglichst verständlich kommunizert werden sollten, eine schnelle Reaktion in den medialen Debatten, die Geschlossenheit der Mitgliedschaft und der Amts- und Mandatsträger, sowie die eine klar erkennbare Führung. Um das nötige Maß an thematischer Fokussierung, Reaktionszeit, Simplifizierung und Geschlossenheit zu erreichen wurde die Organisationsstruktur der GRÜNEN auf Bundesebene professionalisiert. 1993 gab es zum ersten Mal eine politische Bundesgeschäftsführerin, an die Stelle dreier gleichberechtigter „BundessprecherInnen“ traten zwei Vorsitzende. Mit der Regierungsbeteiligung 1998 wurde ein Parteirat gegründet. Beide Reformen hatten zum Ziel, eine erfolgreiche, geschlossene Außendarstellung der Partei zu ermöglichen und endlich die zermürbenden Flügelkämpfe und abseitigen Debatten der 90er Jahre hinter sich zu lassen. Denn nach der vernichtenden Wahlniederlage 1990 und spätestens seit der Regierungsbeteiligung 1998 war eine kohärente und erfolgreiche politische Kommunikation in den medialen Arenen der Öffentlichkeit für die GRÜNEN eine Überlebensfrage. Die planmäßige Professionalisierung der Partei machte jedoch bei den Landesstrukturen halt und vertraute jenseits davon auf die Autonomie der Kreisverbände. Doch den Erfordernissen einer erfolgreichen politischen Kommunikation auf Bundesebene stehen an der Basis die Bedürfnissen einer anspruchsvollen Mitgliedschaft im 21. Jahrhundert gegenüber. Parteisoldaten sind selten geworden. Die aktiven Bürgerinnen und Bürger denken heutzutage politisch autonomer und eigenwilliger, sie wollen mit ihrer Meinung nicht im Parteimainstream untergehen. Sie legen Wert darauf, ihr ehrenamtliches Engagement auf ihre eigene, individuelle Art auszufüllen. Die GRÜNEN waren Verheißung und Teil der Entwicklung, die zum autonomeren und eigenständigeren homo politicus des 21. Jahrhunderts führte. Wer in eine Partei eintritt bringt durch seinen Beruf oder durch sein bisheriges ehrenamtliches Engagement bestimmte, manchmal sehr spezielle Interessen mit, die abseits der aktuellen Fokussierung auf wenige Themen stehen. Oft bilden sich diese Interessen nicht in parteiinternen Arbeitsgruppen oder Diskussionszirkeln ab. Es benötigt eine Menge Eigeninitiative und Zeit, um MitstreiterInnen zu finden oder mit seinen Interessen parteiintern Gehör zu erlangen. Manchmal stehen die lokalen Führungskräfte solch speziellen politischen Interessen einzelner Mitglieder skeptisch bis ablehnend gegenüber – sei es aus Zeitmangel, der eine intensivere Beschäftiguing mit dem Anliegen nicht möglich macht, sei es, weil sie um die Geschlossenheit der Partei fürchten oder Konfliktpotentiale mit dem Partei-Mainstream vermuten. Parteimitglieder sind überdurchschnittlich politisch interessiert. Das bedeutet jedoch, dass sie sich mit allzu simplen Erklärungen politischer Entscheidungen durch „ihre“ Amts- und Mandatsträger nicht zufrieden geben. Sie wollen eben nicht der Komplexität des politischen Systems ausweichen, nicht die schwarz-weiß-Zeichnung der Öffentlichkeitsabteilung unterschreiben, sondern sich einem Thema mit allen seinen Zumutungen und Schwierigkeiten annähern dürfen. Dieses Bedürfnis steht quer zu dem Erfordernis einer in einer halben Minute verständlich zu kommunizierenden politischen Botschaft. Der politische Individualismus des homo politicus des 21. Jahrhunderts sucht kontroverse und spannende Debatten. Es ist wichtig, solche Debatten nicht allein parteiintern auszufechten, sondern auch Menschen von außerhalb eine Möglichkeit zu bieten, an diesen Debatten teilzunehmen. Die Realität zeigt jedoch, dass solche Debatten oft in den Fraktionen hängenbleiben und nicht einmal die Parteiöffentlichkeit erreichen. Wie soll dann eine kritische Öffentlichkeit mit uns Boot geholt werden können? Wie soll man erklären, warum die aktive Mitgliedschaft in einer Partei auch außerhalb von ehrenamtlichen Mandaten möglich uns spannend sein soll? In der Zukunft wird von den Mandats- und AmtsträgerInnen die Eröffnung und Moderation dieser Debatten wichtiger werden. Eine lebendige diskursive Partei darf nicht durch die Angst um das äußere Bild von Zerstrittenheit verhindert werden, sondern muss sich diesem Widerspruch stellen und ihn durch Transparenz und mögliche Partitizipation aufbrechen. Kapitel III: Jenseits von Parteien und Parlamenten Von der Lobby zur NGO Viele Menschen, die am politischen Geschehen mitwirken wollen, wenden sich von Parteien ab und NGOs, Bürgerinitiativen und „Pressure Groups“ zu oder engagieren sich anderweitig ehrenamtlich. Uns sollte nachdenklich stimmen, dass die Mitgliedschaft bei BUND, Greenpeace oder Attac von vielen, vor allem jungen Menschen als gleichwertige Form der Partizipation am Politischen gesehen wird. „Ich will Politik machen, ich weiß aber nicht, ob ich zu Attac gehe oder ob ich in eine Partei eintrete“, sagen sich viele Menschen. Fatal dabei ist, dass solche Organisationen zwar im Modus des Protestes operieren, aber nicht faktisch an dem Ort, der der angestammte Ort der Verteilung von Macht ist: der Schnittstelle zwischen Parteien und Regierung, bzw. Verwaltung. Sie müssen nicht zwischen verschiedenen Interessen moderieren sondern verkörpern geradezu bestimmte Themen und Interessen. Daher ist Schritt von der NGO zur Lobbygruppe nicht weit – auch wenn hier eine Lobby „für die gerechte Sache“ am Werk sein mag. Vor allem AktivistInnen in Bürgerinitiativen zeigen sich frustriert von Parteien. Sie sagen: „wir brauchen Euch Parteien nicht, wir nehmen unsere Geschicke selbst in die Hand.“ Bestenfalls ist die Politik Adresse des jeweiligen Anliegens. Oder Bürgerinitiativen stellen, wie in Stuttgart geschehen, eigene Kommunalwahllisten auf. Dabei können solche Listen ab und an ordentliche Erfolge verbuchen, selbst wenn Sie vielfach unter der 5%-Hürde bleiben. Oft suchen solche Bürgerinitiativen Lösung für ihre Anliegen in mehr direkter Demokratie, weil sie eine Mehrheit hinter sich vermuten. In schlimmeren Fällen wird die parlamentarische Demokratie als Staatsform komplett abgelehnt. Oder als Alternative zum komplexen politischen Entscheidungsprozess in Parteien wird ein „tatkräftiger Unternehmer“ als Erlösungsgestalt gegen die „korrupten Politiker“ gesetzt, wie das Beispiel Italien zeigt. Wohin die Erosion von Parteien führt, kann gerade am Beispiel des postdemokratischen Italiens verfolgt werden. Der Zusammenbruch der Democrazia Christiana 1994 führte zum Aufstieg des Medienunternehmer Silvio Berlusconi und seiner Retortenpartei „Forza Italia“, die sich ebenfalls als „Anti-Parteien-Partei“ geriert. Berlusconi sieht sich selbst als Alternative zur alten Politikerklasse, als „Unternehmer im Dienste der Politik.“ Auch in Deutschland können solche Phänomene beobachtet werden, beispielsweise die „Freien Wähler“. Diese Partei tritt mit höchst unterschiedlichen Interessen vornehmlich bei Kommunalwahlen an. 2008 gewannen sie bei den Landtagswahlen in Bayern 10,2%. Sie profitieren von der zunehmenden Erosion in das Vertrauen der Parteien, ohne jedoch – abseits des radikalen Pragmatismus – ein grundsätzliches Politikangebot zu formulieren. Mit dieser Art von Kirchturmpolitik lässt es sich sehr einfach regieren, ist im Zweifelsfall doch immer die nächsthöhere politische Ebene Schuld, die entweder die falschen Rahmenbedingungen setzt oder aber zu wenig Geld bereitstellt. Doch auch bei Bürgerinitiativen und NGOs sind keine goldenen Zeiten angebrochen. Auch hier wird über Nachwuchsmangel und über die abnehmende Bereitschaft geklagt, längerfristig Verantwortung zu übernehmen. Lange, nervtötende Diskussionen um Kleinigkeiten haben schon so manchen Interessenten aus einer hoffnungsvollen Bewegung vertrieben. Und auch ehrenamtliches Engagement außerhalb der Politik ist seltener und weniger verbindlich geworden. Oft verwechseln auch wir GRÜNE in der praktischen Politik Lobbyismus mit Mehrheitsmeinung und das Verbandswesens mit der Bürgergesellschaft, einer Bürgergesellschaft, die für uns immer schwerer erreichbar ist. Die Stärkung der innergesellschaftlichen Verantwortung muss eines der Kernanliegen grüner Politik sein. Welche Gründe hat dieses veränderte Verhalten? Ist es mangelnde Solidarität und Egoismus wie schnell von konservativer oder linker Seite vermutet wird? Oder ist dieser gesellschaftliche Wandel nicht ebenfalls ein Ausdruck von einem neuen komplexeren Lebensverständnis, dass mit neuen Herausforderungen, wie internationaler Informationsvernetzung und durch die Diversität an Lebensentwürfen auch neue Antworten verlangt? Jenseits von Parteien und Parlamenten II: Institution matters! Viele Parteien und Bürgerbewegungen haben als wichtigste und oftmals einzige Lösung zur Stärkung der Demokratie die Forderung nach mehr Beteiligung durch Plebiszite auf ihrer Agenda. Auch bei Stuttgart 21 wird dies oft und gerne als Argument genannt. Dabei wird vergessen, dass der Gemeinderat demokratisch gewählt wurde und keine der Stuttgart 21 befürwortenden Parteien aus ihrer Haltung je einen Hehl gemacht hat. In vielen Fällen sei dieses Ausspielen von Unmittelbarkeit versus Repräsentation ein kapitaler Fehlschluss, schreibt Peter Siller, der für die GRÜNEN maßgeblich das Grundsatzprogramm entwickelte: „Wenn wir in der Globalisierung demokratische Verfahren anstreben, die eine Vielzahl von Betroffenen gleichermaßen berücksichtigen, ist das in erster Linie ein Kampf um gerechte Repräsentation. Die Erfahrung schon in kleineren Einheiten zeigt: Unter Bedingungen begrenzter Zeit ist ein nicht handhabbares Maß an Unmittelbarkeit der beste Nährboden für Verbandsdespoten und Parteiautokraten im informellen Raum. Eine Demokratievorstellung, die auf den geschäftigen Vollzeitbürger setzt, bekommt am Ende die Diktatur des Bürgeradels oder blanken Populismus“. Er führt die Institutionen als Orte der Demokratie ins Feld: „Wir brauchen durchlässige, partizipative öffentliche Institutionen, in denen sich eine gerechte Repräsentation der Beteiligten organisiert.“ Dies setzt jedoch das Engagement von Initiativen und Bewegungen voraus, wie es ja bereits bei Stuttgart 21 der Fall ist. Auch wenn es falsch ist, direkte Demokratie gegen Repräsentation auszuspielen, brauchen wir mehr direkte Beiteiligungsformen, die zu mehr gemeinsamer Debatte und mehr Beteiligung führt. Dies ist vor allem dort machbar, wo die Anzahl der Betroffenen überschaubar bleibt, also vor allem auf der Ebene der Stadtteile und Bezirke in Stuttgart. Wichtig ist auch die Stärkung des Gemeinderates und der Bezirksbeiräte. Vor allem aufgrund der baden-württembergischen Kommunalverfassung besteht im „Ländle“ ein schleichender Übergang parlamentarischer Aufgaben in den Bereich der Verwaltung. Die Verwaltungen setzen – beispielsweise bei Bauvorhaben - oft derart starke Akzente, dass sie für die gewählten Vertreter kaum mehr kontrollierbar sind. Die kommunalen Parlamente können sich nur dann gestärkt werden, wenn sie sich auf die grundlegenden politischen Weichenstellungen konzentrieren, mittel- und langfristige Konzepte verabschieden und nachvollziehbare Auseinandersetzungen führen, anstatt sich auf Verwaltungsvorschriften und Routinen zurückzuziehen. Wie können wir in Stuttgart auf Landes- und auf kommunaler Ebene dazu beitragen, öffentliche Institutionen zu demokratisieren? Wie schaffen wir mehr Orte der Demokratie ohne uns in endlosen Beiratsunwesen zu verheddern, dessen Entscheidungen ohnehin kaum Gewicht haben? Wie schaffen wir mehr direkte Beteiligungsformen im Rahmen unserer Kommune?