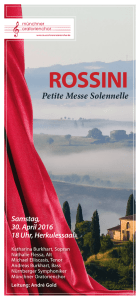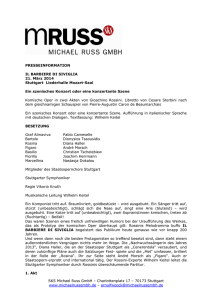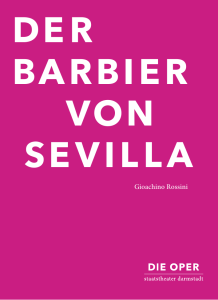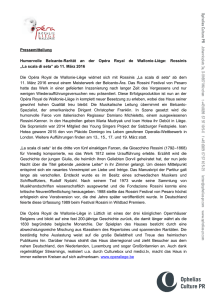Gioacchino Rossini Der Barbier von Sevilla
Werbung

Gioacchino Rossini Der Barbier von Sevilla Heute Abend steht Ihnen ein reines Vergnügen bevor: Rossinis Barbier ist die bedeutendste und wohl auch die beste Opera buffa, die es überhaupt gibt! Dass wir sie heute in Langenthal hören können, ist eine grosse Freude und keineswegs selbstverständlich! Eigentlich stammt sie aus einer ganz anderen Welt, die mit unseren Tagen wenig mehr gemein hat. Viele, viele Opern dieser Zeit sind heute völlig vergessen oder ungeniessbar, wenn doch jemand wieder einmal eine Aufführung riskiert. Nicht so Rossinis Barbier! Er hat in den nun fast zweihundert Jahren seit seiner Uraufführung in Rom 1816 nichts an Frische eingebüsst, aktuell ist er ohnehin immer; das heisst, die Frage nach der Aktualität stellt sich gar nicht, der Barbier ist jenseits solcher Überlegungen. Denken Sie nur etwa an die satirische Radiosendung in den Sechzigerjahren: Walter Roderer als „Der Barbier von Seldwyla“, dann erkennen Sie die Zeitlosigkeit dieser Figur. Wir müssen uns vor Augen halten, dass Oper etwas ganz anderes war als heute. Das Opernhaus des frühen 19. Jahrhunderts war ein Treffpunkt, kein Musentempel, man könnte sie sogar eine Art „Freizeitzentrum“ nennen. Die Oper war in erster Linie ein gesellschaftlicher Ort, erst dann ein Ort der Kunst. Das Theater als „moralische Anstalt“, als Ort der Bildung, ist eine deutschbürgerliche Vorstellung seit der Aufklärung. Die Oper zur Zeit Rossinis war das nicht. Man traf sich, machte Geschäfte, spielte an den Spieltischen, erfrischte sich und suchte einander in den Logen auf. Man spielte zwischen den Akten einer Oper meist noch ein bis zwei Ballette – etwas heute Unvorstellbares. Opernabende dauerten dann fünf bis sechs Stunden. Aber man war ja nicht an seinen Platz gefesselt. Es war ein Kommen und Gehen. Die Oper war auch nicht ein hochsubventioniertes Haus, sondern eine privatwirtschaftliche Unternehmung. Man spricht von der Unternehmeroper des frühen 19. Jahrhunderts. Der Impresario, der Besitzer der Oper, war der Chef, dem sich alles unterzuordnen hatte, er führte das Theater gewinnorientiert, wie das Unternehmer so zu tun pflegen. Und es konnten ungeheure Gewinne gemacht werden. Der Komponist hatte einen Vertrag mit dem Impresario über das Herstellen, das Einstudieren und die Aufführungen einer Oper. Eine Gewinnbeteiligung gab es nicht, das finanzielle Risiko trug der Impresario. Das hatte alles – es liegt nahe – eine grosse Auswirkung auf die Musik und die Komponisten. Es war ganz selbstverständlich, dass ein Komponist seine Einfälle und Melodien mehrfach verwendete. Es war gang und gäbe, Melodien, Arien, die gefallen hatten, in anderem Zusammenhang wieder zu verwenden. Der Komponist hatte eine Anzahl Versatzstücke, die er wieder einsetzen konnte. Der musikalische Zusammenhang mit der Handlung der Oper war sekundär. Das ändert erst mit Verdi und Richard Wagner. Rossini hat zum Beispiel die Ouvertüre zum Barbier bereits vorher zwei anderen Opern vorangestellt, was wir also als Ouvertüre zum Barbier von Sevilla kennen, ist auch die Ouvertüre der Elisabetta und einer weiteren Oper. Niemand störte sich daran, das war üblich, und bei der schlechten Bezahlung der Komponisten auch nicht verwunderlich. Oft wurde einer Melodie einfach ein anderer Text unterlegt, man nennt dieses Verfahren Parodie. Dann musste die Musik auch immer wieder den Wünschen der Sängerinnen und Sänger angepasst werden. Die machten ohnehin, was sie wollten. Sie verzierten die Arien ad libitum in einer fast unzumutbaren Weise, um ihre Virtuosität unter Beweis zu stellen. Rossini soll einmal seine eigene Musik nicht wieder erkannt haben. Oft gaben die Komponisten auch nur ein Schema vor, dass die Sänger dann improvisierend ausfüllten. Rossini Gioacchino Rossini: Der Barbier von Sevilla hat sich gegen diese eitle Verzierungswut gewehrt und begonnen, die Verzierungen festzulegen und auszuschreiben, was ihm hundert Jahre später den Vorwurf eingetragen hat, er sei der Schöpfer all der Verzierungen, weil sie bei ihm eben in der Partitur stehen. Die Entstehungsgeschichte des Barbiers ist von dieser Zeitgeschichte der Oper bestimmt. Und sie ist seltsam genug. Rossini war 23 Jahre alt und hatte schon 13 Opern komponiert und mit Erfolg aufgeführt, als er mit dem Impresario des „Teatro della Torre Argentina“ in Rom einen Vertrag einging für eine Opera buffa. Er reiste Anfang November 1815 nach Rom, für den 15. des Monats war bereits die Aufführung vorgesehen. Rossini hatte noch nicht einmal das Textbuch. Dies sollte ihm in Rom „rechtzeitig“ übergeben werden. Dieser ungeheure Stress, der jedem anderen den Schlaf geraubt hätte, hat Rossini offenbar nicht bewegt. „Il Barbiere di Siviglia“ ging dann zwar erst am 20. Februar 1816 in Szene, aber auch so hatte Rossini kaum Zeit für die Komposition. Die Legende sagt, er habe die Oper in einer Woche niedergeschrieben, er selbst spricht Richard Wagner gegenüber von 13 Tagen. Ein Monat dürfte wohl der Wahrheit am nächsten kommen. Immerhin hat er dann pro Tag etwa 20 Seiten Musik komponieren und schreiben müssen. Dann gab es aber zuerst ja nur diese einzige Partitur, sie musste unzählige Male abgeschrieben werden, die Einzelstimmen für Sänger und Instrumente wurden natürlich von Hand hergestellt. Und einstudieren musste man die Oper auch noch. Gewiss, man musste sich mit sechs oder sieben Proben zufrieden geben; erst Verdi hat dann für seinen Macbeth hundert Proben verlangen können. Das unheimliche Tempo, in dem Rossini arbeitete, zeigt uns dreierlei. Einerseits natürlich das Genie Rossinis, das offenbar in Lage war, geniale Musik einfach aufzuschreiben. Es zeigt uns aber auch, dass der Komponist im Operntheater nicht die Hauptfigur war. Er hatte Musik zu liefern, zu irgendeinem Textbuch. Darauf hatte er keinen Einfluss. Er musste vertonen, was ihm vorgelegt wurde und zu dem er sich vertraglich verpflichtet hatte. Es wundert daher auch nicht, dass der Komponist ohne weiteres eben Sequenzen, Versatzstücke aus anderen Opern verwendet hat. Ein enger Zusammenhang von Handlung und Musik – wie er für Verdi unabdingbar sein wird – war zweitrangig. Die Handlung der Oper lag auch nicht in der Musik, also in den Arien, sondern in den Rezitativen. Diese sind musikalisch sehr einfach und nur vom Cembalo begleitet. Wenn jemand sich verpflichtet in ein paar Wochen eine Oper zu schreiben und einzustudieren, dann kann die Musik nicht viel anders als schematisch sein. Das gilt auch für Rossini. Nur war die Art, wie er das Schema füllte, dann doch eine andere. Etwas Drittes zeigt dieses Tempo wohl auch noch: Es gab damals kein Regietheater. Dass bei fünf oder sechs Proben noch ein Regisseur seine Ideen verwirklicht hätte, ist auszuschliessen. Er musste sich wohl damit zufrieden geben, wenn die Sänger zum richtigen Zeitpunkt auf oder abgingen. Vielleicht sollten sich die Anhänger von so genannten „historischen“ Aufführungen mit meistens schlechten Instrumenten aus der Zeit dies auch einmal überlegen. Rossini bekam das Textbuch zu einer Oper nicht rechtzeitig, offenbar hatte es Schwierigkeiten mit der Zensur gegeben. Die Opernzensur ist überhaupt ein wichtiges und bisher kaum beachtetes Kapitel der Operngeschichte. Sie war nicht nur ein Machtinstrument gegen die Oper, sondern in vielem auch ein Mittel zur Qualitätssicherung, wie man heute sagen würde. In dieser Situation schlug der Librettist Serbini ein Textbuch nach Beaumarchais Komödie „Le Barbier de Seville“ vor. Dieses Theaterstück war bereits unzählige Male vertont worden und ohne Probleme durch die Zensur zu bringen. Die berühmteste Vertonung stammte von Giovanni Paesiello, sie hatte In Italien Triumphe erlebt. Und Rossini sollte nun zur Erfüllung seines Vertrages wieder denselben Stoff vertonen. Eine undankbare Sache, würde 2 Gioacchino Rossini: Der Barbier von Sevilla man meinen. Und wir staunen, dass sich Rossini dazu hergegeben hat. Wir sehen auch daran wieder, dass Oper etwas anderes war zu Beginn des 19. Jahrhunderts! Rossini fand noch Zeit, Paesiello einen Brief zu schreiben, um ihn zu fragen, ob er mit der Neuvertonung einverstanden sei. Paesiello gab höflich seine Zustimmung. Erst dann begann Rossini mit der Komposition. Die Uraufführung am 20. Februar 1816 soll eine Katastrophe gewesen sein. Es hatten sich wohl alle Paesiello-Verehrer im Theater eingefunden, entschlossen, die Neuvertonung ihres Meisterwerks mit allen Mitteln zu bekämpfen. Dann soll es auch zu mehreren Pannen gekommen sein, sodass es am Schluss um den Barbier geschehen war. Er fiel durch. Ein Fiasko bei der Uraufführung ist in der Operngeschichte nicht ungewöhnlich. Verdis Traviata ist in Venedig ebenso durchgefallen, dort angeblich, weil die Sopranistin, eine Frau ausserordentlicher Körperfülle, nicht in der Lage war, glaubhaft an Tuberkulose zu sterben, Wagners Tannhäuser und Puccinis Butterfly sind bei der Premiere durchgefallen. Vielleicht ist es aber auch gerade die Genialität dieser Opern, welche die Zuschauer beim ersten Mal schlicht überfordert hat. Die nächste Aufführung schon – Rossini war vorsichtshalber nicht mehr im Theater erscheinen und überliess die Aufführung dem zweiten Kapellmeister – geriet zu einem Triumph, der nun seit zwei Jahrhunderten anhält. Caron de Beaumarchais hat vor allem zwei Theaterstücke geschrieben, mit denen er durch Rossini und Mozart unsterblich geworden ist. „Der Barbier von Sevilla“ und die Fortsetzung „Die Hochzeit des Figaro“. Auch Goethes Clavigo geht auf die Tagebücher von Beaumarchais zurück. Es ist eigentlich erstaunlich, dass die Zensur die Stücke Beaumarchais zur Vertonung freigegeben hat. Es sind ja revolutionäre Stücke oder sogar Revolutionsstücke! Beaumarchais macht sich lustig über den Adel, über dessen Libertinage und amouröse Abenteuer. Eigentlich sind die beiden Opern sosehr Revolutionsopern wie Beethovens Fidelio oder Cherubinis „Wasserträger“. Nur sind es eben Komödien. Aber eine Komödie kann mindestens ebenso politisch sein, wie eine ernste Oper. Ich möchte am Schluss darauf noch einmal zurückkommen. Nun wenden wir uns dem Barbier in engerem Sinne zu. Zuerst geht es um den Inhalt der Oper, deren Handlung ziemlich kompliziert ist. Graf Almaviva sieht auf der Strasse in Madrid ein hübsches Mädchen, ist sofort verliebt und folgt ihr, in der Hoffnung auf eine Zusammenkunft. Diese ergibt sich aber nicht, er vernimmt nur, dass das Mädchen Rosina heisst und aus Sevilla stamme; Rosina erfährt, der lästige Mann, der sich an ihre Fersen geheftet hat, sei Graf Almaviva. Das geschieht aber alles vor der eigentlichen Handlung. Man muss es einfach wissen, beziehungsweise aus der Handlung ableiten. Der Vorhang geht auf und wir sehen den Grafen, der nun nach Sevilla gereist ist, vor dem Balkon seiner Liebsten. Sie pflegt in den Morgenstunden dort zu erscheinen. Der Graf reist inkognito, Rosina soll den Menschen, nicht den Grafen lieben. Rosina hat den jungen Mann natürlich längst bemerkt, sie spielt ihm geschickt ein Notenblatt zu, natürlich hat auch sie längst eine innige Zuneigung zu ihm gefasst. Er stellt sich ihr nun singend vor, nennt sich Lindoro, ein Mann geringen Standes, der aber rein und ewig zu lieben wisse. Rosina nimmt den Refrain seines Liedes auf und versichert den Grafen nun ihrerseits ihrer unwandelbaren Liebe. Damit könnte die Oper zu Ende sein, aber jetzt kommen die elenden Verwicklungen. Da ist zuerst der alte Dr. Bartolo, der Vormund von Rosina. Er will sie heiraten, denn sie ist nicht nur schön, sondern auch reich. Da er aber natürlich nicht Rosinas Mann der Wahl ist, muss er sein Mündel einsperren und vor jeder Begegnung mit anderen Männern schützen. Als er nun noch erfährt, dass der Frauenheld Almaviva aus Madrid eingetroffen sei, wittert er Gefahr für seine Absichten und beschliesst, zu handeln und sofort zu heiraten. Sein Gehilfe ist der Musiklehrer im geistlichen Stande Don Basilio. Dieser ist ebenso bestechlich, wie intrigant. Durch einen Beutel 3 Gioacchino Rossini: Der Barbier von Sevilla mit Geld motiviert, bereitet er alles zur Hochzeit vor. Er soll dazu noch eine Verleumdungskampagne – italienisch eine Callunnia - in die Welt zu setzen, um den Grafen zu verunglimpfen und auszuschalten. Gegen diese Raffinesse in Liebesdingen ist die reine Liebe der jungen Leute machtlos. Da braucht es nun einen noch raffinierteren Kopf, nämlich Figaro, den Barbier von Sevilla. Er ist ein Tausendsassa, ein Faktotum – von lateinisch fac totum, der Allesmacher – Er stellt sich vor in der weltberühmten Arie „largo al factotum della città“ als einer, der alles kann, von allen gebraucht und gerufen wird, dann aber doch mit seiner Stellung als Barbier zufrieden ist, da er in diesem Beruf in alle Häuser und Familien kommen kann, um seine Fäden zu spannen und seine Netze auszulegen. So weiss er um die Verhältnisse im Hause Bartolo bestens Bescheid. Auch kennt er den Grafen von früher. Die Gelegenheit, dem Geizkragen Bartolo eins auszuwischen, Rosina zu ihrem Glück zu verhelfen und dazu noch vom Grafen belohnt zu werden, lässt er sich nicht entgehen. Mit einem Schlaf- und einem Niespulver setzt er zuerst einmal die beiden Diener Bartolos ausser Gefecht. Er belauscht das Gespräch zwischen Bartolo und Basilio und ist dadurch über die geplante Calunnia im Bilde. Es gelingt ihm, Rosina zu sprechen und ihr zu sagen, dass Lindoro, der Graf, sie liebe und um ein Zeichen ihrer Zuneigung bitte. Rosina ziert sich zuerst, wie es sich gehört, holt dann aber den bereits längst geschriebenen Brief hervor. Auch sie ist raffiniert, muss es aber auch sein, denn sofort entdeckt Bartolo Tinte an ihren Fingern; auch fehlt ein Blatt Briefpapier, damals noch ein wertvoller Gegenstand! Figaro will, dass der Graf und Rosina fliehen können, bevor Bartolo sie heiratet. Erster Versuch: Er überredet Almaviva, sich als Offizier zu verkleiden, betrunken zu stellen und im Hause Bartolo Quartier zu verlangen. Dummerweise hat aber Bartolo ein Dokument, das ihn berechtigt, militärische Einquartierungen abzuweisen. Trotzdem gelingt es dem Grafen, Rosina ein Zettelchen zuspielen. Zweiter Versuch: Der Graf erscheint als Musiklehrer, gibt sich als Don Alonso aus und sagt, er sei der Stellvertreter des erkrankten Don Basilio. Er übergibt – Höhepunkt der Raffinesse – Bartolo den Brief Rosinas an Lindoro, den er vom Grafen Almaviva erhalten habe. Im übrigen sei Almaviva ein Schurke und Frauenheld, der nur mit Rosina spielen wolle. Bartolo fasst Vertrauen zu Don Alonso, er glaubt, die von Don Basilio versprochene Calunnia zu spüren. In der Musikstunde gelingt es Don Alonso, als Bartolo für einen Moment eingeschlafen ist, sich als Lindoro zu erkennen zu geben und alles scheint zu klappen. Da erscheint aber, wie könnte es anders sein, zum Entsetzen aller der kerngesunde Don Basilio. Figaro gelingt es, ihm eine wohlgefüllte Geldbörse zuzustecken, so dass er sich nun bereitwillig sehr krank fühlt und wieder abgeht. Rasch versucht der Graf, Rosina von der nötigen Flucht zu überzeugen. Bartolo erhascht das Wort „travestimento“ Verkleidung und wirft den falschen Musiklehrer hinaus. Nun muss alles schnell gehen! Bartolo bestellt den Notar noch für den nämlichen Abend, um den Ehekontrakt zu unterzeichnen. Er zeigt Rosina den Brief, den er von Don Alonso erhalten hat, und sagt, er habe ihn vom Grafen. Damit ist der Höhepunkt der Konfusion erreicht. Rosina denkt, Lindoro sei nur ein Mittelsmann des Grafen, der ihr seine Liebe nur vorgespielt habe. Sie ist tief gekränkt und entdeckt Bartolo die geplante Flucht mit Lindoro. Bartolo geht, um die Polizei zu holen. In diesem Moment steigen Figaro und Lindoro ein. Rosina reagiert kühl, da gibt sich Lindoro als Graf zu erkennen und sofort ist die Liebe wieder da. In diesem Moment kommen der Notar und Don Basilio, ein voller Geldbeutel überzeugt Basilio schnell, neben Figaro Trauzeuge für die Vermählung von Rosina mit dem Grafen zu spielen. Der Notar weiss natürlich nicht, wen er hier eigentlich mit wem vermählen sollte, er muss also zum Mitmachen gar nicht erst überzeugt werden. Der 4 Gioacchino Rossini: Der Barbier von Sevilla Ehekontrakt ist schnell unterzeichnet. Als Don Bartolo mit der Polizei kommt, ist er der Geprellte. Rosina und der Graf sind verheiratet! Aber auch ihm lacht das ihm eigentliche Glück: der Graf verzichtet auf die Mitgift und überlässt sie Bartolo, was diesen weitgehend versöhnt. Eine unmögliche Komödie der Verwicklungen und Verwirrungen – sie schreit förmlich nach Musik, und es ist nicht verwunderlich, dass sie oft vertont worden ist. Aber Rossinis Oper ist die beste von allen, keine Frage! Sie ist die beste, weil Rossini diese ganze wirre Handlung mit einer geradezu göttlichen Ironie überstrahlt. Man könnte diese Komödie vertonen und den Don Bartolo als Trottel, Don Basilio als Lüstling, den Figaro als aufgeblasenen Kerl und Rosina als raffinierte Zicke darstellen. Das macht Rossini nicht. Die Musik ist voller Liebe zu all den Figuren. Die Trottelhaftigkeit Don Bartolos ist bei Rossini menschlich und liebenswert. Rossini schafft es in seiner Musik, durch Ironie diese Figuren liebenswert zu machen. Echte Ironie ist immer von Liebe getragen. Er schafft es, durch seine Musik, sich gleichsam mit uns Zuhörern über die menschlichen Schwächen dieser Figuren zu verständigen. Und wir lächeln mit Rossini zusammen über menschliche Unzulänglichkeit und werden gewahr, dass eigentlich wir gemeint sind, dass wir über uns selber lächeln – und noch wichtiger: dass uns ein Mensch, der die Menschen liebt, einen Spiegel vorhält. So etwas schaffen nur Rossini und – mit anderen Mitteln – vorher Mozart. Rossini erreicht diese Ironie mit der absoluten technischen Beherrschung der Mittel der Opera buffa, er führt diese Mittel zum Höhepunkt, oder besser gesagt: er treibt sie auf die Spitze. Der Barbier wird damit zur Apotheose der Opera buffa. Nach dem Barbier stirbt sie aus. Rossini hat nach 1817 von keinem italienischen Theater mehr einen Auftrag für eine Opera buffa bekommen. Was sind aber die musikalischen Mittel der Buffa, die Rossini auf die Spitze treibt? Wir müssen dazu noch einmal zur Opera seria zurückkehren, da die Buffa sich aus der Seria entwickelt. Die Opera seria ist die Oper des 18. Jahrhunderts. Sie ist eine Adelsoper, gespielt in den Hoftheatern, nicht in der Unternehmeroper, sie zeigt Sinnbilder des menschlichen Seins, grosse Tragik der Götter und Könige. Die Mythologie ist ihre Welt, in der sich Adel bespiegelt. Sie ist für unsere Begriffe steif und unnatürlich, vor allem, wenn wir bedenken, dass die Hauptrollen darin von Kastraten, männlichen Sopranen, gesungen wurden. Zwar soll der Klang einer Kastratenstimme berückend und einzigartig gewesen sein, doch dass in der Opera seria bei Händel zum Beispiel Julius Cäsar von einem Sopran verkörpert und gesungen wird, ist uns heute fremd. Als Gegenstück zur Opera seria entwickelte sich die Opera buffa: Zuerst wurden einzelne lustige Szenen in die grosse Tragik der Seria eingefügt, später wurde daraus die abendfüllende Opera buffa. Die Buffa greift alltägliche Situationen auf, sie dient der Unterhaltung und ist damit ein typisches Kind der Unternehmeroper. Die Handlung der Buffa geht aus von der „Commedia dell’arte“, der italienischen Stegreifkomödie mit ihren typisierten Figuren, mit denen man unzählige Handlungen improvisieren konnte. Die Operngeschichte ist äusserst komplex, ich vereinfache hier gewaltig. Von den Opere Buffe kennen wir heute die Meisterwerke von Mozart und von Rossini; doch das sind eben Meisterwerke, die in ihrer Grösse und Bedeutung nur bedingt repräsentativ sind für die Geschichte der Oper. Wolfgang Amadeus Mozart ist gleichsam der Vollender der Opera buffa, er deutet die Figuren klassisch aus und macht sie zu Individuen, Gioacchino Rossini aber ist der Höhepunkt der künstlerischen Mittel der Opera buffa. Die Opera seria hat musikalisch ein klares Schema: Rezitativ und Arie. Das Rezitativ war musikalisch einfach, oft auch nur improvisiert, der Komponist gab die 5 Gioacchino Rossini: Der Barbier von Sevilla Harmonien an, mehr nicht. Begleitet wurde das Rezitativ von Cembalo. Diese Rezitative nennt man Secco-Rezitative, „secco“ heisst „trocken“, also ohne Orchester. In diesen Rezitativen findet die Handlung der Oper statt. Hier wird agiert, hier herrscht Bewegung hier „geht es weiter.“ Nach dem typischen Rezitativschluss Dominante – Tonika beginnt die Arie. Die Arie steht ausserhalb der Handlung. Der Sänger tritt an die Rampe, verlässt also gleichsam das Spiel und singt seine Arie, wie ein Instrumentalsolist. Die Arie handelt von hohen Leidenschaften, von tragischen Verwicklungen, von Liebe und Tod und menschlicher Grösse. Wenn sie fertig ist, tritt der Sänger wieder zurück in die Handlung, ins Spiel. Dieses Schema ist geeignet für mythologische Stoffe, wenn Götter und Könige agieren und musikalisch über das Leben nachdenken. Die Buffa nun aber will unterhalten, ihr Stoff stammt aus dem Alltag, sie nährt sich von der Commedia dell’arte mit ihren Typen: dem vertrottelten Alten, dem listigen Diener, der raffinierten Magd. Mit diesen Figuren ein einleuchtendes Stück zu machen, da ist die Form Rezitativ und Arie völlig ungeeignet. Da muss man die Arie und die hohe Tragik, die darin zum Ausdruck gebracht wird, ernst nehmen können. Würde der vertrottelte Alte eine Arie im Stil der Seria singen, wäre das vielleicht zwar durchaus komisch, aber unfreiwillig. Die Entwicklung, die nun beginnt, ist klar: die Buffa löst das starre Schema, Rezitativ und Arie = Handlung und Kontemplation, allmählich auf. D.h. die Handlung zieht sich in die Musik hinein, sie geht über das Rezitativ hinaus. Das ist in der Musikentwicklung ein gewaltiger Schritt. Konnte die Musik in der Seria einfach schön und eindringlich sein, musste sie in der Buffa selber gleichsam zu handeln beginnen! Sie muss sich der Situation auf der Bühne anpassen, sie muss das, was da geschieht, direkt einbeziehen, kommentieren, ausdrücken. Die Arie verliert damit mehr und mehr an Bedeutung, auch die Arie wird in die Handlung einbezogen, ist nicht einfach mehr reflektierend, obwohl sie diesen Charakter behält. (Das ergibt ein neues Problem, das wir bei Verdis Nabucco analysiert haben: es ist schwierig, nach einer Arie wieder in die Handlung hineinzufinden!) Die Oper wird als ganzes dynamisch, das ist der grosse Schritt von der Seria zur Buffa. Die Seria stellt das Gefühl dar, die Buffa ist das Gefühl. Da haben sie nun den Rossini ganz: Seine Musik – im Barbier ist handelnd, nicht ausdeutend! Die Musik handelt und sie handelt atemberaubend. Es ist nicht die musikalische Entwicklung, die thematische und motivische Arbeit, die Differenzierung, die den Barbier und seinen Erfolg ausmacht, es ist die direkte musikalische Handlung. Ein Beispiel: Es gibt im Barbier eine Gewittermusik – la tempesta! Das Gewitter deutet hier nichts aus, es ist nicht der Mahnfinger Gottes, der den Menschen an seine Hybris gemahnt! Nein, es ist einfach ein Gewitter, es donnert und blitzt und regnet und die Flucht von Rosina und dem Grafen wird vorerst verhindert. Eine Musik, die handelt, das hat nun klar formale Folgen! Es ist nicht der Sonatensatz, der entwickelnde, der im Vordergrund steht, nicht die Durchführung, die bei Mozart ein Abbild ist der menschlichen Entwicklung. Der Buffo-Stil ist der folgende: Man komponiert ein szenisches Motiv, das zur Handlung passt und kurz und eindringlich ist. Es sind oft nur ein paar wenige Takte. Dieses Motiv bestimmt nun die ganze Arie, aber es wird nichts aus ihm entwickelt, es wird immer wieder wiederholt, variiert, sequenziert, melodisch verändert, lauter und leiser, diesem, dann jenem Instrument zugeordnet. Die Arie der Buffa ist eine Kettenreaktion. Das ist das Geheimnis der Wirkung: Durch die ständige Wiederholung ergibt sich eine drängende, vorwärts stürmende Motorik, die uns Zuschauer in den Bann schlägt und elektrisiert. Das kleine Motiv setzt sich wie eben in der Kettenreaktion – fort und entzündet sich selbst wieder in der nächsten Wiederholung. 6 Gioacchino Rossini: Der Barbier von Sevilla Ich will Ihnen das an der grossen Auftrittsarie des Figaro „Largo al factotum“ zeigen. Die Anlage ist sehr einfach, harmonisch wie formal. Es werden – in der Rondoform – immer wieder die gleichen Motivteile aneinandergereiht, entwickelt wird nichts. Das Orchester wiederholt drei Mal die gleiche Begleitung, variiert wird der Text Figaros: beim ersten Mal trällert er nur, beim zweiten Mal zählt er auf, wer ihn alles ruft und wozu: „Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono“, beim dritten Mal ahmt er nach, wie alle ihn rufen: „Figaro… son qua“. Es ist letztlich unmöglich, diese Musik zu erklären. Zum Glück werden wir sie heute Abend hören! Man kann aber diese Technik Rossinis, der variierenden Wiederholung gleicher Motive, gut hören und nachvollziehen. Wir haben gesagt, dass die Musik die Handlung übernehme. So ist es auch hier: Figaro ist ein Komödientyp, er ist kein Individuum. Das sind alle Figuren im Barbier, es sind Typen, nicht Individuen. Der Typus entwickelt sich nicht, er bleibt, wer er ist. Keine der Figuren entwickelt sich. Don Bartolo bleibt ein Geizhals, Figaro ein aufgeblasener Kerl. Das ist jedoch nicht alles. Ich habe gesagt, dass Rossinis Barbier unsterblich geworden sei, weil seine Musik durch ihre Ironie uns die Figuren liebenswert mache. Das will ich Ihnen an zwei Bespielen zeigen, zuerst am Terzett im zweiten Akt: „Ah, qual colpo inaspettato“. Figaro hat es soweit gebracht, dass der Graf und Rosina nun flüchten könnten. Die Leiter steht am Balkon, man müsste sie jetzt nur benützen. Rosina hat sich soeben von der Nachricht erholt, dass Lindoro und Graf Almaviva ein und dieselbe Person sind. In einer schönen, nicht überschwänglichen Melodie drückt sie die neu aufgeflammte Liebe aus. Der Graf übernimmt im Kanon diese Melodie. Figaro rühmt sich, dass er der Urheber sei all diesen Glücks. Ein wunderbares Terzett entsteht, Rosina und der Graf in seliger Liebe, Figaro kontrastiert durch seine wiederholten Aufrufe, endlich vorwärts zu machen mit der Flucht. Da kommen plötzlich Leute, Don Basilio und der Notar, und drohen die Leiter wegzunehmen. Die Ironie: Das Terzett dreht sich auf der Stelle, in sich selbst, kommt nicht vorwärts, weil Rossini die drei alle Regeln der Kanonform durchspielen lässt, bis zum bitteren Ende. Und wenn der Zuhörer längst weiss, dass es jetzt zu spät ist, setzt – ganz nach Schema – noch die Reprise ein „zitti, zitti, piano, piano“ und wird durchexerziert bis zum Schluss. Natürlich ist dann die Leiter fort. Das ist zwar im weiteren Verlauf günstig, weil der Notar nun gleich den Grafen und Rosina trauen kann. Rossini macht sich über die Oper und ihre Konventionen, ihre starren Formen lustig, welche einer vernünftigen Handlungsführung entgegen stehen. Stendhal, der grosse französische Schriftsteller, der erste Biograph Rossinis, hat diese Ironie völlig verkannt und vorgeschlagen, man müsste dieser Musik einen anderen Text unterlegen, um den Widerspruch zwischen Form und Inhalt zu aufzuheben. Das zweite Beispiel Auftrittsarie des Don Bartolo „A un dottor del mia sorte“. Bartolo erklärt seinem Mündel Rosina, dass es dann schon ein wenig mehr brauche, einen „Doktor seinesgleichen“ zu betrügen. Ihn, den Pedanten, der überhaupt nichts merkt. Rossini deutet nun im Abschluss der Arie einen Sonatensatz an, also jene Form, die sich eben durch Entwicklung charakterisiert. Das ist Rossinis Ironie: Jener, der sich nicht entwickelt und der Pedant und Geizhals bleibt, der er ist, wird mit einer sich aus dem Motiv heraus entwickelnden Musik begleitet. Sie werden, meine Damen und Herren, mit gewissem Recht sagen, dass man das alles ja doch nicht höre. Ja, gewiss, es geht viel zu schnell. Dennoch ist es so! Es ist, wie wenn Sie den Kindern Märchen erzählen. In Ihrer Erzählung hört man auch nichts von den tiefen mythischen und psychologischen Bezügen eines Märchens. Und dennoch sind sie in Ihrer Erzählung präsent! 7 Gioacchino Rossini: Der Barbier von Sevilla Wir haben Ironie vorhin als ein liebendes Sich-Verständigen des Komponisten mit uns Hörern definiert. Rossini verständigt sich nun noch über ganz etwas anderes mit uns Hörern, als nur über die Figuren seines Stücks. Der Barbier wird 1816 uraufgeführt, Beethovens Fidelio erscheint zum ersten Mal 1806, in der revidierten Fassung 1814. Beethovens Fidelio ist eine Revolutionsoper. Rossinis Barbier erscheint also in einer politischen äusserst aufgewühlten Zeit. Napoleon ist im Jahr zuvor endgültig geschlagen worden, der Wiener Kongress hat Italien wieder unter die Herrschaft der Grossmächte gestellt. Italien ist nicht frei, die sprachlich-kulturelle Einheit ist keine staatliche Einheit. Verdi wird 25 Jahre später mit dem Nabucco einen gewaltigen Erfolg erleben, weil er darin das Gefühl der Unterdrückung in Musik zu setzen weiss. Rossini tut das letztlich auch, doch nicht direkt, sondern mit Ironie. Er macht sich im Barbier nur vordergründig lustig über die Figuren des Stücks. Er macht sich auch lustig über die Gesellschaft seiner Zeit. Es gibt einen politischen Rossini, nicht erst in seiner letzten Oper, dem Wilhelm Tell. Sie erinnern sich vielleicht an die Aufführung der „diebischen Elster“ in der letzten Saison, ein geradezu banales Stück. Aber wenn Sie bedenken, wieviel Gesellschaftskritik darin steckt, wenn eine Magd, weil sie angeblich zwei Silberlöffel gestohlen hat, gleich von einem völlig vertrottelten Bürgermeister zum Tode verurteilt wird, dann wissen Sie, was ich meine. Keiner hat diesen politischen Rossini klarer erkannt als Heinrich Heine; im dritten Teil seiner „Reisebilder“ schreibt er: „Die Verächter italienischer Musik werden einst in der Hölle ihrer wohlverdienten Strafe nicht entgehen, und sind vielleicht verdammt, die lange Ewigkeit hindurch nichts anderes zu hören, als Fugen von Sebastian Bach. (…) Dem armen geknechteten Italien ist ja das Sprechen verboten, und es darf nur durch Musik die Gefühle seines Herzens kund geben. All sein Groll gegen fremde Herrschaft, seine Begeisterung für die Freiheit, sein Wahnsinn über das Gefühl der Ohnmacht, seine Wehmut bei der Erinnerung an vergangene Herrlichkeit, dabei sein leises Hoffen, sein Lauschen, sein Lechzen nach Hülfe, alles dieses verkappt sich in jene Melodien, die von grotesker Lebenstrunkenheit zu elegischer Weichheit herabgleiten. (…) Das ist der esoterische Sinn der Opera buffa. Die exoterische Schildwache ahnt nimmermehr die Bedeutung dieser heiteren Liebesgeschichten, Liebesnöten, worunter der Italiener seine tödlichen Befreiungsgedanken verbirgt. Es ist gut, dass die exoterische Schildwache nichts merkt, denn sonst würde der Impresario mitsamt der Primadonna und dem Primouomo bald jene Bretter betreten, die die Festung bedeuten.“ 19. März 2010 8