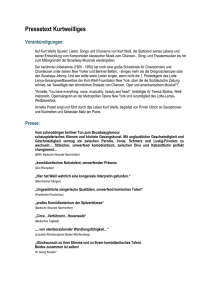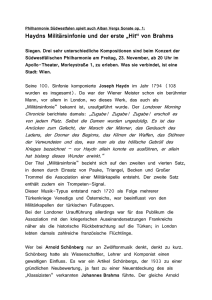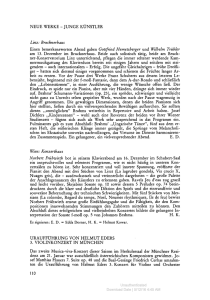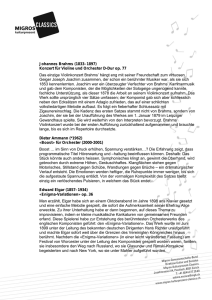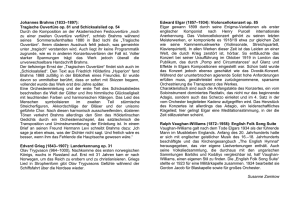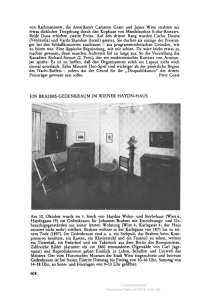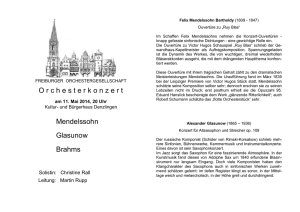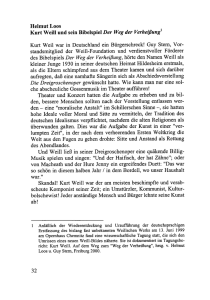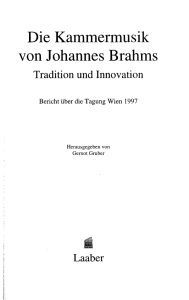Michael Sanderling - Münchner Philharmoniker
Werbung

Michael Sanderling Montag, 8. Dezember 2014, 20 Uhr Mittwoch, 10. Dezember 2014, 20 Uhr 150 JAHRE FRIDRICH Unser lupenreines Jubiläumsangebot: FRIDRICH SOLITÄRRING mit 1 Brillant, 0,50 ct. Weiß lupenrein, gefasst in 750/– Weißgold € 2.999,– mit GIA-Expertise TRAURINGHAUS · SCHMUCK · JUWELEN · UHREN · MEISTERWERKSTÄTTEN J. B. FRIDRICH GMBH & CO. KG · SENDLINGER STRASSE 15 · 80331 MÜNCHEN TELEFON: 089 260 80 38 · WWW.FRIDRICH.DE K u r t We i l l Symphonie Nr. 2 1. Sostenuto – Allegro molto 2. Largo 3. Allegro vivace – Alla marcia – Presto Johannes Brahms Klavierquar tet t Nr. 1 g-Moll op. 25 in der Orchesterbearbeitung durch Arnold Schönberg 1. Allegro 2. Intermezzo: Allegro ma non troppo 3. Andante con moto 4. Rondo alla zingarese: Presto Michael Sanderling, Dirigent Montag, 8. Dezember 2014, 20 Uhr 3. Abonnementkonzer t f Mit t woch, 10. Dezember 2014, 20 Uhr 3. Abonnementkonzer t a Spielzeit 2014/2015 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant 2 Kurt Weill: 2. Symphonie Verbotene Musik im Handgepäck Susanne Stähr Kurt Weill Lebensdaten des Komponisten (1900–1950) Geboren am 2. März 1900 in Dessau; gestorben am 3. April 1950 in New York. Symphonie Nr. 2 1. Sostenuto – Allegro molto 2. Largo 3. Allegro vivace – Alla marcia – Presto Entstehung Ende 1932 beauftragte die Princesse Edmond de Polignac den 32-jährigen Kurt Weill mit der Komposition einer Symphonie. Der erste Satz ent­ stand im Januar 1933 in Kleinmachnow, einer kleinen Ortschaft südwestlich des Berliner Bezirks Steglitz-Zehlendorf, kurz bevor Kurt Weill aus Nazi-Deutschland emigrieren musste. Den zweiten und dritten Satz komponierte er dann Ende 1933 und Anfang 1934 im Pariser Exil. Widmung „À la Princesse Edmond de Polignac“: Hinter diesem Namen verbirgt sich Winnaretta Singer (1865–1943), Erbin des gleichnamigen amerikanischen Nähmaschinen-Konzerns und Gattin des französischen Kunstmäzens Edmond de Polignac; sie führte einen berühmten Pariser Salon, in dem die wichtigsten Künstler der Zeit verkehrten. Uraufführung Am 11. Oktober 1934 in Amsterdam im großen Saal des Concertgebouw (Koninklijk Concertgebouw Orkest unter Leitung von Bruno Walter). Vorausgegangen war eine Privataufführung in Paris im „Hôtel particulier“ der Princesse de Polignac. 3 Kurt Weill (um 1930) 4 Kurt Weill: 2. Symphonie Komponist im Rampenlicht Im Frühjahr 1931 schwappte das Kurt-WeillFieber nach Frankreich über. Zeitgleich war Bertolt Brechts Theaterstück „Die Dreigroschenoper“, zu dem Weill die Musik geschrieben und mit „Der Moritat von Mackie Messer“, dem „Kanonensong“ oder der „Seeräuber-Jenny“ wahre Hits beigesteuert hatte, als Tonfilm in deutsche und französische Kinos gelangt, dort als „L’Opéra de quat’ sous“. Wenige Wochen später schon konnte sich der 31-jährige Komponist bei einer ausgedehnten Reise durch das Nachbarland persönlich davon überzeugen, dass seine kühne Mischung aus populären, jazzigen und avancierten Klängen, gewürzt mit einer guten Prise Agitprop, auch bei den Franzosen mächtig zündete – zumindest in politisch gewogenen Kreisen. Vor allem in Paris wollte man fortan mehr hören von diesem Wundermann und lud ihn ein, am 11. Dezember 1932 ein ausschließlich seiner eigenen Musik gewidmetes Konzert zu veranstalten, mit dem „Mahagonny-Songspiel“ und der Schuloper „Der Jasager“. In der Pariser Salle Gaveau hatte sich dazu allerhand Prominenz eingestellt, die Komponistenkollegen Igor Strawinsky und Darius Milhaud zum Beispiel, die Schriftsteller André Gide und Jean Cocteau oder auch die Maler Pablo Picasso und Fernand Léger. Das Publikum reagierte enthusiastisch, und die Presse war ebenfalls beeindruckt: Von „zwei singulären Werken, die nicht nur durch ihren Einfallsreichtum und Ausdruck bestechen, sondern die man, einmal gehört, nicht so schnell vergessen wird“, sprach etwa der prominente Pariser Kritiker André George. Zwangsläufig wurde auch die Princesse de Polignac, geborene Winnaretta Singer, auf den jungen Deutschen aufmerksam. Die Fürstin, eines von mehr als zwanzig Kindern des amerikanischen Nähmaschinenfabrikanten Isaac Merritt Singer, verfügte dank des väterlichen Erbes über ein Millionenvermögen, und da sie in zweiter Ehe den Prinzen Edmond de Polignac, einen Vetter des Fürsten von Monaco, geheiratet hatte, war ihr obendrein der Aufstieg (oder Quereinstieg) in den europäischen Hochadel gelungen. Sie nutzte indes beides, Geld und Ansehen, um großherzig die schönen Künste zu fördern, vor allem Maler und Komponisten. Maurice Ravel hatte für „Winnie“, wie sie genannt wurde, die „Pavane pour une Infante défunte“ geschrieben, Manuel de Falla „El retablo del Maese Pedro“, Francis Poulenc sein Orgelkonzert und Strawinsky den „Renard“. Kurt Weill aber erhielt von der Fürstin einen Auftrag, der auf den ersten Blick nicht in sein Profil zu passen schien: Er sollte für sie eine Symphonie komponieren. Zwar hatte sich Weill schon 1921, noch während seines Studiums bei Ferruccio Busoni in Berlin, einmal als Symphoniker versucht, doch da sein Lehrer damals das einsätzige Werk kritisch kommentierte, legte er es zur Seite – mit dem Ergebnis, dass es erst 1957, sieben Jahre nach seinem Tod, uraufgeführt werden sollte. Im Verlauf der 1920er Jahre hatte ihn sein Weg dann weit weg von der absoluten Musik und hin zur Bühne geführt, aber vielleicht reizte es ihn gerade deshalb umso mehr, sich einmal auf weniger vertrautem Terrain zu betätigen und seine unglücklichen Erfahrungen mit dem symphonischen Genre zu kompensieren. Jahre spä- Kurt Weill: 2. Symphonie ter, nach seiner Ankunft in Amerika, bekannte er jedenfalls: „Um meinen eigenen Stil zu kontrollieren, habe ich auch absolute Musik geschrieben. Man muss gelegentlich von seinem gewohnten Weg abweichen, in solchen Momenten schreibe ich symphonische Musik.“ Komponist auf der Flucht Im Januar 1933, wenige Wochen nachdem Weill aus Paris zurückgekehrt war in die Heimat, in die Künstlerkolonie Kleinmachnow südwestlich von Berlin, wo er 1932 ein Haus bezogen hatte, machte er sich sogleich an die Arbeit. Es gelang ihm auch, in kurzer Zeit den ersten Satz komplett zu skizzieren und sogar zu orchestrieren, doch dann überschlugen sich die Ereignisse: Am 30. Januar übernahm Hitler mit den Nationalsozialisten die Macht, und das politisch-gesellschaftliche Klima änderte sich schlagartig. In den ersten Tagen glaubte Weill noch, dass der Spuk rasch vorübergehen würde: „Ich halte das, was hier vorgeht, für so krankhaft, dass ich mir nicht denken kann, wie das länger als ein paar Monate dauern soll“, schrieb er am 5. Februar an seinen Wiener Verleger Hans W. Heinsheimer. Als aber Anfang März sein gerade erst uraufgeführtes Bühnenspiel „Der Silbersee“ in allen drei Theatern, die es präsentierten, abgesetzt wurde und Freunde ihn dringend vor einer möglichen Verhaftung warnten, entschied sich Weill, den Weg ins Exil anzutreten. Denn als Jude, als Verfechter des sogenannten „kulturbolschewistischen“ Gedankenguts und Urheber einer als „entartet“ gebrandmarkten Musik war er gleich dreifach gefährdet. Der befreundete Bühnenbildner Caspar Neher brachte ihn mit seinem Auto über die Grenze ins sichere Frankreich; nur wenig Handgepäck 5 hatte Weill in Eile zusammengesucht, aber die angefangene Partitur der Zweiten hatte er glücklicherweise mit eingesteckt. Die Freiheit und ihre Feinde In Paris fand er Zuflucht. Als den „diskretesten Ort der Welt“ hat Weill später die Seine-Metropole gepriesen, eine „Stadt, wo der Respekt für die persönliche Freiheit seinen Gipfelpunkt erreicht, […] wo jeder, die Berühmtheit ebenso wie der Unbekannte, das Recht hat, frei herumzugehen, völlig Herr über seine Zeit und seine Gedanken, völlig befreit von der Masse mit ihren guten oder bösen Absichten“. Ganz leicht war das Leben in diesem Hort der Freiheit für ihn allerdings nicht. Bei seiner überstürzten Abreise hatte Weill kaum nennenswerte Geldbeträge mitgenommen, und nun war sein Berliner Konto konfisziert worden. Da seine Musik in Deutschland nicht mehr aufgeführt werden durfte, blieben auch die gewohnten Tantiemen aus. Zu allem Überfluss kündigte sein Wiener Verlag, die Universal-Edition, mit Oktober 1933 den bestehenden Vertrag und stellte die monatlichen Zahlungen ein. Weill blieb nichts anderes übrig, als in Eile neue Projekte zu realisieren, u. a. das satirische Ballett „Die sieben Todsünden“, das schon im Juni 1933 am Pariser Théâtre du Châtelet herauskam. Und obendrein musste Weill noch erfahren, dass die Nazis auch in Frankreich ihre Anhänger hatten. Als die Sopranistin Madeleine Grey im November 1933 in der Salle Pleyel drei Lieder aus dem „Silbersee“ interpretierte, gellte dem entsetzten Komponisten beim Applaus der Ruf „Es lebe Hitler !“ entgegen und „Genug mit der Musik deutscher Emigranten !“: Es war der Kollege Florent Schmitt, 6 Kurt Weill: 2. Symphonie der sich mit diesen Ausfälligkeiten unrühmlich in die Annalen der Musikgeschichte eingetragen hat. Trauermarsch und Tarantella lich um die „reine Form“ ging, indiziert schon das Faktum, dass er den Kopfsatz ursprünglich mit dem Titel „Sonate“ versah – und dabei für sich vor allem die Sonatensatzform erprobte, die er jedoch insofern erweiterte, als dass die Durchführung nicht das Haupt- und das Seitenthema verarbeitet, sondern von eigenem, neuem Material gespeist wird. Ohnehin greift Weill immer wieder auf prominente Vorbilder zurück: So wird die langsame, trauermarschartige Einleitung zum Kopfsatz im Largo fortgeführt, und noch die Tarantella-Coda im Rondo-Finale dreht das Hauptmotiv dieses Trauermarschs kurzerhand in sein groteskes Gegenteil – ein Verfahren satzübergreifender Zusammenhänge, das einst Robert Schumann in seinen Symphonien zu höchster Blüte gebracht hatte. Trotz dieser Reminiszenzen an die Tradition wirkt Weills Symphonie sehr eigenständig, denn sie arbeitet mit zuweilen harten Schnitten, die ganz heterogene Klangsphären scharf gegeneinander absetzen. Und so finden sich trotz des grundsätzlich ernsten Charakters auch parodistische Momente in dieser Partitur, mit Anklängen an die „Kleine Dreigroschenmusik“, an die Komödie „Happy End“ oder auch an die „Sieben Todsünden“. Den Schriftsteller und großen Musikliebhaber Herbert Rosendorfer erinnerten diese ironischen Momente an eine „von Clowns gespielte BrucknerSymphonie“ oder an den „Anblick einer zerbrochenen und falsch wieder zusammengesetzten klassischen Statue. Der Fuß schaut beim Mund heraus.“ In der Tat kommt nicht weiter, wer versucht, Weills Zweiter Symphonie ein außermusikalisches Programm nach Art einer Tondichtung zu unterlegen. Wie sehr es dem Komponisten wirk- Angesichts der einschneidenden politischen Ereignisse während ihrer Entstehungszeit wurde Weills Zweite Symphonie immer wieder als persönlicher Reflex des Komponisten auf das „Anti-Pastorale“ Dass Kurt Weill unter all diesen widrigen Umständen seine Zweite Symphonie erst im Februar 1934 vollenden konnte, mag nicht verwundern. Nach einer Privataufführung im „Hôtel particulier“ der Princesse de Polignac gelangte das Werk erstmals am 11. Oktober 1934 öffentlich zu Gehör, mit denkbar prominenten Interpreten: Bruno Walter leitete damals in Amsterdam das Koninklijk Concertgebouw Orkest, und wenige Woche später dirigierte er auch die USamerikanische Premiere mit dem New York Philharmonic. „Walter macht es großartig, und alle sind sehr begeistert“, schwärmte der beglückte Komponist in einem Brief an Lotte Lenya. „Es ist ein gutes Stück und klingt ausgezeichnet.“ Weniger begeistert war Weill indes von Walters Bitte, der Symphonie ein erklärendes Programm beizufügen. „Über den ‚Inhalt‘ des Werks etwas zu sagen, ist mir nicht möglich, da es als reine musikalische Form konzipiert wurde“, vermerkte er denn auch in einer Programmnotiz für die Uraufführung. „Vielleicht ist das Wort einer Pariser Freundin richtig, die meinte, wenn es ein Wort gäbe, das das Gegenteil von ‚Pastorale‘ ausdrückt, so wäre das der Titel dieser Musik.“ 7 Im Autograph trägt die zweite Symphonie den Titel „Symphonie Nr. 1“. Erst nach 1956 wurde das Werk als Symphonie Nr. 2 katalogisiert. 8 Kurt Weill: 2. Symphonie Nazi-Regime und die Emigration gedeutet. Und es fällt auch nicht schwer, aus dieser Musik ein Wechselspiel so divergierender Stimmungen wie Wut und Resignation, Nostalgie oder Aufbruch herauszuhören – Empfindungen, wie sie Weills Situation in den Jahren 1933/34 wohl wirklich geprägt haben dürften. Ob man allerdings so weit gehen und den Bläsermarsch im Finale mit dem Stechschritt der Nazis assoziieren sollte oder die nachfolgende mediterrane Tarantella mit der Sehnsucht nach einer besseren Welt ? Kurt Weill hätte sich gegen solche Interpretationen gewiss verwahrt. Der Komponist Kurt Weill 9 Berühmt und doch wenig gekannt Egon Voss Es gibt Komponisten, deren Name mit nur einem einzigen Opus verknüpft ist. Man denke an Leoncavallo oder Mascagni. Wer kennt von den Opern, die diese beiden neben „Bajazzo“ und „Cavalleria rusticana“ hinterlassen haben, auch nur einen einzigen Titel ? Ähnlich ist es mit Kurt Weill. Mit seinem Namen assoziiert man allgemein nicht viel mehr als die „Dreigroschenoper“. Manchem fällt vielleicht sogar nur die „Moritat von Mackie Messer“ ein. Woran liegt das ? Was den Konzertsaal anbetrifft, mag man da­ rauf verweisen, dass Weill die traditionellen Gattungen nur mit einem Violinkonzert und zwei Symphonien bedient hat. Jedoch auch diese Stücke bekommt man so gut wie nie zu hören. Mangel an Qualität und Originalität kann man ihnen nicht vorwerfen. Das gilt erst recht für ein Stück wie die „Kleine Dreigroschenmusik“, eine Suite, die Weill aus der „Dreigroschenoper“ zusammenstellte. Doch schon die Zusammensetzung des Instrumentariums passt nicht in das Schema heutiger Konzerte. Es werden nicht einmal 20 Musiker gebraucht, keine Streicher, dafür Banjo, Bandoneon, Klavier und selbstverständlich Schlagzeug. Das ist eher eine Jazzband als ein Symphonieorchester. Es genügt den Normen nicht, ganz zu schweigen von der Eigenart der Musik selbst. Aber Weill wollte sich auch nicht an die traditionellen Gattungen halten. Sein Ziel war „eine neue Form zwischen Theater und Konzertsaal“. Kein Wunder also, dass er schwer einzuordnen ist. Selbst ein Kenner wie Theodor W. Adorno schrieb 1950 in seinem Nachruf, Weill werde „vom Begriff des Komponisten kaum recht getroffen.“ Auch technisch-stilistisch ist er schwer greifbar. Weill gehörte zu keiner Schule, weder zu Schönberg noch zu Strawinsky, in denen Adorno die Musik der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, also der Lebenszeit Weills, repräsentiert sah. Er komponierte nicht atonal oder dodekaphonisch, nicht neoklassizistisch, minimalistisch oder folkloristisch. Er saß gleichsam zwischen allen Stühlen. Es kommt hinzu, dass er seinen Stil mehrfach änderte. Der seriöse Schüler Ferruccio Busonis wandelte sich in der Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht von 1927 bis 1933 zum frechen SongSchreiber und wurde danach im amerikanischen Exil zum erfolgreichen Broadway-Komponisten. Allerdings ist es verfehlt, wenn man seine in den USA komponierten Musiktheaterstücke pauschal als „Musicals“ abtut. Es sind jedoch vor allem diese Werke, über die viele bis heute die Nase rümpfen, was nicht ohne Auswirkung auf die Aufführungszahlen der Werke Weills geblieben sein dürfte. Dieses Sichwandeln ist für Verfechter eines rigiden Kunstverständnisses der Ausdruck von Anpassung an allgemei- 10 Der Komponist Kurt Weill ne Mode- oder Zeitströmungen und Publikums­ erwartungen. Dergleichen gilt als Einverständnis mit den schlechten Verhältnissen in der Welt, als Verrat an der Kunst und ihrer angeblichen Verpflichtung zur Wahrheit. Das jedoch, was im Falle von Weill als „Anpassung“ diskreditiert zu werden pflegt, ist nichts anderes als die nicht nur legitime, sondern sogar nötige Maßnahme, den Kontakt zu den Hörern nicht zu verlieren. Weill hat – wie übrigens auch Strawinsky – nie daran gedacht, die Allianz mit dem Publikum, auf die doch jeder Komponist angewiesen ist, aufzukündigen (was die sogenannte Neue Musik allzu bedenkenlos getan hat). Soll eine Komposition den Hörer wirklich erreichen, nämlich als das aufgenommen werden, als das sie gemeint ist, müssen Komponist und Hörer eine gemeinsame Basis haben, eine Grundlage für das Verständnis, die gleichermaßen die Mitteilung (von Seiten des Komponisten) wie die Wahrnehmung (durch den Hörer) betrifft. Insofern Musik ein gesellschaftliches Phänomen ist, müssen daran beide Seiten beteiligt sein – was nicht heißen soll, dass der Komponist dem Publikum nach dem Munde zu reden hätte. Kurt Weill hat das auch nie getan. Er hat bei aller Veränderung des Äußeren stets seine Individualität und seine Originalität bewahrt, auch darin Strawinsky verwandt. Was Weill jedoch von Strawinsky wesentlich unterscheidet, ist die Tatsache, dass sich in seinem Werk so oft die Sphären von E- und U-Musik verbinden. Weills Credo lautete: „Ich habe niemals den Unterschied zwischen ‚ernster‘ und ‚leichter‘ Musik anerkannt. Es gibt nur gute und schlech- te Musik.“ Die offenkundige Nähe zur ‚leichten‘ Musik war jedoch vielen, vor allem den strengen Verfechtern der Klassik, naturgemäß ein Dorn im Auge. Es dürfte dieser Aspekt sein, der ein so spritziges, pfiffiges Stück wie die bereits erwähnte „Kleine Dreigroschenmusik“ bis heute vom Konzertbetrieb nahezu ausschließt. Dabei nimmt jeder, der diese Musik auch nur einmal hört, unmittelbar wahr, dass es sich dabei nicht um ein billiges Crossover handelt, sondern um eine höchst artifizielle, originelle Neugestaltung dessen, was Mozarts Vater das „Populare“ nannte (das er seinem Sohn übrigens dringend anempfahl). Gegnerschaft erwuchs Weill freilich auch daraus, dass dieses „Populare“ nicht aus dem deutschen Volkslied oder dem heimischen Schlager stammte, sondern vornehmlich aus nicht-europäischer, nicht-abendländischer Musik wie dem Jazz oder dem Tango (die gleichwohl auch europäische Wurzeln haben). Zu Weills souveräner Freiheit von jeglicher Berührungsangst gegenüber der U-Musik kommt eine unverhohlene Tendenz zu Anarchie und Unbürgerlichkeit, die manchen guten Bürger verschreckt haben mag. Sie äußert sich vor allem in den Werken aus der Phase der Zusammenarbeit mit Bertolt Brecht, die Weill Ende der 1920er Jahre berühmt machte und die das Bild, das man von ihm hat, bis heute nahezu allein bestimmt. Sie verschreckte vor allem die Nationalsozialisten, die in Weill einen ihrer ärgsten Feinde sahen. Weill war nicht nur Jude, sondern schien aufgrund seiner Zusammenarbeit mit Brecht auch noch Kommunist zu sein (was er aber nicht war). Jedenfalls tat Weill gut daran, Deutschland sogleich nach der sogenann- 11 Theodor W. Adornos einflussreicher Nachruf in der Frankfurter Rundschau 12 Der Komponist Kurt Weill ten Machtergreifung zu verlassen. Damit rettete er sein Leben, doch die kaum begonnene Aufführungstradition seiner Werke in Deutschland riss abrupt ab, ein Verlust, den wettzumachen bis heute nicht gelungen ist. Weill selbst, der 1950 mit 50 Jahren starb, konnte nicht mehr für die Durchsetzung seiner Werke sorgen. Wie so viele andere große Geister starb er zu früh. Darum treffen Franz Grillparzers berühmte Worte über Franz Schubert auch und vielleicht noch viel mehr auf Kurt Weill zu: „Die Tonkunst begrub hier einen reichen Besitz, aber noch viel schönere Hoffnungen.“ Johannes Brahms: 1. Klavierquartett g-Moll (Bearbeitung für Orchester) 13 „Ich wollte einmal alles hören“ Adam Gellen Johannes Brahms Lebensdaten des Komponisten (1833–1897) Geboren am 7. Mai 1833 in Hamburg; gestorben am 3. April 1897 in Wien. Klavierquartett Nr. 1 g-Moll op. 25 in der Orchesterbearbeitung durch Arnold Schönberg 1. Allegro 2. Intermezzo: Allegro ma non troppo 3. Andante con moto 4. Rondo alla zingarese: Presto Entstehung Brahms’ erstes von seinen insgesamt drei Klavierquartetten entstand fast zeitgleich mit seinen beiden Schwesterwerken in den Jahren 1855 bis 1861; vom g-Moll-Quartett soll Brahms gesagt haben, es handle fast in jedem Takt von seiner (verschwiegenen) Liebe zu Clara Schumann. Arnold Schönberg (1874–1951), der das Quartett 1937 in seinen Emigrationsjahren in den USA für großes Orchester transkribierte, stellte seine Bearbeitung nach eigener Aussage hauptsächlich deshalb her, „um endlich einmal alles zu hören, was in der Partitur steht“. Uraufführung Uraufführung von Brahms’ Klavierquartett: Am 16. November 1861 in Hamburg (mit Clara Schumann am Klavier). Uraufführung von Schönbergs Orchesterbearbeitung: Am 7. Mai 1938 in Los Angeles (Los Angeles Philharmonic Orchestra unter Leitung von Otto Klemperer). 14 Johannes Brahms: 1. Klavierquartett g-Moll (Bearbeitung für Orchester) Am 17. Mai 1933, bereits wenige Monate nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, sah sich Arnold Schönberg gezwungen, Deutschland den Rücken zu kehren und über Frankreich in die Vereinigten Staaten zu emigrieren. Wie viele seiner Schicksalsgenossen erkannte er jedoch schon lange zuvor die fatalen Zeichen der neuen Zeit. Dies führte einerseits dazu, dass sich der zum Protestantismus konvertierte Jude seiner eigentlichen Wurzeln immer bewusster wurde und sich schließlich zur Rückkehr zum jüdischen Glauben entschloss; andererseits sah er sich seit den späten 20er Jahren einem wachsenden öffentlichen Legitimationsdruck ausgesetzt: Auffällig häufig betonte der radikale Neuerer seine tiefe Verwurzelung im musikalischen Erbe der vorangegangenen Jahrhunderte. Schönberg berief sich dabei insbesondere auf die großen Komponisten der deutschösterreichischen Tradition von Bach bis Strauss als Vorbilder für sein Schaffen. Er versuchte auch im Detail zu demonstrieren, dass seine durch den Bruch mit der Tonalität gekennzeichnete Kompositionsweise trotz der avantgardistischen klanglichen Oberfläche lediglich die organische Weiterentwicklung überlieferter und allgemein als gültig anerkannter musikalischer Regeln darstellte. Progressiver Klassizist Das berühmteste Zeugnis seiner Bemühungen, sich unmittelbar in die mitteleuropäische Tra­ ditionslinie einzureihen, bildet Schönbergs Vortrag „Brahms, der Fortschrittliche“, den er nur wenige Tage nach Hitlers Machtergreifung, am 12. Februar 1933 live im Frankfurter Rundfunk hielt. Diese Radiosendung – seine letzte öffent- liche Äußerung in Deutschland – blieb jedoch aufgrund der noch geringen Anzahl an Empfangsgeräten zunächst ohne größere Resonanz. Erst nachdem Schönberg seinen Aufsatz 1947 in den USA in umgearbeiteter, erweiterter Form als „Brahms the Progressive“ veröffentlichte, erfuhr dieser eine breite Würdigung. Der Text sollte zu einem Meilenstein der Brahms-Rezeption werden, welche das öffentliche Bild vom konservativen, „akademischen“ Brahms zwar nicht nachhaltig korrigieren konnte, im Bereich der Musikwissenschaft jedoch eine umso stärkere Neubewertung von Brahms’ Schaffen und seiner musikgeschichtlichen Nachwirkung hervorrief. Der Titel nimmt sich geradezu provokativ aus, galt doch Brahms – damals noch mehr als heute – als Gegenpol zum „zukunftsweisenden“ Wagner: ein klassizistischer, rückwärtsgewandter Komponist, sehr bedeutend zwar und fest im Konzertrepertoire verankert, doch ohne jegliche musikgeschichtliche Relevanz für nachfolgende Komponistengenerationen. Schönberg verfolgte indessen mit „Brahms, der Fortschrittliche“ ein doppeltes Ziel: Der Vortrag liest sich zunächst tatsächlich als eine teils recht polemisch gehaltene Verteidigung von Brahms gegen dessen eigene Parteigänger wie auch gegen eingefleischte Altwagnerianer – „altgewordene JungWagnerianer“ und „ ‚geborene‘ Alt-Wagnerianer“ gleichermaßen. Doch in mindestens ebensolchem Maße erweist sich der Vortragstext als Rechtfertigung der eigenen kompositorischen Errungenschaften: Schönberg bemühte sich, in Brahms’ Werken einzelne Merkmale aufzuzeigen, die er allein schon deshalb als „fortschrittlich“ kennzeichnete, weil sie für seine eigenen, modernen Kompositionstechniken als Vorbild 15 Arnold Schönberg beschreibt seine Beweggründe zur Brahms-Bearbeitung in einem Brief an den Musikkritiker Alfred Frankenstein 16 Johannes Brahms: 1. Klavierquartett g-Moll (Bearbeitung für Orchester) dienten. Ein solch einfacher Kunstgriff erlaubte es Schönberg, die progressiven Züge von Brahms’ Stil aufzuzeigen und gleichzeitig seine eigene Verwurzelung in der Tradition zu betonen. Brüder im Geiste Arnold Schönbergs innere Beziehung zu Johannes Brahms war – auch über die rein „handwerkliche“ Seite hinaus – seit jeher enger als zu den übrigen seiner verehrten Vorbilder. Dies mag auch mit der Herkunft beider Komponisten aus bescheidenen kleinbürgerlichen Verhältnissen und ihrer schon in jungen Jahren entwickelten tiefen ethischen Verpflichtung zur Kategorie „Leistung“ zu tun haben. Entscheidend war aber die Tatsche, dass der junge Schönberg im Wien des ausgehenden 19. Jahrhunderts aufwuchs, einer Stadt, deren Musikleben weitgehend von Johannes Brahms und seinen Gefolgsleuten geprägt wurde. So verwundert es nicht, dass die ersten Kompositionsversuche des musikalischen Autodidakten Schönberg den Einfluss des norddeutschen Meisters verraten. Öffentlich betonte der „konservative Revolutionär“ seine Verbundenheit mit Brahms zwar erst seit Ende der 1920er Jahre, doch wie seine Schüler übereinstimmend berichten, spielten Brahms’ Werke in Schönbergs Kompositionsunterricht schon wesentlich früher eine bestimmende Rolle. „Entwickelnde Variation“ Der zentrale Begriff in Schönbergs recht selektiver Sicht von Brahms war derjenige der „entwickelnden Variation“ – man könnte das Phänomen vielleicht noch treffender als „permanent variierende Entwicklung“ bezeichnen. Darunter verstand Schönberg Brahms’ Neigung und Fähigkeit, weite Teile eines Satzes mit immer neuen Ableitungen eines Motivkeims – im Extremfall eines einzigen Intervalls – zu gestalten: Ständige Metamorphosen des Ausgangsmaterials bringen fortwährend neue melodischrhythmische Gestalten hervor, die sich jedoch stets auf die ursprüngliche Form zurückführen lassen und untereinander zusammenhängen. Die strenge Logik dieser Kompositionstechnik, bei der ein „vorgegebenes“ Gebilde den weiteren Verlauf des Stückes bestimmt, konnte Schönberg im Rückblick als eine tendenzielle Vorwegnahme seiner um 1920 entwickelten Idee der „Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ erscheinen: Auch bei dodekaphonen Werken existiert mit der Zwölftonreihe ein Basismaterial, das zwar kontinuierlich variiert wird, dabei jedoch latent stets präsent bleibt. Bearbeitung als Interpretation Schönberg, der Werke anderer Komponisten kaum einmal öffentlich aufführte, näherte sich den von ihm hochgeschätzten Kunstwerken der Vergangenheit vornehmlich auf zwei Wegen: durch Analysen und durch Bearbeitungen jeglicher Art, von der bescheidensten Ausharmonisierung bis zur durchgreifenden Neukomposition. Seine Orchesterfassungen kleinbesetzter Ins­ trumentalstücke können dabei in zwei Gruppen eingeteilt werden: Bearbeitungen im engeren Sinne, bei welchen Schönberg tatsächlich „verbessernd“ in das musikalische Material eingriff, sowie reine Neu-Arrangements für großes Orchester, die in ihrer musikalischen Substanz praktisch keine Veränderungen gegenüber dem jeweiligen Original aufweisen. 17 Johannes Brahms mit Joseph Joachim (um 1855) 18 Johannes Brahms: 1. Klavierquartett g-Moll (Bearbeitung für Orchester) Neben seinen Bach-Instrumentierungen gehört auch Schönbergs Orchestrierung von Brahms’ Klavierquartett g-Moll op. 25 in die zweite Gruppe. Bei dieser im Sommer 1937 entstandenen Arbeit kam es Schönberg in erster Linie darauf an, die innere Struktur des Werkes und die sich in ihm artikulierenden zukunftsgerichteten – d. h. auf Schönberg selbst vorausweisenden – Tendenzen offen zu legen und dadurch Brahms’ Aktualität für die Moderne zu betonen. Um zahlreiche latente Zusammenhänge in Brahms’ Quartett aufzudecken, die beim kammermusikalischen Vortrag nicht befriedigend verdeutlicht werden können, erschien es ihm angebracht, den vergleichsweise homogenen Klang des StreicherKlavier-Ensembles mit dem wesentlich farbenreicheren modernen Symphonieorchester aufzufächern. Mittels einer differenzierenden Instrumentationstechnik gelang es Schönberg, „einmal alles zu hören“ und seine häufig geäußerte ästhetische Forderung nach der „Fasslichkeit“ eines jeden bedeutenden Kunstwerks einzulösen. Dabei zeigt sich in allen Sätzen von Schönbergs Instrumentierung, dass der Bearbeiter bewusst und ohne Bedenken über Brahms’ Orchesterstil hinausging, um seine eigenen Klangvorstellungen zu verwirklichen. So findet eine Reihe von Schlag- und Blasinstrumenten Verwendung, die Brahms nie oder nur äußerst selten in seinen Werken einsetzte; aber auch manche moderne Spieltechniken und Instrumentaleffekte zeugen vom nicht unbeträchtlichen zeitlichen und musikgeschichtlichen Abstand zwischen beiden Fassungen. Obwohl also Schönberg dem Brahms’schen Notentext äußerst treu blieb und selbst ausgesprochen pianistische Stellen ori- ginalgetreu auf das Orchester übertrug, schuf er mit seiner subjektiven „Klang-Interpretation“ dennoch eine neue Version des Werks, welche zu Recht längst Eingang in das symphonische Repertoire gefunden hat. 1. Satz: „Allegro“ mit Prozess­ charakter Der Kopfsatz des g-Moll-Klavierquartetts gilt als das erste vollgültige Beispiel dafür, wie es Brahms gelang, durch seine Methode der „entwickelnden Variation“ aus einem einzigen Motivkeim einen ganzen Sonatensatz mit zwingender innerer Logik zu gestalten. Schönberg scheint die Schlüsselfunktion erkannt zu haben, welche diesem Satz in Brahms’ Œuvre deshalb zukommt. In seiner Bearbeitung war er bestrebt, das Moment der Entwicklung, den Prozesscharakter der Musik durch seine Art der Instrumentierung noch stärker als im Original hervorzukehren: Er wollte offenbar die permanente Evolution des musikalischen Ausgangsmaterials selbst dort noch vorantreiben, wo Brahms ein nach dynamischen Entwicklungsphasen erreichtes Ziel durch Wiederholungen und Kadenzierungen bestätigte und gliedernde Markierungspunkte innerhalb der Satzarchitektur setzte. Solch subtile, gleichwohl recht subjektiv interpretierende Eingriffe Schönbergs prägen insbesondere das Seitenthema in der Exposition sowie die Re­ prise. In formaler Hinsicht bietet Brahms manche Überraschung, wenn etwa zu Beginn der Durchführung das zehntaktige Hauptthema notengetreu erklingt, eine Wiederholung der vorangegangenen Exposition andeutend, nur um die 19 Autograph des Klavierquartetts g-Moll op.25, Beginn des ertsten Satzes 20 Johannes Brahms: 1. Klavierquartett g-Moll (Bearbeitung für Orchester) beim Hörer erweckte Erwartungshaltung sogleich zu enttäuschen. Eine ähnliche Verunsicherung entsteht am Übergang zwischen Durchführung und Reprise, denn letztere setzt nicht wie üblich mit dem ersten Thema, sondern mit dem ursprünglich erst darauffolgenden Überleitungsthema ein. Dieser teilweisen Verschleierung der architektonischen Gliederung steht ein vergleichsweise einfacher, wenn auch vom tradierten Schema abweichender harmonischer Verlauf gegenüber. 2. Satz: Vom „Scherzo“ zum „Intermezzo“ Der zweite Satz im sanft dahinfließenden 9/8-Takt versprüht eine gewisse mediterrane Heiterkeit und bildet so einen wirkungsvollen Kontrast zum vorangegangenen, gewichtigen „Allegro“. Ursprünglich als „Scherzo“ überschrieben, änderte Brahms nach einem Vorschlag Clara Schumanns noch vor der Drucklegung die Satzbezeichnung in „Intermezzo“. In der Tat bildet dieser Satz eine wichtige Stufe auf Brahms’ Weg vom Beethoven’schen Scherzo-Typus hin zu einer individuellen, kantableren Ausprägung des Binnensatzes im mittelschnellen Tempo. Formal hält sich Brahms an das traditionelle dreiteilige A-B-A-Muster mit einer abschließenden kurzen Coda. Im A-Teil erklingen zwei Themen, von denen das zweite rhythmisch deutlich profiliertere Konturen gewinnt. Trotz seines beschleunigten Tempos, der sich verstärkenden Tendenz zu chromatischen Eintrübungen und eines von Schönberg mit Schlagwerk und Blechbläsern markierten dynamischen Höhepunkts wahrt der zentrale „animato“-Abschnitt grundsätzlich den beschwingten Charakter des Satzes und bildet somit keinen ausgeprägten Gegenpol zu den Rahmenteilen. 3. Satz: Chromatisch gefärbtes „da capo“ Einen ähnlichen dreigliedrigen architektonischen Aufbau zeigt der langsame Satz: Den breit strömenden, häufig chromatisch gefärbten melodischen Linien des ersten Großabschnitts folgt ein wiederum mit „animato“ überschriebener Mittelteil, dessen Orchestrierung deutlich den Einfluss Mahlers verrät, bevor eine variierte Wiederaufnahme des lyrischen Beginns das „Andante con moto“ abrundet. 4. Satz: Schluss-Rondo „alla zingarese“ Im ungarisch-zigeunerisch inspirierten SchlussRondo des Quartetts stellte Brahms seine schier unerschöpfliche melodische Erfindungskraft ebenso unter Beweis wie seine ausgeprägte Vorliebe für die charakteristische Musik der Magyaren. Sieht man von den „Ungarischen Tänzen“ ab, die ja zum überwiegenden Teil Bearbeitungen schon existierender Vorlagen sind, hat Brahms in keinem seiner anderen Werke Ungarismen in diesem Ausmaß und mit dieser Konsequenz eingesetzt wie im Finale des g-MollQuartetts. „[Im Finale] hast Du mir auf meinem eignen Territorium eine ganz tüchtige Schlappe versetzt“ – kommentierte Brahms’ ungarischer Freund, der Geigenvirtuose und Komponist Joseph Joachim, anerkennend die authentische Verwendung des „style hongrois“ durch den Deutschen. Der aus dreitaktigen Phrasen gebildete Rondo-Refrain tritt im Verlaufe des Stü- 21 Arnold Schönberg bietet seine Orchesterfassung des Brahms-Klavierquartetts Pierre Monteux vom San Francisco Symphony Orchestra an. 22 Johannes Brahms: 1. Klavierquartett g-Moll (Bearbeitung für Orchester) ckes insgesamt dreimal auf, wobei die zweite Couplet-Episode in sich so vielschichtig gegliedert ist und so umfangreich gerät, dass der Rondocharakter beinahe verloren zu gehen droht. Umso wirkungsvoller kann dann jedoch der lange hinausgezögerte, zum „molto presto“ gesteigerte letzte Refrain den Satz und damit das gesamte Werk beschließen. Der Künstler 23 Michael Sanderling Dirigent Michael Sanderling begann seine musikalische Ausbildung auf dem Violoncello. Nach mehreren Wettbewerbserfolgen (u. a. ARD-Musikwettbewerb München, Maria-Canals-Wettbewerb Barcelona) holte ihn Kurt Masur im Alter von 19 Jahren als Solocellist zum Gewandhaus­ orchester Leipzig. Später war er über viele Jahre in der gleichen Position beim RundfunkSinfonieorchester Berlin tätig. Seit Michael Sanderling 2001 kurzfristig die Leitung eines Konzerts des Kammerorchesters Berlin übernahm, avancierte er zu einem gefragten Dirigenten. Von 2006 bis 2010 war er künstlerischer Leiter und Chefdirigent der Kammerakademie Potsdam, mit der er international gastierte und mehrere CDs einspielte. 2010 gründete er in Frankfurt a. M. mit „Skyline Symphony“ ein Orchester, in dem sich projektweise Spitzenmusiker führender europäischer Ensembles zusammenfinden, um Musik ohne Schwellen- und Berührungsängste darzubieten. Michael Sanderling gastiert außerdem am Pult namhafter Orchester, darunter das Tonhalle-Orchester Zürich, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, die Sächsische Staatskapelle Dresden, das Konzerthausorchester Berlin, das Radio-Sinfonieorchester Stuttgart, das Berner Symphonieorchester, das Orchestre Philharmonique de Strasbourg und das Nederlands Philharmonisch Orkest. 2011 leitete er an der Oper Köln die Neueinstudierung von Sergej Prokofjews Oper „Krieg und Frieden“. Seit der Saison 2011/12 ist er Chefdirigent der Dresdner Philharmonie, ein Engagement, das bis ins Jahr 2019 verlängert wurde. In der aktuellen Saison wird er neben mehreren Wiedereinladungen erstmals beim Gewandhausorchester Leipzig, den Bamberger und den Wiener Symphonikern und dem NHK Symphony Orchestra zu Gast sein. Als Professor für Violoncello an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Frankfurt a. M. und als langjähriger künstlerischer Leiter der Deutschen Streicherphilharmonie ist Michael Sanderling auch in der Nachwuchsförderung sehr aktiv. In jüngerer Zeit arbeitete er mit dem Bundesjugendorchester, dem Jerusalem Weimar Youth Orchestra, der Jungen Deutschen Philharmonie sowie mit dem Schleswig-Holstein Festivalorchester zusammen. e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 24 Auftakt Komponisten Die Kolumne von Elke Heidenreich Warum ergreift uns manche Musik im Konzertsaal und andere lässt uns kalt? Warum versinken einige selig beim Zuhören und andere kramen in der Tasche und sind unkonzentriert, was sich dann meist auch in störendem Husten zeigt? Warum klatschen sich einige am Ende die Hände heiß, während andere nach dem letzten Ton sofort zur Garderobe hetzen? Es mag mit dem Stück zu tun haben, mit der persönlichen Stimmung an diesem Tag, aber ich habe bei vielen Auftritten, bei denen ich als Erzählerin mit Musikern auf der Bühne saß, gemerkt, wie man auch unkonzentrierte Zuhörer fesseln kann: indem man mehr über die Komponisten erzählt. Man hört anders, wenn man weiß, dass zum Beispiel Schubert einer der Sargträger von Beethoven war und dass er nach der Beerdigung im Gasthaus sein Glas hob auf den, der als nächster Beethoven folgen würde – und dass er selbst es war, nicht einmal zwei Jahre später, 1828; oder wenn man weiß, dass der Großvater von Felix Mendelssohn-Bartholdy jener berühmte jüdische Philosoph Moses Mendel war, der Freund Lessings, das Vorbild für Nathan den Weisen; oder wenn man darüber staunt, dass Beethoven Kellnern das Essen, das ihm nicht schmeckte, ins Gesicht warf – warum war er so schlecht gelaunt? Weil er Musiker war und taub, das Schlimmste, was passieren konnte. Oder dass Mozart nicht so arm war wie man immer sagt – er hat es halt mit vollen Händen rausgeworfen, und er war auch nicht so prächtig, wie er da in Salzburg vor der Residenz in Bronze steht – gerade mal einen Meter fünfzig war er groß, pockennarbig, glubsch- äugig, ein Doppelkinn. Oder wussten Sie, dass Anton Bruckner einen Zählzwang hatte? Nicht nur bei den Takten seiner unglaublich langen Sinfonien – er zählte auch die Pflastersteine auf der Straße und die Perlen der Frauen, und überhaupt, Bruckner und die Frauen! Ein Leben lang hat er versucht, eine für sich zu gewinnen, mit Briefen, Blumensträußen, Anträgen – immer jünger wurden die Angeschwärmten, immer geringer seine Chancen, bei einer landen zu können, denn er war ein wenig unbeholfen, vielleicht naiv. Gustav Mahler soll gesagt haben: „Halb ein Gott, halb ein Trottel“, und die Erotik strahlte wohl eher seine kraftvolle Musik aus als seine Gestalt …ach, wenn man das alles weiß, hört es sich manchmal anders, was da ertönt, denn nicht Götter haben diese Musik geschrieben, sondern Menschen. Menschen mit Lieben, Leiden, Ticks und Schwächen – denken Sie an Mahler, der seiner Alma das Komponieren glatt verbot, an Puccini, der seine Elvira betrog, indem er einen Studenten anmietete, der im Gartenhäuschen Klavier spielte, während er zur Jagd oder zur Geliebten ging, und abends sagte Elvira: „Heute hast du aber schön gespielt, Giacomo!“ Im Konzertsaal hören wir Musik von Menschen, die sind, die waren wie wir – mit einem Unterschied: ihnen war ein wunderbares, göttliches Talent gegeben. Lassen wir uns davon beglücken, ohne das Menschliche zu vergessen. Ph Abschied (I) Unsere Hornistin Maria Teiwes wechselt zu den Bamberger Symphonikern und tritt dort die Stelle als Solo-Hornistin an. Abschied (II) Barbara Kehrig hat die Stelle als Kontrafagottistin beim Konzerthausorchester Berlin gewonnen, die sie zum Start der Saison 2014/15 antreten wird. Herzlich willkommen (I) Wir begrüßen bei den Philharmonikern Floris Mijnders (Solo-Cello), Fora Baltacigil (Solo-Kontrabass), Teresa Zimmermann (Solo-Harfe) und Mia Aselmeyer (Horn). Sie treten zum Beginn der neuen Spielzeit ihre Stellen und das damit verbundene Probejahr an. Ein Kurzportrait finden Sie auf den folgenden Seiten. Herzlich willkommen (II) Ebenso herzlich heißen wir Sigrid Berwanger, Jiweon Moon und Laura Mead (2. Violinen), Christa Jardine und Julie Risbet (Bratschen), Johannes Hofbauer (Fagott) sowie Thiemo Besch (Horn) will- 25 kommen. Sie haben einen Zeitvertrag für die Saison 2014/15 erhalten. Kampala, Uganda Zu Gast in der Kampala Music School in Uganda. Im August reisten zum ersten Mal Mitglieder des Orchesters in die ugandische Hauptstadt Kampala, um dort mit Kindern und Musikern der Musikschule in Workshops gemeinsam zu musizieren und Konzerte zu geben. Die Eindrücke in diesem tollen ostafrikanischen Land mit unglaublichen Menschen, die Shengni Guo, Traudl Reich und Maria Teiwes dort erlebten, können Sie in unserem Blog nachlesen bei facebook.com/spielfeldklassik. Fußball Eine höchst unglückliche Niederlage beim Fußballspiel gegen das Team des Bayerischen Staatsorchesters musste der FC Philharmoniker verzeichnen. Stark ersatzgeschwächt – sechs Stammkräfte mussten verletzungsbedingt kurzfristig absagen – und trotz drückender spielerischer Überlegenheit mit ansehnlichen Ballstaffetten nutzten selbst klarste Elfmeterchancen nichts: das Spiel ging mit 0:1 verloren. Wir gratulieren dem Staatsorchester und freuen uns auf das nächste Match. Wie es noch besser geht, erlebten dann beide Mannschaften beim WM-Viertelfinale Deutschland gegen Frankreich – das Spiel schauten sich alle in kollegialer Eintracht beim gemeinsamen Grillen an. e Konzertübersicht 2014/15 Eine Broschüre mit den neuen Konzertprogrammen für die Spielzeit 2014/15 ist ab sofort in den Auslagen im Foyer des Gasteigs erhältlich. Allen Abonnenten wurde im Vorfeld der Saison eine Broschüre mit den Programmen nach Abo-Reihen zugeschickt. Sollten Sie kein Exemplar erhalten haben, bedienen Sie sich bitte an den Auslagen oder wenden Sie sich bitte an unser Abo-Büro. ch is on m er ar ätt ilh Bl Philharmonische Notizen e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph Wir begrüßen... 26 Mia Aselmeyer Teresa Zimmermann Instrument: Horn Instrument: Harfe Mia Aselmeyer wuchs in ihrem Geburtsort Bonn auf und war Jungstudentin an der Kölner Musikhochschule bei Paul van Zelm. Während des Studiums an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg bei Ab Koster war sie Mitglied der Jungen Deutschen Philharmonie und Stipendiatin der Orchesterakademien des Schleswig-Holstein Musikfestivals und der Sächsischen Staatskapelle Dresden. Für die vergangene Saison erhielt sie bereits einen Zeitvertrag bei den Münchner Philharmonikern, nach ihrem erfolgreichem Probespiel tritt sie nun ihr Probejahr zur festen Stelle an. „Mit der Stelle bei den Münchner Philharmonikern erfüllt sich mir ein Lebenstraum. Ich bin gespannt darauf mit dem Orchester an die unterschiedlichsten Orte zu reisen und der Welt somit die Stadt München ein Stück näher zu bringen“, bekennt Mia Aselmeyer, die in ihrer Freizeit gerne München und das Umland entdeckt und ihre Häkel- und Backtechniken verfeinert. Teresa Zimmermann erhielt ihren ersten Harfenunterricht in ihrer Heimatstadt Hannover mit sechs Jahren. 2008 schloss sie ihr Studium bei Maria Graf an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ in Berlin mit Auszeichnung in der Solistenklasse ab. Sie erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei allen bedeutenden internationalen Wettbewerben für Harfe. Seit Jahren konzertiert sie als Gast bei renommierten europäischen Orchestern und war seit 2013 Solo-Harfenistin des Philharmonia Orchestra London. Solokonzerte gab sie unter anderem mit den Duisburger Philharmonikern, dem Warschauer Sinfonieorchester und dem Konzerthausorchester Berlin. 2011 wurde sie von ARTE unter der Moderation von Rolando Villàzon für die Sendung „Stars von morgen“ aufgenommen. Seit Dezember 2011 unterrichtet sie als Dozentin für Harfe eine Hauptfachklasse an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. „Ich habe noch nie in Süddeutschland gelebt und bin gespannt, was mich erwartet“, erzählt sie. „Als begeisterte Sportlerin freue ich mich sehr auf die viele Natur und die gute Luft!“ Ph ch is on m er ar ätt ilh Bl 27 Fora Baltacigil Floris Mijnders Instrument: Bass Instrument: Cello Fora Baltacigil, geboren in Istanbul, erhielt ab dem Alter von neun Jahren Bass-Unterricht von seinem Vater, dem Solo-Kontrabassisten des Istanbul State Symphony Orchestra. Später studierte er bis zum Jahr 2002 am Istanbul University Conservatory und erhielt 2006 sein künstlerisches Diplom am Curtis Institute of Music in Philadelphia, wo er Schüler Hal Robinsons und Edgar Meyers war. Fora Baltacigil war Mitglied der Berliner Philharmoniker und Solo-Bassist des Minnesota Orchestra und des New York Philharmonic Orchestras. Als Solist spielte er mit dem Minnesota Orchestra John Harbisons „Concerto for Bass Viol“ und trat zusammen mit seinem Bruder Efe, dem Solo-Cellisten des Seattle Symphony Orchestras, mit den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Sir Simon Rattle auf (Programm: Giovanni Bottesinis „Grand Duo Concertante“). Seine Freizeit verbringt Fora Baltacigil – wenn er nicht gerade als Hobby-Koch am Herd steht und neue Rezepte ausprobiert – gerne als begeisterter Segler und Taucher in bzw. auf dem Wasser. Floris Mijnders, geboren in Den Haag, bekam als Achtjähriger den ersten Cello unterricht von seinem Vater. Ab 1984 studierte er bei Jean Decroos am Royal Conservatory Den Haag. Während seines Studiums spielte er im European Youth Orchestra und besuchte Meisterklassen bei Heinrich Schiff und Mstislav Rostropovich. Mijnders wurde 1990, kurz nach Studienende, 1. Solo-Cellist im Gelders Orkest in Arnhem. Nicht viel später wechselte er in gleicher Position zum Radio Filharmonisch Orkest. Seit 2001 war er 1. Solo-Cellist des Rotterdam Philharmonic Orchestra und wurde als Solo-Cellist von zahlreichen renommierten europäischen Orchestern eingeladen. Als Solist trat er mit vielen europäischen Orchestern auf, unter anderem mehrmals mit dem Concertgebouw Orchestra Amsterdam und dem Radio Filharmonisch Orkest. Floris Mijnders ist Professor für Violoncello am Sweelinck Concervatorium Amsterdam. Neben der Musik ist Kochen Floris Mijnders Leidenschaft. Er freut sich auf die Zeit in München und darauf, die schöne Natur Bayerns genießen und im Winter Schlittschuhlaufen gehen zu können. e Wir begrüßen... e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 28 Über die Schulter geschaut Im Dienste der Musik – die Notenarchivare der Münchner Philharmoniker Christian Beuke Gefragt nach einem typigerne arbeiten die beiden schen Arbeitstag, fällt ihre Archivare für den EhrenAntwort kurz, prägnant und dirigenten, Zubin Mehta. mit einem Schmunzeln aus: Denn pünktlicher als er ist „Den gibt es nicht.“ Thomas niemand. „Von ihm kommt Lang und Georg Haider ardie Quinte mindestens drei beiten seit zehn bzw. fünf Monate vor der ersten ProJahren als Notenarchivare be. Mehr als ausreichend Zeit, damit wir die fertigen bei den Münchner Philharmonikern. Vor allem sind sie Stimmen pünktlich an die dafür verantwortlich, dass Thomas Lang und Georg Haider (von links auf dem Foto) Orchestermusiker überdie Striche – die Auf- und arbeiten seit zehn bzw. fünf Jahren als Notenarchivare geben und sie die ProAbstriche der Streicher – gramme vorbereiten könkorrekt in jede Stimme und nach den Wünschen des nen. Unser Anspruch ist es, immer zwei bis drei Dirigenten eingetragen sind. „Manche Maestri Projekte voraus zu sein“, erläutert Georg Haider. schicken uns eine sogenannte „Quinte“ – die ein„Treten Programmänderungen auf, hat die Aktualigerichteten Striche von je einer 1. und 2. Geige, tät natürlich immer Vorrang.“ Bratsche, Cello und Bass“, erklärt Georg Haider. Was sich auf den ersten Blick simpel anhört, ist Durch ihre Hände wandern mitunter wahre Schätbei genauerem Hinsehen wesentlich komplexer. ze. Gustavo Dudamel war sofort Feuer und Flamme Jeder Maestro hat unterschiedliche Erwartungen: als er hörte, dass es bei den Münchner Philharmoder eine bevorzugt das Notenmaterial eines benikern noch alte Noten gebe, die von Celibidache stimmten Verlags, weil er mit diesen Noten schon eingerichtet wurden und aus denen er dirigiert hat. seit Jahren arbeitet. „Lorin Maazel hat dank seines „Er fragte, ob er nach einer Probe kurz bei uns vorfotografischen Gedächtnisses sofort erkannt, ob es bei kommen dürfe, um sich Partituren genauer an„sein“ Material war“, erinnert sich Thomas Lang. zusehen“, berichtet Thomas Lang. „Fast eine Stun„Diese Stelle war doch bisher immer oben links auf de war er da“ – eine Ausnahme, wie er gerne offen zugibt. „Mit offenem Mund hat er zugehört als dieser Seite. Es ist ein wenig ungewohnt, wenn sie auf einmal woanders auftaucht“, so der Kommentar ich ihm sagte, dass die Münchner Philharmoniker des Maestros. Andere Dirigenten sind dagegen fast alle Orchesterwerke Richard Strauss’ vom sehr an den neuesten Ausgaben interessiert, die Komponisten selbst geschenkt bekommen haben.“ erst ganz frisch herausgekommen sind. Besonders In der Tat eine absolute Besonderheit. Ph Auch ein guter Draht zu den Musikern des Orchesters ist für Thomas Lang und Georg Haider selbstverständlich. Wünsche einzelner Kollegen werden sofort erfüllt, sei es die Vergrößerung von Stimmen, das Übertragen kurzer Passagen in einen anderen Notenschlüssel oder die Bereitstellung von Stimmen auch mal früher als normalerweise üblich. Wolfgang Berg, Bratscher und Erfinder des 29 Odeonjugendorchesters, fragt regelmäßig für das Patenorchester nach einer Quinte, damit die jungen Musiker die Striche in ihr gekauftes Material übertragen können. Gleiches gilt für das Abonnentenorchester. Und unlesbare Stimmen, im letzten Falle waren das zwei Soloviolinen, die in einem Notensystem – „für das menschliche Auge kaum mehr wahrnehmbar“ – zusammengefasst waren, werden fein säuberlich getrennt neu notiert. Für das beste künstlerische Ergebnis. Georg Haider hat u.a. Komposition studiert. Bevor er bei den Münchner Philharmonikern anfing, war er als freischaffender Komponist tätig. Erst kürzlich hat er mit einem außergewöhnlichen Projekt von sich Reden gemacht: dem Klangbuch „Der Dritte Mann“, nach dem Roman von Orson Welles. Die Musik für vier Zithern, Posaune und Schlagzeug hat er ursprünglich für ein Zitherfestival komponiert. Gemeinsam mit dem Sprecher Norbert Gastell, mit verstellter Stimme als Synchronstimme von Homer Simpson bekannt, ist ein Melodram entstanden, das der Mandelbaumverlag herausgebracht hat. Deutschlandradio Kultur rezensiert: „Dieser „Dritte Mann“ ist kein Futter für das Autoradio, kein Unterhaltungskrimi, kein Auffrischen einer bereits bekannten Erzählung. Georg Haiders „Der Dritte Mann – Orson Welles’ Schatten“ ist uneasy listening, faszinierend-verstörende Hörkunst, die bewusstes Hören erfordert. Und nachdem man diesen Stoff mit anderen Ohren gehört hat, wird man vermutlich auch den Film mit anderen Augen sehen.“ Stets im Dienste der Musik eben. e In der Regel aber wird das Notenmaterial eingekauft. Bedingung für den Erwerb ist, dass die Rechte der Komponisten an den Werken freigeworden sind. In Deutschland ist das 70 Jahre nach dem Tod des Komponisten der Fall. Richard Strauss zum Beispiel ist also noch bis zum 1.1.2020 geschützt. In Asien oder auch in Amerika gelten hingegen andere Regeln. So war in den USA bis vor kurzem jedes Werk 50 Jahre nach dem Erscheinen des jeweiligen Erstdrucks geschützt. Wann werden welche Werke frei? Welche neuen Urtexte gibt es? Fragen, die die beiden Archivare aus dem Stand beantworten können. Ein guter Draht zu den Musikverlagen ist dabei mehr als hilfreich, ja geradezu Voraussetzung. Thomas Lang hat viele Jahre in einem großen Notenverlag gearbeitet, er kennt auch die andere Seite bestens und hat schon die eine oder andere kritische Situation still und einvernehmlich gelöst. Vorher war er als Dramaturg an verschiedenen Theatern in Deutschland tätig. Kein Wunder, dass seine große Liebe der Oper gilt, genauer gesagt der unentdeckten Oper. Mehr als 600 verschiedene Opern hat er bereits gesehen, dafür reist er durch ganz Deutschland, wann immer es die Zeit zulässt. Besonders angetan ist er von den zahlreichen Raritäten, die das Stadttheater Gießen schon seit Jahren ausgräbt. ch is on m er ar ätt ilh Bl Über die Schulter geschaut e ilh a Bl rm ät on te is r ch Ph 30 Orchestergeschichte Die Philharmoniker im Ersten Weltkrieg Gabriele E. Meyer „Oesterreich-Ungarn erklärt den Krieg – Der Ernst der Stunde – Vor der Entscheidung – Krieg oder Frieden? – Der Krieg – Der Weltkrieg“ titelte die Münchner Presse kurz vor und nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die am Abend des 1. August verkündete allgemeine Mobilmachung machte die seit der Neuaufstellung im Herbst 1908 sukzessiv erreichte künstlerische und finanzielle Stabilisierung der Münchner Philharmoniker (damals noch Konzertvereins-Orchester) mit einem Schlag wieder zunichte. Nach einigen Wochen quälender Unsicherheit und der inzwischen erfolgten Kündigung der Musiker als Mitglieder des „Konzertvereins“ eröffnete das Orchester unter Beibehaltung des offiziellen Namens die Saison 1914/15 mit sechs Volks-Symphonie-Konzerten „zugunsten deutscher Orchestermusiker“. Initiator der Serie, die für dieses Vorhaben mittels „erlesener Genüsse, Dirigenten von Ruf und billige Eintrittspreise“ um möglichst viele Besucher warb, war Richard Strauss, Begründer der Genossenschaft deutscher Tonsetzer; er übernahm sogleich die beiden ersten Konzerte. Seinem Aufruf folgten Bruno Walter (2 Konzerte), Siegmund von Hausegger und Ernst Boehe. Von diesen sehr gut besuchten Veranstaltungen scheint eine Initialzündung für die gesamte Spielzeit ausgegangen zu sein, konnten doch trotz kriegsbedingter Schwierigkeiten bis Mitte des folgenden Jahres alle 12 Abonnementskonzerte durchgeführt werden. Dazu kamen noch 2 „Mitgliederkonzerte“, 27 Volkssymphoniekonzerte, 13 Wohltätigkeitskonzerte, 9 „Fremdkonzerte“, 1 Moderner Abend, 1 Richard- Strauss-Konzert zu dessen 50. Geburtstag, 1 Konzert „Münchner Ost- preussenhilfe“, 3 „Vaterländische Konzerte“ sowie 1 Abend „Zu Gunsten des Roten Halbmond“, nicht zu vergessen die 93 Populären Konzerte. Namhafte Dirigenten wie Bruno Walter, Fritz Steinbach, Ferdinand Löwe, Franz Mikorey und Felix Weingartner standen am Pult des Orchesters. Noch Ende Januar 1915 bewarb sich Wilhelm Furtwängler für die „erste verantwortliche Kapellmeister-Stellung“, die wegen der Rechtsunsicherheit allerdings nicht besetzt werden konnte. Beispielhaft erwähnt sei hier nur das 8. Abonnementkonzert vom 3. Febr. 1915, in dem Max Reger seine „Mozart-Variationen“ op. 132 und die „dem Deutschen Heere“ gewidmete „Vaterländische Ouvertüre“ erstmalig in München vorstellte. Das an Reger gerichtete Dankesschreiben des damaligen Oberbürgermeisters Wilhelm von Borscht beschrieb den überwältigenden Erfolg: „Der Besuch unserer Abonnementskonzerte war seit Ausbruch des Krieges noch nie so stark, wie bei Ihrem Konzert, die Begeisterung des Publikums für Ihre bewundernswerten Leistungen war grösser und herrlicher denn je.“ Anfang Juli 1915 kam dann doch das Aus, weil nahezu die Hälfte der Orchestermitglieder einberufen worden war. Da für die künstlerische Ausführung der Konzerte auch unter Heranziehung von Aushilfsmusikern keine Verantwortung mehr übernommen werden konnte, sah sich „die Vorstandschaft gezwungen, von der geplanten Durchführung der Sommerkonzerte in der Tonhalle abzusehen und bis auf weiteres alle Veranstaltungen einzustellen.“ Die verbliebenen Musiker aber gaben nicht auf. Verstärkt „durch hier lebende und Ph 31 Zwecke seines Daseins aufs neue zugewandt hat“ ging auch durch die Zeitungen. „Wenn man es nicht schon vorher gewußt hätte“ schrieb Paul Ehlers von den „Münchner Neuesten Nachrichten“, „müßten es einen die konzertvereinslosen letzten Winter gelehrt haben, wie nötig München den Konzertverein hat. Wir waren, weil die Musikalische Akademie über ihre acht eigenen Abende und die paar Konzerte mit dem Lehrergesangverein hinaus nichts mehr übernehmen kann, musikalisch fast auf den Rang einer Kleinstadt gedrückt worden (wozu auch die einzig dastehende Kohlensperre noch ihr Teil beigetragen hatte). Von neuen, zu ihrer Aufführung eines Orchesters bedürfenden Werken lernten wir kaum etwas mehr kennen und selbst die „Klassiker“ unter den Modernen“, hier ist wohl das symphonische Werk Bruckners und Mahlers gemeint, „mußten wir mehr oder minder entbehren.“ Trotz dieser grundsätzlichen Sympathiebekundung hinterließ das Konzert bei Ehlers einen eher zwiespältigen Eindruck, angesichts der äußeren Umstände nur allzu verständlich: „Wäre Berta Morena nicht gewesen […], so wäre der Eindruck des Abends, sein Ertrag an künstlerischen Erlebnissen recht bescheiden geblieben.“ Es sollte noch einige Zeit vergehen, bis sich die Münchner Philharmoniker wieder auf der Höhe ihres Könnens vorstellen konnten… e hierher berufene Tonkünstler“ versuchten sie als „Neues Münchener Konzert-Orchester“, abgekürzt „Neues Konzert-Orchester“ weiterzuarbeiten. Die Besucher kamen trotz Kohlennot, Mangelernährung und schlechter Verkehrsverbindungen. Die Programme konzentrierten sich, der personellen Not gehorchend, meist auf kleiner besetzte Werke wie Serenaden, Suiten und Symphonien. Viele bekannte Solisten, unter ihnen Elly Ney, Willem van Hoogstraten, Alfred von Pauer, Eugen d’Albert, Bronislaw Hubermann, Johannes Hegar, Adolf und Fritz Busch, Teresa Carreño, Eugen Papst, Berta Morena und Fritz Feinhals unterstützten die Orchestermusiker in ihrem Bestreben, auch weiterhin anspruchsvolle Abende zu gestalten. Gespielt wurde im Hotel „Vier Jahreszeiten“. Wie allerdings Wagners „Meistersinger“-Vorspiel von dem „leider sehr dezimierten Neuen Münchener KonzertOrchester“ erklang, sollte man sich eher nicht ausmalen. Noch vor Kriegsende beschloß der „Konzertverein“, zwischenzeitlich als kriegswichtiger Betrieb anerkannt, am 27. Mai 1918 die Wiederaufnahme des Konzertbetriebs „im nächsten Winter“. Am 30. September war es endlich soweit. Auf dem Programm des Eröffnungskonzerts unter der Leitung von Florenz Werner stand die 1. Symphonie von Johannes Brahms sowie Rezitativ und Arie der Leonore aus Beethovens „Fidelio“ und „Vorspiel und Isoldes Liebestod“ aus Wagners „Tristan und Isolde“. Berta Morena, die hochgerühmte WagnerHeroine und Mitglied der Münchener Hofoper hatte den Gesangspart übernommen. Ein Aufatmen ob der Tatsache, „daß sich der Konzertverein dem ch is on m er ar ätt ilh Bl Orchestergeschichte 32 So. 14.12.2014, 11:00 3. Abo m Di. 16.12.2014, 20:00 2. Abo k5 Mi. 17.12.2014, 20:00 2. Abo e5 Olivier Messiaen „Les offrandes oubliées“, Sinfonische Meditationen Frédéric Chopin Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 e-Moll op. 11 Jean Sibelius Symphonie Nr. 1 e-Moll op. 39 Pietari Inkinen, Dirigent William Youn, Klavier Vorschau Mi. 31.12.2014, 17:00 Silvesterkonzert Fr. 02.01.2015, 20:00 3. Abo c Sa. 03.01.2015, 19:00 2. Abo h5 Fr. 09.01.2015, 10:00 ÖGP Fr. 09.01.2015, 20:00 4. Abo f Sa. 10.01.2015, 19:00 4. Abo d So. 11.01.2015, 11:00 3. Abo g5 Georges Bizet Suite aus „Carmen“ Ambroise Thomas „Je suis Titania“ aus „Mignon“ Jacques Offenbach Suite aus „La Gaîté parisienne“ Leonard Bernstein Ouvertüre und „Glitter and be Gay“ aus „Candide“ Josef Strauß „Die Libelle“ Franz Lehár „Vilja“-Lied aus „Die lustige Witwe“ Johann Strauß (Sohn) Ouvertüre zu „Der Zigeunerbaron“, „Auf der Jagd“, „Frühlingsstimmen“, „Im Krapfenwaldl“, Csárdás aus „Die Fledermaus“, „Unter Donner und Blitz“ Hector Berlioz Ouvertüre zu „Les Francs-Juges“ op. 3 Béla Bartók Konzert für Violine und Orchester Nr. 2 Sergej Rachmaninow „Symphonische Tänze“ op. 45 Stéphane Denève, Dirigent Leonidas Kavakos, Violine Manfred Honeck, Dirigent Diana Damrau, Sopran Impressum Herausgeber Direktion der Münchner Philharmoniker Paul Müller, Intendant Kellerstraße 4, 81667 München Lektorat: Christine Möller Corporate Design: Graphik: dm druckmedien gmbh, München Druck: Color Offset GmbH, Geretsrieder Str. 10, 81379 München Gedruckt auf holzfreiem und FSC-Mix zertifiziertem Papier der Sorte LuxoArt Samt. Textnachweise Susanne Stähr, Egon Voss, Adam Gellen, Elke Heidenreich, Christian Beuke und Gabriele E. Meyer schrieben ihre Texte als Originalbeiträge für die Programmhefte der Münchner Philharmoniker. Lexikalische Angaben und Kurzkommentare: Stephan Kohler. Künstlerbiographie: Christine Möller. Alle Rechte bei den Autorinnen und Autoren; jeder Nachdruck ist seitens der Urheber genehmigungs- und kostenpflichtig. Bildnachweise Abbildungen zu Kurt Weill: David Farneth, Elmar Juchem, Dave Stein, Kurt Weill – Ein Leben in Bildern und Dokumenten, München 2000. Abbildungen zu Johannes Brahms: Christiane Jacobsen (Hrsg.), Johannes Brahms – Leben und Werk, Hamburg 1983; Frans Grasberger, Johannes Brahms – Variationen um sein Wesen, Wien 1952; Abbildungen zu Arnold Schönberg: Nuria Nono-Schönberg (Hrsg.), Arnold Schönberg – Lebens­ geschichte in Begegnungen, Klagenfurt 1998; Künstlerphotographien: Marco Borggreve (Sanderling); Leonie von Kleist (Heidenreich); privat (Aselmeyer, Zimmermann, Baltacigil, Mijnders). Diana Damrau Manfred Honeck Sopran Dirigent Werke von Bizet, Thomas, Offenbach, Bernstein, Johann Strauß (Sohn), Josef Strauß und Lehár Mittwoch, 31.12.2014, 17 Uhr Freitag, 02.01.2015, 20 Uhr Samstag, 03.01.2015, 19 Uhr Philharmonie im Gasteig Karten € 85,50 / 71,50 / 62,70 / 51,50 / 45,10 / 26,20 / 17,40 Informationen und Karten über München Ticket KlassikLine 089 / 54 81 81 400 und unter mphil.de 117. Spielzeit seit der Gründung 1893 Valery Gergiev, Chefdirigent (ab 2015/2016) Paul Müller, Intendant