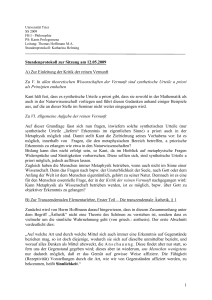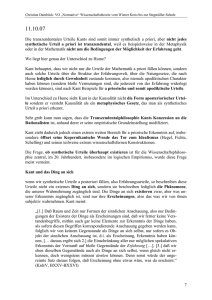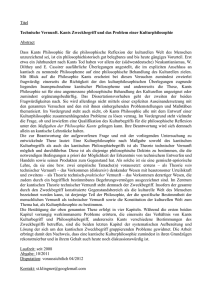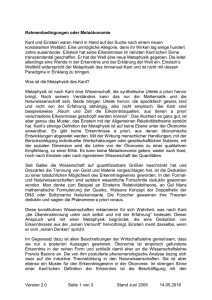Basel Böhlau Verlag Köln · Weimar · Wien Verlag - utb-Shop
Werbung

UTB 2707 Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage Beltz Verlag Weinheim · Basel Böhlau Verlag Köln · Weimar · Wien Verlag Barbara Budrich Opladen · Farmington Hills Wilhelm Fink Verlag München A. Francke Verlag Tübingen und Basel Haupt Verlag Bern · Stuttgart · Wien Julius Klinkhardt Verlagsbuchhandlung Bad Heilbrunn Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft Stuttgart Mohr Siebeck Tübingen C. F. Müller Verlag Heidelberg Orell Füssli Verlag Zürich Verlag Recht und Wirtschaft Frankfurt am Main Ernst Reinhardt Verlag München und Basel Ferdinand Schöningh Verlag Paderborn · München · Wien · Zürich Eugen Ulmer Verlag Stuttgart UVK Verlagsgesellschaft Konstanz Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen vdf Hochschulverlag AG an der ETH Zürich WUV Facultas Wien Georg Römpp Kant leicht gemacht Eine Einführung in seine Philosophie 2., verbesserte Auflage BÖHLAU VERLAG KÖLN WEIMAR WIEN · 2007 Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-8252-2707-4 (UTB) ISBN 978-3-412-22106-5 (Böhlau) Umschlagabbildung: Immanuel Kant. Altersportrait. Holzstich von J.L.Raab nach einem Gemälde von G. Doebler. Foto: akg-images. © 2005 by Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Ursulaplatz 1, D-50668 Köln Tel. (0221) 9 13 90-0, Fax (0221) 9 13 90-11 [email protected] Alle Rechte vorbehalten Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart Druck und Bindung: AALEXX Druck GmbH, Großburgwedel Gedruckt auf chlor- und säurefreiem Papier Printed in Germany ISBN 978-3-8252-2707-4 Inhaltsverzeichnis Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 7 Das Wahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Kants fundamentale Einsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Transzendentale Ästhetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2.1 Das Prinzip der transzendentalen Ästhetik. . . . . . . . . . . . . . . 20 2.2 Der Raum als Form der Sinnlichkeit a priori . . . . . . . . . . . . . 34 2.3 Die Zeit als Form der Sinnlichkeit a priori . . . . . . . . . . . . . . . 45 3. Transzendentale Logik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 3.1 Kants Konzeption einer transzendentalen Logik . . . . . . . . . . 61 3.2 Die Urteilsformen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 3.3 Von den Urteilsformen zu den reinen Verstandesbegriffen . 82 3.4 Die Tafel der Kategorien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 3.5 Das Ich der transzendentalen Apperzeption . . . . . . . . . . . . . 101 4. Die Grenzen der Wahrheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 II. Das Gute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kants fundamentale Einsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Das Gute im Wollen: Moralphilosophie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 Das Gesetz und die Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 Die Antinomie der Selbstverpflichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 Die Freiheit und das Factum der Vernunft . . . . . . . . . . . . . . . 2.4 Das Selbst der Moral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Das Gute im Handeln: Rechtslehre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 Freiheit und Handlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 Die Darstellung der Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 Das allgemeine Gesetz der Freiheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 Der rechtliche Mensch und sein Eigentum . . . . . . . . . . . . . . 4. Das Gute und der Staat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1 Das private Recht und der Staat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 Das positive Recht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 Der Rechtszustand und der Staat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Die Grenzen der praktischen Vernunft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 129 144 144 154 160 165 173 173 183 190 200 216 216 225 233 241 6 Inhaltsverzeichnis III. Das Schöne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Kants fundamentale Einsicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Die Urteilskraft und das Schöne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Das Schöne und die Erkenntnisvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Die Grenzen des ästhetischen Urteils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 249 255 261 269 Literaturangaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Vorwort Daß die Sonne sich um die Erde dreht und deshalb im Osten aufsteigt und im Westen untergeht, war viele Jahrhunderte lang eine selbstverständliche Gewißheit für jeden Menschen. Die meisten von uns glauben auch heute noch, daß sie im Osten aufgeht und im Westen untergeht, aber nur wenige Menschen nehmen an, dies gehe darauf zurück, daß sie sich um die Erde drehe. Am Anfang dieser Einsicht standen ein Problem und eine einfache Überlegung von Kopernikus. Sein Problem war, daß „es mit der Erklärung der Himmelsbewegungen nicht gut fort wollte, wenn er annahm, das ganze Sternenheer drehe sich um den Zuschauer“. Seine Überlegung war, „ob es nicht besser gelingen möchte, wenn er den Zuschauer sich drehen, und dagegen die Sterne in Ruhe ließ.“1 Kants Philosophie – der viele Autoren den Status eines Äquivalents zu der Überlegung des Kopernikus in der Philosophie zuschreiben – begann mit dem Problem, daß rein aus der Erfahrung kein sicheres Wissen zu gewinnen ist. Auf das Erfahrungswissen – sei es im Alltag oder in der Naturwissenschaft gewonnen – verlassen wir uns zwar täglich, wenn wir morgens die Kaffeemaschine einschalten oder abends den Champagner aus dem Kühlschrank holen. Philosophen sind aber nicht restlos zufrieden, wenn der Kaffee heiß und der Champagner kalt ist. Sie möchten gerne noch darüber hinaus wissen, ob wir dies denn auch ganz sicher wissen können. Normale Menschen antworten darauf mit dem Hinweis, es sei doch schon immer so gewesen, worauf Philosophen nur ein Wort sagen: Induktionsproblem. Damit ist die folgende Frage aufgeworfen. Aus der Tatsache, daß bestimmte Zusammenhänge immer schon so waren, können wir nicht schließen, sie werden auch in Zukunft so sein, außer wir nehmen ein Prinzip an, das uns dies zu sagen erlaubt, aber wie begründen wir dieses Prinzip? Aus Erfahrung? Dann brauchen wir ein Prinzip dafür, daß uns dies die Erfahrung lehren kann, denn gerade der Zweifel an der Erfahrung war es ja, der uns nach einem solchen Prinzip zu suchen veranlaßte. Bei Kant erscheint die Frage nach einem sicheren Wissen unter dem Titel der Frage nach einem Wissen a priori, d. h. nach einem Wissen unabhängig von der Erfahrung, aber doch so, daß es ein sicheres Erfahrungswissen möglich macht. Deshalb kann Kant das Problem mit einem sicheren Wissen so formu1 So beschreibt dies Kant in der ‚Kritik der reinen Vernunft‘ (B XVI). 8 Vorwort lieren: „Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne“. Das gleiche gilt auch für die Begriffe, mit denen wir unsere Anschauungen zum Ausdruck bringen: richten sie sich nach den Gegenständen, so können wir nichts sicher wissen, denn die Erfahrung kann uns grundsätzlich immer täuschen. Kant hatte aber auch eine Lösung dafür parat: „richtet sich aber der Gegenstand (...) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen“ – nämlich die Möglichkeit eines sicheren Wissens. Das gleiche gilt für die Begriffe: richten sich die Begriffe nach den Gegenständen, so kann ich nichts Sicheres von ihnen wissen; aber wir können ja auch annehmen, „die Gegenstände oder, welches einerlei ist, die Erfahrung, in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände) erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen“.2 Damit ist das Prinzip einer Kritik der reinen Vernunft im Grunde schon vollständig angegeben, und der Leser/die Leserin wird in der Lage sein, alle Details aus seiner/ihrer reinen Vernunft zu entwickeln. Falls nicht, so findet er/sie auf den folgenden Seiten eine einfache Erörterung und Erklärung dieses einfachen Prinzips, ob dessen Einfachheit er/sie nach der Lektüre nur noch fragen wird, warum er/sie nicht selbst darauf gekommen sei. Und wenn man schon bei der Kritik der Vernunft ist, dann kann man ja auch gleich fragen, ob wir denn auch wissen können, was wir tun sollen. Auch dazu bietet uns Kant eine erschöpfende Auskunft an, die prinzipiell genauso leicht zu verstehen ist wie die entsprechende Aufklärung über das Wissen auf dem Gebiet der Theorie. Falls der Leser/ die Leserin auch diese Erklärungen nicht aus der eigenen Vernunft entwickeln kann oder will, so stehen ersatzweise ausführliche und einfache Erklärungen auf den folgenden Seiten bereit. Aber Kant hat sich nicht nur mit der theoretischen und der praktischen Vernunft beschäftigt – also nicht nur mit den Fragen ‚was können wir wissen?‘ und ‚was sollen wir tun?‘. In der ‚Kritik der Urteilskraft‘ erklärt er darüber hinaus, wie es sich mit dem Schönen und mit der Beurteilung des Schönen im ‚ästhetischen Urteil‘ verhält. Der Leser/die Leserin sollte schon jetzt beachten, daß diese Erörterungen in einem systematischen Zusammenhang mit den Problemen der theoretischen Vernunft stehen, die in den ersten Kapiteln ‚leicht gemacht‘ werden. Deshalb ist es sinnvoll, zuerst diese Ausführungen zu lesen und es sich nicht zu ‚leicht zu machen‘ und gleich zum Schönen zu eilen. Schließlich bietet Kants Philosophie zum Wahren und Guten so viele spannende Gedanken an, daß die Zeit wie im Fluge verstreichen wird, bis der Leser/die Leserin es sich endlich ‚schön‘ machen kann. 2 B XVII 9 Vorwort Auf den folgenden Seiten wird Kants Philosophie so ‚leicht gemacht‘, daß an manchen Stellen ein Einhalten geboten erscheint, damit auch den schweren Einsichten ihr Recht zukommt. Diese Aufgabe hat ein besonders geniales Tier übernommen. Es handelt sich um die Katze Lucy, die mit tiefen Einsichten und schwerwiegenden Bedenken die leichten Erörterungen bisweilen unterbricht. Am besten geben wir ihr gleich das Wort. Anzumerken ist noch, daß sie nicht nur Kants Werke (und die des Autors dieser Zeilen) gelesen hat, sondern auch in der schönen Literatur bewandert ist, was sie nur zu gern zum besten gibt – und dies am liebsten in ihrer Muttersprache. „The increasing seriousness of things, then – that’s the great opportunity of jokes.“ [Leider ist Lucy nicht immer ganz originell, diese Weisheit z. B. hat sie von Henry James.] Es ist für jeden Autor erfreulich, wenn ein Buch nach kurzer Zeit schon in der 2. Auflage erscheinen kann. Der Text wurde durchgesehen und an zahlreichen Stellen verbessert. Es ist zu hoffen, daß die Lesbarkeit und die ‚usability‘ dadurch gewonnen haben. Die folgenden Ausführungen enthalten hoffentlich keine größeren Fehler oder Unrichtigkeiten. Wenn doch, so übernimmt Lucy die gesamte Verantwortung. Georg Römpp 10 Vorwort I. Das Wahre 1. Kants fundamentale Einsicht Wenn wir für unser Wissen beanspruchen, daß es ‚vernünftig‘ begründet sei, d. h. daß wir es ‚aus der Vernunft‘ rechtfertigen können, „so muß darin etwas a priori erkannt werden“ (B IX). Sprechen wir von der theoretischen Vernunft – um die es in der ‚Kritik der reinen Vernunft‘ geht – so muß dieses apriorische Erkennen dazu benutzt werden, um „den Gegenstand“ der Erkenntnis bzw. dessen Begriff zu bestimmen. Damit unterscheidet sich die theoretische Vernunft von der praktischen Vernunft, in der es darum geht, den Gegenstand zu machen und nicht zu bestimmen – m. a. W.: in der wir ein Wissen suchen, das uns angibt, wie wir handeln sollen. Einen solchen Begriff von Vernunft müssen wir nicht haben. Unsere Begriffe sind nicht durch sich selbst bestimmt, sondern wir bestimmen sie, indem wir anderen ihre Bedeutung erklären. Dies kann auf verschiedene Weise gelingen, solange wir von den Menschen verstanden werden, denen wir etwas sagen wollen. Wenn wir aber Kants theoretische Philosophie verstehen wollen, so müssen wir diesen Begriff von Vernunft akzeptieren und dürfen ihm nicht entgegenhalten, die Vernunft sei doch etwas ganz anderes. Daraus läßt sich zunächst ein ganz allgemeiner Hinweis entnehmen. Die Beschäftigung mit einer bestimmten Philosophie ist stets auch das Erlernen einer Sprache, und je schneller wir den Umgang mit dieser Sprache lernen, desto leichter wird es, die damit verbundenen Gedanken zu verstehen. Darin liegt allerdings auch eine gewisse Gefahr. Bewegen wir uns nur noch in dieser Sprache, so fällt es schwer, uns von den philosophischen Gedanken, die wir so erlernen, so weit zu distanzieren, daß wir sie in die größeren Zusammenhänge der Philosophiegeschichte stellen und sie dann sogar noch kritisch betrachten können. Dennoch müssen wir Kants Sprachgebrauch zunächst akzeptieren, wonach unter ‚Vernunft‘ eine Tätigkeit des erkennenden Bewußtseins zu verstehen ist, durch die ein Wissen a priori gefunden werden kann. 12 Kants fundamentale Einsicht Metaphysik? Der Ball ist rund, und das Spiel ist mit dem Schlußpfiff zu Ende, soviel steht doch schon mal fest. Alles andere ist doch bloß Theorie! [Lucy, Katzen können nicht Fußball spielen ...!] Eine solche Erkenntnis aus Vernunft, die a priori erkennt, nennt Kant ganz allgemein ‚Metaphysik‘. Er verwendet damit einen sehr alten Begriff, aber wir können es uns hier sparen, die Geschichte dieses Begriffs nachzuzeichnen. Wichtiger ist, daß es Kant bei diesem Ausdruck nicht darum geht, die Gegenstände einer solchen Erkenntnis zu bezeichnen, sondern die Art und Weise, wie sie gefunden werden – vor allem aber, wodurch sie begründet werden können. Wenn mit ‚Metaphysik‘ also eine Erkenntnis bezeichnet wird, die aus der Vernunft und damit a priori begründet wird, so kann sie nicht empirisch sein. Eine solche Erkenntnis kann also nicht aus der Erfahrung genommen und aus Erfahrung begründet werden; d. h. sie muß „jenseits der Erfahrung liegende Erkenntnis“ sein (P 265).3 Begründet werden kann sie weder aus der äußeren noch aus der inneren Erfahrung. Diese besondere Art der Begründung, die hier bisher nur negativ angegeben ist, bezeichnet Kant als ‚a priori‘ – ‚vor‘ der Erfahrung im Sinne von: nicht durch Erfahrung begründet. Damit wäre eine solche Erkenntnis aber noch nicht von der Mathematik unterschieden, deren Sätze doch auch unabhängig von der Erfahrung begründet werden können. Es muß also noch ein zusätzliches Kriterium hinzugenommen werden, um die Erkenntnis aus Vernunft, von der Kant unter dem Titel ‚Metaphysik‘ spricht, zu bestimmen. Um das besondere Wissen, das ‚Metaphysik‘ ausmacht, nach seiner Begründungsart näher zu bestimmen, hat Kant die Urteile, aus denen unser Wissen besteht, mit Hilfe von zwei Kriterien in vier verschiedene Gruppen eingeteilt. (1) Eines dieser Kriterien ist schon eingeführt worden: wenn es Urteile ‚a priori‘ gibt, so gibt es natürlich auch Urteile ‚a posteriori‘ – Urteile, die empirisch begründet werden, d. h. auf der Erfahrung beruhen. (2) Das zweite dieser Kriterien 3 Zitate im Text werden wie folgt angegeben: A mit Seitenzahl = Kritik der reinen Vernunft 1787; B mit Seitenzahl = Kritik der reinen Vernunft 1781; P mit Seitenzahl = Prolegomena, zitiert nach der Ausgabe im Felix Meiner Verlag (Philosophische Bibliothek), aber mit Angabe der Seitenzahl der Ausgabe in Kants Gesammelten Schriften (= Akademie-Ausgabe) Bd. IV, S. 253–383. Kants fundamentale Einsicht 13 bezieht sich dagegen nicht auf die Begründungsart eines Urteils, sondern auf die Beziehung, die in einem Urteil zwischen dem, wovon etwas ausgesagt wird, und dem, was ausgesagt wird, bestehen kann. Ein Urteil kann nur erläuternd sein, d. h. es gibt uns eigentlich keine Erkenntnis dem Inhalt nach, denn der Inhalt der Erkenntnis ist eigentlich schon im Begriff des Gegenstands, von dem etwas ausgesagt wird, enthalten. Ein ganz einfaches Beispiel: ‚Alle Schimmel sind weiß.‘ Das Prädikat ist hier in der Bedeutung des Satzsubjekts schon enthalten, und wir lernen eigentlich nur etwas über diese Bedeutung. Kants Beispiel ist übrigens: ‚Jeder Körper ist ausgedehnt‘; durch dieses Urteil „habe ich meinen Begriff vom Körper nicht im mindesten erweitert, sondern ihn nur aufgelöst“ (P 266). Solche Urteile nennt Kant analytisch und bezeichnet sie auch als „Erläuterungs-Urteile“ (B 11). Ein Urteil kann aber auch erweiternd sein, d. h. es erweitert unsere Erkenntnis nicht dadurch, daß es den Begriffsinhalt des Satzsubjekts erläutert, sondern indem es diesen Begriffsinhalt mit einem Prädikat verbindet, das in der Bedeutung des Satzsubjekts noch nicht enthalten war. Ein ganz einfaches Beispiel: ‚Einige Katzen sind genial‘; hier ist das Prädikat durchaus nicht in der Bedeutung des Satzsubjekts enthalten, d. h. es ist nicht schon durch unsere Sprache gegeben, daß Katzen eine solche Eigenschaft zuzuschreiben ist. Wenn wir eine solche Behauptung aufstellen, dann sind wir also über die bisherige Bedeutung des Begriffs hinausgegangen und haben diesen Begriff mit einem Prädikat verbunden, das wir nicht analytisch – also durch ‚Auflösung‘ (Analyse) des Begriffs – hätten finden können. Kants Beispiel ist hier übrigens: ‚Einige Körper sind schwer‘ – dieser Satz enthält „etwas im Prädikate, was in dem allgemeinen Begriffe vom Körper nicht wirklich gedacht wird; er vergrößert also meine Erkenntnis“ (P 266). Solche Urteile nennt Kant synthetisch, und er bezeichnet sie auch als „Erweiterungs-Urteile“ (B 11). Wir haben also nun zwei Kriterienpaare, mit deren Hilfe wir die Urteile einteilen können, in denen wir unser Wissen zum Ausdruck bringen: a priori – a posteriori analytisch – synthetisch. Verbinden wir diese Begriffe nun untereinander, so gelangen wir zu vier verschiedenen Urteilen: – analytische Urteile a priori – analytische Urteile a posteriori – synthetische Urteile a priori – synthetische Urteile a posteriori. Von diesen vier Urteilsstrukturen machen drei keine Probleme, die wir im Zusammenhang mit der Erläuterung von Kants theoretischer Philosophie behandeln müßten: – analytische Urteile a posteriori gibt es nicht (wenn das Prädikat schon in der Bedeutung des Satzsubjekts enthalten ist, dann können wir nicht die Erfah- 14 Kants fundamentale Einsicht rung zu Hilfe nehmen, um dieses Urteil zu begründen, sondern wir begründen es nach dem Widerspruchsprinzip, d. h. nach dem Prinzip vom zu vermeidenden Widerspruch); – synthetische Urteile a posteriori sind alle Erfahrungsurteile, die wir nicht aus der Vernunft nehmen; hier verbinden wir das Satzsubjekt mit dem Prädikat, indem wir uns auf „die vollständige Erfahrung von dem Gegenstande“ stützen; – analytische Urteile a priori sind alle analytischen Urteile, denn um das Prädikat zu finden, das zu einem Satzsubjekt gehört, müssen wir in diesem Falle nicht die Erfahrung zu Hilfe nehmen, sondern nur die Bedeutung des Satzsubjekts. Es bleiben also noch die synthetischen Urteile a priori, und es sind genau diese Urteile, mit Hilfe derer Kant die Erkenntnis aus Vernunft und die Metaphysik charakterisiert. Wenn wir oben gesagt haben, daß in unserem Wissen dann Vernunft ist, wenn wir etwas a priori wissen, dann müssen wir jetzt ergänzen: eine vernünftige Begründung kann dem Wissen dann zugeschrieben werden, wenn es ein Wissen ist, das aus synthetischen Urteilen apriori besteht – kurz: aus apriorisch-synthetischen Urteilen. Kant findet solche Urteile zunächst in der Mathematik. Es muß uns hier nicht interessieren, wie er dies näher begründet. Wichtiger ist die Behauptung, daß auch nicht-mathematische Urteile möglich sind, die apriorisch-synthetisch begründet sind, und daß alle eigentlich metaphysischen Urteile apriorisch-synthetische Urteile sind: „Allein die Erzeugung der Erkenntnis a priori, sowohl der Anschauung als Begriffen nach, endlich auch synthetischer Sätze a priori und zwar in der philosophischen Erkenntnis, macht den wesentlichen Inhalt der Metaphysik aus.“ (P 269) Wir haben also nun drei Begriffe, die im Kantischen Sprachgebrauch im wesentlichen äquivalent gebraucht werden können: Metaphysik, Erkenntnis aus Vernunft, Erkenntnis durch apriorisch-synthetische Urteile. I was thrown out of college for cheating on the metaphysics exam; I looked into the soul of the boy sitting next to me. [Lucy, Woody Allen weiß nicht, was Metaphysik ist!] Kants fundamentale Einsicht 15 In den ‚Prolegomena‘ bezieht sich Kant auf Hume, um darzustellen, wie fragwürdig eine solche Erkenntnisform doch eigentlich sei. Er verwendet dazu einen bestimmten Begriff aus der Metaphysik, nämlich genau den, den Hume benutzt hatte, um die Unmöglichkeit einer Metaphysik darzulegen. Wir werden in einem späteren Abschnitt Kants Auffassung zu diesem Begriff näher erläutern, und wir werden sehen, daß gerade dieser Begriff besonders gut geeignet ist, um Kants Lösung des Problems zu bestimmen, das Hume aufgeworfen hatte. Dieser Begriff ist der von der Verknüpfung von Ursache und Wirkung, also der Begriff der Kausalität. Es mag zunächst seltsam erscheinen, daß Kant diesen Begriff der Metaphysik zuordnet, aber dies ist dann verständlich, wenn wir Kants Begriff der Metaphysik berücksichtigen; auch der Begriff der Kausalität kann nicht aus der Erfahrung entnommen werden, sondern wir machen uns mit seiner Hilfe die Erfahrung verständlich, und ist dieser Begriff nicht vernünftig begründet, so kann auch die Erfahrung nicht vernünftig verständlich werden. Kant führt Humes zentrale Behauptung so aus: „Er bewies unwidersprechlich, daß es der Vernunft gänzlich unmöglich sei, a priori und aus Begriffen eine solche Verbindung zu denken, denn diese enthält Notwendigkeit; es ist aber gar nicht abzusehen, wie darum, weil Etwas ist, etwas Anderes notwendigerweise auch sein müsse, und wie sich also der Begriff von einer solchen Verknüpfung a priori einführen lasse.“ (P 257) Wir hatten oben bei den synthetischen Urteilen a posteriori – also den Erfahrungsurteilen – gesagt, der Verstand stützt sich hier auf ‚die vollständige Erfahrung‘ von dem Gegenstand. Warum kann dies im Falle der Kausalität nicht gelingen? Nehmen wir das kausale Urteil ‚weil Lucy in der Sonne liegt, deshalb wird ihr Fell warm‘. Ist dies nur ein Erfahrungsurteil? In gewissem Sinne ja, denn ohne Erfahrung hätten wir keine Kenntnis davon, daß Lucy in der Sonne liegt und daß ihr Fell warm ist. Aber können wir nur aufgrund von Erfahrung behaupten, Lucys Fell ist warm, weil sie in der Sonne liegt? Hume hatte genau dies bestritten, indem er darauf hinwies, daß wir in einem solchen Fall nur zwei Wahrnehmungen besitzen, nämlich ‚Lucy in der Sonne‘ und ‚Lucys warmes Fell‘. Es gibt aber keinen vernünftigen Grund, daß wir beide Wahrnehmungen durch ein ‚weil‘ verbinden, daß wir also den Begriff der Kausalität verwenden. Hume hatte nicht vorgeschlagen, auf den Begriff der Kausalität deshalb zu verzichten. Kant hat das Problem, das Hume aufwarf, so bezeichnet: „Es war nicht die Frage, ob der Begriff der Ursache richtig, brauchbar und in Ansehung der ganzen Naturerkenntnis unentbehrlich sei, denn dieses hatte Hume niemals in Zweifel gezogen; sondern ob er durch die Vernunft a priori gedacht werde und auf solche Weise eine von aller Erfahrung unabhängige innere Wahrheit ... habe.“ (P 258/259) 16 Kants fundamentale Einsicht Hume hatte also bestritten, daß dies ein Begriff sei, der sich aus Vernunft rechtfertigen lasse. Es handelt sich dieser Auffassung zufolge vielmehr um einen Begriff, den wir auf der Grundlage von Gewohnheiten verwenden. Wir verbinden also zwei Wahrnehmungen, die wir oft zusammen vorgefunden haben, und von denen wir deshalb annehmen, daß wir sie auch in Zukunft noch oft zusammen antreffen werden, und sprechen in diesem Fall von Kausalität. Dagegen wendet Kant nun ein, wir könnten diesen Begriff nicht auf der Grundlage von Erfahrung verwenden: „Erfahrung kann es nicht sein, weil der angeführte Grundsatz nicht allein mit größerer Allgemeinheit, sondern auch mit dem Ausdruck der Notwendigkeit, mithin gänzlich a priori und aus bloßen Begriffen diese zweite Vorstellungen zu der ersteren hinzugefügt.“ (B 13) Wir können dieser Stelle die beiden Begriffe der Allgemeinheit bzw. der Allgemeingültigkeit und der Notwendigkeit entnehmen, um sie zur Beschreibung des Problems zu verwenden, vor das sich Kant in bezug auf die Erkenntnis aus Vernunft, also auf der Grundlage apriorisch-synthetischer Urteile, und damit in bezug auf die ‚Metaphysik‘ gestellt sah. Kant hatte die Tragweite der Hume’schen Kritik durchaus in ihrer ganzen Bedeutung erkannt. Er erkannte zunächst, daß der Einwand gegen die vernünftige Begründung des Begriffes der Kausalität sich nicht auf die Urteilsform erstreckt, die diesen Begriff verwendet. Humes Einwand gegen die Kausalität als Vernunftbegriff ließ sich leicht erweitern gegen alle Begriffe, mit deren Hilfe wir Allgemeinheit und Notwendigkeit von Erkenntnissen behaupten; Kant fand bald: „daß der Begriff der Verknüpfung von Ursache und Wirkung bei weitem nicht der einzige sei, durch den der Verstand a priori sich Verknüpfungen der Dinge denkt, vielmehr, daß Metaphysik ganz und gar daraus bestehe.“ (P 260) Das Problem ist im Grunde identisch mit der Frage nach der sinnvollen Verwendung synthetisch-apriorischer Urteile, in denen eine Verbindung zwischen Satzsubjekt und Prädikat behauptet wird, ohne daß man sich dazu auf die Erfahrung berufen kann. Wir können dies mit Hilfe der jetzt gefundenen Begriffe der Allgemeinheit und Notwendigkeit verdeutlichen. Was auf dem Spiele steht, wenn die vernunftgegründete – also nicht nur gewohnheitsmäßige oder pragmatische – Verwendung synthetisch-apriorischer Urteile (wie etwa im Falle der Kausalität) bezweifelt wird, ist letztlich die objektive und Notwendigkeit beanspruchende Geltung unserer Urteile über die Welt. Wir könnten auch sagen: auf dem Spiele steht die Möglichkeit, eine sichere Erkenntnis von der Welt der Erfahrung gewinnen zu können. Kant formuliert dies so: „Alle unsere Urteile sind zuerst bloße Wahrnehmungsurteile; sie gelten bloß für uns, d. i. für unser Subjekt, und nur hintennach geben wir ihnen eine neue Beziehung, nämlich auf Kants fundamentale Einsicht 17 ein Objekt und wollen, daß es auch für uns jederzeit und ebenso für jedermann gültig sein solle; denn wenn ein Urteil mit einem Gegenstande übereinstimmt, so müssen alle Urteile über denselben Gegenstand auch untereinander übereinstimmen, so bedeutet die objektive Gültigkeit des Erfahrungsurteils nichts anderes als die notwendige Allgemeingültigkeit desselben.“ (P 298) Es geht also um die Frage, ob wir über die Welt nur so urteilen können, daß wir behaupten, für unsere Wahrnehmung ist es jetzt so, daß Lucy in der Sonne liegt und ihr Fell warm ist, und wir haben das auch schon oft beobachtet, weshalb wir gerne auch weiter davon ausgehen wollen, es werde sich auch in Zukunft so verhalten, daß Lucys Fell warm wird, wenn sie in der Sonne liegt. So recht genau wissen wir das allerdings nicht, und wenn andere das anders sehen, dann soll es uns nicht stören. Mit der Frage nach der Möglichkeit von synthetisch-apriorischen Erkenntnissen und damit nach der Möglichkeit von Metaphysik als vernunftgegründeter Erkenntnis steht auf dem Spiel also die Frage, ob wir unsere subjektive Erkenntnis auch auf ein Objekt beziehen können. Für einen solchen Bezug unserer subjektiven Erkenntnisse auf Objekte gibt Kant zwei eng zusammenhängende Kriterien an: Allgemeingültigkeit und Notwendigkeit: „Es sind daher objektive Gültigkeit und notwendige Allgemeingültigkeit (für jedermann) Wechselbegriffe, und ob wir gleich das Objekt an sich nicht kennen, so ist doch, wenn wir ein Urteil als gemeingültig und mithin notwendig ansehen, eben darunter die objektive Gültigkeit verstanden.“ Noch anders gesagt: „Wir erkennen durch dieses Urteil das Objekt (...) durch die allgemeingültige und notwendige Verknüpfung der gegebenen Wahrnehmungen.“ (P 298) Wollen wir also behaupten, das Urteil ‚wenn Lucy in der Sonne liegt, so wird ihr Fell warm‘, gelte nicht nur unter der Einschränkung ‚soweit wir dies bisher wahrgenommen haben‘, sondern es gelte unbedingt und allgemein, so daß alle erkennenden Subjekte zustimmen müssen, weil es sich nicht auf subjektive Wahrnehmungen, sondern auf einen objektiven Zusammenhang stützt, so müssen wir Begriffe heranziehen, die wir nicht der Erfahrung entnehmen können, sondern die wir nur aufgrund synthetisch-apriorischer Erkenntnis, also aufgrund reiner Vernunft, also aufgrund von Metaphysik als gültig behaupten können. Es ist genau diese Problematik, die Kant in seiner theoretischen Philosophie untersucht, wenn er die Aufgabe in dem einen Satz zusammenfaßt: „Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?“ (B 19) 18 Kants fundamentale Einsicht „Es ist schon ein großer und nötiger Beweis der Klugheit oder Einsicht, zu wissen, was man vernünftigerweise fragen solle. Denn, wenn die Frage an sich ungereimt ist, und unnötige Antworten verlangt, so hat sie, außer der Beschämung dessen, der sie aufwirft, bisweilen noch den Nachteil, den unbehutsamen Anhörer derselben zu ungereimten Antworten zu verleiten!“ [Manchmal hört sich Lucy ein wenig altklug an .... ; aber immerhin schreibt Kant das auch (B 82).] Wir werden die Antwort, die Kant auf diese Frage und damit auf die zuvor erläuterten Probleme gibt, im folgenden genau entwickeln. Hier mag es genügen, die ‚allgemeine Idee‘, der Kant dabei folgt, vorläufig zu skizzieren. Kant hat die einfache Idee, die seiner theoretischen Philosophie zugrundeliegt, so ausgedrückt: „Bisher nahm man an, alle unsere Erkenntnis müsse sich nach den Gegenständen richten; aber alle Versuche über sie a priori etwas durch Begriffe auszumachen, wodurch unsere Erkenntnis erweitert würde, gingen unter dieser Voraussetzung zunichte. Man versuche es daher einmal, ob wir nicht in den Aufgaben der Metaphysik damit besser fortkommen, daß wir annehmen, die Gegenstände müssen sich nach unserem Erkenntnis richten“. (B XVI) Diese ‚einfache Idee‘ bezeichnet das, was unter der Bezeichnung ‚Kopernikanische Wende‘ in der Philosophie bekannt wurde. Im folgenden wird diese Idee aufgefächert unter den Titeln einer ‚Transzendentalen Ästhetik‘ und einer ‚Transzendentalen Logik‘. In beiden Teilen verfolgt Kant das gleiche Prinzip: die transzendentale Ästhetik hat es mit der Anschauung zu tun und das Prinzip lautet hier so: „Wenn die Anschauung sich nach der Beschaffenheit der Gegenstände richten müßte, so sehe ich nicht ein, wie man a priori von ihr etwas wissen könne; richtet sich aber der Gegenstand (als Objekt der Sinne) nach der Beschaffenheit unseres Anschauungsvermögens, so kann ich mir diese Möglichkeit ganz wohl vorstellen.“ Die transzendentale Logik hingegen hat es mit den Begriffen zu tun und das Prinzip lautet hier so: wir müssen für ein Verständnis der Möglichkeit synthetisch-apriorischer Urteile annehmen, „die Gegenstände oder, welches einerlei ist, die Erfahrung, in welcher sie allein (als gegebene Gegenstände) erkannt werden, richte sich nach diesen Begriffen“. (B XVII) Kants fundamentale Einsicht 19 Wir sollten allerdings dabei nicht vergessen, daß die Frage nach der Möglichkeit apriorisch-synthetischer Urteile steht, nicht nach der Möglichkeit aposteriorisch-synthetischer Urteile. Deshalb kann es bei der Behauptung, die ‚Gegenstände‘ müßten sich nach ‚unserem‘ Erkenntnisvermögen richten, nicht um die einzelnen Gegenstände in ihrer empirischen Gestalt gehen, wie wir sie in unserem alltäglichen Leben erfahren. Wir hatten oben gesehen, daß es bei der Frage nach der Möglichkeit reiner Vernunft und Metaphysik gerade um die Möglichkeit einer objektiven und allgemeingültigen Erkenntnis geht. Deshalb sind es auch nicht ‚wir‘ als ‚Menschen‘ im Sinne einer besonderen Spezies von Lebewesen, nach denen sich die Gegenstände ‚richten‘, sondern sie richten sich nach den Strukturbedingungen des erkennenden Bewußtseins, das nicht individuell ist und das nicht mit dem Begriff des ‚Menschen‘ als einer besonderen Spezies identifiziert werden darf. Wir werden auf dieses Problem insbesondere im Zusammenhang mit der Thematik eines ‚Ich der transzendentalen Apperzeption‘ noch ausführlich zu sprechen kommen. Außerdem ‚richten‘ sich die Gegenstände nicht nach ‚uns‘ und auch nicht nach dem erkennenden Bewußtsein, soweit es ihre ‚Materie‘ angeht, sondern nur im Hinblick auf die Formen, in denen sie angeschaut und begriffen werden können. Was in der ‚Kritik der reinen Vernunft‘ gesucht wird, nennt Kant eine transzendentale Erkenntnis: „Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, insofern diese a priori möglich sein soll, überhaupt beschäftigt.“ (B 25) Davon unterscheidet er allerdings den Begriff der ‚Transzendental-Philosophie‘, den er für ein in der Zukunft zu entwickelndes System apriorischer Begriffe reservieren will. In der Kategorienlehre wird sich zeigen, daß Kant ein solches System zumindest den Grundprinzipien nach durchaus auch schon in der ‚Kritik der reinen Vernunft‘ ausarbeitet, die insofern auch als Transzendental-Philosophie bezeichnet werden kann. Wichtig ist aber, daß sich der Ausdruck ‚transzendental‘ auf die Erkenntnis von einer Erkenntnis bezieht und nicht selbst die apriorischen Erkenntnisse betrifft. Man müsse also beachten, „daß nicht eine jede Erkenntnis a priori, sondern nur die, dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen (Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori angewandt werden, oder möglich sind, transzendental (d. i. die Möglichkeit der Erkenntnis oder der Gebrauch derselben [betreffend]) heißen müsse.“ (B 80) Wenn wir also nun mit der ‚Transzendentalen Ästhetik‘ und hier mit der Erörterung des Raumes als einer reinen Anschauung a priori beginnen, so ist das ‚Transzendentale‘ dieser Erörterung (1) in der Erkenntnis zu sehen, daß die Vorstellung des Raumes nicht aus der Erfahrung genommen wird, und (2) in 20 Transzendentale Ästhetik der Einsicht, wie sich diese Vorstellung dennoch auf Erfahrungsgegenstände beziehen kann bzw. muß. 2. Transzendentale Ästhetik 2.1 Das Prinzip der transzendentalen Ästhetik Daß die Gedanken, die wir uns von der Welt und den Sachverhalten in ihr ‚machen‘, nicht nur von der Welt und den Sachverhalten bestimmt sind, ist eine aus dem alltäglichen Leben vertraute Situation. Wir bringen die Erfahrungen unserer eigenen Lebensgeschichte, das, was uns andere Menschen gesagt haben, was zu sagen üblich ist, und darüber hinaus ganz einfach unsere Vorurteile hinzu, wenn wir urteilen, wie es sich in der Welt verhält und was in ihr der Fall ist. Kants grundsätzliche Behauptung in seiner transzendentalen Logik ist allerdings nicht, daß hier nur eine geschichtliche Bedingtheit vorliegt, sondern es geht um einen systematischen Zusammenhang, der uns einen Aufschluß über die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis überhaupt gibt, also darüber, wie wir zu Urteilen gelangen können, die einerseits von uns geformt und bestimmt sind, die aber andererseits doch etwas über die Welt und die Sachverhalte in ihr aussagen können. Nichtsdestoweniger, für den Grundgedanken der transzendentalen Logik können wir einen Anknüpfungspunkt in unserer Lebenswelt finden. Insofern ist es nicht mit allzu großen Schwierigkeiten verbunden, von hier aus den gedanklichen Sprung zu Kants transzendentalem Gedanken über die apriorische Konstitution der objektiv gültigen Urteile über die Welt in der subjektiven Konstitution des urteilenden Bewußtseins zu unternehmen. Eine solche Anknüpfung steht für den Grundgedanken von Kants transzendentaler Ästhetik nicht zur Verfügung. Es erscheint weit weniger natürlich zu sein, von Raum und Zeit als reinen apriorischen Formen der Anschauung zu sprechen und Raum und Zeit deshalb als die ‚subjektiven‘ Formen aufzufassen, in denen uns Anschauungen gegeben sind. Daß ‚wir‘ es sind, die denken, was wir eben denken, und daß unsere Gedanken deshalb auch einiges von dem mitbekommen, das zu ‚uns‘ gehört und nicht zu den Gegenständen oder Sachverhalten, auf die sich unsere Gedanken beziehen, das ist deshalb leichter aufzufassen, weil wir relativ leicht bereit sind, unser Denken als einen aktiven Akt aufzufassen. Zwar soll sich im Denken die Welt darstellen können, wie sie ist, aber das Denken ist doch eine Leistung, und es geschieht nicht einfach, ohne daß ‚jemand‘ denkt. Weit schwieriger erscheint der Gedanke, daß auch das ‚Gegebensein‘ der Gegenstände unserer Erfahrung einen ‚subjektiven‘ Anteil haben soll. Man könnte dagegen sofort einwenden, daß damit ein in sich widersprüchlicher Ge-