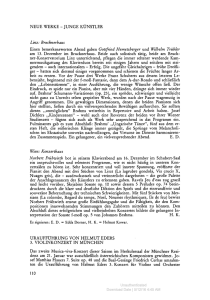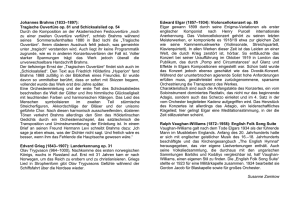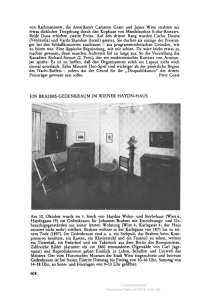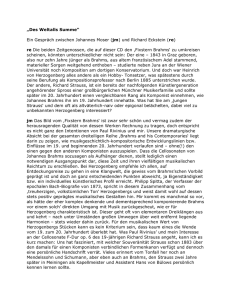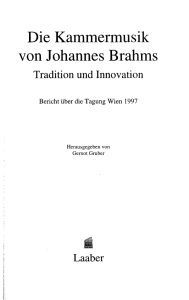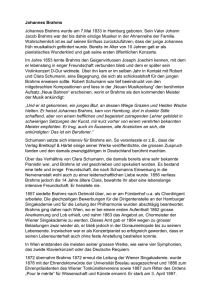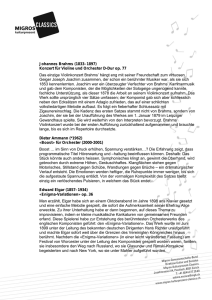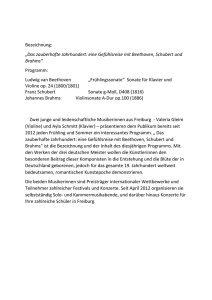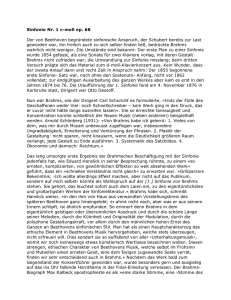Zweite Wiener Klassik
Werbung
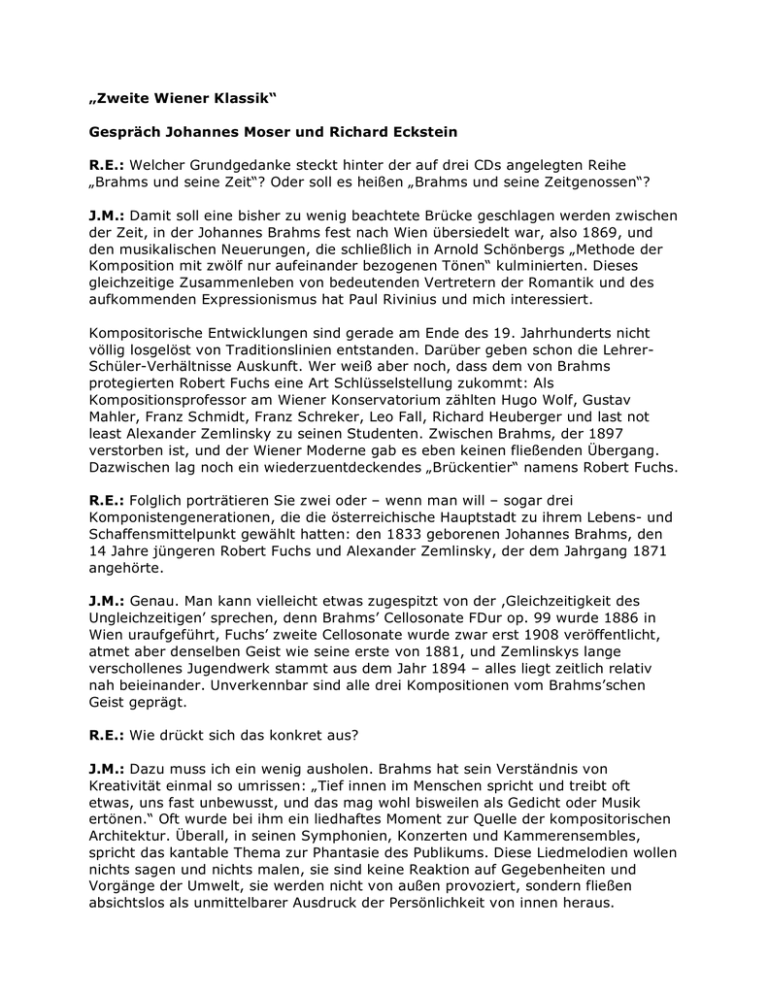
„Zweite Wiener Klassik“ Gespräch Johannes Moser und Richard Eckstein R.E.: Welcher Grundgedanke steckt hinter der auf drei CDs angelegten Reihe „Brahms und seine Zeit“? Oder soll es heißen „Brahms und seine Zeitgenossen“? J.M.: Damit soll eine bisher zu wenig beachtete Brücke geschlagen werden zwischen der Zeit, in der Johannes Brahms fest nach Wien übersiedelt war, also 1869, und den musikalischen Neuerungen, die schließlich in Arnold Schönbergs „Methode der Komposition mit zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen“ kulminierten. Dieses gleichzeitige Zusammenleben von bedeutenden Vertretern der Romantik und des aufkommenden Expressionismus hat Paul Rivinius und mich interessiert. Kompositorische Entwicklungen sind gerade am Ende des 19. Jahrhunderts nicht völlig losgelöst von Traditionslinien entstanden. Darüber geben schon die LehrerSchüler-Verhältnisse Auskunft. Wer weiß aber noch, dass dem von Brahms protegierten Robert Fuchs eine Art Schlüsselstellung zukommt: Als Kompositionsprofessor am Wiener Konservatorium zählten Hugo Wolf, Gustav Mahler, Franz Schmidt, Franz Schreker, Leo Fall, Richard Heuberger und last not least Alexander Zemlinsky zu seinen Studenten. Zwischen Brahms, der 1897 verstorben ist, und der Wiener Moderne gab es eben keinen fließenden Übergang. Dazwischen lag noch ein wiederzuentdeckendes „Brückentier“ namens Robert Fuchs. R.E.: Folglich porträtieren Sie zwei oder – wenn man will – sogar drei Komponistengenerationen, die die österreichische Hauptstadt zu ihrem Lebens- und Schaffensmittelpunkt gewählt hatten: den 1833 geborenen Johannes Brahms, den 14 Jahre jüngeren Robert Fuchs und Alexander Zemlinsky, der dem Jahrgang 1871 angehörte. J.M.: Genau. Man kann vielleicht etwas zugespitzt von der ,Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen’ sprechen, denn Brahms’ Cellosonate FDur op. 99 wurde 1886 in Wien uraufgeführt, Fuchs’ zweite Cellosonate wurde zwar erst 1908 veröffentlicht, atmet aber denselben Geist wie seine erste von 1881, und Zemlinskys lange verschollenes Jugendwerk stammt aus dem Jahr 1894 – alles liegt zeitlich relativ nah beieinander. Unverkennbar sind alle drei Kompositionen vom Brahms’schen Geist geprägt. R.E.: Wie drückt sich das konkret aus? J.M.: Dazu muss ich ein wenig ausholen. Brahms hat sein Verständnis von Kreativität einmal so umrissen: „Tief innen im Menschen spricht und treibt oft etwas, uns fast unbewusst, und das mag wohl bisweilen als Gedicht oder Musik ertönen.“ Oft wurde bei ihm ein liedhaftes Moment zur Quelle der kompositorischen Architektur. Überall, in seinen Symphonien, Konzerten und Kammerensembles, spricht das kantable Thema zur Phantasie des Publikums. Diese Liedmelodien wollen nichts sagen und nichts malen, sie sind keine Reaktion auf Gegebenheiten und Vorgänge der Umwelt, sie werden nicht von außen provoziert, sondern fließen absichtslos als unmittelbarer Ausdruck der Persönlichkeit von innen heraus. Robert Fuchs hat sich ganz an dieser von Brahms vorgezeichneten lyrischen Intensität orientiert. Das hört man besonders dem ersten Satz seiner Cellosonate es-Moll op. 83 an: Der Rhythmus, die Balance zwischen den beiden Instrumenten und die thematische Ausgewogenheit lassen deutlich erkennen, wie stark der Einfluss der ,kompositorischen Instanz’ Brahms gewesen sein muss. Der langsame Satz, Adagio con sentimento, besitzt eine Art Herbststimmung, worauf der virtuose Final-Satz hervorragend passt. Bei einer solchen gleichfalls von Brahms inspirierten Bravour können sich Pianist und Cellist gegenseitig beflügeln. Ein wenig anders sieht es bei Zemlinskys erst 2005 wiederveröffentlichter Cellosonate in a-Moll aus. Durch Sparsamkeit der Thematik, gepaart mit einem Hang zum Theatralischen, gibt sie sich als logische Nachfolgerin der frühen d-MollSymphonie zu erkennen. Hinzu kommt eine offensichtlich auf Verblüffung zielende Destabilisierung der Tonalität sowie – vor allem im heiteren Finale – ein reicher Vorrat an exotischen Skalen und Harmonien. Zemlinsky gelang es hier immer wieder, sich vom Vorbild Brahms zu befreien, indem er quasi ironische Reflexionsebenen einfügte. Nichtsdestoweniger bleibt der musikalische Übervater präsent. R.E.: Gab es auch Kontakte auf der persönlichen Ebene? J.M.: Fuchs hatte in Brahms, den er seit 1875 kannte, einen mächtigen Förderer und Freund gefunden. Dies äußerte sich nicht nur dadurch, dass Brahms das Schaffen von Fuchs ratend und warnend anregte, sondern er stellte auch einen Kontakt zu seinem eigenen Verleger Simrock in Hamburg her, der von da an Fuchs’ Werke herausbrachte. Eine solche Kollegialität würde man sich noch heute wünschen. Das Urteil des wahrlich nicht unkritischen Brahms von 1891 ,Fuchs ist ein famoser Musiker. So fein und so gewandt, so reizvoll erfunden ist alles, man hat immer seine Freude daran!’ ist gewiss mehr als ein willfähriges Freundeslob. Besonders erfolgreich waren übrigens seinerzeit die Serenaden für Orchester von Robert Fuchs, was ihm den Spitznamen ,Serenaden-Fuchs’ eingetragen haben soll. R.E.: Warum war es um Zemlinskys Cellosonate so lange still? Das Werk wurde seit der Wiener Uraufführung am 23. April 1894 mit dem Komponisten am Klavier und dem Widmungsträger, dem Cellisten Friedrich Buxbaum, nie mehr aufgeführt… J. M.: Jedenfalls hat dies nichts mit der künstlerischen Qualität des Stückes zu tun. Selbst wenn der Vergleich jetzt etwas gewagt erscheinen mag, aber Mahlers Symphonien galten auch lange als bloßes Kuriosum. Zu Beginn der 1890er Jahre hatten Zemlinsky und Buxbaum zusammen am Wiener Konservatorium studiert. Gemeinsam hoben sie die Cellosonate aus der Taufe und spielten aus dem Autograph. An eine Drucklegung war wohl nicht zu denken. Buxbaum, dessen Lebensweg von Orchesterstellen in Glasgow und London bis zum Pult des Solocellisten der Wiener Philharmoniker führte, behielt die Noten stets bei sich. Im Juli 1938 wurde er – nach dem Anschluss Österreichs an NS-Deutschland – zwangspensioniert. Mit seiner Familie rettete er sich nach London, wo er das legendäre Rosé-Quartett neu aufleben ließ. Aufgrund seiner Englischkenntnisse konnte er außerdem selbst verfasste Musik-Vorträge halten, die von der BBC ausgestrahlt wurden. Erst 30 Jahre nach Buxbaums tragischem Tod 1948 – er war auf dem Weg zu einer Probe, erlitt einen Herzinfarkt und brach tot auf der Straße zusammen, als er dem Bus hinterherrannte – übergab sein Enkel Martin Buxbaum das Notenmaterial an den Publizisten Fritz Spiegl. Der Alexander Zemlinsky Fonds in Wien erfuhr wiederum erst nach Spiegls Tod vom Standort der Manuskripte. So kam der Stein ins Rollen. Interview: Richard Eckstein