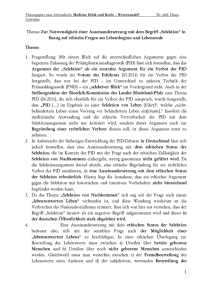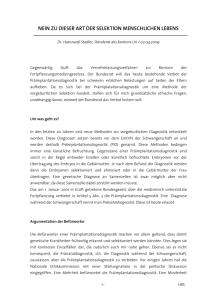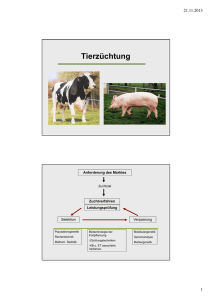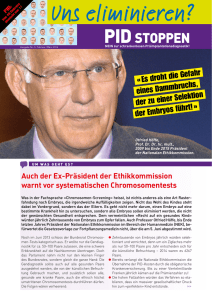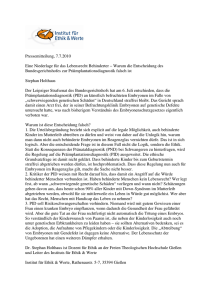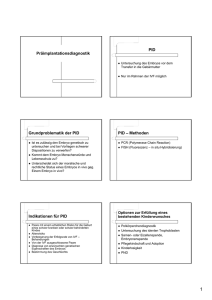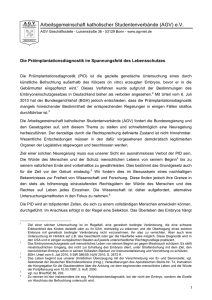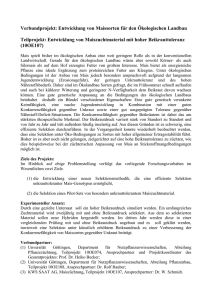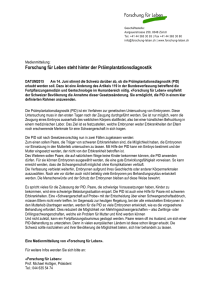Zur Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff
Werbung

Zur Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit dem Begriff „Selektion“ in Bezug auf ethische Fragen am Lebensanfang und Lebensende Diana Aurenque 1. Fragestellung Das „Selektions“-Argument fungiert in Deutschland als eines der gewichtigsten Argumente gegen die Präimplantationsdiagnostik (PID). In dieser Debatte ist es jedoch auffällig, dass die ethische Zulässigkeit bzw. Unzulässigkeit der Selektion von Nachkommen nur begrenzt diskutiert wird. Vielmehr wird in der Regel vorausgesetzt, dass eine solche Selektion ohne Einschränkung schlecht ist und ethisch nicht gerechtfertigt werden kann. Eine differenzierte Auseinandersetzung über den ethischen Status der Selektion wird in Deutschland nur selten geführt 1, da der Begriff „Selektion“ stark belastet ist und aus intuitiven und historischen Vorbehalten abgelehnt wird.2 Zudem wird im Gedanken der Selektion immer ein Verstoß gegen die Menschenwürde gesehen und daher zurückgewiesen. Ein ethisches Argument gegen die Selektion kann aber a) mit historischen und intuitiven Vorbehalten nicht hinreichend begründet werden und b) gibt es konkrete Beispiele, die daran zweifeln lassen, inwiefern das Argument, die Selektion sei immer schlecht, Bestand hat (z.B. das selektive Verfahren bei einer In-Vitro-Fertilisation). Dieses Referat will zur Eröffnung der Debatte zum ethischen Status der Selektion beitragen, da der Zusammenhang zwischen dem Selektionsgedanken und der Vorstellung eines „lebenswerten Lebens“ für ethische Fragen am Lebensanfang und Lebensende relevant ist. Insofern das Ziel ärztlichen Handelns sich einerseits auf den traditionellen Hippokratischen Eid beruft, der die Heilung, Linderung oder Vermeidung von Krankheit und Behinderung zum Ziel hat, andererseits aber auch Zu den wenigen zählen Dieter Birnbacher: „Selektion von Nachkommen. Ethische Aspekte“. In: Jürgen Mittelstraß (Hrsg.): Die Zukunft des Wissens. XVIII. Deutscher Kongreß für Philosophie 1999, Berlin 2000, 457-471. Wiederabgedruckt in: Dieter Birnbacher: Bioethik zwischen Natur undInteresse. Frankfurt am Main 2006, 315-335. 2 Vgl. Birnbacher (2006), S. 315: „Selektion“ erinnert an Programme zu einer wie auch immer gearteten biologischen „Verbesserung“ des Menschen, an Eugenik, „Rassenhygiene“ und Menschenzüchtungsversuche“. Belastet ist der Ausdruck außerdem durch seine besondere Verwendung in deutschen Konzentrationslagern, in denen Opfer einer „Selektion“ zu werden den sofortigen Tod bedeutete.“ 1 1 weitere Prinzipien berücksichtigen muss, wie die Achtung der Patientenautonomie, ist unklar, ob das Absterbenlassen von Embryonen und die Sterbehilfe zum ärztlichen Handeln gehört. Um dies zu erforschen werden v.a. medizinethische Argumente aus dem angelsächsischen Raum einbezogen. 2. Ist die Selektion immer ethisch problematisch? Die Selektion weist auf eine Handlung hin, die voraussetzt, dass man bestimmte Sachverhalte oder Möglichkeiten von anderen unterscheiden und vorziehen kann. Selektion bedarf zunächst immer eines Qualitätskriteriums, an dem sich die Unterscheidung und die Präferenz orientieren können. Zudem bezieht sich das Qualitätskriterium einer selektiven Handlung auf jene Zwecke, die die Handlung innerhalb eines bestimmten Verfahrens verfolgt. Im Alltag führen wir eine Reihe von selektiven Handlungen durch, die keinen ethischen Konflikt mit sich bringen. Betrachtet man das Vorgehen bei einer In-VitroFertilisation (IVF), so findet man ein Beispiel für eine Selektion, die ethisch und gesellschaftlich akzeptiert ist. Für die Befruchtung der Eizelle werden nur diejenigen Spermien verwendet, die die beste Vorwärtsbeweglichkeit aufweisen. Auch in der Phase der mikroskopischen und morphologischen Beurteilung der Oozyten, der Vorkernstadien und der Embryonen in der In-vitro-Kultur geschieht eine Selektion, die den Erfolg der IVF sichern soll. 3 Darüber hinaus ist die Selektion erst in ganz bestimmten Situationen problematisch, etwa in Situationen, wo eine Verletzung der Menschenrechte und Menschenwürde stattfinden kann. 3. Selektion und Lebenswert? Lebensanfang und Lebensende PID ist eine der besonderen Situationen, in denen die selektive Handlung problematisch wird. Werden bei der Beurteilung der genetischen Ausstattung des Embryos auffällige Veränderungen des Erbmaterials gefunden, wird dieser nach Verlangen der Frau bzw. des Paares nicht transferiert, was das Absterben des Embryos zur Folge hat. Die Entscheidung bezüglich des Embryotransfers (ET) hängt also von der genetischen Eigenschaften des Embryos ab. Insofern diese Entscheidung sich auf bestimmten Vorstellungen und Wünsche der Eltern über das künftige Leben B. Koppers, B. Herrmann und S. Mittmann, „Mikroskopische Beurteilung von Oozyten, Vorkernstadien und Embryonen“ (Reproduktionsmedizin Volume 16, Number 4, 290-293. 2 3 ihres Nachkommen bezieht, stellt sich die Frage nach der ethischen Legitimität der PID im engen Zusammenhang mit der Frage nach deren Verständnis von einem „guten Leben“ bzw. vom „Lebenswert“ im Sinne der Lebensqualität einer Existenz. Die Unterscheidung zwischen „besserem“ und „schlechterem“ Leben liegt der Selektion im Rahmen einer PID zugrunde. Aber nicht nur bei der PID kommt die Frage nach dem Gedanken „Lebenswert“ und „Lebensqualität“ zur Geltung. In der Aktualität wird immer deutlicher, dass einige Menschen eine klare Vorstellung davon haben, dass ihr eigenes Leben eventuell nicht mehr lebenswert sein könnte. 4. Differenzierung von Urteilsmodi Die Unterscheidung zwischen „besserem“ und „schlechterem“ Leben ist also in der Debatte zur PID und zur Sterbehilfe wichtig. Es gibt unterschiedliche Urteilsmodi, bei denen eine solche Unterscheidung über die Lebensqualität einer Existenz stattfinden. Wie einige liberale Autoren aus dem angelsächsischen Raum argumentieren, besitzen diese unterschiedlichen Urteilsmöglichkeiten ebenfalls unterschiedliche ethische Zulässigkeit. Hierzu ist die Unterscheidung Julian Savulescus hilfreich. Für Savulescu gibt es Urteile, die a) den Wert einer gesamten Existenz betreffen; die b) den Wert eines einzelnen Elements in einer Existenz bewerten; sowie auch Urteile, c) die prädiktiv das Leben von noch nicht geborenen Menschen bewerten (ex ante-Urteile) und d) die retrospektiv das Leben von geborenen Menschen beurteilen (ex post-Urteile). 4 Während die Beurteilung einer gesamten Existenz als „besser“ oder „schlechter“ ethisch problematisch ist, da sie extrem subjektiv ist, hält Savulescu die Beurteilung von einzelnen Aspekten einer Existenz für weniger problematisch. Ausgehend von dieser Unterscheidung, kann man argumentieren, PID bewerte nicht den Lebenswert oder Lebensqualität einer gesamten Existenz, sondern den Wert von einzelnen Elementen einer Existenz. So wie wir im Alltag ein Verständnis davon haben, inwiefern es uns gut (weil gesund) oder schlecht (weil krank) geht, entsprechend können wir auch intuitiv wissen, ob ein Leben mit oder ohne bestimmten Aspekten schlechter oder besser ist. Zudem ist die Unterscheidung zwischen geborenen (realen) und nicht geborenen (möglichen) Menschen für die ethische Vertretbarkeit solcher lebenswertenden 4 Urteile Vgl. Julian Savulescu, “In defence of Procreative Beneficence”, S.284. 3 entscheidend. Dies hängt auch mit einer weiteren Unterscheidung zusammen, auf die Savulescu allerdings nicht eingeht: e) die Fremdbeurteilung der Lebensqualität und f) die autonome Beurteilung über das eigene Leben und dessen Qualität. Beide haben nicht dieselbe ethische Legitimation. Im Hinblick auf das ethische Prinzip der Autonomie ist die autonome Beurteilung über den Wert des eigenen Lebens weniger problematisch, als die Fremdbeurteilung einer gesamten Existenz oder auch einigen Aspekten einer Existenz als „besser“ oder „schlechter“. Da eine autonome Entscheidung sich auf bestimmte kognitive Fähigkeiten (etwa rationales Denken und Selbstbewusstsein) 5 bezieht, die für die kompetente Entscheidungsfindung6 relevant sind, lassen sich Embryonen, wie auch Kleinkinder oder komatöse Patienten, nicht als autonome Subjekte ansehen. Während also Urteile über den Lebenswert der eigenen Existenz eine ethische Rechtfertigung für die Sterbehilfe durch das Prinzip Achtung vor der Autonomie erhalten können, scheint die Durchführung einer PID bezüglich des möglichen Kindes gerade dieses Prinzip zu verletzen. Dies bestätigt, dass unterschiedliche Urteile über den Lebenswert je nach Kontext ethisch legitimiert werden kann. Paare, die sich nach einer PID für die gesunden und gegen die erblich belasteten Embryonen entscheiden, machen eine Fremdbeurteilung über die Lebensqualität von nicht geborenen Menschen (ihr mögliches gesundes und ihr mögliches erbkrankes Kind). Geht man davon aus, dass die Fremdbeurteilung über den Lebenswert immer schlecht ist, können die Eltern sich nicht rechtfertigen. Bezieht man deren Bewertung auf den entsprechenden Kontext, dann gibt es wenigstens zwei mögliche ethische Rechtfertigung für eine solche Fremdurteilung: a) die reproduktive Freiheit / die elterliche Autonomie. Befürworter der PID in Deutschland legitimieren diese mit dem Argument, dem Kind könne dadurch großes Leiden im Leben erspart werden („Procreative Non-Maleficence“). Die Autonomie der Eltern wird respektiert, da sie in der Regel das Beste für ihre Kinder wollen und Vgl. Singer, Writings on an ethical life, 2000, S. 137: “By ‘autonomy’ is meant the capacity to choose, to make and act on one´s own decisions. Rational and self-conscious beings presumably have this ability, whereas beings who cannot consider the alternatives open to them are not capable of choosing in the required sense and hence cannot be autonomous.” 6 Tom Beauchamp / James Childress, Principles of Biomedical ethics, Oxford Univ. Press, 6. Aufl. 2009, S. 111. 4 5 sich dafür einsetzen, was gesellschaftlich akzeptiert und sogar ethisch geboten ist. Eine weitere Legitimation der elterlichen Autonomie, die nicht die Minimierung von Schaden, sondern die Maximierung des Wohlseins des Kindes sucht, ist Savulescus Prinzip „Procreative Beneficence“. Werdende Eltern sollen ein „besseres“ Kind nicht im Vergleich zu anderen existierenden Kinder auswählen, sondern dasjenige Kind, das von ihren möglichen Kindern am meisten begabt ist 7. Bei PID gehe es damit nicht darum, dass Eltern gesunde Kinder zur Welt bringen sollen, sondern Kinder, mit den besten Chancen eines besseren Lebens. b) Eine weitere Legitimation der elterlichen Fremdbeurteilung wäre es, zu argumentieren, die Selektion von Nachkommen im Hinblick auf die Unterscheidung von „besserem“ und „schlechterem“ Leben kann auch aus der Perspektive des Embryos legitim sein kann. Diese Überlegung setzt aber voraus, dass der Tod nicht immer ein Übel ist. 5. Der Tod als ein Übel? Eine Auseinandersetzung mit dem Thema „Lebenswert“ bezieht sich auf die Frage, ob der Tod stets als ein Übel anzusehen ist. In der angelsächsischen Debatte ist analysiert worden, inwiefern der Tod für den, der stirbt, derart interpretiert werden kann.8 Hierzu erinnert man sich an die Epikureische Überlegung, der Tod sei einzig als der Tod eines Anderen erfahrbar und daher etwas, zu dem wir selbst keinen Zugang haben. Anders als Schmerzen oder Leiden können wir den Tod als ein Übel nicht selbst erfahren, da wenn dieser auftritt, wir selbst erlöschen. Ob der Tod ein Übel ist, hängt von den jeweiligen moralischen Überzeugungen bzw. Theorien ab. Folgt man zum Beispiel einem utilitaristischen Modell, nach dem die Aufgabe der Ethik in der Minimierung von Leiden im Leben besteht, ist der Tod einer von großem Leiden überfallenen (möglichen oder realen) Existenz ein kleineres Übel im Vergleich mit dem Übel, das eine solche Existenz bedeuten kann. Folgt man dagegen einem verantwortungsethischen Ansatz (Hans Jonas), nach dem das Übel Savulescu/Kahane, “The moral obligation to create children with the best Chance of the best life”, S. 275. 8 Siehe: F. M. Kamm, Morality, Mortality: Volume I: Death and Whom to Save from It: 1, Oxford 7 University Press, 1998. 5 einer Existenz durch die fürsorgliche Hingabe eines Drittens abgemildert werden kann, ist der Tod als Übel anzusehen. a) Tod und PID Wird der Tod als ein absolutes Übel verstanden, sind sowohl das Absterben eines Embryos nach auffälligem Befund mittels PID sowie auch die Sterbehilfe ethisch unzulässig. Versteht man dagegen den Tod als ein relatives Übel, das nur im Vergleich mit der Erfahrbarkeit vom Guten im Leben bzw. der realen Existenz stets voraussetzt, lässt sich zwischen dem Absterben eines möglichen Menschen (dem Embryo) und dem Tod eines geborenen Menschen unterscheiden. In diesem Sinne argumentieren einige Autoren, der Embryo könne durch die Nicht-Existenz keinen „schlechten“ Zustand erfahren, da es keinen „besseren“ kennt, während bei geborenen Menschen ihr Tod als ein schlechter Zustand verstanden werden muss, da sie durch den Tod permanent kein weiteres Gutes im Leben erleben können. Gegen diese Differenzierung argumentieren andere (etwa Rebecca Bennet), dass nicht nur geborene, sondern auch ungeborene Menschen ein Interesse daran haben, das Gute im Leben zu erfahren. So sei es im Interesse des Embryos in die Existenz zu gelangen und damit sein Absterben ein Übel. John Harris argumentiert dagegen, dass es kein Unterschied gibt zwischen dem tun und dem zulassen eines Übel, sodass Eltern, die sich nach einer PID dafür entscheiden, die erblich belasteten Embryonen einzupflanzen, die Krankheit und die daraus entstehenden Schäden „geschaffen“ haben und dafür verantwortlich sind.9 Das Leiden einer (auch kommenden) Existenz zu minimieren, und deren Wohlbefinden zu maximieren, sei das Einzige, das einen Vorteil für den Betroffenen hat.10 b) Tod und Sterbehilfe Nur wenn der Tod als ein relatives und vergleichbares Übel verstanden wird, kann die Sterbehilfe legitimiert werden. Dies impliziert jedoch, der lebenswertende Vergleich sei legitim. Während dieser Vergleich zwischen geborenen Menschen John Harris, “One principle and three fallacies of disability studies”, J Med Ethics 2001;27:383-387, S. 385: „she will have created that illness and any harm that it will do.“ 10 Vgl. Harris (2001) S. 387: we always have a moral reason to prevent harm to others and where this is impossible, we have a moral reason to minimize the harm that we do.“ 6 9 problematisch ist, da er diskriminierende und stigmatisierende Wirkungen für die Betroffenen haben kann, ist der Vergleich zwischen möglichen Menschen (bzw. Embryonen) oder mit der eignen Existenz (bzw. der Vergleich zwischen dem vergangenen und dem aktuellen Leben) weniger problematisch. Menschen, die sich Sterbehilfe autonom wünschen, argumentieren oft, für sie sei das Leben kein erfülltes, lebenswertes Leben mehr. Oft knüpft sich diese Beurteilung an das Verständnis des eigenen Lebens und evtl. auch des eigenen Leidens als ein „sinnloses“. Aus der subjektiven Sinngebung des eigenen Leben und Leiden gewinnen Existenzen, in ihrer Gesamtheit, an subjektivem Lebenswert und Lebensqualität, der einzig als Selbstbeurteilung legitim sein kann. (Der Fall von JeanDominique Bauby, der trotz seinem Locked-in-Syndrom ein sinnerfülltes Leben lebt vs. dem Falls von Ramón Sampedro, der jahrelang vom Hals abwärts vollständig gelähmt war, und Sterbehilfe suchte.) Die Legitimierung der Sterbehilfe setzt nicht nur voraus, dass das Verständnis des Todes als ein Übel in Frage gestellt wird, sondern auch die Auffassung eines „natürlichen Todes“ als ein guter Tod. Da der Tod der Anderen sich in vielfältiger, ja oft katastrophaler Weise zeigt (Unfalltod, Krankheit, Mord, etc.), liegt im Begriff eines „natürlichen Todes“ eine friedliche, gewaltlose und leidensfreie Vorstellung des Todes (gleich dem Schlafen) zugrunde. Heute ist jedoch die Romantisierung eines „natürlichen Todes“ fragwürdiger denn je zuvor. In industrialisierten Gesellschaften verlangsamt sich das Sterben; die Bevölkerung veraltet schnell; so leben Menschen heute im Durchschnitt viel länger als noch vor einigen Jahrzehnten. In der Altersmedizin ist es jedoch umstritten, ob Altern ein natürlicher Prozess oder eher eine Krankheit ist. In der Natur veralten Tiere nicht, sondern sie sterben früher (werden gefressen, getötet oder verhungern). Die Verlängerung des Lebens ist ein gesellschaftliches Phänomen, das nun neue Herausforderung an die Medizin stellt: etwa Demenz oder Alzheimer sind typische Krankheiten unserer veraltenden Gesellschaft. Angesichts dieser Situation ist das Bild eines natürlichen Todes schwächer geworden, wobei die Angst vor einem langsamen Sterben und einem sinnlosen und unerfüllten Leben entsprechend wächst. Selbst wenn die Tötung eines Menschen als schlecht anzusehen ist, wie Befürworter des Rechts auf Selbsttötung 7 und der Sterbehilfe argumentieren, gibt es Fälle in denen die Mithilfe zum Töten moralisch gerechtfertigt werden kann. Für Ärzte bedeutet dies, den Hippokratischen Eid in Frage zu stellen und auf die Autonomie des Patienten vorrangig zu achten. Insofern die autonome Beurteilung des eigenen Lebens zudem nicht im Vergleich zu einer anderen fremden Existenz, sondern im Vergleich mit dem eigenen Leben stattfinden, ist diese Beurteilung frei vom externen, gesellschaftlichen Druck und Vorurteilen. 6. Abschluss In diesem Beitrag wurde gezeigt, dass das Argument, die Selektion sei immer schlecht, nicht hält. Eine Auseinandersetzung mit der ethischen Zulässigkeit der Selektion von Nachkommen fordert daher zwischen zulässiger und unzulässiger Selektion zu unterscheiden. Eine Enttabuisierung sowohl des Begriffes „Selektion“ sowie auch des Begriffes „Lebenswert“ ist für diese Auseinandersetzung erforderlich. Der Gedanke „Lebenswert“ spielt für ethische Fragen am Lebensanfang und Lebensende eine entscheidende Rolle. Man muss die Debatte jedoch genauer differenzieren. Es gibt nicht so etwas, wie Lebenswert „an sich“; der Begriff ist kein Paradigma und kein Kriterium, sondern extrem subjektiv. Die Urteilsmodi über den Lebenswert einer Existenz sind keineswegs gleich zu bewerten, sondern je nach konkreter Situation lässt sich eine entsprechende ethische Legitimität bzw. Ablehnung finden. Die Bedeutung für die medizinische Praxis, die die Vorstellung eines guten, lebenswerten Lebens haben, hängt wesentlich davon ab, inwieweit Ärzte ihren Beruf zwischen der Achtung der Autonomie von Patienten und dem Hippokratischen Eid verstehen. 8