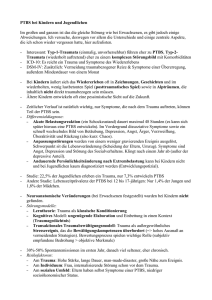PTBS in Asylverfahren: Rechtliche & psychiatrische Aspekte
Werbung

VBI 2/2004 Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg Zeitschrift für öffentliches Recht und öffentliche Verwaltung ABHANDLUNGEN Die posttraumatische Belastungsstörung im Rahmen von Asylverfahren Prof. Dr. Dieter Ebert und Prof. Dr. Hildburg Kindt*, Freiburg I. Juristischer Hintergrund der Fragen posttraumatischen Belastungsstörung zur Der Vortrag eines Klägers, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden, spielt in der verwaltungsgerichtlichen Praxis mittlerweile eine große Rolle. Dabei zielt der Vortrag im Wesentlichen rechtlich in zwei unterschiedliche Richtungen. Zum einen soll im Rahmen eines Asylverfahrens der Vortrag zu einer im Herkunftsland erlittenen politischen Verfolgung gestützt werden; zum anderen soll zur Verhinderung der Abschiebung die Gefahr begründet werden, dass der Kläger im Fall einer zwangsweisen Rückführung durch die deutschen Behörden einen erheblichen psychischen Gesundheitsschaden erleidet oder dass er im Rahmen eines Verlustes von "Steuerungsfähigkeit" Suizid begehen wird. Vor diesem Hintergrund entstehen für den Verwaltungsrichter folgende Probleme und Fragen an einen Sachverständigen, die als gliedernde Richtschnur für den vorliegenden Beitrag dienen. Die richterlichen Fragen sind jeweils im Schriftbild durch Kursivdruck abgesetzt von den Antworten der Sachverständigen. II. Fragen an den psychiatrischen Sachverständigen 1 . Was ist eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) In einer Vielzahl von Fällen werden dem Gericht fachärztliche Atteste vorgelegt, in denen eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) diagnostiziert wird. Was ist eine solche PTBS und nach welchen international anerkannten Standards wird die Diagnose erstellt? Die PTBS ist eine der möglichen, psychopathologisch definierten psychischen Folgen eines Traumas. Bereits diese erste Annäherung impliziert, dass nicht jede psychische Folge eines Traumas eine PTBS ist und dass eine PTBS neben dem ursächlichen Trauma bestimmte psychopathologische Kriterien erfüllen muss, um die Diagnose zu ermöglichen. Indirekt zeigt der verwendete Ausdruck "definiert" aber auch, dass die Diagnose einer PTBS von verschiedenen Klinikern und Gutachtern unterschiedlich gebraucht oder eben definiert werden kann, somit im Laufe ihrer Geschichte begriffliche Ausweitungen und Einengungen erfahren hat. Um dieser damit Möglichen, von Interessen geleiteten begrifflichen und diagnostischen Willkür vorzubeugen, sollte deswegen in Gutachten eine PTBS ausschließlich nach den derzeit international üblichen und akzeptierten Diagnosesystemen festgestellt werden, der Internationalen Klassifikation psychischer Störungen der WHO ICD - 10 einerseits (dort wird das Syndrom als Posttraumatische Belastungsstörung PTBS bezeichnet) oder dem diagnostischen und statistischen Manual der amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft DSM IV andererseits (dort wird das Syndrom als Posttraumatic Stress Disorder PTSD bezeichnet). Das heißt nicht, dass diese Diagnosemanuale nicht auch kritisiert werden oder ein unvollständiges Abbild der Realität darstellen könnten, eine Verständigung auf diese Konventionen ermöglicht aber erst eine Kommunikation unter den am Behandlungs- oder Gutachtensprozess Beteiligten. Die Tabellen 1 und 2 zeigen die Diagnosekriterien der jeweiligen Systeme. Tab. 1: Diagnostische Kriterien der Belastungsstörung nach ICD-10 posttraumatischen Diagnostische Leitlinien Diese Störung soll nur dann diagnostiziert werden, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach einem traumatisierenden Ereignis von außergewöhnlicher Schwere aufgetreten ist. Eine "wahrscheinliche" Diagnose kann auch dann gestellt werden, wenn der Abstand zwischen dem Ereignis und dem Beginn der Störung mehr als sechs Monate beträgt, vorausgesetzt, die klinischen Merkmale sind typisch und es kann keine andere Diagnose (wie Angst- oder Zwangsstörung oder depressive Episode) gestellt werden. Zusätzlich zu dem Trauma muss eine wiederholte unausweichliche Erinnerung oder Wiederinszenierung des Ereignisses in Gedächtnis, Tagträumen oder Träumen auftreten: Ein deutlicher emotionaler Rückzug, Gefühlsabstumpfung, Vermeidung von Reizen, die eine Wiedererinnerung an das Trauma hervorrufen könnten, sind häufig zu beobachten, aber für die Diagnose nicht wesentlich. Die vegetativen Störungen, die Beeinträchtigung der Stimmung und das abnorme Verhalten tragen sämtlich zur Diagnose bei, sind aber nicht von erstrangiger Bedeutung. Späte, chronifizierte Folgen von extremer Belastung, d. h. solche, die noch Jahrzehnte nach der belastenden Erfahrung bestehen, sind unter F 62.0 (andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung) zu klassifizieren. Diagnostische Kriterien der posttraumatischen Belastungsstörung nach ICD-10 in der Version der Forschungskriterien A. Die Betroffenen sind einem kurz oder lang anhaltenden Ereignis oder Geschehen von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß ausgesetzt, das nahezu bei jedem tief greifende Verzweiflung auslösen würde. B. Anhaltende Erinnerungen oder Wiedererleben der Belastung durch aufdringliche Nachhallerinnerungen (Flashbacks), lebendige Erin * Die Autoren sind in der Abteilung Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Freiburg tätig; Frau Prof Dr. Kindt ist Leiterin der dortigen Sektion Forensische Psychiatrie und Psychotherapie. nerungen, sich wiederholende Träume oder durch innere Bedrängnis in Situationen, die der Belastung ähneln oder mit ihr in Zusammenhang stehen. C. Umstände, die der Belastung ähneln oder mit ihr im Zusammenhang stehen, werden tatsächlich oder möglichst vermieden. Dieses Verhalten bestand nicht vor dem belastenden Erlebnis. D. Entweder 1. oder 2. 1. teilweise oder vollständige Unfähigkeit, einige wichtige Aspekte der Belastung zu erinnern. 2. anhaltende Symptome einer erhöhten psychischen Sensitivität und Erregung (nicht vorhanden vor der Belastung) mit zwei der folgenden Merkmale: a) Ein- und Durchschlafstörungen b) Reizbarkeit oder Wutausbrüche c) Konzentrationsschwierigkeiten d) Hypervigilanz e) erhöhte Schreckhaftigkeit. E. Die Kriterien B, C und D treten innerhalb von sechs Monaten nach dem Belastungsereignis oder nach Ende einer Belastungsperiode auf (in einigen speziellen Fällen kann ein späterer Beginn berücksichtigt werden, dies sollte aber gesondert angegeben werden). Tab. 2: Diagnostische Kriterien Störung nach DSM-IV der posttraumatischen Stress- A. Die Person hat ein Ereignis erlebt, das die folgenden beiden Komponenten enthält: 1. Die Person erlebte, war Zeuge oder wurde mit einem oder mehreren Ereignis(sen) konfrontiert, das/die lebensbedrohlich war(en) oder schwere Verletzung oder Bedrohung der physischen Integrität der eigenen Person oder anderer beinhaltete(n) 2. Die Reaktion der Person zeichnete sich durch Angst, Hilflosigkeit und Schrecken aus B. Das traumatische Ereignis wird ständig auf mindestem eine der folgenden Arten wiedererlebt: 1. wiederholte und sich aufdrängende Erinnerungen an das Ereignis (auch Bilder, Gedanken oder Wahrnehmungen) 2. wiederholte, stark belastende Träume 3. plötzliches Handeln oder Fühlen, als ob das traumatische Ereignis wiedergekehrt wäre (dazu gehören das Gefühl, das Ereignis wieder zu durchleben, Vorstellungen, Halluzinationen und dissoziative Episoden (Flashbacks), auch im Wachzustand oder bei Intoxikationen) 4. intensives psychisches Leid bei der Konfrontation mit Situationen, die das traumatische Ereignis symbolisieren oder ihm in irgendeiner Weise ähnlich sind 5. physiologische Reaktivität bei der Konfrontation mit internalen oder externalen Reizen, die das traumatische Ereignis symbolisieren oder ihm in irgendeiner Weise ähnlich sind C. Anhaltende Vermeidung von Stimuli, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, oder eine Einschränkung der allgemeinen Reagibilität (war vor dem Trauma nicht vorhanden), was sich in mindestens drei der folgenden Merkmale ausdrückt: 1. Versuche, Gedanken, Gefühle oder Gespräche, die mit dem Trauma in Verbindung stehen, zu vermeiden 2. Versuche, Aktivitäten, Situationen oder Menschen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen, zu vermeiden 3. Unfähigkeit, sich an einen wichtigen Bestandteil des Traumas zu erinnern 4. auffallend vermindertes Interesse an bedeutenden Aktivitäten 5. Gefühl der Isolierung bzw. Entfremdung von anderen 6. eingeschränkter Affekt (z. B. keine zärtlichen Gefühle mehr zu empfinden) 7. Gefühl, keine Zukunft zu haben (z. B. nicht zu erwarten, Karriere zu machen, zu heiraten, Kinder zu haben oder eine normale Lebenserwartung zu haben) D. Anhaltende Symptome eines erhöhten Erregungsniveaus (waren vor dem Trauma nicht vorhanden), durch mindestens zwei der folgenden Merkmale gekennzeichnet: 1. Ein- und Durchschlafstörungen 2. Reizbarkeit oder Wutausbrüche 3. Konzentrationsschwierigkeiten 4. Hypervigilanz 5. übertriebene Schreckreaktion E. Die Dauer der Störung (Symptome aus B, C und D) beträgt mindestens einen Monat F. Die Störung führt zu einer klinisch bedeutsamen Belastung oder Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit im sozialen, beruflichen oder einem anderen Bereich akut: Dauer der Symptomatik kürzer als drei Monate chronisch: Dauer der Symptomatik drei Monate oder länger verzögerter Beginn: Beginn der Symptomatik mindestens sechs Monate nach dem Trauma Auf drei für die medizinische Begutachtung besonders relevante Aspekte der Diagnosekriterien soll ausdrücklich hingewiesen werden: a) Psychopathologisch wesentlich für die Diagnose einer PTBS sind die ungewollten, intrusiv-angstvoll erlebten Wiedererinnerungen an ein Trauma (und das Vermeiden von Situationen, die solche Erinnerungen auslösen). Die in Asylverfahren von Patienten oft geäußerte Furcht (aktuell oder bei Rückkehr ins Heimatland), verfolgt zu werden, und sich aufdrängende Vorstellungen, wie eine solche (erneute) Verfolgung aussehen könnte, definieren für sich genommen keine PTBS. Es handelt sich entweder um eine normalpsychologisch begründete, nicht krankhafte Realangst, wenn die Person tatsächlich eine Verfolgung befürchten muss, oder um eine Phobie, wenn die Befürchtungen irrational und nicht nachvollziehbar erscheinen. In einem Gutachten müssen deswegen die Inhalte der Angst und der Vorstellungen präzisiert sein, die zur Diagnose einer PTBS geführt haben. b) Die beiden genannten Diagnosesysteme unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten (nur im DSM-IV sind z. B. eine akute Belastungsreaktion direkt nach dem Trauma und Beeinträchtigungen im täglichen Leben als Diagnosekriterien notwendig; nur dort ist ein später Beginn der Symptomatik nach sechs Monaten möglich, wie er nach ICD-10 nur in Ausnahmen erlaubt ist; Erinnerungslücken sind in den beiden Diagnosesystemen unterschiedlich erlaubt bzw. gefordert). Dies zeigt einerseits, dass die PTBS keineswegs ein feststehendes Krankheitsbild ist, wie manche Krankheiten der somatischen Medizin (z. B. ein Herzinfarkt oder Karzinom), sondern sie ist auch Ausdruck von Konvention, Expertenkonsens; Grenzen und Definitionen sind unscharf und fließend. Zum Zweiten muss aber gerade deswegen, und um willkürlichen Interpretationen nicht Vorschub zu leisten, von jedem Gutachter gefordert werden, dass er angibt, nach weichem System und welchen Kriterien er eine PTBS diagnostiziert. Er muss sich dann auch an die vorgegebenen Kriterien halten und darf nicht beliebige Elemente zusammenfügen (wenn jemand nach DSM-IV einen späten Beginn nach sechs Monaten diagnostiziert, darin muss er auch die akute Belastungsreaktion nach dem Trauma und die Beeinträchtigungen des täglichen Lebens durch die PTBSSymptome nachweisen). c) Am wichtigsten für die Begutachtungspraxis ist zweifelsohne das Kriterium A. Für die Diagnose muss ein Trauma nachgewiesen sein, d. h. keine PTBS ohne Trauma. Anders ausgedrückt heißt dies, dass auch beim Vorliegen aller Symptome einer PTBS eine solche nur diagnostiziert werden kann, wenn auch ein entsprechendes Trauma vorhanden war bzw. nachgewiesen ist. Aus den Symptomen kann nicht rückgeschlossen werden, dass ein Trauma stattgefunden hat. Dies wäre nur möglich, wenn eine eindeutige Beziehung zwischen pathognomonischer Symptomatik der PTBS und Trauma bestehen würde, d.h. ent sprechende Symptomschilderungen nur gegeben werden können, wenn ein Trauma tatsächlich stattgefunden hat. Eine solche eindeutige Beziehung besteht aber nicht, da z. g. die Symptome der PTBS auch ohne stattgehabtes Trauma geäußert werden können oder im Rahmen einer anderen Erkrankung, z. B. einer Schizophrenie oder schweren depressiven Episode, als Symptom, z. B. als Wahnerinnerung, auftreten können. In der Sprache der Logik ausgedrückt kann bei einer einfachen Wenndann-Beziehung nicht aus dem Nachweis einer Folge (in diesem Falle der PTBS-Symptomatik) auf die Existenz der Ursache (in diesem Falle des Traumas) geschlossen werden; hierzu wäre eine Wenn-dann-und-nur-dann-Beziehung notwendig. Für den Gutachter bedeutet dies, dass er nur eine PTBS diagnostizieren kann, wenn auch ein Trauma nachgewiesen ist, also das A-Kriterium erfüllt ist. Da gerade dies in Asylverfahren oft strittig ist, muss in jedem Gutachten die Einschränkung ersichtlich sein, dass die Diagnose einer PTBS nur gilt, wenn vom Gericht (nicht vom Gutachter) nachgewiesen werden kann bzw. wahrscheinlich gemacht werden kann, dass das behauptete Trauma stattgefunden hat. Ein Trauma kann nicht dadurch bewiesen werden, dass die Symptomatik einer PTBS dem Gutachter glaubhaft dargestellt wird. Der Gutachter kann allerdings durchaus Angaben dazu machen, ob die Symptomatik typisch für eine PTBS wäre - im Falle eines Traumas, ob sie als typisch geschildert wird, einen typischen Verlauf nimmt o. Ä. Das Gericht kann dann diese Angaben zu seiner Beweiswürdigung heranziehen. Diesbezüglich wird auch ausdrücklich auf die Ausführungen von Leonhardt und Foerster (2003) verwiesen: "Der objektive Ereignisaspekt ist dagegen nicht Gegenstand der gutachtlichen Untersuchung. Mit psychiatrisch-psychotherapeutischen Mitteln kann nicht sicher erschlossen werden, ob tatsächlich in der Vorgeschichte ein Ereignis vorlag und wie dieses geartet war," und "Eine diagnostische Untersuchung im Hinblick darauf, ob eine posttraumatische Belastungsstörung vorliegt, ist etwas völlig anderes als die Glaubhaftigkeitsbegutachtung von Probanden... Eine Vermengung der Erkenntnisziele (Glaubhaftigkeit versus Vorliegen einer Störung) führt zu unsicheren, spekulativen Ergebnissen." 2. Schilderung des traumatisierenden Ereignisses In laufenden Asylverfahren wird eine posttraumatische Belastungsstörung häufig erst spät behauptet, z. T erst nach Beendigung eitles oder mehrerer erfolgloser Asylverfahren. Dabei besteht meist die Besonderheit, dass in den Protokollen über die vorherigen Anhörungen des Asylbewerbers vor dem Bundesamt und/oder vor dem Verwaltungsgericht keine oder nur unsubstanziiert pauschale Hinweise auf ein nunmehr als relevant angegebenes traumatisierendes Ereignis auftauchen. Üblicherweise ist oder war auch der übrige Vortrag des Asylbewerbers nach allgemeinen Kriterien (Detailreichtum, Individualität, Verflechtung mit objektiven Umständen, Konstanz, Strukturgleichheit) unglaubhaft. Welche Fragen müsste ein tatsächlich durch Folter oder ähnliche menschenrechtswidrige Behandlung traumatisierter Flüchtling bei einer sensiblen Befragung regelmäßig noch beantworten können oder beantwortet haben: Raum/Ort/Zeit der Haft Details der Haftzeit bzw. der eigentlichen Folter - Weitere Angaben zur Vor- und Nachgeschichte? Inwieweit können Verweigerungen, Steigerungen und/oder Widersprüche in Bezug auf die Schilderung der Folter und ihre näheren Umstände im Verlauf eines oder mehrerer Asylverfahren durch vorherige Traumatisierung erklärt werden? Inwieweit gilt dies auch in Hinblick auf Widerspräche und unsubstanziierten Vortrag zu vorhergehenden und nachfolgenden Geschehensabläufen, die mit der Folter in keinem unmittelbaren Zusammenhang stehen (Umstände der Verhaftung und Freilassung, Rückkehr in geschätzten häuslichen Bereich; ärztliche Behandlung, Verhalten gegenüber Familie und Freunden etc.)? Die Gründe für fehlende Erinnerung, falsche Erinnerung oder bewusst falsche Angaben sind vielfältig und in der Regel bereits normalpsychologisch erklärbar, ohne dass es dazu der Existenz einer psychischen Störung bedarf. Theoretisch ist eine PTBS ursächlich denkbar im Sinne von "möglichem Zusammenhang". Aus einer PTBS leitet sich aber nicht ab, dass die oben genannten Fragen prinzipiell nicht beantwortet werden können, d. h., es handelt sich nicht um ein krankheitsimmanentes Unvermögen, wie es bei Gedächtnisstörungen im Rahmen cerebral-organischer Schäden, z. B. Demenz, der Fall wäre. Wenn zusätzlich die Erfahrungen mit PTBS-Patienten außerhalb von Asylverfahren berücksichtigt werden, die z. B. Opfer von Verkehrsunfällen, Verbrechen, Konzentrationslagerhaft wurden, bei denen die Art des Traumas detailliert dokumentiert ist, kann bei einer PTBS ein Nebeneinander bestehen von übergenauen Erinnerungen (die sich ja definitionsgemäß ständig aufdrängen) und unscharfen oder fehlenden Erinnerungen in der zeitlichen Umgebung dieses emotional besonders belastenden Ereignisses (siehe auch ICD10 Kriterium D). Diese Erkenntnis entspricht der Wirkung und den Einflüssen von Emotionen auf das Lernen und Erinnern, wie dies auch bei Gesunden nachzuweisen ist. Ein solches Erinnerungsmuster kann durch eine PTBS erklärt werden, ist aber nicht notwendig für die Diagnose, ist kein Indiz für eine PTBS, das heißt die PTBS ist nur eine Erklärungsmöglichkeit neben anderen (z. B. könnte ein solcher Vortrag auch erfunden sein). Erinnerungslücken bezüglich nicht mit dem Trauma zusammenhängender Geschehnisse sind nicht regelhaft mit einer PTBS verknüpft. Auch wenn Zusammenhänge konstruiert werden können, sind alternative Erklärungen primär wahrscheinlicher. Auch Steigerungen und Widersprüche im Verlauf sind für die meisten PTBS-Patienten nicht typisch, da sie ihre PTBSSymptome, d. h. die Erinnerungen, ständig und relativ konstant vor sich haben. Theoretisch können irn Rahmen einer Therapie oder bei forcierten Versuchen, sich an Details des Traumas zu erinnern, auch neue Wiedererinnerungen auftreten. Für den Gutachter gibt es aber keine sichere Methode zu entscheiden, ob diese Ereignisse tatsächlich waren oder induziert wurden bzw. falsch erinnert werden. Dieses Phänomen wird außerhalb von Asylverfahren in der experimentellen Psychologie zur Erforschung von Gedächtnisleistungen (vgl. hierzu Steller und Volbert 1997) z. B. als "false memory syndrom" kontrovers diskutiert. 3. Darlegung und Feststellung der Traumatisierung Die posttraumatische Belastungsstörung wird häufig nur sehr allgemein behauptet, und allenfalls durch ein einfaches psychiatrisch-fachärztliches Attest bzw. eine psychotherapeutische Stellungnahme belegt. Gibt es Indizien für eine tatsächliche Traumatisierung, die für das Gericht in der mündlichen Verhandlung und/oder durch Analyse der Protokolle früherer Anhörungen erkennbar sind? Welche Bedeutung können in der Befragungssituation verwaltungsprozessual typische Rahmenbedingungen wie Zeitdauer der Verhandlung (nur wenige Stunden) und die Rolle des Gerichts und der Beteiligten ("Verhörsituation"/Aufklärungsauftrag, Sitzungssaal ohne "runden Tisch"-Robenbekleidung) spielen? Es wurde oben schon ausführlich dargelegt, dass sich aus einer angegebenen psychopathologischen Symptomatik nicht zweifelsfrei auf die Existenz eines stattgehabten Traumas schließen lässt. Der psychiatrische Gutachter befindet sich damit in keiner besseren Ausgangssituation als der Jurist, er kann aber feststellen, ob es sich um eine typische Symptomatik einer PTBS mit einem typischen Verlauf handelt, wozu Z. B. gehört, dass die Symptomatik bereits nach dem Primärtrauma vorhanden war oder dass die angstvoll erlebten Wiedererinnerungen typisch geschildert werden können. Dies kann als Indiz neben anderen Indizien gewertet werden, aber nicht als Beweis. Ein Gutachter muss auf diesen Sachverhalt hinweisen, damit nicht der Eindruck erweckt wird, hier wäre mit wissenschaftlichen Methoden oder medizinischen Methoden eine Wahrheitsfindung möglich. Die Rahmenbedingungen einer Befragung können insofern eine Rolle spielen, als sich ein Betroffener durch diese erneut an das Trauma erinnert fühlt oder keine Angaben machen will, um nicht erneut an das Trauma erinnert zu werden. In diesem Fall müsste er aber eine in dieser Zeit bereits manifeste PTBS haben. Unterscheidet sich eine folterbedingte Traumatisierung in ihrer Symptomatik objektivierbar von anderen (asylunerheblichen) Ursachen (Verkehrsunfall o. Ä.) oder anderen psychischen Erkrankungen (Anpassungsstörung o. Ä.)? Inwieweit findet im Zusammenhang mit der Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung von Seiten des Psychiaters eine Überprüfung der Angaben des Patienten zu dem vorgeblich traumatisierenden Ereignis und der von ihm dargelegten Symptomatik (Alpträume - Schlaflosigkeit - Angstzustände o. Ä.) statt? Im Falle einer PTBS werden die traumatisierenden Ereignisse unwillkürlich und ungewollt, d. h. gegen den Willen, im Sinne von sich aufdrängenden Gedankeninhalten wiedererinnert. Diese stehen im Zusammenhang mit dem Trauma, spiegeln dessen Inhalt und Erlebnisverarbeitung wider. Insofern sind die Inhalte eines Unfalltraumas von denen eines Gewalttraumas zu differenzieren. Für den Gutachter bedeutet dies, dass in Gutachten dargelegt sein muss, was der Patient angstvoll und gegen seinen Willen wiedererinnert und worin die Inhalte der Alpträume bestehen. Folteropfer, Flüchtlinge und Migranten haben aber auch ein erhöhtes Risiko für verschiedene andere psychische Störungen (v.a. affektive Störungen, Anpassungsstörungen, vielleicht auch Schizophrenien) oder können an einer solchen auch unabhängig von ihrem Schicksal wie eine "Durchschnittsperson" erkranken (mit gegebenenfalls kulturspezifischer und/oder biographiespezifischer Ausprägung, Baeyer 1982, Ebert 1999). Der Gutachter muss ausführen, wie er diese Störungen diagnostiziert oder ausgeschlossen hat bzw. warum mit den zur Verfügung stehenden psychiatrischen Methoden eine sichere Differenzialdiagnose nicht möglich ist. Welche Bedeutung kommt dem Umstand zu, dass der Patient sich erst teilweise nach der erfolglosen Beendigung eines ode r mehrerer Asylverfahren an einen Arzt oder Therapeuten wendet und in diesem Zusammenhang oft vorgetragen wird, dass die Symptome (trotz des auch zuvor zu keinem Zeitpunkt gesicherten Aufenthalts) erst mit der unmittelbar drohenden Beendigung des Aufenthalts im Bundesgebiet eingetreten bzw. unerträglich geworden sind? Das geschilderte Verhalten ist nicht typisch für das Vorliegen einer PTBS (wenn auch nicht ausgeschlossen). Typisch. wäre es, dass "flashbacks", Ängste, Verfolgungsgedanken o. A. auch in Zeiten von Sicherheit und Ruhe (meist über Schlüsselreize) auftreten und nicht erst dann, wenn äußerer Druck und reale Gefahr" zu befürchten sind. Hierdurch wird die Krankheit im eigentlichen Sinne erst definiert. Inmitten einer drohenden Gefahr ist es physiologisch, sich an eine vergangene ähnliche Gefahr wiederzuerinnern. Im genannten Fall muss vom Gutachter gefragt werden, ob überhaupt eine PTBS bestanden hat bzw. jetzt besteht oder ob, falls eine Traumatisierung stattgefunden hat, der Patient nicht berechtigte Angst hat, erneut Gleiches zu erleben. 4. Traumatisierung als Abschiebehindernis Kann das Gericht nicht die notwendige Überzeugung darüber gewinnen, dass der Asylantragsteller in seinem Heimatstaat politisch verfolgt ist, so muss es weitergehend prüfen , ob in Bezug auf diesen Heimatstaat Abschiebungshindernisse bestehen. Dabei ist im Zusammenhang mit dem Vortrag einer posttraumatischen Belastungsstörung insbesondere die Regelung des § 53 Abs. 6 Satz 1 AuslG relevant, nach der unter anderem von der Abschiebung abgesehen werden kann, wenn es beachtlich wahrscheinlich ist, dass sich der Gesundheitszustand im Zielstaat alsbald nach der Rückkehr wesentlich oder gar lebensbedrohlich verschlechtert, ohne dass der Betroffene zureichende Behandlungsmöglichkeiten oder sonst wirksame Hilfe erlangen könnte (BVerwGE 105, 383, 386f.) Welche gesundheitlichen Folgen können eintreten, wenn eine traumatisierte Person in ihr Heimatland zurückkehren muss, und welche Mindestbedingungen einer Behandlung muss sie dort vor finden, um diesen Folgen begegnen zu können? Reicht es zur Vermeidung kurzfristig eintretender erheblicher Gesundheitsschäden ans, eine psychiatrische Behandlung im Sinne einer Krisenintervention zu erhalten, oder bedarf es regelmäßig auch einer therapeutischen Begleitung des Betroffenen? Welche Bedeutung hat es dabei, ob der Betroffene in der Bundesrepublik Deutschland bereits in psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung steht oder eine solche sogar abgeschlossen wurde? Inwieweit muss mit einer dort eintretenden erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustandes bei Patienten gerechnet werden, die nicht traumatisiert sind, sondern z. B. an einer Anpassungsstörung erkrankt sind, weil sich ihre auf einen Daueraufenthalt in Deutschland zielende Leben splanung nicht verwirklicht und sie deshalb im Falle einer Rückkehr in die Heimat vor einem mehr oder weniger existenziellen Nichts stehen? Ist eine typische PTBS nach tatsächlichem Gewalttrauma in Deutschland festgestellt worden und wurde bereits eine störungsspezifische Behandlung begonnen, sollte diese auch zu Ende geführt werden können, um einem Rückfall wirksam begegnen zu können. Patienten mit einer PTBS, deren Symptome typischerweise auch dann auftreten, wenn keine akute Gefahr besteht, haben auch in sicherer Umgebung im Heimatland, wenn z. B. die nachgewiesene Folterung durch Einzeltäter erfolgte ohne Wiederholungsgefahr, ein erhöhtes Rezidivrisiko, da die Symptome auch ohne Begründung wiedererinnert werden und allein die Umgebung der früheren Traumatisierung (wahrscheinlich im Sinne eines Schlüsselreizes) schon angstauslösend wirken kann. Kann die vorgegebene Symptomatik nicht zweifelsfrei auf ein Verfolgungs- oder Gewalttrauma bezogen werden, sondern handelt es sich bei den angegebenen Beschwerden eher um unspezifische Angst oder andere reaktiv entwickelte Folgeerscheinungen und Anpassungsstörungen, hängt die gutachterliche Beurteilung, welche Gesundheitsstörungen zu erwarten sind, vom jeweiligen Einzelfall ab - eine pauschale Beantwortung, d. h. auf alle Fälle übertragbar, ist nicht möglich. Nicht traumatisierte, aber unter anderen psychischen Störungen leidende Personen, z. B. depressive Störungen, Schizophrenien oder Anpassungsstörungen, bedürfen dann der psychiatrischpsychotherapeutischen Hilfe, wenn die Symptomatik krankheitsrelevante Beeinträchtigungen aufweist und Kriseninterventionen und/oder psychiatrischpsychotherapeutische Therapien erforderlich sind, um Symptome zu reduzieren, Verschlimmerung zu verhüten und Leiden zu verringern. Ob dies in Deutschland geschehen muss oder im Heimatland erfolgen kann, lässt sich vorn psychiatrischen Sachverständigen nicht schlüssig klären; er kann lediglich beantworten, ob und in welcher Form zum Zeitpunkt der Begutachtung ärztlich-psychotherapeutische Hilfen erforderlich sind. 5. Inlandsbezogene Vollzugshindernisse Von dem Abschiebungshindernis des § 53 Abs. 6 AuslG rechtlich zu unterscheiden ist die Gefahr, dass der Ausländer nicht erst aufgrund der Verhältnisse in seinem Heimatland einen erheblichen Gesundheitsschaden erleidet, sondern er bereits durch den Abschiebevorgang, d. h. durch die zwangsweise Durchsetzung seiner Ausreiseverpflichtung, an seiner Gesundheit geschädigt wird. Auch insoweit ist nicht jede Verschlechterung des Gesundheitszustandes rele vant, sondern nur eine solche, die in Hinblick auf ihre Schwere und/oder Dauer als erheblich angesehen werden kann. Ist beim Vorliegen einer PTBS per se eine Abschiebung nicht zu vertreten, welche Verschlimmerungen sind denkbar? Was ist eine Retraumatisierung? Sind zuverlässige Prognosen darüber möglich, weint in einem Einzelfall im Zusammenhang mit einer Abschiebung ein entsprechendes Risiko ernsthaft droht? Kann eine aussagekräftige Prognose über die zu erwartende Gesundheitsbeeinträchtigung im Falle einer Abschiebung getroffen werden? Die Beantwortung der Fragen ist untrennbar mit den eingangs genannten Kriterien der PTBS verbunden. Indirekt wird deutlich, dass es sich nicht primär um eine medizinische Fragestellung handelt, die mit psychiatrisch-wissenschaftlichen Methoden beantwortet werden kann. Die Diagnose einer PTBS ist nur bei Verliegen eines Traumas möglich. Wenn ein solches Trauma nachgewiesen wird, dann ist per se bereits mit einer Verschlimmerung von Ängsten, seien sie im Rahmen einer PTBS oder im Sinne einer Realangst, Zu rechnen. Dazu bedarf es keiner "Retraumatisierung", also z. B. einer erneuten Folterung. Ein Mensch, der dies bereits erlebt hat und in eine für ihn gefährliche Situation zurückgeschickt wird, wird berechtigte Angst haben, dies erneut erleben zu müssen. Die Symptomatik einer zusätzlichen PTBS wird sich durch die die Person überflutenden Schlüsselreize und an frühere Erinnerungen anknüpfende Situationen verschlechtern. Insofern ist eine aussagekräftige Prognose durchaus möglich, als tatsächlich traumatisierte Patienten im Falle einer Abschiebung wahrscheinlich psychische Beeinträchtigungen erleben werden, völlig unabhängig vorn Bestehen einer PTBS. D. h., wie schon ausgeführt, dass bei einer festgestellten PTBS nach Realtrauma immer mit einem Rückfall der Symptomatik zu rechnen ist, gleich ob diese bereits behandelt wurde oder derzeit behandelt wird. 6. Suizidgefahr bei Abschiebung Häufig wird im Zusammenhang mit einer Abschiebung eine Suizidgefahr prognostiziert. Ist eine zuver lässige Prognose über eine mögliche Suizidgefahr möglich? Welche Kriterien sind bei einer Prognose zu beachten? Es gibt bestimmte Regeln in der psychiatrischen Praxis und Klinik, die helfen, Suizidgefahr zu erkennen und entsprechend zu handeln. Auch nach diesen Kriterien ist ein Suizid aber individuell nicht zu prognostizieren, d. h. einerseits, ein Suizid kann auch geschehen, wenn keine Gefährdung erkennbar ist bzw. Fragen nach Suizidabsichten verneint werden, andererseits muss und wird sich nicht jeder, der einen Suizid ankündigt, tatsächlich auch suizidieren. Prinzipiell stellt die Aussage einer Suizidabsicht aber einen ernst zu nehmenden Risikofaktor dafür dar, dass ein Patient auch einen Suizidversuch oder Suizid begehen wird, Im Asylverfahren entsteht eine mit der üblichen Klinik selten vergleichbare Situation, wonach ein Suizid angekündigt wird für den Fall, dass etwas geschieht. Ein Gutachter kann genauso wenig oder genauso viel wie irgendeine andere Person wissen, ob dies eine Drohung ist oder ein fester Entschluss eines Patienten. Er kann allerdings dazu Stellung nehmen und sollte dazu Stellung nehmen, ob dieser Suizid dann im Rahmen einer psychischen Störung geschieht, die die freie Willensbildung einschränkt oder aufhebt (z. B. einer schweren Depression) oder ob es sich um einen freien Willensentschluss handelt, der durch das Vorliegen einer psychischen Störung nicht erklärbar ist. III. Literatur American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV. APA, Washington DC, 1994. Baeyer W., Endomorphe Psychosen. bei Verfolgten. Springer, Heidelberg, 1982. Ebert, D., Soziokulturelle Faktoren und die Psychopathologie der Depression. Steinkopff, Darmstadt, 1999. Leonhard M./Foerster K., Probleme bei der Begutachtung der posttraumatischen Belastungsstörung. Der medizinische Sachverständige 99, 150 - 155, 2003. Steller M./Volbert R., Psychologie im Strafverfahren. Huber, Bern, 1997. WHO. The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders. WHO, 1992. VBI-BW Heft 2/2004 -- Seite 41-45