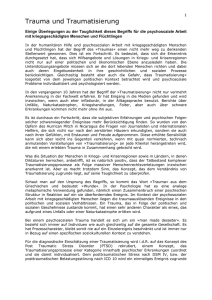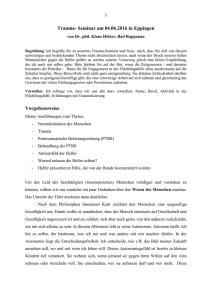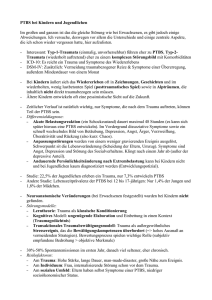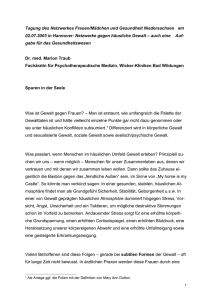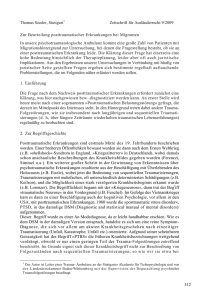SFU-Diff-KHL-Trauma-Kirchbach-Skriptum-SS17
Werbung

Skriptum Differentielle Krankheitslehre I – Trauma 1. Allgemeines zu Traumafolgestörungen
Der bekannte Traumaexperte Franz Ruppert beschreibt die Wirkung des Traumas
anschaulich: Trauma ist eine Lebenserfahrung, wo man in den Zustand der Hilflosigkeit,
Überforderung, Überwältigung gerät. Was man dann dagegen tut, erzeugt noch mehr
Bedrohung. Eine normale Stressreaktion wie Flucht etc. hilft in der traumatischen Situation
nicht mehr, sondern verschärft die noch. Beispiel: Ein weinendes Kind, dem ein erwachsener
Mensch sagt, es solle sofort aufhören zu weinen, denn er ertrage das nicht. Das Kind muss
also seine natürliche Reaktion des Weinens unterdrücken, um nicht in Gefahr zu geraten.
Stress und Trauma sind also ganz unterschiedliche Konzepte. Bei Stress kann ich die äußere
Situation durch meine Reaktion beeinflussen.
Was muss ich also machen, um eine Traumasituation zu überleben?
Das Äußere kann ich nicht ändern, aber mein Inneres, nämlich indem ich das, was ich erlebe,
nicht mehr als solches erlebe. Ich kann meine Sinneswahrnehmung und meine Gefühl so weit
herunterfahren, dass ich weniger wahrnehme, ich kann mein Denken so weit blockieren, dass
ich nicht mehr wahrnehme, was mir da jemand antut. Diese Blockade hört aber nicht
unbedingt auf, wenn die äußere Bedrohung vorbei ist. Nach einer Traumaerfahrung gibt es
kein Zurück zum Vorher. Es gibt eine veränderte Psychosomatik. Der Organismus spaltet sich
in drei verschiedene Substrukturen. Selbst wenn ich traumatisiert bin, bleibt mir meine
gesunde Psyche erhalten. Die verliert nicht ihre natürliche Aufgabe, nämlich den Bezug zur
Realität herzustellen. Dazu muss ich wahrnehmen, fühlen, denken. Dass die verschwindet,
kann nicht passieren. Selbst Schwersttraumatisierte haben gesunde Strukturen, an die man
anknüpfen kann, um in die Traumaheilung zu gehen.
Aber es gibt auch die traumatisierten Anteile, in denen der ganze Horror, die Überwältigung
stecken.
*
Das wird eingekreist, gepuffert durch Betäubungsringe. Wir haben Narkotika in uns, die dafür
benutzt werden. Es geht ganz schön viel Energie in die Erzeugung und Pufferung dieses
wabernden Ringes. Gelöst wird das Problem dadurch nicht, sondern es arbeitet innen weiter.
Das passiert vor allem mit den traumatisierten Gefühlen von Ekel, Panik etc. Was das
wegpackt, ist Abteilung 3, die Überlebensanteile, die uns glauben machen wollen, da sei
nichts passiert und wenn, dann war es nicht so schlimm. Da kann ein ganzes
Lebensprogramm entstehen, das darin besteht, so zu tun, als sei nichts passiert. Das sind
Vermeidungsstrategien, bestimmte Bücher nicht zu lesen, bestimmte Filme nicht zu sehen etc.
Denn sonst könnte etwas angetriggert werden, was sonst hochkommen könnte. Dazu gehören
auch Drogen, Alkohol etc. Zu Trauma gehört also auch, dass diese Strukturen uns bleiben.“
Eine andere Traumaexpertin, Angela Kühner beschreibt das zentrale Erleben im Trauma
folgendermaßen:
„Eine der zentralen Metaphern, mit der Traumata beschrieben werden, ist die der Erschütterung. Durch ein traumatisches Erlebnis werden menschliche Grundüberzeugungen
erschüttert: der Glaube an eine im Prinzip gute Welt, das Vertrauen in die eigene
Selbstwirksamkeit, d. h. in das Gefühl, äußeren Umständen nicht hilflos ausgesetzt zu sein,
sondern aktiv handelnd wirksam sein zu können. Für die amerikanische kognitive
Psychologin Ronnie Janoff-Bulmann sind diese „erschütterten Grundüberzeugungen“
1
(shattered assumptions) nicht nur ein Phänomen von vielen, sondern der Kern jeden Traumas
(Janoff-Bulmann, 1992). Zentral ist für sie neben dem Glauben an eine halbwegs „heile
Welt“, dass die Vorstellung der Unverletzbarkeit der eigenen Person radikal in Frage gestellt
werde. Um ihre Thesen zu differenzieren, hat sie ausführlicher untersucht, welche
Grundannahmen bei verschiedenen Traumatisierten konkret erschüttert wurden und wie sich
vorausgegangene vergleichbare Erfahrungen auswirken. Tatsächlich konnte sie feststellen,
dass für Menschen, deren Vertrauen in die gute Welt schon durch vorherige traumatische
Erfahrungen in Frage gestellt worden waren, die unmittelbare Erschütterung direkt nach
einem traumatischen Ereignis geringer war als bei Menschen, die bis dahin an eine gute Welt
geglaubt hatten. Allerdings erholten sich die „Gutgläubigeren“ in Janoff-Bulmanns
Untersuchungen langfristig trotzdem schneller (was sie mit besseren Coping-Mechanismen
erklärt). Auch wenn vielleicht nicht alle Theoretiker die Erschütterung von Überzeugungen
ins Zentrum des Trauma-Verständnisses rücken würden, so ist doch die Reorganisation und
Restitution von Selbst- und Weltverständnis wesentlicher Bestandteil der spezifisch
menschlichen Traumaverarbeitung. Gerne werden für Traumverarbeitung spektakuläre
Analogien aus der Tierwelt herangezogen, etwa die Tatsache, dass das Beutetier oft schon aus
psychischer Lähmung stirbt, bevor das Raubtier zubeißt. Diese Analogien helfen, den
physiologischen Teil der Traumareaktion und -verarbeitung nicht zu unterschätzen.“
Diese zwei Schilderungen vermitteln schon einen Eindruck davon, wie sehr und wie
unterschiedlich über Traumafolgestörungen diskutiert wird.
-
Posttraumatische Belastungsstörung - Post Traumatic Stress Disorder
FR: Man beachte den Bedeutungsunterschied in der deutschen und englischen Bezeichnung.
Im täglichen Sprachgebrauch unterscheiden wir zwischen Belastung, Stress und Trauma.
Belastung ist etwas Alltägliches. Stress ist ebenfalls nichts Außergewöhnliches. Jeder leidet
bisweilen darunter und kommt doch irgendwie mehr oder weniger gut damit zurecht. Trauma
wird dagegen als eine seelische Verletzung verstanden und vermittelt die Konnotation von
Leiden und Kranksein. Stress und Trauma werden in der englischen Bezeichnung im
Gegensatz zur deutschen Definition miteinander verbunden. Ist das nur ein
Übersetzungsproblem, oder stecken dahinter unterschiedliche Auffassungen?
Mit Fischer und Riedesser bin ich der Meinung, dass das ‚Stress’-Konzept, so große
Verdienste es in Psychologie, Psychosomatik und innerer Medizin hat, nicht ausreicht, um das
zu bezeichnen, was speziell den Gegenstand einer psychosozialen und psychosomatischen
Traumatologie bildet, nämlich die Störung bzw. Zerstörung psychischer Strukturen und
Funktionen, die in gewissem Sinne analog zu jenen Zerstörungen gesehen werden kann, mit
denen sich die chirurgische Traumatologie befasst.In deutschen KZ-Gutachterverfahren der
Nachkriegszeit wurde der Stressbegriff beispielsweise dazu verwendet, ein Trauma
auszuschließen. Einige Gutachter gestanden zwar zu, dass der Aufenthalt in einem KZ für die
Betroffenen ‚Stress’ bedeutet habe. Jetzt noch anhaltende Symptome seien auf
konstitutionelle biologische Faktoren zurückzuführen. Tatsächlich sah die klassische
Stresstheorie keine irreversiblen Symptome und Langzeitschäden vor. Auch besteht Grund
zur Annahme, dass sich die Physiologie der Stressreaktion von der der traumatischen
Reaktion qualitativ unterscheidet. Unter Stressreaktion verstehen wir demgegenüber die
Antwort des Organismus auf eine kritische Belastungsreaktion und kritische Ereignisse,
wobei es in der Regel nicht zu der für die Traumareaktion charakteristischen qualitativen
Veränderung psychischen und/oder organischen Systemen kommt.
2
Es gibt in der Chirurgie schon länger eine Traumatologie, die sich mit körperlichen
Verletzungen befasst. Dort handelt es sich um die Lehre von den Folgen körperlicher
Verletzungen. Das jüngere Gebiet der Psycho-Traumatologie soll die Aufmerksamkeit auf die
menschliche Erlebnissphäre richten. Aber inwieweit hält die Analogie zu psychischen
Wunden?
Eine erste Frage stellt sich, wenn wir nach dem Begriff des Traumas fragen. Ist ‚Trauma’ nun
eigentlich ein Ereignis oder ein Erlebnis? Handelt es sich um eine subjektive oder eine
objektive Kategorie? Der Terminus ‚post-traumatische’ Belastungsstörung in den
gegenwärtigen Diagnostikmanualen legt nahe, ‚Trauma’ sei ein Ereignis, das bereits
vergangen ist, wenn sich die Symptome der Störung auszubilden beginnen. Nach dem Trauma
(= post-traumatisch) bildet sich die Störung aus. Offensichtlich werden hier die Begriffe
„Trauma“ und „traumatisches Ereignis“ miteinander vermischt. Denn vergangen ist ja streng
genommen nur das traumatische Ereignis: eine definitorische Nachlässigkeit, die für eine sich
entwickelnde Wissenschaft nicht folgenlos bleibt. Dagegen ist festzuhalten, dass der Begriff
Trauma nicht koextensiv mit „traumatischem Ereignis“ zu verstehen ist.
Wenn das Trauma also kein Ereignis ist, also kein „objektiver“, äußerlicher Vorgang, sollte
„Trauma“ dann nicht subjektiv definiert werden? Etwas so: Trauma ist ein unerträgliches
Erlebnis, das die individuellen Bewältigungsmöglichkeiten überschreitet. Darin liegt aber eine
Gefahr subjektiver Willkür und Beliebigkeit, sobald der Bezug des Erlebens auf das Ereignis
außer acht gelassen wird.
Es gibt also keine einfachen Lösungen nach Art des Entweder-oder-Denkens. Entweder lässt
sich das Trauma ganz objektiv definieren (als objektives Ereignis) oder der Traumabegriff
wird völlig unscharf, da er nur subjektiv ist und damit auch willkürlich verwendet werden
kann.
Dieses Dilemma wird gelöst, indem traumatisch nicht als eine Qualität verstanden wird, die
einem Ereignis inhärent ist, und Trauma nicht gleichgesetzt wird mit einem Ereignis.
Entscheidend ist vielmehr die Relation von Ereignis und erlebendem Subjekt. Dieser
ökopsychologische Gesichtspunkt ist für die Traumaforschung zentral, wird aber oft
vernachlässigt.
Die ‚traumatische Situation’ ist aus diesem Zusammenspiel von Innen- und
Außenperspektive, von traumatischen Umweltbedingungen und subjektiver
Bedeutungszuschreibung, von Erleben und Verhalten zu verstehen. Wer sich nicht in die
‚Situation’ der Betroffenen hineinversetzt, kann eine traumatische Erfahrung nicht verstehen.
Traumatische Situationen sind solche, auf die keine subjektiv angemessene Reaktion möglich
ist. Sie erfordern dringen, z. T. aus Überlebensgründen, eine angemessene und ‚notwendige’
Handlung und lassen sie doch nicht zu. Wie reagieren wir auf Situationen, die eine
angemessene Reaktion nicht zulassen? Wie verarbeitet das betroffene Individuum oder die
soziale Gruppe eine Situationserfahrung, die ihre subjektive Verarbeitungskapazität oder
vielleicht die von uns allen massiv überschreitet? Das ist die leitende Frage im Hinblick auf
die traumatische Reaktion.
Noch ein dritter Gesichtspunkt ist in der Paradoxie der traumatischen Situation und Reaktion
enthalten und leitetüberzum dritten Moment des Verlaufsmodells, nämlich dem
traumatischen Prozess.
Da PTBS auch nach Monaten, manchmal erst nach Jahren in Erscheinung treten kann, spricht
vieles dafür, psychische Traumatisierung als einen Verlaufsprozess zu verstehen.
Das Paradoxon der traumatischen Reaktion ist hier gewissermaßen auf Zeit gestellt. In der
weiteren Lebensgeschichte, manchmal ein volles Leben lang, bemühen sich die Betroffenen,
die überwältigende, physisch oder psychisch existentiell bedrohende und oft unverständliche
3
Erfahrung zu begreifen, sie in ihren Lebensentwurf, ihr Selbst- und Weltverständnis zu
integrieren. Dies geschieht häufig in einem Wechselspiel von Zulassen der Erinnerung und
kontrollierender Abwehr oder Kompensation, um erneute Panik und Reizüberflutung zu
vermeiden. Auch hier ist die Dialektik von Innen- und Außenperspektive für die
psychotraumatologische Forschung grundlegend. Von der Außenperspektive des unbeteiligten
Beobachters aus lässt sich die Zerstörung unseres Selbst- und Weltverständnisses, welche
traumatische Erfahrungen bewirken, oft nicht einmal ahnen.
FR: Wir halten die Vorsilbe ‚post’-traumatisch für zweifelhaft, da sie eine Gleichsetzung von
Trauma und traumatischem Ereignis suggeriert, während Trauma nach unserem Verständnis
und auch im üblichen Sprachgebrauch eher einen prozessualen Verlauf nahelegt. Das
‚Trauma’ ist nicht vorbei, wenn die traumatische Situation oder traumatische Ereignis vorüber
ist. Weiterhin halten wir die Wortverbindung von Trauma und Stress für problematisch.
FR 45 Faszinierend ist die Beobachtung, dass Forschungsrichtungen mit zunächst völlig
unterschiedlichem Ausgangspunkt und unterschiedlichen Begriffssystemen sich zunehmend
auf die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt zu konzentrieren beginnen,
sobald sie sich mit Phänomenen der Traumatisierung befassen.
Die Posttraumatische Belastungsstörung ist die bekannteste Traumafolgestörung. Sie ist
jedoch nur eine spezifische Form davon. Weitere und verwandte Störungsbilder sind:
Akute Belastungsreaktion ICD10: F 43.0
Anpassungsstörung ICD10: F 43.2
Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung ICD10: F 62.0
Die umfangreichen Folgen, einer durch Traumatisierung gestörten
Persönlichkeitsentwicklung, werden aktuell unter den Begriffen „Komplexe
Traumafolgestörung“, „Developmental Trauma Disorder“ oder „Komplexe Präsentation einer
Posttraumatischen Belastungsstörung“ diskutiert.
Traumatische Ereignisse können sein:
- das Erleben von körperlicher und sexualisierter Gewalt, auch in der Kindheit (sogenannter
sexueller Missbrauch),
- gewalttätige Angriffe auf die eigene Person,
- Entführung,
- Geiselnahme,
- Terroranschlag,
- Krieg,
- Kriegsgefangenschaft,
- politische Haft,
- Folterung,
- Gefangenschaft in einem Konzentrationslager,
- Natur- oder durch Menschen verursachte Katastrophen,
- Unfälle
- oder die Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit.
Diese nicht umfassende Aufzählung zeigt, um wie verschiedenartige Ereignisse es sich
handeln kann. All dies kann zudem an der eigenen Person, aber auch an fremden Personen
4
erlebt werden. In vielen Fällen kommt es zum Gefühl von Hilflosigkeit und durch das
traumatische Erleben zu einer Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses. Je näher die
Beziehung zur betroffenen Person ist, desto wahrscheinlicher ist das Auftreten einer
Traumafolgestörung und desto gravierender wird sie ausfallen.
Das syndromale Störungsbild ist geprägt durch:
sich aufdrängende, belastende Gedanken und Erinnerungen an das Trauma
(Intrusionen wie Flashbacks, Bilder oder Alpträume) oder aber Erinnerungslücken
(partielle Amnesie, Dissoziation),
Übererregungssymptome (Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit, vermehrte Reizbarkeit,
Affektintoleranz, Konzentrationsstörungen)
Vermeidungsverhalten (Vermeidung traumaassoziierter Stimuli) und
emotionale Taubheit (allgemeiner Rückzug, Interessensverlust, innere
Teilnahmslosigkeit)
im Kindesalter teilweise veränderte Symptomausprägungen (z.B. wiederholtes
Durchspielen des traumatischen Erlebens, Verhaltensauffälligkeiten, z. T. aggressive
Verhaltensmuster)
Die Symptomatik kann unmittelbar oder auch mit (z. T. mehrjähriger) Verzögerung
nach dem traumatischen Geschehen auftreten (verzögerte PTBS).
Epidemiologie:
Die Häufigkeit von PTBS ist abhängig von der Art des Traumas. Die folgenden
Zahlen geben an, bei wie viel Prozent der Menschen, die folgendes Trauma erlebt
haben, danach eine Traumafolgestörung auftrat.
Ca. 50% Prävalenz nach Vergewaltigung
Ca. 25% Prävalenz nach anderen Gewaltverbrechen
Ca. 50% bei Kriegs-, Vertreibungs- und Folteropfern
Ca. 10% bei Verkehrsunfallopfern
Ca. 10% bei schweren Organerkrankungen, (Herzinfarkt, Malignome)
Die lebenszeitliche Prävalenz für PTBS in der Allgemeinbevölkerung mit
länderspezifischen Besonderheiten liegt zwischen 1% und 7% (Deutschland 1,5 – 2
%). Die Prävalenz subsyndromaler Störungsbilder ist wesentlich höher. Es besteht
eine hohe Chronifizierungsneigung.“ Diese Zahlen sind aber vermutlich zu niedrig,
weil es eine hohe Dunkelziffer gibt. Häufig werden Traumafolgestörungen falsch
diagnostiziert, entweder als Depressionen, als Angststörung, Suchtproblematik u. Ä.
FR: Traumafolgestörungen bilden also eine der wenigen nosologischen Einheiten,
deren Verursachung bekannt ist. Aus Forschungen zur Kriegstraumatisierung
beispielsweise geht hervor, dass PTBS umso eher auftritt, je enger ein Soldat am
Zentrum des Kampfgeschehens eingesetzt wird. Erbfaktoren üben dabei allenfalls
einen geringfügig modifizierenden Einfluss aus. Neben einer spezifischen Ätiologie
weisen Traumafolgestörungen eine spezifische Pathogenese (von altgr, pathogenesis =
5
Entstehungsverlauf eines Störungsbildes) auf, die sich u. a. aus der Dynamik von dem
sogenannten Traumaschema und dem traumakompensatorischem System ergibt.
2. Geschichte der Psychotraumatologie
2.1. Anfänge
Die Geschichte der Psychotraumatologie zeigt, wie sich das psychotherapeutische Denken zu
diesem stark diskutierten Thema entwickelt hat. Viele dieser Gedanken spielen noch heute
eine mehr oder weniger offensichtliche Rolle, zum Teil in neuem Gewand. Immer wieder
aktuell, nicht zuletzt bei den Flüchtlingen, sind die Fragen nach Anerkennung von
psychischem, häufig von Menschen verursachten Leid, aber auch nach Täterschaft,
insbesondere bei ehemaligen Soldaten. Außerdem ist die Diagnose einer PTSD häufig in
Versicherungsfragen relevant für eine Entschädigungspflicht.
Auch die Frage nach rein psychischen oder (auch) organischen Ursachen der
posttraumatischen Belastungsstörung taucht immer wieder auf.
Außerdem zeigt diese Geschichte, wie sehr psychotherapeutisches Denken auch von
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren geprägt wird.
Die Symptome der PTBS gab es in der Menschheitsgeschichte schon immer.
FR An der ‚Ilias’, dem Bericht vom Trojanischen Krieg, kann man sehen, dass Homer, der
‚Geschichtsschreiber’ und Dichter, traumatische Reaktionen und Wege zu ihrer Überwindung
eindringlich zu schildern verstand. Der bedeutendste Held der Griechen, Achilles, entwickelt
im Kampf vor Troja psychotraumatische Symptome, die recht genau denen entsprechen, die
wir auch heute noch von kämpfenden Soldaten kennen.
Dazu gehören ein Erlebnis von Verrat und Verstoß gegen das, was der Soldat als sein gutes
Recht betrachtet; enttäuschter Rückzug auf einen kleinen Kreis von Freunden und
Kameraden; Trauer- und Schuldgefühle wegen des Todes eines besonders befreundeten und
nahestehenden Kameraden; Lust auf Vergeltung, nicht mehr Heimkehren Wollen; Sich wie
tot Fühlen; dann eine berserkerhafte Raserei mit Entehrung des Feindes und extremen
Grausamkeiten. Dieser berserkerhafte Ausnahmezustand wird in der Literatur (Shay) als
Verlust von Furcht und von jedem Gefühl eigener Verletzlichkeit beschrieben. Es wird keine
Rücksicht auf die eigene Sicherheit genommen; eine übermenschliche Kraft und Ausdauer
entwickeln sich; Wut und Grausamkeit ohne Einhalten oder Unterscheidungsfähigkeit treten
zu Tage. Es kommt zu einer Übererregtheit des autonomen Nervensystems, die von den
Betroffenen oft beschrieben wird als „Adrenalinrausch“ oder „als käme Elektrizität aus mir
heraus.“ (Blutrausch?) (Trojafilm 1:40 – 2:05)
Einzelne Symptome oder auch das gesamte Syndrom finden sich gehäuft in den Berichten
von Kriegsteilnehmern, die nach ihrem Einsatz eine psychotraumatische Belastungsstörung
entwickeln.
Samuel Pepys, der 1666 das große Feuer von London miterlebte, schrieb sechs Monate nach
der Katastrophe in sein Tagebuch:
„Wie merkwürdig, dass ich bis zum heutigen Tag keine Nacht schlafen kann, ohne von großer
Angst vor dem Feuer erfasst zu werden; und in dieser Nacht lag ich bis fast zwei Uhr morgens
wach, weil mich die Gedanken an das Feuer nicht losließen.“
6
Verfolgt man die Anfänge dessen, was heute als komplexes Wissen über die Dynamik von
Traumata, Traumafolgestörungen und Traumaheilung bekannt ist, gerät man in eine
wechselvolle Geschichte, in der überraschend früh erforschtes Wissen immer wieder in
Vergessenheit geraten ist und neu entwickelt wurde, um dann wieder in Vergessenheit zu
geraten und erneut aus der Vergangenheit aufzutauchen. Zum Zweiten schwankte die
Lehrmeinung extrem zwischen der Annahme von organischen Erkrankungen nach
Extrembelastungen und psychischen beziehungsweise neurotischen Folgen, zwischen der
Annahme einer Krankheit und der Vermutung von Simulation zur Erreichung bestimmter
Ziele, z. B. finanzieller Entschädigung in der Folge von Unglücken, insbesondere
Eisenbahnunfällen.
Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem, was wir heute posttraumatische
Belastungsstörung nennen, begann 1766, als ein französischer Arzt bei einem seiner
Patienten, dem Conte de Lordat, nach einem Postkutschenunfall Gedächtnis- und
Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Alpträume und Ängste diagnostizierte, obwohl
der Patient keine körperlichen Verletzungen davongetragen hatte.
1866 stellte der Londoner Chirurg John Eric Erichsen bei Menschen, die Eisenbahnunglücke
ohne körperliche Verletzungen überlebt hatten, ähnliche Symptome fest.
Erichsen ging davon aus, dass diese Beeinträchtigungen durch eine Erschütterung der
Wirbelsäule hervorgerufen worden waren, und nannte die nach Unfällen immer wieder
ähnlich diagnostizierten Störungen »Railroad Spine Syndrome«.
Der Begriff spine syndrome, also Rückenmarkssyndrom wurde deswegen gewählt, da all
diese Symptome auf eine angenommene Rückenmarksschädigung durch Erschütterung
aufgrund von Zugunfällen zurückgeführt wurden. Die in dieser Zeit schon diskutierte
Krankheit der ‚Hysterie’ mit ganz ähnlich beschriebenen Symptomen, wollte Erichson
aufgrund der Annahme, dass Hysterie nur bei Frauen vorkomme, in Abgrenzung zu seinem
„railroad spine syndrome“ (van der Kolk et al. 2000c S. 72) verstanden wissen.
19 Jahre später, also 1895, postulierte sein Kollege Page psychologische ‚nervöse’ Ursachen
dieser Reaktionen auf Zugunfälle und kennzeichnete diese Symptome als ‚traumatische
Hysterie’“ (Liebermann et al. 2001, S. 14)
Sein Kollege Knapp veröffentlichte 1888 im Boston Medical And Surgical Journal einen
Artikel mit der Überschrift Nervous Affections Following Injury – Concussion of the Spine,
Railway Brain. Dabei wählte er einen Begriff, den ein anderer Londoner Chirurg, John
Putnam, schon 1883 geprägt hatte, nachdem er in insgesamt 234 Fällen als Gutachter für
britische Eisenbahngesellschaften tätig war: »Eisenbahn-Gehirn«.
1871 wurde in Preußen ein Gesetz über die Entschädigung bei Eisenbahnunfällen erlassen
und 1884 die gesetzliche Unfallversicherung eingeführt. In der Folge davon kam es zu
Prozessen um Entschädigungen bei Unfällen. Bei einem Prozess wegen Schäden nach einem
Eisenbahnunfall und dann auch in seiner Habilitationsschrift berief sich der deutsche
Neurologe Hermann Oppenheimer auf französische Studien.
In ihnen wurden Zweifel an den organischen Ursachen für die Symptome bei den
Überlebenden von Unfällen geäußert. Oppenheimer nannte die Störungen, denen er in seiner
Aufgabe als Unfallfolgen-Begutachter begegnete, »psychische Erschütterungen« und sprach
schließlich in Anlehnung an Page als erster von »traumatischer Neurose«. Er berief sich dabei
auf die Bedeutung des Schreckens für Nervenkrankheiten, in der das seelische Erleben als
7
auslösendes Moment von Traumafolgestörungen anerkannt wurde. Oppenheim beschrieb
„Desorientiertheit, Aphasie, Unfähigkeit zu stehen, sowie Schlafstörungen nach Eisenbahnund Arbeitsunfällen“ (Liebermann et al. 2001, S. 14). Oppenheim postulierte zudem eine
organische Ursache als Folge der Erschütterung während eines Unfalls. Oppenheim nahm
„funktionelle Probleme [als] durch subtile molekulare Veränderungen im zentralen
Nervensystem hervorgerufen“ (van der Kolk et al. 2000c, S. 72) an. Das Erschrecken eines
Menschen bei solch einem extremen Ereignis spiele die Hauptrolle bei der Entstehung einer
solchen hirnphysiologischen Veränderung. Allein die Behauptung, dass physiologische
Veränderungen durch ein Erschrecken hervorgerufen werden könnten, stieß auf massiven
Widerstand, auch weil Oppenheim eine Entschädigungspflicht gegenüber den Opfern von
Zugunfällen mit einer solchen Symptomatik wissenschaftlich stützte. GegnerInnen einer
Entschädigung für die Unfallopfer wiesen diese Beschwerden als ein „pathologisches
Rentenbegehren“ (Liebermann et al. 2001, S. 14) zurück.
Schultze und Seeligmüller verdächtigten dagegen einen Großteil der Unfallopfer, die die
Symptome einer traumatischen Neurose zeigten, der Simulation und des
Versicherungsbetruges. Eine andere Meinung vertrat Theodor Ziehen. Er schrieb 1911: » ...
dass neben jedem Trauma der psychische Faktor des Schreckens neben dem mechanischen
Faktor eine Rolle spielt ... Dazu kommen die chronischen Affektstrapazen, welche mit der
Sorge um die Folgen des Unfalls und dem Rentenkampf verbunden sind.«
Parallel dazu fand in den USA eine Diskussion zu den Beschwerden von Soldaten des
amerikanischen Bürgerkrieges statt. Hawthorne (1863) sowie Da Costa (1871) beschrieben
„psychovegetative Veränderungen“ (Liebermann et al. 2001, S. 14) bei aus dem Gefecht
zurückgekehrten Soldaten. Da Costa nannte dieses Phänomen „‚irritable heart’ ein Ergebnis
von Überanstrengung durch die belastenden Bedingungen wie Fieber und Diarrhöe, denen die
Soldaten unterlagen“ (Liebermann et al. 2001, S.14). Die Zuschreibung eines organischen
Ursprunges für die psychischen Leiden bot „eine ehrenhafte Lösung für alle Parteien, die
durch das Zusammenbrechen von Personen unter Belastung bloßgestellt werden konnten: Der
Soldat bewahrte seine Selbstachtung, der Arzt brauchte nicht persönliches Versagen oder
Fahnenflucht zu diagnostizieren, und die militärischen Autoritäten brauchten nicht den
psychologischen Zusammenbruch von zuvor tapferen Soldaten erklären“ (van der Kolk et al.
2000c, S. 72).
Die Beschäftigung mit Kindesmisshandlung und sexualisierter Gewalt gegen Kinder begann
in Frankreich. Ambroise Tardieu, Professor für Rechtsmedizin an der Pariser Universität,
belegte in seinem Werk, dass in Frankreich zwischen den Jahren 1858 und 1869 11576
Menschen wegen Vergewaltigung oder versuchter Vergewaltigung angeklagt worden waren,
davon nicht weniger als 9125 wegen solcher Delikte an Kindern, fast immer Mädchen.
Zugleich entstand eine intensive Diskussion, inwieweit die Aussagen junger Mädchen
glaubhaft oder erlogen seien. Man nahm an, diese Kinder hätten ihre Eltern fälschlicherweise
des Inzests beschuldigt. Ähnliche Reaktionen traten auf, als die ersten systematischen
Untersuchungen der Beziehung zwischen Trauma und psychiatrischer Erkrankung an der
„Salpetrière“ in Paris durchgeführt wurden.
Der Neurologe Jean Martin Charcot beschrieb als Erster Hysterie, jenes rätselhaften
Verhaltens von jungen Frauen, welches z. B. durch ekstatische Körperverrenkungen,
Lähmungserscheinungen, Erstickungsanfälle, Verlust der Sprechfähigkeit und
Empfindungslosigkeit der Haut schlagartig in Erscheinung trat und auch ebenso schnell
wieder verschwand. Er meinte, dass hysterische Anfälle dissoziative Zustände, also das
Ergebnis erlebter unerträglicher Erlebnisse, darstellten.
8
Dadurch wurde Pierre Janet inspiriert, das Phänomen der Dissoziation für die Bewältigung
traumatischer Erfahrungen zu untersuchen.
1887 wies Janet zum ersten Mal auf die Bedeutung realtraumatisierender Erfahrungen für die
Entstehung hysterischer und dissoziativer Symptome hin. Laut Janet ergeben sich
Dissoziationen als Folge einer Überforderung des Bewusstseins bei der Verarbeitung
traumatischer, überwältigender Erlebnissituationen. In seiner Arbeit ‚L’automatisme
psychologique’ (1889) führt er aus, dass die Erinnerung an eine traumatische Erfahrung oft
nicht angemessen verarbeitet werden kann: Sie wird daher vom Bewusstsein abgespalten,
dissoziiert, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufzuleben, entweder als emotionaler
Erlebniszustand, als körperliches Zustandsbild, in Form von Vorstellungen und Bildern oder
von Reinszenierungen im Verhalten.
Bedeutsam auch heute noch für die Psychotraumatologie ist Janets Entdeckung, dass
traumatische Erfahrungen, die nicht mit Worten beschrieben werden können, sich in Bildern,
körperlichen Reaktionen und im Verhalten manifestieren. Der ‚unaussprechliche Schrecken’,
den das Trauma hinterlässt, entzieht sich den höheren kognitiven Organisationsebenen,
hinterlässt aber seine Spuren auf elementaren Repräsentationsstufen. Fischer und Riedesser
bezeichnen diese psychische Struktur mit Erinnerungsfragmenten auf unterschiedlichen
Repräsentationsebenen und der charakteristischen Spaltung von Wahrnehmungs- und
Handlungsteil als Traumaschema.
Besonders bedeutsam ist Janets Konzept einer Dissoziation unterschiedlicher
Bewusstseinszustände, die in extremen Fällen zu sich verselbständigenden
Teilpersönlichkeiten führen kann.
Janets wichtigster Verdienst war also zu erklären, wie traumatische Erfahrungen als
abgespaltene Anteile der Persönlichkeit im Unterbewusstsein überdauern, sich dem
Bewusstsein über lange Jahre entziehen und zu Auslösern für spätere Erkrankungen werden
können. Wegen seiner Annahme, dass die Leiden der ‚hysterischen’ Patientinnen in der
Salpêtrière auf real erlebten ‚traumatischen’ Erfahrungen wie sexualisierten
Gewalterfahrungen beruhten, wurde Janet in der wissenschaftlichen Community ausgegrenzt,
und seine wissenschaftlichen Arbeiten gerieten jahrzehntelang in Vergessenheit (vgl. Lewis
Herman 1994).
Andere Forscher richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Rolle der Suggestibilität bei der
Hysterie, so dass bald ein größeres Interesse an der Behandlung der Simulation bestand als an
der Linderung der traumatischen Erinnerungen der Patienten. Stattdessen kam es zu einer
Umwertung der Aussagen von Frauen, die über früheren sexuellen Missbrauch berichtet
hatten, und es wurde behauptet, es handele sich um eine „Pseudologia phantastica auf
hysterisch-degenerativer Grundlage“, um eine kindliche Lügensucht oder um „genitale
Halluzinationen“.
Auch Sigmund Freud hatte Charcot zu einem Studienaufenthalt in Paris besucht und Janet
dort gehört. Er war mit deren Sichtweisen und Behandlungsformen der Hysterie konfrontiert
worden. Zurück in Wien begann Freud zusammen mit Josef Breuer seine Studien zur
Entstehungsgeschichte hysterischer Störungen.
1896 hielt er einen Vortrag „Zur Ätiologie der Hysterie“ vor dem Wiener Verein für
Psychiatrie und Neurologie. Darin beschrieb er Hysterie als Folge sexueller
Traumatisierungen: „Ich stelle also die Behauptung auf, zugrunde jedes Falles von Hysterie
befinden sich – durch die analytische Arbeit reproduzierbar trotz des Dezennien umfassenden
9
Zeitintervalls – ein oder mehrere Erlebnisse von vorzeitiger sexueller Erfahrung, die der
frühesten Jugend angehören. Ich halte dies für eine wichtige Enthüllung.“ (Freud, 1952). Im
selben Jahr schrieb er in Ätiologie der Hysterie: »Jedem Fall von Hysterie liegt eine sexuelle
Erfahrung zugrunde, wobei Kinder weit häufiger sexuellen Angriffen – auch durch nahe
Verwandte – ausgesetzt sind, als man erwarten sollte.« Der Nachweis zwischen traumatischer
Kindheitserfahrung und späterer Pathologie wurde in den Studien zur Hysterie sorgfältig
geführt. Wir können diese Schrift auch heute noch als einen differenzierten Beitrag zur
Erforschung traumatischer Prozesse nach sexuellem Kindesmissbrauch lesen. Sie zeigen
exemplarisch den komplexen Zusammenhang zwischen traumatischer Situation, Reaktion und
Prozess.
Der postulierte Zusammenhang zwischen verfrühten sexuellen Erfahrungen und den
Symptomen seiner ‚hysterischen’ Patientinnen wurde jedoch schon ein Jahr später, im Jahre
1897, zugunsten der Möglichkeit einer der Phantasie der Patientin entsprungenen
‚Verführung’ relativiert. Mit seiner Entwicklung der Theorie der intrapsychischen Konflikte
und der Theorie des Ödipuskomplexes wurden die Berichte von Kindern über sexuelle
Übergriffe dem Bereich der unbewussten Wünsche zugeschrieben, und realtraumatische
Erfahrungen wurden unterbewertet. Nun waren es also nicht mehr die Erinnerungen an ein
tatsächlich stattgefundenes Kindheitstrauma, „die vom Bewusstsein abgespalten sind, sondern
vielmehr die inakzeptablen sexuellen und aggressiven Wünsche des Kindes, die bedrohlich
auf das Ich wirken und eine Abwehr gegen das Bewusstwerden dieser Wünsche
mobilisieren“. Judith Lewis Herman führte diese Relativierung auf die „drastischen sozialen
Konsequenzen, die seine Hypothese nahe legt“ zurück, die Freud „zunehmend beunruhigten“.
„Weibliche Hysterie war weit verbreitet. Wenn seine Patientinnen die Wahrheit gesagt hatten
und seine Theorie stimmte, blieb nur die Folgerung, dass das, was er als ‚Perversion gegen
Kinder’ bezeichnete, weit verbreitet war.“(ebd.). Für diese These spricht der defensive
Aufbau des Vortrages Freuds, in dem er immer wieder Gegenargumenten vorgriff. Auch, dass
Freud in einem unveröffentlichten Brief an Fließ berichtete, der Vortrag habe „eisige
Aufnahme gefunden“ (Freud 2000/ 1896, S. 52) spricht für diese These .
Freuds Theorien und die von ihm entwickelte Psychoanalyse traten einen Siegeszug an. Seine
ursprünglichen Überlegungen zur Ursache der Hysterie ließen ihn jedoch nicht los. Im Abriss
der Psychoanalyse schrieb er 1938:
»Unsere Aufmerksamkeit wird zunächst von der Wirkung gewisser Einflüsse angezogen, die
nicht alle Kinder betreffen, obwohl sie häufig genug vorkommen, wie der sexuelle
Missbrauch durch Erwachsene.«
In der Folge von Freuds Äußerung 1897 wurde allerdings den Aussagen missbrauchter
Mädchen und Frauen meist nicht mehr geglaubt. 1907 schrieb Karl Abraham 1907: „...dass in
einer großen Anzahl von Fällen das Erleiden des sexuellen Traumas vom Unbewussten des
Kindes gewollt wird, dass wir darin eine Form infantiler Sexualbetätigung zu erblicken
haben“ Damit war schließlich das Opfer zur Täterin geworden, und es dauerte noch viele
Jahrzehnte, bis das Trauma des sexuellen Kindesmissbrauchs sowohl in der
psychoanalytischen Vereinigung wie auch gesamtgesellschaftlich anders betrachtet werden
konnte.
2.2. Weltkriege und Holocaust
10
Der erste Weltkrieg brachte eine neue Form der Kriegsführung in Form des Stellungskriegs in
endlos langen Schützengräben hervor.
Dort verloren Tausende ihr Leben durch die verbesserte Technik der Artillerie, ohne dass
nennenswerte Gewinne gemacht wurden. Dieser Stellungskrieg rief eine neue Art der
traumatischen Neurose hervor, die der britische Militärpsychiater Charles Samuel Myers als
Granatenschock „shell shock“ bezeichnete und im Deutschen als Schützengrabenneurose
bezeichnet wurde. Der Stellungskrieg im Schützengraben, bei dem die Soldaten kaum
Möglichkeiten zu Kampf oder Flucht, also den normalen Copingreaktionen, hatten, war
schließlich prädestinierend für die Entwicklung von Traumata.
Die Annahme, dass eine organische Ursache, hier eine durch eine molekulare Erschütterung
im Gehirn, welche durch eine im Gefecht erfolgte Detonation bedingt sei, die
unterschiedlichen Beschwerden der Soldaten hervorrufe, wurde zunächst noch nicht
aufgegeben. „Seitdem jedoch die Kriegsneurose auch bei Soldaten, die nie direkt
Gewehrschüssen ausgesetzt waren, festgestellt werden konnte, wurde langsam deutlich, dass
die Ursachen häufig rein emotionaler Natur waren“ (van der Kolk et al. 2000c, S. 72). Diese
Beobachtung bewegte Myers dazu, eine psychische Ursache für die unterschiedlichen
Beschwerden der Soldaten anzunehmen. Dabei betonte er „die große Ähnlichkeit zwischen
Kriegsneurose und Hysterie“ (van der Kolk et al. 2000c, S. 72). Nachdem jedoch bereits bei
der Behandlung der Hysterie mehr die Behandlung der Simulation als der Pathologie im
Vordergrund stand, geriet auch die Behandlung von Kriegs-Syndromen eher zu einem Kampf
gegen die Simulation. Aus dem Krieg heimgekehrte traumatisierte Patienten wurden als
Rentenneurotiker abqualifiziert. Man behauptete, bei Kriegsneurosen handele es sich um
„abnorme Reaktionen minderwertiger oder vorbelasteter Personen“. Man bezeichnete
Unfallneurosen als „Wunschreaktionen ohne Krankheitswert“, und die erkrankten Soldaten
galten als moralische Invaliden, als konstitutionell minderwertig oder als Feiglinge. Die
gesellschaftliche und medizinische Reaktion auf die Schrecken des Krieges war also eindeutig
verleugnend. Ein Beispiel dafür ist der deutsche Psychiater Emil Kraepelin, der als Begründer
der modernen empirisch orientierten Psychopathologie angesehen werden kann.
Er galt schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts als einer der europaweit einflussreichsten
Psychiater. Er schrieb 1915: »Ganz besonders reich an psychischen Ursachen des Irreseins ist
der Krieg. Der Grund liegt hauptsächlich in den dauernden Schädigungen durch tiefgreifende,
anhaltende gemütliche Erregung« (d.h. des Gemüts). Gleichzeitig sieht er jedoch bei einem
Drittel der sogenannten »Kriegszitterer« eine Belastung vonseiten der Eltern. 1916 setzten
sich Robert Gaupp und Karl Bonhoeffer bei einer Tagung der Militärpsychiater mit der
Meinung durch, dass die Kriegszitterer nicht unter den seelischen Belastungen des Krieges
litten (»shell shock«), sondern dass es sich bei ihnen um willensschwache Simulanten und
Feiglinge handele, die konstitutionell minderwertig seien. Sie wurden in
Militärkrankenhäusern so lange gequält, bis sie aufhörten zu zittern und wieder frontfähig
waren. Solche »heroischen« Therapien waren in ganz Europa und auch in den USA üblich.
Der britische Psychiater Lewis Yealland behandelte die »Hysteric Disorders of Warfare« mit
Elektroschocks.
Nach dem Ende des 1. Weltkrieges betrachteten Bonhoeffer und seine Kollegen sowohl
Kriegs- als auch Unfall-Neurosen als Wunschreaktionen bei asozialen, ethisch
minderwertigen und psychopathischen Persönlichkeiten. Die 1926 in Kraft getretene
Reichsversicherungsordnung sei die Ursache der Unfallneurosen, es handele sich demzufolge
um eine »Rentenneurose«.
Aussagen anderer Ärzte stützten die von Bonhoeffer geäußerten Thesen und bestimmten bis
in die 1970er-Jahre, also ca. fünfzig Jahre lang, in Deutschland und Österreich die
11
Gutachterpraxis vor allem dann, wenn es darum ging, finanziellen Ausgleich für erlittenes
Leid zu erhalten: Es gebe keine kausale Beziehung zwischen äußeren Ereignissen und
psychischen Folgen (Dansauer u. Shellworth1939), USA; Erlebnisreaktionen klängen nach
Fortfall der Belastung ab (Schneider 1946); die Belastungsfähigkeit der Seele läge im
Unendlichen (Hoff 1956). Mit diesen Kernaussagen einflussreicher Psychiater entstand die
Haltung, dass ein konstitutionell gesunder und normaler Mensch jede Belastung verkraftet,
ohne dadurch dauerhaft geschädigt zu werden. Erst 1961 setzte sich bei einer PsychiatrieTagung in Baden-Baden ansatzweise eine neue Lehrmeinung durch: Erlebnisbedingte
Persönlichkeitsänderungen seien das Resultat chronischer Belastung.
Dabei waren neue Impulse zur Beschäftigung mit Traumafolgen bereits während des Zweiten
Weltkriegs aus Amerika gekommen. Amerikanische MilitärpsychiaterInnen dem Thema der
durch den Kampfeinsatz induzierten Beschwerden wieder verstärkt zu. Ziel war, eine schnelle
und wirksame Behandlungsmethode für jene Soldaten zu entwickeln, welche mit
Stressreaktionen auf das Kampfgeschehen reagierten, damit sie schnell wieder im Krieg
eingesetzt werden konnten. Dabei erwiesen sich Methoden, die Stressreaktionen der Soldaten
nicht als ‚Feigheit’ o. ä. stigmatisierten, als effektiver. „Erstmals wurde anerkannt, dass jeder
Soldat zusammenbrechen konnte, psychiatrische Erkrankungen waren vorhersehbar in
Relation zur Heftigkeit der Kämpfe, die ein Soldat mitgemacht hatte“ (Lewis Herman 1994,
S. 40). Statt Soldaten zu stigmatisieren, fanden einerseits „differenzialdiagnostische
Merkmale der Frontpsychiatrie, nämlich das Prinzip der Nähe, der Unmittelbarkeit und der
Erwartung, an der Front Anwendung. Zum ersten mal wurden protektive Faktoren wie
Training, Zusammenhalt der Gruppe, Führung, Motivation und Moral untersucht“ (van der
Kolk et al. 2000c, S. 83). Außerdem wurden Behandlungsmethoden in Form von
Gruppentherapien entwickelt, die aber schon bald nicht mehr mit Kriegsveteranen, schon gar
nicht mit anderen Gruppen weiter praktiziert wurden (vgl. ebd.).
Abram Kardiner fasste die Ergebnisse der Arbeit mit Kriegsveteranen schon 1941 im Buch
„The Traumatic Neuroses of War“ zusammen. Er interpretierte die Folgen der Kriegsneurosen
als eine Überforderung der individuellen Anpassungsfähigkeit an die Kriegserfahrungen.
So kam es zu einer Wiederauferstehung des Konzepts der traumatischen Neurose.
Nach dem Ende des II. Weltkriegs wurden in den USA mehrere Konferenzen und Symposien
zur Erforschung der Folgen des Holocaust sowie des Atombombenabwurfs über Japan
ausgerichtet. Es zeigte sich, welche erstaunlichen Ähnlichkeiten in der Psychopathologie
zwischen den Holocaust-Opfern und den Opfern des Atombombenabwurfs von Hiroshima
bestanden. Dadurch festigte sich immer mehr die Überzeugung, dass massive seelische
Traumatisierungen zu deutlichen und oft anhaltenden Symptombildungen sowie zu
Persönlichkeitsveränderungen führen.
Nach dem zweiten Weltkrieg entwickelte sich eine neue Richtung der ‚Trauma- Forschung’.
Diese machte sich die Überlebenden der Shoa, insbesondere Überlebende von
Konzentrationslagerhaft zum Gegenstand.
Es konnte belegt werden, dass Überlebende von Konzentrationslagerhaft gegenüber der
Normalbevölkerung eine „erhöhte Mortalität und generelle somatische und psychiatrische
Morbidität“ (van der Kolk et al. 2000c, S. 84) aufwiesen. So wurde der Begriff des
„Konzentrationslagersyndroms“ (ebd.) oder „Survivor-Syndrome“ (Mehari 2001) verwendet.
Die unterschiedlichen Forschungen zum psychischen Schaden von (meist) jüdischen
Überlebenden der Shoa haben weniger Eingang in die psychiatrischen Diagnosekriterien
12
gefunden als die Untersuchungen zu Soldaten, die unter ihrer Beteiligung am Krieg und
Mittäterschaft im Krieg zusammengebrochen sind. Viele in der Arbeit mit Flüchtlingen und
politisch Verfolgten entwickelte Überlegungen beziehen sich auf Forschungsansätze, die im
Zusammenhang mit Shoa-Überlebenden entstanden. Als Forscher sind hier insbesondere
Bruno Bettelheim und Hans Keilson zu nennen.
Im deutschsprachigen Raum wurde dagegen, auch aus finanziellen Gründen wegen des
deutschen Wiedergutmachungsgesetzes, über viele Jahre hinweg die Haltung vertreten, dass
konstitutionell gesunde und normale Menschen jede psychische Belastung verkraften können,
ohne dadurch dauerhaft geschädigt zu werden. Dahinter standen natürlich massive finanzielle
Interessen angesichts der gigantischen Opferzahlen des II. Weltkriegs. So konnte Kurt
Schneider, auf den über mehrere Jahrzehnte wesentliche Sichtweisen psychischer
Erkrankungen zurückgingen, formulieren, dass schwere seelische Erschütterungen und
Belastungen zwar vorübergehend abnorme Erlebnisreaktionen hervorrufen, die aber einige
Zeit nach dem Vorfall der Belastung abklängen. Hielten diese Symptombildungen an, so
müsste man von einer psychopathischen Konstitution ausgehen. Wegen dieser Verschiebung
der Schuld auf das Opfer fragte 1964 schließlich der Psychoanalytiker Kurt Eissler: „Die
Ermordung von wie vielen seiner Kinder muss ein Mensch symptomfrei ertragen, um eine
normale Konstitution zu haben?“
2.3. Auf dem Weg zu modernen Sichtweisen
Im selben Jahr, also 1964, veröffentlichten die Psychiater Walter Ritter von Baeyer, Heinz
Häfner und Karl Peter Kisker das Buch „Psychiatrie der Verfolgten“, in welchem sie
eindrucksvoll darlegten, dass die bisher angewandten gutachterlichen Richtlinien nicht
ausreichten, um die gesundheitlichen Schäden der Holocaust- Überlebenden zu erfassen. Der
US-amerikanische Psychiater Robert Lifton legte 1965 eine Untersuchung von HiroshimaÜberlebenden und Korea-Soldaten vor, die gefoltert worden waren. Sie berichteten von ihrer
Überlebensschuld, von einer Aufspaltung der Persönlichkeit und von einem Gefühl des
»Todes mitten im Leben«. Lifton stellte große Ähnlichkeit mit Überlebenden des Holocaust
fest.
1967 fand in Kopenhagen ein psychoanalytischer Kongress statt, während dessen mutige
Analytiker wie der besagte Kurt Eissler, William Niederland und Henry Krystal die These
Freuds von der ausschließlichen Wirkung von Kindheitstraumata ablösten und vom »Survivor
Syndrome«, einer Folge von extremen Belastungen in jedem Lebensalter, sprachen. Henry
Krystal 1968: »Ich hoffe, dass wir viele unterschiedliche Gruppen berücksichtigen können, so
dass es möglich wird, eines Tages wertvolle Generalisierungen zu erzielen, die wir anwenden
können, um traumatisierte Individuen zu verstehen« (Übersetzung AK).
Krystals Hoffnung erfüllte sich tatsächlich. Die Auswirkungen des Vietnam- Krieges trugen
zu einer weiteren Entwicklung bei. Eine Million junger Amerikaner hatten unter der
Belastung dieses außerordentlich grausamen Krieges massive Symptome entwickelt.
Gleichzeitig wuchs durch die Frauenbewegung der 1970er-Jahre eine Sensibilisierung für das
enorme Ausmaß an innerfamiliärer sexueller Gewalt. Die Soziologinnen Ann Burgess und
Linda Holmstrom beschrieben 1974 die Ergebnisse ihrer Erhebungen im Boston City
Hospital. Darin beschrieben sie die Symptome von vergewaltigten Frauen, das „rape-traumasyndrome“ (Langkafel 2000, S.9). Sie stellten eine Ähnlichkeit fest zu den Symptomen von
Kriegsveteranen, insbesondere Flashbacks und Alpträumen. Sie brachten diese in
Zusammenhang mit Ergebnissen der Gerichtsmedizin aus Frankreich vom Ende des 19.
13
Jahrhunderts, der früheren Forschung zur Hysterie in der Salpêtrière sowie den frühen
Arbeiten Freuds (vgl. Lewis Herman 1994; Langkafel 2000; van der Kolk et al. 2000c).
1979 beschrieb die Psychologin Leonore Walker das „Misshandlungssyndrom“ (Lewis
Herman 1994, S. 50). Sarah Haley, eine der Personen, die am stärksten bei der Einführung der
PTSD als diagnostische Kategorie in die dritte Ausgabe des DSM- III beteiligt war, war
sowohl die Tochter eines Veteranen des Zweiten Weltkrieges, der an schwerer
‚Kriegsneurose’ litt, als auch selbst Inzestopfer und mit beiden Forschungsfeldern vertraut
(vgl. van der Kolk et al. 2000c).
In ihrem Buch „Die Narben der Gewalt“ von 1993 beschrieb Judith Herman detailliert die
Folgen früher Vernachlässigung und sexueller Gewalterfahrung.
In der Folge entwickelte sich ein Forschungsansatz, der die psychischen Folgen von
sexualisierter Gewalt thematisierte. Frauen machten zum ersten Mal systematisch die
psychischen Folgen sexualisierter Gewalt zum Thema. Zentral in den Diskussionen dieser
Forschungstradition war die Erforschung psychischer Folgen sowohl sexuellen Missbrauchs
in der Kindheit, als auch von Vergewaltigung erwachsener Frauen. Es wurde versucht, die
Leiden der Opfer sexualisierter Gewalt zu benennen und zu klassifizieren, therapeutische
Behandlungsansätze zu entwickeln, als auch das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Diese
Diskussionen fanden parallel zu Diskussionen um Kriegsveteranen statt (vgl. Lewis Herman
1994). Judith Herman schrieb zu der Parallelität der Symptome zwischen Kriegsneurosen und
sexueller Gewalt später in „Trauma and Recovery“: »Die Hysterie ist die Kriegsneurose des
Geschlechterkampfes.« Auch der Psychoanalytiker Leonard Shengold zog 1979 die Parallele
zwischen Holocaust und Missbrauch und Vernachlässigung in der Kindheit, indem er, wie
schon andere Autoren vor ihm, deren Auswirkungen als „Seelenmord“ bezeichnete.
Nachdem es jedoch in der bisherigen Geschichte der Traumatologie immer zu einer Dialektik
zwischen Beschäftigung mit dem Trauma und Abkehr davon gekommen war, wurde bereits
im gleichen Jahr in einer Abwehrbewegung die „False Memory Syndrom Foundation“
gegründet. Dazu gleich noch mehr.
1978 erschien „Stress Disorders Among Vietnam Veterans“ von Charles Figley, einem
Vietnam-Veteranen, der später Psychologie studierte und als ein Pionier der modernen
Psychotraumatologie gilt. Die Erkenntnisse über die Symptome von Kriegsveteranen, aber
auch von Vergewaltigungsopfern und die Symptome von Menschen, die in der Kindheit
sexualisierte Gewalt erleben mussten, wurden zusammengetragen, um das Diagnosebild der
PTSD zu entwickeln.
2.4 Die Entwicklung der PTSD im DSM und ICD
Die Impulse einer Entwicklung der PTSD als Diagnosekriterium gingen, wie wir gesehen
haben, von US- amerikanischen gesellschaftlichen Entwicklungen aus. Daher schlug sich dies
auch zuerst in dem US-amerikanischen Diagnostischen und Statistischen Manual (DSM)
nieder und fand erst zeitverzögert im ICD Berücksichtigung .
In den vorhergehenden klinischen Klassifikationssystemen existierten jedoch
Diagnosenbilder, die sich dazu eigneten, auf die Reaktionen auf Erfahrungen extremen Leides
angewendet zu werden.
14
Im ICD- 6 von 1948 existierte die Kategorie der ‚akuten situativen Fehlanpassung’. Darin
wurden „vorübergehende situationsunabhängige Syndrome ... als akute Reaktionen auf
überwältigende Belastungen definiert, die sich bei Menschen zeigten, die keine prämorbide
oder komorbide Psychopathologie aufwiesen“. Im ersten diagnostischen und statistischen
Manual (DSM-I), herausgegeben im Jahre 1952, existierte das Diagnosebild einer ‚Schweren
Belastungsreaktion’, welche „die Reaktionen auf Kriegserfahrung und zivile Katastrophen
berücksichtigte“. Dies geschah nicht zuletzt durch die Folgen des zweiten Weltkrieges. Das
DSM-II (1968) orientierte sich stark an den Ausführungen zu psychischen Störungen des
ICD-8 (1969), in denen eine ‚Anpassungsstörung’ beschrieben wurde. Im DSM-II wurde das
Diagnosebild einer ‚schweren Belastungsreaktion’ revidiert, und stattdessen eine
„Anpassungsstörung im Erwachsenenalter“ beschrieben. Hier wurde die Ursache einer
Reaktion auf schwere Belastung erheblich eingeschränkt auf „unerwartete Schwangerschaft,
Angst in Kampfhandlungen und das Erwarten der Todesstrafe“. Im 1977 erschienenen ICD-9
wurde das Kriterium einer ‚akuten Belastungsreaktion’ aufgenommen (vgl. Brett 2000).
Erst mit der Ausgabe des DSM- III von 1980 wurde das Diagnosebild einer PTBS im
heutigen Sinne eingeführt. „Damit wurde auf die Symptome der aus dem Vietnamkrieg
heimgekehrten Veteranen reagiert, die über Alpträume, Flashbacks und Übererregbarkeit
klagten“ (Liebermann et al. 2001, S. 13) . So wurde mit der PTBS ein psychiatrisches
Diagnosebild geschaffen, dass das Vorhandensein eines äußeren‚ traumatisierenden
Geschehens’ als Ursache für psychische Beschwerden wie Wiedererleben,
Vermeidungsverhalten, emotionales Betäubtsein und Übererregbarkeit kennzeichnet.
Politischer Druck von Vereinigungen der Vietnam-Veteranen, Kirchen, Kriegsgegnern und
Gesundheitsorganisationen sowie einer Gruppe von Forschern, die sich mit
Stressphänomenen in den NS-Konzentrationslagern, in Hiroshima, im Koreakrieg und im
Vietnamkrieg beschäftigt hatten (u.a. auch Lifton, Niederland und Krystal), führte zu diesem
Schritt. Die Diagnose PTBS im DSM-III bedeutete sowohl einen politischen Sieg als auch
eine Veränderung in der Sichtweise psychischer Störungen.
Zum ersten Mal haben politische Kräfte und das soziale Gewissen zur Entwicklung einer
Diagnose beigetragen, die die Schrecken einschließt, die Menschen anderen Menschen
bereiten können. Bei der gleichen Ausgabe des DSM wurde durch den Einfluss anderer
politischer Kräfte Homosexualität von der Liste der psychischen Krankheiten gestrichen. Es
überrascht daher nicht, dass die Kritik interessierter Kreise an den Verantwortlichen des DSM
aufrechterhalten wurde: Die Einbeziehung von PTBS und die Streichung von Homosexualität
seien mehr ein Verdienst der Politik als der Wissenschaft.
Die Einführung der PTSD als psychiatrische Diagnose initiierte eine große Anzahl
wissenschaftlicher Untersuchungen. Es entstanden Untersuchungen zu den psychischen
Folgen nach Naturkatastrophen, Banküberfällen, Schiffsunglücken, Geiselhaft, sexualisierter
Gewalt, Militäreinsätzen, KZ- Haft etc.
Ebenfalls Ende der Siebziger Jahre begann vor allem in den USA die Beschäftigung mit der
„Multiplen Persönlichkeitsstörung“ oder „Dissoziativen Identitätsstörung“, die schließlich in
der Diagnose der Dissoziativen Identitätsstörung ihren Niederschlag im DSM-III fand.
Das Konzept der dissoziativen Störung war lange Zeit in Vergessenheit geraten. Janet hatte
wie gesagt schon vor über 120 Jahren erkannt, dass die unter traumatischen Bedingungen
gemachten Erfahrungen nicht in den vorhandenen Erfahrungsschatz des Individuums
integriert werden können, sondern anders im Gedächtnis abgespeichert werden. Diese
15
Erfahrungen werden in dissoziierter und fragmentierter Form abgespeichert und sind der
willentlichen Kontrolle und Beeinflussbarkeit entzogen. Sie wirken jedoch eigendynamisch
weiter und zeigten sich zu Janets Zeit als sogenannte hysterische Symptome. (Ein Beispiel
dafür, wie auch Krankheitssymptome vom historischen oder kulturellen Umfeld beeinflusst
werden.) Das Konzept der Dissoziation verlor ab circa 1910 seine Erklärungskraft, so u. a.
durch die Einführung des Schizophreniebegriffs sowie durch die Dominanz
psychoanalytischer Erklärungsbemühungen mit dem Fokus auf triebbedingten, konflikthaften
intrapsychischen Prozessen anstelle realtraumatischer Erfahrungen. Erst in den 1970er Jahren
wurde das Konzept der dissoziativen Störung wiederentdeckt und zwar sowohl unter der
Anerkennung der epidemiologischen und klinischen Bedeutung kindlicher Traumatisierungen
wie der klinischen Relevanz von traumatischem Stress bei Kriegsveteranen des
Vietnamkriegs. Obwohl beide Opfergruppen sehr unterschiedlich sind, zeigen sie
übereinstimmend, dass spezifische psychische und körperliche Beschwerden wie
Gedächtnislücken oder Entfremdungserleben als Folgen traumatischer Erlebnisse verstanden
werden können.
1992, erfolgte schließlich auch im ICD-10 die Möglichkeit, posttraumatische
Belastungsstörungen und multiple Persönlichkeitsstörung zu diagnostizieren.
Es wurde jedoch gerade im Zusammenhang mit der letztgenannten Diagnose deutlich, dass
die Auswirkungen verschiedener Arten von Traumata sehr unterschiedlich und
unterschiedlich schwer waren. So wurde zwischen Typ-1-Traumata und Typ-2-Traumata
unterschieden, das heißt einmaligen oder kurz anhaltenden und mehrfache und über einen
längeren Zeitraum anhaltende Traumata. Daraus ergab sich der Versuch einer weiteren,
notwendigen Differenzierung.
Bessel van der Kolk war einer der Vorkämpfer für die Diagnose einer komplexen PTBS, die
als DESNOS (Disorder of extreme Stress not otherwise specified) 1994 Einzug in das DSM
hielt.
Im ICD findet sich dazu die »andauernde Persönlichkeitsveränderung nach Extrembelastung
(F 62.0)«. 1993 erschien das International Handbook of Traumatic Stress Syndrome mit 84
Artikeln aus aller Welt. Trauma wurde von nun an als »inescapable shock« definiert, als
unausweichlicher Schock. In Deutschland und Österreich benötigte man mehr als 50 Jahre im
Anschluss an den Zweiten Weltkrieg, um sich mit dem Traumathema und der Erforschung
von Traumafolgestörungen wissenschaftlich zu beschäftigen. Das zeigt, wie schwer es ist,
insbesondere kollektive traumatische Erlebnisse bewusst wahrzunehmen, anzuerkennen und
aufzuarbeiten. Dabei ist natürlich das Thema „kollektive Traumata“ eine eigene Abhandlung
wert. Traumata unterliegen häufig einer Sprachlosigkeit, der Tendenz des Vergessens sowie
einem Zwang der Wiederholung anstelle eines heilsamen Erinnerns.
Seit Beginn der 1990er-Jahre ist wie gesagt in dem Feld der Traumafolgestörungen und ihrer
Therapie seriöse Forschung und Praxis zu verzeichnen.
Auch die neuere Entwicklung war und ist nicht frei von Kontroversen. Während einerseits
parteiliche Opfertherapien entwickelt wurden, fand sich andererseits eine Gegenbewegung,
die nachweisen wollte, in wie vielen Fällen Therapeuten durch suggestive Beeinflussung bei
ihren Klienten Erinnerungen von Ereignissen sexueller Gewalt oder körperlicher
Misshandlung ausgelöst hätten, die tatsächlich nie stattgefunden hätten. Vom »False Memory
Syndrome« war die Rede, von falschen Erinnerungen. Oder: während einige Fachleute davon
ausgingen, dass natürlich auch Kinder und Jugendliche nach extremen Belastungen eine
16
posttraumatische Belastungsstörung entwickeln können, hielten sich andere an das DSM-III,
das die Störung nur bei Erwachsenen diagnostizierte.
Eine dritte, derzeit aktuelle Kontroverse betrifft die methodische Frage, wie viel
Stabilisierung erforderlich ist, bevor eine Auseinandersetzung mit traumatischem Material in
der Therapie geschehen sollte, ganz wenig oder sehr intensive. Hilft die Theorie der
Stabilisierung eher ängstlichen Therapeuten oder ist sie existenzieller Bestandteil der
Unterstützung von Selbstwirksamkeit bei Klienten?
Seitdem die posttraumatische Belastungsstörung in das DSM-III aufgenommen wurde, gab es
wohl bis heute keinen anderen Bereich in der klinischen Praxis, der Therapeuten mehr
herausgefordert hat, die Öffentlichkeit mehr fasziniert und mehr kontroverse Debatten
heraufbeschworen hat als die Behandlung von Traumata.
In den letzten Jahren hat es eine Vielfalt von Veröffentlichungen zu Psychotraumatologie und
Traumatherapie gegeben. Aufgrund der rasend schnellen Entwicklung und der Erforschung
der neurophysiologischen Hintergründe der Entstehung und Verarbeitung von Traumata
werden auch immer wieder neue therapeutische und beraterische Ansätze entwickelt.
Ulrich Sachsse, einer der prominentesten Vertreter der Psychotraumatologie im
deutschsprachigen Raum, stellt fest:
„Ein Blick in die Geschichte lehrt, nicht ungeduldig auf schnelle Lösungen zu hoffen, sondern
sich darauf einzustellen, auf welchen Konfliktfeldern man sich wird bewegen müssen, wenn
man sich diesem Themenkomplex widmet. Die Auseinandersetzung mit Traumatisierung ist
längst eine teils wissenschaftlich, teils engagiert-politisch, teils polemisch, teils
interessenbestimmt-tendenziös geführte Diskussion geworden – eine Diskussion allerdings,
die inzwischen niemand mehr nicht führen kann“.
In Gruppenarbeit die Diagnosekriterien nach ICD-10 DSM-IV und DSM-V vergleichen
lassen.
Diagnostische Kriterien für eine PTBS nach ICD-10
FürdieDiagnosenachICD‐10müssenfolgendeKriterienerfülltsein:
1 DerBetroffenewar(kurzoderlanganhaltend)einembelastendenEreignisvon
außergewöhnlicherBedrohungodermitkatastrophalemAusmaßausgesetzt,das
beifastjedemeinetiefeVerzweiflunghervorrufenwürde.
2 EsmüssenanhaltendeErinnerungenandastraumatischeErlebnisoderdas
wiederholteErlebendesTraumasinsichaufdrängendenErinnerungen
(Nachhallerinnerungen,Flashbacks,TräumenoderAlbträumen)odereineinnere
BedrängnisinSituationen,diederBelastungähnelnoderdamitin
Zusammenhangstehen,vorhandensein.
3 DerBetroffenevermeidet(tatsächlichodermöglichst)Umstände,diederBelastung
ähneln.
17
4 MindestenseinesderfolgendenKriterien(1.oder2.)isterfüllt:
1 eineteilweiseodervollständigeUnfähigkeit,sichaneinigewichtigeAspektedes
belastendenErlebnisseszuerinnern;oder
2 anhaltendeSymptomeeinererhöhtenpsychischenSensitivitätundErregung,wobei
mindestenszweiderfolgendenMerkmaleerfülltseinmüssen:
1 Ein‐undDurchschlafstörungen
2 erhöhteSchreckhaftigkeit
3 Hypervigilanz
4 Konzentrationsschwierigkeiten
5 ReizbarkeitundWutausbrüche
1 DieSymptomemüsseninnerhalbvonsechsMonatennachdembelastendenEreignis
(oderderBelastungsperiode)aufgetretensein.
HäufigsindzudemsozialerRückzug,einGefühlvonBetäubtseinundemotionaler
Stumpfheit,GleichgültigkeitgegenüberanderenMenschensowieeineBeeinträchtigung
derStimmung.
NimmtdieStörungübervieleJahreeinenchronischenVerlauf,isteineAndauernde
PersönlichkeitsänderungnachExtrembelastung(F62.0)zudiagnostizieren.
DSMIVKriterienvonPTBS
A.DiePersonwurdemiteinemtraumatischenEreigniskonfrontiert,beidemdiebeiden
folgendenKriterienvorhandenwaren:
1. DiePersonerlebte,beobachteteoderwarmiteinemodermehrerenEreignissen
konfrontiert,dietatsächlichenoderdrohendenTododerernsthafteVerletzung
odereineGefahrderkörperlichenUnversehrtheitdereigenenPersonoder
andererPersonenbeinhalteten.
2. DieReaktionderPersonumfassteintensiveFurcht,HilflosigkeitoderEntsetzen.
Beachte:BeiKindernkannsichdiesauchdurchaufgelöstesoderagitiertes
Verhaltenäußern.
B.DastraumatischeEreigniswirdbeharrlichaufmindestenseinederfolgendenWeisen
wiedererlebt:
1. WiederkehrendeundeindringlichebelastendeErinnerungenandasEreignis,die
Bilder,GedankenoderWahrnehmungenumfassenkönnen.
Beachte:BeikleinenKindernkönnenSpieleauftreten,indenenwiederholt
ThemenoderAspektedesTraumasausgedrücktwerden.
2. Wiederkehrende,belastendeTräumevondemEreignis.Beachte:BeiKindern
könnenbeängstigendeTräumeohnewiedererkennbarenInhaltauftreten.
3. HandelnoderFühlen,alsobdastraumatischeEreigniswiederkehrt(beinhaltet
dasGefühl,dasEreigniswiederzuerleben,Illusionen,Halluzinationenund
dissoziativeFlashback‐Episodeneinschließlichsolcher,diebeimAufwachenoder
beiIntoxikationenauftreten).
Beachte:BeikleinenKindernkanneinetraumaspezifischeNeuinszenierung
auftreten.
18
4. IntensivepsychischeBelastungbeiderKonfrontation
mitinternalenHinweisreizen,dieeinenAspektdestraumatischenEreignisses
symbolisierenoderanAspektedesselbenerinnern.
5. KörperlicheReaktionenbeiderKonfrontationmitinternalenoderexternalen
Hinweisreizen,dieeinenAspektdestraumatischenEreignissessymbolisieren
oderanAspektedesselbenerinnern.
C.AnhaltendeVermeidungvonReizen,diemitdemTraumaverbundensind,odereine
AbflachungderallgemeinenReagibilität(vordemTraumanichtvorhanden).
MindestensdreiderfolgendenSymptomeliegenvor:
1.BewusstesVermeidenvonGedanken,GefühlenoderGesprächen,diemitdemTrauma
inVerbindungstehen
2.BewusstesVermeidenvonAktivitäten,OrtenoderMenschen,dieErinnerungenandas
Traumawachrufen
3.Unfähigkeit,einenwichtigenAspektdesTraumaszuerinnern
4.DeutlichvermindertesInteresseoderverminderteTeilnahmeanwichtigen
Aktivitäten
5.GefühlderLosgelöstheitoderEntfremdungvonanderen
6.EingeschränkteBandbreitedesAffekts(z.B.Unfähigkeit,zärtlicheGefühlezu
empfinden)
7.GefühleinereingeschränktenZukunft(z.B.erwartetnicht,Karriere,Ehe,Kinderoder
normallangesLebenzuhaben)
D.AnhaltendeSymptomeerhöhtenArousals(vordemTraumanichtvorhanden).
MindestenszweiderfolgendenSymptomeliegenvor:
1.Schwierigkeitenein‐oderdurchzuschlafen
2.ReizbarkeitoderWutausbrüche
3.Konzentrationsschwierigkeiten
4.ÜbermäßigeWachsamkeit(Hypervigilanz)
5.ÜbertriebeneSchreckreaktion
E.DasStörungsbild(SymptomeunterKriteriumB,CundD)dauertlängeralseinen
Monat.
F.DasStörungsbildverursachtinklinischbedeutsamerWeiseLeidenoder
Beeinträchtigungeninsozialen,beruflichenoderanderenwichtigen
Funktionsbereichen.
Bestimme,ob:
Akut:WenndieSymptomewenigeralsdreiMonateandauern.
Chronisch:WenndieSymptomemehralsdreiMonateandauern.
Bestimmeob:
MitverzögertemBeginn:WennderBeginnderSymptomemindestenssechsMonate
nachdemBelastungsfaktorliegt.
DasStörungsbildlässtsichfrühestenseinenMonatnachdemtraumatischenEreignis
diagnostizieren.ZusätzlichzudenvorgestelltendreiSymptomkomplexen(hieralsB,C,
D)werdendissoziativeErlebnisweisen(B)erwähnt,diealszentraleReaktionsformin
traumatischenSituationenanzusehensindundindereinoderanderenFormbeifast
jederTraumatisierungauftreten.
19
DiagnostischeKriterienfüreinePTBSnachDSM‐5
FürdieDiagnosenachDSM‐5müssenfolgendeKriterienerfülltsein:
A.TraumatischesEreignis:
DiePersonwarmiteinemderfolgendenEreignissenkonfrontiert:Tod,tödlicher
Bedrohung,schwererVerletzung,angedrohterschwererVerletzung,sexuellerGewalt,
angedrohtersexuellerGewalt,undzwarineinerdernachfolgendenWeisen(mindestens
eine):
5 Direktausgesetzt
6 AlsAugenzeuge
7 Indirekt;erfahren,dasseinnaherVerwandterodereinFreundeinemtraumatischen
Ereignisausgesetztwar.WenndiesesEreigniseinTodesfallodereinetödliche
Bedrohungwar,dannmusstedieserbzw.diesedieFolgevonGewaltodereines
Unfallesgewesensein.
B.Wiedererleben
DastraumatischeEreigniswirdwiederkehrendwiedererlebtundzwarineinerder
nachfolgendenWeisen(mindestenseine):
3 Wiederkehrende,unfreiwilligeundeindringlichebelastendeErinnerungen(Kinder
älterals6JahrekönnendiesepotentiellinrepetitivemSpielausdrücken).
4 TraumatischeAlbträume(KinderkönnenAlbträumehaben,ohnedasssichderInhalt
direktaufdastraumatischeEreignisbezieht).
5 DissoziativeReaktionen(z.B.Flashbacks),inDauervariierendvoneinerkurzen
EpisodebiszumVerlustdesBewusstseins(Kinderkönnendastraumatische
ErlebnisimSpielnachstellen)
6 IntensiveroderlanganhaltenderStress,nachdemdiePersonandastraumatische
Erlebniserinnertwurde(unabhängigderUrsachefürdieErinnerung).
7 MarkantephysiologischeReaktion,nachdemdiePersoneneinemReizausgesetztwar,
dereinenBezugzumtraumatischenErlebnishat.
C.Vermeiden
AnhaltendesstarkesVermeidungsverhaltenvontraumaassoziiertenReizennachdem
traumatischenErlebnis(mindestenseines):
6 TraumaassoziierteGedankenoderGefühle
7 TraumaassoziierteexterneReize(z.B.Menschen,Orte,Unterhaltungen,Tätigkeiten,
ObjekteoderSituationen).
D.NegativeVeränderungenvonGedankenundStimmung
DienegativenVeränderungenvonGedankenundStimmungbegannenoder
verschlechtertensichnachdemtraumatischenErlebnis(mindestenszwei):
2 Unfähigkeit,sichanwichtigeMerkmaledestraumatischenErlebnisseszuerinnern
(normalerweisedissoziativeAmnesie;nichtaufgrundeinerKopfverletzung,
AlkoholoderDrogen)
3 Andauernde(undoftverzerrte)negativeAnnahmenvonsichselbstoderderWelt
(z.B.„Ichbinschlecht“,„DieganzeWeltistgefährlich“).
4 AndauerndeverzerrteVorwürfegegensichselbstodergegenandere,am
traumatischenErlebnisoderseinennegativenFolgenschuldzusein.
20
5 AndauerndenegativetraumaassozierteEmotionen(z.B.Angst,Wut,Schuldoder
Scham).
6 MarkantvermindertesInteressevonwichtigen(nichttraumaassozierten)Tätigkeiten.
7 DasGefühl,anderenfremdzusein(z.B.DistanziertheitoderEntfremdung)
8 EingeschränkterAffekt:andauerndUnfähigkeit,positiveEmotionenzuempfinden.
E.VeränderunginErregungundReaktionsfähigkeit
TraumaassoziierteVeränderungeninErregungundReaktionsfähigkeit,dienachdem
traumatischenErlebnisbegonnenodersichdanachverschlechterthaben(mindestens
zwei):
1 GereiztesoderaggressivesVerhalten
2 SelbstverletzendesoderleichtfertigesVerhalten
3 ErhöhteVigilanz
4 ÜbermäßigeSchreckreaktion
5 Konzentrationsschwierigkeiten
6 Schlafstörungen
F.Dauer
DasStörungsbild(alleSymptomeinB,C,DundE)dauertlängeralseinenMonat.
G.FunktionelleBedeutsamkeit
DasStörungsbildverursachtinklinischbedeutsamerWeiseLeidenoder
Beeinträchtigungeninsozialen,beruflichenoderanderenwichtigen
Funktionsbereichen.
H.Ausschluss
DieSymptomesindnichtdieFolgevonMedikamenten,Substanzeinnahmeoderanderen
Krankheiten.
ZuspezifizierenbeidissoziativenSymptomen:
ZusätzlichzurDiagnosekanneinePersonineinemhohenMaßeeinederbeiden
folgendenReaktionenzeigen:
1 Depersonalisation:DasGefühl,außerhalbdeseigenenKörperszuseinodervonsich
losgelöstzusein(z.B.dasGefühl,alsob„dasnichtmirpassiert“sei,oderin
einemTraumzusein).
2 Derealisation:DasGefühlvonUnrealität,DistanzoderRealitätsverzerrung(z.B."diese
Dingesindnichtreal").
ZuspezifizierenbeiverzögertemBeginndesKrankheitsbildes:Vollständige
DiagnosekriteriensindindenerstensechsMonatennachdemtraumatischenEreignis
nichterfüllt(einigeSymptomekönnen,abermüssennichtdirektnachdem
traumatischenEreignispräsentsein).
ImDSM‐IVistPTBSunterderKategoriederAngststörungen
aufgeführt,dadavonausgegangenwird,dassAngsteinHauptsymptomderPTSD
ausmacht.DiePTBSistinsechsdiagnostischeKriterien(A‐F)eingeteilt.Als
HauptmerkmalderPTSDwirdimDSM‐IV„dieEntwicklungcharakteristischer
SymptomenachderKonfrontationmiteinemextrementraumatischenEreignis“als
KriteriumAbenannt(DSM‐IV1996,S.487).KriteriumB,C,undDbeschreibendiefür
einePTSD„charakteristischenSymptome“(ebd.)desWiedererlebens,andauernder
21
VermeidungundAbflachungderallgemeinenReagibilitätsowieanhaltendeSymptome
deserhöhtenErregungsniveaus(vgl.ebd.).EswerdeneineVielzahlantraumatischen
Erfahrungen,diedirekterlebtwurden,beispielartigaufgeführt:
„kriegerischeAuseinandersetzungen,gewalttätigeAngriffeaufdieeigenePerson
(Vergewaltigung,körperlicherAngriff,Raubüberfall,Straßenüberfall),Entführung,
Geiselnahme,Terroranschlag,Folterung,Kriegsgefangenschaft,Gefangenschaftineinem
Konzentrationslager,Natur‐oderdurchMenschenverursachteKatastrophen,schwere
AutounfälleoderdieDiagnoseeinerlebensbedrohlichenKrankheit.BeiKindernsind
auchihremEntwicklungsstandunangemessenesexuelleErfahrungenohneangedrohte
odertatsächlicheGewaltalssexuelltraumatischeErfahrungzuwerten“(DSM‐IV1996,
S.487).
Alsindirekte,beobachteteEreignissewerden„dieBeobachtungeinerschweren
VerletzungodereinesunnatürlichenTodesbeieineranderenPersondurch
gewalttätigenAngriff,Unfall,KriegoderKatastrophe“(ebd.)benannt.Auch„Ereignisse,
diebeianderenMenschenauftraten,undvondenenmanerfahrenhat“(ebd.),werden
aufgeführt.Dazugehören„gewalttätige,persönlicheAngriffe,schwereUnfälleoder
schwereVerletzungen,dieeinemFamilienmitgliedodereinernahestehendenPerson
zugestoßensind,vomplötzlichen,unerwartetenTodeinesFamilienmitgliedsodereiner
nahestehendenPersonzuhörenoderzuerfahren,dassdaseigeneKindaneiner
lebensbedrohlichenKrankheitleidet“(ebd.).
Im‚Normalverlauf’beginnendieSymptomeinnerhalbdererstendreiMonatenachdem
extrembelastendenLebensereignis.DieBeschwerdenkönnenaberauchumMonate
odersogarJahreverzögerteintreten(vgl.ebd.S.490).
WennderBelastungsfaktornichtalsextrembelastendeinzustufenist,wiez.B.ein
VerlassenwerdenvomEhepartneroderderVerlustdesArbeitsplatzes,undeinePerson
mitdemSymptombildeinerPTBSreagiert,isteineAnpassungsstörungzu
diagnostizieren(vgl.ebd.).EineAkuteBelastungsstörung(F43.0)unterscheidetsich
voneinerPTSDv.a.durchdieDauerderBeschwerden.DasSymptombildmuss
„innerhalbvon4WochennachdemtraumatischenEreignisauftreten“(ebd.S.491)und
innerhalbdieservierWochenauchwiederremittieren.HaltendieSymptomelängerals
vierWochenan,„wirddieDiagnosevonakuterBelastungsstörunginPosttraumatische
Belastungsstoörungumgewandelt“(ebd.S.491).
Eswirdaktuelldiskutiert,obesnichtakkuraterwäre,siedendissoziativenStörungen
zuzuordnenodereineeigeneKategoriederBelastungsreaktionenzuschaffen,wieesim
ICD‐10erfolgtist(vgl.Liebermannetal.2001;vanderKolketal.2000
DiagnostischeKriterienfüreinePTBSnachDSM‐V
FürdieDiagnosenachDSM‐5VmüssenfolgendeKriterienerfülltsein:
A.TraumatischesEreignis:
DiePersonwarmiteinemderfolgendenEreignissenkonfrontiert:Tod,tödlicher
Bedrohung,schwererVerletzung,angedrohterschwererVerletzung,sexuellerGewalt,
angedrohtersexuellerGewalt,undzwarineinerdernachfolgendenWeisen(mindestens
eine):
8 Direktausgesetzt
9 AlsAugenzeuge
22
10
Indirekt;erfahren,dasseinnaherVerwandterodereinFreundeinem
traumatischenEreignisausgesetztwar.WenndiesesEreigniseinTodesfalloder
einetödlicheBedrohungwar,dannmusstedieserbzw.diesedieFolgevon
GewaltodereinesUnfallesgewesensein.
B.Wiedererleben
DastraumatischeEreigniswirdwiederkehrendwiedererlebtundzwarineinerder
nachfolgendenWeisen(mindestenseine):
8 Wiederkehrende,unfreiwilligeundeindringlichebelastendeErinnerungen(Kinder
älterals6JahrekönnendiesepotentiellinrepetitivemSpielausdrücken).
9 TraumatischeAlbträume(KinderkönnenAlbträumehaben,ohnedasssichderInhalt
direktaufdastraumatischeEreignisbezieht).
10
DissoziativeReaktionen(z.B.Flashbacks),inDauervariierendvoneinerkurzen
EpisodebiszumVerlustdesBewusstseins(Kinderkönnendastraumatische
ErlebnisimSpielnachstellen)
11
IntensiveroderlanganhaltenderStress,nachdemdiePersonandastraumatische
Erlebniserinnertwurde(unabhängigderUrsachefürdieErinnerung).
12
MarkantephysiologischeReaktion,nachdemdiePersoneneinemReizausgesetzt
war,dereinenBezugzumtraumatischenErlebnishat.
C.Vermeiden
AnhaltendesstarkesVermeidungsverhaltenvontraumaassoziiertenReizennachdem
traumatischenErlebnis(mindestenseines):
8 TraumaassoziierteGedankenoderGefühle
9 TraumaassoziierteexterneReize(z.B.Menschen,Orte,Unterhaltungen,Tätigkeiten,
ObjekteoderSituationen).
10
D.NegativeVeränderungenvonGedankenundStimmung
DienegativenVeränderungenvonGedankenundStimmungbegannenoder
verschlechtertensichnachdemtraumatischenErlebnis(mindestenszwei):
9 Unfähigkeit,sichanwichtigeMerkmaledestraumatischenErlebnisseszuerinnern
(normalerweisedissoziativeAmnesie;nichtaufgrundeinerKopfverletzung,
AlkoholoderDrogen)
10
Andauernde(undoftverzerrte)negativeAnnahmenvonsichselbstoderder
Welt(z.B.„Ichbinschlecht“,„DieganzeWeltistgefährlich“).
11
AndauerndeverzerrteVorwürfegegensichselbstodergegenandere,am
traumatischenErlebnisoderseinennegativenFolgenschuldzusein.
12
AndauerndenegativetraumaassozierteEmotionen(z.B.Angst,Wut,Schuldoder
Scham).
13
MarkantvermindertesInteressevonwichtigen(nichttraumaassozierten)
Tätigkeiten.
14
DasGefühl,anderenfremdzusein(z.B.DistanziertheitoderEntfremdung)
15
EingeschränkterAffekt:andauerndUnfähigkeit,positiveEmotionenzu
empfinden.
E.VeränderunginErregungundReaktionsfähigkeit
TraumaassoziierteVeränderungeninErregungundReaktionsfähigkeit,dienachdem
traumatischenErlebnisbegonnenodersichdanachverschlechterthaben(mindestens
zwei):
7 GereiztesoderaggressivesVerhalten
8 SelbstverletzendesoderleichtfertigesVerhalten
23
9 ErhöhteVigilanz
10
ÜbermäßigeSchreckreaktion
11
Konzentrationsschwierigkeiten
12
Schlafstörungen
F.Dauer
DasStörungsbild(alleSymptomeinB,C,DundE)dauertlängeralseinenMonat.
G.FunktionelleBedeutsamkeit
DasStörungsbildverursachtinklinischbedeutsamerWeiseLeidenoder
Beeinträchtigungeninsozialen,beruflichenoderanderenwichtigen
Funktionsbereichen.
H.Ausschluss
DieSymptomesindnichtdieFolgevonMedikamenten,Substanzeinnahmeoderanderen
Krankheiten.
ZuspezifizierenbeidissoziativenSymptomen:
ZusätzlichzurDiagnosekanneinePersonineinemhohenMaßeeinederbeiden
folgendenReaktionenzeigen:
3 Depersonalisation:DasGefühl,außerhalbdeseigenenKörperszuseinodervonsich
losgelöstzusein(z.B.dasGefühl,alsob„dasnichtmirpassiert“sei,oderin
einemTraumzusein).
4 Derealisation:DasGefühlvonUnrealität,DistanzoderRealitätsverzerrung(z.B."diese
Dingesindnichtreal").
ZuspezifizierenbeiverzögertemBeginndesKrankheitsbildes:Vollständige
DiagnosekriteriensindindenerstensechsMonatennachdemtraumatischenEreignis
nichterfüllt(einigeSymptomekönnen,abermüssennichtdirektnachdem
traumatischenEreignispräsentsein).
PosttraumatischeBelastungsstörungnachICD‐10
FürdieDiagnosenachICD‐10müssenfolgendeKriterienerfülltsein:
DerBetroffenewar(kurzoderlanganhaltend)einembelastendenEreignisvon
außergewöhnlicherBedrohungodermitkatastrophalemAusmaßausgesetzt,das
beifastjedemeinetiefeVerzweiflunghervorrufenwürde.
EsmüssenanhaltendeErinnerungenandastraumatischeErlebnisoderdas
wiederholteErlebendesTraumasinsichaufdrängendenErinnerungen
(Nachhallerinnerungen,Flashbacks,TräumenoderAlbträumen)odereineinnere
BedrängnisinSituationen,diederBelastungähnelnoderdamitin
Zusammenhangstehen,vorhandensein.
DerBetroffenevermeidet(tatsächlichodermöglichst)Umstände,dieder
Belastungähneln.
MindestenseinesderfolgendenKriterien(1.oder2.)isterfüllt:
‐eineteilweiseodervollständigeUnfähigkeit,sichaneinigewichtigeAspektedes
belastendenErlebnisseszuerinnern;oder
24
‐anhaltendeSymptomeeinererhöhtenpsychischenSensitivitätundErregung,
wobeimindestenszweiderfolgendenMerkmaleerfülltseinmüssen:
‐Ein‐undDurchschlafstörungen
‐erhöhteSchreckhaftigkeit
‐Hypervigilanz
‐Konzentrationsschwierigkeiten
‐ReizbarkeitundWutausbrüche
‐DieSymptomemüsseninnerhalbvonsechsMonatennachdembelastenden‐
Ereignis(oderderBelastungsperiode)aufgetretensein.
HäufigsindzudemsozialerRückzug,einGefühlvonBetäubtseinundemotionaler
Stumpfheit,GleichgültigkeitgegenüberanderenMenschensowieeineBeeinträchtigung
derStimmung.
NimmtdieStörungübervieleJahreeinenchronischenVerlauf,isteineAndauernde
PersönlichkeitsänderungnachExtrembelastung(F62.0)zudiagnostizieren.
UnterscheidungenzwischenDSM‐IVundDSM‐V
PTSDbeginswithastressor.Previously,thatstressorwasnarrowlydefinedashavingto
havebeenexperiencedorwitnessed.IntheDSM‐V,however,thestressorcriteriahave
beenbroadenedtoinclude:
Learnsthatthetraumaticeventoccurredtoaclosefamilymemberorclosefriend
(withtheactualorthreateneddeathbeingeitherviolentoraccidental)
Experiencesfirst‐handrepeatedorextremeexposuretoaversivedetailsofthe
traumaticevent(notthroughmedia,pictures,televisionormoviesunlesswork‐related)
MoreattentionintheDSM‐VisplacedonthesymptomsofPTSDratherthanonthe
immediatereactionoftheindividualuponexperiencingthestressor.Forthisreason,the
DSM‐Vhasoutlinedfourdistinctdiagnosticsymptomclustersinsteadofthree.The
symptomclustersofPTSDare:
Re‐experiencing(previouslycalled“intrusiverecollection,”)–involvesthe
persistentre‐experiencingoftheexperiencethroughthoughtsorperceptions,
images,dreams,illusionsorhallucinations,dissociativeflashbackepisodesor
intensepsychologicaldistressorreactivitytocuesthatsymbolizesomeaspectofthe
event.
Avoidance(previouslycalled“avoidant/numbing”)–involvesavoidanceofstimuli
thatareassociatedwiththetraumaandnumbingofgeneralresponsiveness.Thisis
determinedbyavoidanceofthoughts,feelings,orconversationsassociatedwiththe
eventand/oravoidanceofpeople,places,oractivitiesthatmaytriggerrecollections
oftheevent.
Negativecognitionsandmood(newintheDSM‐V)–involvesnegativealterations
inthoughtandmoodascharacterizedbysymptomslike:inabilitytorememberan
importantaspectoftheevent(s),persistentnegativeemotionalstate,persistent
inabilitytoexperiencepositiveemotionsandothers.
Arousal–(previouslycalled“hyper‐arousal”)–involvesalterationinarousaland
reactivity.Examplesofthisinclude:irritablebehaviorandangryoutbursts,reckless
orself‐destructivebehavior,hypervigilance,exaggeratedstartleresponse,
concentrationproblems,and/orsleepdisturbance.
LikeintheDSM‐IV,symptomsmustpersistforatleastamonth.UnliketheDSM‐IV,
however,theDSM‐VdoesnotseparateacutefromchronicphasesofPTSD.
25
TheDSM‐Vwillalsoincludetwonewsubtypes:
Preschoolsubtype–forchildrenlessthan6yearsold
PTSDwithprominentdissociativesymptoms–suchasbeingdetachedfromone’smind
orbody,orexperiencesinwhichtheworldseemsunreal,dreamlikeordistorted
3.1. Grundsätzliche Überlegungen zu den Diagnoseschemata
Mit der Aufnahme der PTSD in die klinischen Klassifikationssysteme für psychiatrische
Erkrankungen wird ein Symptombild beschrieben, welches den Zusammenhang von Gewalt
und menschlichem Leid anerkennt.
Die Einführung der PTSD als Diagnosebild eröffnet die Möglichkeit einer rechtlichen
Anerkennung des Leides. Dieses beinhaltet die Möglichkeit, Versicherungsleistungen,
Behandlungskosten, Rentenansprüche und Entschädigungsleistungen durchzusetzen. Mit der
PTSD im DSM-V wurde eine psychiatrische Diagnose erschaffen, die mit dem Kriterium A
eine ätiologische Grundvoraussetzung beinhaltet, nämlich das den Beschwerden
vorangehende traumatische Ereignis. Darin werden alle möglichen ‚traumatisierenden’
Lebensereignisse zu Ungunsten einer Berücksichtigung der unterschiedlichen Kontexte
nebeneinandergestellt. Im DSM- IV existiert lediglich ein einführender Hinweis auf
unterschiedliche ‚traumatisierende Lebensereignisse’, die einen kleinen gemeinsamen Nenner
haben. Gemeinsam ist diesen Erlebnissen, dass ein traumatisches Ereignis „eine Gefahr der
körperlichen Unversehrtheit für sich oder Andere“ (ICD- 10 1993, S. 22) darstellt.
Unterschieden wird aber in beiden klinischen Klassifikationssystemen nicht, ob eine Person
ein Erdbeben überlebt hat, eine lebensbedrohliche Krankheit diagnostiziert bekommt,
jahrelang von einer nahestehenden Person, zu der sie in einem Abhängigkeitsverhältnis steht,
sexualisierte Gewalt erfahren- oder im Kontext von Krieg Haft, Folter und Vertreibung erlebt
hat.
Die im ICD-10 und im DSM-IV formulierten Klassifikationskriterien der PTBS decken nicht
das Spektrum traumainduzierter Störungen ab. Es ist auch innerhalb der klinischen
Diskussion unumstritten, dass keineswegs alle Opfer extrem belastender bzw.
lebensbedrohender Lebensereignisse die Kernsymptomatik einer PTBS entwickeln, sondern
andere Symptombildungen im Vordergrund einer klinischen Diagnose stehen können. „Die
Posttraumatische Belastungsstörung ist eine mögliche Folgereaktion eines oder mehrerer
traumatischer Ereignisse“ (Langkafel 2000, S. 3, Herv. K.R.). Es besteht keine für alle
Menschen gleichermaßen geltende Reaktion auf extrem stressauslösende Lebensereignisse.
Mindestens für folgende Diagnosebilder wird diskutiert, dass sie zusätzlich zu einer PTBS
oder auch anstelle von einer PTSD mit einem extrem belastenden Lebensereignis in enger
Verbindung stehen bzw. von solchen Ereignissen ausgelöst werden:
„Akute posttraumatische Belastungsreaktion, dissoziative Störungen, dissoziative Amnesie,
dissoziative Fugue, Depersonalisierungsstörung, Dissoziative Identitätsstörung (“Multiple
Persönlichkeitsstörung”), Somatisierungsstörungen bzw. Konversionsstörungen, insb.
somatoforme Schmerzstörungen, posttraumatische Depression, Zwangserkrankungen,
Borderline Persönlichkeitsstörung, Angsterkrankungen, Essstörungen, insb. Bulimia nervosa,
Substanzmissbrauch“ (Wöller et al. 2001 et al. S. 25) Diese werden bei den Komorbiditäten
näher erläutert.
26
Die in anderen Kontexten getroffene Unterscheidung zwischen Man- Made- Desaster und
bspw. Naturkatastrophen, welche die Qualität der Leiden von Personen mitbestimmen, finden
keine Entsprechung im DSM- IV, auch nicht im ICD-10. Dieses erschwert die Benennung
gesellschaftlicher Implikationen unterschiedlicher Ursachen für das Leiden der Menschen. In
beiden Klassifikationssystemen wird nicht zwischen von (evtl. nahestehenden) Menschen
verursachten Traumatisierungen und ‚schicksalhaften’ Ereignissen (Naturkatastrophen,
Unfällen etc.) unterschieden.
So bewegt sich das PTSD- Diagnosebild in einem Spannungsfeld zwischen der Anerkennung
von Leiden und einer Pathologisierung und Stigmatisierung derer, die an durchaus
bestimmbaren und benennbaren Verhältnissen in einer Gesellschaft leiden. Die
Posttraumatische Belastungsstörung wird in den aktuellen Klassifikationssystemen zu einer
individualistischen Reaktion der betroffenen Person. Eine andere Umgangsweise wäre, sich
mit den auslösenden äußeren Ereignissen, sowie deren Bedeutung und gesellschaftlichem
Hintergrund auseinander zu setzen und so den konkreten Bezug des Individuums zur
konkreten Belastung herzustellen.
Traumatische Ereignisse und Erfahrungen führen beim Menschen zu einer nachhaltigen
Erschütterung seines Welt- und Selbstverständnisses (> Trauma). Die Reorganisation und
Restitution von Selbst- und Weltverständnis ist wesentlicher Bestandteil der spezifisch
menschlichen Traumaverarbeitung. Dieser Prozess folgt Gesetzmäßigkeiten, die sich bei
Tieren nicht identisch beobachten lassen, obgleich traumatogene Situationen im Tiermodell in
erstaunlicher Weise den menschlichen gleichen.
Die PTBS zeichnet sich insgesamt durch ein relativ klares und einfaches Zuordnungssystem
aus, was diagnostisch ein Vorteil ist. Aber es ist wohl eher zu eng als zu weit gefasst. Kritik
wurde wiederholt am Algorithmus (= Verrechnungssystem) des Syndroms geübt, z. B. an
dem Kriterium, dass für die Diagnose sowohl Intrusions- als auch Vermeidungssymptome
vorhanden sein müssen. In der Verlaufsbetrachtung der traumatischen Reaktion, erst recht
aber im traumatischen Prozess können die Phasen von Verleugnung und Intrusion zeitlich
alternieren. Manche Patienten sind vorübergehend sogar symptomfrei und entwickeln
Symptome erst bei einer situativen Neuauflage der traumatischen Erfahrung.
4. Neurophysiologische Erklärung widersprüchlicher Symptome
Offensichtlich gibt es bei den Symptomen des Psychotraumas scheinbar widersprüchliche
Symptome, nämlich die der Übererregung und die der Amnesie und Dissoziation.
Zu den Symptomen der Übererregung zählen Alpträume und Flashbacks, die zu den
quälendsten Traumasymptomen gehören. Sie können so weit gehen, dass sich der Betroffene
wieder in die Situation zurückversetzt fühlt und entsprechend agiert. Sie können zu
erheblichen Störungen im sozialen Funktionsniveau des Betroffenen führen.
Dissoziation und Amnesie
27
Dissoziation und Amnesie dienen dagegen der Abspaltung und Unterdrückung der quälenden
Erinnerung. Innerhalb der Dialektik von Auseinandersetzung und Abwehr kommt dem
Phänomen der Dissoziation eine herausragende Bedeutung zu. Dissoziation ist ein „TraumaCoping-Mechanismus“, der, wie Reddemann und Sachsse betonen, eingesetzt werde, wenn es
keine Möglichkeit zu Kampf oder Flucht gebe. („Coping“ ist ein Ausdruck aus der
Stresstheorie und bezeichnet Strategien zur Bewältigung von Stressphänomenen) Wilson
definiert Dissoziation als einen „Prozess, durch den bestimmte Gedanken, Einstellungen oder
andere psychische Aktivitäten ihre Relation zu anderen psychischen Aktivitäten bzw. zur
übrigen Persönlichkeit verlieren, sich abspalten und mehr oder minder unabhängig
funktionieren.“ (zit. nach Reddemann/Sachsse, 1997, S. 118). Am bekanntesten ist die Form
der Dissoziation, die manche Opfer als ein Heraustreten aus dem eigenen Körper beschreiben,
wodurch sie sich selbst von außen beobachten. Erich Fromm nannte die Dissoziation
dementsprechend eine „Spaltung zwischen beobachtendem Ich und erlebendem Ich“ (Fromm
1965). Vor allem missbrauchte oder misshandelte Kinder nutzen die Dissoziation als eine
Möglichkeit, unerträgliche Realitäten zu verlassen. Wie alle Traumasymptome kann sich auch
dieser ursprünglich schützende Mechanismus verselbständigen und zu dauerhaften Problemen
führen, indem jemand etwa später nach bestimmten Auslösereizen (den so genannten
„Triggern“) unwillkürlich die Realität verlässt und „dissoziiert“.
Kühner: Luise Reddemann und Ulrich Sachsse sehen diese entgegengesetzten Tendenzen als
funktionalen Bewältigungsprozess, durch den das Trauma „integriert“ werde. Wenn dieser
Bewältigungsprozess durch verschiedene externe oder interne Faktoren (z.B. der
Persönlichkeitsstruktur) erschwert oder gestört wird, komme es zu länger anhaltenden
Schwierigkeiten (vgl. Reddemann/Sachsse, 1997). Interessant ist, dass die Autoren dabei dem
sozialen Umfeld eine entscheidende Rolle zuweisen. In den Reaktionen der Umwelt, so
Reddemann und Sachsse, spiegeln sich meist ebenfalls die gleichen Impulse, nämlich
entweder zur aktiven Auseinandersetzung zu ermutigen („Sprich drüber, lass es raus“) oder
zur Verleugnung („Lenk dich ab“). In diesem Sinne kann man die unterschiedliche Intensität
von Auseinandersetzung bzw. Intrusion oder Verleugnung auch als Folge dessen
interpretieren, was ein bestimmtes soziales Umfeld nahe legt oder sogar ermöglicht. Dies ist
vor allem deshalb von Bedeutung, weil es der spontanen, naiven Annahme Außenstehender
widerspricht, ein Trauma sei umso schlimmer einzuschätzen, je deutlicher eine Person an
Intrusionssymptomen leidet. Das Gegenteil kann der Fall sein, nämlich, dass jemand sich
durch ein verlässliches Umfeld vorübergehend mehr „Intrusion“ leisten kann und sich dann
schneller erholt. Insgesamt gibt es dafür jedoch kaum feste Regeln.
Reddemann und Sachsse weisen darauf hin, dass es dann zu einer Störung des
Bewältigungsprozesses kommen kann, wenn dem Betroffenen von relevanten Anderen die
eigene Wahrnehmung abgesprochen wird. Insgesamt zeigen zahlreiche Untersuchungen die
eminente Bedeutung, die „soziale Unterstützung“ für die Erholung von einem traumatischen
Erlebnis hat.
Diese gegensätzlichen Phänomene erklären sich aber vor allem aus dem
neurophysiologischen Geschehen während der Traumatisierung.
In einer gefährlichen und potentiell traumatischen Situationen kommt es zu der
Copingkaskade des: „Freeze, Flight, Fight, Fright, Flag und Faint“, also des Erstarrens
(Innehaltens), Flüchtens, Kämpfens, Schreckens, Erschlaffens und der Ohnmacht.
(Zunächst erlaubt das „Halt-Schau-Horch“ (stop-look-listen) (Freeze) eine genaue
Wahrnehmung und Einschätzung der Bedrohung.
28
Pavlov bezeichnete diese spontane Reaktion 1927 als „Shto Eta) (Was ist es?) – ein Reflex,
der die Sinne auf die Reizquelle lenkt und der als Sammlung der körperlichen Reaktionen
betrachtet werden kann, die bei der Verarbeitung des Reizes helfen können. Dazu gehören die
Weitung der Pupillen, ein sinkender Hautwiderstand und ein vorübergehende Verlangsamung
des Herzschlags. Wenn der Reiz als Bedrohung wahrgenommen wird, wird eine
Alarmreaktion ausgelöst mit Erregung des Sympathikus.
Das ermöglicht es dem Organismus, der Gefahr entgegenzutreten. Der Herzschlag wird
beschleunigt, der Blutdruck steigt, und die Gefäße ziehen sich zusammen. Es kommt zur
Flucht (Flight) oder zum Kampf (Fight). Dabei ist zu beachten, dass hochgradig aversive
Stimuli, die nahe beim Organismus auftauchen, keine Orientierungsreaktion, sondern eher
einen Abwehrreflex auslösen. Zum Beispiel kommt eine sehr lautes und plötzliches Geräusch
höchstwahrscheinlich von einer nahen Gefahr und ruft eine erschreckte Reaktion hervor – die
Pupillen ziehen sich zusammen, und der Herzschlag beschleunigt sich. Dieser
Verteidigungsreflex beinhaltet Reaktionen, die dabei helfen, das Ereignis zu blockieren. Die
peritraumatische Panik erreicht ihren Höhepunkt in der Schreckensreaktion (Fright). Wird die
Angst überwältigend, bzw. kommt das Opfer in direkten Kontakt mit dem Täter oder seinen
Körperflüssigkeiten, kann das zu einer parasympathetischen Dominanz (Bradykardie (=
Herzfrequenz von < 60/Minute)führen, die einen Abfall des Blutdrucks und eine Weitung der
Blutgefäße bewirkt. Es kommt also zu einer vasovagal bedingten Reaktion der tonischen
Erschlaffung bzw. Immobilität (Flag), in der die Kontrolle über die äußeren Gliedmaßen und
die Stimme verloren geht. Dieser Zustand kann sogar übergehen in eine Ohnmacht (Faint).
Die Erschlaffungsreaktionen vergrößern die Überlebenschancen, wenn es scheinbar keine
Möglichkeit mehr gibt, zu entkommen oder den Kampf zu gewinnen.
Die tatsächliche Sequenz der traumabezogenen Reaktionen in extreme gefährlichen Situation
hängt vom subjektiven Gefühl der Bedrohung im Verhältnis zum eigenen
Handlungsvermögen ab. Da spielen Alter, das Geschlecht und Körperbau eine Rolle sowie die
vermeintlichen Eigenschaften des Angreifers bzw. der Gefahr. Daher variiert der Ablauf
dieser Kaskade von Mensch zu Mensch.
Der Körper, einschließlich des Gehirns, kann also mit Gefahr auf flexible und angepasste Art
umgehen. Im Gegensatz zur Homöostase, i. d. h. Der Fähigkeit des Organismus, einen
stabilen inneren Zustand zu erhalten, gibt es bei der Anpassung an Stresssituationen eine
erhebliche Flexibilität. Die Stresssituationen können eine Reihe von physischem Mangel wie
Kälte, Lärm, Nahrungs- oder Schlafentzug und Ähnliches enthalten oder sich auf wirkliche
oder vorgestellte Situationen von Angst beziehen und eine Alarm- oder
Herunterschaltreaktion auslösen. Diese können in einer entsprechenden Störung im
Traumaspektrum führen. Säugetiere und damit auch Menschen haben zur Abwehr
unangenehmer Reize ein Arsenal von Angriffs- und Verteidigungsmöglichkeiten. Selbst mit
kleinen Schlüsselreizen kann das Gehirn eine geeignete Möglichkeit aus der Kampf-FluchtEinfrieren-Ohnmachts-Verteidigungsskala (flight-fight-freeze-faint defense cascade)
aktivieren.
Eine evolutionäre Sichtweise legt nahe, dass diese Herunterschaltung (shutdown) das
Überleben in folgenden Situationen ermöglicht:
- Wenn der Organismus in direktem oder ganz naher Begegnung mit einem gefährlichen Täter
ist, bzw. wenn schon Hautkontakt besteht;
- In der Gegenwart von Körperflüssigkeiten und der Gefahr der Kontamination, z. B. mit Blut
oder Sperma;
29
- Wenn die körperliche Unversehrtheit schon verletzt ist oder bei drohender Verletzung, z. B.
sexueller Penetration, scharfen Gegenständen wie Zähne oder ein Messer an der Haut oder bei
medizinischen Prozeduren.
Diese Situationen erfordern physiologische Anpassungen wie Immobilität und Betäubung
gegenüber Schmerz, damit man sich tot stellen und weitere Verletzungen des eigenen
Gewebes vermeiden sowie totale Unterwerfung signalisieren kann.
Damit einher geht ein Umschalten im Bewusstsein, in der Informationsverarbeitung und im
Verhalten, das von außen seltsam erscheinen mag, weil es außerhalb des gewöhnlichen
Erfahrungsbereichs liegt.
Evolutionsbiologisch macht dieser Totstellreflex Sinn, weil man bei Raubtieren und Opfern
beobachten kann, dass die Attacken des Angreifers nachlassen, wenn sich das Opfer nicht
mehr wehrt. Oft lässt es dann sogar von ihm ab. Gegenwehr in einer Lage, in der man
offensichtlich schon besiegt ist, wäre also in der Regel kontraproduktiv. Deswegen sorgt der
Organismus dafür, dass diese nicht stattfinden kann. Die Art der Traumafolgestörung, bzw.
ihre Symptome, hängen wiederum von der Art der Traumatisierung ab bzw. lassen darauf
schließen, wie groß die gefühlte Bedrohung war, ob die Gefahr als „hautnah“ erlebt wurde, ob
die Körperbarriere verletzt wurde, bzw. der Täter in irgendeiner Form in den Opfer des
Körpers eingedrungen ist oder nicht.
5. Prävalenz
Mit welcher Vorsicht Angaben zur Prävalenz zu genießen sind, zeigt folgende Geschichte.
Zwischen dem DSM III und dem DSM IV hat man versucht, die Definition für Trauma, die es
da gab, zu verändern. Zur Überprüfung einer ersten Veränderung wurde ein Test in einer
amerikanischen Großstadt gemacht, und es wurde festgestellt, dass nach der neuen Definition
55 Prozent der Leute in dieser Stadt traumatisiert waren. Man folgerte aus dieser hohen
Prävalenz, dass diese Traumadefinition nicht benutzt werden konnte. Also wurden die
Kriterien wieder eingeengt, damit es nicht mehr 55 Prozent sind. Das Problem ist also eines
der Definition.
50 bis 90 Prozent der Erwachsenen und Kinder in den USA erleben in ihrem Leben ein
Trauma, zumeist im Kontext eines Verkehrsunfalls, welches aber nicht unbedingt zu einer
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) führen muss. Die lebenszeitliche Prävalenz
einer PTBS liegt bei etwa 8 %, kann aber bei exponierten Personen wie Rettungskräften,
Ärzten, Polizisten, Soldaten oder Flüchtlingen auf über 50 % ansteigen. Missbrauch führte
laut einer deutschen Stichprobe in 30 % der Fälle zur Entwicklung einer PTBS,
Vergewaltigung bei jedem zweiten davon Betroffenen.
Nach Guido Flatten und Arne Hofmann 2001 liegt die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine
PTBS nach politischer Haft und Verfolgung deutlich höher als hier angegeben, nämlich bei
50–70 %. Allerdings legen diese Autoren andere Kriterien für die Diagnose an, als von der
Weltgesundheitsorganisation gefordert.
Laut einer Studie von 2004 führen Kampfsituationen bei Soldaten zu 38,8 % zu der
Ausbildung einer PTBS. Nach den Erfahrungen des Vietnamkrieges musste man mit Quoten
von mehr als 30 % der Kombattanten rechnen.
30
6. Differenzialdiagnostik
Es soll beachtet werden, dass komorbide Störungen bei der Posttraumatischen
Belastungsstörung eher die Regel als die Ausnahme sind. Deswegen wird die PTBS häufig
übersehen, insbesondere wenn das traumatische Ereignis schon länger zurückliegt.
Das ICD- 10 weist eine größere Variationsbreite des Diagnosebildes der
posttraumatischen Störungsbilder auf, als das DSM-IV. Diagnostiziert werden kann,
wie nach DSM- IV eine Akute Belastungsreaktion (F.43.0) , eine Posttraumatische
Belastungsstörung (F43.1), darüber hinaus aber auch eine Andauernde
Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung (F 62.0) (vgl. ICD- 10, Kap. V. 1993).
Ebenfalls sind im ICD-10 die PTBS und die akute Belastungsreaktion
gemeinsam mit einer Anpassungsstörung (F 43.2), die ähnliche Symptome
beschreibt, aber kein ‚traumatisches Ereignis’ voraussetzt unter „Reaktionen auf schwere
Belastungen und Anpassungsstörungen“ ( ICD- 10, Kap. V, 1993 S. 22) klassifiziert worden.
In der Einleitung zu dieser Kategorie wird darauf verwiesen, dass sich die „Störungen dieses
Abschnittes [...] von den übrigen nicht nur aufgrund der Symptomatologie und des Verlaufs
[unterscheiden, K.R.], sondern auch durch die Angabe von ein oder zwei ursächlichen
Faktoren: ein außergewöhnlich belastendes Lebensereignis, das eine akute Belastungsreaktion
hervorruft, oder eine besondere Veränderung im Leben, die zu einer anhaltend unangenehmen
Situation geführt hat und eine Anpassungsstörung hervorruft“ (ebd.). Weiter wird darauf
hingewiesen, dass schwere Lebensereignisse oder Situationen auch den Beginn und Verlauf
„zahlreicher anderer Störungen [...] auslösen und beeinflussen können“ (ebd.), die Ursache
der Entwicklung von psychiatrischen Störungen sei allgemein „nicht immer ganz klar“ (ebd.).
Hier taucht die von PraktikerInnen immer wieder aufgeworfene Frage danach auf, was
eigentlich traumatisch sein kann und was nicht.
Verwandte Störungsbilder sind also:
Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F4)
Akute Belastungsreaktion ICD10: F 43.0
Anpassungsstörung ICD10: F 43.2
Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung ICD10: F 62.0
Dissoziative Störungsbilder F 44
Die Unterscheidung zur PTBS liegt im katastrophischen Ausmaß des Ereigniskriteriums
begründet, das bei der PTBS am stärksten ausgeprägt ist. Bei den beiden anderen
Störungsbildern ist die subjektive Disposition der Patienten stärker ausgeprägt.
6.1. Verwandte Störbilder
Akute Belastungsstörung
Bei einer akuten Belastungsreaktion handelt es sich um:
„Eine vorübergehende Störung, die sich bei einem psychisch nicht manifest gestörten
Menschen als Reaktion auf eine außergewöhnliche physische oder psychische Belastung
entwickelt, und die im allgemeinen innerhalb von Stunden oder Tagen abklingt. Die
31
individuelle Vulnerabilität und die zur Verfügung stehenden Bewältigungsmechanismen
(Coping- Strategien) spielen bei Auftreten und Schweregrad der akuten Belastungsreaktionen
eine Rolle. Die Symptomatik zeigt typischerweise ein gemischtes und wechselndes Bild,
beginnend mit einer Art von ‚Betäubung’, mit einer gewissen Bewusstseinseinengung und
eingeschränkten Aufmerksamkeit, einer Unfähigkeit, Reize zu verarbeiten und
Desorientiertheit. Diesem Zustand kann ein weiterer Rückzug aus der Umweltsituation folgen
(bis hin zu dissoziativem Stupor, siehe F44.2) oder aber ein Unruhezustand und Überaktivität
(wie Fluchtreaktion oder Fugue). Wir finden hier also ganz ähnliche Symptome wie bei der
PTBS.
Vegetative Zeichen panischer Angst wie Tachykardie, Schwitzen und Erröten treten zumeist
auf. Die Symptome erscheinen im Allgemeinen innerhalb von Minuten nach dem belastenden
Ereignis und gehen innerhalb von zwei oder drei Tagen, oft innerhalb von Stunden zurück.
Teilweise oder vollständige Amnesie (siehe F44.0) bezüglich dieser Episode kann
vorkommen. Wenn die Symptome andauern, sollte eine Änderung der Diagnose in Erwägung
gezogen werden. [...]“ (ICD- 10, Kap. V, 1993, S. 22), nämlich in PTBS.
„Bei der akuten Belastungsreaktion handelt es sich um Zustände von subjektiver Bedrängnis
und emotionaler Beeinträchtigung, die im allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen
behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden
Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten. Die Belastung kann
das soziale Netz des Betroffenen beschädigt haben (wie bei einem Trauerfall oder
Trennungserlebnissen) oder das weitere Umfeld sozialer Unterstützung oder soziale Werte
(wie bei Emigration oder nach Flucht). Sie kann auch in einem größeren Entwicklungsschritt
oder einer Krise bestehen (wie Schulbesuch, Elternschaft, Misserfolg, Erreichen eines
ersehnten Zieles und Ruhestand). Die individuelle Prädisposition oder Vulnerabilität spielen
bei dem möglichen Auftreten und bei der Form der Anpassungsstörung eine bedeutsame
Rolle – genau wie bei der PTBS - ; es ist aber dennoch davon auszugehen, dass das
Krankheitsbild ohne die Belastung nicht entstanden wäre. Die Anzeichen sind unterschiedlich
und umfassen depressive Stimmung, Angst oder Sorge (oder eine Mischung von diesen).
Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den alltäglichen Gegebenheiten nicht
zurechtzukommen, diese nicht vorausplanen oder fortsetzen zu können. Störungen des
Sozialverhaltens können insbesondere bei Jugendlichen ein zusätzliches Symptom sein.
Hervorstechendes Merkmal kann eine kurze oder längere depressive Reaktion oder eine
Störung anderer Gefühle und des Sozialverhaltens sein“ (ICD- 10, Kap. V, 1993, S. 22).
Anpassungsstörung
Im DSM wird zwischen akuter und chronischer Anpassungsstörung unterschieden. Bei
ersterer dauert die Störung weniger als sechs Monate, bei letzterer sechs Monate oder länger.
Die Anpassungsstörung kann einhergehen entweder mit einer depressiven Stimmungslage
oder einer ängstlichen, ferner mit einer Mischung aus Angst und Depression, mit
Verhaltensstörungen oder einer Mischung von Verhaltens- und emotionalen Störungen.
Personenverluste bilden eine Ausnahme, wenn die Reaktion eine über das erwartbare Maß an
Trauer und Bedrückung hinaus, so kann eine Anpassungsstörung im Sinne einer
pathologischen Trauerreaktion diagnostiziert werden.
Differentialdiagnostisch zum PTBS ist der Zeitraum bedeutsam, in dem sich die Störung
manifestiert. Während PTBS Monate oder auch Jahre nach dem belastenden Ereignis
auftreten kann, tritt die Anpassungsstörung innerhalb von drei Monaten im Anschluss darauf
auf und dauert nicht länger als 6 Monate an, gerechnet ab dem Zeitpunkt der traumatischen
32
Erfahrung. Nach diesem Kriterium können sich beide Störungsbilder zeitlich überschneiden.
So kann es sein, dass eine gegenwärtige Anpassungsstörung in Wirklichkeit die Reaktion auf
eine längere Zeit zurückliegende traumatische Erfahrung darstellt und so den Kriterien des
PTBS entspricht.
Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung ICD10: F 62.0
Die umfangreichen Folgen, einer durch Traumatisierung gestörten Persönlichkeitsentwicklung, werden aktuell unter den Begriffen „Komplexe Traumafolgestörung“,
„Developmental Trauma Disorder“ oder „Komplexe Präsentation einer Posttraumatischen
Belastungsstörung“ diskutiert.
Eine Andauernde Persönlichkeitsstörung nach Extrembelastung (F62.0) wird definiert als:
„Eine andauernde, wenigstens über zwei Jahre bestehende Persönlichkeitsänderung kann
einer Belastung katastrophalen Ausmaßes folgen. Die Belastung muss extrem sein, so daß die
Vulnerabilität der betreffenden Person als Erklärung für die tiefgreifende Auswirkung auf die
Persönlichkeit nicht in Erwägung gezogen werden muss. Die Störung ist durch eine feindliche
oder misstrauische Haltung gegenüber der Welt, durch sozialen Rückzug, Gefühle der Leere
oder Hoffnungslosigkeit, ein chronisches Gefühl der Anspannung wie bei ständigem
Bedrohtsein und Entfremdungsgefühl, gekennzeichnet. Eine Posttraumatische
Belastungsstörung (F43.1) kann dieser Form der Persönlichkeitsänderung vorausgegangen
sein. Persönlichkeitsänderungen nach:
• andauerndem Ausgesetztsein lebensbedrohlicher Situationen, etwa als Opfer von
Terrorismus;
• andauernder Gefangenschaft mit unmittelbarer Todesgefahr;
• Folter;
• Katastrophen;
• Konzentrationslagererfahrungen [...]“ (ICD 10, Kap. V 1993 S. 33)“
Dissoziative Störungsbilder F 44
Dissoziative Störungen gelten heute als typische Folge schwerer komplexer Traumatisierung,
ein Zusammenhang, den wie gesagt schon Pierre Janet erkannt hatte. Bei ‚Dissoziation’ wird
allgemein zwischen Gelegenheitsdissoziation, peritraumatischer Dissoziation und
dissoziativen Störungen unterschieden. Gelegentliche ‚Geistesabwesenheit’ wie
Fehlleistungen zählen zur ersten Kategorie, peritraumatische Dissoziationen, wie
Derealisation, Depersonalisation oder Veränderung des Zeiterlebens treten in der
traumatischen Situation auf, während die dissoziativen Störungen als Folge traumatischer
Prozesse zu verstehen sind. Bei den dissoziativen Störungen werden neuronalen Netzwerke
unterbrochen, welche Emotion, Kognition und Erinnerung verknüpfen. So entsteht das
Phänomen von abrupten Zustandswechseln (Switching), das für Außenstehende und die
Betroffenen selbst mit dem Effekt einer Drehbühne vergleichbar ist. Das „Switchen“ der
Erlebniszustände, der abrupte Wechsel, kann auf die Reizüberflutung in der traumatischen
Situation zurückgeführt werden. Es dient einer Segmentierung des traumatischen Erlebens in
gerade noch erträgliche Einheiten und ist insofern als Überlebenstechnik zu verstehen.
Psychogene Amnesien (F.44.0) unterbrechen die Erinnerung, bei dissoziativen Fuges (F44.1)
wird die Fluttendenz der ‚unterbrochenen’ Fight-Flight-Reaktion reaktiviert, und die Patienten
33
finden sich an einem anderen Ort wieder, oft ohne zu wissen, wie sie dorthin gekommen sind.
Der ‚dissoziative Stupor’ (F44.2) entspricht dem Totstellreflex, der in der traumatischen
Situation ausgelöst wurde, im Traumaschema gespeichert ist und durch Stimuli reaktiviert
werden kann, die an die traumatische Erfahrung erinnern.
Dissoziative Krampfanfälle (F44.4) reaktivieren nach Robert Bering die Gegenwehr in der
traumatischen Situation. Durch Bewusstlosigkeit ist der sensorische Flügel des
Traumaschemas abgekoppelt, und der motorische Flügel automatisiert die Abwehrreaktion.
Das Vorhandensein eines psychotraumatischen Hintergrundes muss differenzialdiagnostisch
zur Abgrenzung von Epilepsie beachtet werden. Bei den dissoziativen Sensibilitäts- und
Empfindungsstörungen (F44.6) sind neben psychogenen Sehstörungen auch dissoziativer
Tinnitus und Schmerzsyndrome zu erwähnen. Beides kann hypothetisch auf die
Reaktivierung des Traumaschemas zurückgeführt werden.
Die Voraussetzungen zum Verständnis der geheimnisvoll anmutenden, diagnostisch lange
Zeit übersehenen ‚dissoziativen Identitätsstörung’ (F44.7) wurden in diesem Kapitel schon
ausführlich erarbeitet. Sie tritt in der Folge von schwerer fortgesetzter körperlicher und
sexueller Misshandlung und Folter auf, häufig verbunden mit Ritualisierung in einer Sekte.
Obwohl die Betroffenen selbst oft von Teilpersönlichkeiten sprechen, die abwechselnd ihr
bewusstes Erleben und Verhalten beherrschen, handelt es sich nicht um wirkliche
Teilpersönlichkeiten, sondern verselbständigte und aus ihrer gegenseitigen Verbindungen
‚entkoppelte’ Erlebniszustände. Obwohl deren gegenseitiger Zusammenhagn subjektiv
unbewusst geworden ist, lässt er sich als ‚unbewusst-intentional’ rekonstruieren.
6.2. Komorbiditäten
Differentialdiagnostische Kriterien sind vor allem gegenüber solchen Störungen von
Interesse, die Ähnlichkeit oder Überschneidungen mit den psychotraumatischen Syndromen
aufweisen. Gleichzeitig kann ein Patient jedoch auch unter beiden Störungen leiden. Diesen
letzteren Fall bezeichnen wir als Ko-Morbidität, als gleichzeitiges Auftreten zweier
Krankheiten.
Neben der schon erwähnten Anpassungsstörung überschneidet sich das PTBS jeweils in
einigen Symptomen mit Depression, Schizophrenie, Angststörungen, antisozialer und
Borderline- Persönlichkeitsstörung. Die Ähnlichkeit einiger Symptome mit psychotischem
Erleben hatte nach Arnold (1985) dazu geführt, dass nicht wenige Vietnamveteranen mit
PTBS die Diagnose ‚paranoide Schizophrenie’ erhielten. Ihre intrusiven Erinnerungsbilder
wurden als Halluzinationen bewertet und die erhöhte Wutbereitschaft der ehemaligen
Soldaten auf paranoide Ideen zurückgeführt. Das Beispiel kann verdeutlichen, wie häufig vor
Entwicklung der Psychotraumatologie Traumaopfer als schwer ‚gestört’, evtl. als psychotisch
eingestuft wurden.
Wegen der Dissoziationen und der Flashbacks wird, wie gesagt, mitunter fälschlich
Schizophrenie diagnostiziert. Ein differenzialdiagnostistisches Kriterium dazu ist jedoch der
Inhalt der dissoziierten Rückblenden und Erinnerungsbilder. Während diese beim PTBS die
traumatischen Erfahrungen ausdrücken, lassen sich die schizophrenen Halluzinationen meist
mit keiner konkreten Erfahrung in Zusammenhang bringen. Andererseits kann eine
psychotische Episode selbst ein traumatisches Ereignis für den Betroffenen im Sinne der
DSM IV-Kriterien darstellen. Eine Studien konnte bei annähernd der Hälfte von 36 stationär
behandelten Patienten ein PTBS nachweisen, das sich in der Erholungsphase nach dem
psychotischen Erleben entwickelte.
34
Da sich eine PTBS mit möglicherweise sogar jahrzehntelanger Verspätung zeigen kann, sind
häufiger komorbide Pathologien früher sichtbar. Das kann in der Form einer Drogensucht
oder einer Depression sein.
Zu den häufigen Komorbiditäten zählen:
Affektive Störungen F 32, 33, 34
Bei den affektiven Störungen (F3 nach ICD) stehen Manie und Depression im Vordergrund.
Vor allem bei ‚bipolarem’ Wechsel von Manie und Depression kann das ‚Drehbühnenmodell’
zum Verständnis beitragen. Soweit traumatische Belastungen im Hintergrund stehen, hat sich
vor allem sexueller Kindesmissbrauch durch nahestehende Personen als bedeutsam erwiesen.
Dabei spiegeln die manischen Erlebniszustände z. T. die Stimmungslage des ‚Allmächtigen’,
grenzüberschreitenden Erwachsenen wieder, einen ‚Täter-state’, während in den depressiven
zuständen vor allem die Schuldgefühle und Selbstvorwürfe dominieren, die sich das
missbrauchte Kind für seinen Missbraucht macht (Selbstbeschuldigung der Opfer).
Mit der Major Depression im DSM IV überschneiden sich folgende Symptome:
Verlust von Interesse an Aktivitäten, Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen. Die
Differenzialdiagnose ist hier schwierig, da sich eine depressive Stimmungslage auch aus den
verbreiteten Phänomenen des Schuldgefühls, evtl. der Überlebendenschuld bei Traumaopfern
ableiten lässt. Ein differenzielles Kriterium ist das Vorkommen prätraumatischer depressiver
Episoden. Co-Morbiditäten zwischen Depression und psychotraumatischen Störungsbildern
werden relativ häufig diagnostiziert.
Typische disponierende Belastungsfaktoren für schwere Depressionen sind Vertreibung und
Migration sowie die Schwerstpflege und Sterbebegleitung naher Angehöriger. Heimatverlust,
Gefühle der ‚Entwurzelung’ und Schuldgefühle wegen des Todes der Pflegeperson scheinen
besonders die suizidalen Tendenzen zu fördern. Belastungen in der Kindheit, wie Gewalt oder
Missbrauch , bringen vor allem dann eine depressive Entwicklung im späteren Leben hervor,
wenn sie bei den Kindern und Jugendlichen mit dem Gefühl von schutzloser Preisgabe
einhergingen.
Substanzabhängigkeit F 1
Der Alkohol- oder anderer Suchtmittelgenuss soll die traumatische Angst und die intrusiven
Erinnerungsbilder unter Kontrolle bringen, was sich als eine Form der Selbstmedikation
verstehen lässt. Des weiteren stellt die Einnahme von Drogen oder Alkohol eine Möglichkeit
dar, Kontakt mit der Umgebung aufzunehmen, ohne jedoch zu große beängstigende Nähe
entstehen zu lassen. Die Suchtmittel werden also im Sinne eiiner Wiederherstellung von
Wahrnehmungs- und/oder Handlungskontrolle verwendet. Oft findet sich in der Familie
solcher Menschen bereits ein Suchthintergrund, der die Bevorzugung dieser Form der
Traumaverarbeitung begünstigt.
Auch mit Alkoholabusus ist eine erhöhte Co-Morbiditätsrate gegeben, die u. a. auf die
Versuche von Traumapatienten zur Selbstmedikation zurückzuführen ist. Alkohol kann
35
Alpträume unterdrücken, das Erregungsniveau des autonomen Nervensystems reduzieren und
nichttraumatische Phantasien fördern. Alkoholgenuss in begrenzter Menge kann als am
Beginn der traumatischen Erfahrung die psychische Abwehr stärken. Es besteht jedoch die
Gefahr der Gewöhnung, wenn keine anderen Verarbeitungsmöglichkeiten gefunden werden.
Alkohol- oder Medikamentenabhängigkeit ist häufig ein Grund, weshalb sich
Traumapatienten später in Behandlung begeben.
Somatoforme Störungen F45
Bei den somatoformen Störungen unterscheidet das ICD die Somatisierungsstörungen (F45),
undifferenzierte Somatisierungsstörung (F45.1), die hypochondrische Störung (F45.2), die
somatoforme autonome Funktionsstörung (F45.3) und die anhaltende somatoforme
Schmerzstörung (F45.4). Der psychotraumatische Anteil an diesen Störungsbildern ergibt sich
meist aus einer Kombination von Übererregung, Intrusionen und Phänomenen des
‚Körpergedächtnisses’, das einer somatischen Repräsentation des Traumaschemas entspricht.
Das Traumaschema als ‚unterbrochene Handlung’ wird gewissermaßen im Körper
‚eingefroren’ und verursacht an der betreffenden Stelle oft anhaltende Schmerzen.
Ich habe es immer wieder erlebt, dass sich die somatischen Symptome auch am Ort der
Traumatisierung ausbilden, also Kopfschmerzen nach Schlägen auf den Kopf,
Unterleibsschmerzen nach einer Vergewaltigung etc.
Chronifizierte posttraumatische Belastungen können über die traumaassoziierte
Stressaktivierung den Verlauf körperlicher Erkrankungen mitbedingen oder beeinflussen.
Insbesondere ist dies belegt für Herz-Kreislauferkrankungen und immunologische
Erkrankungen.
Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F6):
In diese diagnostische Kategorie sind die in der klassischen Psychiatrie so genannten
‚Psychopathen’ eingegangen, von psychoanalytischer Seite die sogenannten
‚Charakterneurosen’ oder ‚neurotischen Charaktere’. Der psychoanalytische Terminus steht
im Kontrast zum Begriff der ‚Symptomneurose’. Die diagnostische Fastregel lautet: Unter
einer Symptomneurose bzw. neurotischen Symptomen leidet die betreffende Persönlichkeit
selbst, unter einer Charakterneurose ihre soziale Umgebung. Das trifft für das Konstrukt
‚Persönlichkeitsstörung’ nach ICD nur noch vereinzelt zu. So kann etwas die
Dissoziale Persönlichkeitsstörung (F60.2)
subjektiv frei von Leidensdruck sein, desto mehr leidet jedoch ihre soziale Umgebung.
FR 56: Überschneidungen mit der antisozialen Persönlichkeit bestehen in Impulsivität,
feindseliger Haltung, unverantwortlichem Finanzgebaren und sexuellen Funktionsstörungen
als Symptomen, die sich auch bei Traumapatienten finden. Unterschiede lassen sich vor allem
an der Biographie der beiden Patientengruppen feststellen. Bereits in der Kindheit und
Jugendzeit auftretende antisoziale Verhaltensweisen sind ein verlässlicher Hinweis auf die
antisoziale Persönlichkeit. Co-Morbidität besteht jedoch häufig, da antisoziale
Persönlichkeiten einen Lebensstil pflegen, der sie einem erhöhten Traumarisiko aussetzt.
Bei anderen Persönlichkeitsbildern, wie etwas der
Borderline-Persönlichkeit (Emotional instabile Persönlichkeitsstörung) (F60.31)
36
kurz BPS, leidet zumeist der Patient selbst wie auch sein soziales Umfeld. Der
psychotraumatische Hintergrund der BPS kann heute für viele Fälle als gesichert gelten.
Gleichzeitig scheint die Störung mit einem Defizit in der psychischen Strukturbildung
einherzugehen, das neben der psychotraumatischen Ätiologie auch auf einen biologischen
Anteil verweist, so dass nach unserem gegenwärtigen Erkenntnisstand im typischen Fall von
einer gemischten Ätiologie (traumatisch und biologisch) auszugehen ist. Kommt noch die
ätiologische Komponente Untersozialisation hinzu, so treten dissoziale Züge auf, die sich als
Identifkation mit dem Täter und Übernahme der Täterrolle erweisen. Diese Neigung zur
Umkehr der ‚Täter-Opfer-Konstellation’ sollte therapeutisch unbedingt berücksichtigt
werden, da andernfalls der Therapeut unbewusst in die Opferrolle gerät und zu aggressivem
Gegenagieren neigt.
Zum Zusammenhang von Borderline Persönlichkeitsstörung und Komplexer
Posttraumatischer Belastungsstörung:
In einem Review wurde die Literatur von 1995 bis 2007 gesichtet und hinsichtlich des
kausalen Zusammenhangs zwischen BPS und Traumatisierung in der Kindheit untersucht.
Zur Beurteilung kamen folgende Kriterien zur Anwendung: Stärke des Zusammenhangs,
zeitlicher Auftreten, Dosis-Wirkungsbeziehung, Spezifität, Folgerichtigkeit, biologische und
epidemiologische Plausibilität und Analogien (Hill 1984).
Stärke des Zusammenhangs:
Es wird ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der BPS und sexualisierter Gewalt in der
Kindheit beschrieben wobei ein Review von Raten zwischen 40% und 70% bei BPS im
Unterschied zu anderen Achse I Diagnosen (CSA: 19%-26%) ausgeht (Zanarini et al. 2000).
Zeitliches Auftreten:
Für den zeitlichen Zusammenhang ist die Evidenz schwieriger zu finden da der Großteil der
Studien auf retrospektive Angaben der Betroffenen angewiesen ist. Rogosch und Cicchetti
(2005) fanden bei Jugendlichen, bei denen Misshandlungserfahrungen dokumentiert waren,
signifikante Prädiktoren für die Entwicklung einer BPS.
Dosis-Wirkungsbeziehung:
Drei Studien konnten den eindeutigen Zusammenhang zwischen der Schwere der erlebten
Gewalt (2 Studien CSA) und der Ausprägung der BPS Symptome zeigen.
Spezifität:
Hinsichtlich der Spezifität sind die Ergebnisse weniger eindeutig, da immerhin 20-45% (Sabo
et al. 1997) der Patienten mit einer BPS keine traumatischen Erfahrungen berichten. Die
Autoren gehen von der multifaktoriellen Genese bei der Entwicklung einer BPS aus.
Die Forschung {von Nahas et al.(2005), Rinne et al.(2005), Schmahl et al.(2006)} zeigt
ähnliche Veränderungen in Gehirnen von Patienten mit BPS und Patienten mit PTBS.
Die epidemiologische Evidenz wird an der höheren Raten von Frauen mit BPS und der
gleichzeitig höheren Missbrauchsrate von Frauen gegenüber Männern abgeleitet.
Analogien:
37
Es wurden verschiedene multifaktorielle Modelle in der Entstehung von
Persönlichkeitsstörungen untersucht, doch bislang noch keine mit empirischer Evidenz für
BPS.
Schlussfolgerung:
Die Ergebnisse des Reviews weisen auf einen kausalen Zusammenhang zwischen kindlicher
Traumatisierung und der Entwicklung einer BPS hin, insbesondere dann wenn eine
multifaktorielle Genese ätiologisch in Betracht gezogen wird.
Weitere Störungen, bei denen traumatische Belastungen maßgeblich mitbedingend sind:
Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren (F5): Hierunter
fallen Anorexia nervosa, Schlafstörungen, Bulimie, sexuelle Funktionsstörungen,
Verhaltensstörungen im Wochenbett und Missbrauch von nicht Abhängigkeit
erzeugenden Substanzen.
Adipositas bei Frauen hat vor dem Hintergrund von sexuellem Missbrauch oft die Funktion,
nach außen hin zu schützen und den weiblichen Körper unattraktiv zu machen.
Schlafstörungen lassen sich hypothetisch auf Übererregung zurückführen, in Alpträumen
kehren die Intrusionen wieder.
Parasomnien wie Sprechen im Schlaf, Zähneknirschen, Schlafwandeln oder andere
nächtliche Handlungen können mit dem traumatischen Erlebniskomplex in Verbindung
stehen.
Besonders auffällig ist der Zusammenhang zwischen sexuellen Funktionsstörungen und
Erfahrungen negativer Intimität in der Lebensgeschichte.
Bei Robert Bering findet sich die Hypothese, Promiskuität nach Erfahrungen von sexuellem
Missbrauch in der Kindheit als ‚dysfunktionales reparatives Schema’ zu betrachten. Die
reparative Wiederaufnahme der unterbrochenen Handlung scheitert immer von neuem.
Gleichzeitig verbindet sich mit jedem neuen Kontakt die Hoffnung, die frühere traumatische
Überforderung endlich kontrollieren zu können.
Auch bei den klassischen Neurosen liegt es aus psychotraumatologischer Sicht nahe, nach
einer Erklärung im Sinne der Traumadynamik zu suchen. Dabei handelt es sich um Angstund Zwangsstörungen. Die Angststörung entsteht bei Dominanz der Erregungskomponente in
der PTBS. Traumabedingte Angststörungen werden jedoch meist relativ früh behandelt,
allerdings unter der Diagnose einer Angststörung.
Bei Phobien z. B. wird die häufig zu beobachtende Angstausbreitung verständlich aus der
präventiven Komponente dessen, was Fischer und Riedesser das Traumakompensatorische
Schema nennen. Dabei handelt es sich um eine Basisstrategie und individuelle Ausprägung
der traumakompensatorischen Maßnahmen. Während sich in der peritraumatischen Erfahrung
spontane Selbstschutzmechanismen bilden, werden diese während der weiteren traumatischen
Reaktion und im traumatischen Prozess elaboriert. Das kompensatorische Schema umfasst
drei Komponenten: eine ätiologische Theorie (wodurch ist das Trauma entstanden?), die
Heilungstheorie (wie kann das Trauma geheilt werden?), die präventive Theorie (was muss
geschehen, um eine Retraumatisierung zu vermeiden?). Diese Komponenten sind logisch
38
aufeinander bezogen, basieren aber schon auf einer traumatischen Erfahrung, die
entsprechend ihrer Speicherung im Traumaschema nur unvollständig zugänglich ist und in
wichtigen Teilaspekten oft nur implizit erinnert werden kann. Von daher erwecken die
traumakompensatorischen Maßnahmen eine – von außen – betrachtet – irrationalen,
unzweckmäßigen Eindruck, während es sich, gemessen am gegebenen Informationsstand, um
subjektiv sinnvolle Maßnahmen handelt. Bei Kindheitstraumen wird das
Traumakompensationsschema auf dem entsprechenden Niveau der kognitiven Entwicklung
und der dadurch gegebenen Begrenzung ausgearbeitet. Daher sind das Schema und seine
Komponenten oft durch eine magisch anmutende, egozentrische Denkweise bestimmt, die
dem frühen kognitiven Egozentrismus des Kindes entspricht.
Nach einem Autounfall beispielsweise wird zunächst der Autotyp phobisch gemieden, der in
den Unfall verwickelt war. Bei weiterer Ausbreitung des Traumaschemas kann der weitere
kompensatorische Schritt stattfinden, den Straßenverkehr überhaupt zu meiden. Schließlich
kann sich das präventive Teilschema des TKS zu einer ‚Agoraphobie’ generalisieren, Straßen
und freie Plätze überhaupt zu vermeiden.
Trauma (im Modell der ‚unterbrochenen Handlung’) kann die zwanghafte, ritualisierte
Wiederholung bestimmter Handlungen erklären, die für die Zwangsneurose charakteristisch
ist. Nicht nur in der Phantasie, sondern auch im Handeln muss der Unfall immer wieder
durchgespielt werden. Manche vergewaltigte Frauen unterliegen einem Duschzwang, der
zumindest für Dritte als Versuch erkennbar ist, die ‚Beschmutzung’ abzuwaschen, die mit der
erzwungenen Intimität verbunden wird. Für die betroffenen selbst bleibt dieser
Zusammenhang allerdings oft dynamisch unbewusst. Daher führt die zwanghafte Reinigung
meist keine Heilung herbei. Vielmehr imponiert sie als zusätzliches Symptom. Eine an den
Ursachen orientierte Psychotherapie von Zwangsstörungen und Phobien sollte sich, einen
psychotraumatischen Hintergrund der Ätiopathogenese vorausgesetzt nicht mit
Symptombeseitigung begnügen, sondern sollte zum Punkt geführt werden, an dem das
Traumaschema emotional durchgearbeitet werden kann.
Welche komorbiden Bilder sich im Einzelnen entwickeln, hängt von den Symptomen ab, die
bei der anfänglich auftretenden PTBS im Vordergrund stehen Handelt es sich dabei um
Übererregung, so kommt es möglicherweise zusätzlich zur Selbstmedikation und
Suchtproblematik (ICD-10: F1) oder zu einer Angststörung (ICD-10:; F40, F41). Steht die
Vermeidung im Vordergrund sind als Komorbidität eher depressive (ICD-10: z.B. F32) oder
dissoziative Störungsbilder (ICD-10: F44) zu erwarten.
Studien, die sich mit psychiatrischen Krankheitsbildern und ihrer Komorbidität zu PTBS
beschäftigen, kommen zu dem Ergebnis, dass ein hoher Prozentsatz der Patienten in der
psychiatrischen Regelversorgung auch die Kriterien einer psychotraumatischen
Belastungsstörung erfüllt.
6.3. Prävalenz komorbider Diagnosen: Zwei große epidemiologischen Studien, die
in den USA und Australien durchgeführt wurden, fanden bei 85–88% der Männer und 78–
80% der Frauen mit PTBS komorbide psychiatrische Diagnosen (Kessler et al., 1995;
Creamer et al. 2001).
39
Kessler et al. (1995) bestimmen retrospektiv, wie häufig PTBS als primäre Störungen
auftreten, welche dann andere Syndrome oder Erkrankungen nach sich ziehen. Sie schätzten,
dass vor allem bei Depressionen und Substanzmissbrauch PTBS in der Mehrzahl der Fälle als
primär anzusehen waren, während das Verhältnis bei den Angststörungen umgekehrt zu sein
schien.
In einer Studie mit 801 Frauen fanden Breslau et al. (1997) ein gut zweifach erhöhtes Risiko,
nach einer PTBS erstmalig an einer Major Depression zu erkranken, und ein dreifaches
Risiko, einen Alkoholabusus bzw. eine Alkoholabhängigkeit zu entwickeln.
Gleichzeitig war bei Frauen mit bereits zuvor bestehender Major Depression sowohl die
Gefahr, ein traumatisches Ereignis zu erleben, als auch die Wahrscheinlichkeit, in dessen
Folge eine PTBS-Symptomatik zu entwickeln, erhöht.
In der deutschen Studie von Perkonigg et al. (2000) wurde bei 87,5 % der PTBS-Patienten
mindestens eine weitere psychische Störung diagnostiziert. Die Autoren vermuten, dass in
etwa einem Drittel der Fälle zuvor bestehende psychopathologische Faktoren zur Entstehung
einer primären Vulnerabilität oder einer bestimmten Risikokonstellation beitragen (z. B. bei
bekannter Alkohol- oder Substanzabhängigkeit); auch könne beispielsweise durch phobische
oder depressive Störungen die Schwelle für das Auftreten einer Posttraumatischen
Belastungsstörung nach einem entsprechenden Ereignis gesenkt werden. Gleichwohl
entwickelten sich die komorbiden psychischen Störungen in der weit überwiegenden
Mehrzahl der Fälle sekundär nach einer PTBS; dies gelte insbesondere für somatoforme
Störungen, Agoraphobien, generalisierte Angststörungen und affektive Störungen, wobei
nach Ansicht einiger Autoren der Posttraumatischen Belastungsstörung die Rolle eines
maßgeblichen Risikofaktors zukommt (McMillen et al. 2002; Breslau et al. 2003).
Auch die Studie von Zlotnick et al. 2006 bestätigt die hohe Prävalenz komorbider Störungen
und nennt vor allem affektive Störungen, Angststörungen, Substanzmissbrauch und
Somatisierungsstörungen (Zlotnick et al. 2006).
Trauma, PTBS und körperliche Erkrankungen:
Herz-Kreislauf-Krankheiten:
Kubansky, Koenen et al. (2007) publizierten eine prospektive Längsschnittsstudie, die ein
erhöhtes relatives Risiko von 1.26 für Myokardinfarkt und letale KHK (koronare
Herzkrankheit) bei PTBS fand. Mindestens 5 gut kontrollierte Studien haben retrospektiv
erhöhte Risiken bei PTBS gefunden. Als pathogenetische Verbindungen werden die
verlängerte endokrine Stressreaktion sowie Verhaltensveränderungen (z.B. Rauchen,
Substanzabhängigkeit) diskutiert (Shalev 2001). Dazu gibt es bisher aber keine prospektiven
Studien.
Immunologische Erkrankungen (dermatologisch, Arthritis, Asthma etc.):
Ca. 5 retrospektive Studien liegen vor, die jeweils mehrere Krankheiten untersuchten. Die
Befundlage des Zusammenhangs ist recht eindeutig, mit ca. 4/5 der Befunde die einen
Zusammenhang belegen und 1/5 der Befunde, die ihn nicht statistisch absichern können. Die
Zusammenhänge zwischen PTBS und den Krankheiten war nach dem systematischen Review
von Qureshi et al. (2009) folgt signifikant: Arthritis (p = .001), Asthma (p = . 001), Ekzem (p
< .05).
Zusammenhang von PTBS nach Schädelhirntrauma (SHT):
40
In Review des Institutes of Medicine wurde die Literatur von 1960 bis 2008 gesichtet und
hinsichtlich des kausalen Zusammenhangs zwischen Schädelhirntraumata und Langzeitfolgen
untersucht. Eine der Kategorien waren psychiatrische Störungsbilder nach
Schädelhirntraumata. Differenziert wurden die Studien nach Folgen bei der Zivilbevölkerung
und Militär. Zur Beurteilung kamen folgende Kriterien zur Anwendung: Stärke des
Zusammenhangs, zeitlicher Auftreten, Dosis-Wirkungsbeziehung, Spezifität, Folgerichtigkeit,
biologische und epidemiologische Plausibilität und Analogien (Hill 1984). Als Problem der
Studien sehen die Autoren die Überschneidung zwischen dissoziativen Symptomen und
Symptomen nach Schädelhirntraumen. In den Studien fand sich bei Vorhandensein von
leichtem SHT (Schädelhirntrauma) und PTBS eine intensivere Symptomatik in Bezug auf
Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Geräuschempfindlichkeit gegenüber Patienten mit
leichtem SHT ohne PTBS. Hinsichtlich des Zusammenhang zwischen leichtem SHT und
PTBS in der Zivilbevölkerung sehen gibt es nur einen unzureichenden Zusammenhang, für
Soldaten einen begrenzten Zusammenhang zwischen leichtem SHT und PTBS
In einer aktuellen prospektiven australischen Studie (Bryant et al) fanden die Autoren die
Entwicklung einer PTBS nach leichtem SHT nach 12 Monaten doppelt so häufig im
Vergleich zu der Gruppe ohne SHT.
6.4. Therapeutische Überlegung zur Komorbidität
Spinazzola et al. stellten fest, dass bei den 34 Studien, die bei der bisherigen Leitlinie der
ISTSS (2000) (International Society for Traumatic Stress Studies) berücksichtigt wurden,
Patienten mit schweren Komorbiditäten systematisch ausgeschlossen wurden. Aufgrund
dieser Studienlage bleiben die folgenden Empfehlungen häufig auf dem Niveau von
Expertenwissen und sind nicht wissenschaftlich abgesichert.
Empfehlungen der NICE-Guidelines (Pkt 2.3.7) (NICE: National Institute for Health and Care
Excellence, brit.):
Entsprechend den Befunden von Kessler (1995) und Blanchard (2003) wird bei PatientInnen
mit PTBS und Depression eine vorrangige Behandlung der PTBS empfohlen, wenn von einer
sekundären Komorbidität auszugehen ist. Es wird davon ausgegangen, dass es in vielen Fällen
bei den komorbiden sekundären Störungen der PTBS (z.B. bei Depressionen,
Angsterkrankungen, Alkohol- und Substanzmissbrauch) durch traumafokussierte
Psychotherapie auch zur Besserung der komorbiden Symptome kommt. So zeigten
PatientInnen in einer Behandlungsstudie bei erfolgreicher Behandlung der PTBS, dass sie die
vorher komorbide Diagnose einer Major Depression nicht mehr aufwiesen (Blanchard et al.
2003b).
Bei PatientInnen mit einer langen, chronischen PTBS-Anamnese und multiplen traumatischen
Erfahrungen und Verlusten gehen die Guidelines allerdings davon aus, dass die Depression
und andere komorbide Symptomatik ein so schweres Ausmaß annehmen können, dass die
Komorbidität vorrangig behandelt werden muss. Patienten können häufig dann erst im 2.
Schritt von einer traumafokussierten Herangehensweise profitieren. Z. B. Sucht- und
Traumabehandlung müssen miteinander verschränkt werden.
Bei Menschen mit PTBS, bei denen die Diagnostik oder genauere Exploration der
Traumatisierungen bereits ein hohes Risiko zu Suizidalität und Schädigung von sich und
anderen in sich birgt, wird zunächst Krisenmanagement dieses Risikos empfohlen (siehe auch
NICE-Guidelines 2.3.7.2. und 2.3.7.3 sowie These 2 zu Affektregulierung und Stabilisierung)
41
Auch bei Menschen mit Drogen und Alkoholabhängigkeit sowie schweren dissoziativen
Symptomen und Neigung zu Selbstverletzung empfehlen die Guidelines, dass dieses Problem
zunächst vorrangig behandelt werden sollte (siehe NICE-Guidelines 2.3.7.4; siehe auch Pkt.
2:Affektregulierung, Stabilisierung)
Am besten untersucht und als erfolgreich bewertet sind integrative Therapieansätze im
Bereich des Substanzmissbrauchs (Baschnagel et al. 2006, Morrissey et al. 2005), aber auch
bei PTBS und Panikstörung (Hinton et al. 2005). Für die Depression sind die Ergebnisse nicht
eindeutig (Dunn et al. 2007). In den meisten Studien zur PTBS- Behandlung, die nicht gezielt
auf die Komorbidität eingehen, zählen viele psychischen Störungen, die häufig bei einer
PTBS bestehen, als Ausschlusskriterium, was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse stark
beeinträchtigt (Spinazzola et al. 2005).
Komorbide Störungen werden entsprechend der spezifischen Leitlinienempfehlungen
behandelt.
7. Besonderheiten im Verständnis von
Traumafolgestörungen
7.1 Individuelle Faktoren für die Entwicklung von Traumafolgestörungen
Subjektive Disposition: Die Erwartung des Unerwartbaren
Die große Variationsbreite traumatischer Situationen, Situationsfaktoren und Dynamiken trifft
auf ein breites Spektrum subjektiver Dispositionen und persönlichkeitstypischer
Reaktionsbereitschaft. Diese Wechselbeziehung von Situation, Situationsdeutung und
disponierter Handlung ist ein weites Forschungsfeld.
Aktuelle Disposition.
Hier ist vor allem der Erwartungshorizont des Individuums zu berücksichtigen. Manche
Traumata treffen als Schocktrauma das Individuum unvorbereitet und zeitlich überraschend.
Dieser zeitliche Überrumpelungseffekt kann als ein eigener traumatogener Faktor betrachtet
werden. Gewalterfahrungen wie Folter beispielsweise sind, wenn sie sich über längere Zeit
erstrecken, nicht mehr im zeitlichen Sinne überraschend. Sie sind jedoch in einem anderen
Sinne ‚unerwartet’ und möglicherweise auch ‚unerwartbar’. Es ist den wenigsten Menschen
möglich, sich in ihrer Lebensgeschichte auf jenes Ausmaß von Brutalität und
Unmenschlichkeit innerlich einzustellen, das sich bei Folter, politischer Verfolgung und
Gewaltverbrechen manifestiert.
Überdauernde Dispositionen
Die überdauernden Dispositionen können physiologischer, psychischer oder sozialer Art sein.
Hierbei ist vor allem die Lebensgeschichte als ‚trauma history’ zu berücksichtigen.
Vorausgegangenen traumatische Erfahrungen hinterlassen das autonome Nervensystem in
erhöhter Erregungsbereitschaft. Eine traumatische Stressreaktion mit traumatisch
dysreguliertem Affektzustand und emotionaler Überflutung tritt hier leichter auf als bei
Personen, die entweder in dieser Hinsicht nicht vorgeschädigt sind oder in ihrer
Lebensgeschichte protektive Erfahrungen machen konnten.
42
Man unterscheidet terminologisch zwischen protektiven und korrektiven Faktoren. Letztere
wirken sich aus bei der Verarbeitung traumatischer Information, sei es während der
Reaktionsphase oder im traumatischen Prozess. Hilfreiche soziale Beziehungen bzw.
Personen könnten bei der Traumaverarbeitung korrektiv wirken, auch dann, wenn der
Verarbeitungsprozess stagniert. In diesem Sinne kann auch die Psychotherapie als korrektiver
Faktor betrachtet werden.
Protektive Faktoren dagegen entsprechen einer bereits vorhandenen Disposition, einem
mitgebrachten Schutzfaktor. Nach Sichtung empirischer Studien wurden folgende Faktoren
genannt:
Eine dauerhaft gute Beziehung zu mindestens einer primären Bezugsperson,
Aufwachsen in einer Großfamilie mit kompensatorischen Beziehungen zu den Großeltern und
entsprechender Entlastung der Mutter;
Ein gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust;
Überdurchschnittliche Intelligenz;
Ein robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament;
Sicheres Bindungsverhalten;
Soziale Förderung z. B. durch Jugendgruppen, Schule oder Kirche;
Verlässliche unterstützende Bezugspersonen im Erwachsenenalter, vor allem Ehe- oder
sonstige konstante Beziehungspartner;
Lebenszeitlich späteres Eingehen ‚schwer lösbarer Bindungen’;
Eine geringe Risiko-Gesamtbelastung
Risikofaktoren
Unter Risikofaktoren verstehen wir belastende Lebensereignisse oder Lebensumstände, die
einzeln oder in ihrem Zusammenwirken eine psychische Störung oder Erkrankung
begünstigen. Sie stellen im statistischen Mittel ein ‚Risiko’ für Fehlentwicklungen oder
psychische Störungen dar. Traumatische Situationsfaktoren lassen sich auch unter diesen
weiten Begriff des Risikos fassen. Allerdings potenziert sich bei ihnen das Erkrankungsrisiko,
und es käme einer Verharmlosung und Bagatellisierung gleich, wollten wir etwa fortgesetzte
schwere Misshandlung von Kindern und Jugendlichen zum ‚Risikofaktor’ herabstufen.
Terminologisch dürfte es also sinnvoll sein, zwischen Risikofaktoren und traumatischen
Situationsfaktoren im engeren Sinne zu unterscheiden. Beide Faktorengruppen können
allerdings im Sinne einer kumulativen Traumatisierung in fataler Weise zusammenwirken. So
wird ein Typ 1-Schocktrauma schlechter verarbeitet, wenn konfliktreiche und in sich schon
belastende Familienverhältnisse den Erholungsprozess erschweren oder immer von neuem
unterbrechen. Solche konflikthaften sozialen Lebensumstände bleiben normalerweise
vielleicht ein ‚subtraumatischer’ Risikofaktor, in der genannten Kombination können sie
jedoch zu einer insgesamt traumatischen Lebenssituation beitragen. Umgekehrt schützen wie
gesagt protektive Faktoren und Lebensumstände vor Traumatisierung trotz potenziell
traumatischer Ereignisse und Situationsfaktoren und verhindern, dass ein traumatischer
Erlebnisverarbeitungsprozess in Gang kommt.
Neuere Forschung hat ergeben, dass sie die belastenden Faktoren im Leben nach dem
Bausteinprinzipe im Sinne einer immer größeren Vulnerabilität addieren.
Als Risikofaktoren bzw. potenziell traumatische Situationsfaktoren lassen sich benennen:
43
Niedriger sozioökonomischer Status der Herkunftsfamilie;
Mütterliche Berufstätigkeit im ersten Lebensjahr;
Schlechte Schulbildung der Eltern;
Große Familien und sehr wenig Wohnraum;
Kontakte mit Einrichtungen der ‚sozialen Kontrolle’;
Kriminalität oder Dissozialität eines Elternteils;
Chronische Disharmonie;
Unsicheres Bindungsverhaltung nach dem 12./18. Lebensmonat;
Psychische Störungen der Mutter oder des Vaters;
Alleinerziehende Mutter;
Autoritäres väterliches Verhalten;
Verlust der Mutter;
Häufig wechselnde frühe Beziehungen;
Sexueller und/oder aggressiver Missbrauch;
Schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen;
Ein Altersabstand zum nächsten Geschwister von unter 18 Monaten;
Früher: Uneheliche Geburt
Aus einer Übersicht über etliche Studien geht weiter hervor, dass Jungen vulnerabler sind als
Mädchen. Ferner müssen wir sehr wahrscheinlich von einem ‚nicht-linearen’
Zusammenwirken der einzelnen Risikofaktoren ausgehen. Während die Wirkung eines
einzelnen Faktors eher gering ist, erhöht sich bei zwei Faktoren die Wahrscheinlichkeit, dass
Entwicklungsstörungen auftreten, um das Vierfache.
Wie gesagt, spielen die biologisch angeborene und die biologisch erworbene Disposition eine
gewisse Rolle. Die geringste scheint sie bei psychotraumatischen Situationsfaktoren von
mittlerem und hohem Schweregrad zu spielen. Neben den genetisch angeborenen
Dispositionen rücken erworbene, gleichwohl physiologisch verankerte Dispositionen
neuerdings immer deutlicher ins Blickfeld. Dazu gehören einmal die verschiedenen
zentralnervösen, neuromuskulären und neurovegetativen Folgen des Traumas, zum anderen in
der Kindheit früh erworbene Veränderungen hormoneller und neuroendokriner
Regulationssysteme, z. B. eine Dysregulation des Serotoninhaushalts infolge frühkindlicher
Deprivation, die für depressive Erkrankungen im Erwachsenenalter disponiert.
Politisch brisant wurde diese Frage im Kontext der Entschädigungsverfahren, als Überlebende
des Holocaust sich aus heutiger Sicht unzumutbare Fragen über ihre mögliche „prämorbide
Störung“ gefallen lassen mussten, die an den psychischen Schwierigkeiten mehr schuld sein
sollten als KZ-Haft, Folter und Ermordung von Angehörigen. Den Psychoanalytiker Kurt
Eissler veranlassten diese entwürdigenden Verfahren zu der berühmt gewordenen Frage: „Die
Ermordung von wie vielen seiner Kinder muss ein Mensch symptomfrei ertragen, um
psychisch gesund zu sein?“ (Eissler 1963)
7.2. Bedeutung spezifischer Situationsfaktoren
Hier geht es um Situationsfaktoren, die jeder für sich oder in ihrer Kombination sehr
wahrscheinlich eine psychotraumatische Wirkung entwickeln. Im Gegensatz zu ‚Stressoren’
handelt es sich hier um Faktoren einer im engeren Sinne ‚traumatischen’ Situation. Arthur H.
44
Green hat in seiner Arbeit mit Traumaopfern über unterschiedliche Desaster, Katastrophen
und Gewalttaten hinweg acht Situationsfaktoren ermittelt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Bedrohung für Leib und Leben
Schwerer körperlicher Schaden oder Verletzung
Absichtlicher Verletzung oder Schädigung ausgesetzt zu sein
Konfrontation mit verstümmelten menschlichen Körpern (‚exposal to the grotesque’)
Gewaltsamer oder plötzlicher Verlust einer geliebten Person
Beobachtung von Gewalt gegen eine geliebte Person oder Informationen darüber
Die Information, dass man einem schädlichen Umweltreiz ausgesetzt ist oder war
Schuld haben am Tod oder an schwerer Verletzung anderer
Diese Faktoren wirken additiv zusammen. Ferner existieren besonders belastende
Ergänzungsverhältnisse zwischen ihnen. Den Schweregrad von Folgeerscheinungen im
postexpositorischen Zeitraum konnte Green aus dieser Kombinatorik mit überzufälliger
Treffsicherheit vorhersagen, was wir als Beleg für den angenommenen Einfluss werten
können. Symptome und Stressoren müssen nach Green unabhängig voneinander erhoben und
erst dann auf einen korrelativen Zusammenhang geprüft werden. So lassen sich längerfristig
immer spezifischere Zusammenhänge zwischen beiden Variablengruppen herausfinden.
Erläutern, indem fiktive Beispiele durchgegangen werden.
7.3. Latenz
Wir haben gehört, dass Traumafolgestörungen mit Verzögerung auftreten können. Dabei
handelt es sich um das Phänomen der Latenz. Dieses ist mit der Logik der sequentiellen
Traumatisierung und mit der Logik des Gewaltaktes selbst eng verbunden: das Phänomen der
Latenz. Um psychisch und physisch zu überleben, versucht das Gewaltopfer während der Tat
unbewusst, eine Art Wahrnehmungsschutz aufzubauen, der
verhindert, dass es sich der vollen Tragweite dessen, was gerade passiert, klar wird. Dies kann
insbesondere für das Ausmaß der Lebensgefahr gelten. Die volle Bedeutung, das Ausmaß der
Lebensgefahr und damit die volle Wucht des Traumas erfasst das Opfer oft erst viel später.
Neben dem typischen Wechsel von Auseinandersetzung und Abwehr kann das Trauma
deshalb auch so verlaufen, dass lange Zeit nach dem traumatischen Ereignis gar keine
Symptome vorhanden sind, das Opfer die Gewalt scheinbar unbeschadet überstanden hat und
erst viel später Symptome auftreten. Traumatherapeuten weisen darauf hin, dass etwaige
psychosomatische Beschwerden dann oft nicht mehr mit dem Trauma in Verbindung gebracht
werden.
Das Trauma kann also über einen kürzeren oder längeren Zeitraum “latent" bleiben. So hob
der norwegische Psychiater Leo Eitinger bereits in seinen frühen Untersuchungen zum
“Concentration Camp Syndrome“ hervor, dass die norwegischen Überlebenden, die im
Prinzip in eine stabile und unterstützende, sie als Helden feiernde Umwelt zurückkehrten,
zunächst eine fast euphorische, symptomfreie Phase hatten und erst nach einiger Zeit schwere
Symptome entwickelten. Eine erst kürzlich in Israel durchgeführte Studie kommt zu dem
Ergebnis, dass viele Holocaust-Überlebende, die ihr Leben kompetent meisterten, im Alter von außen unerwartet - unter massiven Traumasymptomen leiden (vgl. Landau und Littwin
2000).
45
Von Bedeutung ist für den hier interessierenden Zugang zu kollektivem Trauma, dass das
Phänomen der Latenz auf verschiedenen Ebenen sichtbar wird: So wurde etwa auch für die
Auswirkungen auf die zweite Generation festgestellt, dass das, was weitergegeben wurde,
eher im Bereich einer latenten psychischen Verwundbarkeit als im Bereich einer manifesten
Schädigung liegt (vgl. Kapitel I.2 Transgenerationelle Weitergabe, S. 45ff).
7.4. Nachträglichkeit
Verwandt mit dem Phänomen der Latenz – in manchen Fällen vielleicht sogar als ihre
Ursache verstehbar – ist die bereits von Freud im Zusammenhang mit Trauma konstatierte
„Nachträglichkeit“. Er beschrieb, dass Opfer von sexuellem Missbrauch oft deshalb in der
Pubertät an Symptomen zu leiden beginnen, weil ihnen die Bedeutung des Erlebten erst durch
das Gewahrwerden der eigenen Sexualität bewusst wird. Durch das wachsende Bewusstsein
für Sexualität erkennen sie das ursprünglich vielleicht nur diffus als „falsch“ Erlebte
nachträglich zutreffend als sexualisiert. Analog kann bei Erwachsenen die Phase der latenten
Traumatisierung durch plötzliches Bewusstwerden beendet sein. Bessel van der Kolk und
Alexander McFarlane beschreiben die Reaktion einer vergewaltigten Frau, die Monate später
erfuhr, dass der gleiche Täter ein weiteres Sexualopfer umgebracht hatte. Erst dann
entwickelte sie starke Symptome (McFarlane/van der Kolk, 2000, S. 31).
Das Phänomen der „Nachträglichkeit“ illustriert besonders deutlich den Prozesscharakter des
Traumas: Das vergangenen Trauma wirkt nicht nur (linear-kausal) auf das gegenwärtige
Erleben, sondern das gegenwärtige Leben wirkt auf die traumatische Erinnerung zurück, die
Gegenwart verändert die Vergangenheit. Laplanche und Pontalis definieren Nachträglichkeit
so: „Erfahrungen, Eindrücke, Erinnerungsspuren werden später aufgrund neuer Erfahrungen
und mit dem Erreichen einer anderen Entwicklungsstufe umgearbeitet. Sie erhalten somit
gleichzeitig einen neuen Sinn und eine neue psychische Wirksamkeit“ (Laplanche/Pontalis,
1972, S. 313). A. Modell (1990) versteht unter Nachträglichkeit einen „Prozess, bei dem
Erinnerungen durch neue Erfahrungen geprüft und modifiziert werden“ (zit. nach Kerz–
Rühling, 2000, S. 472). Für das Verständnis von Trauma von besonderer Bedeutung ist, dass
nicht das Erlebte allgemein „nachträglich umgearbeitet“ wird, „sondern selektiv das, was in
dem Augenblick, in dem es erlebt worden ist, nicht vollständig in einen
Bedeutungszusammenhang integriert werden konnte (Laplanche/Pontalis, 1972, S. 314).“
7.5. Schuld
Da die offizielle Klassifizierung von Trauma als psychiatrische Diagnose im DSM der
American Psychiatric Association eng mit der Anerkennung des spezifischen Leidens der
Vietnam-Veteranen verknüpft war, wurden die für Vietnam-Veteranen so charakteristischen
quälenden Schuldgefühle als eine Form von Intrusionssymptomen in die Traumadiagnose
mitaufgenommen. Tatsächlich scheinen zwar Schuldgefühle für die meisten Überlebenden
von Gewalterfahrung eine herausragende Rolle zu spielen, jedoch lohnt sich ein
differenzierter Blick auf die unterschiedliche psychologische Bedeutung und den je realen
Hintergrund. So wird zum Beispiel psychodynamisch argumentiert, dass irrationale
Schuldgefühle dazu dienen können, sich die real gegebene völlige Ohnmacht nicht
eingestehen zu müssen, d.h. dass es für das psychische Gleichgewicht leichter erträglich sein
kann, schuld gewesen statt völlig ohnmächtig gewesen zu sein. Bereits Sandor Ferenczi
verwies auf die besondere Bedeutung, die dies bei Kindern haben kann: Wenn Kindern von
einer nahen, geliebten Bezugesperson Gewalt angetan wird, dann ist es für sie oft leichter, die
Schuld auf sich zu nehmen (also etwa sich zu Recht bestraft zu fühlen) als - psychisch - die
46
Bezugsperson zu verlieren, d.h. einsehen zu müssen, dass die bis dahin für gut gehaltenen
wichtige Bezugsperson sich so schlecht verhalten hat (vgl. Ferenczi 1933). Mathias Hirsch
nimmt an, dass dieser paradox anmutende Prozess - nämlich dass das Opfer die Schuldgefühle
hat, die der Täter haben sollte - auch charakteristisch für schwere Beziehungstraumata im
Erwachsenenalter sein könnte. Er beschreibt ein charakteristisches „traumatisches
Schuldgefühl“:
„Schwere Gewalt- und Verlusterfahrungen hinterlassen einen Fremdkörper im Selbst, ein
Introjekt, das Schuldgefühle verursacht. Das Paradoxon, dass das primär unschuldige Opfer
[...] unter schweren Schuldgefühlen leidet, während der Täter weder Schuldgefühle hat noch
irgendeine Schuld anerkennt, kann eigentlich nur damit aufgelöst werden, dass das Opfer den
Täter lebensnotwendig braucht [...].“ (Hirsch, 2000, S. 457)
Hier klingt an, wie komplex bei genauerem Hinsehen das Beziehungsgeschehen ist, das sich
zwischen Täter und Opfer entwickelt und das in seiner vielschichtigen Bedeutung zentral für
den Inhalt des Traumas ist.
Meist übersteigt das Schuldgefühl in seinem Ausmaß jede reale Verantwortung, es kann aber
dennoch wichtig sein, den Teil der Verantwortung anzuerkennen, der tatsächlich beim
Traumatisierten lag. Herman (1993) weist auf die Tendenz hin, Schuldgefühle zu schnell zu
entkräften. Dies helfe jedoch auch den Klienten nicht, da es darum gehe, zwischen dem
tatsächlichen Anteil an Verantwortung und der zu Unrecht übernommenen Schuld zu
unterscheiden. Allerdings gestaltet sich dies häufig als besonders schwieriger Balanceakt.
Fischer warnt in diesem Zusammenhang davor, dass die Frage nach der „Mitschuld“ sehr
schnell in Richtung der typischen Abwehrstrategie der Umwelt geht, die - statt das
traumatische Leid anzuerkennen und auszuhalten, dass hier jemandem unschuldig etwas
Schlimmes zugestoßen ist - allzu schnell dem Opfer die Schuld gibt. Diese Strategie ist als
„blaming the victim“-Strategie bezeichnet worden und ist vor allem typisch für den
gesellschaftlichen Umgang mit Vergewaltigung (Fischer 1998, S. 181).
In Bezug auf die Vietnam-Veteranen war der bezeichnete Balanceakt von besonderer
Bedeutung. (Davon mehr im Kapitel „Täter“)
Die Schuldfrage lässt sich innerhalb der Dialektik des Traumas dem Pol der
Auseinandersetzung zuordnen, wobei diese Art der Auseinandersetzung sehr zwanghaften,
quälenden Charakter bekommen kann. So waren viele Holocaust- Überlebende jahrelang von
der Erinnerung an eine ganz konkrete Szene gequält, in der sie ihrer Meinung nach anders
hätten handeln können.
7.6. Re-Inszenierung und Wiederholungszwang
Wenn die Psyche von traumatischen Ereignissen überflutet wird und die
Verarbeitungsmöglichkeiten dementsprechend überfordert sind, erfolgt nicht unbedingt eine
unmittelbare Reaktion. Stattdessen „merkt“ sich die Psyche die Ereignisse und sucht zu einem
späteren Zeitpunkt nach einem Ausdruck für das Trauma, idealtypisch in der Hoffnung, dass
es dann bearbeitet werden kann.
Bereits Freud selbst war zu der Überzeugung gelangt, dass bestimmte Erinnerungen nicht
direkt analysiert werden können, sondern dadurch nach Bearbeitung „rufen“, dass sie in der
Übertragungsbeziehung mit dem Therapeuten wiederholt werden (vgl. Freud, 1914). Dieser
Vorgang wird auch als „Re-Inszenierung“ bezeichnet, und in Bezug auf Trauma als
„Wiederholungszwang“. Dem liegt eine ähnliche Vorstellung zu Grunde, wie dem
47
entwicklungspsychologischen Verständnis vom Spiel der Kinder: Kinder spielen in
Rollenspielen häufig Situationen nach, in denen sie sich als ohnmächtig erlebt haben. Im
Spiel wird die Beherrschung der Situation wiederhergestellt (vgl. Mertens 1992), die Kinder
wollen sich wieder als machtvoll erleben. Der erwachsene Traumatisierte, für den ebenfalls
das Erleben der Ohnmacht zentral war, stellt „Szenen“ her oder sucht „Szenen“ auf, die der
traumatisierenden Situation ähnlich sind. Man könnte sagen, dass die „Psyche“ diese
Situationen herstellt oder sucht, um diesmal - ähnlich den Kindern im Spiel - eine neue, eine
bessere Erfahrung zu machen. Dieser Versuch kann jedoch auch scheitern, dann nämlich,
wenn der Traumatisierte keine bessere Erfahrung macht, in der Re-Inszenierung nicht
„geheilt“, sondern retraumatisiert wird. Man spricht dann von Wiederholungszwang. In der
Wiederholung liegt also die Chance der „Heilung“ und gleichzeitig im „WiederholungsZwang“ ihr größtes Hindernis.
In einer sehr differenzierten Analyse „Der Umgang mit dem Trauma“, in der Hans
Holderegger (1998) die typischen Gefahren einer intensiven therapeutischen Beziehungsarbeit nach dem Trauma beschreibt, illustriert der Autor, wie sich das Phänomen der
Re-Inszenierung in der therapeutischen Beziehung auswirkt. In der sich zwischen
traumatisiertem Patienten und Therapeuten entfaltenden „Szene“ kann es nicht nur dazu
kommen, dass der Therapeut vom Patienten wie der Täter erlebt wird; auch umgekehrt fügt
der Patient dem Therapeuten oft unbewusst etwas von dem zu, was er als traumatisch erlebt
hat. Dies läuft nicht auf der konkreten Handlungsebene ab, sondern der Patient lässt den
Therapeuten in der Beziehungsdynamik (in Ansätzen) Ähnliches erleben.
Bei der sogenannten „Traumatophilie“ oder „Addiction to Trauma“ geht es möglicherweise
um den Genuss der Ausschüttung von körpereigenen Opiaten (danger thrill).
(Szene aus der Deerhunter)
Nach Einschätzung Fischers gab es in der Diskussion um das Konzept des
Wiederholungszwangs ein der prekären Schuldfrage verwandtes Problem: Im Zusammenhang
mit der so genannten Opferforschung wurde anhand des Konzepts der Traumatophilie die
Frage diskutiert, ob es eine typische „Opferpersönlichkeit“ gebe, die sich traumatische
Erfahrungen systematisch „zuziehe“. Die Diskussion erinnerte dann eher an die oben
skizzierte Abwehrstrategie “blaming the victim” (vgl. Fischer 1998).
7.7. Die Spuren des Täters im Opfer
Die Gewaltausübung des Täters am Opfer lässt sich aus psychologischer Sicht auch als
komplexes Beziehungsgeschehen analysieren. Dies ist deshalb von besonderer Bedeutung,
weil bei man-made disasters ein zentraler Schlüssel für das Verständnis des Traumas im
Verstehen dieses Beziehungsgeschehens liegt. Was hat sich zwischen Täter und Opfer
ereignet? Hier erscheint es besonders schwierig, allgemeine Aussagen zu treffen. Hatten Täter
und Opfer kaum, nur kurz, oder etwa im Rahmen einer Monate oder Jahre andauernden Haft
miteinander zu tun? Der Psychoanalytiker Hirsch versucht trotzdem folgende sehr allgemeine
Aussage: „[...] Schwere Traumatisierung bedeutet massive Grenzüberschreitung, ein
Einreißen der Grenze zwischen Subjekt und Objekt, Täter und Opfer. Der Implantation des
Bösen durch den Folterer folgt die Introjektion, das Einrichten einer entsprechenden
„tyrannischen Instanz“ im Opfer selbst, die es nun weiter entwertet und schuldig spricht − das
Introjekt macht Schuldgefühle.“ (Hirsch 2000, S. 642)
48
Was in der kognitiven Psychologie als “shattered assumptions“, als „erschütterte Annahmen“
bezeichnet wird, kann hier mit Blick auf das Täter-Opfer-Verhältnis differenziert werden: Der
Täter dringt durch die Tat in die Innenwelt des Opfers ein, zerstört nicht nur Grundannahmen,
sondern insgesamt die psychische Struktur des Opfers. Die ungerechtfertigte Übernahme des
Schuldgefühls ist dabei nur ein Teil. In vielen Fällen von man-made disasters (also z.B. bei
wiederholter Folterung durch den gleichen Folterer, bei Entführungen und bei wiederholtem
sexuellem Missbrauch) ist es für das Opfer lebensnotwendig, sich intensiv mit dem Täter zu
beschäftigen, sich partiell mit ihm identifizieren zu können, um ein Stück Kontrolle über die
ansonsten von purer Ohnmacht gekennzeichnete Situation zu bekommen. In diesem
Zusammenhang wird oft ein weiterer paradoxer Effekt beschrieben, nämlich dass ein
unwillkürliches Gefühl der Nähe zum Täter entstehen kann, welches das Opfer jedoch
wiederum innerlich in erhöhte Bedrängnis bringt, da es zugleich weiß, dass der Täter sein
Gegner bleibt und bleiben muss.
7.8. Rachegedanken
Im Vergleich dazu, dass Rache und Rachegefühle in der kulturellen Auseinandersetzung mit
Gewalt häufig vorkommen (etwa der elaborierte Racheplan der Hekabe in der griechischen
Tragödie oder Kriemhilds Rache im Nibelungenlied) sind Rache und Rachephantasien sehr
wenig zum Gegenstand der psychologischen Auseinandersetzung mit Folgen von
Gewalttraumata geworden. Wenn Rachephantasien angesprochen werden, dann eher in
kurzen Bemerkungen, die nicht näher diskutiert werden. So schreibt der Traumaexperte
Martin Bergmann kurz und lapidar:
„Ob es uns gefällt oder nicht, die natürliche Reaktion auf ein Trauma ist der Wunsch, anderen
dasselbe zuzufügen - nach Möglichkeit natürlich den Tätern, aber wenn dies nicht möglich ist,
dann eben anderen.“ (Bergmann 1993, S. 20)
Bergmann spricht hier von einer “natürlichen Reaktion", deutet aber die Schwierigkeit nur an,
diese als solche zu sehen. Judith Herman deutet Rachegefühle im Sinne des oben als ein
Kernstück von Trauma beschriebenen Ohnmachtgefühls. Sie sieht in Rachephantasien –
interessanterweise ganz analog dazu auch in Vergebungsphantasien – den Versuch, die
ohnmächtige Position wenigstens in der Vorstellung zu überwinden und stattdessen, je
nachdem, die Macht zu haben, vergeben oder rächen zu können. Der oder die Traumatisierte
sucht in der Rachephantasie Erleichterung, findet sie jedoch meistens nicht, da er oder sie, so
Herman, häufig in Konflikt mit ihrem Selbstbild komme und sich dann als “Monster" erlebe.
Die Bilder der Rachephantasie orientieren sich oft an der ursprünglichen Tat und können
deshalb die quälenden Erinnerungen verstärken und Angst auslösen. Für Herman ist das
Aufgeben der Rachephantasie deshalb ein Schritt zur Heilung:
„Wer seine Rachephantasien ablegt, gibt damit jedoch nicht auch seine Suche nach
Gerechtigkeit auf, ganz im Gegenteil: Nun ist die Zeit gekommen, sich wieder mit anderen
Menschen zusammenzutun und gemeinsam den Täter für seine Verbrechen zur Rechenschaft
zu ziehen.“ (Herman 1993, S. 269)
Während die Rachephantasien oft einsam sind (da es meist aus Scham schwer fällt, sie
mitzuteilen), ist die Suche nach Gerechtigkeit ein potentiell gemeinsames Anliegen. Unter
Bezugnahme auf Hannah Arendt, die betont, dass eine verbrecherische Tat die Gemeinschaft
bedroht und dass es deshalb um „das Gesetz selbst und nicht um den Kläger“ geht, formuliert
Herman eine Idealvorstellung von Genesung: Indem auch das Opfer nach einer Verurteilung
49
des Täters strebt, sieht es diese als Frage des Prinzips an und weniger als die Befriedigung
persönlicher Rachegelüste. Dies ermögliche das letztendlich heilsame Gefühl, „an einer
wichtigen sozialen Handlung mitzuwirken“ (Herman 1993, S. 301).
In vielen „therapeutischen“ Überlegungen ist Rache eine unreife Form der Reaktion auf
zugefügtes Unrecht, die in eine reifere Form transformiert werden muss. Dieser
Argumentation widerspricht explizit Reemtsma, selber ein Entführungsopfer, der hier den
Einfluss des gesellschaftlichen Interesses hervorhebt. Nicht weil es für das Individuum besser
ist, sondern weil die Gemeinschaft sich keine subjektive Willkür leisten will, müsse auf die
Rache verzichtet werden:
„Fairerweise sollte demnach die staatlich verhängte Strafe nicht als geläutertes Substitut der
Rache ausgelobt werden. Sie ist nicht das niedrige Bedürfnis in das sozial Akzeptable
transformiert. Denn der Rachewunsch ist kein niedriges Bedürfnis, es sollte (als im
Individuum fortbestehender Wunsch) nicht verachtet noch geächtet werden.“ (Reemtsma
2002, S. 81)
Reemtsmas Plädoyer impliziert auch, dass das Opfer, wenn es von der Rache Abstand nimmt,
tatsächlich einen Verzicht leistet. Das sollte auch für den therapeutischen Zuganggelten: Statt
im Sinne eines „das tut Ihnen nicht gut“ mögliche durch das Rachebedürfnis verursachte
Scham- und Schuldgefühle noch zu verstärken, könnte es dann darum gehen, den Verzicht auf
die persönliche Rache als Verzichtsleistung zu benennen und zu würdigen. Sie ist häufig auch
die einzige Art der „Vergebung“, die man Opfern abverlangen sollte.
Der Traumatisierte als anstrengendes Gegenüber (Aggression, Misstrauen)
Von besonderer Bedeutung ist die Auswirkung des Traumas auf Beziehungen auch deshalb,
weil im klassischen Verständnis das Trauma in einer weiteren Beziehung, der
therapeutischen, „geheilt“ werden soll. So ist z.B. die Erkenntnis hilfreich, dass sich der Hass
bzw. die Aggression, die eigentlich dem Täter gelten müsste, sehr häufig auf die Helfer und
Helferinnen richten. Dies trifft nicht nur die helfende Therapeutin, sondern diese Dynamik
entfaltet sich, da das Trauma als Agens wirksam bleibt, potentiell in jeder nachfolgenden
Beziehung. Der Täter ist wie ein unsichtbarer Dritter anwesend, die Beziehungen sind oft von
einer starken Destruktivität geprägt. In milderer Ausprägung wird das Gegenüber zumindest
erst mal „getestet“. Da es das Opfer als überlebensnotwendig erlebt hat, seinen Mitmenschen
nicht zu vertrauen, ist diese von Therapeuten oft als “Test" bezeichnete misstrauische
Grundhaltung, wie Reemtsma hervorhebt, eine angemessene neue Überlebensnotwendigkeit.
Reemtsma betont jedoch in diesem Kontext auch, dass das Trauma aus dem Opfer keinen
besseren Menschen mache, sondern dass der Traumatisierte ein anstrengender, verletzlicher
Mitmensch sei.
„Wem die normalen Erwartungen dem gegenüber, was er in einem Sozialverband für
möglich, wahrscheinlich oder unmöglich halten darf, so gestört worden sind wie dem Opfer
extremer Gewalt, der empfindet - posttraumatisch - eine generelle Verstörung, also, alltäglich
gesprochen, ein Misstrauen auch gegen diejenigen, die “gar nichts dafür können". So
einerseits scheinbar magisch, so ungerecht dieses Affektgemisch auch anmuten mag, es dürfte
durch noch so großes pädagogisches Raffinement nicht aus der Menschenwelt zu bringen
sein. [...] Der Traumatisierte wird durch sein Trauma nicht besser. Der Umgang mit ihm ist
mühsam, sein Verhalten tatsächlich scheinbar grundlos verletzend.“ (Reemtsma 1999, S.
210).
50
7.10. Scham
Als Erklärung für das Nichtsprechenkönnen und -wollen vieler Traumatisierter werden häufig
massive Schamgefühle angeführt. Scham ist ein zutiefst soziales und sozial geprägtes Gefühl.
Es scheint wiederum bei unterschiedlichen Traumatisierungen eine unterschiedlich
ausgeprägte Rolle zu spielen. Besonders stark sind Schamgefühle bei Opfern sexueller Gewalt
(vgl. Herman 1993) oder sexueller Folter (vgl. Becker 1992). Hier scheinen Opfer das Erlebte
sehr oft als etwas zu empfinden, was mit Ekelgefühlen behaftet immer noch an ihnen klebt
und das sie vermuten lässt, vom gegenwärtigen Gegenüber als Ekel erregend wahrgenommen
zu werden, so als wären sie an dem Erlebten schuld.
Lifton (1995) macht Scham aber auch als zentralen Faktor bei den Hiroshima-Überlebenden
aus: In diesem Fall besteht die Scham darin, dass ihnen so etwas “passieren konnte" und geht
so weit, dass sehr viele nicht zugeben wollen, dass sie zu den Bombenüberlebenden gehören.
Dabei ist jedoch nicht endgültig zu entscheiden, inwiefern die Hemmung, über das Erlebte zu
sprechen, mehr mit Scham oder mehr mit anderen Schutzmechanismen zu tun hat: Sicher
spielt dabei eine Rolle, dass im modernen, aufstrebenden Japan niemand mehr daran erinnert
werden will, dass man einmal derartig von den USA gedemütigt wurde. Insofern könnte man
auch sagen, dass die Scham der Überlebenden mit der Scham der Gesellschaft korrespondiert.
Die britische Historikerin Catherine Merridale (2000) arbeitet in der beeindruckenden
Untersuchung “Death and Memory in Russia” heraus, wie schwer es für Opfer des
Stalinismus bis heute ist, über das eigene Opfergewordensein oder die Ermordung von
Angehörigen zu sprechen. Neben einer andauernden Identifikation mit dem Aggressor
wecken auch ihre Beschreibungen den Eindruck einer zu Grunde liegenden großen Scham,
Opfer geworden zu sein.
8. Traumaursachen und verschiedene Arten von Traumatisierung
8.1. Mittelbare vs. Unmittelbare Betroffenheit
FR 151 Mittelbar von einem traumatischen Ereignis betroffen sind beispielsweise Angehörige
direkt betroffener Personen. Auch bei der mittelbaren Traumatisierung finden sich in der
Literatur verschiedene terminologische Vorschläge. Manchmal wird der Ausdruck
„Mitbetroffene“ verwendet, was zum Beispiel auf Angehörige von Opfern sexueller
Gewaltdelikte zutrifft. Diese sollen den Opfern zwar nicht gleich gesetzt werden. Der
Ausdruck kann aber auf die enorme emotionale Belastung der Angehörigen aufmerksam
machen. Bei der Weitergabe von Traumata über Generationen hinweg (transgenerationelle
oder intergenerationale Weitergabe) wird bisweilen der Ausdruck sekundäre Traumatisierung
benutzt. Diese Vorgänge wurden beobachtet an Holocaustopfern, die auf verschiedenen
Wegen ihre traumatische Erfahrung an die zweite Generation weitergeben. Vor allem wenn
über die extreme Belastung in der Familie nicht gesprochen wird, kann es zu sekundären oder
auch ‚tertiären’ Traumatisierung späterer Generationen kommen.
GvK: Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Traumatisierung über epigenetische
Veränderungen weitergegeben wird. Wenn z. B. durch Kriegserlebnisse ständig große
Angstzustände erzeugt werden, verändert sich vermutlich die Epigenetik und eine erhöhte
Angstbereitschaft oder Vulnerabilität kann weitervererbt werden.
51
Der Ausdruck „sekundäre Traumatisierung“ wird auch mit Bezug auf Traumahelfer
verwendet. Damit wird die emotionale Belastung bezeichnet, der diese oft ausgesetzt sind.
Das gilt für Katastrophenhelfer auf Intensivstationen, Polizeibeamte und psychologische
Heilberufe. Deswegen ist in diesen Tätigkeitsbereichen eine gute Supervision umso wichtiger.
8.1 Trauma wegen von der Natur oder von Menschen verursachten
Desastern
Autoren, die mit Opfern massiver Gewalt arbeiten (Becker, Brainin) kritisieren, dass nicht
unterschieden wird zwischen natürlichen Unglücksfällen und von Menschen erzeugter
Gewalt: Sie weisen darauf hin, dass durch die sehr allgemein gehaltene Trauma-Definition die
Spezifika der Gewaltanwendung aus dem Blick geraten. Judith Herman und andere haben
deshalb eine eigene Traumadiagnose für Gewaltopfer vorgeschlagen: das
Viktimisierungssyndrom. In der Auseinandersetzung mit extremer und massenhafter
Gewaltanwendung wird jedoch deutlich, dass auch diese Diagnose zu grob bleibt. Innerhalb
der Diagnose „Trauma als Folge von Gewalt“ sind folgende Unterscheidungen zu treffen:
Ist das Opfer im engeren Sinne „nur“ Opfer geworden oder gibt es eine komplizierte
Verschränkung von Opfer- und Tätergewordensein? Klassisches Beispiel hierfür sind die
Vietnamveteranen, die aufgrund der spezifischen Konstellation einerseits enorme Wut auf
einen Staat verspürten, der sie in diesen absurden Krieg geschickt hatte, andererseits unter
quälenden Schuldgefühlen litten. Die für Traumata u. a. charakteristische Erschütterung des
Weltbildes besteht dann zu großen Teilen darin, dem eigenen Weltbild und der eigenen Moral
nicht entsprochen zu haben. In den Traumafolgen und in den Perspektiven der Aufarbeitung
bedeutet dies einen wichtigen Unterschied zu Opfern, die in keiner Weise zu (Mit-) Tätern
wurden.
Lässt sich die traumatische Sequenz an einer einzigen Szene festmachen oder handelt es sich
um eine kumulative Traumatisierung, die über Wochen, Monate oder gar Jahre andauerte?
Das eine bezeichnen wir nach einer von Leonore Terr 1995 eingeführten Terminologie als
Typ-1-Trauma, das andere als Typ-2-Trauma.
Ein Trauma vom Typ-1 liegt vor, wenn es sich um ein kurzes, akutes und begrenztes
traumatisches Ereignis handelt, bei dem spätestens nach dem Geschehen selbst sozialer
Beistand, Schutz und Hilfe durch andere gegeben ist. Die Opfer können in der Regel mit
nahestehenden Personen oder Helfern über das Ereignis sprechen, beispielsweise nach
Unfällen, Naturkatastrophen oder kriminellen Überfällen. Diese Art von Trauma hat oft ihre
Ursache in Naturkatastrophen.
*
Dagegen spricht man von einem Trauma Typ-2, wenn Menschen wiederholte, länger
andauernde und schwere Bedrohungen und/oder Gewalt durch andere Menschen erleiden
müssen, z.B. bei längeren Geiselnahmen, Kriegshandlungen und Verfolgungen. Die
häufigsten Traumatisierungen vom Typ-2 ereignen sich in Deutschland jedoch im Rahmen
sogenannter familiärer Gewalt und hier wiederum in Form von emotionalen, physischen und
sexuellen Missbrauchshandlungen während der Kindheit. Diese Art von Trauma ist also von
Menschen verursacht.
Die Frage nach dem Typ der Traumatisierungist für die therapeutische Bearbeitung natürlich
von entscheidender Bedeutung, worauf in der entsprechenden Literatur erst in jüngster Zeit
52
hingewiesen wird: Konfrontative Methoden wie die des schnellen Debriefing nach einem
traumatischen Erlebnis (siehe unten S. 25 Fußnote 7) scheinen - wenn überhaupt - nur bei
kurzen, konkreten traumatischen Sequenzen geeignet.
Die Folgen einer lang anhaltenden, kumulativen Traumatisierung sind komplexer, vor allem
auch in den hier interessierenden langfristigen Auswirkungen auf soziale Beziehungen und in
der Interdependenz mit dem sozialen Gefüge.
Die letztgenannten Formen der Traumatisierung haben für die Opfer besonders
schwerwiegende Folgen. Insbesondere frühe Gewalt- und sexuelle Missbrauchserfahrungen
sowie emotionale Vernachlässigungen verursachen schwere Schäden in der nachfolgenden
Persönlichkeitsentwicklung. Da diese Traumata tabuisiert und schambesetzt sind, werden sie
oft jahrelang verschwiegen.
Eine Rolle spielen auch die Absichten der Täter. Wurde mit der Tat ein politisches Ziel
verfolgt? War es Zufall, dass gerade diese Person oder Personengruppe zum Opfer wurde
oder war die Tat gezielt gegen sie gerichtet? Handelt es sich um eine gezielte Tat, dann ist des
Weiteren zu unterscheiden, ob eine genozidale Absicht zugrunde lag oder eine nur auf
einzelne Personen bezogene Straf- oder Erpressungsabsicht, z.B. im Zusammenhang von
Kriegsmaß- nahmen. Leo Eitinger (1964) konnte innerhalb des vermeintlich gleichen
Traumas „KZ-Haft“ den Unterschied zwischen jüdischen und norwegischen Häftlingen
herausarbeiten. Da die jüdischen Häftlinge zur Vernichtung bestimmt waren, waren bereits
während der KZ-Haft ihre Überlebensschancen ungleich geringer, die “Traumafolgen" bei
den Überlebenden in vielerlei Hinsicht komplexer und schwer wiegender.
Verhältnis zwischen Täter und Opfer
Eine traumatische Situation wird für die Betroffenen komplexer, wenn der Täter zugleich eine
enge Beziehungsperson, ein Vertrauter des Opfers ist. FR schlagen für diese Konstellation
den Begriff des Beziehungstraumas vor. Im Englischen wird sie auch betrayal trauma, also
Verratstrauma genannt.
Die trau
matisch bedingte Orientierungsstörung, die Erschütterung des Selbst- und Weltverständnisses
ist in diesem Falle äußerst nachhaltig, da das Urvertrauen in die Zuverlässigkeit sozialer
Beziehungen generell erschüttert werden kann. Von den Eltern misshandelte Kinder leiden
unter dieser Konstellation ebenso wie Opfer sexueller Gewalterfahrung durch Freunde,
Bekannte oder den Ehepartner. Auch sexuelle Übergriffe oder Gewalthandlungen in
Psychotherapie und psychiatrischer Behandlung geschehen durch den eng vertrauten
Therapeuten und lösen insofern ein Beziehungstrauma aus. Langfristige, kumulative
Beziehungstraumen nehmen bisweilen die Form Double-bind-Situationen an.
Zum Beziehungstrauma kommt hier ein Orientierungstrauma hinzu, da das Vertrauen in die
Zuverlässigkeit der eigenen Kognitionen untergraben wird.
Dieses Vertrauen in die eigenen Kognitionen wird übrigens auch in vielen lügenhaften
Situationen untergraben und ist insofern ein großes, aktuelles Thema.
Traumatische Situationen enden nicht nach der objektiven Zeit und nicht per se schon dann,
wenn das traumatische Ereignis vorüber ist. Unter subjektiven und inter-subjektiven
Gesichtspunkten enden sie, vor allem wenn sie von Menschen verursacht werden, erst dann,
wenn die zerstörte zwischenmenschliche und ethische Beziehung durch Anerkennung von
Verursachung und Schuld wiederhergestellt wurde. Zeit allein heilt nicht alle Wunden.
53
Viermehr muss eine qualitativ veränderte Situation entstehen, die die traumatischen
Bedingungen überwindet und einen qualitativ neuen Anfang erlaubt. Bei dieser Auflösung
und Überwindung von traumatischen Situationen sind Schuldanerkennung,
Wiedergutmachung, aber auch Fragen von Sühne und Strafe von Bedeutung.
Die Problematik, die das Trauma aufwirft, kann ein Mensch nicht allein bewältigen.
Traumatische Situationen und die Verarbeitungs- und Selbstheilungsversuche der Betroffenen
haben wesentlich eine soziale Dimension. Das traumatisierte Individuum ist kein isoliertes
Einzelwesen, sondern um einen zunächst paradox klingenden Begriff zu verwenden, ein
‚individuelles Allgemeines’, d.h. die konkrete Realisation jener allgemeinen menschlichen
Möglichkeiten, sozialen Absprachen, Lebensprinzipien und Lebenswerte, an denen wir alle
teilhaben, so dass ihre Verletzung letztlich uns alle als eine eigene Möglichkeit betrifft. Für
das Trauma der Betroffenen, ihre traumatische Reaktion, den sich entwickelnden Prozess, den
Heilungsverlauf oder weitere traumatische Sequenzen ist nun von wesentlicher Bedeutung,
wie sich die Allgemeinheit zum individuellen Elend der Traumatisierten verhält. Unterliegen
diese der gesellschaftlichen Verdrängung, Ausgrenzung oder gar Missachtung, weil sie durch
ihr Leiden an die ‚Katastrophe’ erinnern, so ist für sie die traumatische Situation noch
keineswegs beendet. Entscheidend ist, ob wir im traumatischen Leid unserer Mitmenschen
das ‚allgemeine menschliche Wesen’ in seiner konkreten Ausformung erkennen oder darin
nur einen zwar bedauerlichen, statistisch aber durchaus ‚erwartbaren’ Einzelfall sehen.
Wichtig ist auch die Unterscheidung zwischen den verschiedenen Bereichen, in denen das
Weltbild traumatisierter Menschen erschüttert wurde. Psychotraumatologisch ist das von
Bedeutung, wenn wir die Auswirkungen von Naturkatastrophen und Katastrophen mit
menschlicher Verursachung miteinander vergleichen wollen. Im einen Fall wird unser
pragmatisches, im anderen unser kommunikatives Realitätsprinzip mehr oder weniger
nachhaltig erschüttert oder infrage gestellt. Das pragmatische Realitätsprinzip bezieht sich auf
den sachlich-gegenständlichen Umweltbereich, über dessen Funktionieren wir Kenntnisse zu
haben und den wir hinreichend kontrollieren zu können glauben. Das kommunikative
Realitätsprinzip zeichnet sich durch das Kriterium der sozialen „Wechselseitigkeit“ aus.
Dahinter steht die Annahme, dass der andere mich und mein Weltverhältnis ebenso
antizipieren kann wie ich das seine, was im Umgang mit Sachobjekten natürlich nicht der Fall
ist.
8.3.FrühkindlicheTraumatisierung
Wir haben schon gehört, wie verheerend sich frühkindlicher Missbrauch auf die spätere
Persönlichkeitsentwicklung auswirken kann. DV Als die klassische Trias früher
Traumatisierung werden in der Literatur üblicherweise Vernachlässigung, körperliche
Misshandlung und sexueller Missbrauch genannt. Am intensivsten erforscht dürfte die
körperliche Misshandlung sein, da diese bereits in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in
den USA thematisiert und zu ersten Meilensteinen der Forschung führte. In den späten 70er
und 80er Jahren geriet dann im Gefolge der internationalen Frauenbewegung der sexuelle
Missbrauch von Kindern in den Blick der Öffentlichkeit und dominierte lange Zeit den
öffentlichen wie den wissenschaftlichen Diskurs. Die Vernachlässigung war ursprünglich eher
als ein Nebenaspekt des Themas der körperlichen Misshandlung gesehen worden, dies vor
allem, weil sie meist unauffällig geschieht und zumindest zunächst kaum sichtbare Spuren
hinterlässt. Sie wurde erst wieder in den 90er Jahren Thema der „Abuse“-Forschung, jetzt
ergänzt durch das Wissen um emotionale Formen der Vernachlässigung.
54
Unter zeitlich-entwicklungspsychologischem Gesichtspunkt ist es im ersten Lebensjahr wohl
– neben körperlicher Misshandlung - die physische und emotionale Vernachlässigung, die in
einem fundamentalen Mangel an sensorischen Erfahrungen besteht und die „möglicherweise
der destruktivste und zugleich am wenigsten verstandene Aspekt der Kindesmisshandlung
(ist).“ (Perry et al., 1998, S. 284). Im zweiten und dritten Lebensjahr sind es dann v. a. die
körperlichen Misshandlungen, die traumatisierend wirken. Anders, als man spontan vermuten
würde, liegt die höchste Misshandlungsrate bei Kindern im Alter zwischen 0 und 3 Jahren,
und in den USA ist mehr als die Hälfte der Todesfälle in diesem Alter auf Misshandlungen
zurückzuführen (National Center on Child Abuse and Neglect, 2000, zit. nach Schore, 2007,
S. 169).
Dagegen ist der sexuelle Missbrauch, sofern er ohne Penetration und physische
Gewalteinwirkung erfolgt, im Säuglings- und Kleinkindalter möglicherweise, was die
pathologischen Folgen für das Kind betrifft, als weniger schwerwiegend einzuschätzen. Die
mit dieser Form von Missbrauch zusammenhängenden Vorgänge sind nämlich für das Kind
aufgrund seines kognitiven und emotionalen Entwicklungsstands in ihrer Bedeutung nur
eingeschränkt erfassbar und fallen daher tendenziell „mangels kognitiver
Wahrnehmungsmöglichkeiten ins ‚affektive Nichts.’“ (Riedesser et al., 2003, S. 12). Sexuelle
Übergriffe in späteren Jahren (die Mehrzahl der sexuellen Missbrauchshandlungen findet
zwischen drei und dreizehn Jahren statt, vgl. Wetzels, 1997, S. 156), wenn Generations- und
Geschlechtergrenzen sowie moralische Kategorien (Über-Ich) etabliert sind, wenn Schuldund Schamgefühle sowie Loyalitätskonflikte erlebbar sind, wirken der klinischen Erfahrung
von PraktikerInnen nach wesentlich destruktiver. Hier beweist sich die Abhängigkeit der
pathogenen Wirkung eines Traumas vom Lebensalter und dem kognitiv-emotionalen und
sozialen Entwicklungsniveau.
Neben diesen drei klassischen Misshandlungsformen ist in den letzten Jahren das Miterleben
häuslicher Gewalt (Kindler & Werner, 2005) in den Blickpunkt des Forschungsinteresses
gerückt. Ein Stiefkind der „Abuse“-Forschung ist nach wie vor die emotionale und seelische
Mißhandlung von Kindern („Niederbrüllen“, „Nicht mit dem Kind reden“ etc., vgl.
Bussmann, 2002), dies sicherlich vor allem deshalb, weil hier die Grenze zwischen noch
normalem und traumatisierendem Erziehungsverhalten besonders schwer zu ziehen ist (Behl
et al., 2003). Ein weiteres Ergebnis jüngerer Forschung ist die wichtige Erkenntnis, „daß das
gleichzeitige, überlagernde Auftreten verschiedener Formen der Kindesmisshandlung sehr
viel häufiger ist als das Erleiden einer einzigen Misshandlungsform.“ (Deegener, 2005, S. 52).
Vor allem in klinischen Studien wurde immer wieder die multiple Viktimisierung von
kindlichen Misshandlungsopfern belegt (Mullen, 1997; Silverman et al., 1996; Zanarini et al.,
1997).
Es ist davon auszugehen, daß v. a. Misshandlung und Vernachlässigung i. d. R. Hand in Hand
gehen.
Risikofaktoren aus der Kindheit:
55
Weitere ätiologische, zwischenmenschliche Faktoren bei der Entstehung von
Traumafolgestörungen sind laut Fischer und Riedesser Übersozialisation durch einen
übermäßig strengen, rigiden und einengenden Erziehungsstil. Ebenso wirkt sich aber
Untersozialisation mit einem ‚Laissez-faire’ Erziehungsstil negativ aus, der zu wenig oder
auch einseitig normative Strukturierung ermöglicht und so zu einem Mangel an Empathie,
Normenverständnis und Verständnis für die ‚Wechselseitigkeit’ sozialer Beziehungen führt,
die den Kern des kommunikativen Realitätsprinzips bildet
8.4. Häufung traumatischer Ereignisse oder Umstände
Wir haben schon davon gesprochen, dass sich belastende Ereignisse addieren und zu einer
56
Vulnerabilität beitragen. Wir haben auch schon von Typ-1 und Typ-2-Trauma gehört.
Fischer und Riedesser nennen das auch
Mono- und Polytramatisierung (von griechisch polys = vielfach
vs. Griechisch monos = einmalig). Die von Lenore Terr 1995 vorgeschlagene Unterscheidung
zwischen Typ I vs Typ II-Traumatisierungen deckst sich hiermit annäherungsweise und hat sich
durchgesetzt. Typ I-Trauma bezeichnet ein einmaliges überwältigendes Vorkommnis (‚one single blow’),
Typ II sich längerfristig hinziehende traumatische Umstände. Bei Polytraumatisierung wirken
verschiedene traumatische Ereignisse bzw. Umstände entweder simultan oder sukzessiv zusammen
und vervielfältigen so gegenseitig ihre Auswirkung auf das betroffene Subjekt.
Für den Vorgang einer zeitlich sukzessiven Polytraumatisierung werden in der Literatur zwei
unterschiedliche Begriffe vorgeschlagen, kumulative und sequentielle Traumatisierung.
Der Begriff des kumulativen Traumas nach Masud Khan (1963) bezeichnet eine Abfolge von
traumatischen Ereignissen oder Umständen, die jedes für sich subliminal (unterschwellig)
bleiben können, in ihrer zeitlichen Abfolge und Häufung jedoch die restitutiven Kräfte des Ich
so sehr schwächen, dass insgesamt eine oft sogar schwer traumatische Verlaufsgestalt
entsteht. Immer von neuem wird die ‚Erholungsphase’ unterbrochen. Die ständige
Wiederholung durchbricht die Abwehrbarriere und hinterlässt tiefe Spuren im
Persönlichkeitssystem. Viele Beziehungstraumata sind durch ihren Wiederholungscharakter
diesem Typus der Traumaentstehung zuzurechnen.
8.5.
Sequentielle Traumatisierung
Hans Keilson hat diese Form der wiederholten und sich über einen längeren Zeitraum
hinstreckenden Traumatisierung beschrieben und ist zu sehr interessanten Erkenntnissen
gelangt. Er war selbst ein Überlebender der Shoa, dessen Eltern in Birkenau umgebracht
wurden. Im Jahr 1934 wurde gegen den Mediziner und Lehrer in Deutschland ein Praxis- und
Publikationsverbot ausgesprochen. Er emigrierte 1936 in die Niederlande, wo er sich im Jahre
1943 einer Widerstandsgruppe anschloss, die ihm schon in dieser Zeit die psychologische
Betreuung jüdischer Waisenkinder, die ihre Eltern aufgrund der NS- Verfolgung verloren
haben, anvertraute (vgl. Vorwärts 1997 und Keilson 1979). Nach dem zweiten Weltkrieg
fungierte Keilson als Berater jüdischer Kriegswaisenorganisationen in den Niederlanden, ab
1967 war er Mitarbeiter der kinderpsychiatrischen Universitätsklinik in Amsterdam.
Im Rahmen seiner psychotherapeutischen und beratenden Tätigkeit mit jüdischen
Kriegswaisen führte Keilson von 1967 bis 1978 eine Längsschnittstudie über die
Auswirkungen der Verfolgung des NS- Terrors auf jüdische Kinder durch. Dabei bediente er
sich eines deskriptiv- klinischen und eines quantifizierend statistischen Verfahrens. In einer
follow- up Untersuchung wurden die nun erwachsenen Kriegswaisen „rund 25 Jahre nach
dem Ende des Krieges“ (ebd. S. 48) zusätzlich retrospektiv zu ihrer Biographie und
Bewertung ihrer Verarbeitung ihrer Erlebnisse befragt. Keilson ging der Frage der
alterspezifischen Traumatisierung von Kindern nach. Er untersuchte unterschiedliche
Auswirkungen der belastenden Lebenssituationen dieser Kinder unter Berücksichtigung ihres
Entwicklungsstandes. Die Einteilung der unterschiedlichen Entwicklungsstände erfolgt nach
psychoanalytischen und bindungstheoretischen Gesichtspunkten. Dieser Frage wird hier nicht
weiter nachgegangen, sondern es werden die Keilson’schen traumatischen Sequenzen als
Vorbild für eine Verallgemeinerung vor allem für den Bereich der psychosozialen Arbeit mit
Flüchtlingen dargestellt. In der Untersuchung Keilsons wird der Versuch unternommen, in
psychologisch- psychiatrischen und psychosozialen Begriffen die Schäden und das Leid der
Kinder zu beschreiben, die im Zuge der Okkupation der Niederlande in den Jahren 1940
57
1945 dem antijüdischen Terror ausgesetzt waren und diese als Vollwaisen überlebten, sei es
in den Verstecken, sei es in den Konzentrationslagern“ (ebd. S. 2).
Dieses Phänomen ist nicht nur als individueller Verlust der Eltern, sondern als
Gruppenphänomen der planmäßigen, gezielten Vernichtung der jüdischen Gruppe als eine
„traumatische Gesamtsituation“ (ebd. S. 2) zu fassen. Dabei spielte das
subjektive Verhalten zu der jüdischen Bezugsgruppe eine nur untergeordnete Rolle .
Der direkte gesellschaftliche Bezug der Verfolgung der jüdischen Gruppe in einem
spezifischen historisch- politischen Kontext ist für Keilson zentral. Eine individuelle
Betrachtung der Einzelschicksale hieße, die Lebenslagen der Untersuchten
„miss[zu]verstehen“ (ebd. S. 55). Mit dem Verständnis der Lebensereignisse der jüdischen
Kriegswaisen als man-made desaster wird „zugleich die psychologische und die historischpolitische Dimension des Verfolgungsgeschehens“ (ebd. S. 54) beschrieben. Nach dem Ende
des zweiten Weltkrieges lebten in den Niederlanden 2041 jüdische Kriegswaisen, die Krieg
und Verfolgung in Europa überlebt hatten, und 401 sog. ‚indische’ Waisen, die aus der
ehemaligen Kolonie Niederländisch- Indien aus japanischen Konzentrationslagern in die
Niederlande zurückkehrten. Für all diese Kinder mussten bis zur Volljährigkeit
Entscheidungen „hinsichtlich der Vormundschaft und des zukünftigen Erziehungsmilieus
getroffen werden“ (ebd. S. 5). Zur Klärung dieser Fragen wurden in sog. ‚Streitfällen’
„ausführliche psychiatrische Gutachten, meist von Child Guidance Clinics und der
sozialpsychiatrischen Abteilung der jüdischen Waisenorganisation“ (ebd. S. 10) verfasst.
‚Traumatisierungen’ erlebten die von Keilson betreuten und untersuchten Kinder in
verschiedenen Situationen. Keilson betonte, dass die Traumatisierung der Kinder auch nach
Kriegsende weiterging, als die Zeit der Verarbeitung anbrach und aus unterschiedlichen
Bedingungen die traumatischen Erlebnisse doch nicht verarbeitet werden konnten. Von
historisch kontextualisierten „traumatischen Situationen“ (ebd. S. 61) ausgehend, definiert er
drei Sequenzen:
Erste Sequenz
„Das einzigartige Charakteristikum der damaligen Situation war, dass nicht die
Selbstinterpretation dieser Gruppe oder die Interpretation des Einzelnen bezüglich seiner
Zugehörigkeit letzthin dessen Verhalten in einer bestimmten- in diesem Fall drohendenSituation reguliert, sondern die Interpretation anderer, fremder Individuen oder
Mehrheitsgruppen über das Schicksal der Angehörigen der jüdischen Gruppe entschied.“
(ebd. S 36) Ähnliches kann über Flüchtlinge heute gesagt werden, nämlich dass die
Selbstinterpretation über die Gruppenzugehörigkeit im Krieg oder auch als Flüchtling eher
unwesentlich ist im Vergleich zu Fremdzuschreibungen und deren konkrete Auswirkungen.
Zeitlich umfasst die erste traumatische Sequenz die Anfangsphase der Verfolgung, die
deutsche Besetzung der Niederlande mit dem beginnenden Terror gegen die jüdische
Minderheit. Sie enthielt alle Ängste der Besetzung der mit dem Abbröckeln des
Rechtsschutzes und mit dem Tragen des gelben Sternes beginnenden und sich immer schärfer
anlassenden Verfolgung (kumulierend in den Razzien und den Deportationen); den Angriff
auf die Integrität der Familie, der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz, die
Ghettoisierungen, die ängstliche Erwartungshaltung der kommenden Untaten, das plötzliche
Verschwinden von Angehörigen, Bekannten, Freunden, Spiel- und Schulkameraden“ (ebd. S.
56f). Zusammenfassend bezeichnete Keilson diese Sequenz als eine „panische Auflösung der
eigenen vertrauten Umgebung“ (ebd. S. 57).
Zweite Sequenz
Die zweite traumatische Sequenz beginnt mit der direkten Verfolgung, der Trennung von den
58
Eltern und dem Verstecktsein bzw. der Konzentrationslagerhaft und endet mit der Befreiung
von den deutschen Besatzern und dem Ende des Krieges. Eltern und Kinder werden in dieser
Periode deportiert. Die jüdischen Kriegswaisen halten sich in Konzentrationslagern oder im
Versteck auf. Die Belastungen in dieser Zeit „enthalten neben der direkten Lebensbedrohung,
der Rechtlosigkeit ihrer Situation, dem Ausgeliefertsein an eine feindliche Umgebung, die im
stressorischen Sinn zu verstehenden Dauerbelastungen wie Entbehrung, Hunger, Krankheit;
ferner eindeutig die psychologischen Erlebnisqualitäten der ‚generellen Bedrohlichkeit’, wie
Zermürbung, Infragestellung und Vernichtung mitmenschlicher Verhaltensweisen [...] durch
die Konfrontation mit der brutalen Macht, dem Grauen und dem Tod“ (ebd. S. 57). Die
Belastungen in dieser Phase setzen sich für die Kinder aus zwei Dimensionen zusammen, der
aktuellen Kriegssituation sowie der Pflegekindschaft der ‚Versteckten’.
Dritte Sequenz
Die dritte traumatische Sequenz beginnt schließlich in der Nachkriegsperiode mit all ihren
Schwierigkeiten der Wiedereingliederung. Sie ist gekennzeichnet durch die „Rückkehr aus
der Rechtlosigkeit in rechtlich gesicherte und bürokratisch geordnete Zustände“ (ebd. S. 58).
„Maßnahmen hinsichtlich der Vormundschaft und hinsichtlich ihrer weiteren Unterbringung
[...] bedeuteten neue Eingriffe in das Leben der Kinder aus der stark dezimierten jüdischen
Bevölkerungsgruppe. Die Waisenschafts- und Vormundschaftsproblematik war unlösbar
verbunden mit der Konfrontation mit der Modalität des Todes der Eltern“ (ebd. S. 58). „Das
‚Auftauchen’ oder ‚Zurückkehren’ geschah in eine andere Welt, als die, die man verlassen
hatte. Das Ende der Lebensbedrohung, der Beginn der Rehabilitationsmaßnahmen, der
Versuch der Aufarbeitung der entstandenen Schäden und Lücken führte nur zu oft zu einer
Verstärkung der Konfrontation mit den erlittenen Traumata und dadurch zu neuen
Schädigungen“ (Keilson 1979, S. 58). Auch „Trauer und Schuldgefühl der Überlebenden“
(ebd. S. 78) tauchen meist erst in der dritten Sequenz auf.
Von vielen der untersuchten jüdischen Kriegswaisen wurde in der Follow- Up- Untersuchung
immer wieder die dritte traumatische Sequenz „als die eingreifendste und schmerzlichste ihres
Lebens bezeichnet, und zwar nicht nur ihrem subjektiven Ermessen nach, sondern auch
aufgrund objektiv aufzeigbarer Kriterien“ (ebd. S. 58).
Im Idealfall sollten die Kinder aus einem Zustand der „Passivität, Duldung, des Mit- sichgeschehen- Lassens“ (ebd. S. 70) in eine Lage versetzt werden, in der „auf einmal an ihre
Aktivität, ihre Initiative, ihre Entschlusskraft und an ihren Einsatz appelliert wurde“ (ebd.).
Häufig dominierte insbesondere im Zusammenhang mit sorgerechts- und
vormundschaftsrechtlichen Entscheidungen „das Gefühl des Ausgeliefertseins an Instanzen,
die über Wohl und Wehe der Kinder gebieten“ (ebd. S. 76f). In der Nachuntersuchung wiesen
die befragten Erwachsenen „die Nachkriegsperiode als die schwierigste Phase der extremen
Belastungssituation an“ (ebd. S. 73).
Diese sei auch die entscheidende Phase für den weiteren Werdegang der Betroffenen. Nicht
die Qualität und Quantität der Erlebnisse in der ersten oder der zweiten Sequenz erwies sich
als ausschlaggebend für eine erfolgreiche Verarbeitung der Erlebnisse, sondern die
Lebensbedingungen in der Nachkriegsperiode.
Die von Keilson definierten Sequenzen für jüdische Kriegswaisen sind auf die Erfahrungen
von Krieg, Verfolgung, politischen Repressionen und Flucht heutiger Flüchtlinge
verallgemeinerbar. Beide Gruppen- die jüdischen Kriegswaisen wie heutige Flüchtlingekönnen als sequentiell traumatisiert gefasst werden. Unter Einbezug der unterschiedlichen
59
historischen Situationen scheint für beide Gruppen die Bestimmung unterschiedlicher
belastender Sequenzen sinnvoll, um ihre Leiden und Erlebnisse konzeptionell fassbar zu
machen. Insbesondere die dritte Keilsonische Sequenz der Zeit nach der unmittelbaren
Verfolgung ist für Flüchtlinge insgesamt strukturell ähnlich bestimmbar, wie für die von
Keilson untersuchten jüdischen Kriegswaisen. Für beide Gruppen besteht nach den
Erlebnissen unmittelbarer existenzieller Bedrohung die äußere und belastende Notwendigkeit
der Klärung ihres rechtlichen Status auch mittels klinisch- fachlicher Begutachtung, wie die
Aufgabe, nach ihren Erlebnissen von extremen Leid, weiter leben zu müssen. Die
Keilson’sche Forderung des Einbezuges der spezifischen Kontexte der jüdischen
Kriegswaisen und der für eine Gruppe in einer spezifischen historischen Situation gefassten
Sequenzen, kann durch den Einbezug strukturell ähnlicher Prämissen, Gründe bzw.
Zusammenhänge auch für andere Gruppen fruchtbar gemacht werden. Das psychische
Befinden wird nicht isoliert oder abstrakt mit äußerlichen Lebensereignissen verbunden
dargestellt, sondern in einem je konkreten gesellschaftlichen Kontext situiert. Das
Keilson’sche Konzept richtet den Blick auf den Prozess der Lebensbedingungen, der nicht mit
einem konkreten ‚traumatischen Ereignis’ erschöpfend beschrieben ist, auch nicht mit der
Abfolge von ‚traumatischen Ereignissen’ während der Verfolgungszeit. Bedeutsam ist, dass
der Nachkriegszeit, dem Umgang in der Nachkriegszeit mit dem Erlebten, aber auch dem
gesellschaftlichen Umgang mit den Überlebenden Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das gilt
für damals wie für heute.
Sequentielle Traumatisierung bedeutet, Trauma nicht als einen einmaligen Vorgang zu
denken, sondern als einen langen Prozess mit verschiedenen Phasen bzw. verschiedenen
traumabezogenen Sequenzen.
Diesem neuen Konzept von „Trauma als Prozess“ liegt insofern ein radikal anderes Verstehen
von Trauma zu Grunde, als nun nicht mehr ein traumatisches Ereignis, sondern eine Abfolge
von Trauma zugrunde, als nicht mehr ein Ereignis, sondern eine Abfolge von Ereignissen
betrachtet wird. Damit wird die Rede von einem „post“-traumatischen Syndrom eindeutig
irreführend, da aufeinander folgende traumatisierende Ereignisse und die Entwicklung von
Traumasymptomen eine Einheit darstellen. Auch das unterstreicht den Prozesscharakter von
Traumatisierungen und der Entwicklung von Traumafolgestörungen.
Inzwischen verweisen auch andere Traumaforscher auf den Prozesscharakter, indem sie zum
Beispiel ganz allgemein von der nicht zu unterschätzenden Bedeutung der „postexpositorischen Phase“ (vgl. z.B. Fischer, 1998) sprechen. Entscheidend für die Entwicklung
psychischer Schwierigkeiten ist also nicht nur, wie grausam das Trauma an sich war, sondern
immer auch wie es unmittelbar danach und später weiterging.
Diese Ergebnisse sind von enormer Bedeutung sowohl für die individuelle Traumatherapie als
auch für die Reflexion kollektiver Prozesse. Die Aufmerksamkeit des Gegenübers allgemein
wie auch des Therapeuten, der das Leiden des Opfers verstehen will, richtet sich meist intuitiv
fast nur auf das, was in der ersten traumatischen Sequenz geschah („Wenn ich weiß, was dir
vom Täter angetan wurde, kann ich dich besser verstehen“). Das Konzept von Trauma als
Prozess und der sequentiellen Traumatisierung ist vor allem deshalb revolutionär, weil es alle
„mit in die Pflicht nimmt“, die mit dem Opfer zu tun hatten und haben, auch nach der
Traumatisierung. Dies ist unmittelbar von politischer Bedeutung, wenn es etwa um
Flüchtlingspolitik geht: Zur Heilung des Traumas kann die aufnehmende Gesellschaft einen
wichtigen Beitrag leisten; es besteht jedoch die erhebliche Gefahr der Re-Traumatisierung,
wenn beispielsweise Befragungen durch die Polizei (oder andere Konfrontationen mit ihr) der
60
ursprünglichen traumatischen Szene stark ähneln. David Becker formuliert es so, dass es in
Keilsons Verständnis von Trauma also nicht nur um die Aufarbeitung vergangener
Verbrechen gehe, sondern um die „fortgesetzte Relevanz der sozialen Umwelt, auch viele
Jahre später noch“ (Becker, 2001c).
8.6. Komplexe posttraumatische Belastungsstörung
Wikipedia: Als komplexe posttraumatische Belastungsstörung (komplexe PTBS) wird ein
psychisches Krankheitsbild bezeichnet, das sich infolge schwerer, anhaltender
Traumatisierungen (z. B. Misshandlungen oder sexueller Missbrauch, Kriegserfahrung,
Folter, Naturkatastrophen, physische oder emotionale Vernachlässigung in der Kindheit,
existenzbedrohende Lebensereignisse) entwickeln kann. Es kann sowohl direkt im Anschluss
an die Traumata als auch mit zeitlicher Verzögerung (Monate bis Jahrzehnte) in Erscheinung
treten. Im Unterschied zur Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) ist es durch ein
breites Spektrum kognitiver, affektiver und psychosozialer Beeinträchtigungen
gekennzeichnet, die über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben. Der Begriff Komplexe
PTBS (engl. Complex PTSD, C-PTSD) wurde für dieses Krankheitsbild erst 1992 durch die
amerikanische Psychiaterin Judith Herman eingeführt und ist im deutschen Sprachraum
bislang noch nicht vollständig etabliert.
Der Begriff geht zurück auf eine kritische Auseinandersetzung mit der Definition und den
diagnostischen Kriterien der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die 1980 in der
dritten Ausgabe des Diagnostischen und Statistischen Manuals Psychischer Störungen (DSMIII) der American Psychiatric Association (APA) publiziert wurden. Die diagnostischen
Kriterien der PTBS konzentrierten sich auf Symptome, die bei Kriegsteilnehmern beobachtet
worden waren und eigneten sich nicht dazu, auch die Störungsbilder zu beschreiben, die bei
missbrauchten Kindern beobachtet werden konnten. Insbesondere eigneten sich die PTBSKriterien nicht zur Diagnostik von psychischen Problemlagen, die sich etwa als Spätfolgen
des Kindesmissbrauchs im Jugend- und Erwachsenenalter entwickelten.
Basierend auf den daraufhin von der DSM-Arbeitsgruppe der APA initiierten
Felduntersuchungen ließ sich ein komplexeres Krankheitsbild identifizieren, das im Gefolge
besonders schwerer oder wiederholten bzw. langanhaltenden Traumatisierungen wie
psychischer, körperlicher oder sexueller Gewalterfahrungen, aber auch bei Kriegs- und
Foltererfahrungen oder Entführungen entsteht und als „Störung durch Extrembelastung, nicht
anderweitig bezeichnet“ („Disorder of Extreme Stress Not Otherwise Specified“ (DESNOS),
Anhang DSM IV) begrifflich gefasst wurde. Diese Kategorie sollte nach den Vorstellungen
der Arbeitsgruppe in der nächsten Überarbeitung des DSM als „Komplexe Posttraumatische
Belastungsstörung“ neu gefasst und aufgenommen werden. Das ist aber weder im DSM-IV,
noch im DSM-V geschehen. Ein sehr ähnliches Krankheitsbild wird, wie wir gesehen haben,
in der ICD-Diagnose F62.0 „Andauernde Persönlichkeitsänderung nach Extrembelastung“
beschrieben. Nach den klinischen Beschreibungen und diagnostischen Leitlinien der ICD-10
„sollen“ die „späten chronischen Folgeerscheinungen von verheerenden Belastungen, d. h.
die, die sich erst Jahrzehnte nach der belastenden Erfahrung entwickeln, […] unter F 62.0“
(übersetzt aus dem Englischen) klassifiziert werden.[3]
Im Rahmen einer komplexen Posttraumatischen Belastungsstörung können im Verlauf der
61
Erkrankung eine Vielzahl von Symptomen auftreten. Legt man die diagnostischen Kriterien
zugrunde, mit denen die sehr ähnliche DESNOS beschrieben wurde, lassen sich die
Symptome aber sechs übergeordneten Bereichen zuordnen:
I. Veränderungen in der Regulation von Affekten und Impulsen (Affektregulation, Umgang
mit Ärger, autodestruktives Verhalten, Suizidalität, Störungen der Sexualität, exzessives
Risikoverhalten)
II. Veränderungen in Aufmerksamkeit und Bewusstsein (Amnesien, zeitlich begrenzte
dissoziative Episoden und Depersonalisationserleben)
III. Veränderungen der Selbstwahrnehmung (geringe Selbstwirksamkeit, Stigmatisierung,
Schuldgefühle, Schamhaftigkeit, Isolation und Bagatellisierung, Verlust des
Selbstwertgefühls)
IV. Veränderungen in Beziehungen zu anderen (Unfähigkeit anderen Personen zu vertrauen,
Reviktimisierung, Viktimisierung anderer Personen)
V. Somatisierung (Gastrointestinale Symptome, chronische Schmerzen, kardiopulmonale
Symptome, Konversionssymptome, sexuelle Symptome)
VI. Veränderungen von Lebenseinstellungen (Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, Verlust
früherer stützender Grundüberzeugungen)
Es kann sogar zu einer Aufspaltung der Persönlichkeit in verschiedene Persönlichkeitsanteile
kommen, der sogenannten Persönlichkeitsspaltung oder „struktureller Dissoziation“ )Huber.
Im ICD-10 werden etwas andere und weniger genaue Symptome beschrieben. Dort ist es
erforderlich, dass mindestens zwei der folgenden Persönlichkeitsänderungen beschrieben
werden:
- feindliche oder misstrauische Haltung (=IV im DSM)
sozialer Rückzug (=III)
andauerndes Gefühl von Leere und Hoffnungslosigkeit (das ggf. mit einer gesteigerten
Abhängigkeit von anderen, der Unfähigkeit, negative oder aggressive Gefühle zu äußern,
oder anhaltenden depressiven Symptomen einhergehen kann) (=VI)
andauerndes Gefühl von Nervosität oder von Bedrohung ohne äußere Ursache (das ggf. zu
Gereiztheit oder Substanzmissbrauch führen kann)
andauerndes Gefühl der Entfremdung (anders als die anderen zu sein), ggf. verbunden mit
dem Gefühl emotionaler Betäubung. (=III?)
Die beschriebene Symptomatik darf vor dem traumatischen Ereignis nicht vorhanden
gewesen sein und nicht durch eine andere psychische Störung (z. B. Depression) bedingt sein.
Die beschriebene Persönlichkeitsänderung muss seit mindestens zwei Jahren bestehen. Im
Falle einer vorangegangenen Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) sollte eine
anhaltende Persönlichkeitsänderung nur angenommen werden, wenn die PTBS vorher
mindestens zwei Jahre lang erfüllt war (das heißt, die Diagnose erfordert hier mindestens zwei
Jahre PTBS plus mindestens zwei Jahre Persönlichkeitsänderung).
Unter anderem wegen der nicht abschließend geklärten Überschneidungen mit anderen
psychischen Krankheitsbildern existieren nur wenige Erkenntnisse über die Prävalenz der
komplexen PTBS.
62
9. Weitere Traumatisierungsarten
9.1. Retraumatisierung
Mit dem Begriff der Retraumatisierung sind Zustände des Betroffenen gemeint, in denen eine
erneute Erinnerung an das traumatische Ereignis direkt zu einer Symptombelastung führt.
Retraumatisierungen können auch hervorgerufen werden in juristischen oder polizeilichen
Kontexten, durch häufige Betrachtung des traumatischen Ereignisses in Filmen sowie durch
Medienaktivitäten gegenüber Opfern. Techniken der Traumakonfrontation sind jedoch
eindeutig von einer Retraumatisierung zu unterscheiden, da die therapeutische
Traumakonfrontation gewollt, geplant und in einem sicheren Setting mit dem Ziel der
Verarbeitung des Vergangenen durchgeführt wird. Allerdings können vorschnelle
Traumakonfrontationen bei nicht ausreichender Stabilisierung bzw. bei einem unsensiblen
Vorgehen des Therapeuten zu einer Retraumatisierung führen und den Behandlungserfolg
gefährden oder gar zu einer anhaltenden Dekompensation beitragen.
Bereits in „friedlichen Zeiten”, jenseits kollektiver Gewalt, gerät die konventionelle
juristische Praxis in Konflikt mit den Anforderungen eines traumasensiblen Umgangs mit den
Opfern. Sobald ein „Trauma” in der Form einer Anzeige gegen eine Straftat artikuliert wird,
wird das Opfer zugleich zum Objekt des Rechtssystems. Es geht dann nicht mehr primär um
die Bedürfnisse des Opfers, sondern die Tat wird zu einem eigenen Anliegen des Staates.
Dieser verfolgt dabei verschiedene Ziele, von denen sich eines, nämlich das Ziel der
Strafverfolgung und Verurteilung, besonders massiv auch auf das Opfer auswirkt. Das Opfer
wird in Verfolgung dieses Ziels zum Zeugen, dessen Aussage nun nach den Kriterien einer
Zeugenaussage kritisch bewertet werden muss; es muss sich daher den entsprechenden
Methoden, etwa dem Kreuzverhör unterwerfen. Art, Ziel und Logik von Vernehmungen
widersprechen in vielen Aspekten den aus der Traumatheorie bekannten Bedürfnissen des
Opfers nach Sicherheit und Wiederherstellung der eigenen Würde. So werden kritische
Nachfragen (oft zu Recht) als Misstrauen erlebt und können im Extremfall zu einer
Retraumatisierung führen. Das Gleiche gilt für Interviews im Asylverfahren, wo schon
geringfügige Widersprüche in der Aussage zu Ablehnung führen können. Dabei sind
lückenhafte Erinnerungen eine bekannte Traumafolge.
Bei Wahrheitskommissionen dagegen stehen andere Ziele im Vordergrund, so dass sie
Zeugen mit einer anderen Logik anhören können. Da es nicht um die Strafverfolgung
einzelner Täter geht, kann das Opfer seine Geschichte so erzählen, wie es sie erlebte, seine
Bedürfnisse passen eher zum Anliegen der Wahrheitskommission, die Geschichte
rekonstruieren will. Heilsam wirkt dabei im Idealfall die Erfahrung, dass einem geglaubt
wird, dass das Erlebte öffentlich anerkannt wird. Minow (1998, S. 60) zitiert in diesem
Zusammenhang Pumla Gobodo-Madikizela, die als Psychologin für die
Menschenrechtskommission arbeitete. Für das Opfer sei es wichtig, von offizieller Seite zu
hören “you are right, you were damaged, and it was wrong”. In diesem Sinne kann eine
Wahrheitskommission die oben beschriebene Funktion erfüllen, das Erlebte als Unrecht zu
benennen statt als Unglück, das einem widerfuhr (vgl. S. 55ff).
9.2. Tätertraumatisierung
Ruppert: „ Von der Täterseite her gibt es auch eine Selbsttraumatisierung. Denn auch Täter
haben eine gesunde Psyche, die sie nicht loswerden und die die Realität sieht. Deswegen
entstehen Scham, schlechtes Gewissen etc. Wenn man mit diesem Bewusstsein weiterlebt,
63
hält man das nur schwer aus. Ein Täter braucht also auch Überlebensstrategien. Er muss also
die Erinnerung an die Signale des Opfers wegschließen, also einen inneren Kokon bauen. Die
Wirkung davon ist zu sagen, dass man es nicht war oder nichts passiert ist oder es nicht so
schlimm war, also zu verleugnen, zu minimieren oder auf Nebenschauplätze abzulenken.
Täter haben ein Bedürfnis, sich möglichst öffentlich als unschuldig darzustellen, wenn
möglich als Philantrop, Politiker, Wohltäter etc. Täter sind in ihrem brüchigen
Selbstbewusstsein schnell beleidigt und gekränkt. Jeder Anlass von Beleidigung wird ganz
groß aufgebauscht, um sich als Opfer darstellen zu können. Ähnlich wie die Opfer verstecken
sich die Täter auch gern hinter einem Wir: wir Österreicher, unsere Familie etc.
Trauma ist zudem mit Aufgabe der Identität verbunden. Man muss meine Identität so lange
aufgeben, wie man Täter ist. Denn man muss versuchen, nicht der zu sein, der man ist. Dann
kann man auch nicht mehr die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Dann kann man
auch entsetzliche Befehle und Anordnungen erteilen, ohne sich verantwortlich zu fühlen.
Entschuldigungen nach dem II .Weltkrieg lauteten häufig sinngemäß: Ich habe ja nur Befehle
ausgeführt. Das eigene Ich, die eigene Identität aufzugeben und sich hinter einem kollektiven
Wir zu verstecken ist trotzdem eine der fatalsten Täterstrategien, weil sie den Kern der
Persönlichkeit aushöhlen. Im Falle einer solchen psychischen Fragmentierung haben die
eigenen Gefühle keinen Bezugspunkt mehr. Täter können durchaus sentimental sein, aber das
flippt hin und her. Hitler hatte aggressive Ausbrüche, war larmoyant, wütend, aber es
schwankte stark und hatte keine Folgen. Dann nimmt ein Täter gern Medikamente,
Rauschmittel oder agiert aus. Feinde ergeben sich immer. Als Mensch sind Täter nicht
wirklich präsent, sondern in ihren Verleugnungs- und Überlebensstrategien verstrickt.“
Häufig vermischen sich Täter- und Opfersein. (Kühner) In Bezug auf die Vietnam-Veteranen
war der bezeichnete Balanceakt von besonderer Bedeutung.
Im Gegensatz zu vielen anderen kollektiven Traumata handelt es sich beim kollektiven wie
beim individuellen US-amerikanischen Vietnamtrauma um ein „Tätertrauma“, dessen
Leitsymptome durch reale Mit-Verantwortung für Grausamkeiten verursacht sind. In der
kollektiven Traumabearbeitung geht es deshalb vor allem um eine gesellschaftliche
Auseinandersetzung mit dieser Verantwortung und Schuld. Durch ihre Aktivitäten forderten
die Veteranen diese Auseinandersetzung ein, die bis dahin kaum stattfand und gewannen auf
diesem Wege einen Teil ihrer Selbstachtung zurück.
Der amerikanische Psychiater Robert Lifton nannte sein Buch über die Veteranen “Neither
Victims nor Perpetrators”. Die Soldaten in Vietnam seien von ihrem Staat für einen
ungerechten und grausamen Krieg instrumentalisiert worden, insofern also Opfer, innerhalb
dieses Opferseins jedoch auch zu Tätern in diesem Krieg geworden. Lifton hat in seiner
Arbeit mit Selbsthilfegruppen ein Konzept entwickelt, das helfen sollte, die meist lähmende
Auseinandersetzung mit der eigenen Schuld umzuwandeln: das der “animating guilt” (Lifton,
1973). Lifton sah, dass er den Vietnam-Veteranen die Schuld nicht ausreden konnte, da sie
tatsächlich auch schuldig geworden waren. Es musste deshalb darum gehen, diese
Schuldgefühle in etwas Lebendig-Machendes zu verwandeln, von der Lähmung zum Handeln
zu kommen.
In diesem Zusammenhang ist außerdem der Hinweis von Shay (1994) bedeutsam, der bei
kriegstraumatisierten Vietnam-Veteranen einen Verstoß gegen geschriebene oder
ungeschriebene Regeln als wichtigen Faktor für die Entwicklung schwer wiegender
Symptome feststellte. Den Schuldgefühlen liegt also unter Umständen auch ein Versagen vor
der eigenen Moral zugrunde. Als quälende Sequenz, an der sich für sie Schuldgefühle
festmachten, tauchten bei vielen Veteranen nicht vietnamesische Opfer, sondern die Bilder
64
von Kameraden auf, für deren Tod sie sich mitverantwortlich fühlten (vgl. S. 88). (Courage
under fire)
Die amerikanische Sozialarbeiterin Noemi Noka Zador berichtet (1995) von ihrem in der
klinischen Arbeit mit Veteranen gewonnen Eindruck, dass diejenigen am längsten und am
schwersten leiden, die real schwere Grausamkeiten begangen hatten:
„Es ist, als ob sich der Veteran nicht von der Erkenntnis erholen kann, dass er etwas
Unverzeihliches mit realen, entsetzlichen und irreversiblen Folgen getan hat. Obwohl viele
Veteranen schon Jahre von Psychotherapie und psychopharmakologischer Behandlung hinter
sich haben, beklagen sie sich immer noch darüber, hoffnungslos und demoralisiert zu sein und
ihre Leben als sinnlos zu empfinden... Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass die
Fähigkeit ein Leben zu leben, in dem Erlösung ein zentrales Thema ist, eine essenzielle und
unerlässliche Komponente im Heilungsprozess darstellt.“
(“It is as if the veteran cannot recover from the realization that he committed an unforgivable
act with real, horrifying and irreversible consequences. Although many of them have been
through years of psychotherapy and psychopharmacological treatment, they still complain of
being hopeless, demoralized and that their lives are devoid of meaning. (...) I have become
more and more convinced that the ability to live a life where redemption is a central theme is
an essential and indispensable component of their healing process” (Zador 1995, S. 18).
In Übereinstimmung mit anderen Autoren sieht Zador das zerstörte Gefühl für die eigene
Integrität, das Gefühl, so sehr vor den eigenen Wertmaßstäben und dem eigenen Selbstbild
versagt zu haben, als zentralen Faktor für das so lang andauernde starke Leiden an. Zador
macht hier auf einen Aspekt von Traumatisierung aufmerksam, der für ein transkulturelles
Verständnis von Trauma von besonderer Bedeutung sein könnte: Die Veteranen haben vor
den eigenen kulturell geprägten Wertmaßstäben versagt.
So arbeitete der mozambiquische Anthropologe Victor Igreja für eine traumatisierte Region in
Mozambique heraus, dass der entscheidende Faktor der durch den Krieg erzwungene Bruch
mit spezifischen religiös-kulturellen Vorstellungen war (Igreja et al, 2002, vgl. S.137). Mit
Blick auf sehr verschiedene Kontexte nennt Mary de Young “cultural bereavement” als
zentralen traumatisierenden Faktor.
Er fügt eine interessante Interpretation hinzu: “His feeling badly makes it possible for him to
maintain the one thing that gives him some sense of integrity - his conscience”.
Sich schlecht zu fühlen ermöglichte es ihm, das eine aufrechtzuerhalten, das ihm ein Gefühl
von Integrität gab – sein Gewissen. (Zador 1995, S. 19).
Der amerikanische Psychiater Chaim Shatan selbst spricht statt von Integrität von
Selbstachtung und hebt den kollektiven Aspekt gelungener Heilungsversuche hervor:
„Das heilsamste Mittel, ihre Selbstachtung wieder zu finden, ist für diese Männer, den Sinn
des Lebens neu zu entdecken in der Verbundenheit ihres eigenen Ichs als Individuum mit dem
Leben noch ungeborener Generationen. Und mehr als alles andere dient diesem
Genesungsprozess das Bewusstsein, dass viele andere dasselbe Anliegen haben” (Shatan
1981, S. 290).
Die Beschäftigung mit den Tätern des Holocausts war und ist besonders schwierig, weil deren
Taten so monströs und außerordentlich beschämend für die Nachkommen waren. Gudrun
Brockhaus vermutet, dass sich nichtjüdische Deutsche oft auf Grund eigener „biographischer
65
Verstrickungen“ gegen alle Versuche wehren, sich der Täterseite in irgendeiner Weise
psychologisch verstehend anzunähern.
Wahrscheinlich gilt für kollektive Traumata insgesamt und nicht nur im Kontext des
Holocaust, dass Versuche, der Täterperspektive Raum zu geben und „die Täter zu verstehen“,
Kontroversen auslösen: Ist es unerlässlich, um die Vergangenheit zu verstehen? Oder setzt es
ein falsches Signal, Tätern so viel Raum für rationale Erklärungen zu geben, wie Kritiker der
südafrikanischen Wahrheitskommission formulieren (vgl. S. 106) Ob dieses „Verstehen der
Täter“ Entlastungsdiskurse bedient bzw. im Sinne der Entlastung instrumentalisiert werden
kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab (z.B.: Wie klar grenzen sich die Zuhörer/Autoren
ab? Wie viel Öffentlichkeit bekommen die Täter dadurch?). Für das hier interessierende
Thema ist festzuhalten, dass im Sinne der Traumadynamik jede Annäherung an die Täterseite
potentiell einen Angriff gegen das Opfer darstellt.
9.3. Transgenerationelle Traumatisierung
Transgenerationelle Weitergabe als Brücke zwischen kollektivem und individuellem Trauma
Als Erklärung dafür, warum man bei “man-made-disasters“ oft schwer wiegende
Langzeitfolgen feststellt, bietet sich ein Konzept an, das sich innerhalb der psychologischen
Trauma-Diskussion in den letzten 20 Jahren zunehmend etabliert hat: das Konzept der
Trauma-Weitergabe von einer Generation zur nächsten. Diese Vorstellung entstand, als
erstmals Kinder von Holocaust-Überlebenden verstärkt in den Blick der Forschenden
gerieten. In den ersten wissenschaftlichen Arbeiten zu diesem Thema gab es eine erstaunlich
hohe Übereinstimmung in der Beschreibung von Schwere und Besonderheit psychischer
Belastungen, unter denen Nachkommen von Holocaust-Überlebenden leiden. Sie ähnelten
zudem den bereits vorher festgestellten Belastungen der Eltern.
Die meisten Reflexionen über die „Weitergabe des Holocaust“ entstanden aus den
Erfahrungen, die PsychotherapeutInnen, zumeist PsychoanalytikerInnen, mit Nachkommen
von Überlebenden sammelten, aufzeichneten und in der Fachwelt im Austausch mit anderen
zur Diskussion stellten (dies vor allem in den letzten Jahren, vgl. z.B. Lilian Opher Cohn et
al., 2000). Aber auch so genannte repräsentative systematische Untersuchungen an
„nichtklinischen“ Populationen (also Menschen, die sich nicht in Therapie begeben hatten)
wurden durchgeführt.
In einer Art Metaanalyse der ersten Publikationswelle stellt Miriam Rieck (1991) insgesamt
übereinstimmende Darstellungen der Eltern-Kind-Beziehung (emotional kühl und zugleich
übermäßig beschützend) und der Familienatmosphäre (deprimierend und misstrauisch) fest.
So seien etwa die Geschwisterbeziehungen oft von heftigen Streitereien geprägt.
Charakteristisch für diejenigen Nachkommen, die sich in Psychotherapie begeben hätten,
seien Depressionen, Apathie und Schuldgefühle gewesen, oft als Ausdruck spezifischer
Schwierigkeiten im Separations- und Individuationsprozess: Jegliche Form von Loslösung
und Trennung sei für die Eltern psychisch so sehr mit der Gefahr der Endgültigkeit verknüpft,
dass den Kindern auch als jungen Erwachsenen der Ablösungsprozess sehr schwer falle. Viele
Kinder nähmen in der Familie den Platz eines verstorbenen Kindes ein (äußerlich sichtbar
indem sie dessen Namen bekommen) und seien dadurch schwer belastet. Die Kinder könnten
jedoch solche und andere Belastungen schwer artikulieren, da sie ihre eigenen
Schwierigkeiten am vergangenen Leiden der Eltern mäßen und diese von jeglicher Belastung
verschonen wollten.
66
Im Zentrum der Erklärungen für diese Phänomene standen Überlegungen zum
Zusammenhang von Phantasie und Realität: Autoren wie Martin Bergmann, Milton Jucovy
und Judith Kestenberg (1982) nahmen an, „dass die unbeschreiblichen Holocaust-Erlebnisse
der Eltern jede kindliche Phantasie überschreiten und dadurch die Unterscheidung zwischen
Phantasie und Realität unmöglich machen“ (zit. nach Miriam Rieck 1991, S. 134).
Trotz der großen Übereinstimmung verschiedener Studien konnten repräsentative Erhebungen
keinen deutlichen Effekt, allenfalls Trends nachweisen. Die Wirkung, die von der Weitergabe
der Verfolgungserfahrung ausgeht, liegt vermutlich eher in einer besonderen Verletzlichkeit,
die sich erst in Extremsituationen zeigt.
In diese Richtung weist etwa eine in Israel durchgeführte Untersuchung, mit der Zahava
Solomon (1995b) zeigen konnte, dass in einer Gruppe von Soldaten, die Traumasymptome
entwickelten, die Kinder von Verfolgten des NS-Regimes eine ausgeprägtere Störung mit
einer größeren Zahl von Symptomen aufwiesen. Zudem nahmen die Symptome innerhalb von
drei Jahren bei Nachkommen von Nicht-Verfolgten ab, nicht jedoch bei den Kindern von NSOpfern, und dies obwohl sie vor Antreten des Militärdienstes als gesund und dienstfähig
eingestuft worden waren. Denkbar wäre, dass epigenetische Veränderungen im Gehirn weiter
vererbt werden.
Brainin, Ligeti und Teicher geben eine Darstellung der so genannten zweiten Generation, die
sich wenig an pathologischen Kriterien orientiert, sondern die Prägung dieser besonderen
Generation als angemessene Reaktion auf die „Pathologie der Wirklichkeit“ des
Nationalsozialismus analysiert:
„Bei dieser Generation wird noch viel deutlicher, dass es keine generalisierbaren Ergebnisse
in Bezug auf psychopathologische Entwicklungen gibt. Was man wohl als gemeinsames
Moment dieser Generation feststellen kann, ist ein Gefühl für die Präsenz der Ereignisse
während des Krieges sowie das Gefühl, einer gesellschaftlichen Randgruppe anzugehören.
[...] In den Phantasieinhalten, die um Verfolgung und Massenmord zentriert sind [...] liegt die
Besonderheit. Eine Schwierigkeit für die Kinder der Verfolgten besteht darin, dass dieser
Phantasieinhalt für ihre Eltern die Realität der Vernichtung war.“ (Brainin/Ligeti/Teicher
1986, S. 65)
Außerdem sehen es die zitierten Autoren als Gemeinsamkeit dieser Generation an - vor allem
wenn sie in Deutschland oder Österreich lebt - der nicht-jüdischen Umwelt, dem Staat und der
Gesellschaft gegenüber besonders misstrauisch zu sein. Dieses Misstrauen werde sehr oft von
den verfolgten Eltern übernommen und ist eines der deutlichsten Phänomene
transgenerationeller Weitergabe. Brainin, Ligeti und Teicher (ebd.) weisen an dieser Stelle auf
die Angemessenheit dieses Misstrauens hin: Zentrale Erfahrung der Elterngeneration war,
dass zu viel Vertrauen unter Umständen tödlich war und dass vor allem diejenigen überlebten,
die früh genug misstrauisch wurden und emigrierten. In diesem Sinne verschwimmen hier die
Grenzen zwischen einer an die nächste(n) Generation(en) auch bewusst weitergegebenen
Einsicht in die Notwendigkeit der Wachsamkeit und einem unwillkürlicheren, unter
Umständen quälenden Grundmisstrauen in die Welt.
Ein weiteres Spezifikum der zweiten Generation lässt sich als nachvollziehbare Reaktion der
Kinder auf das Leiden der Eltern verstehen: Viele Kinder von Überlebenden haben den sehr
starken Wunsch, das Leiden der Eltern ungeschehen zu machen, wieder gutzumachen oder zumindest in der Phantasie - zu rächen.
67
Auch in Deutschland ist in den letzten Jahren viel über transgenerationelle Traumatisierung
diskutiert worden. Zumindest ist einiges von dem Schrecken, dem Terror und der
Hilflosigkeit über die Erziehung weiter vermittelt worden.
Auswirkungen auf der Täterseite
Versucht man die Langzeiteffekte eines kollektiven Traumas mit dem Konzept der
transgenerationellen Weitergabe besser zu verstehen, dann liegt die Frage nahe, ob sich das
Konzept der transgenerationellen Weitergabe auch auf die Rolle der Täter und Zuschauer
anwenden lässt. Einer der ersten, die sich systematisch mit dieser Frage beschäftigten, war der
israelische Psychologe Dan Bar-On, der in den 80er Jahren begann, Interviews mit Kindern
von Nazi-Tätern zu führen. Bar-On fragte sich im Hinblick auf die unmittelbare
Nachkriegszeit: „Was bedeutet auf der Seite der Täter Normalität? [...] In der
Nachkriegsgesellschaft konnten die Menschen funktionieren, sich um ihre eigene physische
Existenz kümmern, ohne sich andauernd um die Vergangenheit zu kümmern. Das bedeutet
jedoch auch, dass die weniger unmittelbaren psychischen Prozesse - das Betrauern der Toten,
das Durcharbeiten der Hilflosigkeit und Aggression, die Neufassung des eigenen moralischen
Selbst, die Wiederherstellung von Vertrauen in sich selbst und andere - auf bessere Zeiten
verschoben werden mussten. Bessere Zeiten, das hieß [...] dass diese
Durcharbeitungsprozesse auf die folgenden Generationen verschoben wurden.”
(Bar-On 1996, S. 20)
Mit dieser Darstellung bietet Bar-On eine wohlwollende Formulierung („sie konnten
funktionieren....“) der Grundthese, welche die Reflexionen um die zweite Generation
durchzieht: Die „Weitergabe“ besteht vor allem in dem, was in der ersten Generation
gewissermaßen fehlte. Am deutlichsten zeigt sich dies für die fehlenden Schuld- und
Schamgefühle, die von der Tätergeneration erschütternd selten artikuliert wurden. Bis in die
dritte Generation (vgl. Rommelspacher, 1994) ist das Grundgefühl vieler Nachkommen von
Widerspruch und Verwirrung gekennzeichnet: Kinder und Enkel erfahren häufig erst
außerhalb der eigenen Familie über die Realität des Holocaust, spüren zwar deutlich die
Beteiligung der eigenen Familie an den Verbrechen, werden jedoch mit „glatten
Entlastungsgeschichten“ abgespeist.
Das Gefühl für diesen Widerspruch zwischen der eigenen Wahrnehmung und der Erzählung
der Familie kann verschiedene Ausdrucksformen finden, etwa typische Alpträume, die
verdecktes Verbrechen symbolisieren. Weil nicht klar wird, worauf sich das Unbehagen
konkret bezieht, bleiben auch die Scham- und Schuldgefühle häufig diffus.
Vor allem das offene oder verdeckte Festhalten der Eltern an nationalsozialistischen Idealen
kann für die Nachkommen zu einer ausgeprägten „Scham-Anfälligkeit“ führen sowie zu einer
„mangelnden Fähigkeit, innerlich zu den eigenen Wertvorstellungen zu stehen und sie
nachhaltig zu vertreten“ (ebd.).
Die Unmöglichkeit, sich mit dem Ich-Ideal der Eltern oder Großeltern positiv identifizieren
zu können, kann auch als Deformation einer unbeschwerten Erzähltradition zwischen den
Generationen bezeichnet werden, wie dies z.B. der Psychoanalytiker Sammy Speier (1988)
herausgearbeitet hat. Die Identifikation mit den von früher erzählenden Großeltern gerät
irgendwann in die Krise, in Konflikt mit dem, was Kinder oder Jugendliche von diesem
„Früher“ zu begreifen beginnen.
68
Zusätzlich kompliziert wird dieser Prozess häufig durch das Gefühl, sich zum Teil dennoch
mit den Großeltern zu identifizieren. Diese Identifikationen können umso mehr Schuldgefühle
hervorrufen. Die deutsche Psychoanalytikerin Almuth Massing (1988, S. 55) spricht von
„nationalsozialistischen Identitätsanteilen“ und dem Fortbestehen „nationalsozialistischer
Weltbilder“, der deutsche Psychologe und Philosoph Jürgen Müller-Hohagen (1993, S. 26-27)
von einer „Komplizenschaft über Generationen", für die er als zentralen Faktor die
„Identifikation mit der Macht“ sieht.
Diese Mechanismen werden öffentlich vor allem im Hinblick auf rechtsradikale Jugendliche
diskutiert, denen jene übernommenen Identitätsanteile und die bewusste Pflege
nationalsozialistischer Weltbilder zugeschrieben werden. Für das Verständnis der Prägung
weiterer Generationen ist es jedoch wichtig, sich auch subtilere Mechanismen, etwa im Sinne
einer weitgehend unbewussten Identifikation vorzustellen. Man könnte hier von einer
„heimlichen Faszination“ sprechen. Die deutsche Soziologin und Psychoanalytikerin Gudrun
Brockhaus diskutiert dieses Phänomen gerade im Hinblick auf Nachkommen, die sich
bewusst von der Ideologie der Eltern abgrenzen und diese heimliche Faszination besonders
stark verleugnen müssen. Sie spricht von der „verleugneten Angst vor der Anziehungskraft
des Faschismus“ (1997, S. 139), die die öffentliche und wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zutiefst präge.
Die dargestellten Mechanismen gelten in unterschiedlicher Ausprägung vermutlich für einen
sehr großen Teil der Nachkommen sowohl von Tätern als auch von Zuschauern. Besonders
verschärft stellten sich diese „kollektiven Schwierigkeiten“ jedoch für viele Täter-Kinder im
engeren Sinne. Als PsychotherapeutInnen ab Mitte der 80er Jahre zunehmend für die
transgenerationalen Folgen der NS-Täterschaft sensibilisiert wurden, konnten viele bis dahin
unerklärbare Symptome verstanden werden. Es gehe um etwas Schreckliches, das in einen
“hineingelegt worden” sei, fasst Brockhaus die Erkenntnisse verschiedener Autoren
zusammen (Brockhaus, 1997, S. 162). Tilman Moser spricht von „Dämonischen Figuren“, die
die Patientinnen in sich trügen und berichtet: „Es ging um Leere, Sinnlosigkeit, ein Gefühl der
Unstimmigkeit des eigenen Lebens, der Nicht-Authentizität, der Vergeblichkeit menschlicher
Beziehungen“ (Moser 1993, zit. nach Brockhaus, 1997, S. 162).
Das erinnert stark an das, was Shatan von den Vietnam-Veteranen berichtete.
Die Debatte zur „Täter-Opfer-Parallelisierung“ und Differenzierungsversuche
Je mehr über die Folgen auf Täterseite nachgedacht wurde, desto mehr tauchte die Frage auf,
inwiefern die transgenerationelle Weitergabe auf beiden Seiten ähnliche Phänomene
hervorbringe. Diese Fragestellung mündete in hitzig geführte Debatten. Manche
ForscherInnen betonten, wie sehr die Kinder von Tätern und Mitläufern ebenfalls unter den
Folgen des Holocaust litten und wiesen auf mehrere Parallelen zum Leiden der Opferkinder
hin. Es entstand eine Debatte über Vergleichbarkeit und Unvergleichbarkeit der Folgen des
Holocaust für Täter- und Opfernachkommen.
Die Dynamik solcher Debatten ist inzwischen selbst Gegenstand psychologischer Reflexionen
geworden. So beobachtet der deutsche Psychoanalytiker Kurt-Grünberg eine symbolische
Täter-Opfer-Umkehrung. Dort wurde von jüdischer Seite formulierte Kritik an einer
bestimmten Form der Auseinandersetzung so rezipiert, dass die jüdischen Kritiker mit
(vernichtenden) Nazi-Verfolgern gleichgesetzt wurden (vgl. Grünberg 1997).
Im Bezug auf transgenerationelle Weitergabe bemühen sich einige Autoren im Kontext dieser
Debatte um sorgfältige Differenzierungen, die im Folgenden kurz skizziert werden sollen, da
69
sich analoge Differenzierungen möglicherweise auch auf andere „kollektive Traumata“
übertragen lassen (vgl. auch S. 76ff und S. 110).
Ängste
Die deutsche Soziologin Gabriele Rosenthal führte mit ihren Mitarbeitern in einer breit
angelegten Studie ausführliche narrative Interviews jeweils mit den Mitgliedern von drei
Generationen. Dabei stellten sie fest, dass auch die Täter-Kinder mehr als zunächst
angenommen, nicht nur von Schuldgefühlen, sondern auch von Ängsten bestimmt seien.
„Die Nachkommen von Nazi-Tätern schützen sich davor, die grausamen Handlungen, die
mangelnden Schuldgefühle, die Gefühlskälte und den immer noch bestehenden Rassismus
und Antisemitismus ihrer nächsten Bezugspersonen wahrnehmen zu müssen. Und sie
versuchen, sowohl Schuldgefühle als auch die Angst abzuwehren, von den Großeltern oder
Eltern ermordet zu werden bzw. als lebensunwert eingestuft zu werden. [...] So hatte z.B. die
Tochter eines Euthanasiearztes in ihrer Kindheit diese Angst vor ihrem Vater und verheimlichte aus diesem Grunde ihre Kurzsichtigkeit (Rosenthal/Bar-On 1992). Als Kind hatte
sie miterleben müssen, wie der Vater ihren jüngeren Bruder als Baby in einen Swimmingpool
warf, um dessen von ihm angezweifelte 'Reinrassigkeit' zu testen“ (Rosenthal 1997, S. 20).
Ängste können wie in diesem Beispiel traumatische Qualität haben. Sowohl die Angst der
Täter-Kinder als auch die der Opfer-Kinder kann existentiell sein. Rosenthal arbeitete jedoch
heraus, dass die Ähnlichkeiten meist auf der Oberfläche bestehen: die „latenten
Tiefenstrukturen“ und die Funktionen unterscheiden sich stark. So differenziert sie ganz
konkret am Beispiel der Angst:
„Die Angst, ermordet zu werden, finden wir bei Kindern und Enkeln sowohl von Tätern als
auch von Überlebenden. Vernichtungsängste von Kindern und Enkeln von Tätern beziehen
sich meist auf die unbewusste Phantasie, von den eigenen Eltern ermordet zu werden (vgl.
Kestenberg/Kestenberg 1987; Rosenthal/Bar-On 1992), während die potentielle Bedrohung,
die Kinder von Überlebenden spüren, eher eine allgemeine Angst vor der außerfamiliären und
der nichtjüdischen Welt ist.“ (Rosenthal 1997, S. 20)
Schweigen und Verschweigen
Ähnliches gilt für das in vielen Täter- und Opferfamilien festgestellte Phänomen, dass
zwischen den Generationen sehr wenig über die Vergangenheit gesprochen wurde.
„Überlebende wollen mit ihrem Schweigen den Kindern Belastungen ersparen und sich
anderen mit ihren schmerzhaften Erlebnissen nicht zumuten. Ein Großvater oder eine
Großmutter oder Eltern, die an den Nazi-Verbrechen beteiligt waren, schützen dagegen mit
ihrem Schweigen und darüber hinaus mit ihrem Leugnen in erster Linie sich selbst vor
Anklage und Verlust von Zuneigung.“ (Rosenthal 1997, S. 19)
Hinter dem oberflächlich gleichen Phänomen „Schweigen“ verbirgt sich also eine völlig
andere Psychodynamik (vgl. dazu auch Grünberg, 1997).
Überhaupt manifestiert sich das Thema Schweigen sowohl auf kollektiver als auch auf
individueller bzw. familiärer Ebene. So ist häufig von einer Mauer des Schweigens zwischen
den Generationen die Rede (Bar-On, 1996) oder vom kollektiven Schweigen in Deutschland
nach dem Holocaust (z.B. Schittenhelm, 1996). Aber zunehmend wird auch darauf
hingewiesen, dass Schweigen ganz unterschiedliche Gründe und Bedeutungen haben kann
(vgl. S. 52).
70
10. Allgemeine Regeln für die Traumatherapie
Wilson (1989) hat einige Regeln für Traumatherapien formuliert die auf einen breiten
Konsens unter Traumatherapeuten und -Forschern beruhen. Die Kommentare dazu stammen
von Riedesser und Fischer:
1) Nicht beurteilende (non judgemental) Akzeptierung des Opfers.
Traumaopfer fühlen sich oft in ihrem Traum gefangen wie in einer Falle Sie beteuern
dass niemand sie verstehen kann, dann jemand anderer, auch nicht der Therapeut, ihre
Erfahrungen geteilt hat gelingt es den Kliniker, sich von den eigenen
Abwehrtendenzen wie zum Beispiel Opfer Beschuldigungen oder Kritik wegen
wirklichen Fehlverhaltens des Opfers oder anderen Gegenübertragungsreaktionen
innerlich freizumachen, Inhaltlich Signale verdeutlichen, dass er bereit ist, die
Geschichte zu hören. In manchen Fällen, Es anders war extrem Traumatisierung wie
bei extrem Traumatisierung wie bei Folteropfern, ist es sinnvoll, bestimmte Punkte
des unsagbaren direkt und selbstverständlich anzusprechen, nicht infrage formulierter
Zentren gerichtet, sondern mit einer Bemerkung, in der der Therapeut erkennen lässt
dass er von solchen Vorkommnissen weiß. Sexuelle Folter beispielsweise willst auf
unerträgliche Schamgefühle aus, die so gemindert werden können. Zweitens Absatz
2) Sofortige Intervention und die Beschaffung von Hilfe unterstützen den
Erholungsprozess.
Traumaopfer benötigen dringend so viel soziale, psychische und ökonomische Hilfe
wie möglich, um ein Grund Gefühl von Sicherheit wiederherstellen zu können.
3) Erwartung massiver Gegenübertragungsreaktionen.
Traumatherapeuten müssen sich auf massive eigene Gefühlsreaktionen und oft nur
schwer kontrollierbare Handlungstendenzen einstellen.
4) Die Bereitschaft, sich testen zu lassen.
Traumaopfer haben oft jedes Vertrauen in zwischenmenschliche Hilfe und
Zuverlässigkeit verloren. Bevor sie sich einem neuen Menschen anvertrauen,
unterziehen sie diesen einer Reihe von Tests, die entscheiden sollen, ob er das
Vertrauen verdient für die Hilfe, die er anbietet. Der Kliniker, der Traumaopfer
behandelt, muss offen sein, ehrlich und in einer angemessenen Weise seine Gedanken
und Gefühle mitteilen (self-disclosure), ohne die Grenzen der Abstinenz zu verlieren
und sich in Gegenübertragungs Reaktionen zu verstricken.
5) Übertragung ist in der Traumatherapie ein Prozess der Wiederaufnahme von
Beziehungen
(re-bonding) und ist insofern auf das Trauma bezogen. Übertragung wird als ein
Prozess gesehen, dramatisch gestörte Beziehungen wieder aufzubauen. Bei sozialen
Traumata ist hier vor allem die Überwindung von Misstrauen und der Wiederaufbau
der Fundamente des kommunikativen Realitätsprinzips erforderlich Ein
therapeutisches Arbeitsbündnis wird aufgebaut beziehungsweise verstärkt, wenn der
Therapeut die aus der traumatischen Erfahrung stammenden Beziehungstests aushält.
6) Ausgehen von der Hypothese, dass traumatische Belastungssymptome durch das
traumatischen Ereignis hervorgerufen werden.
Am Ausgangspunkt der Traumatherapie stets zunächst die Vermutung, dass die
gegenwärtigen Symptome und Stressreaktionen durch die erlebte traumatische
71
Situation hervorgerufen und bedingt sind. Unter diesen Voraussetzungen kann die
Patientin sich angenommen fühlen und sich auf die traumatische Erlebnisverarbeitung
einlassen. Erst wenn das aktuelle Trauma durchgearbeitet ist, kann die Patientin auch
Zusammenhänge mit früheren traumatischen Ereignissen und der Lebensgeschichte
bearbeiten. Die theoretisch zu erwartende Disposition zu traumatischen Reaktionen
aufgrund früherer Traumatisierung darf nicht von der aktuellen traumatischen
Erfahrung ablenken. Im Zentralen Traumatischen Situationsthema sind ja ohnehin die
lebensgeschichtlichen Vorerfahrungen mit dem aktuellen Trauma verschränkt. Von
daher ist beim Durcharbeiten des aktuellen Traumas implizit immer auch die
lebensgeschichtliche Vorerfahrung mit angesprochen. Nach unserer klinischen
Erfahrung ist es günstig, wenn die Therapeutin es der Patientin überlässt,
lebensgeschichtliche Zusammenhänge in die gegenwärtige Traumaverarbeitung
einzubeziehen. Dies geschieht oft spontan, wenn die Patientin sich eine gewisse
Distanz zum aktuellen Trauma erarbeiten konnte.
7) Information über die Natur und die Dynamik von traumatischen Reaktion ist ein
Bestandteil der Traumatherapie.
Ochberg formulierte 1993 drei Prinzipien der Traumatherapie: Normalität;
Kooperation und Wiederermächtigung des Patienten sowie Individualität. Nach dem
Prinzip der Normalität sollten die Betroffenen die postexpositorischen Symptome als
normale Folgeerscheinungen einer anomalen Situation vermittelt werden. In
Verbindung mit dem Prinzip der Individualität besagt dies, dass der Therapeut die
individuelle Variante der Patienten akzeptieren und ihr verständlich machen sollte.
8) Traumatische Ereignisse können in jedem Lebensalter zu Veränderungen der Ichund Identitätsentwicklung führen.
Sie können normale Entwicklungsprozesse beschleunigen, verlangsamen, verhindern,
unterbrechen, so zum Beispiel zu einer Unterbrechung zwischen prätraumatischer und
posttraumatische Identität und Selbstverständnis führen. In der Literatur hinaus eine
posttraumatische Selbststörung beschrieben Posttraumatic Self Disorder, PTsfD), die
entsteht, wenn die soziale Umwelt nicht genügend empathisch auf dramatische
Verletzungen reagiert. Zu den Folgen gehören narzisstische Wut und Verletzlichkeit,
geringe Selbstachtung, Entfremdungsgefühle, paranoide Vorstellungen, Fantasien von
Rache und Vergeltung sowie hohe Sensibilität gegenüber unemphatischem Verhalten.
Parson beschrieb 1988 dieses Syndrom an kriegstraumatisierten Vietnamsoldaten, die
sich nach Kriegsende von ihrer sozialen Umgebung und der Gesellschaft
vernachlässigt fühlten. Hierbei handelt es sich um ein sekundäres Symptombild, das
aus dem häufig zu beobachten, wenig einfühlsamen Umgang mit Traumaopfern
entsteht. Die erschütternde traumatische Erfahrung kann aber auch von sich aus die
Kontinuität des Selbstgefühls unterbrechen.
9) Verwerfung, Spaltung und Formen von Dissoziation gehören zu den
Abwehrmechanismen, die einem psychischen Trauma folgen.
Es ist notwendig, das Traumatherapeuten auf solche Abwehrreaktionen eingestellt
sind, die in den traditionellen Abwehrkonzepten eher vernachlässigt wurden. All diese
Mechanismen können zu einer dauerhaften Persönlichkeitsveränderung führen. Auch
das so genannte Verdoppeln (Doubling) (R. J. Lifton 1993, die Tendenz nach
schweren Traumata eine neue Identität auszubilden, die wie in Winnicotts
Unterscheidung zwischen wahrem und falschem Selbst der neuen Situation
anscheinend besser angepasst ist, sollte als eine der regelmäßigen Folgen schwerer
Traumatisierung erwartet werden.
72
10) Selbstbehandlungsversuche durch Alkohol oder Drogen sind verbreitet bei
psychotraumatischen Belastungssyndromen.
Es ist durchaus normal, dass Patienten die extreme Belastung durch Alkohol und
andere Drogen zu mildern suchen, um den extremen Erregungszustand des autonomen
Nervensystems in erträglichen Grenzen zu halten. Traumatherapeuten sollten hierfür
Verständnis haben, jedoch ein Alkoholismus-und Drogenbehandlung in den
Behandlungsplan einbeziehen. Der übermäßige Gebrauch von Betäubungsmitteln ist
der Traumaverarbeitung nicht förderlich.Der übermäßige Gebrauch von
Betäubungsmitteln ist der Traumaverarbeitung nicht förderlich.
11) Die erfolgreiche Transformation der traumatischen Erfahrung kann die
Entwicklung von positiven Charakterzügen zur Folge haben.
Der Kampf um die Reformulierung und Transformation des Traumas kann nach
Wilson zu Charakterzügen führen wie Redlichkeit, Integrität, Sensibilität für andere
und starke Bemühungen um Gleichheit, Gerechtigkeit, Wahrhaftigkeit, Interesse an
geistigen Werten. Eine solche Entwicklungsmöglichkeit anzudeuten, ohne den
Patienten zu einer so genannten „Sinnfindung“ zu drängen, kann ihm helfen, aus der
Traumafalle herauszufinden.
12) Soziales Engagement und Sprechen über das Trauma fördern den
Entwicklungsprozess.
Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass das Sprechenkönnen über das Erlebte,
Darstellung der eigenen Gefühle und auch ein soziales Engagement von
Traumatisierten in Prävention und Hilfe für andere Traumatisierte in sich hilfreich und
heilsam für den Erholungsprozess sein können. Grundsätzlich erleichtert auch die
Möglichkeit, anderen Betroffenen zu helfen, die eigene Traumaverarbeitung.
13) Die Transformation des Traumas ist ein lebenslanger Prozess.
Auch wenn im Rahmen einer Psychotherapie die traumatische Erfahrung erfolgreich
durchgearbeitet werden konnte, so bleibt bei den Betroffenen eine lebenslange
Erschütterung zurück.
14) Physische Aktivität ist indiziert.
Über die angesprochenen Themen hinaus ist für Traumapatienten physische Aktivität
wichtig, etwas Sport oder körperliche Arbeit, um die physiologische Stressreaktion
abzubauen. Spazieren gehen oder Bergsteigen können dazu beitragen, den Zirkel von
Grübeln, Wiedererleben der traumatischen Erfahrung oder Abstumpfung und Rückzug
zumindest zeitweilig zu unterbrechen. Die tägliche physische Aktivität sollte einen
rituellen Charakter erhalten. Aus der interkulturellen vergleichenden Forschung ist
bekannt, dass Kulturen zu allen Zeiten Rituale zur Bekämpfung und Dämpfung von
Traumafolgen entwickelt haben, hier möglichst auch im Gruppenkontakt.
15) Ernährungsfragen sind zu beleuchten.
Ernährungsfragen sind deshalb von besonderer Bedeutung, weil Traumapatienten in
ihrer emotionalen Bedrängnis sich oft durch Essen, Trinken oder die Einnahme von
Drogen, wie etwa Alkohol, zu trösten suchen. Während Drogen-und Alkoholprobleme
in der ärztlichen Praxis auch gegenwärtig schon Beachtung finden, ist die
Aufmerksamkeit weniger auf andere Ernährungs- und Trinkgewohnheiten gerichtet.
16) Nikotin- und Koffeingenuss steigern die Erregung.
73
Um einen Zustand von apathischem Rückzug zu bekämpfen, greifen Traumapatienten
häufig zu Nikotin und entwickeln bisweilen eine Koffeinabhängigkeit, die mit
Angstanfällen, Ruhelosigkeit, Nervosität, Erregtheit, Schlaflosigkeit,
gastrointestinalen Störungen, Herzarrythmie, Erschöpfungszuständen und
psychomotorischer Unruhe einhergeht. Diese Symptome sind den traumabedingten
Angstzuständen oft sehr ähnlich und können sich mit ihnen verbinden.
Gesundheitsschädliche Ernährungsgewohnheiten können sich nach einem
traumatischen Erlebnis so sehr verstärken, dass Gesundheitsrisiken zu der seelischen
Belastungen hinzukommen. Einige Forscher betonen die Gefahr, die in einem
exzessiven Gebrauch von Zucker, Fett und Koffein liegt. Ein erhöhter Genuss von
Zucker und mit Zucker verarbeiteten Esswaren kann in Verbindung mit der
Stressreaktion zu ungünstigen Schwankungen des Blutzuckerspiegels führen und zu
einer entsprechenden physiologischen und psychischen Symptomatik. Gesättigte
Fettsäuren, wie sie tierische Fette und einige pflanzliche Fette aufweisen wie Palmenund Kokosnussöl sind in vielen Fertiggerichten enthalten und werden in FastfoodRestaurants angeboten, so in Chips oder Tom Fritsch. Erhöhter Fettgenuss steigert den
Fettgehalt des Blutes und damit das Risiko einer Herz-und Kreislauferkrankung.
17) Soziale Integration fördern
Um die soziale Integration von Traumapatienten zu fördern, kommen sehr
unterschiedliche therapeutische Settings und soziale Gruppen in Betracht, zum
Beispiel die Familie, Selbsthilfegruppen oder soziale Dienste.
Die Familie kann eine wertvolle Hilfe zur Überwindung von Traumatisierung sein,
allerdings nur dann, wenn die Familienstruktur günstig ist.
Es gibt einige Kriterien für ein bei der Traumaverarbeitung hilfreiches Familienmilieu.
Die traumatische Situation wird von den Familienmitgliedern klar gesehen und nicht
verleugnet;
das Problem wird von der Familie getragen und nicht dem Opfer zugeschrieben; das
Vorgehen ist eher lösungsorientiert als auch Schuldzuschreibung gerichtet; es besteht
Toleranz; ein zugewandtes und gefühlvolles Klima unter den Familienmitgliedern;
offene Kommunikation; großer Zusammenhalt;
die Familienrollen sind eher flexibel als rigide;
es werden Ressourcen auch außerhalb der Familie benutzt;
es gibt keine Gewalt und es werden keine Drogen genommen.
Familientherapie kann Ressourcen mobilisieren und einen helfenden und schützenden
Rahmen für die Traumaverarbeitung bereitstellen. Ein extrem ungünstiges
Familienmilieu stellt allerdings eine Kontraindikation für Familientherapie dar. In
diesem Falle sollte nach geeigneten sozialen Kontakten außerhalb der Familie
Ausschau gehalten werden.
74