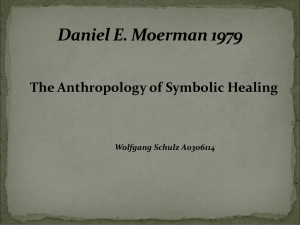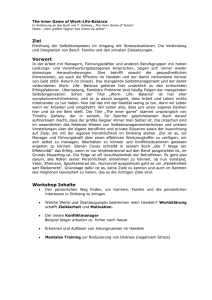Flow und Mentales Training im Kontext des
Werbung
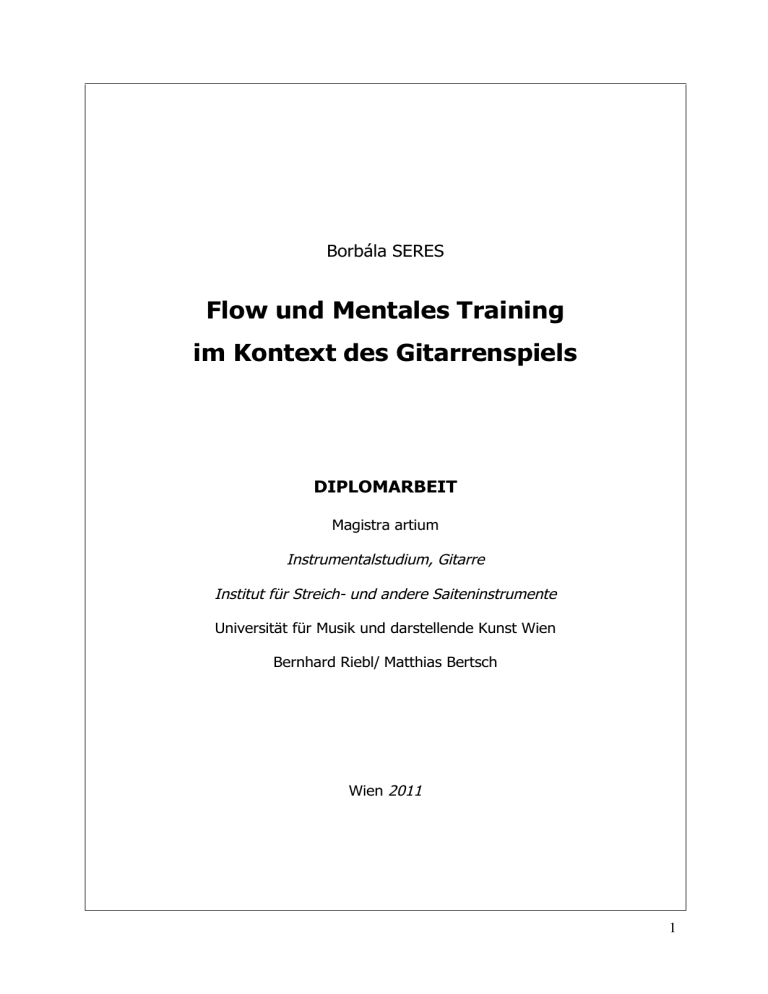
Borbála SERES Flow und Mentales Training im Kontext des Gitarrenspiels DIPLOMARBEIT Magistra artium Instrumentalstudium, Gitarre Institut für Streich- und andere Saiteninstrumente Universität für Musik und darstellende Kunst Wien Bernhard Riebl/ Matthias Bertsch Wien 2011 1 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis .............................................................................................. 3 Einleitung .................................................................................................................... 5 1. Grundlagen des musikalischen Übens ................................................................ 7 1.1 Psychologische Grundlagen des Gedächtnisses ........................................ 7 1.2. Neurophysiologische Grundlagen des Gehirns .......................................... 9 1.2.1 Veränderungen der neuronalen Netzwerke des Gehirns beim Üben. ............................................................................................................................ 14 2. Mentales Training................................................................................................. 19 2.1 Der Begriff des Mentalen Training ................................................................ 19 2.1.1 Die Geschichte des Mentalen Trainings für Musiker ............................. 24 2.1.2 Die Methoden ............................................................................................ 27 2.1.3. Untersuchungen über die Effektivität des Mentalen Trainings ........... 46 3. Üben im Flow........................................................................................................ 64 3.1 Der Begriff des Flow-Erlebnisses nach Csíkszentmihályi ............................. 64 3.2 Die Prinzipien des Übens Im Flow ................................................................. 66 3.2.1 Der Lernprozess beim Üben im Flow .................................................... 68 3.2.2 Unterstützende Techniken ..................................................................... 69 3.3 Untersuchungen über die Effektivität des Übens im Flow ......................... 71 4. Eigene Erfahrungen ............................................................................................. 76 4.1 Mentales Training ........................................................................................... 76 4.2 Üben im Flow .................................................................................................. 81 5. Zusammenfassung............................................................................................... 87 6. Literaturverzeichnis .............................................................................................. 89 2 Abbildungsverzeichnis Abb. 1. Teile des menschlichen Gehirns ............................................................... 11 Quelle: http://www.muenstergass.ch/blog/?p=2267 Abb. 2. Teile der Großhirnrinde .............................................................................. 12 Quelle: http://www.brainhealthandpuzzles.com/brain_parts.html Abb. 3. Aktivierung der sensomotorischen Hirnregionen beim reinen Anhören des Stückes............................................................................................................... 16 Quelle: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC270043/figure/F2/ Abb. 4. Aktivierung der auditiven Areale beim stummen Bewegen der Finger.. ................................................................................................................................... 17 Quelle: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC270043/figure/F3/ Abb. 5. Aufsicht des Gehirns der Pianisten bei der Beobachtung der stummen Bewegung der rechten Hand im Vergleich zur Beobachtung einer ausruhenden Hand. ................................................................................................ 18 Quelle: Haslinger, B., Erhard, P., Altenmüller, E., Schroeder, U., Boecker, H., Ceballos-Baumann, A. O. (2005.) Transmodal sensorimotor networks during action observation in professonal pianists. Journal of Cognitive Neuroscience 17, S. 286. Abb. 6. Etüde von Lebert-Stark. ............................................................................. 29 Quelle: Leimer, K., Gieseking, W., (1931.) Modernes Klavierspiel: Mit Ergänzung Rhytmik, Dynamik, Pedal. Mainz u. a., Schott S. 19. Abb. 7. Chopin: Cis-moll Nocturnes Op. posth. ................................................... 43 Quelle: Mahlert, U. (hrsg.) (2006.) Handbuch Üben: Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden u. a., Breitkopf und Härtel S. Abb. 8. Die vereinfachte Struktur der ersten vier Takte ...................................... 44 Quelle: ebd S. Abb. 9. Die erweiterte harmonische und melodische Struktur ......................... 44 Quelle: ebd. S. 3 Abb. 10. fMRI Aktivierungsergebnisse bei Amateure und Profis. Die Aktivierungen sind in rot dargestellt, Deaktivierungen der gleichen Bedingung in grün. ...................................................................................................................... 59 Quelle: Scheler-Moster, G. (2004.) Neurophysiologische Korrelate beim mentalen Training motorischer Bewegungen: Ein Vergleich zwischen professionellen Musikern und Amateuren. Mainz, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Dissertation S. 60. Abb. 11. Die Messungsdaten der Studie .............................................................. 61 Quelle: Gutzwiller, J. (2008.) Mentales Training mit Studierenden – ein gesundheitserhaltendes Angebot? Luzern, Hochschule Luzern Musik, Ein Projekt am Institut F&E. S. 13. Abb. 12. Die Anzahl der Stunden pro Tag für Kohorten, Messzeitpunkte und Standorte .................................................................................................................. 62 Quelle: ebd. 17. Abb. 13. Das Flow-Erlebnis im Verhältnis von Anforderungen und Fähigkeiten ................................................................................................................................... 65 Quelle: Burzik, A. (2003.) "Mit Leib und Seele" üben - das Geheimnis der Meister. in: Das Orchester, Mainz u. a. Schott Music, S. 14. Abb. 14. Die Punkte der Flow-Kurzskala ................................................................ 72 Quelle: Pauken mit Trompeten: Lassen sich Lernstrategien, Lernmotivation und soziale Kompetenzen durch Musikunterricht fördern. Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Referat Bildungsforschung (hrsg.), Bonn u. a., Bildungsforschung Bd. 32. S. 74. Abb. 15. Verlauf des Flow-Erlebnisses.................................................................... 72 Quelle: ebd. S. 81 Abb. 16. EEG Messung zur Neurobiologie von Flow-Zuständen bei MusikerInnen ............................................................................................................ 74 Quelle: http://www.flowskills.com/neurobiologie-und-flow.html Abb. 17. Alpha-Aktivität des Gehirns im Flow-Zustand ....................................... 74 Quelle: http://www.flowskills.com/neurobiologie-und-flow.html Abb. 18. Alpha-Aktivität des Gehirns beim Üben ohne Flow ............................. 75 Quelle: http://www.flowskills.com/neurobiologie-und-flow.html 4 Einleitung In der vorliegenden Arbeit wird der Versuch unternommen, einen Überblick über die Methode des Mentalen Trainings sowie den Prinzipien des Übens im Flow im Kontext des Gitarrenspiels zu bieten. Dabei werden sowohl die Definition des Mentalen Trainings und des Flows, als auch die Praxis beider Übungsarten erklärt. Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den psychologischen und neurophysiologischen Grundlagen des Gedächtnisses, beziehungsweise betrachtet es den Mechanismus des musikalischen Gedächtnisses und des musikalischen Lernens aus der Nähe. In dessen Rahmen bietet es eine Übersicht sowohl über die Veränderungen der neuronalen Netzwerke des Gehirns beim Erlernen des „Musizierens“ als auch über die Veränderungen der Hirnstruktur durch intensives und langjähriges Üben. Das zweite Kapitel – das auch das umfassendste ist – besteht eigentlich aus zwei Teilen, wobei der erste den Begriff des mentalen Trainings erläutert, und den Versuch unternimmt, zu bestätigen, dass der Begriff betreffs der musikalischen Verwendung unterschiedlich definiert wird, und dementsprechend die Praxis Unterschiede zeigt. In der zweiten Hälfte des Kapitels werden der praktische Prozess des Mentalen Trainings und dessen Verwendungsbereiche, hinweisend auf die verschiedenen Begriffserklärungen dargelegt. In diesem Rahmen werden die geeigneten Entspannungstechniken, die Bereiche der Bewegungsvorstellung, und die möglichen Strategien zur Meisterung des Lampenfiebers festgestellt. Schließlich werden die immer nicht sehr zahlreichen Ergebnisse verschiedenster Untersuchungen über die Effektivität des mentalen Lernens zusammengefasst. Das dritte Kapitel stellt die Definition der Flow-Erfahrung, die acht Elemente des Flows nach Csíkszentmihályi Mihály und die Grundlagen dieser Übungsart, die von Andreas Burzik entwickelt wurde, dar. Dabei wird die neurobiologische Wirkung des Übens im Flow mithilfe der Ergebnisse einer explorativen Studie, die Andreas Burzik und Dr. Olga Bazanova im Mai 2005 im Russland durchführten, besprochen. 5 Das letzte Kapitel umfasst die Praxis beider Methoden im Kontext des Gitarrenspiels, dabei werden meine persönlichen Erfahrungen, als auch die bei mir aufgetauchten Schwierigkeiten dargelegt. Es wird der Versuch unternommen, eine persönliche Stellungnahme zu diesem Thema zu beziehen. 6 1. Grundlagen des musikalischen Übens Das musikalische Üben ist „ein in Wiederholungen erfolgendes Lernen und Vervollkommnen einer praktischer Tätigkeit.“ (Mahlert 2006, S. 9.) Viele professionelle MusikerInnen haben keine Wissen, im Sinne sowohl psychologisch als auch physiologisch über den Ablauf des musikalischen Lernens. Um welche Übestrategie führt zu der schnellsten und der besten Wirkung, hängt vorwiegend von der musikalischen Aufgabe ab. Zum Beispiel obwohl die rein motorische Wiederholung eines Aktionsmusters für das Erlernen eines neuen Bewegungsmuster notwendig ist, führt nach wenigen Malen zu einer Verschlechterung der Geschicklichkeit. Dieser Effekt tritt vermutlich wegen der nachlassenden Aufmerksamkeit auf, wobei die vorher optimierte neuronalen Repräsentation der Bewegungen durch Verschlechterung den Einsatz der ungeeigneten Hilfsmuskeln zu einer führt. (Altenmüller 2006, S. 57.) Mittels der Kenntnisse der psychologischen und physiologischen Grundlagen des Gedächtnisses, die sich im diesen Kapitel vorgestellt werden, können die Übestrategien besser und wirkungsvoller ausgestattet werden. 1.1 Psychologische Grundlagen des Gedächtnisses Unter Gedächtnis versteht man im Allgemeinen die Fähigkeit des Gehirns, die aufgenommenen Informationen zu behalten und wieder abzurufen. An diesen Prozessen sind verschiedene Gehirnstrukturen beteiligt. Die Gedächtnismodelle versuchen die Struktur des Gedächtnisses zu erklären. Die einfachste ist das Dreispeichermodell, es unterscheidet die Gedächtnisfunktionen nach der Speicherdauer: Das sensorische Gedächtnis Das Kurzzeitgedächtnis Das Langzeitgedächtnis 7 Das sensorische Gedächtnis wird auch Ultrakurzzeitgedächtnis genannt und seine Speicherdauer beträgt nur von 0,5 bis maximal 5 Sekunden. Bei den Wahrnehmungsprozessen spielt die wichtigste Rolle der sensorische Speicher. Die neuen Informationen, die das Gehirn über die Sinnesorgane erreichen, werden in dem sensorischen Gedächtnis festgehalten, um sie für das Kurzzeitgedächtnis verarbeiten zu können. Der größte Teil der Informationen wird im sensorischen Gedächtnis gelöscht, da das Behalten und die Verwendung aller Informationen völlig undenkbar wären. Im Kurzzeitgedächtnis wie im sensorischen Speicher wird die gespeicherte Information nur über einen kurzen Zeitraum aufgenommen und verarbeitet, bevor sie verlöscht oder ins Langzeitgedächtnis, das auch eine begrenzte Speicherkapazität hat, verankert wird. Das Kurzzeitgedächtnis wird auch Arbeitsgedächtnis genannt und speichert Informationen zumeist akustisch bis zu 20 Sekunden, höchstens bis zu einer Minute (7 ± 2 Informationseinheiten). Durch die Organisation der einzelnen Informationselemente in größere Gruppen kann die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses gesteigert werden. Der Übergang vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis erfordert meist eine Wiederholung des Materials. Das Langzeitgedächtnis ist der dauerhafte Speicher für alle Informationen, Erfahrungen, Emotionen, Fertigkeiten usw., die aus dem sensorischen und dem Kurzzeitgedächtnis übertragen werden. Das Langzeitgedächtnis hat eine für den menschlichen Alltag praktisch unbegrenzte Kapazität. Es kann vier Prozesse des Langzeitgedächtnisses unterscheidet werden: Lernen: Einspeichern neuer Informationen Behalten: Bewahren der wichtigen Informationen durch Wiederholung Erinnern: Reproduktion der Gedächtnisinhalte Vergessen: Zerfall von Gedächtnisspuren. Ob eine Information im Gedächtnis verankert wird ist, also ins Langzeitgedächtnis rückt, ist einerseits von der Relevanz und der Anzahl der Assoziationen und andererseits von der emotionalen Bedeutung abhängig. Je nach dem wie 8 Informationen verarbeitet werden, unterscheidet man zwei Formen des Langzeitgedächtnisses: Das deklarative und das prozedurale Gedächtnis. Das deklarative Gedächtnis speichert Ereignisse und Fakten, die meist verbalisierbar sind und mit bewusster Erinnerung einhergehen. Es handelt sich um Wissen über Fakten, wie zum Beispiel Namen, Orte, Begriffe oder persönliche Erinnerungen. Dieses Gedächtnis kann in einen episodischen und einen semantischen Teil untergliedert werden. Das episodische Gedächtnis enthält spezifische Erinnerungen der Lebensgeschichte einer Person. Das semantische Gedächtnis ist die Speicher für das Wissen über die Welt einer Person. Das prozedurale Gedächtnis beinhaltet die motorischen und kognitiven Fertigkeiten wie zum Beispiel Klavierspielen oder Radfahren. Die automatisierte Handlungsabläufe bzw. Fertigkeiten können ohne nachzudenken abgerufen werden. Das prozedurale Lernen erfordert viele mechanische Wiederholungen und läuft langsamer ab als das deklarative Lernen, das häufig schnell geht. (Klöppel 1993., Seel 2003.) 1.2. Neurophysiologische Grundlagen des Gehirns Unser Nervensystem besitzt nach Altenmüller die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern. Um die Vorgänge beim Erlernen und Ausführen der Musizierbewegungen zu verstehen, liefern zwei unterschiedliche Vorgehensweisen Informationen über die Funktionsweise des Nervensystems beim Instrumentalspiel. Beim ersten Weg handelt es sich um die direkte Betrachtung und Untersuchung des Nervensystems (Physiologische Aspekte), beim anderen Weg geht es um die Beobachtung des Individuums in alltäglichen und experimentellen Situationen (Psychologische Aspekte). In dem vorigen Kapitel wurde aus der Sicht der Psychologie die Funktion des Gedächtnisses betrachtet. In diesem Kapitel wird das Nervensystem beim Erlernen eines Stückes aus der Sicht des Neurophysiologie bzw. Physiologie in den Fokus genommen. 9 Bislang sind die hirnphysiologischen Grundlagen des musikalischen Übens unzureichend erforscht. Nur im Bereich der Sportwissenschaften und der Disziplinen der Bewegungswissenschaft sind zahlreiche Erkenntnisse zum feinmotorischen Lernen vorhanden, die auch auf das musikalische Lernen übertragen werden können. Altenmüller definiert das musikalische Üben im Kontext Hirnphysiologie folgendermaßen: „Üben ist eine zielgerichtete musikalische Betätigung, die dem Erwerb, der Verfeinerung und dem Erhalt sensomotorischer, auditiver, visueller, struktureller und emotionaler Repräsentationen von Musik dient“ (Altenmüller 2006, S. 47.) Die Repräsentation von Musik wird eine Veränderung im Netzwerk der Nervenzellen verstanden, die zahlreiche Regionen der Hirnhälften umfassen können. Die Modulierung der Netzwerke ist nach wenigen Minuten des Übens nachweisbar und ein langfristiges Üben führt zu Veränderung der verschiedenen Hirnfunktionen und der Hirnstruktur. Die Nervenzellen bestehen aus einem Zellkörper und den Zellkörper abgehenden Nervenfasern. Die Aufgabe der Nervenfasern ist die Informationen weiterzuleiten. Die weitergeleiteten Nervenimpulse sind elektrische Spannungsveränderungen, die sich an der Oberfläche der Nervenfaser fortpflanzen. Die Veränderungen blitzschnellen der Ausgleich elektrischen der Spannungen Ionenverteilung entstehen innerhalb und durch einen außerhalb der Nervenfaser. (Klöppel 1999.) Gehirn und Gedächtnis Nach Altenmüller teilt sich das menschliche Gehirn in fünf Teile. Die so genannte Verlängerte Mark (Medulla oblongata) verknüpft sich, als Fortsetzung mit dem Rückenmark und mit der Brücke. Daran schließt das Mittelhirn (Mesencephalon) und das darüber liegende Kleinhirn (Cerebellum) an. Aufwärts folgen das Zwischenhirn (Diencephalon) und das Endhirn (Telencephalon oder Celebrum). 10 Abb. 1. Teile des menschlichen Gehirns Jedes Teil des Gehirns hat spezifische Aufgaben. Im verlängerten Mark befinden sich Zentren für die Kontrolle der lebenswichtigen Körperfunktionen wie Atmung, Blutkreislauf, Körpertemperatur, Flüssigkeitshaushalt, Wachen und Schlafen. Das Kleinhirn ist wichtig Augenbewegungen und für die die Gleichgewichtskontrolle, Feinkoordination des die Kontrolle der zeitlichen Ablaufens wie Bewegungen, Sprachlaute oder Gedankenketten. Das Mittelhirn steuert sowohl die visuell als auch die auditiv ausgelöste Blick- und Greifbewegungen. Die Nervenzellgruppen des Mittelhirns sind an motorischen Aufgaben bei der Haltungskontrolle beteiligt. Das Zwischenhirn enthält den Thalamus, wo die sensorischen Bahnen der Augen, der Ohren, des Gleichgewichtsorgans, der Haut und der Muskeln enden, und auf Bahnen zur Hirnrinde umgeschaltet werden. Ein anderer Teil des Zwischenhirns ist der Hypothalamus, der unterhalb des Thalamus liegt. Der Hypothalamus ist das wohl wichtigste Steuerzentrum des vegetativen Nervensystems. Das Endhirn bildet den größten Teil des Gehirns und gliedert sich in die Großhirnrinde und in die Nervenzellgebiete. Die Großhirnrinde ist der eigentliche Ort des Gedächtnisses. Die Hirnrinde besteht aus zwei Hirnhälfte, die sich in vier Lappen gliedern: der Stirnlappen (Frontalkortex), der Schläfenlappen (Temporalkortex), der Scheitelappen (Parietalkortex), der Hinterhauptslappen (Okzipitalkortex). Der Stirnlappen steuert die Lenkung der Aufmerksamkeit, die Programmierung und Ausführung der Bewegungsfolgen. Das 11 linke Frontalkortex ist an der Produktion erlernter symbolischer Handlungen wie zum Beispiel musikalischen Bewegungsfolgen beteiligt. Der Scheitelappen spielt eine Rolle in der Verarbeitung der räumlichen Orientierung. Der Hinterhauptslappen besitzt die Rindegebiete, die für das Sehen zuständig ist. Im Schläfenlappen werden die gehörten Informationen verarbeitet und die Emotionsverarbeitung gesteuert. Die Großhirnrinde enthält etwa 20 bis 50 Milliarden Nervenzellen. Die Grundlage der Kommunikation zwischen zwei Neuronen sind die Synapsen. Die Verknüpfungsstruktur durch die Synapsen ist ganz dicht, so jedes Neuron mit dem anderen Neuron über höchstens zwei Zwischenstationen kommunizieren kann. Die Nervenzellkerngebiete enthalten die Basalganglien, die Mandelkerne, und den Hippokampus. Die Aufgabe der Basalganglien ist die Steuerung von Bewegungen, vorwiegend beim prozeduralen Lernen als auch beim instrumentalen Üben, das Automatisieren komplexer Bewegungen. Die Mandelkerne sind wesentlich am emotionalen Lernen und an der Angstkonditionierung beteiligt. Der Hippokampus organisiert, welcher Inhalt in welcher Weise und an welchem Ort, sowohl für das deklarative Gedächtnis als auch für das episodische Gedächtnis gespeichert wird. Nach der funktionellen Einteilung der Großhirnrinde ist in den primären motorischen Cortex (MC), in die supplementäre motorische Area (SMA) und in die prämotorische Area (PMA) unterteilt. Abb. 2. Teile der Großhirnrinde 12 Altenmüller beschreibt fünf Strukturprinzipien der Hirnrinde, die Bedeutung für die hirnphysiologischen Vorgänge beim musikalischen Lernen haben. 1. Jede Hirnhälfte beschäftigt sich mit der Verarbeitung sensorischer Information und der motorischen Ansteuerung der gegenseitigen Körperhälfte. 2. Die Hirnhälften besitzen unterschiedliche Funktionen, zum Beispiel beim Musizieren verarbeitet die linke Hirnhälfte eine Melodie als Abfolge einzelner Intervalle, indem die rechte Hirnhälfte die globale Konturen der Melodie erfasst. 3. Die Hirnrinde und die motorischen Zentren folgen einem hierarchischen Prinzip. 4. Die Anordnung der Nervenzellen spiegelt räumliche Beziehungen der Außenwelt wieder. 5. Die Nerven können sich an Spezialanforderungen anpassen das heißt das Großhirn ist anpassungsfähig und plastisch. Beim Erlernen des „Musizierens“ handelt es sich um die Abspeicherung der Bewegungen. Diese durch Üben erlernten motorischen Steuerprogramme enthalten alle Informationen für die Muskelgruppen und laufen nicht mehr bewusst. Das Erarbeiten der Steuerprogramme wird durch eine Auswertung der Impulse von den Sinnesorganen der Haut, der Sehnen, der Muskeln, der Gelenke, vom Auge und vom Gehör ständig verfeinert und ermöglicht eine immer feinere Kontrolle des Bewegungsablaufes. Die Bewegung nach den Rückmeldungen zu korrigieren und das Steuerprogramm zu optimieren, erfordert zuerst Üben in einem langsamen Tempo. Die neuronale Repräsentation der geplanten Bewegung und der aktuellen sensorischen Rückmeldung wird Efferenzkopie genannt. Durch die gespeicherte Efferenzkopie können die Steuerprogramme verbessert werden, und kann der zuerst kontrollierte Bewegungsablauf nach und nach korrekt in das Bewegungsgedächtnis verankert werden. Der eingeprägte Bewegungsablauf kann ohne bewusste Kontrolle über die Sinne automatisiert und mit großer Geschwindigkeit durchgeführt werden. Das Erlernen der Bewegungen verläuft in mehreren Schritten, wo vorerst unter der Kontrolle der beteiligten Sinne ein grobes und auch noch fehlerhaftes Schema des Bewegungsprogramms in den motorischen und sensorischen Zentren des 13 Zentralnervensystems erstellt wird. In diesem Schritt sind die Bewegungen noch unkoordiniert und unökonomisch. Durch Einstudieren des Bewegungsablaufes werden in der zweiten Phase die Koordination und die Ökonomie der Bewegung und die Bewegungsgeschwindigkeit verbessert, verfeinert und erhöht. Hier geht es um das prozedurale Lernen. Im dritten Schritt werden die Bewegungsfolgen im Bewegungsgedächtnis als motorisches Programm abgespeichert und automatisiert. Die Speicherung und der Erhalt dieser Programme beruhen auf einer regelmäßigen Aktivierung und Korrektur der neuronalen Netzwerke. (Altenmüller, 2006. S. 48 – 52.) 1.2.1 Veränderungen der neuronalen Netzwerke des Gehirns beim Üben. „Musik gilt einerseits ein »Sprache des Gefühls« und soll Emotionen ausdrücken, andererseits bewegt sich ein professioneller Musikern in einem unerbittlichen Bestrafungssystem – gesellschaftlichen zumindest in Belohnungs- unserer so und genannten »Hochkultur«. Negative Emotionen, Angst vor falschen Tönen vor einer schlechten Kritik oder vor einem Tadel des Dirigenten sind bei Musikern keine Seltenheit. Vielleicht sind starke intrinsische Motivation und der hohe Verhaltensdruck die Kräfte, die Musiker zu ihren Höchstleistungen antreiben, die sich dann wiederum in Adaptationen des Zentralnervensystems spiegeln. Musizieren ist, das Paradigma für Neuroplastizität.“ (Bangert, & Altenmüller, 2003. S. 132.) Das neuronale Netzwerk des Gehirns und der Hirnstruktur verändert sich sowohl durch das Üben als auch durch das langjährige Musizieren. In den folgenden Abschnitten sollen diese strukturellen und funktionellen zentralnervösen Veränderungen ausgeführt werden. An dem Erwerb neuer feinmotorischer Programme sind die Großhirnrinde, die Basalganglien und das Kleinhirn beteiligt. Diese Regionen sind durch Rückkopplungsschleifen mehrfach miteinander verbunden, wodurch sich das 14 motorische Lernen nicht auf eine bestimmte Stelle des Nervensystems beschränkt, sondern sich in allen beteiligten Funktionssystemen zeigt. (Altenmüller, 2006. S. 55.) In einer Untersuchung über die Hirnaktivität feinmotorischer Fingerbewegungen konnten Karni und seine Kollegen im Jahre 1995 die Änderungen der neuronalen Aktivität der motorischen Areale nachweisen. Dieser Effekt trat unterschiedlich auf, abhängig von der wenigen Minuten Dauer oder von der längeren Dauer des Übens. Bei mehrfach hintereinander durchführten Fingerbewegungen, wurde eine Zunahme in den aktivierten neuronalen Netzwerken der primären motorischen Areale gezeigt. Bei der einmalig geforderten Folge der Fingerbewegungen war dieser Effekt nicht messbar. Über mehrere Wochen täglich geübte und perfektionierte Bewegungen konnten eine langfristige Vergrößerung der aktivierten Areale im Bereich der Handregion der primären motorischen Hirnrinde erweisen. Eine Verkleinerung der beteiligten Nervenzellen des Kleinhirns und der supplementären motorischen Areal (SMA) tritt gleichzeitig mit der Vergrößerung der aktivierten Netzwerke der primären motorischen Hirnrinde auf. Eine zunehmende Komplexität einer vorher gelernten Fingerbewegung wurde eine neuronale Aktivität in der SMA gezeigt. (Karni et al. zitiert nach Altenmüller, 2006. S. 55.) Die zeitliche Abfolge der neuronalen Aktivität in den beteiligten Hirnregionen hängt von der Erfahrung ab. Dieses Phänomen konnte Hund-Georgiadis et al. bestätigen. Im Vergleich zu den Laien zeigten geübte PianistInnenen eine Zunahme der Aktivität im primären motorischen Kortex, aber eine geringere Aktivierung der SMA und des Kleinhirns, die bestätigt, dass das Kleinhirn und die SMA vor der Automatisierung eines Bewegungsablaufes eine wichtige Rolle spielen. Das Kleinhirn hat Bedeutung am Beginn eines Lehrvorganges und es kontrolliert die richtige Auswahl, die richtige Reihenfolge und die richtige Zeitsteuerung der Bewegungen. Im Bereich der Basalganglien tritt eine Aktivierung des unbewussten motorischen Lernens ein. (Hund-Georgiadis et al zitiert nach Altenmüller, 2006. S. 56.) Im Kontext musikalischen Übens sind an dem Erwerb neuer Bewegungsprogramme nicht nur die oben beschriebenen Hirnregionen, sondern die Sinnesorgane, vor allem das Gehör beteiligt. Bangert und Alltenmüller (2003) konnten in einer experimentellen Studie mit musikalischen Laien und professionellen PianistInnen die 15 auditorischen und sensomotorischen Verknüpfungen beim Klavierüben nachweisen: Das Hören der Klaviermusik hat zu einer Aktivierung der sensomotorischen Hirnregion ohne tatsächliche Fingerbewegung geführt. Abb. 3. Aktivierung der sensomotorischen Hirnregionen beim reinen Anhören des Stückes. (a) Anfängliches Gleichspannungs-Elektroenzephalographie (DC-EEG) in vor der ersten Praxis. (b) Aktivierungsänderungen nach der ersten 20-minutigen Praxis. (c) Aktivierungsänderungen nach 20.5 ± 7.9 Tage der Praxis (5 Sitzungen). (d) Aktivierungsänderungen nach 38.7 ± 11.6 Tage der Praxis (10 Sitzungen). (e) Gruppe von professionelle Pianisten (angesammelte Praxis-Zeit = 19.4 ± 6.7 Jahre). Auf einer stummen Tastatur gespielte Melodie aktivierten die im Schläfenlappen gelegenen auditiven Areale. 16 Abb. 4. Aktivierung der auditiven Areale beim stummen Bewegen der Finger. Für die allgemeine Zeichenerklärung, bitte vgl. Abb. 3. Das Resultat der Studie zeigt deutlich, dass sowohl allein durch das Hören der Musik auch die Sensomotorik als auch bei der stummen Fingerbewegung auch die Audiomotorik geübt wird. (Bangert et al. 2003b. S. 26 – 36.) Die Untersuchung von Haslinger und seine Kollegen konnte die Aktivitätszunahme der sensomotorischen Handregion, die auditiven Regionen des Schläfenlappens und des Kleinhirns auch durch die Beobachtung von stummen pianistischen Fingerbewegungen erweisen. (Observatives Üben!) Professionelle PianistInnen sollten in einer Videoaufnahme stumme Fingerbewegungen auf einer Klaviertastatur beobachten, ohne dass sie selbst die Finger bewegten. (Haslinger et al. 2005. S. 282 – 293.) 17 Abb. 5. Aufsicht des Gehirns der PianistInnen bei der Beobachtung der stummen Bewegung der rechten Hand im Vergleich zur Beobachtung einer ausruhenden Hand. Nicht nur das neuronale Netzwerk des Gehirns verändert sich durch das Üben, sondern auch die Hirnstruktur wird durch intensives und langjähriges Musizieren modifiziert. Bei professionellen MusikerInnen vergrößert sich sowohl die sensomotorische Handregion als auch die Dichte der Nervenzellsubstanz. Die langfristige Musikübung führt bei professionellen MusikerInnen zu einer Vergrößerung des Kleinhirns und des primären auditiven Kortex. Auch die Faserverbindung zwischen der rechten und linken Hirnhälfte zeigt bei MusikerInnen eine deutliche Vergrößerung, im Gegensatz zu NichtmusikerInnen. (Altenmüller 2006. S. 59.) 18 2. Mentales Training Welcher Musiker hat noch nie von einer schnelleren und effektvolleren Methode geträumt, um die Übungszeit zu reduzieren, und die Podiumsangst zu bewältigen. In der Literatur findet sich eine Vielfalt sowohl die Übungsmethoden als auch an möglichen Strategien zur Meisterung des Lampenfiebers. Im Rahmen dieser Arbeit beschäftige ich mich in erster Linie speziell mit zwei „neuen“ Wegen dieser Möglichkeiten, die noch immer viel zu selten genutzt werden. In diesem Kapitel handelt es sich um das mentale Training, die eine dieser „neuen“ Wege der möglichen Strategien ist. Wie im Folgenden gesehen wird, zeigt der Begriff und der Praxis des mentalen Trainings im Bezug der Musikübung ein uneinheitliches Bild. 2.1 Der Begriff des Mentalen Training Das so genannte mentale Training stammt ursprünglich aus der Sportpsychologie, wo es zur Optimierung der Leistung von Spitzensportlern systematisch eingesetzt wird. Die Bezeichnung mental practice ist mehr als 50 Jahre alt, Untersuchungen zu diesem Thema, die sich auf das Bewegungslernen beziehen, stammen bereits aus den 30er Jahren. (Klöppel 1996. S. 10 – 11.) Im Grunde genommen versteht man unter „Mentalem Training“ eine Art und Weise des planmäßig wiederholten Durchspielens einer Bewegung oder bestimmten Handlungsabläufen in der Vorstellung ohne tatsächliche praktische Ausführung. (Eberspächer 2008. S. 74.) Die Terminus „Mentales Training” fasst Frauscher in seiner Diplomarbeit folgendermaßen zusammen: „»Training durch interne Realisation«, »indirektes Training«, »observatives Training«, »ideomotorisches Training«, »symbolic Rehearsal«, »imaginary practice«, »implicit practice«, »mental 19 rehearsal«, »conceptualising practice«, »mental preparation«, »internal imagery«, »external imagery« et cetera.“ (Frauscher 2003, S. 4.). Diese Vielfältigkeit des Begriffes erzeugt sowohl eine Uneinheitlichkeit der Definitionen des mentalen Trainings als auch die verschiedenen Verwendungsweisen des Terminus, die auch auf Musik bezogenen Arbeiten eine begriffliche Unschärfe zeigen. In der Sportpsychologie stellt Fetz (zitiert nach Frauscher 1973.) das mentale Training auf die gleiche Stufe wie das praktische Training und teilt es auf in: Verbalinformatives Üben: Diese Übungsart ist eine Form des inneren Sprechens, die sich in Kommunikation mit anderen Menschen, Kommunikation mit der Instruktor, Kommunikation mit selbst gliedert. Observatives Üben: Eine planmäßig wiederholte und gezielte Beobachtung des Bewegungsablaufes anderer Personen. Ideomotorisches Üben: Erlernen oder Verbessern eines Bewegungsablaufes durch intensives Vorstellen ohne gleichzeitiges tatsächliches Üben. Das Modell von Kunze (zitiert nach Frauscher, 1978.) gliedert die mentale Trainingsmethoden nach der Art ihrer Informationsaufnahme und –verarbeitung, in Observatives Training Motorisches Training Verbales Training Mentales Training Er unterteilt das mentale Training in: Subvocale Training Verdecktes Wahrnehmungstraining und Ideomotorisches Training 20 Für diese Arbeit ist nur das mentale Training als Form des musikalischen Lernens von Bedeutung, deshalb möchte ich mich im Rahmen dieser Arbeit vorwiegend mit der Theorie und Praxis des musikbezogenen Mentalen Trainings beschäftigen. Im Folgenden werden die Definitionen und Praxisbeschreibungen aus diesem Bereich erläutert. Die oben genannte Unschärfe der Begriffserklärungen und der Methoden des mentalen Trainings scheint auch in den musikalischen Definitionen und der Praxis zu sein, die unten noch näher beleuchtet werden. In der musikalischen Praxis des mentalen Trainings wird der Begriff einerseits als Vorstellung und Lernen einer Bewegung, andererseits eine Form zur Vorbereitung für den Auftritt, beziehungsweise zum Bewältigen von Ängsten verwendet. Aus den oben genannten Modellen der mentalen Trainingsmethoden wird auf das observative Üben/observative Training in den musikalischen Publikationen über Mentales Training verzichtet. Das verbalinformative Üben/verbale Training wird nicht bei allen Autoren und bei allen Methoden angeführt. Wie das verbale Training/ ideomotorische Training in der Praxis wirken soll, sind sich die Autoren auch nicht einig. Diese Abweichungen werden im Folgenden erläutert. Orloff-Tschekorsky (1996, S. 35.) definiert mentales Training so „Der Begriff »mental« meint alles Lernen, Erfassen, Verarbeiten und Memorieren geistiger Inhalte. Werden diese nun konkretisiert bzw. praktisiert, definiert man diesen Vorgang folgendermaßen: Mentales Arbeiten ist eine geistige Vorwegnahme einer später ausgeführten Tätigkeit, die auf schon erworbenen Kenntnissen und der Fähigkeit zu analogem Denken und zu konkreten Vorstellungen fußt. [...] Nun noch eine Anmerkung zum Begriff »Training«: Er kommt aus dem Sport und wurde von dorther übernommen.“ (Orloff-Tschekorsky 1996, S. 35.) Orloff-Tschekorsky hat eine eigene Methode des mentalen Lernens entwickelt, die als Mentales Training in der Musikausbildung (MTMA), oder „Orloff-Mental-System“ genannt. Diese Art des Lernens ist eine “Einstudierungs- und Übungsmethode“, die sie einfach mit dem Wort „Üben im Kopf“ bezeichnet hat. (Orloff-Tschekorsky 1996, S. 35.) 21 Nach Klöppel bedeutet „Mentales Training […] Üben im Geist (abgleitet von dem lateinischen Wort mens = Geist).“ In wenigen Zeilen darunter weist sie auf Unterschiede zum sportlichen mentalen Lernen hin: „Nun ist beim Musizieren nicht die richtige Ausführung einer Bewegung die wesentliche Zielvorstellung, sondern der daraus entstehende Klang. Mentales Training beim Üben auf dem Instrument, beim Dirigieren oder beim Singen ist denn auch viel mehr als nur das geistige Einüben von Bewegungen, weil die Klangvorstellung immer einbezogen werden soll. Eine differenzierte Klangvorstellung, das heißt ein genaues Bild von der angestrebten Wiedergabe einer Komposition, ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung.“ (Klöppel 2008, S. 3.) Sie spricht über mentales Training im weitesten Sinne über eine Veränderung der Verhaltensmöglichkeiten, die, durch die verstandesmäßige Bearbeitung einer Aufgabe entsteht, ohne dass eine Handlung tatsächlich ausgeführt wird: „Durch Mentales Training wird angestrebt, ein Verhalten zu lernen, ohne daß es körperlich geübt wird.“ (Klöppel 1996, S. 10.) Johanna Gutzwiller weist in ihrer Studie darauf hin „Mentales Trainieren umfasst mehr als das Vorstellen von Musik. Es bedingt, dass die Ausübenden in der Lage sind, vor dem mentalen Teil zu entspannen, um so die Ausgangslage zu schaffen dafür, effizient zu üben und speichern. Dieser Aspekt ist die meisten MusikerInnen nicht bekannt, ebenso wenig die Tatsache, dass das Mentale Trainieren nebst dem Vorstellenkönnen der musikalischen Inhalte das exakte Vorstellen der körperlichen Vorgänge beim Instrumentalspiel oder Singen bedeutet. Diese Vorstellungsarbeit umfasst nicht nur Finger oder Hände, sondern auch die gesamtkörperliche Haltung und Atmung.“ (Gutzwiller 2008, S. 3.) 22 Langeheine in ihrem Buch „Üben mit Köpfchen“ verzichtet auf eine Begriffserklärung des mentalen Trainings, beschäftigt sich aber mit der praktischen Anwendung dieser Übungsart. Nach Pohl „Der Begriff »mental« stammt aus dem Lateinischen: »mentalis« bedeutet so viel wie „geistig, in der Vorstellung vorhanden.“ Mentales Training heißt, etwas nur in der Vorstellung zu üben. Hierfür benötigen wir die Grundfähigkeiten: 1. Konzentration (Fokussierung der Aufmerksamkeit) 2. Imagination (Vorstellungskraft) 3. Suggestion (Einbildungskraft). […] Das mentale Training ist eine Art universelle Methode für jeden Handlungsbereich menschlichen Lebens und kann maßgeblich zur Persönlichkeitsbildung und Entwicklung von Selbstdisziplin beitragen.“ (Pohl 2006, S. 288.) Klöppel schreibt über die Leimer/Gieseking Methode: „Mentales Training bei MusikerInnen hat ebenfalls eine längere Tradition, ohne dass der Begriff »Mentales Training« bei denen, die so geübt haben, gebräuchlich gewesen wäre.“ (Klöppel 1996, S. 10.) Das heißt, obwohl Gieseking seine Methode nicht als mentales Üben gekennzeichnet hat, sprechen die Autoren in den musikalischen Veröffentlichungen über seine Methode, als Mentales Üben/Mentales Training. Gieseking hat seine Methode folgendermaßen beschrieben „Jedes komplizierte Werk lerne ich aber nicht am Instrument, sondern nur lesend. Ebenso repetiere ich länger nicht gespielte Werke, indem ich diese, mit dem Notenbuch in greifbarer Nähe, im Gedächtnis ablaufen lasse, wobei zur Erleichterung der Kontrolle die Finger, die jeweils zu spielen hätten, andeutungsweise bewegt werden können. Hierdurch werden die vom Kopf (von der musikalischen Vorstellung) ausgehenden Impulse sozusagen durchprobiert, um festzustellen, ob die Übertragung in die Finger 23 einwandfrei funktioniert. Wenn diese Übertragung ohne Störung verläuft, ist kein Üben am Klavier mehr nötig. Dieses Lernen durch Lesen ist nicht nur die sicherste Art des Auswendiglernens, sondern auch eine praktische Verwendung der Zeit, die die Eisenbahnfahrten in Anspruch nehmen.“ (Gieseking 1963, S. 94.) Pohl führt die erste Erscheinung des mentalen Trainings in den Musikunterricht auf Margit Varró zurück, die in ihrem Buch Der lebendige Klavierunterricht (1929/1958.) die Wichtigkeit der mentalen Textverarbeitung bevor das instrumentale Üben betont wurde. (Pohl, 2006. S. 287.) Die Autoren sind sich einig, dass das mentale Training eine „geistige“ Übungsart ist, doch nicht darüber, wie diese Vorstellungsarbeit in der Praxis verlaufen sollte. Diese unterschiedlichen Vorstellungen können einerseits zu der Gieseking/Leimer Methode – die am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entwickelte Art des sogenannten „mentalen“ Übens – andererseits zu der späteren nach OrloffTschekorsky erstellten Methode zurückführen. Diese Vielfältigkeit des mentalen Lernens hat nur dann Bedeutung, wenn eine Untersuchung die Effektivität dieser Übungsart vorliegt. 2.1.1 Die Geschichte des Mentalen Trainings für Musiker 1929 veröffentlicht Margit Varró das Buch “Der lebendige Klavierunterricht.“ In dem Kapitel Lerntechnik unterscheidet sie zwei gleich wichtige Teile des Musikstudiums. Eine ist die „Bewältigung des Geistigen der Aufgaben“, die andere „das Üben auf dem Instrument“. Sie meinte, das beste Ergebnis wird dann erreicht, wenn der geistige Teil der Aufgabe von dem technischen Teil des Übens getrennt wird. Das heißt „daß die geistige, musikalische Seite der Aufgabe durch den Schüler gelöst wird, bevor er an ihre technische Ausführung geht.“ (Varró, 1929. S. ) 1931 wurde das Buch “Modernes Klavierspiel“ von Leimer/Gieseking veröffentlicht. Die Grundlagen dieser Methode sind das Trainieren des Gehörs und das Trainieren 24 des Gedächtnisses. Die Fähigkeit der Entspannung der Muskeln hält er für eine wichtige Voraussetzung dafür, ohne Anstrengung Klavier zu spielen (!). Für die Schulung des Ohres muss man das Notenmaterial so genau wie möglich durch Analyse des Textes memorieren. Diese Arbeit nennt Leimer das Trainieren des Gedächtnisses durch Reflexion (systematisch- logisches Nachdenken). Nach dieser mentalen Verarbeitung und Einprägung des Notentextes wird das Werk am Instrument gespielt. Diese hoch konzentrierte Übungsart ist nach Leimer ohne Unterbrechung von 20 bis 30 Minuten möglich. Das Weiterspielen hat nach seinem Erachten kein Sinn mehr. (Leimer-Gieseking 1931.) Ende 1988 entwickelte Tatjana Orloff-Tschekorsky mit drei Psychologen der Sporthochschule Köln ein Mentaltraining-System für die Musik, die als „Mentales Training in der musikalischen Ausbildung“ abgekürzt MTMA bezeichnet wird. Der erste Kurs wurde im Frühjahr 1989 mit acht SchülerInnen von Tatjana Orloff- Tschekorsky durchgeführt, die im Alter von 15 bis 51 Jahren waren und deren unterschiedliche Spielniveaus vom Sonaten-Stadium bis zum professionellen Hochschulgrad hatten. Der Kurs begann mit einem mehrwöchigen Entspannungsunterricht nach Dr. Hannes Lindemann. Als alle TeilnehmerInnen die Entspannungszeit auf 1-1,5 Minuten reduzieren konnten, fing der „wahre“ mentale Kurs mit der Schülern an. Auffallend war der Fall des 15jährigen Carsten, der kein flüssiges Spiel erzielen konnte. Während des Kurses und danach zeigten sich bei ihm und bei allen anderen Teilnehmerinnen erstaunliche Fortschritte. Sein Spiel war plötzlich fließend. Nach diesem ersten Versuch wurden regelmäßige Kurse eingerichtet. Dazu wurden: Ein Professional-Kurs, einen für Amateure und einen für Kinder, die alle sehr erstaunliche Erfolge hatten. Zwei Jahre lang unterrichtete Tatjana Orloff-Tschekorsky das Mentaltraining nur am Klavier, als die ersten Studenten gemeldet wurden, die an anderen Instrumenten spielten. Nach dieser Ausweitung des Mentalübens auf andere Instrumente wurde 1992 in Wien ein Institut gegründet. (Orloff-Tschekorsky, 1996. S. 21 – 34.) Ihr Buch über ihre Methode veröffentlichte Orloff-Tschekorsky im Jahre 1996, aber sie betonte, dass man „… das MTMA durch dieses Buch nicht vollständig erlernen kann. Man kann Anregungen bekommen, Anregungen, die sich auch für das gesamte Üben und Einstudieren eines Musikstückes sehr positiv auswirken können. Man kann die Methode kennenlernen, man kann 25 versuchen, damit auch selber experimentieren, aber man kann sie nach diesem Buch nicht vollkommen erlernen, weil die flexibilität der Methode, d. h. die Anwendung auf den Einzelnen und auf seine Situation und eventuelle Problematik für den Erfolg entscheidend ist“ (Orloff-Tschekorsky, 1996. S. 19.) 1994 wurde von Ulrike Klees-Dacheneder ein Artikel über Mentales Training in der Zeitschrift „Üben und Musizieren“ veröffentlicht. Im Bezug auf die Verwendung der Methode vertritt Klees-Dacheneder eine einzigartige und interessante Ansicht. Die Autorin legt bei der Bewältigung schwieriger Stellen durch mentales Üben das Gewicht vorwiegend auf das Körpergefühl, sowie auf die Auflösung der Verspannungen. Sie hält auch die Entspannung als eine notwendige Voraussetzung für das mentale Training ähnlich wie Orloff-Tschekorsky, Renate Klöppel und Linda Langeheine.(Klees-Dacheneder, 1994.) 1996 veröffentlichte Renate Klöppel ihr Buch “Mentales Training für Musiker Leichter lernen – sicherer auftreten“. Sie hat den Verwendungsbereich dieser Technik auf die Angstbewältigung erweitert. Zu der Praxis des mentalen Lernens gibt sie viele praktische Anweisungen und gegenüber von Orloff-Tschekorsky schreibt sie über mentales Training nicht nur als eine Einstudierungsmethode der technischen Einheiten eines Stückes im Sinne die Bewegungsvorstellung, sondern auch über die musikalische Gestaltung des Werkes (Rhythmus, Intonation, Artikulation, Dynamik, Klangfarbe, Tonqualität, Ausdruck, Phrasierung) durch mentales Üben. Sie ist der Meinung, dass Mentales Training im Selbststudium erworben werden kann. (Klöppel 1996.) 1996 publiziert Linda Langeheine das Buch “Üben mit Köpfchen Mentales Training für Musiker“. Sie widmet ein Kapitel der Bewältigung der Auftrittangst, bietet viele praktische Anweisungen, aber sie verzichtet auf Musikbeispiele, die in der Arbeit von Klöppel und Orloff-Tschekorsky vorhanden sind. Über die praktische Anwendung des mentalen Übens schrieb sie genauso wie Klöppel. Die drei Autorinnen sind gemeinsam der Ansicht, dass Mentales Training nur effektvoll ist, wenn die Trainingseinheiten einer Entspannungsphase vorhergegangen werden. (Langeheine 1996.) 26 2006 wurde das Handbuch Üben (hrsg. Mahlert) veröffentlicht, in dem Christian A. Pohl über Mentales Training im Sinne der Methode von Leimer einen zusammenfassenden Artikel nach eigenen Erfahrungen schrieb. Obwohl er auf die Methode von Leimer als Grunde seines Artikels hinwies, zeigt sein zusammenfassender Artikel viele Abweichungen. Der wichtigste Unterschied zu Leimer und der anderen Autoren ist die Verbalisierung, die nur bei Pohl als mentale Technik erscheint und eine sehr große Rolle spielt. Er erarbeitet seine Anleitungen von Musikbeispielen mit ausführlichen Erklärungen. (Pohl 2006.) 2.1.2 Die Methoden Da sich die Autoren über die Technik des mentalen Übens nicht einig sind, werden in diesem Kapitel diese Methoden ausführlich dargestellt. Bei Klöppel und Langeheine werden nur die Unterschiede zur Orloff-Tschekorsky Methode vorgestellt. Der Prozess der Techniken wird sowohl theoretisch als auch praktisch durch Beispiele veranschaulicht. Margit Varró: Der Lebendige Klavierunterricht In ihrem Buch schrieb Varró vorwiegend nicht über eine Art mentales Üben, sondern über Lerntechniken und Lerntechniken stellte sie über Klavierunterricht allgemein. In dem Kapitel eine mögliche Art des Memorierens durch eine innere Tonvorstellung dar. „Beim Memorieren in der Vorstellung, müssen wir, sobald wir in die Noten blicken, mit unserem inneren Ohr die durch das Notenbild vertretenen Ton- und Harmoniefolgen so deutlich hören, ob sie außen auf einem Instrument ertönten“. (Varró, 1929/1958. s. 48-49.) Wie Leimer und Gieseking verteilt sie das Material in nacheinander zu lernende Abschnitte. Nach mehrmaligen Durchlesen und Vorstellen des ersten Teils, wenn wir uns in der Lage fühlen, den Abschnitt zu beherrschen, so können wir versuchen, es 27 auswendig am Klavier zu spielen. Wenn dabei einige Unsicherheiten auftreten, muss das geistige Einüben so wiederholt werden, dass der betreffende Abschnitt mit geschlossenen Augen in auditiver Weise noch mal vorgestellt wird, achtend darauf, dass keine Pause vorkommen. Nach der Verarbeitung jedes Abschnittes wird das innere Abhören des Ganzen auf dieselbe Art verfolgt. Über das Tempo des inneren Vorstellens wurde der folgende Hinweis gegeben: Es soll so mäßig sein, dass jeder Ton ins Bewusstsein fließen kann, und das Tempo muss verlangsamt werden, wenn der Fluss der Vorstellung zu stocken droht. (Varró 1929/1958, S. 49.) Um diese Art der inneren Vorstellung des Auditives zu unterstützen, bemerkt sie: „Um die angestrebte Oberherrschaft der auditiven Vorstellungsreihe über die motorische zu unterstützen, enthalten wir uns während des inneren Memorierens aller Hand- und Fußbewegungen, Kopfnickens und aller fühlbaren Kehlkopfbewegungen“ (Varró 1929/1958, S. 49.) Leimer-Gieseking: Modernes Klavierspiel Wenn es um mentales Lernen geht, zitieren viele Autoren die Leimer-Gieseking Methode. Leimer nennt diese Arbeit als Training des Gedächtnisses durch Reflexion. Der Grund dieser Übungsart ist das Auswendiglernen eines Stückes bevor der Spieler es am Instrument aufführt. Den ganzen Verlauf des Übens hat er folgendermaßen zusammengefasst: „1. lediglich mit der Einprägung des Notenbildes, 2. macht man sich aufs Genaueste die Notenwerte zu eigen, 3. bringt man für das bis dahin Beherrschte die richtigen Anschlagsarten in Anwendung und geht 4. erst dann auf den Vortrag ein, wenn die vorhergehenden Probleme einwandfrei gelöst sind.“(Leimer-Gieseking 1931, S. 79.) Bei diesem Prozess ist nur die erste Phase des mentalen Lernens, wo das Stück ohne Instrument von Takt zu Takt eingeprägt wird. Die weiteren Abschnitte werden schon am Instrument geübt. Leimer beschreibt seine Methode durch Musikbeispiele, wo die Bearbeitung des Werks durch viele und immer wechselnden Ansichtspunkte ausgeführt ist. Nach seinem Erachten ist es ratsam von einem Takt zum anderen überzugehen, wenn der erste Takt schon im Gedächtnis eingeprägt ist. Die Bearbeitung der wenigen Takte muss man im Laufe des Tages vier- bis 28 sechsmal wiederholen. Wie die Ausarbeitung des Notenbilds durch Reflexionen läuft, versuche ich nach Leimers Beispiel zu erläutern. Abb. 6. Etüde von Lebert-Stark. Am Anfang muss immer die Tonart und der Takt festgestellt werden. Von Takt zu Takt wird zuerst die rechte Hand und dann erst das Material der linken Hand durchgearbeitet. Es sieht so aus bei den ersten Takten der der Etüde von LebertStark: Die Tonart ist C-dur, der Takt ist 2/4. Die rechte Hand beginnt mit der Sexte e’’- c’’’ und abwärts im 1. und 2. Takt in Sechszehntel skalenförmigen Sexten durch zwei Oktaven bis zum kleinen e - c’. Die Sexten beginnen auf dem zweiten Sechszehntel. Die linke Hand spielt den gebrochenen C-Dur-Dreiklang, der im ersten Takt als C Viertelnote mit darauf folgender Viertelpause, im zweiten, dritten und vierten Takt E G c auch mit Viertelpause klingt. Im 3. und 4. Takt gehen die skalenförmigen Sexten in der rechten Hand abwärts von kleinen d - h durch zwei Oktaven bis e’’ - c’’ Die nächsten zwei Takte entsprechen dem ersten und zweiten Takt nur mit eingefügter Terz zu den Sexten. Der 7. Takt ist wie der 3. Takt ebenfalls mit eingefügter Terz. Der 8. Takt bringt die Sexten des 4. Taktes bis g’ - e’’, aber dort endet es mit den Sexten f’ - d’’ und e’ - c’’ als Viertelnote. In der linken Hand geht alles gleich von 5. Takt bis 8. Takt, wie in den ersten vier Takten. Die ersten acht Takte sind schon durch Reflexion bearbeitet. Die weiteren Takte werden auch durch diese Art des Durchlesens beschrieben. Das reflektierende Lesen gewährt noch den Eindruck in die kompositorische Form des Stückes. Nach dieser „mentalen“ Einprägung des Werkes kann die technische Beherrschung des Stückes durch intensive Kopfarbeit begonnen werden. Bei dieser Arbeitsphase wird das Notenmaterial aus technischer- interpretatorischer Hinsicht geübt, wo die Kontrolle 29 durch das Ohr nach Leimer der wichtigste Faktor ist. In seinem Buch gibt er viele praktische Hinweise zu dieser Arbeit. (Leimer-Gieseking, 1931. S. 19.) Tatjana Orloff-Tschekorsky: Mentales Training in der musikalischen Ausbildung Die Methode von Orloff-Tschekorsky ist die einzige, die als Einstudierung neuer technischen Fertigkeiten funktioniert. MTMA ist in drei Phasen strukturiert, die immer nacheinander verfolgt werden: Entspannen Vorstellen der Bewegung Praxis im vorgestellten Tempo Alle drei Stufen werden mit Temposteigerung von Vorstellung und Spiel wiederholt, bis das gewünschte Tempo erreicht wird. Die Entspannung Wichtig ist nach Orloff-Tschekorsky die Beherrschung einer Entspannungstechnik, die in wenigen Minuten (1-2) erreicht werden kann. Es ist nicht genügend, wenn dieser Zustand in mehreren Minuten erreicht werden kann, denn dies bedeutet beim Üben eine große Zeitverschwendung. Ohne die Erreichung des entspannten Zustandes, kann die Methode nicht ausreichend wirken. Bei Tatjana OrloffTschekorsky werden nur die Lindemannsche Technik, die progressive Muskelentspannung nach Jacobson und das Autogene Training erwähnt, doch sie verzichtet auf eine ausführliche Beschreibung dieser Techniken. Es wird aber zum Beispiel bei der Methodenbeschreibung von Klöppel diskutiert. Die Vorstellung Wenn der entspannte Zustand erreicht ist, kommt der nächste Schritt die Vorstellungsarbeit. Bevor man mit dem Notenmaterial zu arbeiten beginnt, bedarf es noch einiger Vorbereitung. Man muss das Musikstück in angemessene Abschnitten 30 einteilen, die Tempi bestimmen und noch entscheiden mit welcher Technik das Werk erarbeitet werden soll. Diese Einteilung ist von dem Schwierigkeitsgrad des Stückes, von dem individuellen Level und von der individuellen Vorstellungsfähigkeit, von dem Grad der Komplexität des Stückes, von der momentanen Aufnahmefähigkeit und von der erworbenen Gehirnkapazität abhängig. Bei komplizierten Werken können diese Phrasen der Vorstellung ein bis vier Takte sein, wie zum Beispiel bei einer Fuge. Bei einer leichteren Komposition kann acht bis sechzehn Takte auf einmal vorgestellt werden. Die Fingersätze sollten wenn möglich vorher bestimmt werden. Nach dieser Vorbereitung kann die eigentliche Mentalarbeit beginnen. Man sitzt auf einem Stuhl, öffnet die Augen und konzentriert sich auf den betreffenden Abschnitt in den Noten. Dann imaginiert man anhand der Noten den Klang und die Bewegung. Bei dieser Bewegungsvorstellung sollte eine große Genauigkeit angestrebt werden. „Beim Klavierspieler sind das die Bewegungen der Finger, das Erfühlen des Niederdrückens der Tasten, vielleicht sogar der genauen Stelle, an der der Finger und in welcher Krümmung er die Taste berührt. Dazu kommen die Bewegungen oder Stellungen der Hände und die Bewegungen des Armes. […] Bei den Bläsern ist diese Imaginationsarbeit wesentlich komplizierter. Sie müssen sich zusätzlich noch die Zungenbewegungen Atemführung, vorstellen. […] die Mund-, Bei Lippen- Sängern ist und die Atemvorstellung kombiniert mit der Vorstellung des gesamten Stimmapparates notwendig. Die Streicher müssen in der Vorstellung den Klang, Haltung der Finger und deren Bewegung kombinieren. Dazu kommt die Hand- und Armstellung der linken Hand zusammen mit der Haltung und Bewegung der rechten Hand und des Armes bei der Bogenführung.“ (Orloff-Tschekorsky, 1996. S. 38.) Die Praxis Nach dieser Klang- und Bewegungsvorstellung wird der entsprechende Abschnitt des Stückes ein- bis zweimal in dem vorgestellten Tempo ausgeführt. Voraussetzung für diese praktische Aufführung ist die Genauigkeit der Bewegungsvorstellung. Das heißt man kann nur das vorspielen, was man sich in dem entspannten Zustand vorstellen konnte. Nach Orloff-Tschekorsky liegt die zeitliche Obergrenze dieses 31 hochkonzentrierten Übens ohne Unterbrechung bei 45 Minuten. Für Anfänger können zehn bis zwanzig Minuten schon genug sein. Eine nächste Arbeitsphase ist nach einer Ruhepause von mindestens fünfzig Minuten möglich. Die Erfahrungen von Frau Orloff-Tschekorsky zeigen einen reduzierten Zeitaufwand für die Einstudierung eines Stückes. Durch die von MTMA erworbene Beherrschung eines Werkes nennt man den Mentaleffekt. Um die Erfüllung dieses Effekts zu erreichen, müssen folgende Kriterien erfüllt werden: eine ausreichende Entspannung eine genaue Imagination des Klang- und Bewegungsgefühls eine nicht zu stark kontrollierte Ausführung der Bewegungen. Frau Orloff-Tschekorsky bemerkt noch, dass es im Zustand der Ermüdung, der Krankheit, des Stresses oder der Unlust sinnlos ist, mental zu arbeiten. Der genaue Prozess der Verarbeitung eines Stückes wird durch Beispiele einiger Musikwerke beleuchtet. Obwohl die Methode von Orloff-Tschekorsky eine technische Einstudierung eines Stückes ist, spricht sie auch über die Erarbeitung der Interpretation. Voraussetzung für diese Arbeit ist die technische Beherrschung des Werkes. Es handelt sich hier um die Konkretisierung der musikalischen Vorstellung, deshalb kann man größere Abschnitten nehmen. Nach Orloff-Teschkorsky kann die Phrase zwei- bis viermal so groß gewählt werden wie beim technischen Einstudieren. Bei dieser Interpretationserarbeitung ist die Klangvorstellung vorrangiger als die Bewegungsvorstellung. (Orloff-Tschekorsky 1996, S. 38-39.) Ulrike Klees-Dacheneder: Mentales Training in der Musik Markant unterscheidet sich Klees von den anderen Autoren in der Art, wie sie die Methode verwendet. Der Prozess des Übens verläuft auf gleiche Weise wie bei Orloff-Tschekorsky. Am Anfang steht die Entspannung, als mögliche Technik bevorzugt sie und beschreibt sie die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson, später ausführlich beschreiben wird. Die zweite Phase ist die Vorstellung beziehungsweise das mentale Training. Sie unterscheidet grundsätzlich zwei Wege des Erarbeitens einer schwierigen Stelle: Das „Erarbeiten von Bewegungsabläufen 32 bei technisch schwierigen Stellen“ und das „Erarbeiten von unterstützenden Gedanken bei technisch schwierigen Stellen“. Im ersten Fall sollte nach ihrer Methode zuerst während der Vorstellung der schwierigen Stelle fühlen und feststellen, wo körperliche Verkrampfungen auftreten. Nach dieser Diagnose muss man sich ein paar Takte vor der Stelle vorstellen, dann die entsprechenden Muskeln bewusst lockern. Nach dieser Entspannung muss man im Kopf die Schwierige stelle entspannt zwei bis drei Mal spielen, bevor er am Instrument kontrolliert. Im Vordergrund stehen immer das Körpergefühl und die Auflösung der auftretenden Verkrampfungen bei dem Spiel. Im zweiten Fall verwendet sie die Technik positive Gedanken zu fördern, im Gegensatz zu Klöppel und Langeheine nicht nur als eine positive Einstellung zu der Vorspielsituation, sondern auch die negativen Gedanken bei schwierigen Stellen mittels mentaler Vorstellung zu identifizieren und zu verändern. Bei dieser Technik handelt es sich um die Beobachtung der auftretenden negativen Gedanken während der Vorstellung des eigenen Spiels. Um diese negativen Gedanken zu beheben, wird ein positiv formulierter Satz erfunden, diesen Satz spricht man bei der bertoffenen Stelle aus. Nach dieser Durcharbeitung soll man die Stelle auch am Instrument kontrollieren. Die dritte Phase der mentalen Arbeit ist das „Realtraining“, bedeutet bei ihr nicht nur die praktische Aufführung des Abschnittes am Instrument, sondern den Einfluss der Gedanken auf die Körpersprache, die ebenso Einfluss auf die Selbstsicherheit hat. In dieser Hinsicht empfiehlt sie Situationsübungen, wie zum Beispiel die Simulierung eines in einen Raum eintretenden unsicheren ängstlichen Menschen und die Beobachtung dessen Verhaltens auf das eigene Gefühl. Als Vorbereitung auf eine Konzertsituation empfiehlt sie die Hilfe von Videoaufnahmen zu nutzen, wobei während einer simulierten Prüfungssituation die oft nicht wahrgenommene Körpersprache deutlich gezeigt wird. In ihrem Artikel gibt sie noch Tipps, wie das mentale Training in das alltägliche Leben eingebaut werden kann. Diese sind: „Mentales nachüben“, „Situation vorüben“ und „Körpergefühl üben“. Das mentale Nachüben bedeutet die nachträgliche mentale 33 Verarbeitung der schon am Instrument gespielten sowohl geklappten als auch nicht gelungen Stellen. Die Situation vorüben entspricht der Technik der Angstbewältigung mit Hilfe der mentalen Technik bei Klöppel und Langeheine, die unten ausführlicher beschrieben wird. Das Körpergefühl zu üben, bedeutet den ganzen Körper so genau und so oft wie möglich wahrzunehmen. (Klees-Dacheneder, 1994. S. 3 – 9.) Renate Klöppel: Mentales Training für Musiker, Linda Langeheine: Üben mit Köpfchen Mentales Training für Musiker. Im Vergleich zu Orloff-Tschekorsky gibt es bei Klöppel und Langeheine eine zusätzliche Anwendungsmöglichkeit des mentalen Trainings: Sie widmen dem Thema Angstbewältigung mit Hilfe des mentalen Trainings ein eigenes Kapitel. Der Prozess des mentalen Übens besteht, wie bei Orloff-Tschekorsky aus drei Phrasen: die Entspannung, die Vorstellung und das Spielen. Die Entspannung spielt auch bei Klöppel und Langeheine eine wichtige Rolle. Beide Autorinnen liefern eine ausführliche Beschreibung über die möglichen Entspannungstechniken. Die entsprechende Methode ist nur von der Trainingszeit der körperlichen und geistigen Entspannung abhängig. Mit anderen Worten soll der entspannte Zustand relativ schnell erreicht werden, um unnötigen Zeitverlust die beim Üben zu vermeiden. Diese möglichen Methoden lauten nach den Autorinnen: Progressive Muskelentspannung nach Jacobson Entspannung mittels bildhafter Vorstellung Autogenes Training Langeheine empfiehlt noch weitere Techniken: Atmen Biofeedback Schnelle Visualität Bewegung Lachen Dehnung 34 Progressive Muskelentspannung nach Jacobson Nach Mihalec wurde die Progressive Muskelentspannung im Jahre 1938 von dem Psychologen Edmund Jacobsen in Amerika entwickelt. Diese Technik kann relativ gut nach einer schriftlichen Anleitung erlernt werden. Der Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit alle Muskelgruppen gleichzeitig anzuspannen. Das Prinzip der Progressiven Muskelentspannung ist einfach: Durch die willentliche und bewusste An- und Entspannung bestimmter Muskelgruppen soll ein Zustand tiefer Entspannung des ganzen Körpers erreicht werden. Die einzelnen Muskelpartien des Körpers werden in einer bestimmten Reihenfolge zunächst angespannt, die Muskelspannung wird für einige Sekunden gehalten, und anschließend wird die Anspannung wieder gelöst. Bei der Praxis der Progressiven Muskelentspannung muss die Haltung bequem sein. Die Übungen können im Sitzen oder im Liegen durchgeführt werden. Es wird üblicherweise sechzehn Muskelgruppen nacheinander einzeln angespannt. Im Grunde genommen läuft die Praxis der Progressiven Muskelentspannung in fünf Phasen ab: 1. Hinspüren Die übende Person konzentriert sich auf die jeweilige Muskelgruppe. 2. Anspannen Die jeweilige Muskelgruppe wird angespannt. Die Spannung soll deutlich spürbar sein, ohne in Verkrampfung überzugehen. 3. Spannung halten Die Spannung wird etwa von fünf bis zehn Sekunden gehalten und die Aufmerksamkeit bleibt in der jeweiligen Muskelgruppe 4. Loslassen 35 Nach der Beobachtung der angespannten Muskelgruppe wird die Muskelanspannung gelockert. 5. Nachspüren Die übende Person bleibt mit ihrer Aufmerksamkeit etwa 30 Sekunden in der betreffenden Muskelgruppe und nimmt wahr, was dort passiert, ohne dies zu bewerten. Übungsabfolge der sechzehn Schritte sind die folgende: 1. Aktivere Hand und Unterarm 2. Aktiverer Oberarm 3. Andere Hand und Unterarm 4. Anderer Oberarm 5. Stirn 6. Obere Wangenpartie und Nase 7. Untere Wangenpartie und Kiefer 8. Nacken und Hals 9. Brust, Schultern und obere Rückenpartie 10. Bauchmuskulatur und untere Rückenmuskulatur An dieser Stelle wird in einigen Anleitungen über Progressive Muskelentspannung empfohlen, zusätzlich zu den sechzehn Muskelgruppen von Jacobson die An- und Entspannung der Gesäß- und Beckenbodenmuskulatur einzufügen. Anweisung: Spannen Sie die Gesäß- und Beckenbodenmuskulatur fest an. 11. Aktiverer Oberschenkel 12. Aktiverer Unterschenkel 13. Aktiverer Fuß 14. Anderer Oberschenkel 15. Anderer Unterschenkel 16. Anderer Fuß 36 Wenn die Übenden das Grundverfahren der Progressiven Muskelentspannung in der Langform erlernt haben und dies sicher beherrschen, können verschiedene Kurzformen eingeübt werden, durch die – mit weniger Zeitaufwand – die gleiche Entspannungstiefe erreicht werden kann. Die erste Kurzform ist die Entspannung mit sieben Muskelgruppen. Dies läuft in folgenderweise: 1. Aktivere Hand, Unterarm und Oberarm. 2. Andere Hand, Unterarm und Oberarm. 3. Stirn, Wangenpartie, Nase und Kiefer. 4. Nacken und Hals. 5. Brust, Schultern, Rücken, Bauch-, Gesäß- und Beckenbodenmuskulatur. 6. Aktiverer Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß. 7. Anderer Oberschenkel, Unterschenkel und Fuß. Die nächste Kurzform ist die Entspannung mit vier Muskelgruppen: 1. Beide Hände, Unterarme und Oberarme. 2. Gesichts- und Nackenmuskulatur. 3. Brust, Schultern, Rücken, Bauch-, Gesäß- und Beckenbodenmuskulatur. 4. Beide Oberschenkel, Unterschenkel und Füße. Schließlich können die ursprünglich sechzehn Muskelgruppen auf Anhieb mit allen Muskelgruppen entspannt werden. Hier werden alle Muskelgruppen gleichzeitig anund entspannt. In einigen Fällen, wie zum Beispiel vor dem Einschlafen ist es ratsam, nicht das Grundverfahren der Progressiven Muskelentspannung durchzuführen, sondern den entspannten Zustand mit Hilfe des Vergegenwärtigungsverfahrens zu erreichen. Hiermit muss die Übende keine muskuläre Anspannung aufbringen. Ähnlich wie beim Autogenen Training wird die betreffende Muskelparte durch den Zugang über die mentale Ebene hergestellt. Die Voraussetzung für diese Arbeit ist die Beherrschung des Grundverfahrens der Progressiven Muskelentspannung. Man konzentriert sich auf eine Muskelgruppe, die beim klassischen Verfahren angespannt wird, dann löst man mit einem Mal alle Spannungen in diesem Muskel. Man erinnert 37 sich an das Gefühl, als dieser Muskel entspannt war und versucht diesen Zustand zu vergegenwärtigen. (Mihalec, 2006. S. 91 – 101.) Entspannung mittels bildhafter Vorstellung Bei dieser Entspannungstechnik ist jede angenehme und entspannende Szene geeignet. Eine wunderbare Wiese mit bunten Blumen oder eine Seeküste an dem man ruht, ein gemütlicher Raum, eine Badewanne mit warmem duftendem Wasser usw. Bei der Vorstellung sollte das Bild so lebhaft wie möglich sein. Das vorgestellte Erlebnis wird innerlich so wahrgenommen, dass jede Einzelheiten so genau wie möglich vergegenwärtigt werden. Man soll in der Phantasie alles hören, sehen, riechen, spüren und schmecken. Bei dieser Entspannungsart ist auch wichtig die regelmäßige Übung, um in einer aufregenden Situation die Erregung unter Kontrolle zu halten. Beide Autorinnen gaben ein bis zwei Beispiele für Entspannung mittels bildhafter Vorstellung. (Klöppel, 1996. S. 141 – 142.) Autogenes Training Autogenes Training wurde vom Berliner Nervenarzt Johannes H. Schultz entwickelt. Diese Technik basiert ausschließlich auf Selbst- (Auto-) Suggestionen. Ziel des Autogenen Trainings ist es, mittels selbsthypnotischer Formeln auf körperliche Prozesse Einfluss zu nehmen. Man unterscheidet beim Autogenen Training zwischen Grund-, Mittel- und Oberstufe. Die Grundstufe besteht aus folgenden Teilen: • Schwereübung "Mein rechter Arm ist schwer" (Linkshänder ersetzen "rechter" durch "linker Arm") • Wärmeübung "Mein rechter (linker) Arm ist warm" • Atemübung "Mein Atem fließt ruhig" oder "Es atmet mich". • Herzübung "Mein Herz schlägt regelmäßig und ruhig" • Bauchwärme "Mein Sonnengeflecht ist strömend warm" oder einfach "Mir ist angenehm warm im Bauch" • Stirnkühlung "Die Stirn ist angenehm kühl, mein Kopf ist frei und klar". 38 Die Übungsformeln werden vier- bis sechsmal wiederholt und beginnen mit der Autosuggestion "ich bin ganz ruhig", „was geschieht, ist gut". Sie werden erneut mit der Formel "Ich bin ganz ruhig" geschlossen. Das gesamte Trainingsprogramm mit den sechs Übungen ist somit nach 12 bis 15 Minuten abgeschlossen. Wenn die Grundstufe des Autogenen Trainings perfekt beherrscht wird, kann zur Mittel- und Oberstufe übergegangen werden. Die Oberstufe wird in verschiedenen Formen als Therapie angewendet. Nach Schultz ist es ratsam, das Autogene Training durch einen Arzt oder Psychologen zu erwerben. (Langeheine, 1996.) Atmen Bei dieser Entspannungstechnik handelt es sich um ein konzentriertes Ein- und Ausatmen, wo die Tiefe der Atmung durch das Ausatmen verwirklicht wird. Die Pause nach dem Ausatmen, die für die innere Entkrampfung sorgt, wird immer länger. Der Verlauf dieser Technik ist: Man muss vor- und während der Übung die Augen geschlossen halten. Es wird beobachtet, wie der Atemzug ein- und ausgeht. Beim Einatmen wird das Zwerchfell gehoben, beim Ausatmen wird es von selbst gesenkt. Hier wird eine Pause von bis zu zehn Sekunden eingehalten. Man überlässt sich dem vertieften Ruhestand und erlebt die wiegende Auf- und Abbewegung. Die Atmung wird immer tiefer und ruhiger sein. Die Ausatmung sollte sich vom einen zum anderen Mal verlängern. Um sich selbst dabei zu helfen, denke man währenddessen: „Meine Atmung strömt langsam und ruhig.“ Sechs Atemzüge pro Minute sind das Ziel. (Langeheine, 1996.) Biofeedback Im Grunde genommen wird beim Biofeedback unter allem mit Hilfe eines elektrischen Gerätes die Anspannung der Muskeln festgestellt. Die folgenden Körperreaktionen können gemessen werden: Muskelanspannungen, Atemverlauf, Puls, Hauttemperatur, Hautwiderstand. Es ist wichtig zu wissen, dass das Gerät nicht dazu fähig ist, einen entspannten Zustand herbeizuführen. Es dient zur Darstellung und sofortigem Feedback des momentanen körperlichen Zuständen. (Langeheine, 1996.) 39 Schnelle Visualisierung Diese Entspannungstechnik basiert ähnlich wie die bildhafte Vorstellung auf die in der Phantasie vergegenwärtigbaren Szenen. Der Unterschied ist die Dauer des Prozesses. Die Basis ist eine Szene, wie zum Beispiel ein Baum, der sich neben einem sanft plätschernden Bach befindet. Man muss sehen, wie ein Blatt in das Wasser fällt und langsam wegtreibt. Das Blatt verkörpert einen störenden Gedanken, der mittels schwimmenden Blattes losgelassen wird. Diese Szene versucht man sich wiederholt vorzustellen, bis alle schlechten Gedanken „den Bach hinunter geschwommen sind“. (Langeheine, 1996.) Für die letzten drei Entspannungstechniken sollte keine Erläuterung nötig sein. Bewegung, Lachen und Dehnung ist hoffentlich jedem und jeder aus dem Alltag vertraut. Das Mentale Training zur Angstbewältigung bei Klöppel und Langeheine Über den Ablauf des mentalen Lernens gibt sowohl Klöppel als auch Langeheine viele praktische Hinweise. Langeheine verzichtet auf theoretische Diskurse. Bei Orloff-Tschekorsky bezieht sich die mentale Arbeit nicht nur auf eine Bewegungsvorstellung, sondern auf eine gleichzeitige Vorstellung der Bewegungen und des Klanges. Sie verwendet die mentale Arbeit als eine Übungsart der Einstudierung des Stückes. Bei den Autorinnen sieht es ein bisschen anders aus. Sie gliedern das mentale Training in mehrere Teile, die sind: Die reine Bewegungsvorstellung (zum Beispiel nur der Fingersatz), die musikalische Vorstellung, die Vorstellung des Rhythmus, die mehrstimmige Vorstellung, die umfassende Vorstellung die musikalische Vorstellung von Klang und Charakter, der musikalische Ausdruck, das Auswendiglernen. Mit Hilfe dieser Gliederung durch Beispiele stellen sie den Prozess des mentalen Lernens dar. Die Unterteilung zeigt die verschiedenen Aspekte, auf die Aufmerksamkeit der MusikerInnen während des mentalen Übens gerichtet werden kann. Der Verlauf der mentalen Arbeit entspricht dem von Orloff-Tschekorsky. Nach der Entspannung wird die innere Vorstellung mit kleinen Abschnitten begonnen und mit der praktischen Ausführung beendet. Der wichtigste Unterschied zu Orloff-Tschekorsky und den anderen Autoren ist wie 40 bereits erwähnt das zusätzliche Kapitel über die Angstbewältigung und Vorbereitung für den Auftritt mit Hilfe des mentalen Übens. Es gibt sehr viele unterschiedliche mentale Übungen zur psychischen Vorbereitung eines Konzertes, beziehungsweise um die Podiumsangst zu bewältigen. Diese sind: Positive Gedanken fördern Angstphantasien vermeiden Entspannungstechniken verwenden Konzentration steigern, üben Vorstellung der Vorspielsituation Positive Gedanken fördern heißt, dass eine positive Einstellung zur eigenen Person vorausgesetzt wird. Es bedeutet, man sollte sich die positiven Aspekte seiner Leistung vor Augen halten. Es kann mittels positiven Gedanken erreicht werden, die man sich sowohl innerlich vorsagt, als auch wirklich ausspricht. Sätze wie: „»Meine Hände haben das Stück schon oft zu meiner Zufriedenheit gespielt, sie werden mich auch jetzt nicht im Stich lassen!« […] »Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben!«“ (Klöppel, 1996. S. 118.) Langeheine schlägt zusätzlich vor, die positiven Sätze mit einem Partner auszudrücken. Die Aussagen sollten mit viel Ausdruck und Überzeugung aussprechen, die die vertraute Person mit der gleichen Gewissheit wiederholt, zum Beispiel: „Person A: »Ich bin völlig konzentriert und entspannt.« Person B: »Du bist völlig konzentriert und entspannt.« Person A: »Ich glaube an mich!« Person B: »Du glaubst an dich!« Person A: »Ja!«“ (Langeheine, 1996. S. 56.) Auch bei den Angstphantasien handelt es sich um ein inneres Selbstgespräch, wo die negativen Gedanken die Einstellung zu dem Vorspiel beeinflussen. Im diesem Fall kann es auch nützlich sein, die oben erwähnten positiven Sätze zu aussprechen. 41 Die Entspannungstechniken tragen nicht nur zur Steigerung der Aufnahmefähigkeit des Gehirns, sondern auch zum Abbau von vor und während des Konzertes eintretenden Muskelverspannungen und Konzentrationsstörungen bei. Hier spielt auch eine Rolle, welche Methode angewendet wird, aber es ist weniger entscheidend, als dass der Musiker überhaupt ein Entspannungstechnik beherrscht. Konzentration ist wichtig sowohl während des Übens, als auch während eines Konzertes, um Fehler zu vermeiden. Wenn beim Üben die Aufmerksamkeit nicht völlig auf die Musik gerichtet wird, werden auch vor dem Publikum die Gedanken nicht bei der Sache bleiben. Das mentale Üben fördert eine hohe Konzentration, wobei die Gedanken immer bei der Musik bleiben müssen. Wie die Erfahrungen von Orloff-Tschekorsky zeigen, steigert das mentale Lernen die Konzentrationsfähigkeit. Beim Angstgefühl kann die Konzentration auf die negativen körperlichen Reaktionen gerichtet werden, das kann dazu führen, dass das Gefühl der Angst verstärkt wird. Die konkrete Vorstellung der Vorspielsituation kann schon beim Üben in die Gedanken gerufen werden. Beim Üben mit der Vorstellung der Podiumssituation muss die ganze Situation bildhaft und klanglich im Gedächtnis verwirklicht werden. Wenn ein Fehler eintritt, es ist ratsam, ihn zu akzeptieren. Eine andere Möglichkeit der inneren Vorstellung ist, eine in der Vergangenheit liegende Konzertsituation in sich abspielen zu lassen, wo das Spiel gut ausgefallen ist und versucht, die angenehmen Gefühle wieder zu erleben. (Klöppel, 1996., Langeheine, 1996.) Christian A. Pohl: Mentales Üben Pohl gliedert das Üben in zwei Phasen, die im Alltag nicht scharf voneinander abgegrenzt sind. 1. Erste Übephase: Mentale Texterarbeitung 2. Zweite Übephase: Instrumentale Ausarbeitung. Bei der ersten Phase handelt es sich um das möglichst genaue Auswendiglernen des Notenmaterials durch Analyse. Die Einprägung des Notentextes ist ähnlich wie bei der Methode von Leimer durchgeführt. Die wichtigsten Unterschiede zwischen 42 Pohl und Leimer ist die Verbalisierung. Nach Pohl kann die intensive Texterarbeitung mit Hilfe von zwei Methoden verlaufen: 1. Durch systematische Beschreibung, 2. Durch strukturelle Reduktion. Im ersten Fall werden nicht nur die Tonart und das Metrum, sondern von Takt zu Takt der Rhythmus, die Akkorde und deren Umkehrungen, die Richtung der Melodie und der Begleitung, ähnliche oder gleiche melodische Figuren, festgestellt. Im zweiten Fall stehen die Grundelemente der Struktur der Komposition im Vordergrund, wie zum Beispiel die Grundtöne der Melodie. Hier wird der Text auf einfache Struktur reduziert. Pohl stellt beide Fälle anhand des Cis-moll Nocturnes von Chopin dar. Abb. 7. Chopin: Cis-moll Nocturnes Op. posth. Nach der systematischen und nach der strukturellen Beschreibung wird die Phrase mental memoriert. Bei Pohl geht diese mentale Arbeit vorwiegend mit der Vorstellung der Bewegung gleichzeitig mit der Verbalisierung des analysierten Textes. Man stellt sich die ersten vier Takte vor, wie der zugrunde liegende Akkord gespielt wird und dabei spricht man laut den Namen des Akkordes aus. Zum Beispiel in diesem Fall „cis-moll“ und „fis-moll“. 43 Abb. 8. Die vereinfachte Struktur der ersten vier Takte Wenn es gelingt, spielt man darauf aufbauend die nächste Erweiterung des Gerüsts auch mental und verbalisiert. Im nächsten Schritt erweitert man die harmonische Struktur und fügt die melodische Struktur zu: „Die harmonische Struktur beschreibend: »cis-moll« – »fis-moll mit sexte« – »cis-moll« – »Cis-dur« – »fis-moll« und die melodische Struktur memorierend: »Quinte« (gis in Bezug zum Grundton cis) – »Nebennote« (fis²) – »Quinte« – »Grundton« (cis²) – »Oktave« – (Den Sprung beschreibend) – »Terz« (a in Bezug zum neuen Grundton fis).“ (Pohl 2006, S. 297.) Abb. 9. Die erweiterte harmonische und melodische Struktur Im letzten Schritt verbalisiert man die erweiterte melodische Struktur. Die genaue verbale Beschreibung des Notenmaterials läuft natürlich immer langsamer, als tatsächlich gespielt wird. Deswegen empfiehlt Pohl die Hilfe der so genannten „Knotenpunkt“ Technik. Es handelt sich dabei um einen einzigen zusammenfassenden Begriff der zu einem bestimmten Textteil zu geordnet werden soll. Um den Notentext in Echtzeit zu verbalisieren sollten die Knotenpunkte kurz und prägnant sein. Die Verbalisierung von Knotenpunkten wird nicht nur im mentalen 44 Training sondern auch am Instrument eingesetzt. Nach der mentalen Memorierung des Notentextes wird die zweite Übephase begonnen. Während dieser Phase wird die Note sowohl am Instrument als auch mental geübt. Dies kann dreierlei eingesetzt werden: 1. Mentales Training zur Vertiefung der Textkenntnis 2. Mentales Training zur Intensivierung des Ausdruckswillens 3. Mentales Training zur Stabilisierung der Spieltechnik Mentales Training zur Vertiefung der Textkenntnis Ohne das Instrument wiederholt man das „Drehbuch“ und verbalisiert alle Einzelheiten des Notenmaterials. Währenddessen soll das Stück innerlich mit der Bewegung und dem Klang vorgestellt werden. Während des Spiels werden die Begriffe für die Knotenpunkte ausgesprochen. Mentales Training zur Intensivierung des Ausdruckswillens Die künstlerische- emotionale Übung des Werkes erweckt in uns ausgelöste Empfindungen, die in Worte gefasst können werden. Unser Ausdruckswillen kann durch die Verbalisierung unserer Stimmungen, der Klangvorstellung und der Spannungsverläufe, musikalischer Impulse intensiviert werden. Bei den Stimmungen bedeutet es eine emotionale Assoziation mit anderen Kunstwerken oder eigenen Erlebnissen über die betreffende Phrase. Dies kann mental trainiert werden, während die Phrase innerlich gespielt wird und dabei die Schlüsselworte ausgesprochen werden. Bei der Klangvorstellung können auch Emotionen auftreten, die mit Knotenpunkten innerlich sprechend hervorragend geübt werden können. Bei den Spannungsverläufen und musikalischen Impulsen geht es um musikalische Spannungs- und Entspannungsphasen innerhalb des Stückes, die auch mit der Technik des Verbalisierens gespielt werden können. 45 Mentales Training zur Stabilisierung der Spieltechnik Durch Imaginationstechniken kann die Spielsicherheit gesteigert werden, wo die Bewegungen vor den inneren Augen gespielt sind. Dies sind meistens die Fingersätze, die instrumentbezogenen Spieltechniken wie zum Beispiel die Anschlagsarten, Bewegungen und das Spielgefühl. Man stellt sich die Bewegungen innerlich vor und verbalisiert die dazugehörigen Beschreibungen gleichzeitig. Wie die Zusammenfassung die Methode des mentalen Trainings nach Pohl zeigt, stellt er die Verbalisierung in den Vordergrund, die bei den anderen Autoren nicht erwähnt und dargestellt werden. (Pohl, 2006. S. 287 – 311.) 2.1.3. Untersuchungen über die Effektivität des Mentalen Trainings Im Bereich der Musikpsychologie wurden Untersuchungen über die Effektivität des mentalen Trainings seit den dreißiger Jahren von Grace Rubin-Rabson durchgeführt. Sie führte Ende der dreißiger und vierziger Jahre eine Versuchsreihe über das Lernen und Auswendiglernen beim Musizieren mit neun professionellen PianistInnen. Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, acht Takte aus untraditionellem Klavierrepertoire mittels visueller und mentaler Analyse drei, vier, fünf, sechs oder neun Minuten zu üben. Sie stellte vor allem fest, dass die erwachsenen PianistInnen kurzfristig am Instrument geübte Stücke besser behalten konnten, wenn sie sie auch mental geübt hatten. „The intensive mental rehearsal of the material at some point before the completion of the learning trials not only saves keyboard trials but is as effective for retention as a greater number of keyboard trials followed by keyboard over-learning equivalent to the mid-way study. As for mental rehearsal after the learning point, this seems to be inferior to both of the other time distributions.“ (Rubin-Rabson, 1941. S. 37.) 46 1985 veröffentlichte Stewart L. Ross seine Studie „The Effectiveness of Mental Practice in Improving the Performance of College Trombonists“. 30 Musiker wurden unwillkürlich in fünf Gruppen geordnet: praktisches Üben (physical practice, PP), Mentales Training (mental practice, MP), Kombination des mentalen und praktischen Übens (combined physical and mental practice, CP), Mentales Training mit simulierter Bewegung (mental practice with simulated slide movements, MPS) und einer Kontrollgruppe (no practice, NP). Die MusikerInnen während einer Vorstudie mussten vom Blatt eine Etüde aus der „School of Sight Reading and Style, Book A“, André Lafosse zum Metronom spielen. Die vor- und Nachtestleistungen wurden registriert. Die PP-Gruppe musste die Etüde drei Mal hintereinander physisch üben, wobei sie ihr Tempo frei auswählen konnten. Die nur mental übende Personen (MP) imaginierten die Etüde drei Mal hintereinander nur im Kopf ohne Instrument. die PosaunistInnen sollten sich dabei selbst sehen, hören und fühlen. Über eine kinästhetische Vorstellung wurde keine detaillierte Anweisung gegeben. Das mentale Training wurde mit der folgenden Instruktion erklärt: „Relax. Put your trombone down and try to feel comfortable in your chair. You are to mentally play the excerpt. Do not make any physical movements. Tempo: Use any tempo you wish but try to keep it steady to the end. Do not stop or go back to repeat any notes. Pitch: Try to ’hear’ each pitch but do not vocalize. Embouchure: Try to ’feel’ the movements of your embouchure but do not buzz your lips. Slide: Try to ’feel’ the movements of your slide for each shift to a new position. It is important that you concentrate. When you have finished mentally practicing the music, please turn it over so that we know you are done. “ (Ross, 1985. S. 224.) Den Versuchspersonen, die Mentales Training mit simulierter Bewegung (MPSGruppe) ausführen sollten, wurde der Befehl gegeben, mit der Posaune die entsprechenden Bewegungen durchzuführen. Die kombiniert übende Gruppe (CP) spielte die Etüde zwei Mal wechselnd die mentale Vorstellung mit physischem Üben 47 durch. Die Kontrollgruppe (NP) musste einen Artikel über die notwendige Fertigkeit des Blattspielens lesen. Die Nachtestergebnisse wurden in der Dimension: die richtige Tonhöhe, der richtige Rhythmus und die vorgeschriebene Artikulation ausgewertet. Das Ergebnis der Studie zeigte, dass die Gruppe mit kombiniertem Üben das beste Resultat erreichte, gefolgt von der praktischen Trainingsgruppe, der mentalen Trainingsgruppe mit simulierter Bewegung, der mentalen Trainingsgruppe und der Kontrollgruppe. (Ross, 1985. S. 221 – 230.) Evelyn Bird erforschte im Jahr 1984 die Muskelaktivität eines erfahrenen Dirigenten mittels EMG-Messung, sowohl während dem Dirigieren einer symphonischen Ouvertüre als auch während des mentalen Probens. Sie konnte die Zunahme der elektrischen Impulse in den Muskeln des Dirigenten in der Korrelation mit dem Tempo, Dynamik, Rhythmus belegen. Beim mentalen Üben ohne musikalische Begleitung wurden sich die EMG-Resultate im Vergleich zum entspannten Zustand dreihundert Prozent größer gezeigt. Das mit Musik begleitende mentale Üben wurde trotzdem nur fünf Prozent bis dreißig Prozent des Ergebnisses der physischen Leistung erreicht. In ihrer Studie untersuchte Bird auch die elektrischen Impulse im Gehirn (EEG) sowie in den Muskeln (EMG) von neun unerfahrenen DirigentInnen mit durchschnittlichen 36 Lebensjahren und ihres Professors. Das Resultat der Studie zeigte, dass die Herzraten der TeilnehmerInnen bedeutsam zunahmen, wenn sie vor der Probe mental übten, aber sich nach der Probe während des mentalen Übens ihre Herzraten wenig steigerten. Diese Ergebnisse waren am wahrscheinlichsten normale physiologische Antworten auf die Tätigkeit. Die EEG-Profile der StudentInnen zeigten eine höhere Ähnlichkeit nach der Probe als vor der Probe. Die Ergebnisse der EEGMessungen des Professors waren nach der Probe und vor der Probe gleichartig, was nach Bird suggeriert, dass mehr Erfahrung während des physischen und mentalen Übens eine Ähnlichkeit der Gehirnwellen erzeugt. Die EMG-Messungen zeigten vor der Probe und nach der Probe bei den drei besten StudentInnen der Klasse und bei dem Professor ähnliche Ergebnisse, was bedeutet, 48 dass mehr Erfahrung mehr Aktivierung in den passenden Muskeln während des mentalen Übens hervorruft. Bei den StudentInnen war die Geschwindigkeit der mentalen Vorstellung langsamer, was bestätigt, dass sich ein Anfänger nur in einem langsameren Tempo die Bewegung im Geist vorstellen kann. (zitiert nach Johnson, 1984.) 1990 untersuchte Coffman die Effektivität des mentalen Trainings mit vierzig Laien und professionellen PianistInnen. Die Probanden wurden in 4 Gruppen geteilt: praktisches Üben, mentales Üben, Kombination aus praktischem Üben und mentalem Training und eine Kontrollgruppe (kein Üben). Jede Gruppe wurde in zwei Teile gegliedert, eine die keine Kenntnisse von Ergebnissen hatte und eine die über den gelungenen Versuch eine Bestätigung bekam. Jeder TeilnehmerInnen saß vor einem Computer mit einer elektronischen Klaviertastatur und musste mit der vorgeschriebenen Übungsart zum Metronom spielen. Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, zuerst als ein Vortest das Stück einmal zu spielen, danach gingen sie üben und als Nachtest spielten sie diese Passage nochmal. Die vorgeschriebene Übezeit war sechsmal 30 Sekunden mit fünf Sekunden Pause zwischen jedem Abschnitt. Die ganze Untersuchung dauerte 15 Minuten. Hier wurde festgestellt, dass kombiniertes Üben (mentales Üben und praktisches Üben) und dass rein praktisches Üben genauso effektiv ist. Das rein mentale Training war effektiver als kein Üben, aber es war ineffektiver, als rein physisches oder kombiniertes Training. (Coffman, 1990. S. 187 – 196) 1991 führte Kopiez eine deutsche Untersuchung mit 108 GitarrestudentInnen aus verschiedensten Musikhochschulen durch. Im Mittelpunkt der Studie stand die Effektivität verschiedener Lernmethoden in der ersten Lernphase. Als Lernmaterial wurden die ersten vier Takte aus den 4. Satz der Suite für Gitarre Op. 64 von Ernst Krenek vorgegeben. Die Probanden hatten das Stück in zwei aufeinander folgenden Lernphasen von fünf Minuten Dauer auswendig zu lernen. Es wurde in drei Gruppen unterteilt: die rein motorisch übende Gruppe, die erst motorisch dann mental übende Gruppe und die erst mental dann motorisch übende Gruppe. Für die zwei sowohl praktisch als auch mental Übenden wurde von dem Versuchsleiter eine kurze motivische Analyse vorgelesen. Nach Ablauf der Lernzeit spielten die Probanden 49 alles gelernte Material auswendig vor, wovon eine Aufnahme gemacht wurde. Nach dem Ergebnis ist die Leistung der motorisch übenden Gruppe besser, als die mental übenden Gruppen. Die Konsequenz von Kopiez lautet: „In der Praxis könnte demnach kognitives Üben das motorische nur partiell ersetzen und zwar unter der Voraussetzung, daß die grundlegenden motorischen Informationen bereits gelernt wurden und daß eine geringfügig schlechtere Leistung akzeptiert wird. Dies steht in Widerspruch zu den Voraussagen von LEIMER/GIESEKING (1931) und den Annahmen der kognitiven Lerntheorien.“ (Kopiez, 1991. S. 169.) Orloff-Tschekorsky führte 1995 einen Kurs für zwölf PianistInnen an der Hochschule Trossingen. Es wurde die Schnelligkeit, Präzision und Treffsicherheit der StudentInnen über einen MIDI -Flügel gemessen. Die Flügel waren mit einer Abtastapparatur ausgestattet und es wurde von jedem gespielten Ton die Tonhöhe, der Zeitpunkt des Anfangs und Endes und die Dynamik in Form von MIDI -Daten (Musical Instruments Digital Interface) einem Computer zugeleitet, wo sie zur weiteren Auswertung zur Verfügung standen. Zusätzlich wurden die TeilnehmerInnen mittels Fragebögen über persönliche Daten, die musikalische Ausbildung, subjektiv empfundene Veränderungen im Klavierspiel et cetera insgesamt drei Mal – vor dem Kurs, am letzten Kurstag und vier Monate später - gefragt. Die TeilnehmerInnen wurden während der zwei Wochen täglich eine Stunde in Zweiergruppen unterrichtet und übten ein bis zwei Mal täglich 45 Minuten. Nach festgelegten Übungseinheiten während des Kurses wurden die verarbeiteten Abschnitte der Stücke vor und nach dem mentalen Üben registriert. Die aufgezeichneten Stücke mussten von den TeilnehmerInnen selbst erarbeitet werden. Eine Teilnehmerin erkrankte während des Kurses und nahm im Weiteren nur noch passiv teil, deshalb konnte das Spiel nur noch von elf TeilnehmerInnen ausgewertet werden. Obwohl die Auswirkung des Entspannungstrainings in dem Kurs nicht untersucht wurde, begann der Kurs mit einem Entspannungsunterricht entsprechend dem Orloff- 50 Mental-System, bei dem die PianistInnen autogenes Training und progressive Muskelentspannung nach Jakobson erlernten. Die Kriterien der Auswertung waren die Folgenden: richtige oder falsche Töne, der Zeitpunkt der gespielten Töne und zusätzliche oder fehlende Töne. Unter dem Zeitpunkt der gespielten Töne wurden die Gleichmäßigkeit, die Schnelligkeit beziehungsweise eventuelle Stockungen, die rhythmische Genauigkeit und das Zusammenspiel der beiden Hände bewertet. Wegen der Schwierigkeit der objektiven Bewertung von den ästhetischen Kriterien wurden die Gleichmäßigkeit an Tonleitern und die Schnelligkeit bei Geläufigkeitsetüden mit Hilfe eines Metronoms ausgewertet. Die erste Hypothese, dass das Orloff-Mental-System den Lernvorgang beschleunige und beim Erreichen eines höheren Tempos effektvoller sei als das repetitive Üben mit gleichem Zeitaufwand, nach Auswertung der zweiten Aufnahme der Geläufigkeitsetüde, konnte nicht festgestellt werden. Keiner der PianistInnen konnten nicht einen längeren Abschnitt erlernen. Drei TeilnehmerInnen spielten langsamer, zwei davon verkürzten den Abschnitt. Sechs Probanden spielten schneller, zwei davon eine kürzere Phase. eine spielte gleich schnell und eine davon weniger. Es konnten nur vier PianistInnen das Tempo beschleunigen, ohne den Abschnitt zu verkürzen. Obwohl die Hypothese zurückgewiesen werden musste, konnten neun Teilnehmer die Fehlerhäufigkeit reduzieren. Bei den sechs schneller gespielten PianistInnen, zeigten sich hingegen mehr Fehler. Die zweite Hypothese, dass die Vorstellung von größter Gleichmäßigkeit zu gleichmäßigerem Spiel führt, wegen der geringen Motivation der PianistInnen die Tonleiter mit der neuen Methode zu üben, konnte nicht festgestellt werden. Nur sechs PianistInnen übten die Tonleiter, drei davon konnten ihre wiederkehrenden Fehler beheben. Ein sehr positiver Effekt des Orloff-Mental-Systems konnte nachgewiesen werden: Sechs TeilnehmerInnen hatten vor dem Kurs bestimmte Stücke über mehrere Monate geübt, in den einige scheinbar unlösbare Probleme vorhanden waren. Fünf PianistInnen davon konnten mit einer Übezeit fünf Mal 15 Minuten mentales Training nach Orloff-Tschekorsky eine Verbesserung erreichen. Nur ein Teilnehmer konnte keine positive Veränderung erzielen. 51 Nach der Auswertung der Fragebögen wurde der Mangel bei der Hälfte der PianistInnen an der Bewegungsvorstellung beider Hände im hohen Tempo ersichtlich. Nur vier Personen konnten die Bewegungen vollständig imaginieren, sechs konnten sie sich nicht vorstellen, einer manchmal und einer meistens. Fünf PianistInnen antworteten auf die Frage, ob die Bewegungsvorstellung im hohen Tempo oberflächlicher ist, dass sie sich die linke Hand schwerer als die rechte vorstellen können. Auf die Frage, ob die Anwendung mentales Training eine Veränderung des Spiels erzeugt habe, gaben sechs Personen eine Erhöhung der Lockerheit, drei eine Erhöhung der Sicherheit an. Zehn TeilnehmerInnen berichteten über die Zunahme der Konzentration beim Üben. Zehn PianistInnen von zwölf bemerkten mit Hilfe des mentalen Trainings ihre Fehlhaltungen, acht von ihnen konnten dies positiv verändern. Vier Monate nach dem Kurs wurde erneut eine Befragung durchgeführt. Unmittelbar nach dem Kurs äußerten zehn PianistInnen, dass sie die Orloff-Mental-System regelmäßig anwenden wollen, zwei gelegentlich. Vier Monate später waren es nur noch drei, die mindestens die Hälfte des Übens mental übten. Acht Pianisten wendeten die Methode fast nie oder nur gelegentlich an, eine Teilnehmerin (diejenige, die am Kurs nur passiv teilgenommen hatte) gar nie. Die PianistInnen nutzten die Methode vor allem um schwierige Stellen zu bewältigen. Drei Personen verwendeten die Methode zum Auswendiglernen, vier übten mit Hilfe dieses Systems neue Werke, nur eine Teilnehmerin übte ganze Stücke zeitweise, wie sie es am Kurs studiert hatte. Über das Resultat der Studie wurden einige kritische Bemerkungen von Christian Frauscher angebracht: 1. Mentales Training kann nicht in kurzer Zeit (in diesem Fall nur in zwei Wochen) erlernt werden. Aus den Fragebögen kam zutage, dass die Mehrzahl der Teilnehmer eher die visuelle Übungsart des mentalen Trainings verwendet hat. 52 2. Die PianistInnen übten die Stücke nicht unter Anleitung, und was sie sich vorstellen konnten, wurde nicht überprüft. 3. Die Untersuchung wurde nur mit einer Testgruppe durchgeführt, die verhinderte das Vergleichen verschiedener Gruppen, was die Effektivität des mentalen Trainings nach Orloff-Tschekorsky besser darstellen gekonnt hätte. (Klöppel, 1995. in Frauscher, 2003.) Im selben Jahr untersuchten Theiler und Lippman die Effektivität des mentalen Trainings bei GitarristInnen und SängerInnen. In der Studie wurden sieben GitarristInnen und sieben SängerInnen getestet, die an der Western Washington University studierten. Die MusikerInnen waren zwischen 19 und 29 Jahre alt. Der Unterricht der SängerInnen erstreckte sich von 1,5 bis 4 Jahre, der der GitarristInnen von 2 bis 9 Jahre. Als Material wurde für die GitarristInnen vier Tänze aus dem 17. Jahrhundert, Prelude, Bourrée und Allemande aus der Suite in D-Moll von Robert de Visée und „Galliard for Queen Elizabeth“ von John Dowland mit der Länge von acht Takten vorgegeben. Für die SängerInnen wurde das Material aus den Übungen von Berkowitz, Frontrier und aus “A New Approach to Sight-Singing“ von Kraft mit dem Schwierigkeitsgrad „fortgeschrittenes Niveau II.“ ausgewählt. Die Länge dieser Übungen betrug 13 bis 20 Takte. Alle Stücke waren tonal mit kurzen Modulationen oder Chromatik ausgestattet. Die Probanden wurden in 4 Gruppen geteilt: Die praktisch Übenden (physical practice, PP) spielten die Stücke körperlich für 12 Minuten. Die Kombination des praktischen Übens und mentalen Trainings (combination physical practice and mental practice, MP) wurde so organisiert, dass die Probanden das Stück wechselnd 3 Minuten praktisch und 3 Minuten mental (verwendet visuelle, gehör- und kinästhetische Imagination) bis zu 12 Minuten spielten. Die dritte Gruppe verwendete die Kombination des praktischen Übens und mentalen Übens mit zusätzlicher Verwendung von Gehörmaterial (mental practice wihle listening to the model, MPM). Es wurde abwechselnd 3 Minuten praktisch und 3 Minuten mental geübt. Während des mentalen Übens hörten sie das Werk auf einer Tonaufnahme bis zu 12 Minuten lang. Die Kontrollgruppe (control/motivational condition, CM) spielte alternierend 3 53 Minuten praktisch und verbrachte 3 – 12 Minuten damit, ein Nachschlagwerk von Ristad zu lesen. Die Anweisungen bezüglich des mentalen Übens waren: „ When you begin the imaginary practice of the music, visualize yourself performing the music as vidily as possible without actually moving or humming. Try to actually see yourself performing: how you would sit/stand, the movements of your finger/mouth, Try to hear the music as clearly and smoothly as possible. Try to actually feel yourself playing/singing each note: the touch of your fingers on the frets and strings and the gliding movements of your hands and arms/the movements of your lips, mouth, throat and vocal cords and the rise and fall of your breathing through the phrases.” (Theiler & Lippman, 1995. S. 342.) Die Instruktionen für das mentale Üben mit zusätzlicher Verwendung von Gehörmaterial enthielten ähnliche Anweisungen wie zum mentalen Üben, wobei die Probanden zuerst mittels der Aufnahme des Stückes, die Phrase memorieren versuchen sollten. Nachdem sie das Tonband anhörten, sollten sie versuchen zu imaginieren, wie die Musik klingen sollte während sie sich dabei selbst sehen und fühlen. Nach 12 Minuten Probe spielten die Probanden das Material zweimal mit Noten und zweimal auswendig vor, wovon eine Bandaufnahme gemacht wurde. Jede Aufführung wurde auf sechs Aspekte hin ausgewertet: Tonhöhengenauigkeit, rhythmische Genauigkeit, Artikulation und Phrasierung, Dynamik und Expressivität und Tempo und Tonqualität. Die Auswertung der Tonhöhengenauigkeit und der rhythmischen Genauigkeit erfolgte nach einem Punktsystem von 1 bis 10, wobei 1 bedeutet das Stück wurde 1 – 10 Prozent korrekt gespielt, 10 bedeutet 90 – 100 Prozent. Die anderen Dimensionen wurden an einer Skala von 1 bis 7 abgeschätzt. Im Allgemeinen zeigten die Aufführungen in der Art der Kombination des praktischen Übens und mentalen Trainings und des praktischen Übens die gleiche Entwicklung. 54 Die größte Differenz erwies sich zwischen den mental übenden Gruppen (MP, MPM) und der Kontrollgruppe. Die Ergebnisse der GitarristInnen: Nach dem Resultat der mit Noten spielenden GitarristInnen konnten nur in zwei Aspekten relevante Abweichung festgestellt werden. Aus der Sicht der Tonhöhengenauigkeit erreichte die Gruppe mit kombiniertem Üben das beste Resultat, gefolgt von der praktischen Trainingsgruppe, der Kombination des praktischen Übens und mentalen Übens mit zusätzlicher Verwendung von Gehörmaterial, und der Kontrollgruppe. Die Gruppe-MP und PP erreichte ein weitaus besseres Ergebnis als die Gruppe-CM, die bestätigte, dass die bessere Wirkung der MP Methode nicht wegen der Faktoren der physischen Erholung und der Motivation eintritt. Der zweite Aspekt, der eine relevante Abweichung bei den Gitarristen zeigte, war die Tonqualität. Das Resultat konnte nur bei der Gruppe-MPM eine bessere Leistung als bei der Gruppe-CM nachweisen. Bei den auswendig gespielten Aufführungen der GitarristInnen konnte nur in der Länge der gelernten Stücke ein signifikanter Effekt zwischen den Übungsarten gezeigt werden, wobei die Gruppe-MPM einen markant längeren Abschnitt memorieren konnte als die Kontrollgruppe. Die Ergebnisse der SängerInnen: Bei den Noten gespielten Aufführungen zeigten sich bei den SängerInnen in Bezug auf die Artikulation und Phrasierung, die Tongenauigkeit, die Dynamik und Tempo eine größere Differenz. Aus der Sicht der Artikulation ergab die erste und die zweite Aufnahme ein unterschiedliches Ergebnis. Nach dem ersten Versuch haben sich MP signifikant niedriger bewiesen als die anderen Konditionen. Die zweite Aufnahme erbrachte ein anderes Resultat, wobei das mentale Üben mit zusätzlicher Verwendung von Gehörmaterial (MPM) effektiver war als die anderen Techniken. Darunter konnten auch von den Gruppen-MP und PP eine bessere Leistung erzielt werden als von der Kontrollgruppe. Das war der einzige Fall, in denen die Wirksamkeit aller Übungsmethoden wechselte. Anhand der Auswertung von den 55 anderen Parametern wurde festgestellt, dass die Technik MPM das beste Ergebnis erreichte. In Hinsicht auf die Tonqualität zeigte die MP Technik eine höhere Wirkung als PP und CM. Die rhythmische Genauigkeit ergab keine relevante Differenz. Bei den auswendig gesungenen Abschnitten konnten relevante Unterschiede in der Länge des Stückes nachgewiesen werden, ähnlich wie bei den GitarristInnen. Die Bewertung der Dynamik, Artikulation und Tempo bestätigte, dass die Gruppe-MPM die beste Leistung erbrachte. Die Kondition der MPM war besser als die der PP und CM in Hinsicht auf die Tongenauigkeit. Beide mentale Übemethoden ergaben ein besseres Ergebnis bei der Tonqualität als die Technik PP und CM. Die Ergebnisse bestätigten den Effekt des mentalen Übens. Welche Art der Technik verwenden soll, geben die Autoren die folgende Empfehlung: „The present results certainly confirm that mental practice is effective, but they also suggest that features of a mental practice regimen should be adjusted to accommodate particular applications, because different attributes maybe optimal for various physical and musical endeavors.” (Theiler und Lippman, 1995. S. 338.) Das Resultat der Studie konnte nicht nur eine mögliche positive Auswirkung der alternierenden Verwendung der mentalen Techniken, sogar die Art der motivischen Kontrolle mit dem physischen Üben, sondern in einigen Fällen auch die Methoden MP, MPM, CP eine bessere Leistung als beim rein physisches Üben nachweisen. (Theiler & Lippman, 1995. S. 329 – 343.) Zwischen 1985 und 2000 führte Bruno Repp eine Reihe von Studien über die ausdrucksvolle musikalische Aufführung (expressive music performance) und die Wahrnehmung des Timings in der Musik (perception of timing in music) sowohl mit professionellen und erfahrenen PianistInnen als auch mit ausgebildeten StudentInnen durch. Im Zentrum seiner Untersuchungen stand die Abweichung des individuellen musikalischen Ausdrucks der KünstlerInnen. In den Studien (1999, 2001a, 2001b.) wurde dieses Phänomen auch unter dem Aspekt der mentalen Vorstellung des musikalischen Abschnittes im Vergleich zu anderen Parametern, wie 56 zum Beispiel der Aufführung des Stückes mit einer Folge von Computer-erzeugten Klicks oder das gleichzeitige Spiel mit Metronome und Musik erforscht. Die Zahl der Teilnehmer wurde sich von sechs auf zwölf erweitert. Als Material wurden in jeder Studie die ersten fünf Takte aus der Etüde in E-Dur Op. 10 Nr. 3. von Chopin ohne Ausdruckszeichen vorgegeben. Die musikalische Aufführung der PianistInnen wurde über einen MIDI -Flügel gemessen. Währen der mentalen Vorstellung sollten die TeilnehmerInnen ohne Klavier beim lautlosen „Tapping“ die Etüde spielen. “Here the pianists were asked to tap in synchrony with an imagined expressive performance of the excerpt. In this condition, not only was there no sound, but the physical interaction with the piano keyboard was also absent. This, then, was a pure musical imagery condition, and finger taps reflected the temporal unfolding of auditory image.”(Repp, 2001. S. 190.) Die Resultate der Imagination zeigte sich ähnliches Muster der Abweichungen, wie die tatsächliche Aufführung, die bestätigte, dass die MusikerInenn die Musik vorstellen konnten, und die vorgestellte Musik hat unwillkürlichen Effekt auf das Timing des motorischen Verhaltens. „The very same pattern of deviations, albeit somewhat reduced in magnitude, emerged in the imagery condition. This proves that participants did imagine the music and that imagined music can have involuntary effects on the timing of accompanying motor behavior.”(Repp, 2000. S. 411.) Gabriele Scheler-Moster untersucht im Jahre 20031 die Repräsentation des mentalen Spielens und des realen Spielens im Gehirn bei acht professionellen GeigerInnen und bei acht AmateurgeigerInnen mittels Kernspintomographen. Die Profis spielten an ihrem Instrument durchschnittlich 35.63 Jahre, die Amateure 12.03 Jahre. Die professionellen MusikerInnen übten regelmäßig mental. In der Studie wurden drei Hypothesen untersucht: 1 Gabriele Scheler-Mosters Dissertation wurde auch als Artikel in der Zeitschrift NeuroImage im 2003 unter dem Titel „The musicians’s brain: functional imaging of amateurs and professionals during performance and imagery“ veröffentlicht. 57 „Hypothese 1: Mentales Üben komplexer motorischer Aufgaben aktiviert ähnliche neuronale Strukturen wie die Ausführung der Bewegung. Hypothese 2: Profis und Amateuren zeigen Unterschiede in den aktivierten Arealen. Hypothese 3: Aufgrund der langjährigen Erfahrung der Profis wird eine Koaktivierung im auditorischen Kortex auch beim mentalen Üben erwartet.“ (Scheler-Moster, 2004. S. 37.) Die ProbandInnen mussten während einer Vorstudie die ersten 16 Takte des Soloparts aus Mozarts Violinkonzert in G-Dur (KV 216, 1. Satz) durch Hören einer Aufnahme des Konzertes von der CD und gleichzeitiges Lesen der Violinstimme auswendig lernen. Die Tapping-Aufgabe musste den Probanden wegen des begrenzten Platzes im Kernspintomographen auf dem Brustkorb ausgeführt werden. Nach der Vorstudie bekamen sie folgende Anweisung: „Sie hatten die Aufgabe sich die Fingerbewegungen der linken Hand, die für die ersten 16 Takte des Soloparts der Violine benötigt werden, so lebhaft wie möglich vorzustellen ohne sie tatsächlich auszuführen.“(Scheler-Moster 2004, S. 39.) Die Imagination der Fingerbewegungen übten die Teilnehmer anhand der Note mit festgelegten Fingersätzen und im Rhythmus. Das Training wurde unter professioneller Kontrolle durchgeführt, bis die Probanden die Bewegungsabläufe des Stückes im Kopf beherrschten. Die Bewältigung der Aufgabe erforderte bei den professionellen MusikerInnen nur ein paar Minuten, die Amateure brauchten durchschnittlich eine Stunde Zeit. Jeder Teilnehmer führte die Bewegungen zwei Mal tatsächlich und zwei Mal in der Vorstellung aus. Um die Muskelaktivität beider Hände der Probanden beurteilen zu können, wurde die Muskulatur der Arme neben der FMRI-Untersuchung während der Vorstellungsaufgabe mittels EMG aufgezeichnet. Neben der FMRI und EMG 58 Messungen wurde mittels eines Fragebogens sowohl das Alter der Probanden, der Beginn des Instrumentalunterrichts, die Dauer des wöchentlichen Übens als auch die Fähigkeit zur Konzentration, zur Lebhaftigkeit der Bewegungsvorstellung der Probanden befragt. Zusätzlich wurden die professionellen Musiker über die Art ihres mentalen Übens erfasst. Die EMG Messung zeigte bei der vorgestellten Bewegung in beiden Gruppen keine Muskelaktivität. Die Ergebnisse der Untersuchung bestätigten, dass sich beide Gruppe sowohl während der ausgeführten als auch während der vorgestellten Bewegung signifikante BOLD-Signale zeigten, trotzdem unterschieden sich deutlich die neuronalen Aktivierungen beider Gruppen. Die Abbildung 10. zeigt die neuronalen Aktivierungen während der ausgeführten Bewegung als auch während der vorgestellten Bewegung beider Gruppen. Abb. 10. fMRI Aktivierungsergebnisse bei Amateure und Profis. Die Aktivierungen sind in rot dargestellt, Deaktivierungen der gleichen Bedingung in grün. 59 Die professionellen MusikerInnen zeigten weniger Cluster von BOLD-Signalen. Die Amateure erwiesen eine weit verbreitete Aktivität in beiden Hemisphären. Das Resultat der Studie konnte die erste Hypothese bestätigen, dass Mentales Üben ähnliche neuronale Netzwerke aktiviert wie die Aufführung der Bewegungen. Die Aktivierungsmuster innerhalb der Gruppen ähnelten sich bei der Ausführung und Vorstellung der Bewegungen. Auch die zweite Hypothese konnte unterstützt werden. Bei den vorgestellten Bewegungen wurden jedoch deutliche Unterschiede der aktivierten neuronalen Regionen bei Profis und Amateuren gezeigt. Die dritte Hypothese, dass durch die langjährige Erfahrung der Profis eine Koaktivierung vom auditorischen und motorischen Kortex schon bei der reinen Vorstellung der Bewegungen auftritt, konnte die Studie nicht bestätigen. Zwischen 2004 und 2007 führte Johanna Gutzwiller eine Studie mit erstsemestrigen Studierenden an den Musikhochschulen in Luzern (15 StudentInnen), Basel (14 StudentInnen) und Bern (12 StudentInnen) durch. Das Ziel des Projekts war, die Erforschung ob Mentales Training für Studienanfänger ein gesundheitliches Angebot sein kann und ob sie diese Technik im Selbststudium erlernen können. In dessen Rahmen wurden die Studenten zu ihrem Übverhalten und ihre physische und psychische Situation befragt. Die Fragestellungen lauten folgenderweise: „Wie reagieren Studierende des ersten Studienjahres auf das Angebot freiwillig mental zu trainieren? Wie reagieren Studierende auf zwei verschiedene Ansätze des Mentalen Trainings? Wie entwickelt sich ihr Übverhalten während der Projektphase in Abhängigkeit von der gewählten Lehr- und Lernmethode? Verstärkt Mentales Training die Trainingseffekte einer Übungseinheit mit dem Instrument?“ (Gutzwiller, 2008. S. 11 – 12.) Alle Gruppen sollten zu Beginn 2004/2005 und an dessen Ende eine Fragebogenbatterie ausfüllen, welche auf die Fragen Übegewohnheiten auch im Kontext Mentales Training, physische und psychische Beschwerden die Antwort suchte. Die Luzerner Probanden wurden in die progressive Muskelentspannung 60 als Teil des Mentaltrainings im Rahmen eines einmonatigen Kurses unter der Leitung eines Therapeuten eingeführt, und erhielten das Werk „Mentales Training für Musiker“ von Renate Klöppel (1996) zum Selbststudium. Die Probanden aus Basel und Bern dienten als Kontrollgruppe. Am Beginn des zweiten Studienjahres wurden dieselben Gruppen nochmals mit der Fragebogenbatterie befragt. Dabei wurden einige Ausfälle registriert, so fiel die gesamte Berner Stichprobe und zwei Luzerner Studenten aus. Insgesamt standen Daten von 27 Personen zur Verfügung. In dem Schuljahr 2005/2006 waren nur noch drei Studenten am Projekt gemeldet, deshalb wurde die Untersuchung um ein Jahr verschoben. Am Beginn des Studienjahres 2006/2007 wurde eine zweite Gruppe für die Studie rekrutiert. In diesem Jahr wurde die Studie in Luzern im Rahmen eines modularisierten Angebots unter den Nahmen „Auch üben will gelernt sein“ läuft. In dem Modul wurden zum Üben und zum mentalen Training gehörige Inhalte sowohl theoretisch als auch praktisch bearbeitet. An der Hochschule Luzern konnten dazu 20 Personen, an den Hochschulen Basel und Bern 17 und 19 Personen gewonnen werden. Am Beginn und am Ende des Studienjahres wurden auch diese Gruppen befragt. Die ausgefüllte zweite Fragebogenbatterie wurde in Luzern von 18 StudentInnen in Basel von 14 StudentInnen und in Bern von 17 StudentInnen zurückgeschickt. Abb. 11. Die Messungsdaten der Studie Die abgegebenen Fragebögen waren die von Horst Hildebrandt entwickelten „Epidemiologischer Fragebogen für Musikstudentinnen“ und „Fragebogen zum 61 Übeverhalten“, sowie die deutsche Version der „HADS-D“ (Hospital Anxiety and Depression Scale) und die standardisierte Form der „GBB-24“ (Giessener Beschwerdebogen). Die erste Kohorte der Luzernen Studierenden wurde drei Monate nach der Einführung in die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson im Rahmen eines Interviews befragt, wie sie mit dem Entspannen, dem Werk von Klöppel und dem mentalen Training zurechtkommen. Die zweite Lucerner Gruppe erläuterte ihre Erfahrungen schriftlich. Die Ergebnisse wurden nach Angaben zu der Übezeit sowie nach Angaben zu den berichteten psychischen und physischen Beschwerden gegliedert. Nach Angaben der Studierenden übten sie am Ende des ersten Jahres durchschnittlich eine halbe Stunde länger als zu Beginn des Semesters. Die StudentInnen der Kontrollgruppen blieben bei den Messzeitpunkten stabil bei gerundet drei Stunden. Bei dem zweiten Messzeitpunkt übten die erste Gruppe der Luzerner Probanden im Schnitt vier Stunden, die zweite Gruppe fünf Stunden länger als beim ersten Zeitpunkt. Abb. 12. Die Anzahl der Stunden pro Tag für Kohorten, Messzeitpunkte und Standorte Das Resultat des Epidemiologischen Fragebogens zeigt, dass 107 StudentInnen von den 170 Befragten jemals Beschwerden hatten oder aktuell haben, die sie beim Spiel oder Singen beschädigen. Dieser Anteil entspricht einem Prozentsatz von 63%. Auf 62 die Frage, wann zuletzt die Beschwerden auftraten, waren die Antworten: 7 Studenten haben “vor Stunden“ (7%), 25 Personen „vor Tagen“ (23%), 21 „vor Wochen“ (20%), 23 „vor Monaten“ (22%), 11 „vor Jahren“ (10%), 19 „immer wieder“ (18%) Beschwerden und eine Antwort war nicht einzuordnen. Den Antworten nach auf den GBB-24 Fragebogen war der Beschwerdedruck der Teilnehmer im Vergleich zur Normalpopulation relativ hoch aber nicht alarmierend. Der HADS-D Fragebogen bewertet die Ängstlichkeit und die Depressivität, die den Erwartungen nach bei der ersten Luzerner Kohorte signifikant sank. Bei den anderen Gruppen ergab die Befragung keine Auffälligkeiten. Anhand der Interviews kam zu Tage, dass die meisten Teilnehmer den Zusammenhang zwischen dem Entspannen und dem mentalen Training nicht verstanden. Das Erlernen dieser Methode im Selbststudium ist nicht möglich und obwohl die Muskelrelaxation eine gute Sache wäre, kann sie nicht in so kurzer Zeit erworben werden. Allgemein wünschten die StudentInnen, dass Mentales Training als Schulfach angeboten werden soll. Die 20 Teilnehmer, die sich am Schluss in einer schriftlichen Stellungnahme äußerten, fühlten eine starke Veränderung in ihrer Übweise. Dies manifestierte sich in ihrem Bewusstsein für die Inhalte, die Zeit und die Körperlichkeit während des Übens. Die kritischen Anmerkungen der Autorin zum Projekt: 1. Die Form des Projekts war wegen der enormen Schwierigkeiten (externe Kontrollgruppen) nicht befriedigend. 2. Die geringe Anzahl des Probanden ergibt wissenschaftlich keine relevanten Aussagen. 3. Mittels Messungen innerhalb eines Jahres kann nicht zuverlässig behauptet werden, in wie weit ein gesteigertes Bewusstsein für die Qualität des Übens sich auf die Bewahrung der Gesundheit auswirkt. 4. Die Anwendung einer Kontrollgruppe wirft ethisch die Frage auf, ob es erlaubt ist für Studienzwecke eine Gruppe zurückhalten. (Gutzwiller, 2008 63 3. Üben im Flow Die Methode Üben im Flow entwickelte Andreas Burzik im Bereich der musikalischen Praxis. Die Grundlage der Methode ist das Flow-Erlebnis, die der amerikanische Psychologe Mihály Csikszentmihályi definierte, als er den Zustand des völligen Eintauchens in eine Tätigkeit bei Künstlern und Sportlern wissenschaftlich untersuchte. Burzik bezeichnet seine Art des Übens, als „eine ganzheitliche, körperorientierte Übemethode“. (Burzik, 2006. S. 265.) 3.1 Der Begriff des Flow-Erlebnisses nach Csíkszentmihályi Csíkszentmihályi definiert das Flow-Erlebnis, als ein Zustand des Glückgefühls in den die Menschen geraten, wenn sie in einer Tätigkeit vollkommen aufgehen. In seiner Untersuchung fragte er viele KünstlerInnen und SportlerInnen nach ihren Erfahrungen, die Meisten würden dieses besondere Gefühl als ein „kontinuierliches Fließen“ beschrieben, so nannte er diesen Zustand, als Flow-Erlebnis. Um das FlowErlebnis entstehen zu lassen, beschreibt Csíkszentmihályi acht grundsätzliche Komponenten der Flow-Erfahrung. Einige Elemente sind eine Voraussetzung für ein Flow-Erlebnis, die anderen beziehen sich auf das subjektive Erlebnis beim Flow. In seinem Buch (1997.) beschreibt Csíkszentmihályi das dritte und das vierte Elemente der Entstehung des Flow-Erlebnisses zusammen, die hier auch verfolgt wird. Die acht Elemente des Flow-Erlebnisses sind: 1. Die Anforderungen und die Fähigkeiten stehen im ausgewogenen Verhältnis: Die Abbildung 4. zeigt, wie der Flow Zustand zwischen den zwei Polen der Anforderungen und der Fähigkeiten erreicht werden kann. Die Unter- oder Überforderung hemmt das Flow-Erlebnis. Das Glückgefühl tritt in dem Moment auf, wenn durch das Individuum identifizierte mögliche Maßnahmen zusammenfallen mit dem Niveau der betreffenden Fähigkeiten. 64 Abb. 13. Das Flow-Erlebnis im Verhältnis von Anforderungen und Fähigkeiten 2. Das Verschmelzen der Handlung und der Aufmerksamkeit: Die vertiefte Beschäftigung mit einer Aufgabe im Flow bewirkt, dass die Handelnde ein Einheitsgefühl mit seiner Tätigkeit erlebt. 3.- 4. Die Klarheit der Ziele und die unmittelbare Rückmeldung der Aktivität: Um den Flow Zustand zu erreichen, ist die klare Zielsetzung der Aktivität und die dazu gehörige Rückmeldung eine Voraussetzung, wobei die Aufmerksamkeit kontinuierlich auf die Aufgabe gerichtet ist. 5. Die Konzentration auf die Aufgabe: Die zerstreute Aufmerksamkeit behindert es tief in eine Tätigkeit einzutauchen. Im Flow Zustand werden die irrelevanten Informationen und Gedanken ignoriert. 6. Man hat das Gefühl der Kontrolle über seine Aktivität: Im Flow Zustand fühlt man, dass der Erfolg in der eigenen Hand liegt. Die Befragten der Untersuchung von Csíkszentmihályi beschrieben dieses Gefühl, lieber die Möglichkeit der Kontrolle über die Tätigkeit, als die konkrete Verwirklichung der Aufgabe. 7. Auflösen des Ich-Bewusstseines: Hier geht es vorwiegend um die Pausierung der bewertenden Gedanken über sich selbst. Das Verschmelzen mit der Tätigkeit erlaubt keine Selbstprüfung. 65 8. Die Veränderung des Gefühls der Zeitabläufe: Im tiefen Flow Zustand scheinen die Stunden, wie nur wenige Minuten, oder wenige Minuten, wie Stunden zu verfließen. (Csíkszentmihályi 1997.) Außer den acht Grundelementen des Flow-Erlebnisses ergänzt Csíkszentmihályi seine Beschreibung mit dem „autotelischen“ Erlebnis, das aus den griechischen Wörtern auto (selbst) und telos (Ziel) zusammengesetzt ist. Diese Ergänzung, die in seinem später entstandenen Buch „A fejlődés Útjai“ (2008.) schon als Grundelement vorkommt, ist das nach der Erfüllung der ersten sieben Komponenten zustande kommende Erlebnis. Das autotelische Erlebnis wird durch eine sich selbst genügende Aktivität gekennzeichnet, in welcher die Person die Tätigkeit nicht wegen der Folgen ausführt. Das Wohlbefinden sowohl während der Aktivität als auch danach wird der Anreiz zur Widerholung des autotelischen Erlebnisses hervorgerufen. (Csíkszentmihályi 2008.) 3.2 Die Prinzipien des Übens Im Flow Die Flow Theorie von Csíkszentmihályi übertrug Andreas Burzik auf den Bereich der Musik. Diese Art des Übens bietet die Möglichkeit einer spielerischen Herangehensweise und der konzentrierten Erarbeitung konkreter technischer Schwierigkeiten, dient der Ergänzung des täglichen instrumentalen Übens, kann aber diese keineswegs ersetzen. Das Schlüsselprinzip der Methode ist, das Gefühl einer körperlichen Anstrengungslosigkeit zu erreichen und beizubehalten. Nach Burzik (2006.) um den Flow-Zustand beim Üben zu etablieren, muss die Konzentration auf die folgenden vier Aspekte der instrumentalen Praxis gerichtet werden: Auf den Kontakt zum Instrument, auf die Entwicklung der Klangqualität, auf das Gefühl der Anstrengungslosigkeit und auf den spielerischen Umgang mit dem Material. 1. Der Kontakt zum Instrument Bei dem ersten Prinzip handelt es sich in erster Linie um den Tastsinn. Am Anfang einer Übungseinheit muss der Musiker ein Wohlgefühl an den Kontaktpunkten seines Instruments herstellen, an denen es um eine optimale und effektive 66 Kraftübertragung auf das Instrument geht. Dieses Gefühl kann mit der satten taktilen Verbindung zum Klangkörper beschrieben werden. Die bevorzugten Berührungspunkte sind, jene an denen der Klang erzeugt wird. Bei GitarristInnen entspricht diesem dem Fingerspitzgefühl der linken Hand, wo der Kraftaufwand aus dem Arm auf die Seite anstrengungslos bewirkt. Für die Finger der rechten Hand geht es um den Nagelkontakt in der Verbindung zu den Saiten. Der richtige Nagelkontakt führt zu einem dichten schönen Ton. Für StreicherInnen betrifft der Berührungspunkt der linken Hand gleich wie für GitarristInnen, die Abweichung ist der Bogenkontakt der rechten Hand. Die Kontaktstelle bei Bläsern ist vorwiegend der Ansatz und die genaue Wahrnehmung der Atmung. Für die Finger geht es um ein genaues Erspüren der Klappen oder Grifflöcher. Den Kontaktpunkten entspricht bei PianistInnen sowohl die dichte Verbindung zwischen die Finger und die Tasten, als auch das Gefühl des Druckpunktes und das anstrengungslose Wechseln der Akkordverbindungen. 2. Erzeugen einer „angenehmen“ Tonqualität Bei der Entwicklung des Klangsinnes steht im Vordergrund das Hören, bei welcher die Konzentration auf die Klangqualität gerichtet ist. Das Schlüsselprinzip ist, dass das Erzeugen einer Tonqualität unmittelbar von dem ästhetischen Bedürfnis des Spielers abhängt. Die gezielte Sensibilisierung für den Obertonbereich der erzeugten Töne kann durch Veränderungen der Spielweise beeinflusst werden. Zum Beispiel bei GitarristInnen durch das Ausprobieren verschiedener Zupftechniken oder durch die Veränderung der Lage der rechten Hand, bei PianistInnen durch Variierung der Anschlagsarten. Bei StreicherInnen und BläserInnen neben dem Bodenkontakt und der Ansatztechnik verändert sich weitgehend die Farbe der Töne durch die Intonation, wo zum Beispiel ein Unterschied von Dis- und Es-Dur erklingt. Diese Art der Konzentration auf die Klangqualität erlaubt das tiefe Eintauchen in das Tun. 3. Das Gefühl der Anstrengungslosigkeit erreichen und beibehalten Das Gefühl der Anstrengungslosigkeit bedeutet, jede einzelne Aktion am Instrument mit einem entspannten Körpergefühl ausführen zu können. In der Praxis handelt es sich um das Tempo einer bestimmten Stelle sowohl zu verlangsamen als auch zu 67 vereinfachen, dass die Übung ohne Verkrampfung oder eine Überforderung des Bewegungsapparates durchführt werden kann. Im weiteren Verlauf des Übens dieser Stelle kann die Grenze der Geschwindigkeit kontinuierlich erweitert werden. Hier spielt eine wesentliche Rolle die Beibehaltung des Gefühls der Mühelosigkeit. 4. Improvisierendes Herumspielen des Übematerials Die ersten drei Prinzipien sollten am Anfang jeder Übungseinheit – in Form von einzelnen Tönen oder Skalen – fundiert werden. Nach der Erreichung dieses Gefühls kann man die Erarbeitung des Übungsmaterials anfangen. Der spielerische Umgang mit der aktuellen Literatur bedeutet, dass während der improvisierenden Beschäftigung mit den Tönen des Werkes die Notenwerte, die dynamischen Vorschriften nicht eingehalten werden müssen. Ein zentraler Aspekt dieses Prinzipes ist das Tonmaterial des Werkes vor allem im Tasten, Hören und Fühlen konsequent musikalisch zu gestalten. Der weitere Verlauf des Übens nähert sich mit der Art des improvisierenden Herumspielens nach und nach der beabsichtigten Endfassung, wobei das wichtigste ist, immer bei dem Gefühl der Anstrengungslosigkeit zu bleiben. 3.2.1 Der Lernprozess beim Üben im Flow Wenn der Kontakt zum Instrument, der angenehm und schön empfundene Klang und das Gefühl der Anstrengungslosigkeit erreicht wurde, werden die nicht beherrschten technischen Schwierigkeiten deutlich erkennbar. In dem weiteren Verlauf des Übens muss der Spieler diese störenden Lücken des Bewegungsablaufes nach und nach abbauen. Während der Bemühung den Bewegungsvorgang vollkommen durchzuarbeiten, entsteht eine Automatik der Kraftregulation. Um in dem FlowZustand zu bleiben, wird immer das genaue Körpergefühl gefordert: Das schnelle Durchspiel einer schwierigen Passage führt zur Verkrampfung der Muskulatur (Überforderung s. Abb. 4.), ein zu langsames oder rein mechanisches Angehen der technischen Probleme aber zur Langeweile (Unterforderung s. Abb. 4.). Die gewünschte Endfassung der technisch schwierigen Stellen entsteht spontan, wenn alle Lücken im Bewegungsablauf abgebaut sind. Betrachtet man den Lernprozess beim Üben im Flow aus psychologischem Aspekt, gibt es vorwiegend drei innere Haltungen, die das Kontaktgefühl zum Instrument verhindern: der übertriebene 68 Perfektionsdrang, die Ungeduld und die Angst beim Spielen. Die Folge dieser Dispositionen ist ein angespanntes Körpergefühl, das zu der Unterbrechung des subtilen Kontakts zum Instrument führt. In den meisten Fällen prägen sich die klassisch ausgebildeten MusikerInnen die Bewegungsvorgänge durch Wiederholung ein. Üben im Flow hingegen basiert auf dem Lustempfinden beim Spielen und auf dem Vertrauen in unsere Sinne. Im Vordergrund steht immer das Körpergefühl gesteuerte Erforschen einer schwierigen Stelle. Der Übeprozess kann nicht mit dem Kopf gesteuert werden. 3.2.2 Unterstützende Techniken Im Folgenden werden Techniken dargestellt, welche nach Burzik die Methode des Übens im Flow verfeinern und fördern. Die Akzeptanz der aktuellen Gemütslage Hier handelt es sich um die Gemütslage des Spielers, die das Übeerlebnis beeinflusst. Zum Beispiel an den verschiedenen Tageszeiten zu üben, bedeutet ein unterschiedliches Erlebnis, die mit der aktuellen Verfassung des Musikers zusammenhängt. So wäre es ratsam, Übungseinheiten zu der aktuellen Disposition in der man sich gerade befindet zu richten. Ein hoch dramatisches Stück muss nicht dramatisch gespielt werden, wenn man eher eine ruhige Gemütslage hat. Das dramatische Stück kann ruhig im Piano und vielleicht sogar im halben Tempo angegangen werden. Dieses Verfahren verhindert eine Orientierung an der einzigen richtigen Interpretation. „Der Musiker erkennt und erlebt, dass er es mit lebendigem Spiel zu tun hat und nicht mit dem Erfüllen einer abstrakten Aufgabe“ (Burzik 2006, S. 278.) Das Prinzip der Deutlichkeit Das Ziel des Übens ist, die Bewegungsabläufe in dem motorischen Gedächtnis zu speichern. Um das richtige sensomotorische Körpergefühl zu erlernen, müssen dem Körper klare Informationen vermittelt werden. Abhängig von der aktuellen Disposition 69 sollten die schwierigen, exponierten Stellen und die Passage des Werkes zum Beispiel ein schneller ppp-Lauf auf dem Klavier, mit einer Dynamik ausgeführt werden. Am Anfang müssen die Bewegungen am Instrument verlangsamt werden, um das subtile Kontaktgefühl zu etablieren. Der Ausgangspunkt des weiteren Übens ist die klare deutlich gefühlte Rückmeldung von den beteiligten Sinnen. Im Falle, dass im verlangsamten Tempo das Kontaktgefühl etabliert ist, kann ein von innen heraus pulsierender Übeprozess beginnen: Man nähert sich nach und nach der vorgesehenen Endfassung. Wenn der Kontakt zum Instrument verloren geht, muss die Bewegung erneut verlangsamt werden. Die Integration der Zielgefühle Hier handelt es sich um die Einrichtung der schnellen Griffkombinationen oder Akkordwechseln nach einer gründlichen Integration des eigentlichen Zielgefühls (das Prinzip der Anstrengungslosigkeit). Zunächst sollte es langsam, ohne Sorgen über das Zieltempo, konzentriert auf den bestimmten Ton oder Akkord gehörige Körpergefühl ausgeführt und gespeichert werden. Der Musiker sollte seine Gedanken nicht an das Treffen des exponierten Tones oder Griffes, sondern eher an das gemütliche Gefühl des Tones oder Griffes richten. Flexibles Tempo Obwohl den klassisch ausgebildeten MusikerInnen eine Anforderung beim Spielen das Tempo zu halten ist, gilt es beim Üben im Flow die optimale Übegeschwindigkeit durch das Körpergefühl zu bestimmen. Dieses flexible Tempo hilft nicht nur die subtilen Verkrampfungen während des Übens einer schwierigen Stelle zu finden, sondern auch die Unterforderungen. Das heißt die Langeweile zu erkennen und zu bewältigen. Es ist ratsam, am Ende jeder Übungseinheiten die geübte Stelle mindestens einmal im Originaltempo durchzuspielen, um die noch nicht ganz anstrengungslosen Bewegungen zu realisieren. 70 Kreisübungen Eine mögliche Strategie zur Meisterung der technisch schwierigen Probleme sind die ein paar Taktige Einheiten die sogenannten Kreisübungen. Sie sind ein paar Takte lange Einheiten, die der Musiker aus dem problematischen Material für sich selbst ausdenkt. Diese Übungen sollten häufige Wiederholungen und das improvisierende Herumspielen mit der schwierigen Stelle erlauben. Beim Erfinden einer Kreisübung sollte man darauf achten, diese Einheiten melodisch interessant und angenehm zu gestalten. Das Ziel dieser Übungen besteht darin, immer im Fluss zu bleiben das heißt bei der Konzentration auf den Bewegungsablauf der schwierigen Stelle die Körperliche Anstrengungslosigkeit nicht zu verlieren. (Burzik, 2006. S. 265 – 286.) 3.3 Untersuchungen über die Effektivität des Übens im Flow Die Methode von Andreas Burzik scheint immer mehr bekannter zu werden, aber es fehlen noch Untersuchungen über die Effektivität dieser Art des Übens. Die vorliegenden Untersuchungen sind mehr auf das Erleben des Flows konzentriert. 2007 wurde eine umfassende Untersuchung von Ester Thoma zum Thema FlowErleben beim Klavierspielen durchgeführt. Es wurde untersucht, ob man beim Üben das Flow-Gefühl erleben kann und ob dabei zwischen Laien und Professionellen ein Unterschied auftreten würde. Deswegen wurden in der Gruppe nicht nur Klavierschülerinnen und Schüler, sondern auch professionelle PianistInnen getestet. In der Studie nahmen 26 Leien und 10 Profis teil. Die Laien waren zwischen 7 und 50, die Profis zwischen 18 und 61 Jahre alt. Das Klavierspielen der Laien erstreckte sich höchstens über 12 Jahre, dass der Profis nicht unter 11 Jahre. Die Probanden wurden so ausgewählt, dass kein Laie länger als 12 Jahre spielte und kein Profi kürzer als 11 Jahre. Im Bezug auf die musikalischen Richtungen wurden drei Gruppe unterschieden. In der Kategorie der Klassik nahmen 16, in der Jazz 7 und in der Lieder (Songs) 13 Spielerinnen und Spieler teil. Die Probanden hatten die Aufgabe, ein Tagebuch über 14 Übungseinheiten möglichst ohne Unterbrechung zu führen. An jede Übungseinheit musste die von Rheinberg entwickelte sogenannte FlowKurzskala – ein bestimmter Fragebogen konzentriert auf das Flow-Erlebnis – 71 ausgefüllt werden. Die Abbildung zeigt die auf einer Sieben-Punkte-Skala zu beurteilenden zehn Aussagen (von „trifft nicht zu“ bis „trifft zu“). Abb. 14. Die Punkte der Flow-Kurzskala Dem Ergebnis der Untersuchung nach kam zu Tage, dass selbst die Tätigkeit Klavier zu üben in den meisten Fälle zu einem Flow-Erlebnis führt. Die Flow-Werte bei den MusikerInnen, die schon Erfahrung hatten, vor Publikum zu spielen, waren deutlich höher. Die angegebenen Werte liegen über dem Wert sechs, nur in einem Fall bei den Laien an der Grenze zu fünf. Es wurde auch eine Steigerung des Flow-Gefühls bei der Vorspiel-Situation festgestellt, das in dieser Situation viel öfter auftrat. Dieses Phänomen nennt man „social facilitation effect”. Abb. 15. Verlauf des Flow-Erlebnisses 72 Die PianistInnen wurden um eine Selbsteinschätzung ihrer Fähigkeit des Spielens gefordert. Dem Resultat nach wurde eine hohe Korrelation zwischen der Einschätzung und der Intensität des Flow-Erlebens festgestellt. Zwischen den Jahren des Klavierspiels und der Höhe des Flow-Werts konnte kein signifikanter Zusammenhang gezeigt werden. Die PianistInnen mussten einen Fragebogen ausfüllen, der neun Gründe enthielt warum sie Klavier spielen. In den neun Fragen im Bezug auf die Motivation standen fünf intrinsische und vier extrinsische Gründe. Die Kandidaten mussten eine Rangfolge dieser Motivationen stellen. Die Tabelle zeigt deutlich, dass an der Spitze die fünf intrinsischen Ursachen standen. Rang Mittelwert Die Musik 1 3,3 Das Besondere am Klavierspielen, der Zauber 2 3,8 Die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten 3 4,2 Die Lust am Klavierspielen als Tätigkeit 4 4,5 Das Ausleben von Gefühlen 5 4,8 Motivation durch Andere 6 5,7 Das Messen an Idealen 7 5,9 Anerkennung, Bewunderung 8 6,3 Der Wettbewerb 9 6,5 Das Resultat dieser Untersuchung erwies, dass unabhängig ob bei Laien oder Profis das Klavierspielen ohne notwendigen äußeren Anreiz eine Befriedung für PianistInnen ergab. (Thoma, 2007. S. 80 – 82.) 2005 führte Dr. Olga Bazanova und Andreas Burzik2 eine Untersuchung über die Neurobiologie der Flow-Zustände bei MusikerInnen durch. Im Rahmen der Studie wurden die MusikstudentInnen der Hochschule Bremen und des Konservatoriums 2 Die Studie wurde unter allem an dem Workshop von Burzik im Frankfurt am Main im 2009 repräsentiert und sie kann auf der Seite http://www.flowskills.com/neurobiologie-undflow.html aufgefunden werden. Derzeit sind keine Publikationen über die Angaben des Resultats vorhanden. 73 Nowosibirsk während des Übens im Flow mit Hilfe des EEG (Elektroenzephalografie) gemessen. Abb. 16. EEG Messung zur Neurobiologie von Flow-Zuständen bei MusikerInnen Den Ergebnissen nach zeigten die MusikerInnen in einem tiefen Flow-Zustand starke Alpha-Aktivität und hohe Kohärenz. Die Alpha-Aktivität weist auf eine erhöhte Leistungsfähigkeit, Lernfähigkeit und hohe Konzentration hin. Abb. 17. Alpha-Aktivität des Gehirns im Flow-Zustand 74 Die hohe Kohärenz ist nach Burzik „...ein Maß für die Zusammenarbeit weit auseinander liegender Hirnregionen. Im Flow kommunizieren und kooperieren alle Hirnregionen optimal miteinander, das Gehirn schwingt im Gleichtakt, es wird zum „Supraleiter“. Supraleitfähigkeit des Gehirns bedeutet erhöhte Durchlässigkeit des Gehirns für kreative Ideen, Offenheit für spontane Problemlösungen. Hoch kohärente Zustände gehen mit positiven Emotionen und der Ausschüttung von Endorphinen (körpereigenen Opiaten) einher – das „Heureka“- oder Stimmigkeitsgefühl“. (Burzik, http://www.flowskills.com/neurobiologieund-flow.html) Bei den MusikerInnen, die nicht in einem Flow-Zustand übten, konnte die Studie nur geringe Alpha-Aktivität beweisen. Bei jeder Elektrode zeigte sich eine andere elektrische Aktivität, es wurde keine Kohärenz bestätigt. (Burzik, http://www.flowskills.com/neurobiologie-und-flow.html) Abb. 18. Alpha-Aktivität des Gehirns beim Üben ohne Flow 75 4. Eigene Erfahrungen Im Folgenden wird die Praxis beider Übungsarten im Kontext des Gitarrenspiels anhand meiner Erfahrungen erläutert. In dessen Rahmen beschreibe ich, unter welchem Umstand ich auf diese Methoden traf und was für einen Eindruck sie auf mich machten. Am Ende beider Beschreibungen wird der Versuch unternommen, eigene Bemerkungen sowohl im Bezug auf die Praxis als auch auf die Untersuchungen zu formulieren. 4.1 Mentales Training Der Methode und der Praxis des mentalen Trainings begegnete ich schon in meiner Kindheit während meines Studiums im Konservatorium, ohne es als Mentales Training zu bezeichnet zu haben, sondern als „Üben im Kopf“. Mein damaliger Lehrer Professor József Papp empfahl mir das momentan gespielte Stück in meinem Kopf ohne Gitarre durchzuspielen. Das bedeutete bei mir eine Visualisierung des Fingersatzes der linken Hand. Ich verwendete diese Technik ständig vor den Auftritten, die mir sehr viel half, um das Gefühl der Sicherheit zu erreichen und die Auftrittsangst zu bewältigen. Zum zweiten Mal habe ich den Begriff in Frankfurt gehört, als an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main 10. bis 12. Juli 2009 ein Workshop für StudentInnen unter dem Titel „Mentales Training“ unter der Leitung Ulrike KleesDacheneder veranstaltet wurde. Im selben Jahr verbrachte ich an dieser Hochschule mein Erasmus Aufenthalt und ich hatte die Möglichkeit als ordentliche Studentin der Hochschule an diesem Kurs teilzunehmen. Bevor ich die Veranstaltung besucht hatte las ich das Buch „Üben mit Köpfchen: Mentales Training für Musiker“ von Linda Langeheine, um mein Wissen über dieses Thema zu vertiefen. Damals war mir noch nicht bewusst, wie viele verschiedene Theorien und Praxen im Bezug auf Mentales Training vorhanden sind. An dem Workshop nahmen 12 Personen teil. Die Leiterin des Kurses war Ulrike Klees-Dacheneder, eine Diplompsychologin/Sportpsychologin, die selbst als 76 Spitzenschwimmerin im Jahr 1972 als Mitglied der olympischen Nationalmannschaft Deutschland an den Olympischen Spielen teilnahm. Seit 1990 ist sie auf die Arbeit mit MusikerInnen spezialisiert. In diesen drei Tagen wurden anhand der im zweiten Kapitel beschriebener Annäherung zum mentalen Training von Klees viele theoretische und praktische Anwendungsarten der Methode erklärt. Statt progressiver Muskelentspannung verwendeten wir die Technik bildhafter Vorstellung zum Erreichen des entspannten Zustands, der aber meines Erachtens körperlich nicht so effektiv wirkt, als geistig. Der ganze Workshop basierte auf der Erweckung unserer Körperwahrnehmung. In dessen Rahmen simulierten wir verschiedene Seelenzustände und die dazu gehörige Körperhaltung, Körpersprache im Kontext von Konzertsituationen. Mit Hilfe einer Videoaufnahme wurde das Verhalten jeder TeilnehmerInnen auf der Bühne analysiert, die nicht nur anhand der eigenen, sondern der anderen Aufnahmen instruktive Ergebnisse zu Tage kommen ließen. Obwohl die zeitliche Kürze des Workshops eine tiefgehende Beschäftigung mit der Methode des mentalen Trainings verhinderte, konnte der Anblick auf die einzigartige Anwendungsmöglichkeit der Technik bei mir die weitere Beschäftigung mit dem mentalen Training erregen. Anhand des Erlebnisses des Workshops baute ich im Weiteren die neuen Techniken zur Bewältigung meiner Podiumsangst nicht nur in die Vorbereitungsphase der Auftritte, sondern auch in mein alltägliches Üben ein. Unter diesen Techniken sind sowohl die Vorstellung der bestimmten Bühne als auch die Vorstellung der ganzen Situation und der Gefühlszustände gemeint. Nach dem Kurs nahm ich im Sommer 2009 an einem Wettbewerb teil, an dem ich versuchte diese neuen Techniken zu verwenden. Am vorigen Tag jeder Runde stellte ich mir den Saal vor, wie ich langsam auf die Bühne gehe, wie ich mich auf den Sessel hinsetze, während ich mich ganz ruhig und selbstbewusst fühle. Danach spielte ich jedes Stück in meinem Kopf durch und versuchte in meiner Vorstellung sowohl den Fingersatz der linken Hand als auch die dazu erklingenden richtigen Melodien musikalisch so lebhaft wie möglich darzustellen. Nach meinen Erfahrungen ruft diese Weise des Übens eine tiefe Ruhe in der Vorspielsituation hervor, da der ganze Verlauf bereits bekannt vorkommt. 77 In den vorigen Kapiteln wurden die unterschiedlichen Verwendungsarten des mentalen Trainings erläutert, diese Vielfältigkeit tritt auch in meiner Übepraxis auf. Am meisten verwende ich die Vorstellung des Fingersatzes der linken Hand vom Anfang bis zum Ende des Stückes, währenddessen versuche ich so lebhaft wie möglich das Stück und die kinästhetischen Bewegungen zu durchleben. Die kinästhetische Bewegungsvorstellung funktioniert nicht in jedem Fall, manchmal sehe ich einfach nur meine Finger. Die zweite Art des mentalen Übens die ich anwende, ist die rein auditive musikalische Vorstellung des Stückes mit der Phrasierung, dem Rhythmus, der Artikulation, Dynamik, Klangfarbe usw. Bei der nächsten Technik handelt es sich um die Angstbewältigung, sowie die Vorbereitung auf den Bühnen-auftritt. Wie diese Übungsweise bei mir funktioniert, wurde im Vorigen schon beschrieben. Die letzte Art des mentalen Trainings die ich in meiner Übepraxis einbaute, das Erarbeiten schwieriger Stellen mittels mentalem Üben in Form Entspannen, Vorstellen der Bewegung und die Praxis im vorgestellten Tempo. Am wenigstens nütze ich für das Erlernen und Einstudieren von Bewegungsabläufen eines ganzes Stückes das mentale Training im Sinne der Methode OrloffTschekorsky. Obwohl diese Art der Methode für mich die sympathischste ist, konnte ich den genauen Verlauf der Technik nicht ganz erwerben, deshalb benutze ich das mentale Üben nicht zum Einstudieren eines Werkes, sondern zur Erarbeitung und Vertiefung einzelner Abschnitte. Kritische Bemerkungen im Bezug auf das Thema Mentales Training Obwohl viele von den Autoren der Meinung sind, dass die Technik des mentalen Trainings ohne der Hilfe einer Fachperson oder eines Kurses erworben werden kann (Ausnahme bilden Orloff-Tschekorsky), nach der Untersuchung von Gutzwiller und meiner Erfahrung kann bestätigt werden, dass das Erlernen und die Einsetzung der Technik in dem alltäglichen Üben eine äußere Hilfe erfordert. Ebenfalls kann die Methode im Rahmen eines zweitägigen Workshops nicht erworben werden. Diese Seminare können nur das Interesse erwecken, aber sie bieten keine weitere Anweisung betreffs der Verwendung des mentalen Trainings. 78 In dem deutschsprachigen Raum sind sich die Autoren einig, dass für die erfolgreiche Anwendung der Methode, die Beherrschung und der kontinuierliche Einsatz einer Entspannungstechnik Voraussetzung ist, trotzdem erfordert der Erwerb der am meisten empfohlenen Technik der progressiven Muskelentspannung nach Jacobson, die Hilfe und die Kontrolle einer Fachperson. (vgl. Gutzwiller S. 49 – 53.) Im angloamerikanischen Relaxationstechnik Sprachraum gibt es keine Angaben, ob eine sowohl in Rahmen der Untersuchungen als auch bei der Anwendung des mentalen Trainings eingesetzt würde. Bemerkenswert ist die Tatsache, dass kein Hinweis auf das Orloff-Mental-System in diesem Sprachraum vorhanden ist, obwohl diese Methode die Einzige ist, die mit Hilfe von Sportpsychologen unmittelbar auf den Bereich der Musik entwickelt wurde. Die Anwendung des Begriffes Mentales Training zeigt ein uneinheitliches Bild. Nicht nur die AutorInnen, sondern auch die Forscher meinen unter dem Begriff andere Arten der Methode, die nicht immer präzisiert werden. Bei den Untersuchungen sind in den meisten Fällen keine genauen Angaben, welche Art der mentalen Vorstellung von den Probanden verlangt wurde. Bemerkenswert sind auch die in den Studien fehlenden Informationen, ob die Teilnehmer die Technik des mentalen Trainings in Rahmen eines Selbststudiums oder an einem Kurs oder gar nicht erlernt hatten, da das Resultat der Untersuchung von dem Grad der Beherrschung der Methode in großem Maß beeinflusst werden kann. Da bei den Personen die vorher nie mit dieser Technik übten, schon während einer drei minütigen Übungseinheit eine Ermüdung auftreten kann, die die Leistung der Person beeinflusst. (Orloff-Tschekorsky, 1996. S. 39.) Ebenfalls fehlen die Angaben im Bezug auf die Nachprüfung, ob die Probanden überhaupt die mentale Technik verwenden können, das heißt nach der gegebenen Art des mentalen Trainings, sich die Aufgabe vorstellen können. Zum Beispiel in der Untersuchung von Orloff-Tschekorsky war eine Teilnehmerin nicht in der Lage 79 gewesen, sich die Bewegungen in einem schnelleren Tempo vorzustellen. (in: Frauscher, 1999. S. 278.) Die gewählten Stücke sind in den meisten Fällen zu einfach oder zu bekannt, die für professionelle MusikerInnen keine Schwierigkeit bedeuten, deshalb spiegelt sich in den Resultaten nicht der wahre Einstudierungs- oder Verarbeitungsprozess des mentalen Trainings. In der Studie von Scheler-Moster zeigten die professionellen MusikerInnen sowohl während der Aufführung als auch bei der Vorstellung der Bewegungen eine niedrigere Aktivität in den neuronalen Regionen, als die Amateure, die mit der Vorerfahrung der Profis erklärt werden kann. Ein Anfänger muss überlegen wie er welchen Ton oder Ablauf spielt, bei Professionellen ist der Spielvorgang bereits automatisiert, sie zeigen weniger neuronale Aktivität. (vgl: Scheler-Mosters Untersuchung S. 47 – 49.) Dieser Aspekt ist bei den Messungen nicht berücksichtigt. Obwohl Haslinger und seine Kollegen 2005 in einer experimentellen Studie nachweisen konnten, dass sich bei PianistInnen durch die Beobachtung von stummen pianistischen Fingerbewegungen eine Aktivitätszunahme der sensomotorischen Handregion, den auditiven Regionen des Schläfenlappens und des Kleinhirns zeigt, erwähnen die Autoren Observatives Üben als mögliche Art des mentalen Trainings in dem seltensten Fall. Trotz des Resultats der Studie kann meines Erachtens das observative Training im Bezug auf die Gitarrenpraxis nur begrenzt angewendet werden, da der Fingersatz der Greifhand bei den GitarristInnen fast in jedem Fall und bei jeder Person einen Unterschied zeigt. Bei den komplizierteren Werken gibt es fast keinen GitarristInnen, die den gleichen Fingersatz bis zum Ende des Stückes benutzen würde. Um die genaue Effektivität und Effizienz des mentalen Trainings bewerten zu können, wäre es in der Zukunft ratsam, die Untersuchungen immer mit der fMRI Messungen zu verknüpfen, sowohl um die Beherrschung der Technik als auch den Grad des Vorstellungsvermögens zu bestätigen. 80 Zukünftig sollten die Probanden an einem mehrwöchigen Kurs teilnehmen, in dem nicht nur die erforschte Art der Methode, sondern auch eine Entspannungstechnik erworben werden könnte, um einheitlichere Ergebnisse zu unterstützen. Um den wahren Übeverlauf beim mentalen Training zu erforschen, sollte die Qualität, beziehungsweise der Schwierigkeitsgrad der gewählten Abschnitte und dessen Länge dem realen Üben angenähert werden, in dessen Rahmen sollte auch die Untersuchungen als ein längeres Verfahren verlaufen. Nach Altenmüller „Interessant ist, dass die Hirnaktivität mit dem Schwierigkeitsgrad der vorgestellten Bewegungen ansteigt und dass insbesondere auch durch mehrtägiges mentales Üben die beteiligten neuronalen Bezirke plastische Veränderungen aufweisen“ (Altenmüller, 2006. S. 58.) Die immer weiter zunehmende Zahl der Untersuchungen würde nicht nur eine Metaanalyse der vorhandenen Studienergebnisse, sondern die Sicherung einer gemeinsamen Internetplattform erfordern, wo auf der ForscherInnen aus den verschiedenen Sprachräumen ebenfalls ihre Resultate miteinander austauschen könnten. Zum Beispiel sind in dem angloamerikanischen Sprachraum nur einige deutsche Untersuchungsergebnisse vorhanden, die die allgemeine Beurteilung des Standes der Forschung erschwert. 4.2 Üben im Flow Es wurde vom 13. bis 15. Mai 2009 an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt am Main ein Workshop für StudentInnen mit dem Titel „Üben im Flow“ mit der Leitung Andreas Burzik veranstaltet. Vorher hatte ich keine Erfahrung mit dieser Methode gehabt, nur im Allgemein über das Flow-Erlebnis nach Csíkszentmihályi Mihály. Der Workshop wurde für zwölf TeilnehmerInnen angekündigt. Im Rahmen des dreitägigen Seminars wurden einerseits die theoretischen Grundlagen erläutert, andererseits die praktische Anwendung des Übens im Flow mit der Beteiligung der Studenten präsentiert. Als ersten Schritt sollten alle Betroffenen 15 Minuten üben, danach mussten sie einen Fragebogen 81 über die subjektiv empfundenen Erfahrungen während des Übens ausfüllen. Die Fragen waren zum Beispiel die folgenden: „Haben Sie das Üben genossen oder hat es sie gelangweilt? Konnten Sie sich die ganze Zeit über auf das Üben konzentrieren? Haben Sie auf die Uhr angeschaut? Wie haben Sie sich gefühlt?“ usw.(Burzik, 2009.) Obwohl dieser Fragebogen für Andreas Burzik ausgefüllt werden sollte, diente er mir als ein Feedback. Es ist mir plötzlich deutlich geworden, dass während des Übens mein Körpergefühl eher verkrampft als locker war, und dass ich mich oft nicht auf das gespielte Stück konzentrierte. Nach der Erläuterung der schon im dritten Kapitel beschriebenen theoretischen Grundlagen begannen wir die Methode anhand der vier Grundprinzipien in der Praxis unter der Leitung Burziks zu verwirklichen. An der Gitarre laufen die ersten zwei Prinzipien nebeneinander ab. Bei dem ersten Prinzip handelt es sich um den Kontakt zum Instrument, wo ich als erster Schritt nur mit den linken Hand (bei linkshändigen mit der rechten Hand) einen einzigen Ton greifen musste, so, dass ich das Griffbrett mit der Fingerspitze nicht als etwas festes, hartes fühlen, sondern verschmelzend, wie Honig oder Butter. Im Workshop wurde den TeilnehmerInnen eine sogenannte Checkliste verteilt, die bei der Überprüfung der Prinzipien half. Die Kontrollfragen zum ersten Prinzip sind: „Fühle ich mein Instrument wirklich? Fühle ich mich an den Berührungspunkten wohl, bin ich auf mein Instrument gut und genau eingestellt? Sorge ich für klare Gefühlseindrücke oder fühlt es sich »vage« oder »brüchig« an? Bin ich zu schnell?“ (Burzik, 2009. Workshopmaterial) Neben dem Erwerb des angenehmen Kontaktgefühls am Griffbrett sollte ich mit der rechten Hand den richtigen Nagelkontakt in der Verbindung zu den Seiten mittels einzelnen Tönen und der Tonleiter erzeugen, der zu einem runden, dichten, obertonreichen Klang führt. Die Qualität des gezupften Tons hängt sowohl von dem Abstand zum Steg als auch von der Haltung der rechten Hand beziehungsweise der 82 Zupftechnik ab. Das Wichtigste ist, dass die Tonqualität nach dem eigenen Bedürfnis gebildet wird. Der so produzierte Klang entspricht dem zweiten Prinzip, dem Kontakt zum Klang. Kontrollliste zum zweiten Prinzip: „Bin ich in Kontakt mit jedem Ton? Genieße ich den Klang, den ich produziere? Höre ich auf meine Obertöne?“ (Burzik, 2009. Workshopmaterial) In der Praxis laufen auch die nächsten zwei Prinzipien ungetrennt voneinander. Als der Kontakt zum Klang und zum Instrument erreicht war, musste ich mit einer vorher gewählten problematischen Stelle quasi improvisatorisch herumspielen. Das ausgewählte Tempo muss immer einem angenehmen Körpergefühl angepasst werden. Die Folge dieses konzentrierten Verfahrens ist das Gefühl der Anstrengungslosigkeit im Körper. Die Kontrollfragen des dritten Prinzips und des vierten Prinzips sind: „Wie geht’s mit jetzt in diesem Augenblick? Spüre nach innen! Spiele ich so, wie ich mich gerade fühle, oder tue ich mir Gewalt an? Fühle ich jede Bewegung wie viel »tun« ist in meinem Spiel? (Das »Körper-Radar« einschalten!) Bewege ich mich? Schwingt mein Körper? Tanze ich mit meinem Instrument?“ (Burzik, 2009. Workshopmaterial) „»Suche« ich »erforsche« ich das Stück spielerisch – oder »übe« ich (mechanisch)? Wie kann ich diese Stelle vereinfachen um ein Gefühl für sie zu bekommen? Verliere ich das Interesse an dieser Passage? Bin ich zu langsam zu perfektionistisch? Weitergehen – oder mit dieser Stelle ein wenig herum spielen? Erlaube ich »flexibles Tempo«? Bin ich im »-Richtig-Falsch-Modus« – oder genieße ich die Musik? Empfinde ich die musikalische Qualität dieser Passage? Worum geht es in diesem Stück? (Bilder, Gefühle, Empfindungen – »die Story«!)“ (Burzik, 2009. Workshopmaterial) 83 Nach meinem Erachten ist das Erreichen des Flow-Zustandes mit geschlossenen Augen leichter, da der Mangel an Visualität die Aufmerksamkeit sowohl auf das Körpergefühl als auch auf die Qualität des Klanges richtet. Dazu unerlässlich ist die auswendige Beherrschung des betroffenen Abschnitts, die nicht immer vorhanden ist. Nach dem Erwerb des Kontaktgefühls am Instrument und der angenehmen Tonqualität in Form von einzelnen Tönen oder Skalen kann ich mit der schwierigen Stelle beginnen zu arbeiten. Die möglichen „Elemente“ des improvisatorischen Herumspielens sind das Beschleunigen und Verlangsamen des Tempos, das Verlassen der Notenwerte, die Repetition einiger Töne, die Aushaltung der Töne, das Rückspiel einiger Phrasen und die Übertreibung der Agogik in positive oder negative Richtung. Das Tempo, die Repetition und das Rückspiel der Töne richtet sich immer zu meinem aktuellen Körpergefühl das heißt zu der Bewahrung der Anstrengungslosigkeit. Im Gegenteil zu anderen Instrumenten, wie zum Beispiel der Klarinette, kann man sowohl einige musikalische Phrasen an der Gitarre wegen der Fingerwechsel nicht als auch die Töne rückwärts spielen /repetieren, da der Fingersatz der rechten Hand (Anschlagshand) verändert, dadurch würde nicht der genaue Fingersatz der Stelle geübt werden. Bei den „Elementen“ des improvisatorischen Herumspielens, dem Verlassen der Notenwerte, das Verlassen des Rhythmus und der Aushaltung einzelner Töne muss ebenfalls in bestimmten Grenze beibehalten werden, wegen der Zupfhand und der akustischen Eigenschaft des Instruments. Die Qualität der Töne kann nicht nachträglich korrigiert werden. Die Methode ist für die Lösung einiger technischen Probleme im Bezug auf die Gitarre überhaupt nicht geeignet, aufgrund folgender Aspekte: 1. Die Aufschlagbindung (ein freier Finger der Griffhand schlägt eine Saite an einem bestimmten Bund schnell auf das Griffbrett). Hier handelt es sich um eine fehlende Kontrollmöglichkeit der Anstrengungslosigkeit wegen der Geschwindigkeit der Tonerzeugung, die in einem langsameren Tempo überhaupt nicht erklingen würde. 84 2. Die Abzugsbindung (ein Finger der einen Ton gegriffen hat, lässt die Seite los bzw. zupft sie leicht an). Ähnlich zu der vorigen Technik kann die Fingerbewegung nicht verlangsamt oder der Ton ausgehalten werden, um den angenehmen Kontakt zum Instrument und die Anstrengungslosigkeit zu finden und zu bewahren. 3. Der Barré-Griff, Barré-Kette (mit einem Finger mehrere oder alle Saiten eines Bundes drücken). Wegen der festen Position und des notwendigen starken Drucks des betreffenden Fingers kann der Griff nicht für lange Zeit gehalten werden, eine sowohl längere als auch langsamere Kette des Griffes kann eher eine Verkrampfung der Muskeln verursachen. In meiner Übepraxis verwende ich die Methode bei neuen Werken auf die Erarbeitung und Vertiefung technisch schwieriger Sprünge bzw. Stellen, wobei ich vorwiegend auf die Bewegung und das dazugehörige Körpergefühl achte. Obwohl Andreas Burzik seine Methode durch konzentrierte Erarbeitung konkreter technischer Schwierigkeiten, für eine Ergänzung des täglichen instrumentalen Übens hält, benutze ich diese Übungsart zusätzlich sowohl für die Erfrischung seit langer Zeit gespielter Stücke als auch zum Wachrufen seit langer Zeit nicht gespielter Stücke. In diesen Fällen spiele ich das ganze Stück einmal improvisatorisch, dann einmal nicht in dem Endtempo aber mit dem genauen Rhythmus durch. Während des improvisierenden Spiels bevorzuge ich in erster Linie die Übertreibung der Agogik und das Beschleunigen und Verlangsamen des Tempos. Kritische Bemerkungen im Bezug auf das Thema Üben im Flow Die Methode ist nach meiner Erfahrungen auf professionellem Niveau für den Erwerb des Bewegungsablaufes eines neuen Stückes ungeeignet, beziehungsweise kann ich die Aussage von Burzik, die Stücke schneller und tiefer erworben zu können, kann ich nicht bestätigen. Die Untersuchungen über diese Übungsart erforschen nur den Flow-Zustand, anstatt die Effektivität des Übens im Flow zu forschen, deshalb ist derzeit keine Bestätigung über Burziks Behauptung vorhanden. 85 Die Methode kann zum Erreichen eines bewussten und anstrengungslosen Körpergefühls und zur Erkenntnis der Muskelverkrampfungen helfen, dennoch steht dieses Verfahren im Einklang mit anderen physiologischen Methoden wie zum Beispiel der Bewegungslehre. Aus dem Artikel von Burzik im „Handbuch Üben“ kommt zu Tage, dass sich das improvisatorische Herumspielen des schwierigen Abschnittes immer mehr zu der beabsichtigten Endfassung annähern sollte. An dem von mir besuchten Workshop wurde diese Aussage nicht erwähnt. 86 5. Zusammenfassung In Rahmen dieser Arbeit wurden die Methoden des mentalen Trainings im Bezug auf die Musik, sowohl der Verlauf des Übens im Flow diskutiert. Dabei wurden sowohl die Definition des Mentalen Trainings und des Flows, als auch die Geschichte beider Übungsarten mittels Veröffentlichungen dargestellt. In diesem Zusammenhang wurden die Methode von Margit Varró als „erste“ Erscheinung des mentalen Übens, die Methode von Karl Leimer und Walter Gieseking, das einzigartige MentaltrainingSystem von Tatjana Orloff-Tschekorsky, die außerordentliche Ansicht von Ulrike Klees-Dacheneder im Bezug auf die Verwendungsart des mentalen Trainings, die „weiterentwickelte“ Orloff-Methode von Renate Klöppel und Linda Langeheine und die im Grunde genommen auf Leimers Methode gebaute Anwendungsart der Technik von Christian A. Pohl dargelegt. Um den Mechanismus des musikalischen Gedächtnisses und des musikalischen Lernens zu verstehen, wurden die psychologischen und neurophysiologischen Grundlagen des Gedächtnisses dargestellt. In dessen Rahmen wurde eine Übersicht sowohl über die Veränderungen der neuronalen Netzwerke des Gehirns beim Erlernen des „Musizierens“ als auch über die Veränderungen der Hirnstruktur durch intensives und langjähriges Üben geboten. Die Erfassung des Themas „Mentales Training“ erschwert die Vielfältigkeit der Auslegung des Begriffes und die unterschiedlichen Anwendungsarten der Methode. Die unterschiedlichen Begriffserklärungen der Autoren im Bezug auf die Musik wurden im zweiten Kapitel ausführlich diskutiert. Diese Abweichungen erscheinen ebenso in den Untersuchungen über die Effektivität der Methode, in denen diese Vielfältigkeit in den meisten Fällen die Beurteilung des Resultates und dessen Gegenüberstellung verhindert. Die zunehmende Zahl der musikbezogenen Untersuchungen zeigt das steigende Interesse an der Methode Mentales Training, die immer im mehreren Bereichen der Wissenschaften auftreten. Im Bereich der Musikpsychologie wurden Untersuchungen über die Effektivität des mentalen Trainings seit den dreißiger Jahren durchgeführt. 87 Die präsentierten Ergebnisse der Studien wurden chronologisch auch aus der verschiedenen Bereichen der Wissenschaften dargestellt, die nach dem Erachten der Autorin einander unterstützen könnten. Dazu gehören zum Beispiel die neurophysiologischen Untersuchungen und dessen Resultate, die ein Feedback über die Beherrschung der erforschten Art der Technik und den Grad des Vorstellungsvermögens bieten könnten. Obwohl in der allgemeinen Geschichte der Methode Mentales Training schon mehrere Metaanalyse über die Ergebnisse der Studien vorhanden sind(Feltz & Landers 1983., Driskell et al. 1994.), es fehlt noch eine im Bereich der musikbezogenen Untersuchungen, die aber wegen der zunehmenden Zahl der Untersuchungen einen Überblick über die Resultate bieten könnte. Die Definition des Flows und die Prinzipien des Übens im Flow wurden im dritten Kapitel beschrieben. Die Grundlagen der Methode Üben im Flow entstanden aus der Wurzel der Flow-Erfahrung nach Csíkszentmihályi Mihály, die Andreas Burzik auf den Bereich der Musik übertrug. Die Methode hilft, ein bewusstes und anstrengungsloses Körpergefühl zu erreichen, wobei immer die Konzentration auf die Aufgabe und auf den Körper im Vordergrund steht. Dieses Verfahren hilft den Zustand des Glückgefühls zu erreichen, in den die Menschen geraten, wenn sie in einer Tätigkeit vollkommen aufgehen. Bislang wurde die Effektivität dieser Methode unzureichend erforscht, nur über das Erleben des Flows sind verfügbare aber nicht zahlreiche Erkenntnisse, in der Arbeit bekanntgemacht wurden vorhanden. Da die Arbeit die Methode im Kontext des Gitarrenspiels betrachten wollte, wurden in dem letzten Kapitel wurden sowohl die instrumentspezifischen Erfahrungen als auch die aufgetauchten Schwierigkeiten der Autorin dargelegt. In dessen Rahmen wurde zu beiden Übungsarten auch eine persönliche Stellungnahme geäußert. 88 6. Literaturverzeichnis Altenmüller, E. (2006.) Hirnpsychologische Grundlagen des Übens. in: Mahlert, U. (hrsg.) Handbuch Üben: Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden u. a. Breitkopf und Härtel S. 47 – 65. Bangert, M., & Altenmüller, E. (2003a.) Mapping Perception to Action in Piano Practice: a Longitudinal DC-EEG Study. BMC Neuroscience, 4, S. 26 – 36. Bangert, M., & Altenmüller, E. (2003b.) Funktionelle und dysfunktionelle Plastizität bei Musikern. Musikphysiologie und Musikermedizin 10. Jg., Nr. 3. S. 131 – 147. Bird, E. I. & Wilson. E. V. (1984.) The Effects of Physical Practice upon PsychoPhysiological Response During Mental Rehearsal of Novice Conductors. Journal of Mental Imagery 12 (1988): 51- 63. Burzik, A. (2006.) Üben im Flow: Eine ganzheitliche körperorientierte Übemethode. in: Mahlert, U. (hrsg.) Handbuch Üben: Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden u. a., Breitkopf und Härtel S. 265. – 284. Coffman, D.D. (1990.) Effects of mental practice, physical practice, and knowledge of results on piano performance. Journal of Research in Music Education 38, S. 187 – 196. Csíkszentmihályi M. (1997.) Flow. Az Áramlat. Budapest, Akadémiai Kiadó S. 83. – 106. Csíkszentmihályi M. (2008.) A fejlődés útjai. A harmadik évezred pszichológiája. Budapest, Nyitott Könyvműhely S. 231. – 232. Driskell, J. E., Copper, C., Moran, A. (1994.) Does Mental Practice Enhance Performance? Journal of Applied Psychology 79. (4) S. 481 – 492. 89 Eberspächer, H. (2008.) Gut sein, wenn's drauf ankommt: Erfolg durch mentales Training. 2. überarbeitete Auflage, München, Carl Hanser Verlag S. 74. Feltz, D. L., Landers, D. M. (1983.) The effects of mental practice on motor skill learning and performance: A meta-analysis. Journal of Sportpsychology 5. S. 25 – 57. Frauscher, C. (2003.) Psychologische Grundlagen des mentalen Bewegungslernens im Instrumentalspiel. Wien, Univ. für Musik u. darst. Kunst, Dipl.-Arb. Gieseking, W. (1963.) So wurde ich Pianist. Wiesbaden, Brockhaus S. 94. Gutzwiller, J. (2008.) Mentales Training mit Studierenden – ein gesundheitserhaltendes Angebot? Luzern, Hochschule Luzern Musik, Ein Projekt am Institut F&E. http://www.hslu.ch/m-mentaltrainingschlussbericht.pdf Haslinger, B., Erhard, P., Altenmüller, E., Schroeder, U., Boecker, H., CeballosBaumann, A. O. (2005.) Transmodal sensorimotor networks during action observation in professonal pianists. Journal of Cognitive Neuroscience 17, S. 282 – 293. Hund-Georgiadis, M. und Yves von Cramon, D. (1999.) Motor-learning-related changes in piano players and non-musicians revealed by functional magneticresonance signals. Experimental Brain Research 125, S. 417 – 425. Leimer, K., Gieseking, W., (1931.) Modernes Klavierspiel: Mit Ergänzung Rhytmik, Dynamik, Pedal. Mainz u. a., Schott Karni, A., Meyer, G., Jezzard, P., Adams, M. M., Turner, R., Ungerleider, L. G. (1995.) Functional MRI evidence for adult motor cortex plasticity during motor skill learning. Nature 377, S. 155 – 158. 90 Klees-Dacheneder, U. und a Campo, Anne C. (1994.) Mentales Training in der Musik: Wie man als Musiker Stress vermeiden und dadurch seine künstlerische Leistung steigern kann. Üben und Musiziren Band 6. Mainz, Schott S. 3 – 9. Klöppel, R. (1993.) Die Kunst des Musizierens: von den physiologischen und psychologischen Grundlagen zur Praxis. Mainz u. a., Schott Klöppel, R. (1996.) Mentales Training für Musiker: Leichter lernen – sicherer auftreten. Kassel, Gustav Bosse Verlag Klöppel R. (1999.) Das Gesundheitsbuch für Musiker: Anatomie, berufsspezifische Erkrankungen, Prävention und Therapie. Kassel, Gustav Bosse Verlag Kopiez R. (1991.) Das Erlernen eines Musikstücks – aber wie? Die Effektivität verschiedener Übemethoden in Wechselwirkung mit der individuellen Wahrnehmungsorganisation. in: Kraemer Rudolf-Dieter (Hrsg.) Musiklehrer. Beruf, Berufsbild, Berufsverlauf. Musikpädagogische Forschung Bd. 12. Essen, Die Blaue Eule S. 165 – 174. Langeheine, L. (1996.) Üben mit Köpfchen: Mentales Training für Musiker. Frankfurt am Main, Musikverlag Zimmermann Mahlert, U. (hrsg.) (2006.) Handbuch Üben: Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden u. a., Breitkopf und Härtel S. 9. Mihalec, G. (2006.) A nyugodt élet titkai: Gyors és hatékony ellazulás progresszív izomrelaxációval. Budapest, Új Platinus Könyvesház Kft. Orloff-Tschekorsky, T. (1996.) Mentales Training in der musikalischen Ausbildung. Aarau, Musikedition Nepomuk Pohl, Christian A. (2006.) Mentales Üben.. in: Mahlert, U. (hrsg.) Handbuch Üben: Grundlagen, Konzepte, Methoden. Wiesbaden u. a., Breitkopf und Härtel S. 287 – 311. 91 Repp, B. H. (1999.) Control of expressive and metronomic timing in pianist. in: Journal of motor Behavior 31, S. 145 – 167. Repp, B. H. (2001a.) Effects of Music Perception and Imagery on Sensorimotor Shynchronization with Complex Timing Patterns. in: Zatorre, R. J. & Peretz, I. (hrsg.) The Biological Foundation of Music, Annals of the New York Academy of Sciences 930. S. 409. – 411. Repp, B. H. (2001b.) Expressive timing in the mind’s ear. in: Godoy, R. I. & Jorgensen, H. (hrsg.) Musical Imagery, Lisse, The Netherlands: Swets & Zeitlinger, S. 185 – 200. Ross, Stewart L. (1985) The Effectiveness of Mental Practice in Improving the Performance of College Trombonists. in: Journal of Research in Music Education 33, S. 221 – 230. Scheler-Moster, G. (2004.) Neurophysiologische Korrelate beim mentalen Training motorischer Bewegungen: Ein Vergleich zwischen professionellen Musikern und Amateuren. Mainz, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Dissertation Seel, Norbert M. (2003.) Psychologie des Lernens: Lehrbuch für Pädagogen und Psychologen. München, Ernst Reinhardt Verlag Theiler, Anne M. & Lippman, Louis G. (1995.) Effects of Mental Practice and Modeling on Guitar and Vocal Performance. The Journal of general psychology 122 (4), S. 329 – 349. Thoma, E. (2007). Flow-Erleben beim Klavierspielen. Unveröffentlichte Diplomarbeit, Technische Universität Braunschweig. in: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Referat Bildungsforschung (hrsg.) Pauken mit Trompeten: Lassen sich Lernstrategien, Lernmotivation und soziale Kompetenzen durch Musikunterricht fördern. Bonn u. a., Bildungsforschung Bd. 32. S. 80 – 82. 92 Varró, M. (1929.) Der lebendige Klavierunterricht : seine Methodik und Psychologie. Hamburg u. a., Simrock Verlag 93