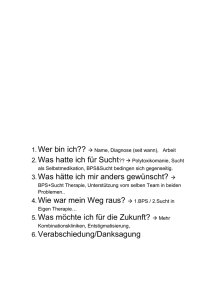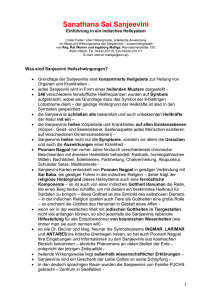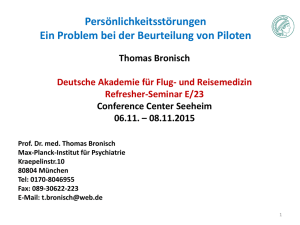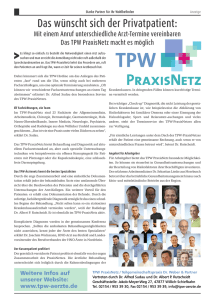7 Borderline-Persönlichkeitsstörung – Diagnostik, Epidemiologie
Werbung
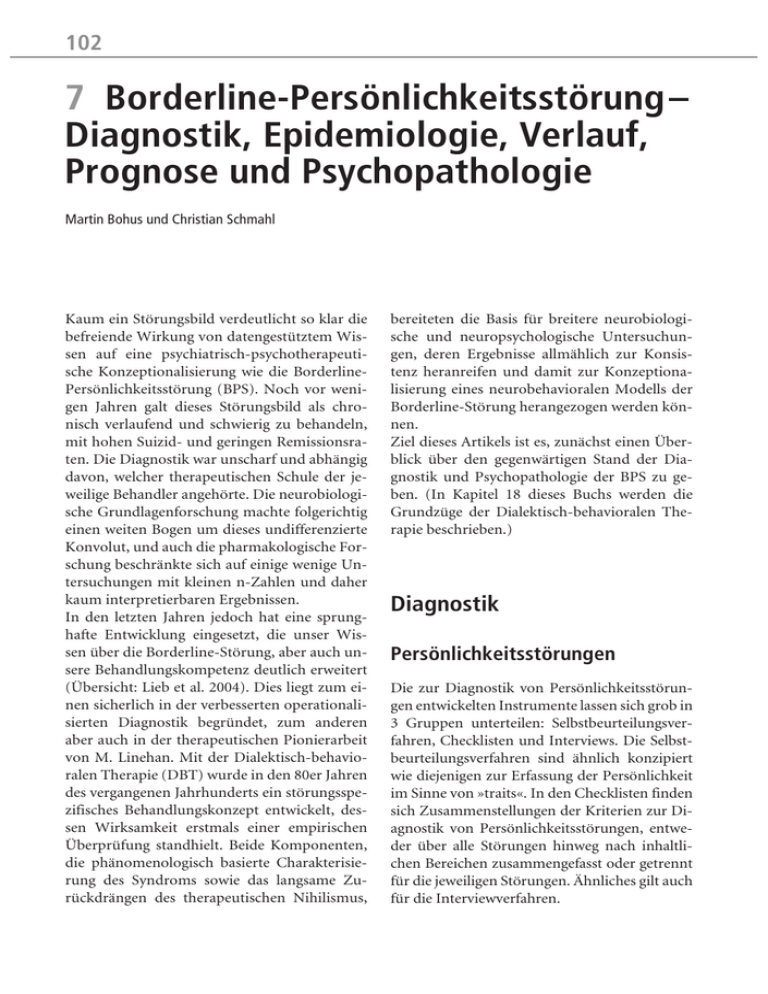
102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 7 Borderline-Persönlichkeitsstörung – Diagnostik, Epidemiologie, Verlauf, Prognose und Psychopathologie Martin Bohus und Christian Schmahl Kaum ein Störungsbild verdeutlicht so klar die befreiende Wirkung von datengestütztem Wissen auf eine psychiatrisch-psychotherapeutische Konzeptionalisierung wie die BorderlinePersönlichkeitsstörung (BPS). Noch vor wenigen Jahren galt dieses Störungsbild als chronisch verlaufend und schwierig zu behandeln, mit hohen Suizid- und geringen Remissionsraten. Die Diagnostik war unscharf und abhängig davon, welcher therapeutischen Schule der jeweilige Behandler angehörte. Die neurobiologische Grundlagenforschung machte folgerichtig einen weiten Bogen um dieses undifferenzierte Konvolut, und auch die pharmakologische Forschung beschränkte sich auf einige wenige Untersuchungen mit kleinen n-Zahlen und daher kaum interpretierbaren Ergebnissen. In den letzten Jahren jedoch hat eine sprunghafte Entwicklung eingesetzt, die unser Wissen über die Borderline-Störung, aber auch unsere Behandlungskompetenz deutlich erweitert (Übersicht: Lieb et al. 2004). Dies liegt zum einen sicherlich in der verbesserten operationalisierten Diagnostik begründet, zum anderen aber auch in der therapeutischen Pionierarbeit von M. Linehan. Mit der Dialektisch-behavioralen Therapie (DBT) wurde in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ein störungsspezifisches Behandlungskonzept entwickelt, dessen Wirksamkeit erstmals einer empirischen Überprüfung standhielt. Beide Komponenten, die phänomenologisch basierte Charakterisierung des Syndroms sowie das langsame Zurückdrängen des therapeutischen Nihilismus, Schattauer, Frau Rieble, Remmel „Bewegungstherapie“, MS bereiteten die Basis für breitere neurobiologische und neuropsychologische Untersuchungen, deren Ergebnisse allmählich zur Konsistenz heranreifen und damit zur Konzeptionalisierung eines neurobehavioralen Modells der Borderline-Störung herangezogen werden können. Ziel dieses Artikels ist es, zunächst einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Diagnostik und Psychopathologie der BPS zu geben. (In Kapitel 18 dieses Buchs werden die Grundzüge der Dialektisch-behavioralen Therapie beschrieben.) Diagnostik Persönlichkeitsstörungen Die zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen entwickelten Instrumente lassen sich grob in 3 Gruppen unterteilen: Selbstbeurteilungsverfahren, Checklisten und Interviews. Die Selbstbeurteilungsverfahren sind ähnlich konzipiert wie diejenigen zur Erfassung der Persönlichkeit im Sinne von »traits«. In den Checklisten finden sich Zusammenstellungen der Kriterien zur Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen, entweder über alle Störungen hinweg nach inhaltlichen Bereichen zusammengefasst oder getrennt für die jeweiligen Störungen. Ähnliches gilt auch für die Interviewverfahren. 103 Diagnostik Alle 3 Verfahrensgruppen lassen sich weiterhin dadurch unterscheiden, inwieweit sie versuchen, alle Störungen oder nur bestimmte Subgruppen eines Klassifikationssystems zu erfassen (z. B. Borderline-Störungen). Ein weiteres Unterscheidungskriterium betrifft die konzeptuelle Grundlage. Die meisten Verfahren orientieren sich an ICD-10 oder DSM-III-R/DSM-IV bzw. versuchen, die Störungen in Bezug auf beide Systeme abzubilden (sog. polydiagnostisches Vorgehen). Nur wenige Verfahren basieren auf eigenen theoretischen Annahmen. Selbstbeurteilungsverfahren führen eher zu einer falsch positiven Diagnose und sind daher auch primär im Sinne von Screening-Instrumenten zu betrachten. Um den aufwändigen Prozess der Informationserhebung zu vereinfachen, haben Interviews wie das SKID-II und das IPDE dem diagnostischen Prozess zusätzliche Screening-Bögen vorgeschaltet. Interviewverfahren führen zwar zu einer höheren Zuverlässigkeit der Erfassung, setzen jedoch ein umfassendes Training voraus und sind zudem oft sehr zeitaufwändig, was die Durchführung betrifft (bis zu mehreren Stunden). Checklisten nehmen hier eine Zwischenstellung ein, sind auch in der klinischen Routine einsetzbar, erfordern jedoch gründliche Kenntnisse der jeweils zugrunde liegenden Klassifikationssysteme sowie umfangreiche klinische Erfahrung. Die meisten Checklisten beziehen sich auf die im DSM-IV und in der ICD-10 enthaltenen Störungen. Generell kann gegenwärtig das IPDE als das elaborierteste Instrumentarium für die Diagnostik von Persönlichkeitsstörungen angesehen werden. Es besteht aus einem ICD-10- und einem DSM-IV-Modul, ermöglicht neben einer kategorialen Diagnostik auch eine dimensionale Beschreibung der Patienten und ist das offizielle Instrument der WHO für Persönlichkeitsstörungen (Loranger et al. 1999). In der Forschung werden vermutlich in Zukunft diejenigen Verfahren Anwendung finden, die Diagnosen sowohl nach ICD-10 als auch nach DSM-IV erlauben. Zurzeit kann jedoch kein Instrument als Goldstandard angesehen Schattauer, Frau Rieble, Remmel „Bewegungstherapie“, MS werden, wenngleich das SKID-II und das IPDE vor allem im deutschsprachigen Bereich am häufigsten eingesetzt werden. Borderline-Persönlichkeitsstörung Wie bereits ausgeführt, gilt auch für die Diagnostik der Borderline-Störung derzeit das IPDE (International Personality Disorder Examination; Loranger et al. 1999) als Instrument der Wahl. Es integriert die Kriterien des DSMIV und der ICD-10. Die Interrater- und TestRetest-Reliabilität ist gut und deutlich höher als für unstrukturierte klinische Interviews (z. B. k = 0,68 bis 0,96 für Interrater-Reliabilität). Alternativen sind das von M. Zanarini entwickelte Diagnostic Interview for DSM-IV Personality Disorders (DIPD-IV; Zanarini et al. 1996) und das Structured Interview for DSM-IV Personality (SIDP; Pfohl et al. 1997). Zusätzlich zu diesen allgemeinen Instrumenten wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Verfahren spezifisch zur Diagnostik und Schweregraderfassung der Borderline-Störung entwickelt. Lange Zeit galt das Diagnostic Interview for BPD-Revised Version (DIB-R; Gunderson u. Zanarini 1992; Zanarini et al. 1989) als Standardinstrument. Da es nicht DSM-basiert ist, verliert es jedoch zunehmend an Bedeutung. Dies gilt auch für Instrumente wie das Schedule for Interviewing Borderlines (SIB; Baron 1981), die Borderline Personality Disorder Scale (BPDS; Perry 1982) und das Structural Interview von Kernberg (Kernberg 1977). Diese Instrumente wurden primär zur kategorialen Diagnostik der BPS entwickelt. Instrumente zur Quantifizierung der Symptomatik, das heißt zur Schweregradbestimmung, kamen erst in jüngster Zeit auf den Markt: M. Zanarini publizierte eine DSM-basierte Fremdrating-Skala (ZAN-SCALE), die ausreichende psychometrische Kennwerte aufweist (Zanarini 2003). Arntz und Mitarbeiter entwickelten den Borderline Personality Disorder Severity Index (BPDSI; Arntz et al. 2003) und veröffentlichten erste 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 7 Borderline – Diagnostik, Epidemiologie, Verlauf, Prognose und Psychopathologie Prä-post-Messungen. Bohus und Mitarbeiter entwickelten die Borderline-Symptom-Liste (BSL; Bohus et al. 2001) als 90-Item-Selbstrating-Instrument. Die psychometrischen Kennwerte sind sehr gut, dies betrifft auch die Veränderungssensitivität. Das Instrument liegt mittlerweile auch als 17-Item-Kurzfassung vor. Als Leitlinie für die Diagnostik im klinischen Alltag kann folgender Algorithmus empfohlen werden: • Leitsymptom: einschießende intensive aversive Anspannung • operationalisierte Diagnostik: Diagnostisches Interview für DSM-IV Persönlichkeitsstörungen (DIPD-IV) oder IPDE (Borderline-Segment) • Schweregradeinteilung: BSL (ZAN-Skala) • Komorbidität: SKID-I Die Erfahrung von rasch einschießenden, manchmal lange anhaltenden intensiven Erfahrungen von äußerst unangenehmer innerer Anspannung ist pathognomonisch für das Störungsbild der BPS (Stiglmayr et al. 2001, 2005b). Da diese Symptomatik auch relativ trennscharf von anderen psychiatrischen Störungen diskriminiert (Stiglmayr et al. 2005a), kann dieses Phänomen als Indikator für affektive Instabilität und Irritabilität im Sinne eines Leitsymptoms herangezogen werden. Da die Komorbidität bei der Borderline-Störung Verlauf und Prognose, damit aber auch die Therapieplanung, erheblich beeinflusst, ist deren vollständige Erfassung mithilfe eines operationalisierenden Instruments dringend anzuraten. Epidemiologie Die Punktprävalenz der Borderline-Persönlichkeitsstörung, also die Häufigkeit der Störung zu einem definierten Zeitpunkt in der Allgemeinbevölkerung, wird mit Zahlen zwischen 0,8 und 2% angegeben (Übersicht: Stone 2000). Meri- Schattauer, Frau Rieble, Remmel „Bewegungstherapie“, MS kangas und Weissman (1986) schätzen die Prävalenz der Borderline-Persönlichkeitsstörung in Bevölkerungsstudien vor 1980 auf 1,7 bis 2%. 1990 führten Swartz et al. (1990) an 1541 Einwohnern in der Gegend der Duke University in North Carolina eine DSM-III-basierte Studie durch und fanden eine Prävalenz von 1,8%. Die Arbeitsgruppe untersuchte Personen zwischen 18 und 55 Jahren, also die Altersspanne, in der sich die BPS primär manifestiert, sodass die Prävalenz in der Gesamtbevölkerung geringer ausfallen dürfte. Auch Reich et al. (1989) ermittelten in einer Studie an 235 Einwohnern eine Prävalenz von 2,1%, wobei die Fallzahl sicherlich zu niedrig ist, um repräsentative Aussagen machen zu können. Eine Untersuchung von Maier et al. (1992), die in der BRD auf DSM-IIIR-Basis durchgeführt wurde, erfasste eine Stichprobe von 447 Personen und ihren Verwandten aus zufällig ausgewählten Familien und fand eine Prävalenzrate für BPS von 1,2%. Eine groß angelegte epidemiologische Feldstudie in Norwegen findet eine Punktprävalenz von 0,8% (Torgersen et al. 2001). Über 80% dieser Betroffenen befinden sich in psychiatrischer bzw. psychotherapeutischer Behandlung. Etwa 70% der Betroffenen sind Frauen. Auch diese Zahl ist sicherlich kritisch zu interpretieren, da die Untersuchungen zur Geschlechterprävalenz an Personen durchgeführt wurden, die sich bereits in psychiatrischer/psychotherapeutischer Behandlung befanden. Differenzialdiagnose und Komorbidität Gegenwärtig liegen 15 Studien vor, die zeitgleich Achse-I- und Achse-II-Störungen des DSM-III-R mittels operationalisierter Messinstrumente erfassten. Die methodisch sorgfältigste mit nach DIB-R und DSM-III-R diagnostizierten Borderline-Persönlichkeitsstörungen fand retrospektiv im Langzeitverlauf bei 96% der Patienten eine depressive Erkrankung. 105 Psychopathologie 88,5% litten an Angststörungen, 64% an Substanzmissbrauch oder -abhängigkeit und 53% an einer zusätzlichen Ess-Störung. Im Langzeitverlauf zeigt sich, dass mit Remission der Borderline-Störung sich auch die komorbide Achse-I-Symptomatik deutlich zurückbildet (Zanarini et al. 2003). Eine Ausnahme bilden die dysthymen Störungen. Die Bedeutung komorbider Achse-I-Diagnosen lässt sich daran ermessen, dass sich komorbider Alkohol- und Drogenmissbrauch als wichtigster Prädiktor für eine Chronifizierung der BPS errechnen lässt, gefolgt von komorbider Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS), depressiven Störungen und Ess-Störungen. Die Komorbidität mit Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis ist mit 1% äußerst selten. Wie die meisten spezifischen Persönlichkeitsstörungen auch, erfüllen Borderline-Patienten häufig zeitgleich die Kriterien für andere Persönlichkeitsstörungen. Im Vordergrund stehen dabei folgende: • Dependente Persönlichkeitsstörungen (50%) • Ängstlich-vermeidende Persönlichkeitsstörungen (40%) • Passiv-aggressive Persönlichkeitsstörungen (25%) • Paranoide Persönlichkeitsstörungen (ca. 40%) • Antisoziale Persönlichkeitsstörungen (25%) • Histrionische Persönlichkeitsstörungen (15%) Deutliche Geschlechterunterschiede zeigen sich vor allem bei der komorbiden Paranoiden Persönlichkeitsstörung (signifikant häufiger bei Männern) (Zanarini et al. 1998b). Verlauf und Prognose Alter von 14 Jahren Verhaltensauffälligkeiten (Ess-Störung, Selbstschädigung, Suizidversuche, Auffälligkeiten des Sozialverhaltens, affektive Störung), die einer stationären Behandlung bedurften, während eine zweite Gruppe im Mittel mit 24 Jahren erstmals stationär behandelt wurde. In retrospektiven Analysen unserer Arbeitsgruppe gaben etwa 30% der untersuchten erwachsenen Borderline-Patientinnen an, sich bereits im Grundschulalter intendierte Selbstverletzungen zugefügt zu haben. Die Suizidrate der BPS liegt bei 5 bis 10% (Frances et al. 1986). Als Risikofaktoren für vollendete Suizide werden impulsive Handlungsmuster, höheres Lebensalter, Depressionen, komorbide antisoziale Persönlichkeitsstörung sowie frühkindlicher Missbrauch benannt. Auch Selbstverletzungen gelten als Risikofaktor für vollendete Suizide. 2 Studien (Grilo et al. 2004; Zanarini et al. 2003) konnten zeigen, dass 6-Jahres-Katamnesen bzw. 2-Jahres-Katamnesen (bei Grilo et al.) überraschend hohe Remissionsraten (basierend auf DSM-IV-Kriterien) aufweisen. So erfüllen 2 Jahre nach der Diagnose nur noch 60% der Betroffenen die DSM-IV-Kriterien, nach 4 Jahren 50% und nach 6 Jahren noch 33%. Die Rückfallraten sind mit jeweils 6% sehr gering. Während die affektive Instabilität persistiert, scheinen sich insbesondere dysfunktionale Verhaltensmuster wie Selbstverletzungen und Suizidversuche deutlich zu reduzieren. Psychopathologie Neurobehaviorales Entstehungsmodell Psychosoziale Komponenten Umstritten ist das durchschnittliche Alter bei Erstmanifestation. Eigene Untersuchungen (Jerschke et al. 1998) fanden eine bimodale Verteilung: Eine große Gruppe zeigte bereits im Schattauer, Frau Rieble, Remmel „Bewegungstherapie“, MS Neben den zentralen Risikofaktoren (weibliche Sozialisation und frühe Erfahrung von Gewalt und Vernachlässigung) scheint das Fehlen der zweiten Bezugsperson von Bedeutung zu sein, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 7 Borderline – Diagnostik, Epidemiologie, Verlauf, Prognose und Psychopathologie also einer Schutz und Sicherheit gewährenden Person, die insbesondere die Wahrnehmung der Betroffenen teilt und deren Emotionen bestätigen könnte. Trotz der hohen Missbrauchsrate (etwa 60% weiblicher Patienten mit BPS berichten über sexuelle Gewalterfahrung in der Kindheit), ist der kausale Zusammenhang zwischen erlebter Traumatisierung und Entwicklung einer BPS sicherlich nicht geklärt. Genetische Komponenten Für die Gesamtheit der Persönlichkeitsstörungen liegen seit Mitte der 90er Jahre Befunde aus Zwillingsstudien vor, die den Nachweis eines starken genetischen Einflusses erbringen (Konkordanzraten bei eineiigen Zwillingen: ca. 55%, bei zweieiigen: ca. 14%). Bis auf eine Studie (Torgersen et al. 2000) haben alle jedoch primär Verhaltens- und Erlebensdispositionen untersucht (z. B. Beziehungsverhalten, affektive Labilität, Zwanghaftigkeit) (Livesley et al. 1998). Die Autoren dieser Studien verfolgen also ein dimensionales Modell, das heißt, sie gehen von einem Kontinuum zwischen Persönlichkeitszügen und Persönlichkeitsstörung aus. Diese Zwillingsstudien weisen auf eine Beteiligung von 3 empirisch nachweisbaren Varianzquellen hin (genetische, umweltbezogene und individuumspezifische), wobei bei der Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen nichtgenetische individuumspezifische Einflüsse am stärksten zu sein scheinen (Übersicht: Maier et al. 2000). Schon die Ergebnisse der frühen Arbeiten von Livesley, die eine genetische Disposition für Verhaltens- und Erlebenskomponenten, wie affektive Labilität, Identitätsprobleme, Narzissmus und Impulsivität bei gesunden Zwillingspaaren fanden, weisen auf die Bedeutung hereditärer Faktoren bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung hin. Die einzige Zwillingsstudie, welche Konkordanzraten von monozygoten mit bizygoten Zwillingen vergleicht, von denen ein Zwilling manifest eine nach DSM-IV diagnostizierte Persönlichkeitsstörung aufweist, wurde im November 2000 veröffentlicht (Torgersen et al. 2000). Sie zeigt eine er- Schattauer, Frau Rieble, Remmel „Bewegungstherapie“, MS hebliche genetische Bedeutung bei allen nach DSM-IV diagnostizierten Persönlichkeitsstörungen. Für BPS erklären genetische Faktoren ca. 69% der Varianz. Die Ergebnisse dieser Studie sind sicherlich vorsichtig zu interpretieren, da die Komorbidität der untersuchten Populationen nicht berücksichtigt wurde. Wie oben ausgeführt, erfüllen über 90% aller Patienten mit BPS die diagnostischen Kriterien für mindestens eine weitere Persönlichkeitsstörung, sodass die hohe genetische Varianz eventuell alleine durch komorbide andere Persönlichkeitsstörungen erklärt werden könnte. Gesichert scheint jedoch die Bedeutung genetischer Faktoren für die Entwicklung dissoziativer Symptomatik (bis zu 55% der Varianz). Störungen der Affektregulation Autoren wie Coid und Linehan postulierten schon früh eine erhöhte Sensitivität gegenüber emotionalen Reizen, eine verstärkte emotionale Auslenkung und eine Verzögerung des Rückganges der Aktivierung auf das Ausgangsniveau. Diese Hypothesen basierten jedoch zunächst ausschließlich auf klinischer Beobachtung. S. Herpertz veröffentlichte 1997 (Herpertz et al. 1997) eine erste Arbeit, die auf experimenteller Ebene die affektive Instabilität bei dieser Patientengruppe belegen konnte. Die Autoren konnten nachweisen, dass Patientinnen mit BPS im Vergleich zu Kontrollpersonen auf das Vorlesen einer emotional belastenden Kurzgeschichte (»Die Eisbären« von Marie-Luise Kaschnitz) signifikant häufiger angaben, intensive Emotionen zu erleben. Auch Kemperman et al. (1997) hatten bereits beschrieben, dass Selbstschädigungen von Borderline-Patientinnen häufig eingesetzt werden, um undifferenzierte intensive aversive Anspannungszustände zu beenden. Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe (Stiglmayr et al. 2001, 2005b) konnten zeigen, dass Patientinnen mit BPS im Vergleich zu gesunden Kontrollen signifikant häufiger, länger und intensiver aversive Anspannung erleben, jedoch Schwierigkeiten haben, dabei Emotionen zu differenzieren. Psychopathologie In den letzten Jahren wurde damit begonnen, die funktionelle und topographische Anatomie von Hirnarealen bei BPS zu untersuchen, denen eine Bedeutung für die Induktion und Regulation von Affekten zugemessen wird. So spielen limbische, paralimbische und neokortikale frontale Strukturen eine zentrale Rolle für emotionale, motivationale, kognitive und motorische Verarbeitungsprozesse. Auch die Fähigkeit zur sozialen und emotionalen Selbstregulation wird dem Zusammenwirken spezifischer frontaler und limbischer Areale zugesprochen. Mittlerweile zeigen neuere Forschungsergebnisse, dass nicht nur Substanzschädigungen frontaler oder limbischer Strukturen gravierende Persönlichkeitsveränderungen verursachen, sondern dass auch chronischer Stress oder erhebliche Verwahrlosungserlebnisse in der Kindheit zu einer Beeinträchtigung neurobiologischer Reifungsprozesse und damit zu assoziierten kognitiven und emotionalen Störungen führen können. So ergaben experimentelle Untersuchungen an Tieren unter unkontrollierbarem Stress Hinweise auf funktionale und strukturelle neuronale Veränderungen im limbischen System. Am besten untersucht ist derzeit die Auswirkung von Glukokortikoid-Hyperexpression oder artifizieller Glukokortikoid-Exposition auf eine Schädigung und Volumenminderung hippocampaler Strukturen. Mehrere unabhängige Arbeitsgruppen konnten eine Störung der zentralen Stressregulation bei BPS-Patientinnen auf endokrinologischer Ebene nachweisen. Sowohl unter experimentellen Stressinduktions-Paradigmen als auch auf dem freien Feld zeigten sich Überaktivitäten der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-(HHN-) Achse (Lieb et al. 2004, Rinne et al. 2002). Aufgrund von Tiermodellen gilt als gesichert, dass die Erfahrung von frühem, unkontrollierbarem Stress Auswirkungen auf die adulte CRH-Sekretion hat. Da bei der Pathogenese der BPS frühe Gewalterfahrungen und unkontrollierbarer Stress eine Schattauer, Frau Rieble, Remmel „Bewegungstherapie“, MS 107 zentrale Rolle spielen, kann zumindest im Analogieschluss eine traumabedingte Störung der HHN-Achse angenommen werden. Es wird diskutiert, inwieweit die im MRT nachgewiesenen hippocampalen Volumenreduktionen auf eine früh einsetzende oder chronisch persistierende Kortisol-Hypersekretion zurückzuführen sind. Erste klinische Studien belegen die Bedeutung des Lebensalters zum Zeitpunkt der Traumatisierung. Da die Hirnentwicklung über die Pubertät bis weit in die Adoleszenz hineinreicht, wird in Zukunft die Rolle von vulnerablen Entwicklungsphasen für die Generierung traumaassoziierter Persönlichkeitsveränderungen neu diskutiert werden müssen. Derzeit liegen Studien bei Patienten mit BPS vor, die Hinweise auf metabolische Veränderungen im präfrontalen Kortex fanden (Übersicht: Kap. 11). Strukturelle MRI-Untersuchungen kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen, wobei die methodisch ausgereifteste Studie von Driessen et al. (2000) eine Volumenreduktion des Hippocampus bei Patienten mit BPS gegenüber gesunden Kontrollen um 16% findet. Auch das Volumen der Amygdala ist um 8% verkleinert. Diese Befunde decken sich mit den Ergebnissen von anderen Arbeitsgruppen, die ebenfalls Volumenreduktionen dieser Hirnareale bei Patienten mit chronischer Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) fanden. Sicherlich kann aus diesen Befunden kein kausaler Zusammenhang zwischen biografischer Stress- oder Trauma-Erfahrung und morphologischen Veränderungen des ZNS gezogen werden. Auch die Abgrenzung gegenüber anderen psychiatrischen Störungsbildern, wie etwa Major Depression, bei der ebenfalls Volumenreduktionen der Hippocampi gefunden wurden, ist noch nicht gesichert. Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe mittels MR-Spektroskopie fanden eine Reduktion von N-Acetyl-Aspartat (NAA) bei Patientinnen mit BPS im dorsolateralen präfrontalen Kortex um 19% gegenüber gesunden Kontrollen. NAA gilt als Indikator für Störungen der zellulären Integrität (Tebartz van Elst et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 7 Borderline – Diagnostik, Epidemiologie, Verlauf, Prognose und Psychopathologie al. 2001). Dem frontalen Kortex wird eine wichtige Rolle bei der Regulation der Amygdala sowie bei der Kontrolle von konditionierten Furchtreaktionen zugewiesen. So kann auch dieser Befund als Hinweis auf morphologische oder funktionelle neuroanatomische Störungen der Affektregulation interpretiert werden. Dissoziative Phänomene Manche Autoren unterscheiden zwischen so genannten psychologischen dissoziativen Phänomenen, wie Derealisation und Depersonalisation, und somatoformen Phänomenen, wie Analgesie, Verlust der Kontrolle über die Willkürmotorik, Veränderung der kinästhetischen Wahrnehmung, der Optik oder Akustik. Mehrere Studien unterschiedlicher Arbeitsgruppen konvergieren dahingehend, dass ca. 65% aller Patienten mit Borderline-Störung unter schwerwiegender, das heißt klinisch relevanter dissoziativer Symptomatik leiden. Zanarini et al. (1997) konnten weiterhin nachweisen, dass die dissoziative Symptomatik bei Patienten mit BPS hoch korreliert mit Selbstschädigung, häufigen Klinikaufenthalten und niedriger sozialer Integration. Untersuchungen unserer Arbeitsgruppe (Stiglmayr et al. 2001, 2005b) ergaben eine hochsignifikante Korrelation zwischen aversiven Anspannungsphänomenen und dissoziativer Symptomatik bei Patientinnen mit BPS. Es kann also zumindest vermutet werden, dass diese Symptomatik durch intrapsychischen Stress getriggert wird. Dafür spricht auch die klinische Erfahrung, dass Clonidin, ein zentral wirksames Sympathikolytikum, die akute dissoziative Symptomatik bei Patientinnen mit BPS reduziert (Phillipsen et al. 2004). Andererseits kann, wie bereits ausgeführt, als gesichert gelten, dass die Entwicklung dissoziativer Symptome zumindest einer genetischen Teildetermination unterliegt. Der Einfluss dissoziativer Phänomene auf psychosoziale Lernprozesse ist bislang nicht untersucht. Es darf jedoch vermutet werden, dass sowohl extrem hohe Anspannungsphänomene als Schattauer, Frau Rieble, Remmel „Bewegungstherapie“, MS auch dissoziative Phänomene die Lernkapazität von traumatisierten Patienten erheblich behindern. Das hieße, die Fähigkeit, neue Erfahrungen zu machen und diese mit alten Erfahrungsmustern zu verknüpfen, ist erheblich beeinträchtigt (Störung des kontextabhängigen Lernens). Dies wiederum, so darf hypothetisch angenommen werden, manifestiert sich in scheinbar irreversiblen dysfunktionalen Grundannahmen, die häufig widersprüchlich, das heißt schlecht kompatibel sind und daher ihrerseits zur Labilisierung der Affektregulation beitragen. Wie immer, wenn dysfunktionale Schemata emotional stark aufgeladen prozessiert werden, sind eine situationsadäquate Interpretation der Realität sowie entsprechende Handlungsentwürfe erschwert. Zur Entwicklung von dysfunktionalen Strategien zur Problemlösung ist es nur ein kleiner Schritt. Da diese kurzfristig oft als sehr wirksam erlebt werden, sind sie trotz langfristig resultierender psychosozialer Problematik nur schwer zu revidieren. Störungen der Körperakzeptanz und der Schmerzwahrnehmung Störungen der Körperwahrnehmung und der Körperakzeptanz imponieren bereits in der klinischen Praxis. Patientinnen berichten über Schwierigkeiten, sich im Spiegel zu betrachten, über Scham und Ekelgefühle, wenn sie an ihren Körper denken, bis hin zu ausgeprägten Störungen der Wahrnehmung peripherer Körperareale. Über die Hälfte einer repräsentativen Stichprobe von 400 Borderline-Patientinnen gibt an, ihren Körper »so, wie er jetzt ist«, intensiv abzulehnen (Bohus et al., in Vorb.). Viele erleben den Körper als weitgehend getrennt von sich selbst. Hinzu kommt in aller Regel eine ausgeprägte Angst vor körperlichen Berührungen. Das Ausmaß dieser Attributionsstörungen konnte in einer Arbeit von Haaf et al. (2001) erstmals operationalisiert werden. Unter Verwendung der Frankfurter Körperkonzeptskalen (Deusinger 1998) wurden die Körperkonzepte von 47 Patientinnen mit BPS verglichen mit ei-