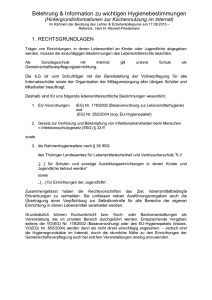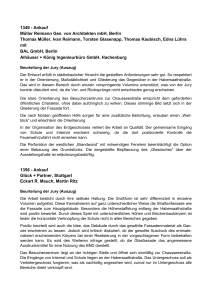Internationale Beziehungen
Werbung
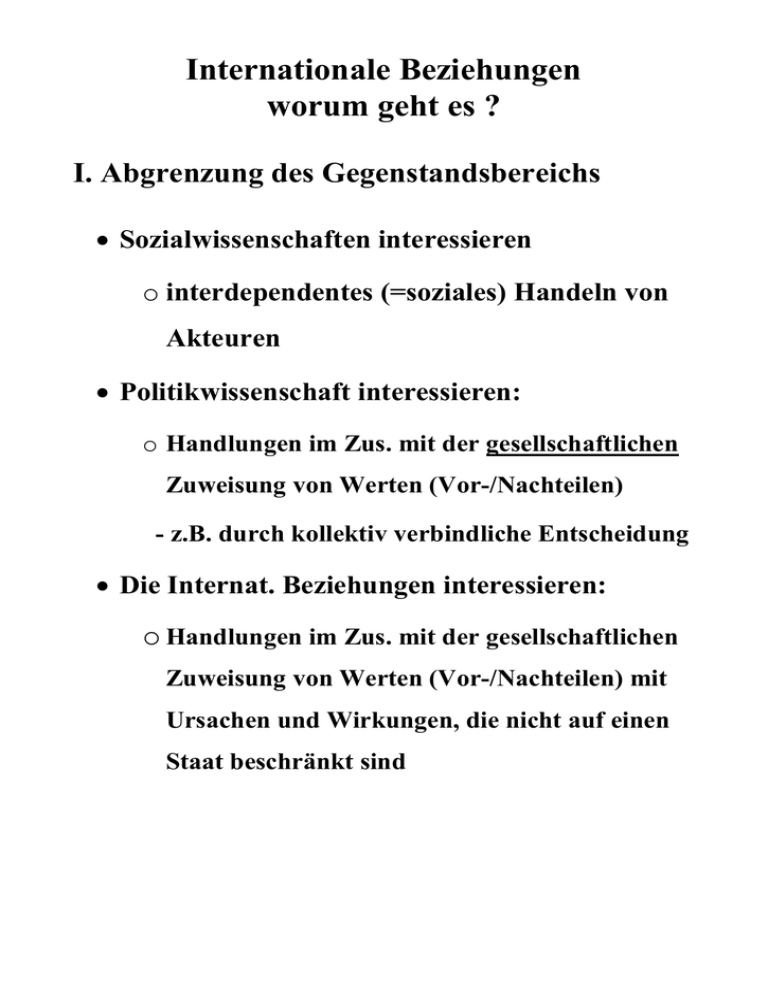
Internationale Beziehungen
worum geht es ?
I. Abgrenzung des Gegenstandsbereichs
Sozialwissenschaften interessieren
o interdependentes (=soziales) Handeln von
Akteuren
Politikwissenschaft interessieren:
o Handlungen im Zus. mit der gesellschaftlichen
Zuweisung von Werten (Vor-/Nachteilen)
- z.B. durch kollektiv verbindliche Entscheidung
Die Internat. Beziehungen interessieren:
o Handlungen im Zus. mit der gesellschaftlichen
Zuweisung von Werten (Vor-/Nachteilen) mit
Ursachen und Wirkungen, die nicht auf einen
Staat beschränkt sind
zentrale Kategorien:
Akteure,
o Staaten
o nicht-staatliche Organisationen,
Unternehmen, multinationale Konzerne
o sub-staatliche Einheiten (z.B. Länder,
Ministerien, Zentralbanken)
o ggf. Einzelpersonen
o Internationale Organisationen
Handlungen
o realwirksames Handeln
o Kommunikationshandeln (z.B. in
Verhandlungen)
o Voraussetzungen einer Handlung
o Prozeß der Entscheidung über eine
Handlung
o Folgen von Handlungen (z.B. als
Grundlage für weiteres Handeln)
Interaktion (Beziehung zwischen Einzelhandlungen), z.B.
o Handlungsabfolgen (pfadabhängige
Prozesse)
o Interdependenzen (z.B. Dilemmata)
o Einflußbeziehung zw. Akteuren
o Beeinflussung von Handlungen (z.B. durch
Aufbau v. Institutionen)
II. Was zeichnet die internationale Politik aus?
1. Staatliche Souveränität als grundlegendes
Organisationsprinzip des internat. Systems
Souveränität nach innen:
Organisationshoheit im Inneren
Einmischungsverbot
Ausnahme: Menschenrechte
Souveränität nach außen:
Anerkennung von Staaten als
gleichberechtigte Akteure
(Grundsatz: ein Land - eine Stimme)
Souveränitätsprinzip umfaßt nicht:
gleiche Handlungschancen für alle
Staaten
Monopol der staatlicher Handlungschancen gegenüber anderen Akteuren
Folgen des Souveränitätsprinzips:
konstituiert Staaten als zentrale Akteure
privilegiert Staaten gegenüber anderen
Akteuren (z.B. internat. Verhandlungen)
veranlaßt Völker zur Selbstorganisation
in Staaten
wirkt als Bestandsschutz für instabile
Staaten (z.B. Somalia)
2. Die horizontale Struktur ('Anarchie') des
internat. Systems
Einheiten (Staaten) auf derselben Ebene
keine durchsetzungsfähig Kollektivinstanz
Macht/Einfluß dezentral verteilt
(fortwährender Kampf ums Überleben ?)
politisch/rechtliche Entscheidungen nur im
Konsens
dagegen moderne Staaten:
durchsetzungsfähige kollektive Instanz
nicht-konsensuale politische/rechtliche
Entscheidungen möglich
=> hierarchisch strukturiert
=> Dichotomie von Staat und internationalem
System ist:
erkenntnisfördernd durch idealtypische
Überhöhung
aber keine genaue Wirklichkeitsbeschreibung
Staat tatsächlich nicht so handlungsfähig
internat. System nicht nur an Selbsthilfe
orientiert
=> 'Anarchie des internat. Systems
bedeutet nicht Unordnung/Chaos/Krieg
sondern Fehlen einer durchsetzungsfähigen
Ordnungsinstanz
III. Einige zentrale Fragenkomplexe der IB
Krieg und Frieden (Sicherheitsproblem)
o Unter welchen Bedingungen entsteht Krieg,
wann Frieden ?
o Warum führen Demokratien
gegeneinander keine Kriege ?
o Warum war das bipolare System der
Nachkriegszeit trotz Rüstung so stabil ?
o Was folgt nach dem Ende des Ost-West
Konfliktes?
Internationale Wirtschaftsbeziehungen
o Welche folgen hat die "Globalisierung"
auf innerstaatliches Handeln ?
auf das Verhältnis der Industriestaaten
untereinander?
auf die Entwicklungsländer ?
auf die Entwicklung der Europäischen
Union?
Internationale Umweltprobleme
o Unter welchen Bedingungen lassen sich
internat. Umweltprobleme erfolgreich
bearbeiten ?
o Welche Rolle spielen internat. Institutionen
dabei ?
IV. Wissenschaftliche Analyse in den IB
Beschreibung eines Phänomens
z.B. Fallstudien
seltener: statistische Datenauswertung
Typologisierung von Fällen
Erklärung eines Phänomens aufgrund
allgemeiner Zusammenhänge
Suche nach Kausalmechanismen
Suche nach allgemeingültigen
Zusammenhängen
=>Bedarf für Theorien und Analysekonzepte
Reduktion von Komplexität (was ist
wichtig, was kann ausgeblendet werden ?)
Ableitung und Testen von Hypothesen
Ablauf der Vorlesung
Näheres: web.uni-bamberg.de/sowi/ipo
Benutzername: ba6ip99; Password: london
17. Okt. 2005: Internationale Beziehungen: Worum
geht es ?
I. 'Regieren' im internationalen System
24. Okt. 2005: Steuerungsbedarf jenseits des Nationalstaates und internationale Institutionen
Verträge, Organisationen und 'Regime'
31. Okt. 2005: Kooperationsprobleme I
07. Nov. 2005: Kooperationsprobleme II
14. Nov. 2005: fällt aus (Dies Academicus)
21. Nov. 2005: Förderung internationaler Kooperation
durch das Setzen institutioneller Steuerungsanreize
II. Europäische Integration
28. Nov. 2005: Die zentralen Integrationsschritte
05. Dez. 2005: Der 'supranationale' Entscheidungsapparat als Spezifikum der Union
12. Dez. 2005: Welche Rolle spielen die Mitgliedstaaten
in der Europäischen Union ? Der integrationstheoretische Intergouvernementalismus
19. Dez. 2005: Die Eigendynamik des Integrationsprozesses: Der Neofunktionalismus
III. Außenpolitik
9. Jan. 2006: Zentrale Merkmale der deutschen
Außenpolitik
16. Jan. 2006: Das internationale System als
Bestimmungsfaktor für außenpolitische
Entscheidungen
23. Jan. 2006: Das Ebenenproblem und innerstaatliche
Bestimmungsfaktoren außenpolitischer
Entscheidungen
30. Jan. 2006: „Politische Kultur“ als Bestimmungsfaktor außenpolitischer Entscheidungen
06. Feb. 2006: Klausur

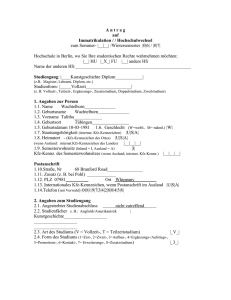
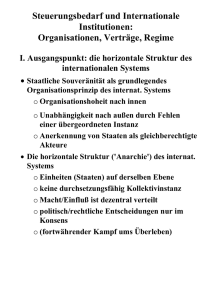
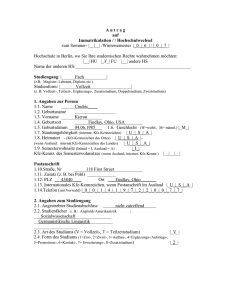
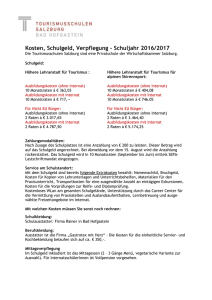
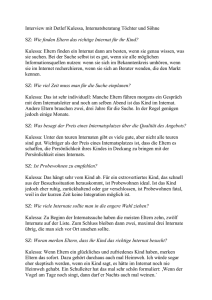

![Zeit [min] - Umwelt.Wissen](http://s1.studylibde.com/store/data/003359789_1-dad3090bddf1def4d3e9b08938488ff9-300x300.png)