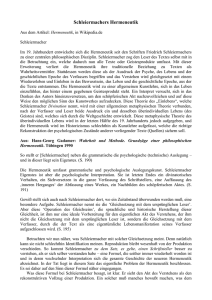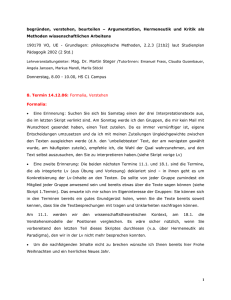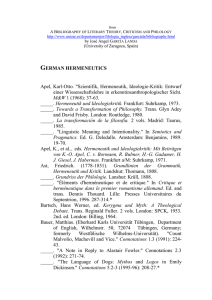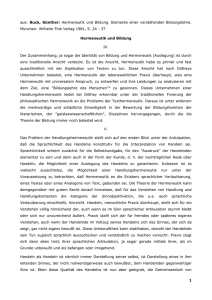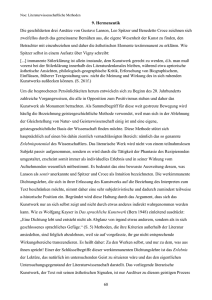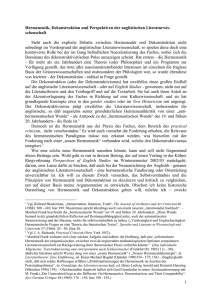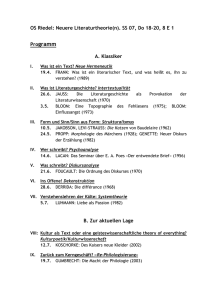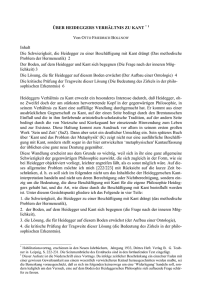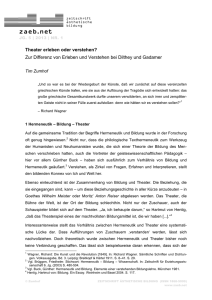Der Raum des Lesens
Werbung
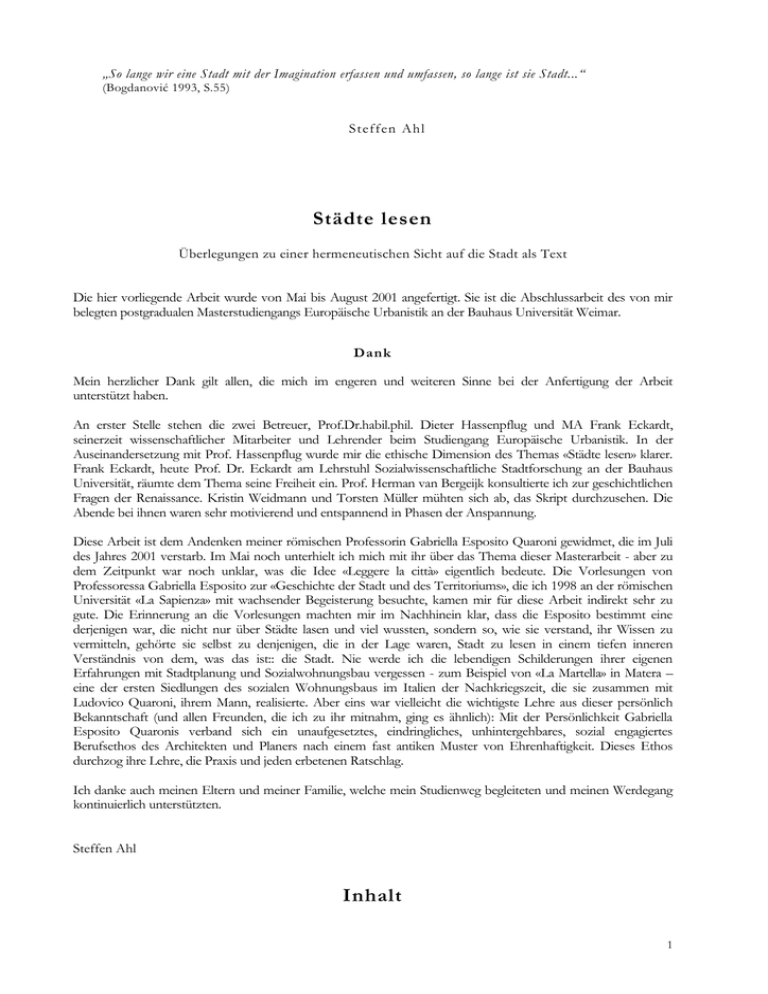
„So lange wir eine Stadt mit der Imagination erfassen und umfassen, so lange ist sie Stadt...“ (Bogdanović 1993, S.55) Steffen Ahl Städte lesen Überlegungen zu einer hermeneutischen Sicht auf die Stadt als Text Die hier vorliegende Arbeit wurde von Mai bis August 2001 angefertigt. Sie ist die Abschlussarbeit des von mir belegten postgradualen Masterstudiengangs Europäische Urbanistik an der Bauhaus Universität Weimar. Dank Mein herzlicher Dank gilt allen, die mich im engeren und weiteren Sinne bei der Anfertigung der Arbeit unterstützt haben. An erster Stelle stehen die zwei Betreuer, Prof.Dr.habil.phil. Dieter Hassenpflug und MA Frank Eckardt, seinerzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter und Lehrender beim Studiengang Europäische Urbanistik. In der Auseinandersetzung mit Prof. Hassenpflug wurde mir die ethische Dimension des Themas «Städte lesen» klarer. Frank Eckardt, heute Prof. Dr. Eckardt am Lehrstuhl Sozialwissenschaftliche Stadtforschung an der Bauhaus Universität, räumte dem Thema seine Freiheit ein. Prof. Herman van Bergeijk konsultierte ich zur geschichtlichen Fragen der Renaissance. Kristin Weidmann und Torsten Müller mühten sich ab, das Skript durchzusehen. Die Abende bei ihnen waren sehr motivierend und entspannend in Phasen der Anspannung. Diese Arbeit ist dem Andenken meiner römischen Professorin Gabriella Esposito Quaroni gewidmet, die im Juli des Jahres 2001 verstarb. Im Mai noch unterhielt ich mich mit ihr über das Thema dieser Masterarbeit - aber zu dem Zeitpunkt war noch unklar, was die Idee «Leggere la città» eigentlich bedeute. Die Vorlesungen von Professoressa Gabriella Esposito zur «Geschichte der Stadt und des Territoriums», die ich 1998 an der römischen Universität «La Sapienza» mit wachsender Begeisterung besuchte, kamen mir für diese Arbeit indirekt sehr zu gute. Die Erinnerung an die Vorlesungen machten mir im Nachhinein klar, dass die Esposito bestimmt eine derjenigen war, die nicht nur über Städte lasen und viel wussten, sondern so, wie sie verstand, ihr Wissen zu vermitteln, gehörte sie selbst zu denjenigen, die in der Lage waren, Stadt zu lesen in einem tiefen inneren Verständnis von dem, was das ist:: die Stadt. Nie werde ich die lebendigen Schilderungen ihrer eigenen Erfahrungen mit Stadtplanung und Sozialwohnungsbau vergessen - zum Beispiel von «La Martella» in Matera – eine der ersten Siedlungen des sozialen Wohnungsbaus im Italien der Nachkriegszeit, die sie zusammen mit Ludovico Quaroni, ihrem Mann, realisierte. Aber eins war vielleicht die wichtigste Lehre aus dieser persönlich Bekanntschaft (und allen Freunden, die ich zu ihr mitnahm, ging es ähnlich): Mit der Persönlichkeit Gabriella Esposito Quaronis verband sich ein unaufgesetztes, eindringliches, unhintergehbares, sozial engagiertes Berufsethos des Architekten und Planers nach einem fast antiken Muster von Ehrenhaftigkeit. Dieses Ethos durchzog ihre Lehre, die Praxis und jeden erbetenen Ratschlag. Ich danke auch meinen Eltern und meiner Familie, welche mein Studienweg begleiteten und meinen Werdegang kontinuierlich unterstützten. Steffen Ahl Inhalt 1 Dank Seite 4 Ka p ite l I Ei nle itu ng I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 These und Fragestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Relevanz des Themas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Anschlussfähigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Methodiken und Umsetzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 Ka p ite l I I Der Raum des Lesens II.1 Die metaphysische Dimension des Raums . . . . . . . . . . . 1 0 II.2 Die ontologisch Dimension des Raums . . . . . . . . . . . . . 1 2 II.3 Die anthropologische Dimension des Raums . . . . . . . . . 1 3 Ka p ite l I I I Argumente des Lesens III.1 Gestalt und Ganzheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 III.2 Sinn und Verstehen .... .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . 1 8 Ka p ite l I V Das Lesen IV.1 Hermeneutik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 IV.2 Semiotik im Vergleich zur Hermeneutik . . . . . . . . . . . . 2 4 IV.3 Lektüre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 Ka p ite l V Städte schreiben und lesen V.1 V.2 V.3 V.4 Spekulation zum Verhältnis Welt-Stadt und Sprache-Text . 3 8 Zeit lesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 Raum lesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 Stadt lesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 Resümee Seite 58 Konsultierte Literatur Seite 59 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kapitel I 2 Einleitung I.1 These und Fragestellung Der industriellen Gesellschaft ist es bei aller Anstrengung nur mit großer Mühe und allgemein wenig gelungen, Stadtraum in komplexen Zusammenhängen zu begreifen und für die Menschen zu gestalten. Nicht nur in der Realität, sondern auch als Idee ist die Stadt als intaktes, ganzheitliches Gebilde verschwundenen (wie es in der Tat vielleicht allein die mittelalterliche Stadt gewesen sein mochte). An einer heute weitgehend wertfrei gewordenen Welt gibt es nichts mehr zu kritisieren und also im Hinblick auf eine Zukunft auch nichts tiefgründig zu gestalten. Unsere bürgerliche Gesellschaft ist keine Projektgesellschaft mehr und mithin die Stadt keine Konzept-Stadt (de Certeau 1988, S.182). Die Krise des Menschen stellt sich ungeschminkt dar und die bürgerliche Ideologie hält zum Verstehen dieser Existenz an, damit der Mensch seine Krise eigenverantwortlich meistere (Schreiter 1988, S.11). Die Stadt als seine figürlich-räumliche Lebenswelt hilft ihm dabei nur wenig. Stadtkritische Positionen sprechen von der Stadt als einer verloren gegangenen Utopie. Wie ist es da möglich, die alte Qualität der Stadt, Hort geistiger Imagines zu sein, neu zu beleben? In der Realität steht heute eine Minderzahl durchaus gestalteter öffentlicher Räume (die zumeist historische Räume sind) einer Mehrzahl minder gestalteter, ja überhaupt ungestaltbarer ZwischenRäume gegenüber. Die mangelnde Kapazität der Raumgestaltung geht einher mit einem abnehmenden Grad an Urbanität. Bereits die italienische Kunstströmung des Neorealismus der 1950er Jahre hatte den nicht mehr eindeutig begrenzten, verschwommen konturierten, ungestalteten und hauptsächlich leeren Raum als Lebensraum der Menschen in zweiten Hälfte der 20.Jahrhunderts filmisch entdeckt. Die Erfahrung von im Fordismus entstandenen öffentlichen Räumen drückt sich in der Grunderfahrung des Verlorenseins aus, wie der französische Anthropologe und Ethnologe Marc Augé zu Beginn der 1990er Jahre in seinem Buch «Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit» eindringlich darstellte. Dennoch: für das Zusammenleben und das schöpferische Zusammen-Tätigsein kennt der Mensch zur Stadt auch in Zukunft praktisch keine Alternative – und zwar die Stadt nicht nur als ökonomischökologischer Organismus, sondern vor allem als Ort von Sozialität und Humanismus. „Unter dem Maßstab ökonomisch-technischen Fortschritts mag der Begriff der Entwicklung einen eindeutigen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Sinn haben. Aber daß das nicht alles ist, b eginnt die heutige Welt gerade in den höchstentwickelten Ländern am meisten zu spüren.“ (Gadamer 1989, S.47) Die Sozialgeschichte der Stadt betrachtend, bleiben Städte - insbesondere die alten historischen Stadtkerne - nach wie vor die einzigen Verortungs- und Akkumulationsorte von Sinn für menschliches Sein (Wästberg 1999, S.74). Auch aus der Sicht der Nachhaltigkeit ist die Beherbergun g der Menschen in Städten anerkanntermaßen der in seiner Wirkung nachhaltigste aller Kompromisse. Die anhaltende Anziehung und Migration von Menschen in Städte (Hall 2000, S.29ff.) oder an deren Ränder spricht für das Zukunftsmodell der «Stadt», wenngleich als Siedlungslandschaft. Stadt kann global nicht ausgewichen werden, wenngleich sich seit Alexander Mitscherlichs 1965 erschienene Schrift über die «Unwirtlichkeit unserer Städte – eine Anstiftung zum Unfrieden» die Literatur der „öden Orte“ mehrt (vgl. Roth 1998). Für das Leben der Menschen in Städten spielt der Begriff der Urbanität nach wie vor eine zentrale Rolle. Ohne Inhalt ist der Urbanitätsbegriff eine reine Form, zu der hin alles drängt (Lefébvre 1990, S.128). Urbanität, unter der der Volkswirtschaftler und Soziologe Edgar Salin (1892-1974) die von der Stadtkultur geprägte Lebensform des Menschen verstand (Sieverts 1997, S.32), wird dieser Arbeit als überwiegend positiver Wert vorangestellt. Zu den positiven Eigenschaften des urbanen Charakters gehören ein gesundes Maß an permanenter Neugierde und geistiger Beweglichkeit, eine prinzipielle Weltoffenheit und Toleranz gegenüber dem Fremden, das ein Schlüsselthema in der Arbeit Georg Simmels (1858-1918) darstellte. Der in der Regel wache Verstand des urbanen Menschen bildet sich überhaupt erst im ständigen Wechselverhältnis von Rezeption aller in der Stadt auf ihn einströmenden Reize bei gleichzeitiger Reaktion auf sie. Simmel hat neben einigen negativen Eigenschaften – darunter die Blasiertheit - diese typischen Charaktereigenschaften des Großstädters herausgearbeitet und erklärt, wie sie ihr Profil gewannen (Simmel 1995, 119f.). Neben dem persönlichen Umfeld ist das städtische die zweite Sozialisationsmaschine des Individuums. Wie kann der Einzelne aus dieser Hinsicht Stadt heute und künftig erfahren? 3 I.2 Relevanz des Themas „Aus vielen [...] Gründen müßten sich Städte lesen lassen und weise sein wie weise B ücher.“ (Bogdanović 1993, S.50) In dieser Arbeit geht es um die Untersuchung der theoretischen Möglichkeit einer ganzheitlichen Sicht auf die Stadt in ihrer Bedeutung als privilegierter Lebensraum des Menschen. Eine ganzheitliche Sicht kann dabei nicht anders vorgestellt werden, als in Form einer Imagination – eine Imagination wie ein Leitbild. Leitbilder dienen der Orientierung. Sie gehen von dem zukünftigen Vollkommenheitszustand eines Ganzen aus und vermögen der Entwicklung eine Richtung zu geben - wenngleich sie möglicherweise selbst unerreicht bleiben. Hier wird die Sicht auf ein städtisches Leitbild von hoher Komplexität imaginiert, das Aspekte von Irrationalität und Undurchschaubarkeit zurückgewinnt. An die Stelle des mit rationalen Mitteln Undurchschaubare wird das intuitiv Fühlbare als komplementäres Mittel des Erkenntnisgewinns über Stadt vorgestellt. Diese Arbeit schickt sich an, einer Idee nachzuspüren, die geeignet scheint, einen leitmotivischen, ganzheitlichen Blick auf die Stadt zu fö rdern: Es geht darum, die Stadt zu lesen. Der Begriff des «Lesens» steht hier für Interpretieren, Deuten, Begreifen und Verstehen. Meiner Meinung nach stellt ein geschichtsbezogenes, aufmerksames «Lesen» von physisch-räumlichen Kontingenzen sozialer Zusammenhänge in der Stadt einen wertvollen, wenn nicht gar einzigen Zugang zur Gesellschaft dar – einen Zugang, der die in der Moderne in die Krise geratene Stadtplanung und gestaltung künftig autorisieren könnte. Angesichts einer zunehmenden Materialisierung und Faktizität der in der Diskussion stehenden Stadt von heute sind Politiker, Unternehmer und Urbanis ten in ihrer Verantwortung für die Gestaltung der Stadt als fundamentales, humanistisches Gut und als Lebensraum herausgefordert. Bei der hier gemeinten, im einzelnen zu erläuternden und zu hinterfragenden Theorie des «Städtelesens» sollte es um die Sensibilisierung und Anregung besonders der raumkompetenten Akteure der Gesellschaft derart gehen, über eine ethische Haltung hinsichtlich der Stadt als Hort des Menschseins, nachzudenken. Es geht um die allgemeine Verantwortung des Städtebaus. In den Händen von Technokraten wäre diese Verantwortung schlecht aufgehoben, sondern besser in den Händen derjenigen, welche die personelle Fähigkeit rekultivieren, das jeweils Spezifische an einer Stadt und der Stadtgesellschaft lesend zu verstehen und so für den notwendig planerisch-gestalterischen Umgang mit der Stadt nutzbar zu machen. Der Schlüssen dazu liegt in der Vergangenheit der Stadt – in ihrer Geschichte. „Es geht eben nicht bloß um die Abschilderung der uns fremden Stadt. Sind wir auf der Spurensicherung in die Vergangenheit hinein doch auch immer uns selbst auf der Spur, und begegnet uns in dem, was uns ansichtig wird, eine fremde Welt, die uns nur in dem Maße verständlich wird, wie wir sie verstehen, wie wir mehr wissen und mehr sehen, als der plane Anblick uns freigibt.“ (Schlögel 2000, S.29) Architekt und Planer sind traditionell keine Intellektuellen. Sie sind keine Philosophen, sondern Pragmatiker. Sie sind deshalb auch traditionell auch nicht von Natur aus Leser, sondern denken in Bildern. Bilder erfassen immer nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Versuche der Rückgewinnung der Bildimagination von Stadträumen gab es in den 1970er Jahren mit Hilfe der Semiotik. Das war der Beginn des schwierigen Prozesses der Revision der funktionalistischen Stadtplanung der Nachkriegsmoderne. In den 1980er Jahren stützte sich dann die Bewegung der Postmoderne mit Nachdruck auf die Zeichenausdrücklichkeit des Inhalts baulich-architektonischer und städtebaulicher Formen. Heute gilt die Postmoderne bereits als überwunden. Das gewohnte Bild- und Elementdenken von Architektur- und Raumgestaltung befriedigt nicht mehr vollends. Aus dieser Erkenntnis resultieren gegenwärtig häufig unternommene Versuche, Bilder nachträglich zu vertexten. Ich halte das für keine echte Fortentwicklung. Meiner Meinung nach rührt die ganzheitliche Sicht auf die Stadt, in der die raumkompetenten Akteure heute und künftig gefragt sind, vornehmlich aus einer anderen, dem «Lesen» verwandten Praxis her. Die mit dem Thema Stadt umgehenden und verantwortlichen oder lediglich von einem persönlichen, kulturellen Erkenntnisinteresse an der Stadt geleiteten Menschen sollten jeder für sich den individuellen Gewinn erschließen, der daraus resultieren könnte, sich heute städtischen Zusammenhängen lesend anzunähern. 4 In der Nachmoderne muss für die problematischen Modelle der Moderne – wie Ästhetisierung, Spezialisierung und Funktionalisierung - über Ersatz nachgedacht werden, und zwar in der Hoffnung, letztendlich die sozialen Raumnachteile zu überwinden, wozu die bekannten Verfahren des symmetrischen Denkens nicht in der Lage ist. Ein zweckfreies, nachindustrielles «Lesen» nun halte ich für praktikabel, um die Mängel der Stadt intuitiv – also in dieser Mischung aus Wissen und Fühlen aufzuspüren. Es geht um die Wiederbelebung der alten kulturellen Begabung, Probleme zu «erfühlen» – zuerst als Mensch und dann als Professionist. Schelers «Verfehlungstheorie» folgend ist der praktisch größte Nutzen des Wissens beim Nachstreben nach Wissen als Selbstzweck garantiert (Sc heler 1977, S.4). Vorausgesetzt also, dass Stadt durch den Planer zunächst grundsätzlich zweckfrei gelesen und er dadurch sozusagen das Städtische auf sich selbst reflektiert versteht, tut sich dem Planer vermittels des Modells «Stadt» ein breiter kultureller Hintergrund auf, welcher ihm die Chance bietet, eine persönliche, moralisch-ethisch orientierte Haltung zu gewinnen, die er ohnehin notwendig für seine Berufstätigkeit benötigt. Die einer pragmatischen Planung vorhergehende, bewusste Zweckignoranz ist notwendig für die Schaffung eines neutralen Denkraums, in dem der Akteur sich seiner professionellen Haltung zunächst auf der menschlichen Ebene selbst vergewissern kann. Und erst aus diesem theoretischen Raum heraus gewinnt er die letztendlich notwendige, praktische Handlungsfähigkeit im Berufsleben. Könnte der Planer also zunächst zu einem intuitiven Leser der «Stadt als Text» werden, brächte ihm das den Kompetenzvorteil ein, als erster zu intuieren, wo die Stadt Mängel aufweist, denn an diesen Stellen würde die Kohärenz des Leseflusses ins Stocken geraten. Dort, wo sie ins Stocken gerät, könnte Planung schonend ansetzten. Und schließlich bietet das Verfahren die Möglichkeit der Überprüfung des realisierten Ergebnisses. Denn auch nach der Realisierung muss der soziale Erzähltext der Stadt fließen. „Texte müssen fließen. Die geballten Buchstaben, Sätze und Absätze müssen lückenlos aufeinanderfolgen. Die Textpartikel müssen in eine Wellenstruktur eingebaut werden. Es geht um Rhythmus, um einander überlagernde Ebenen von Rhythmus. [...] sie müssen alle zusammenschwingen. Texte müssen «stimmen» [...]. Nur wenn ein Text stimmt, kann er den Leser zustimmen oder nicht zustimmen lassen, ihn in Sympathie oder Antipathie schwingen lassen.“ (Flusser 1992 b, S.43) W o r u m e s i n d i e s e r A r b e i t n i c h t g e h e n k a n n , ist aufzuzeigen, wie man es denn nun praktisch macht, die Stadt zu lesen. Hier muss ich womöglich dahingehende Erwartungen des Lesers enttäuschen. Aus Gründen, die besonders im Abschnitt IV.3 betrachtet werden, kann es zum einen keine Anleitung für das Lesen geben – ebenso wenig für ein Buch wie für eine Stadt. Die Anleitungslosigkeit liegt in der Natur der Sache des Lesens. Zum andern würde eine Anleitung zum Lesen meinen gegenwärtigen, auf das Thema bezogenen Erkenntnisstand übersteigen und es wäre vermessen, darüber hinaus zu gehen. So konzentriert sich diese Arbeit auf die theoretische Umschreibung des Lesens, das Umkreisen seines Kerns ohne ihn zu treffen, dafür aber die Bedi ngungen wie ein Negativ streifend, die diesen positiven Kern konditionieren. Die Arbeit zieht es vor, das Umfeld in der Breite zu sondieren, anstatt in die Tiefe zu gehen. In die Tiefe des Kerns ginge meiner Meinung nach nur ein konkretes Stadtbeispiel. Ein konkretes Beispiel ist aber nicht Inhalt dieser Arbeit - es wäre ihre Fortsetzung. Als Entschädigung gibt es einige Beispiele wie Italo Calvino und Walter Benjamin imaginierte oder konkrete Städte lasen. An sie schließt ein Versuch an, besonders im Kapitel V allgemeine geschichtliche Zusammenhänge auf die Lesemetapher hin zu interpretieren. I.3 Hypothesen „Macht gegen die Übermacht der Welt besteht darin, in den Dingen nicht etwas von uns ganz und gar verschiedenes zu sehen, sondern das, was in emphatischer Sprache ein uns verwandtes, ve rborgenes Du sei.“ (Blumenberg 1983, S.274) Die These, Städte zu lesen, ist eine Metapher, denn im wörtlichen Sinne lesen kann man nur geschriebenen Text. Wir müssen aber zugeben, dass alles, was der Mensch schafft und also in eine relativ eigenständige Existenz entlässt, Anlass bietet, in einem metaphorischen Sinne gelesen zu werden. Die lesende Zurkenntnisnahme seiner Taten, Schöpfungen und Phänomene als Ausdruckswerke und Leistungen menschlichen Seins und Weltverhältnisses unter den jeweiligen gesellschaftlichen 5 Umständen einer Epoche ist eine positive Anerkenntnis von Kultur. Eine besondere Rolle, die Taten, Schöpfungen und Phänomene aufkommen zu lassen, festzuhalten sowie alle Teilzusammenhänge in einen umfassenden Zusammenhang zu überführen, kommt der Stadt zu. „Die Stadt ist eine Metapher, ein Abbild des Menschen, sie hat wie er ein Selbstbewusstsein, ein Gedächtnis und eine Kontinuität, die man lesen kann, in der Architektur, der Geschichte, in einem System aus Artefakten, in der Stimmung, die man in ihr verspürt.“ (Schürmann-Emanuely 2001) Die Metapher des Lesens ist an die ursprünglichere Metapher des Schreibens gebunden. Dadurch, dass alles menschliche Tun zusammenhängendes Tun ist, ist jede Handlung im übertragenen Sinne ein kulturgenetisches Formulieren, ein Schreiben, ein Einschreiben von Inhalten und Gedanken in den Ausdruck der Dinge, Räume und Phänomene. Menschliche Handlungen haben gebaute Städte wie einen Teppich gewoben, auf dem sich die europäischen Kulturen bis heute bewegen. Die Handlung en vergangener Generationen sind gewissermaßen in den Städten eingefroren. Jedes Tun und Schöpfen kann somit als ein Texten aufgefasst werden. Jede Eintragung, jedes Bau- oder Kunstwerk, jede Auslöschung oder Umformulierung in der realen Stadt komplettiert ihren kulturellen Text - selbst in seiner Lückenhaftigkeit. Raumproduktion ist die kulturelle, gesellschaftliche Praxis, und zwar in sofern sie Wirtschaft, Politik und Kultur in Kultur stadträumlich künstlerisch ausdrückt. Die Ausdrucksgestalt städtischer Räume und Phänomene sind der Gestaltausdruck der Gesellschaft. Die Stadt ist ein geschichtliches Kunst-Werk. „Die spezifische Geschichtlichkeit von Kunstwerken ist [...] eine solche, welche sich nicht in «Kunstgeschichte» sondern nur in Interpretation erschließt.“ (Benjamin 1974, S.889) Historisch übereinandergeschichtete Orte gleichen ineinandergeschriebenen Schichten (de Certeau 1988, S.306). Selbst die imaginierten, nicht gebauten Städte (die Utopien) sind feste B estandteile unseres kulturellen Seins – sie sind Nekropolen des Denkens und als solche zuweilen gegenwärtiger und interessanter als die Realität. In einem erweiterten Verständnis des Lesebegriffs ist jeder Zusammenhang, der auf menschliches Handeln zurückgeht, die Verortung einer Texttheorie (M üller 1990, S.187). Die zeitlich versetzte Wiederauferstehung der Inhalte durch eine spätere Lektüre ist in jedem Fall eine Wiedergeburt, die einen hohen Anteil an neu Geborenem enthält, denn zu den Eigenarten der retrospekiven Interpretation gehört es, das im Text Ungehörte und Ungeschriebene – also das Immaterielle - zu deuten (Honold 2000, S.27). Besonders diese Differenz der Nichtübereinstimmung ist es, welche die Städte auf alten Ansichtskarten von ihrem heutigen, realen Pendant so stark entfernt – und zwar zum Teil so weit, dass sie wie völlig verschiedene Städte scheinen. Für Italo Calvinos erfundene Stadt Maurilia trifft zu, ... „... daß zuweilen verschiedene Städte auf demselben Boden und mit demselben Namen aufeinander folgen, entstehen und vergehen ohne gegenseitige Mittelbarkeit. Manchmal bleiben auch die Namen der Einwohner und der Klang der Stimmen und sogar die Gesichtszüge die gleichen; doch die Götter, die unter den Namen und über den Orten thronen, sind wortlos gegangen, und an ihrer Stelle haben sich fremde Götter eingenistet. Unnütz zu fragen, ob sie besser oder schlechter sind als die alten, da es zwischen ihnen keinerlei Beziehung gibt, wie auch die alten Ansichtskarten nicht Maurilia darstellen, wie es war, sondern eine andere Stadt, die zufällig auch Maurilia hieß wie diese.“ (Calvino 2000, S.37) Im Industriezeitalter wurde diese Kohärenz vielfach aufgebrochen. Heute ist der Text der Stadt nicht mehr der überkommene Diskus von gestern, sondern die Weiterentwicklung des heutigen Diskurses ins Morgen. Der französische Kunsttheoretiker Michel de Certeau versteht die Vielfältigkeit der Aktivitäten der Textproduktion in den heute hochentwickelten Gesellschaften als Bestreben, die Gesellschaft selbst in Form eines Textes zu reproduzieren. Er behauptete, Fortschritt trage den Charakter von Schrift (de Certeau 1988, S.245). „... die Idee der Schaffung einer Gesellschaft durch ein Schrift-System [ist,] ständig mit der Überzeugung einhergegangen, daß die Öffentlichkeit mit mehr oder weniger Widerst and durch die (verbale oder ikonische) Schrift geformt wird, daß sie sich dem anpaßt, was sie aufnimmt, und daß sie durch den Text geprägt wird und wie der Text wird, den man ihr aufzwingt. Früher handelte es sich dabei um einen Schultext. Heute ist der Text die Gesellschaft selber. Er stellt sich in urbanistischer, industrieller, kommerzieller und televisiver Form dar.“ (de Certeau 1988, S.296) 6 Obwohl vom Menschen im Grunde nicht abzulösen, scheinen die Artikulations- und die Kommunikationsformen der Gesellschaft (Sprache und Schrift) wie vom Menschen externalisierte Komplexe, die ein Eigenleben führen, eigene Gesetzlichkeiten aufweisen, eigenen Regeln geho rchen Regeln, die sie selbst zum Teil erst in einer autopoietischen Zeugung hervorbringen. Die Prax is des Schreibens hat seit dem 16.Jahrhundert alle Bereiche des Lebens umorganisiert. Heute kann man besser und einfacher denn je scheinbar unzusammenhängende Sachen willkürlich zu begrifflichen Ordnungseinheiten künstlich, vielleicht computergestützt vertexten und so in neue Zusammenhänge bringen, deren Sinnerschließung zu völlig neuen Einsichten und Erkenntnissen führen. Aber nicht nur auf dem Gebiet der Erkenntnistheorie. Im Computerzeitalter haben Formeln und Formen die Bedeutung von Matrizes gewonnen, nach denen letztendlich auch materielle Gestalt erzeugt werden kann.I Diese Verwandlung läuft Gefahr, eine imperiale Sprache zu kreieren, die lebens- und stadtbestimmend Einzug hält und das Lesen verhindert. Mit der Produktion einer Sprache geht Macht einher – eine Macht, die früher das Bürgertum innehatte und heute die Technokraten – die Macht, Geschichte zu machen (de Certeau 1988, S.252f.). I.4 Anschlussfähigkeit „Es mag von den meisten Beteiligten heute für nichts als poetische Ausdrucksweise gehalt en werden, wenn wir Baudenkmäler, Einzelbauformen, Bildwerke höherer Art, kurz alles künstl erisch Geformte wie eine Sprache genommen wissen wollen, wenn wir sie wie Buchstaben, Worte, Sätze und Bücher der Schriftsprache als Versuch betrachten, höchst lebendige, für die Menschheit bedeutsame und in ihr wirksame geistige Wesen wahrnehmbar zu machen.“ (Andrae 1933, zit. in: Berndt 1978, S.65) Der französische Philosoph Paul Ricœur behauptet, man könne jegliche kulturelle Ausdruckszusammenhänge analog wie Texte lesen (Lessing 1999, S.29ff.). Seit ein paar Jahren wird die Textmetapher geradezu inflationär auf alle möglichen Erklärungszusammenhänge angewandt. Das kommt zum einen daher, dass die Lesemetapher den Menschen immer schon in einen gewissen apriorischen Schutz gestellt hat, das noch Übermächtige, Unerklärliche und Unerforschte (einschließlich unserer Rolle dabei und gleichzeitig von uns selber Abstand nehmend) zu bezwingen. Die Lesemetapher impliziert zum anderen im Vergleich zu anderen Metaphern ein hohes Maß an Offenheit, da sie eine bestimmte Sichtweise nicht vorgibt, sondern eine Auffassung als «mögliche Welt» erst im Zuge des Verstehens erschafft. Das macht sie so undogmatisch, a priori an Sachverhalte setzbar, vielseitig verfügbar und dadurch recht weit verbreitet. Die «Welt als Text» ist eine junge Metapher. Sie geht aus der weitaus älteren Metapher der «Welt als Buch» (vgl. Blumenberg 1999) zurück. Die Buchmetapher wurde von der Textmetapher abgelöst. Es scheint, dass die spätbürgerliche Philosophie geneigt ist, die Welt in Texte aufzulösen, denn sie „ging dazu über, soziale Handlungen nicht mehr analog zum Text, sondern als Text zu deuten“ (Schreiter 1988, S.12). Schritte auf dieser Entwicklungslinie sind die Theorie der Sprachspiele von Wittgenstei n und die Traumdeutung Siegmund Freuds. Seit der Traumdeutung wird vieles unterbewusst „gelesen“, da - mit Freudscher Optik getrachtet -, vieles plötzlich eine unterliegende Textur aufzuweisen scheint. Mittlerweile bieten Sprach-, Schrift-, Text- und Lesemetapher allgemein neue Zugänge zum Verständnis gesellschaftlicher Sachverhalte, die aus Subtexten, Überschreibungen, Wörtern, Lauten und Geräuschen etc. bestehen. Die Zusammenhänge zu lesen ist entwirrend und anschaulich. Die «Praxis des Lesens» ist zu einem sehr bildlich gesprochen Terminus geworden, der dem heutigen Erklärungsbedürfnis entgegenkommt, intellektuell und gleichermaßen künstlerisch zu sein. In der Postmoderne erneuern Text- und Lesemetapher den alten Wunsch der Menschen, sich ... „... in anderer Weise als der bloßen Wahrnehmung und [...] der exakten Vorhersehbarkeit ihrer Erscheinungen [...] im Aggregatzustand der Lesbarkeit als ein Ganzes von Natur, Leben und Geschichte sinnspendend [... zu, d.A.] erschließen.“ (Blumenberg 1983, S.10) Hier sei auf den tschechischen Kommunikations- und Medienwissenschaftler Vilém Flusser (1920-1991) verwiesen, der aus seiner phänomenologischen Betrachtung heraus einige Beiträge geliefert hat. (Siehe zum Beispiel: Flu sser, 1993 a.) I 7 Die Stadt erscheint in der Schrift gespiegelt. Das Lesen ist das dem Schreiben umgekehrte Verfahren. Auf sozio-räumliche Zusammenhänge übertragen, geht es beim Lesen darum, auf den Stadtraum in seiner heutigen Präsenz wie durch eine literarisch-geisteswissenschaftliche Brille zu blicken. Diese Brille gestattet, die in der Figur von Stadt und Raum ausgedrückte kultur- und zeitspezifische Praktika, welche zur Raumentstehung führten, interpretatorisch auszubreiten. Wie einige Versuche zeigen II, ist ein hermeneutischer Zugang zum «Phänomen Stadt» möglich und sinnvoll, um nicht unmittelbar erfassbare Inhalte zu entdecken - wie zum Beispiel das «Wesen» einer Ansiedlung. Die Untersuchung der Stadt als Bedeutungsträger, die jüngst in der Schweizer Schule thematisiert wird, will Stadt nicht beschreiben, messen, vergleichen, sondern interpretieren und verstehen. Verstanden wird nur das, was in irgendeiner Form gelesen und ausgelegt werden kann. „Die Interpretation, das heißt die Erzeugung von Bedeutung, besteht darin, das Beziehungssystem zu erkennen, welchem das untersuchte Objekt angehört.“ (Corboz 2001, S.58) Einem solchen Interpretieren geht es praktisch um das Aufheben, Bewahren und Überliefern. Es stellt sich der These, nach welcher die kultureinschreibende Texturierung städtischer Bereiche in ihrer Subsummierung unter die Gesamtstadt zur Entstehung eines Metatextes führt – eines Metatextes, der zwar an die konkrete Materialität der Stadt gebunden ist, aber über die Realität hinausweist; darin ist er Schrif twerken ganz ähnlich. In ihrer Metatextualität ruht die autopoietische Veranlagung der Stadt, da (parallel zur Sprache) ein Metatext selbst ein Text ist. Früher bestand ein solcher Metatext in der metaphysischen Aura, dem Ruf oder dem Bild einer Stadt wie das der Legende nach untergegangene Vineta. Heute erleben wir nur noch den schwachen Abglanz einer dezimierten Autopoiesis - das Image. Das Interpretieren von Stadt hat sich verändert, denn allgemein hat sich das Lesen verändert. Es ist aggressiver geworden. Es wird heute weniger metaphorisch und viel wörtlicher genommen. Text ist heute kaum hermeneutisch, sondern eher semiotisch gemeint. Die Metapher «Städtelesen» ist eine vordergründig poetische und in ihrer künstlerischen Verwendung freie Metapher geworden. Anstatt wie in klassischen Beispielen passiv, ist der Stadttext zu einem aktiven Text geworden, der sich den Einwohnern einschärft und sie erzieht (Bollerey 2001, S.366). Michel de Certeau äußert sich überzeugt von einer solchen Art der Textgleichheit und Lesbarkeit von Stadt (de Certeau 1988, S.179). Der erste, explizite Leser von Stadt war der Flaneur. Ganz am Ende dieser Arbeit wird seine Praxis des Lesens untersucht und verglichen. Im Verständnis der Certeaus hat die Stadt lesen heute nichts mehr mit dem klassischen Flanieren zu tun. Wenn sich de Certeau vorstellt, vom obersten Stock des World Trade Centers auf das sich unter ihm ausbreitende Manhattan zu schauen, scheint sich ihm die Stadt so in ein Textgewebe zu verwandeln, das eine Fiktion heraufbeschwört, welche ihrerseits der Stadt-Text-Leser erst erschafft. Der Flaneur hat in diesem Sinne nichts erschafft. Diesen neuen Text hingegen stellt sich de Certeau vor als ein kakophones, lautes, monotones Rauschen von Tausend Schreibmaschinen, Verkehrszeichen, Leuchtreklamen und Videowänden. „Die Netze dieser vorausschreitenden und sich überkreuzenden «Schriften» bilden ohne Autor oder Zuschauer eine vielfältige Geschichte“ (de Certeau 1988, S.182). Das ist die Einstellung eines Künstlers, eines real gewordenen Ikarus, Poeten und Mystikers, der den Blick absichtsvoll, um der Kunst willen verfremdet. „Sie verwandelt die Welt, die einen behexte und von der man «besessen» war, in einen Text, den man vor sich unter den Augen hat. Sie erlaubt es, diesen Text zu lesen, ein Sonnenauge oder Blick Gottes zu sein [...] Ausschließlich dieser Blickpunkt zu sein, das ist die Fiktion des Wissens.“ (de Certeau 1988, S.180) Unseren Zwecken der Untersuchung mag diese Einstellung weniger dienlich sein. Es interessiert uns hier eher „a gentle way of reading“ (Bollerey 2001, S.362ff.) – ein Lesen also, bei dem der Leser sein Maß an Passivität bewahrt, wie deas Hüten einer Tradition. Die häufig wiedergegebenen Zitate von Bogdan Bogdanović sprechen die Sprache eins solchen, sanften Lesers. Dieser Leser nähert sich kontemplativ der Autorität des Lesestoffes an – ein Text, der einfach immer schon da ist und darauf wartet, gelesen zu werden. Walter Benjamin verfuhr nach diesem Grundsatz. Er hob in seinen «Denkbildern» Schätze, die seit Urzeiten wie auf dem Grund des jeweiligen Phänomens zu schlummern scheinen (vgl.: Benjamin, 1974). Eine akribische Empirie würde diese Schätze nicht zu „illuminiertem“ Bewusstsein fördern – dies kann nur die Schau der Traumseite der Phänomene leisten (Hassenpflug 2001). Die aktuelle Diskussion um eine aggressivere Textmetapher hingegen ist keineswegs gering zu schätzen. Auch wenn sie nur wenig gemein hat mit der Art des hier favorisierten, schauenden «Lesens», Der Architekturprofessor an der Belgrader Universität und spätere Bürgermeister von Belgrad Bogdan Bogdanović „... lehrte das Stadtlesen, denn nur wer stadtlesen kann, kann schlußendlich auch stadtschreiben.“ (Schürmann-Emanuely, 2001). Siehe auch: Chtouris (u.a.) 1993, S.55ff.: „Das Athener Grundstück und die hermeneutische Frage“ etc. II 8 bereichert sie den Diskurs um die heute gültigen und allgemein praktizierten Leseerfahrungen von Wirklichkeit. Beim auf diese Weise entstandenen, gegenwärtigen Nachdenken über die Eigenmächtigkeit von Texten und über das, was man als «auf die objektive Realität gerichtetes Verständnis» bezeichnet, haben die neuen Aspekte der Betrachtung auch in den Diskurs der Hermeneutik Einzug gehalten. Die Arbeiten der in dieser Arbeit zum Teil mehrfach zitierten Persönlichkeiten wie Roland Bartes (1974), André Corboz (2001), Michel Butor (1992), aber auch Wim Wenders’, Hans -Magnus Enzensberger und andere gehen den Weg eines neuen, generativen Textverständnisses der menschlichen Realität. Ohne die modernen Tendenzen zu ignorieren, wird hier jedoch auf ein Verstehen fokussiert, das nicht im Künstler seinen Ursprung hat, sondern im Wesen der Dinge – in ihrer Seele. Diese Seele ist es, die in einem inneren Monolog des sanften Leser traumwandlerisch und treffsicher ans Licht gehoben wird. Ein Verstehen in diesem Sinne ist kein Verstehenmachen-Wollen, sondern ein Vorverstehen, denn es verlässt die Kontingenzen der objektbezogenen Wahrheit nicht. Dennoch wird es notwendigerweise vom Leser subjektiviert – ein entscheidendes Moment, ohne das Verstehen nicht abläuft. Und wenn es gelingt, ist es dem Anschein einer höheren Eingebung nicht fern. „Als wahr empfinden wir die blitzartigen Erkenntnisse, die mit der Kraft der Intuition ins Wesen [...] einer Frage hineinleuchten und nicht die strengen, begrifflichen, wissenschaftlichen Feststellungen.“ (Lukács 1973, zit. in: Jung 1990, S.166) In einer solchen Haltung habe ich das Thema «Städte lesen» wie folgt strukturiert: I.5 Methodik und Umsetzung K a p i t e l I I D e r R a u m d e s L e s e n s . Methodisch werden in der vorliegenden Arbeit einige für das Thema «Städte lesen» relevante Argumente behandelt, um die Bedingungen, Chancen und Grenzen einer entsprechenden Möglichkeit des Lesens zu erfassen. Im Kapitel II werden zunächst die Kategorien des Raumes und des Ortes in einem Grundverständnis vorgestellt. Anliegen di eses Kapitels ist es, den Raum in kultureller und anthropologischer Hinsicht als einen grundbedingten Wert zu würdigen, denn nur als eingerichteter Raum erfüllt er die Grundbedingung, gelesen zu we rden. K a p i t e l I I I A r g u m e n t e d e s L e s e n s . Die Argumente des Lesens «Gestalt und Ganzheit», die ein Verstehen möglich machen, werden im Kapitel III beleuchtet, um dann auf die Frage nach dem Verhältnis von «Sinn und Verstehen» zu sprechen zu kommen. K a p i t e l I V D a s L e s e n . Im Abschnitt IV.1 steht das Lesen in seiner Bedeutung für den Menschen und die Entwicklung der Wissenschaft vom Verstehen - die Hermeneutik - im Mittelpunkt. Die Wissenschaften hatten im 19.Jahrhundert einen Kenntnis- und Entwicklungsstand erreicht, dem die klassische Monostrukturiertheit der Disziplinen Grenzen setzte. Es wird dargeste llt, wie die Hermeneutik, und mit ihr viele andere Wissenschaften, wie auch die Semiotik, ihr angestammtes Wissenschaftsgebiet in der Absicht verlassen, die Probleme der Gesellschaft zu lösen, und wie in fremde Bereiche transferiertes Gedankengut zum Teil erfolgreich adaptiert wird. Wenn die erneuerten und erweiterten Wissenschaften die realen Widersprüche auch keineswegs zu lösen vermochten, trug die Fremdverwendung und die Übertragung der Erkenntnisse doch zur Entwicklung der eigenen Disziplinen bei und gestattete, einige innerdisziplinäre Widersprüche neu zu betrachten. Ist die Stadt ein Zeichensystem, welches entschlüsselnd durchlesen werden kann? Der Einzug der Semiotik in die Architektur in der 2.Hälfte des 20.Jahrhunderts hat einige Erfolge gefeiert – zunächst in der Fachliteratur, aber dann auch in der Praxis. Schließlich ist die Postmoderne in den 1980er Jahren dezidiert semiotisch vorgegangen. Dagegen hat niemand daran gedacht, die Hermeneutik in die Architektur zu übertragen. Warum eigentlich nicht? Abschnitt IV.2 führt den Vergleich von Semiotik und Hermeneutik. Dazu werden die Charakteristika beider Ansätze einander gegenübergestellt sowie Chancen und Grenzen der Anwendbarkeit aufgezeigt, so dass klar wird, inwieweit die scheinbaren Ähnlichkeiten der Interpretation von Zeichen und der Interpretation von Texturen doch auf einem grundsätzlich verschiedenen Ansatz beruhen. Stadt zu lesen ist theoretisch und nicht pragmatisch. Lesen ist in erster Linie Selbstzweck; die Frage des klaren Nutzens tritt dabei in den Hintergrund. Der Gewinn ist in erster Linie ein Erkenntnisgewinn. Darin liegt auch das Geheimnis begründet, warum das Vorhaben, Städte zu lesen, lediglich ein Verstehen will und deshalb so wenig direkt für Planungstätigkeit operationalisierbar ist. Denn es ist 9 primär ein Anschauen, für das der mittelalterliche Satz gilt: „Für die Anschauung sind die Dinge Selbstzweck, für den Gebrauch sind sie Mittel.“ (Assunto 1997, S.44) Dass die Methode, Stadt zu lesen nicht auf eine direkte Verwertbarkeit abzielt – zum Beispiel für die Planung - ist kein Nachteil, denn Nichtoperationalisierbarkeit lässt unauffällig Kreativität ablaufen, unterwandert die Technik und entzieht sich der Verwaltbarkeit, die immer kollektive Kontrolle ist. Die Methode stellt sich de r pragmatischen Funktionalisierung von Stadt(er)kenntnis entgegen und entzieht sich dadurch der Tendenz, aus der Denkform einer Sache zur Denkform über eine Sache zu werden (Frings, in: Sch eler 1977, S.XV). Im Abschnitt IV.3 wird das mit dem Lesen und interpretierenden Verstehen verbundene Maß betrachtet, in welchem die «Lektüre» zwischen Objektivität und notwendiger, subjektiv bedingter Inobjektivierbarkeit schwankt, um auf die ethische Dimension des lesenden Verstehens von Stadt zu reflektieren. K a p i t e l V S t ä d t e s c h r e i b e n u n d l e s e n . An das theoretische Gerüst werde ich im Kapitel V auf die Stadt zu sprechen kommen. Nachdem die Sprachforschung um 1900 zur allgemeinen Zeichenlehre erweitert wurde, der Philosoph Ludwig Wittgenstein (1889-1951) Sprache aus dem Gebiet der Linguistik in das Gebiet der Philosophie überführte, der Ethnologe Claude Lévi-Strauss (1908-1982) Völkerkunde strukturell mit Sprachkunde verknüpfte, Michele Foucault jüngst Unters uchungen über den sprachlichen Diskurs der Gesellschaft anstellte und Jaques Derrida ähnliches für die Schrift tat, treten die Komplexe von Sprache und mehr noch Schrift(!) in ihrer Eigenständigkeit nach Art eines Marx’schen Überbaus deutlich zum Vorschein. Abschnitt V.1 spekuliert über die enge textliche Verwobenheit der Idee der Stadt mit der Schrift und Sprache in Form eines widerstreitenden Prozesses zwischen Bejahung (Ver-Wirklichung) und Verneinung (Ent-Wirklichung) der Stadt als determinierte und determinierende, kulturelle und ethnische Lebensbedingung des Menschen. Dazu werden im Rahmen dieser Arbeit zwei historische Etappen näher betrachtet: 1. die praktische Geburt der Stadt der Neuzeit (Renaissance) aus dem Text der Antike 2. die theoretische Selbstreflexion der Stadt durch die Figur des Flaneurs (19.Jahrhundert) In den Abschnitten V.2 und V.3 wird das Lesen von Zeit und Raum geschichtlich reflektiert. Für die Renaissance nimmt der Text antiker Schriftdokumente eine Schlüsselstellung ein. Es wird die These erörtert, nach der die Neuzeit nicht auf einem natürlichen, evolutionären Wege aus dem Hochmittelalter hervorging, sondern in willentlicher Negation der renitenten, mittelalterlichen Realität - und zwar unter medialer Zuhilfenahme wieder aufgefundener und wieder studierter Schriftstücke. Die Stadt ist ein kultureller Text, den die Menschen über Jahrtausende kontinuierlich fortgeschrieben und permanent revidiert haben. Im Abschnitt V.4 wird ein Licht fallen auf die klassische Figur des sanften Stadtlesers, der dem hier intendierten Leseverständnis am nächsten steht: der Flaneur. Da es in der vorliegenden Arbeit um ein Plädoyer für die Kultur eines sanften, einfühlsamen und intuitiven Lesens geht, kann man vom Flaneur am meisten lernen, da die Aufmerksamkeit, die der Flaneur der Stadt entgegenbringt, dem unbequemen, klassischen Lesen von dicken Büchern ähnelt. Das Flanieren wird dem Wandern und dem heute üblichen Zu-Fuß-Gehen gegenübergestellt, um Parallelen und Differenzen aufzuzeigen. Ist der Wanderer der proletarische, ein wenig zum Kitsch neigende kleine Bruder des Flaneurs, ist die heutige Stadt dem Fußgänger symptomatische und kursorische Lektüre. Die würdige Schwere eines Buches wurde viel leichteren, informationsökonomischen Textbausteinen geopfert. R e s ü m e e . Ein Resümee, bei dem es noch einmal um die Ethik des Stadtlesens geht, beendet diese Arbeit. Ich Wende mich nun den Kategorien des Raumes und des Ortes in ihrem Grundverständnis zu. Kapitel II Der Raum des Lesens 10 II.1 Die metaphysische Dimension des Raums „Insgesamt ist der Raum ein Ort, mit dem man etwas macht. So wird zum Beispiel die Straße, die der Urbanismus geometrisch festlegt, durch die Gehenden in einen Raum verwandelt. Ebenso ist die Lekt üre ein Raum, der durch den praktischen Umgang mit einem Ort entsteht, den ein Zeichensystem – etwas Geschriebenes – bildet.“ (de Certeau 1988, S.218) Das theoretische Fundament europäischen Denkens liegt in der Metaphysik. Die Metaphysik ist eine Philosophie, die im antiken Griechenland aufkam und sich von da aus über ganz Europa verbreitete. Sie geht von relativ geschlossenen, auf das Sein gerichteten Denkfiguren und Denkräumen aus. Zu den vier existenziellen Denkfiguren gehören Wahrheit (ständig begleitet von Skepsis), Vision, Drama und Ereignis (Rizzi 1999, S.13). Im metaphysischen Denken gehen Gegenstände und Phänomene über ihre körperlich-sinnliche Erfahrbarkeit hinaus und hinüber in Ideale wie Gott, Freiheit und Unsterblichkeit (Kant, vgl. dazu: Russell 1999, S.717). Die Neuzeit beschwor einen Paradigmenwechsel mit räumlichen Konsequenzen herauf. Die Erkenntnisse von Geometrie und Perspektive, die am Beginn der Neuzeit stehen, ließen das ptolemäische, in seiner metaphysischen Typik geschlossene Raumsystem durch das offene, kopernikanische ersetzen. Der Raum wurde weithin über seine metaphysische Determiniertheit hinaus geöffnet (Bollnow 2000, S.83). Das Dispositiv der Perspektive gestattete dem Menschen, neuen Planungsraum nach optischen Regeln geometrisch zu entwerfen und zu projektieren. Architektur wurde den Menschen in der Renaissance zur „mathematischen Disziplin, die mit Raumeinheiten arbeitete; d.i. mit Ausschnitten jenes unendlichen Raumes, für dessen wissenschaftliche Erforschung sie einen Schlüssel in den Gesetzen der Perspektive entdeckt hatten“ (Wittkower 1969, S.29). Aber auch der vorhandene, aus dem Mittelalter überkommene öffentliche Raum konnte neu durchmessen, koordinatiert und somit in der Retrospektive neu erkannt, bewertet und verstanden werden. Nur richtete sich der Blick des neuzeitlichen Menschen nicht auf das Mittelalter, sondern in die zeitlich viel weiter zurückliegende Ferne der Antike. (Siehe die Abschnitte V.2 und V.3.) Die neue Raumerkenntnis und das neue Raumverständnis zeigte am deutlichsten die Widersprüche des vordem endlich gedachten, metaphysischen Raums, denn potentiell führten die sich perspektivisch in der Ferne nie schneidenden Fluchtlinien in die Unendlichkeit. Jedoch wurde deshalb die Metaphysik als Grundannahme deswegen nicht in Frage gestellt. Vielleicht stellt die Metaphysik in Europa so etwas wie einen mentalen, denkhistorisch nicht revidierbaren, eher ethisch-moralisch motivierten Grundwert dar. Die nahezu metaphysische Ewigkeitskennzeichnung des Daseins als Entität unterstrich selbst im 20.Jahrhundert durch das ontologische Denken Martin Heideggers die Geschlossenheit dessen, was ist wenngleich das, was ist prinzipiell als Möglichkeit da sei, so HeideggerIII (Heidegger 1935, S.143ff.). Gerade durch Heidegger wurden Sein und Möglichsein als grundsätzliche Konstituenten auch des modernen, europäischen Weltverständnisses erneuert. Wenn wir Heidegger genau studieren, wird uns klar, dass seine Ontologie ein in seiner Existenzialität ethisches Anliegen verfolgt. Diese Erkenntnis legt uns nahe anzunehmen, dass Ethik, Moral, Humanität und Verantwortungsbewusstsein metaphysisch konnotiert sind – Grund genug, an den Werten metaphysischen Denkens festzuhalten und sie nicht im Zuge einer physikalischen Korrektur zu opfern. Bauen und Wohnen arbeitete Heidegger als die grundlegenden Daseinskategorien des Menschseins heraus. Das Wohnen gilt Heidegger (und mit ihm anderen Existenzialisten, wie zum Beispiel Sartre) als Schlüsselbegriff, dem Menschen sein eigenes Weltverständnis begreiflich zu machen. Sofern der Mensch in der Welt sei, sei er in ihr wohnend, sagt Heidegger. Alles bewohne er: die Zeit, den Raum, die Dinge – kurz: das Sein. Als physischen Ausdruck des bewohnten Raums sieht Heidegger den «Ort». Dieser spielt eine existenzielle Rolle für das so In-der-Welt-Dasein. An den Ort und also in seine Nähe nämlich hole der Mensch die Dinge der unbekannten Welt und verwandle sie damit in potenziell bekannt sein könnende Dinge. „Die Sterblichen sind, das sagt: wohnend durchstehen sie Räume auf Grund ihres Aufenthaltes bei den Dingen und Orten.“ (Heidegger 1954, S.158) Der Ort in seiner Archetypik steht im Mittelpunkt des Heideggerschen Gevierts aus Erde, Himmel, den Göttlichen und den Sterblichen. In «Bauen Wohnen Denken» heißt es dazu feierlich und als verantwortungsvolle Aufgabe: Leicht kann Ontologie in Dogmatismus enden, wie die biographische Episode Heideggers zeitweiliger Symp athie mit dem Faschismus belegt. III 11 „Im Retten der Erde, im Empfangen des Himmels, im Erwarten der Göttlichen, im Geleiten der Sterblichen ereignet sich das Wohnen als das vierfältige Schonen des Gevierts. Schonen heißt, das Geviert in seinem Wesen hüten.“ (Heidegger 1954, S.151) Mit der ontologischen Positionierung des Menschen in der Welt steht der humanitäre Aspekt des menschlichen Daseins über allen anderen Eigenschaften, die das Menschsein sonst noch ausmachen. Der Mensch trägt im Hinblick auf die Gestaltung seiner Umwelt zu seinem Lebensraum Eigenverantwortung. Die Freiheit des Menschen besteht darin, seine eigenen Existenzparameter zu konstruieren. Ausgangspunkte und Zielvisionen kommen ihm allein zu definieren zu - im Rahmen entsprechender Möglichkeiten. Es ist sinnvoll, zu betrachten, was mit dem Lebensraum ganz am Anfang des Raums bei der Sesshaftwerdung passierte. II.2 Die ontologische Dimension des Raums Im Unterschied zur Künstlichkeit der vom Menschen sich zu eigen gemachten Welt ist in die Natur alles gleichwertig eingebettet. In der Natur kommt die Heraushebung einem Gegenstand gegenüber einem anderen nicht zu. Aber bereits im aufrechten Gang, mit dem sich der Urmensch von den anderen Tieren unterschied, stand er gegenüber all seinen Mitwesen privilegiert und aus dem selbstgenügsamen Eingebettetsein in die Natur herausgehoben da. Eine horizontale Körperlage, wie sie den Tieren gemeinsam ist, neigt einer flächigen, streunenden Bewegung zu. Im aufrechten Gang hingegen steckt eine Veranlagung zur Ortbildung und die Abkehr von diffusen Streunen zu relativem Aufenthalt. Noch bevor der erste Mensch ein Werkzeug greift - einen Stab – und dieses senkrecht in den Boden steckt und also zu bauen begann, war der aufrecht gehende Mensch selber „das einfachste Modell für den existenziellen Raum [...:] eine horizontale Ebene, die von einer vertikalen Achse durchschnitten wird“ (Norberg-Schulz 1982, S.40). Um seine eigene, senkrechte Achse herum, spannt der Mensch gleichsam «Ort» auf (Bollnow 2000, S.44). Kurz verweise ich an dieser Stelle auf die strukturelle Ähnlichkeit dieses physischen mit dem narrativen Raum: eine Erzählebene spannt sich zwischen Autor und Leser auf, die von einer transversalen Achse durchschnitten wird, welche den Erzählraum zu einem dreidimensionalen Raum macht (Wenz 1997, S.146). (Dazu ausführlicher im Abschnitt IV.3.) Vorerst gilt festzuhalten: Die bis vor 10.000 Jahren herumziehenden Sammler und Jäger wohnten noch nicht - sie hausten. Erst mit der Sesshaftwerdung fing der Mensch an zu wohnen. Wohnen heißt (mit Heidegger gesprochen), all den in die Nähe geholten Dinge im Nahraum einen Platz zuzuweisen. So der Mensch in der Welt wohnt, ordnet er. Dazu macht es sich ganz wie von selbst erforderlich, einige Dinge gegenüber anderen zu bevorzugen und sie aus ihrer natürlichen Gleichwertigkeit herauszuheben. Gewissermaßen überträgt der Mensch den Status seiner eigenen Ungleichwertigkeit auf die sein Interesse erregenden Dinge – vielleicht auch, damit ihm die Dinge gleichberechtigte Gesellschaft leisten. Noch ursprünglicher als die Abschätzung auf eine mögliche Verwen dbarkeit hin lässt den Menschen eine emotionale Anziehung oder Abscheu, die von den Dingen ausgeht, sich den Dingen zu- oder eben abwenden. In einer zweiten Phase sind Dinge, die interessant sind, solche Dinge, die sich im Hinblick auf eine bestimmte Benutzung bearbeiten lassen. Aber die emotionale Zu- oder Abwendung geht der pragmatischen voraus. Die Wissenschaft der Semiotik widmete sich explizit der Untersuchung der „Bedingungen für die Interaktion zwischen uns und etwas, das uns gegeben und dessen Konstruktion gewissen Zwängen unterworfen ist“ (Eco 1990, S.21). Durch das Ordnen, das die Dinge einrichtet, werden Bereiche zu aus der Natur herausgeschnitt enen Orten. Sie werden umfriedet (Heidegger 1954, S.147; Norberg-Schulz 1982, S.22f.). Orte sind somit immer künstliche Produkte. In ihnen fließt ein Strang von Handlungen zusammen. Gleichzeitig entstehen Handlungen aus den Orten heraus oder finden an ihnen statt. Handlungen verwandeln den diffusen Raum in konkreten Ort (Norberg-Schulz 1982, S.6). Indem die Stadt aus dem weiten Land herausgeschnitten, Natur und Kultur voneinander getrennt und also geordnet wurde, entstanden Welt und Zeit - und Sinn! (Bollnow 2000, S.144) Wenn durch die Stadt Welt entsteht, entsteht sie immer schon dualistisch angelegt: ein Gegenüber von Natur und Kultur (Lefébvre 1997, S.87f.). Ein homogenes Weltganzes hat es demnach im Prinzip nie geben - lediglich ein vorstädtisches und vorweltliches Naturganzes. Aber es herrschte noch über lange Zeit danach eine Harmonie zwischen den 12 beiden Seiten Natur und Stadt, welche die antike Welt bis zum Mittelalter zusammengehalten hat. Als mit der Stadt die Welt entstand und gleichzeitig Sinn in ihr Einzug hielt, kristallisierte Welt sofort in die Unmittelbarkeit von Wirklichkeit aus – in ein Hier und Jetzt! Im Bauen kristallisiert menschliches Handeln dauerhaft derart aus, einen zeitlich-räumlichen Ort zu schaffen, der den Genius loci enthüllt (Norberg-Schulz 1982, S.18). „Der existenzielle Zweck des Bauens ist es [...], aus einer Stelle einen Ort zu machen, das heißt den potentiell in einer gegebenen Umwelt vorhandenen Sinn aufzudecken.“ (Norberg-Schulz 1982, S.18) In einem geordneten Raum bewegt sich der Mensch sinnvoll. Ein um sich herum sinnvoll eingerichteter Raum kommt aber nicht nur dem Einzelnen, sondern der Gemeinschaft zu Gute. Wenn eine Ordnung einsehbar ist, kann ihr verallgemeinertes Verständnis im Prinzip von jedem Mitmenschen geteilt werden. Ein nach bestimmten kulturellen Regeln einsehbar geordneter Ort erfüllt die Funktion eines die Gemeinschaft umhüllenden Schutzraums – und zwar nicht so sehr vor Feinden, sondern im Sinne eines die Gemeinschaft behütenden Raums. In ihm findet der Mensch existenziellen Halt (Norberg-Schulz 1982, S.19 – mit Heidegger). Dieser Schutzraum, den sich die Stammesgemeinschaft willentlich in Form einer Zusammensiedlung schafft, ist Kulturraum. Die Ansiedlung - die potentiell Stadt (Stätte) ist - ist ein Hort. Die räumlich figurierte Ordnung ist jedem „ein gemeinsames Medium, in dem wir uns mit Sicherheit bewegen und in dem uns alles «von Kindesbeinen an verständlich» ist“ (Bollnow 2000, S.210). Vom zum Hort gewordenen Raum kann der Wohnende die ganze Welt beobachten. Er kann verstehen, „worumwillen“ (Heidegger 1935, S.147) etwas in der Welt da ist. „Von hier aus versteht er, als was er die Dinge zu nehmen und wie er sie in der rechten Weise zu gebrauchen hat.“ (Bollnow 2000, S.210) Im gerahmten Raum scheidet eine dünne ontologische Linie die Bedingung, überhaupt verstehen zu können, von der ganz dicht daneben liegenden Weite der Möglichkeit, potenziell alles verstehen zu können. Er erlangt Lese- Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit. Denn das Lesen setzt den Blick auf eine erkennbare Ordnung voraus. Die Entdeckung der Landschaft in der Renaissance ist nur ein Be ispiel für die unbewusst wachsende menschliche Befähigung zum Lesen aus dem immer komfortabler und komplexer geordneten städtischen Schutzraum heraus. (Siehe dazu besonders Abschnitt V.1.) B ereits zu Beginn der Entstehung der Städte im Zweistromland war nur geordneter Raum potentiell lesbarer und damit sinnvoller Raum. Aus der (Kenntnis der) Stadt heraus vermochte der Mensch im Buch der Welt zu lesen – einen «Naturkosmos» (Panofsky 1996, S.11), der ihm bis dahin mysteriös und chaotisch ohne Struktur gewesen ist. In der Stadtschöpfung (wie vorher schon im Hausbau) vollzog der Mensch den göttlichen Schöpfungsakt nach: Er gründete - mit Buchstaben, Zahl und Maß - einen Kosmos aus dem Chaos (Bollnow 2000, S.144). „Galilei hatte noch angenommen, die mathematische Verschlüsselung des Textes der Natur sei die Sprache, in der Gott seine Wahrheit über die Natur den Fachleuten vorbehalten wissen wollte.“ (Blumenberg 1999, S.402). „Das Universum der jüdisch-christlichen Tradition stellt sich als eine Schrift aus Buchstaben und Zahl en dar; der Schlüssel zum Verständnis des Universums liegt in unserer Fähigkeit, die Buchstaben und Zahlen richtig zu lesen, ihre Kombinationen zu beherrschen und somit einen kleinen Teil des gewaltigen Textes zum Leben zu erwecken – in Nachahmung des Schöpfers.“ (Manguel 1999, S.18) Das von der Plattform des Städtischen aus unbewusste In-die-Welt-Hineinleben offenbarte dem Menschen nicht nur die Zusammenhänge der äußeren Umwelt; es offenbarte ihm auch sein eig enes Inder-Welt-Sein. In der städtischen Gemeinschaft kam er zu Selbstbewusstsein, Identität, Autonomie gegenüber seinen Mitmenschen und wurde sich seines Ursprungs bewusst, denn in der Stadt berührte er überall die Sinnfrage. II.3 Die anthropologische Dimension des Raums Wie die anthropologische Schule der Philosophie des 20.Jahrhunderts feststellte, hat der Mensch von vornherein gute Chancen auf den Zugang zum äußeren Raum, denn ihm ist das Vermögen eigen, sich vom subjektiven Raum loszulösen und eine Leerform von Raum und Zeit zu imaginieren (Scheler 1995, S.45). Im Gegensatz zum Tier, das seinen Handlungsraum ständig mit sich herumschleppt, ist der Handlungsraum des Menschen ein feststehender Raum! Während beim Tier Sinnes- und 13 Handlungsraum zusammenfallen, scheidet sich beim Menschen der Sinnes- vom Handlungsraum. Im Handlungsraum kann er seinen Sinnesraum frei umherbewegen. Da der Mensch ein intentionales Wesen ist, ist der Sinnesraum ein intentionaler Raum (Bollnow 2000, S.272). Im Zentrum dieses Sinnesraums steht das erwachsene Subjekt wie im Mittelpunkt eines individuellen Kosmos. Die amerikanischen Architekten Bloomer und Moore haben das sehr schön am Beispiel des Körperschemas deutlich gemacht (Bloomer, Moore 1980, S.53ff.). Aus dem Sinnesraum heraus agiert der Mensch hinein in den objektiven, feststehenden Handlungsraum. Die freie Bewegung in diesem Raum macht es möglich, den Handlungsraum zu durchmessen und Dimension und Gestalt sowohl des Raumes zu erfahren, wie auch sich selbst – noch vor der Wissenschaft! „Der Mensch allein – sofern er Person ist – vermag sich über sich – als Lebewesen – emporzuschwingen und von einem Zentrum gleichsam jenseits der raumzeitlichen Welt aus alles, darunter auch sich selbst, zum Gegenstand seiner Erkenntnis zu machen.“ (Scheler 1995, S.47) Zu Max Schelers (1874-1928) Verständnis der Person muss hier eine Ergänzung vorgenommen werden: Eine solche Person hätte nicht in der Natur heranreifen können! Zwar gibt es „einen Raum nur, insofern der Mensch ein räumliches, d.h. Raum bildendes und Raum gleichsam um sic h aufspannendes Wesen ist“ (Bollnow 2000, S.23). Aber in der Natur wäre es letztendlich unmöglich gewesen, Handlungs- und Sinnesraum voneinander zu scheiden. Um diese Trennung vorzunehmen und Raum zu fixieren, benötigte er den künstlich zum festen Stand gebrachten Raum der Stadt! Die Stadt ist die physische Fixierung des Handlungsraums. Ihm steht das Land wie ein großer, ursprünglicher Sinnesraum gegenüber, welcher in letzter Instanz und etwas romantisch betrachtet alles aus sich heraus hervorbringt. In der Stadt bewegt sich das Individuum frei. Potentiell ist der ganze Weltenraum sein Handlungsraum. Städtischer Raum bleibt dem Menschen sinnlich nahe, denn trotz seiner relativen Objektivität als Handlungsraum weist dieser Raum Eigenschaften von Innenraum auf. So definierte der italienische Kunst- und Architekturgeschichtler Bruno Zevi (1918-2000) Raum als «Gesamtheit der Leere» (in: Boudon 1991, S.27). Was für den Innenraum sofort einleuchtet, fand Zevi gleichermaßen für den Außenraum zutreffend. Nach seiner Definition verpacken Fassaden nicht einen dahinterliegenden Innenraum, sondern umgekehrt: sie geben dem hohlen Außenraum, der ja ein Leerraum ist, Gestalt – das eigentlich sei Architektur (Boudon 1991, S.28). Durch das unterbewusste Als-ein-Innen-Denken des Außen besitzt der Mensch einen anthropologischen Zugang zum Raum. Denn in sofern der Außenraum auch Sinnesraum ist, hat das Innen eine Substanz: das Innere des menschlichen Kö rpers selbst. Auch wenn der Mensch in der Stadt lebt, gibt er seinen subjektiven Sinnesraum nicht auf. Er bleibt in soweit Tier, als dass er sich stets in die unmittelbare Präsenz einer individuellen, um sich herum aufgespannten, raumzeitlichen Einheit der Wirklichkeit eingehüllt findet. Der Sinnesraum ist beim Menschen selbstverständlich ungleich ausgereifter als beim Tier. In der Kategorie des Sinnesraums übernimmt der Körper des Menschen eine aktive Rolle. „Es ist kein Zweifel, daß das, was der natürliche Sprachraum «Empfindung» nennt, gewisse wechselnde erlebte Zuständlichkeiten sind, die wir als Modifikation unseres Leibes und unmittelbar auf ihn bezogen erleben“ [... in dem Sinne, daß, d.A.] „das natürliche Bewußtsein aufgrund vager Erfahrungen annimmt, daß der [...] Gegenstand in strengem Raum- und Zeitkontakt zu einem Teil unseres körperlichen Organismus stehe.“ (Scheler 1977, S.128f.) Da sich dem Kind der Handlungsraum als Sinnesraum einprägt, erinnert sich der Erwachsene emotional oft an seinen als Kind durchlebten Raum. Das Kind liest den objektiven Raum als subjektiven Raum, da es vornehmlich sinnlich vorgeht und ihm aus allem Äußeren eine subjektive Bedeutung hervorgeht oder es dem objektiven Raum eine solche verleiht. „Die erste, egozentrische Lokalisation dominiert in den frühen Lebensjahren, die zweite, exozentrische gewinnt dann mit zunehmendem Alter an Bedeutung.“ (Salzmann 1985, S.21) Wird das Kind erwachsen, nimmt die subjektive Bedeutung des eg ozentrischen Sinnesraums in dem Maße ab, wie die objektive Bedeutung des exozentrischen Außenraums zunimmt. Am Außenraum hängt zunehmend weniger persönliche Bedeutung und der Raum offenbart sich immer weniger durch sich selbst, wie das der kindliche Wahrnehmungsraum noch tat. Ganz anders als bei einer Person, die sich infolge des Bewusstseins durch Gebärde, Handlung und Sprache sinnesräumlich selbst zu offenbaren vermag, wächst die Einsicht, dass Steine und Phänomene kein Bewusstsein besi tzen, das sie zu einer Selbstoffenbarung befähigen könnte. Damit sich jemandem die Außenwelt erschließt, bedarf sie der Interpretation. Abschnitt V.4 führt diesen Gedanken weiter und untersucht das Wechselverhältnis von Sinnes- und Handlungsraum bei den Raum explizit lesendes Figuren. 14 Es werden nun Argumente betrachtet, die das Lesen berühren. Kapitel III Argumente des Lesens III.1 Gestalt und Ganzheit G e s t a l t . Wenn man Raum oder Zeit liest, nimmt man deren Gestalt wahr. Gestalt (griechisch «morphe», lateinisch «forma») bedeutet die anschauliche, umgrenzte, in sich geschlossene Erscheinung eines Phänomens der Betrachtung. Die Gestalt ist dem Phänomen nichts Äußerliches oder Vorgesetztes - sie ist deren innere Struktur, unteilbarer Aufbau, Geist, Charakter, Herkunft, Umgebung und Schicksal. All das führt zum sichtbaren Gestaltausdruck. Der Gestaltausdruck ist das, was es ausdrückt selber. Historisch betrachtet, dreht sich der Begriff «Gestaltausdruck» am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit in den Begriff «Ausdrucksgestalt» um. Während der reine «Gestaltausdruck» der Phänomene naturgegeben schien, platonische Züge aufweist und später von der Morphologie adaptiert wurde, knüpfte sich der Terminus «Ausdrucksgestalt» vornehmlich an die künstlerische Absicht eines Gestalters. Die raffinierte, geometrisch exakte Gestaltung in der Renaissanc ekunst beeindruckt in dem Maße, wie der Aspekt einer irrationalen Innerlichkeit im Kunstschaffen nachließ. Die Soziologin Heide Berndt beschrieb den Übergang vom innengeleiteten zum außengeleiteten Menschen, die sich aber erst mit der Konzentration des zerstreuten Privateigentum zu großem Kapital durchsetzte (Berndt 1978, S.150). Denn im wesentlichen laufen reine und beabsichtigte Gestaltung bis in das 20.Jahrhundert nebeneinander her. Noch nicht einmal die industrielle Revolution führte zu einem abrupten Bruch. Im Gegenteil: Das 19.Jahrhundert beförderte sogar eine ausdrucksgestalterische Kraft im Kunstschaffen. Um etwas von der Gestalt in ihrer Komplexität wahrzunehmen, muss irgendeine Vorahnung bestehen, ein Bild vom Ganzen des Phänomens, vom Weltganzen. Bereits die Gestaltlehre Goethes (1749-1832) – die MorphologieIV - geht hinsichtlich der Gestalterfassung von einer Vorahnung der gestaltinhärenten Struktur durch den Betrachter aus. Die Gestalt ... „... kann nicht bloß durch das Beschauen ihrer Oberfläche begriffen werden, man muß ihr Inneres entblößen, ihre Teile sondern, die Verbindung derselben bemerken, die Verschiedenheiten ke nnen, sich von Wirkung und Gegenwirkung unterrichten, das Verborgene, Ruhende, das Fundament der Erscheinung sich einprägen, wenn man dasjenige wirklich schauen und nachahmen will, was sich als ein schönes ungetrenntes Ganzes [...] vor unserm Auge bewegt.“ (Goethe 1986, S.148) Eine mit den Wahrnehmungs- und Sinnesorganen individualisierte Gestalt ist eine Sinneinheit - eine sinnvolle Einheit. Ist die Gestalt eines Zusammenhangs erkennbar, schließt sie eine Form von Wissen ein. Sinn und Wissen werden hier wie Synonyme behandelt. Nicht verbirgt es sich dahinter (wie Kant argwöhnte), sondern die Gestalt ist der lebendige Ausdruck dieses «Wissens». Können wir eine Gestalt oder verschiedene Gestalten ausmachen, ist dasjenige, was in unserer Wahrnehmung die Gestalt evoziert, per se tendenziell sinnvoll, da sie ja unserer Wahrnehmung überhaupt zugänglich ist. Ungestalt oder Gestaltlosigkeit hingegen ist Chaos. Chaos ist unerkennbar und mithin unv erstehbar. In dem Moment aber, in dem wir im Chaos der Unverständlichkeit eine Gestalt erkennen, nehmen wir Ordnung und mit der Ordnung eine Hohlform von Sinn wahr. Denn mit dem Sinn ist es nicht so einfach wie mit dem Wesen. Anders als das Wesen liegt der Sinn nicht vollends in der Sache selbst, sondern lediglich eine Veranlagung zu Sinn. Diese Veranlagung anzufüllen, beginnt praktisch im Moment der Gestaltwahrnehmung. In der Natur entwickelt sich Form als absichtsvoller Widerstand gegen das Chaos. Höherentwicklung vollzieht sich als Reaktion der Form auf Einbrüche von außen – als Störung der Vollkommenheit, wie Goethe in seinen morphologischen Studien darlegte (vgl. Goethe 1986). IV 1795 taucht der Begriff «Morphologie» erstmals bei Goethe in der Schriftenreihe: «Zur Morphologie» auf. 15 Kunstprodukten ist Sinn immanenter als Naturprodukten. Die ganze Stadtgestalt ist eine Einheit von Sinn und Wissen. In einfachster Ausbildung kann Gestalt physisch konkret sein - zum Beispiel ein Krug, eine Hügel- oder Stadtlandschaft. Der klassische Begriff der Landschaft hebt sich von dem der Natur als typischer Gestaltbegriff ab. (Siehe hierzu die Erläuterungen im Abschnitt V.1.) Aber auch ein Staatsgebilde oder das Rechtssystem besitzt Gestalt. Auf der höchsten Stufe kann Gestalt völlig immateriell sein, deshalb aber nicht weniger als geschlossene Sinneinheit aufgefasst werden - wie zum Beispiel bestimmte persönliche Prinzipien des Handelns oder der Lauf der Geschichte. (Siehe hierzu Abschnitt IV.1.) G a n z h e i t . Der Gestalt- und der Ganzheitsbegriff stehen miteinander in einer engen Beziehung. Beide Begriffe sind ineinander verflochten. Unter Ganzheit versteht man ein strukturiertes, geschlossenes System, dessen Teile sich wechselseitig aufeinander beziehen. Die Teile und deren Beziehung bestimmen «das Ganze als solches». Sie beziehen sich nicht nur aufeinander und untereinander, sondern darüber hinaus noch auf eben «das Ganze als solches» (die Gesamtheit), so die Ganzheitslehre des deutschen Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831) (vgl.: Russell 1999, S.750). Diese «Gesamtheit» besitzt ein hohes Maß an Eigenständigkeit, unabhängig von ihren Teilen (Fragmenten), aus denen sie sich dennoch zusammensetzt. Auf dem Weg zu dieser Erkenntnis steht Hegels dialektische Methode. Sie deutet an, dass Sinn nicht den Fragmenten im einzelnen angehört, sondern nur ihrer Synthese. In der Synthese des «Ganzen» werden These (Materie) und Antithese (Geist) dialektisch aufgehoben. Die einzelnen, empirisch feststellbaren Elemente des Wirklichen – die Fakten – sind dabei mit den Kategorien der Logik erforschbar (Lyotard 1999, S.124). Aber in den Teilen steckt noch nicht die Wahrheit, die in der Gesamtheit steckt. Über einzelne Aspekte kann somit nie ganz Wahres ausgesagt werden, hatte Hegel geschlussfolgert, denn nur das Ganze sei wegen ebendieser Ganzheit auch das einzig Wahre und leuchte ein, da es sich auf nichts anderes mehr beziehe als sich selbst (Russell 1999, S.740f.). Auch wenn man bei allem Ganzheitsschauen dennoch nur Teile erfasst, subsummiert man diese ideell und oft unbewusst unter eine Gesamtbedeutung und „dann leuchtet die Sache in ihrem Sosein nach «selbst» in den Geist immer adäquater ein“ (Scheler 1977, S.17). Der englische Philosoph Bertrand Russell würdigt das Verdienst Hegels darin, das von Descartes (1596-1650) bis Kant (1724-1804) in metaphysische Entitäten auseinander getriebene Sein wieder zusammengebracht zu haben (Russell 1999, S.739ff.). Die Gestalttheorie, auf die wir nun einen Blick werfen wollen, da ihr die Theorie des Lesens verpflic htet ist, findet in Bezug auf die Wahrnehmung von Phänomenen aber auch einen Hegel völlig entgegengesetzten Ansatz: nicht über die Synthese, sondern über die Deduktion (Ableitung). Letztendlich gehen Synthese und Ableitung in der Praxis Hand in Hand, denn das Ganze aus dem Einzelnen zu verstehen und das Einzelne aus dem Ganzen ist eine antike Regel der Rhetorik und somit auch eine hermeneutische Regel (Gadamer 1960, S.199). G e s t a l t t h e o r i e u n d W a h r n e h m u n g . Der österreichische Philosoph Christian Freiherr von Ehrenfels (1859-1932) bahnte der Gestalttheorie einen Weg. In seiner Gestaltlehre ist er dem Idealismus verpflichtet, der in einer Art «absoluter Idee» (Hegels) den Urgrund der Weltordnung sieht. Aber im Unterschied zur idealistischen Induktion arbeitete von Ehrenfels heraus, dass dasjenige, was wir als die Gestalt eines komplexen Gebildes ansehen, nicht allein über die Addition sämtlicher Teile hin zu einem Ganzen erklärt werden kann, sondern vielmehr umgekehrt: Gestalthaftes Sehen gehe von der «Übersummativität» aus und ergieße sich von dort über die einzelnen Teile. Die Qualität der Übersummativität entspringt ausschließliche der Ganzheit. In ihr ist „die Summe selbst zu einem eigenständigen Ganzen gelangt“ (von Ehrenfels 1922, S.55f.). Platon (427 v.Chr. -347 v.Chr.) vergleichbar, der behauptete, die Dinge und ideellen Gebilde V entwickeln sich, um innerhalb des irdischen Daseins ihrer Idee möglichst nahe zu kommen, b esitzt nach von Ehrenfels’ Meinung die Ganzheit ein Primat gegenüber ihren Teilen. Die Einzelteile, welche die Gestalt konstituieren, entwickeln sich nach dieser Theorie von der Idee der Gesamtgestalt ausgehend rückwirkend. Nach morphologischem Muster muss die Gestalt der Ganzheit irgendwie schon in ihren Elementen genetisch angelegt sein. Wilhelm Dilthey stimmte dem zu und stellte fest, dass Verständnis von etwas erst aus dem Ganzen heraus möglich sei. Auch im geisteswissenschaftlichen Bereich weise das Ganze als Ganzheit über seine eigene Existenz hinaus in die Kategorie des Seelischen, des Lebendigen, von Idee und Sinn (Dilthey 1900, S.43) – auf ein Feld also, dass uns emotional-sinnlich zugänglich ist und von dem her ein Phänomen deduktiv wahrgenommen werden kann. Auf die Stadt V ... wie zum Beispiel Rechtssystem und Staatlichkeit. 16 übertragen bedeutet dieser Ansatz: in sofern sie eine unbewusst oder gewollt ganzheitliche Betrachtung erfahren soll, offeriert die sinnliche Ebene der Wahrnehmung einen Zugang dazu. Von der sinnlichen Wahrnehmung herrührend werden die komplementären Einzeltatsachen in die Sinnhaftigkeit des ganzen transzendiert. Nach der Gestalttheorie von Ehrenfels’ tastet sich die Wahrnehmung auf dem selben Weg e wie die Gestaltbildung voran - nämlich von der Gesamtgestalt zur Einzelheit. Das phänomenale Lesen urb aner Zusammenhänge muss also von einer intuierten Ganzheit ausgehen, bevor es sich auf sie richtet. Aber in der Realität laufen die Bewegungen des Verstehens - Heideggers Sinnbild des «hermeneutischen Zirkels» vergleichbar (siehe Abschnitt IV.1.) - in konzentrischen Kreisen immer vom Ganzen zum Teil und zurück zum Ganzen, um die Einheit des verstandenen Sinns zu erweitern und gleichzeitig die Richtigkeit des Verstandenen zu überprüfen (Gadamer 1960, S.199). Offensichtlich schließt die von Ehrenfels’sche Lehre an Immanuel Kant an, nach welchem dem Subjekt das apriorische Vermögen gegeben ist, Formen wahrzunehmen. Das Organ des Vermögens der Formwahrnehmung sei der Geist, sagte Kant. Dieser filtere das Mannigfaltige formal und nehme es geordnet auf. Gleichzeitig formulierte Kant die Konzeption eines synthetisch formenden, die Gegenstände der Erfahrung erst hervorbringenden Denkens (Scheler 1977, S.79). Praktisch vollzieht von Ehrenfels das am Beispiel der Musik nach: hätte der Zuhörer nicht - zum Beispiel aufgrund der Harmonie - eine unbewusste Vorahnung (Intuition) von einer Melodie, würde er immer nur Töne hören und könnte sich höchstens an die bis zum Augenblick verklungenen Töne erinnern, sich aber nie dem Genuss des Klangs der ganzen Melodie hingeben (von Ehrenfels 1890, S.12). Leider bleibt von Ehrenfels in seinem Aufsatz «Über Gestaltqualitäten» bei der bloßen Bemerkung stehen, für Raumgestalten müsse dasselbe gelten, ohne hier weiter auszuführen... Eins leuchtet dennoch ein: beim Hören einer Melodie ebenso, wie bei der räumlichen Wahrnehmung, geht der erste Eindruck von der Wucht der Ganzheit aus(!), bevor er auf Details au fmerksam wird. Wir kennen das, wenn wir zum Beispiel aus dem U-Bahn-Schacht auftauchen und plötzlich mitten auf einem hellen Platz stehen. Ganzheitlichkeit wird a priori als Wert und Möglichkeit gesetzt. Kant hatte das schon angedeutet als er sagte, Erkenntnis könne zwar nie über Erfahrung hinausgehen, sei dem Menschen aber trotzdem zum Teil a priori gegeben (Russell 1999, S.714). Aufgrund des menschlichen Vermögens, a priori um Formen zu wissen, können Gegenstände, Erscheinungen und Phänomene sowie Raum erkannt werden. Kant suchte für diese Tatsache nach einer Erklärung. Er vermutete, dass die phänomenale Wahrnehmung der Raumgestalt auf dem geistigen, dem Menschen apriorisch eingegebenen Geometriebegriff basiere (Russell 1999, S.715). Mit der Hermeneutik entwickelte sich im 18.Jahrhundert die Theorie der Wahrnehmung weiter. Die Hermeneutik integrierte die Erkenntnisse der Wahrnehmungstheorie in ihr Denken und behauptete, die reale Welt unserer Wahrnehmung sei keine Dingwelt, sondern bestehe aus einer Vielzahl von mehr oder minder bildhaft beschriebenen Sachverhalten (Eco 1990, S.259). Auf einer dünnen Gradlinie zwischen Semiotik und Hermeneutik wurde behauptet, die Welt repräsentiere sich nicht selber, sondern allein durch die Beschreibungsgesamtheit von ihr. Damit erschien die Welt plötzlich als eine mögliche Welt, als ein kulturelles Konstrukt. K o m p l e x i t ä t u n d D i s p e r s i o n . Der Entwicklungsgrad einer Stadtkultur drückt sich im Grad der Arbeitsteilung der in ihr ablaufenden Geschehnisse und Prozesse aus. Dazu zählen nicht nur Arbeitsprozesse, sondern die ganz umfassende Organisation des täglichen Lebens. In seinem Buch «Fleisch und Stein» hat der amerikanische Soziologe Richard Sennett die Entwicklung der Stadt auf dem Weg zu einem Organismus eingehend dargestellt (vgl. Sennett 1995, S.315ff.). Der Vergleich der Stadt mit einem Körper unterstreicht die anthropologische Dimension der Stadt, die im Abschnitt II.3 betrachtet wurde. Aus der Anthropologie wissen wir um die natürliche Regel, dass der Grad der Ganzheit bei Organismen mit zunehmendem Entwicklungsgrad rückläufig ist. Das heißt, Prozesse artikulieren sich um so ganzheitlicher und zielhafter, je primitiver sie sind (Scheler 1995, S.74), wohingegen solche, die sehr stark differenziert ablaufen, im Maß der Ausprägung von Ganzheitlichkeit und Geschlossenheit rückläufig sind. Jedes hoch entwickelte, weit ausdifferenzierte Gebilde büßt also ganz natürlich an Gestaltungsvermögen ein. Die Stadt der arbeitsteiligen Gesellschaft ist ein solcher stark ausdifferenzierter Organismus. Die mit der Arbeitsteilung zunehmende Routine ausdifferenzierter Handlungsmuster führt dazu, dass komplexe Assoziationen in Einzelassoziationen zerfallen (Scheler 1995, S.28). Mit Beginn der Neuzeit ist die städtische Akkumulation aufgrund fortschreitender Arbeitsteilung und Spezialisierung ein der Dispersion zustrebender Organismus. Der öffentliche Raum ist tendenziell durch die qualitative Auflösung seiner Geschlossenheit gekennzeichnet. Nur mit einer bewussten Willensentscheidung kann dagegen opponiert werden. 17 III.2 Sinn und Ver stehen Die Sinnforschung wird meist als Wesensforschung betrieben – in Form von philosophischer Anthropologie, Phänomenologie, Ausdruckskunde, Existenzphilosophie etc.. Sinn fühlen und Sinn verleihen sind zwei Seiten derselben Medaille. Den Sinn in der Lebensumwelt Stadt zu fühlen, hängt eng mit der Textmetapher zusammen, denn in der Idee des Vorhandenseins von interpretierbarem Text ist der Wunsch des Menschen auf Sinnzugang zu den Phänomen gewissermaßen vorgeprägt. Wie im Abschnitt III.1 begonnen auszuführen, ist die Möglichkeit, in etwas Sinn zu sehen gegeben, wenn Gestalt oder Gestaltung erkennbar ist. Heidegger brachte das Verstehen einer Sache mit dem Darin-Sinn-Sehen zur Deckung und sagte: „Sinn ist das, worin sich Verständlichkeit von et was hält.“ (Heidegger 1935, S.151) Sinn und Verstehen sind die zwei Seiten ein und derselben Medaille. Wenn wir verstehen, verstehen wir immer Sinn. Der französische Philosoph Henri Bergson (1859-1941)VI ging dieser These Heideggers vorgreifend nämlich davon aus, dass wir Sinn nicht erst über den Umweg der Wahrnehmung von Lauten oder Bildern erschließen, sondern wir uns bereits bei der B enennung der Dinge «auf Anhieb» im vorverstandenen Sinn niederlassen. „Der Sinn ist gleichsam die Sphäre, in die ich bereits eingeführt bin, um die mögliche Bezeichnung vorzunehmen und selbst noch die entsprechenden Bedingungen zu denken.“ (Deleuze 1993, S.48) Denn erst, wenn der Sinn von etwas allgemein bekannt und legitimiert ist (also konventioniert), sei die Bezeichnung ei ner Sache überhaupt möglich. Sinn ist mit Bergson nicht Resultat des Verstandenhabens, sondern vorausgesetzte Vorahnung, „sobald ich zu reden beginne; ohne diese Voraussetzung könnte ich gar nicht beginnen“ (Deleuze 1993, S.48). Sinn ergibt sich in erster Linie aus der persönlichen Beziehung, die ein Mensch zu der Sache unterhält. Das Sinnverlangen ist ein existenzielles Verlangen des Menschen. Die Sinnvergabe fordert den Menschen in seiner Fähigkeit heraus, das Ding zur Hälfte zu verstehen und zur anderen Hälfte zu schätzen. Im Industriezeitalter nun hat sich vornehmlich die Frage nach dem Zweck an die Stelle nach dem Wesen oder Sinn – zum Beispiel der baulich-räumlichen Umwelt - gesetzt. Heidegger hatte einen Schritt in dieser Richtung unternommen, denn er ersetzte die antike philosophische Wesensfrage nach dem «Warum» (etwas da sei) durch die aktuellere und lockere Fragestellung nach dem «Worumwillen». Worumwillen zu fragen zielt darauf ab herauszubekommen, woraufhin etwas gestaltet werden kann, um „Sinn zu machen“ (making sense) – eine Wortverbindung, die sich aus dem angloamerikanischen in den lateinischen Sprachschatz eingebürgert hat, in dem sie bislang fremd war. Überall in der Stadt wird heute versucht, Sinn zu produzieren anstatt gegebener Sinn verstanden. Nicht mehr auf die gewaltsame, sondern auf die vollkommene Verfügbarkeit der Realität ist heute das Sinnverlangen gerichtet (Blumenberg 1999, S.10). Diese kritische Position würde ein lesendes Verstehen zumi ndest temperieren. Ich möchte an dieser Stelle noch die Kategorien Erkennen und Verstehen auseinander zu halten, um deutlich zu machen, dass sich ein Lesen mit der Sinnfrage abmüht, ohne sie zu besetzen. Für die Kategorien Erkennen und Verstehen trifft folgende Differenzierung zu: das Erke nnen ist auf das Wesen einer Sache gerichtet, wohingegen das Verstehen auf den Sinn gerichtet ist. Heideggers Frage nach dem «Worumwillen-etwas-da-ist» hat den Charakter einer Verständnisfrage, währenddessen die alte «Warum-Frage» eine Erkenntnisfrage ist. Die vier Begriffe Wesen, Sinn, Erkennen und Verstehen aus den Bereichen der Ontologie (Wesen und Sinn) und Erkenntnistheorie (Erkennen und Verstehen) treten bei genauerem Hinsehen einander verschränkt gegenüber. Darum werden sie nach meiner Ansicht gerne in eine falsche Beziehungen zueinander gesetzt - nämlich ein Wesen «verstehen» zu wollen (wo man es doch nur «erkennen» kann) und einen Sinn «erkennen» (den man doch nur «verstehen» kann). Die korrekt sich gegenüberstehenden Paare lauten Wesen-Erkennen und SinnVerstehen. Wie der deutsche Mathematiker, Logiker und Philosoph Friedrich Ludwig Gottlob Fr ege (1848-1925) feststellte, besitzt «Sinn» eine gleichmäßige Extension und Ruhe, dagegen «Bedeutung» eine sprunghafte Intention (Gerichtetheit) und Bewegung (Mersch 1998, S.19). Der Verwechslungsgrund der Zuordnung der Begriffspaare mag in einer Verschränkung der Dynamiken zu suchen sein, die Gottlob Frege differenzierte. Denn das tiefe, in letzter Instanz auf das Weltganze gerichtete Sinnverstehen ist aufgrund VI 18 ... seinem Kollegen Gilles Deleuze zufolge, auf den ich mich hier beziehe seiner ontologischen Dimension (Dasein = Verstehen) von einer merkwürdigen metaphysischen Trägheit bestimmt – darin der Kategorie des «Wesens von etwas» ähnlich. Erstaunlich ist nun, dass dem metaphysischen «Wesen» mit dem weitaus dynamischeren Prozess der «Erkenntnis» zu Leibe gerückt wird, während dem «Sinn», der wankelmütig und weitaus dynamischer als das «Wesen» ist (da er ja von der subjektiven Auslegung abhängen wird), mit dem metaphysischen Instrument des «Verstehens» nachgegangen werden soll – eine Tatsache, die auch zur Revision der Werte beitrug. Eine Fußnote: Apropos Sinn darf hier folgendes nicht verschwiegen werden. Auf den allgemein positiv belegten Sinnbegriff ist durch den Faschismus ein Schatten gefallen. Denn „in einer Zeit, in der Auschwitz möglich gewesen ist, fällt es schwer, dem Weltlauf noch einen Sinn zu verleihen“ (Sauerland 1979, S.105). Bevor die programmatisch betriebene Ausrottung des Menschen durch den Menschen möglich war, hatte die Natur scheinbar alle Kontingente vorgehalten, als s innvoll entdeckt und ausgefüllt zu werden. Danach trat das Absurde (zum Beispiel die Möglichkeit der totalen Vernichtung durch Atomwaffen bis heute) an die Stelle des Sinns - aber nicht in Form eines Nihilismus (die Feststellung der Abwesenheit von Sinn) -, sondern in der Form, Sinn zu einer Verhandlungsgröße erklärt zu haben. Erst die Sinnskepsis aber befähigte uns, sich mit Phänomenen wie Sinnverlust, Sinnlosigkeit oder scheinbarem Sinn auseinander zu setzen (Sauerland 1979, S.109f.). Kapitel I V Das Lesen IV.1 Hermeneutik Die Hermeneutik ist die Wissenschaft vom Verstehen. Verstehen ist Auslegen und die Hermeneutik die Kunst der Auslegung. In diesem Abschnitt betrachte ich, wie sich die Hermeneutik von der Fixiertheit auf Schrift entfernt hat und auf die Auslegung potenziell aller Zusammenhänge übertrug , die einen Textcharakter besitzen. Was Text ist, hat Vilém Flusser folgendermaßen auf den Punkt gebracht: „Etymologisch bedeutet das Wort «Text» ein Gewebe und das Wort «Linie» einen Leinenf aden. Aber Texte sind unfertige Gewebe: Sie bestehen aus Linien (der «Kette») und werden nicht, wie fertige Gewebe, von vertikalen Fäden (dem «Schuß») zusammengehalten. Die Literatur (das Universum der Texte) ist ein Halbfabrikat. Es verlangt nach Vollendung.“ (Flusser 1992 b, S.36) Ursprünglich ist die Hermeneutik das „kunstmäßige Verstehen von schriftlich fixierten Lebensäußerungen“ (Dilthey 1900, S.39). Keine persönliche, menschliche Lebensäuß erung zeichnet sich durch eine größere Dauerhaftigkeit aus als die schriftlich festgehaltene. Immer geht das wirkliche, verstehen-wollende Lesen hermeneutisch vor. Gegenüber anderen Verfahren bietet die Hermeneutik die Chance, sich einen Zugang zum Lesegegenstand zunutze zu machen, der den Gegenstand relativ integer und vom Leseergebnis relativ unberührt lässt. Der hermeneutische ist ein sanfter Zugang. Das griechische Wort «hermeneuein» bedeutet verkünden/ dolmetschen. Der Mythologie nach überbrachte der Götterbote Hermes (daher der Name) den Menschen die Botschaften der Götter und erklärte sie ihnen. Erstaunlich ist, dass er die Botschaften nicht einfach verkündete, wie sie der Christengott später verkündete. Die Vermittlertätigkeit Hermes’ verweist vielmehr auf die Bipolarität von Verstehen und Erkennen und auf die Verantwortung des Interpreten. Klar ist, dass Hermes die Verantwortung zukam, die Botschaften korrekt auszulegen, denn hinter der Auslegung verschwindet die ursprüngliche Botschaft fast völlig. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr, sofern nicht direkt verkündet, sondern durch einen Mittler ausgelegt wird. Wenn die Botschaft die Menschen auf die eine oder andere Weise erreichen sollte, musste man im Prinzip nicht Gott huldigen, sondern Hermes gewinnen und notfalls bestechen. In der angewandten Praxis konzentrierte sich die antike griechische Kunst der Auslegung im Wesentlichen auf die Schriften Homers. Das Christentum adoptierte das Verfahren und legte den «einen Text» aus - die Bibel. Vor dem Erscheinen der Heiligen Schrift hatte Gott nicht ausgelegt werden müssen, sondern er offenbarte sich direkt in den Dingen, Erscheinungen und Phänomenen oder wurde 19 durch seine Jünger offenbart. Der Wortlaut der Bibel nun stellte sich zwischen die Menschen und die reale Welt. Der biblische Text vermittelte. Durch die Buchstaben hindurch musste auf die Realität geblickt werden und umgekehrt, die Realität mit Hilfe dessen, was in der Bibel geschrieben stand, gedeutet werden. Die Geschichte des Abendlandes ist somit seit Jahrhunderten schriftbestimmt. Auf der Interpretation des biblischen Textes fußt der größte Teil der zivilisatorischen Entwicklung Europas. Er ist der «Grundtext des Westens», als den ihn Flusser bezeichnete. Die beständige Reinterpretation dieses Urtextes – wenngleich dieser als solcher im Laufe der vielen Übersetzungen weitgehend verloren gegangen und stattdessen von Schicksalen ausgefaltet worden ist (Flusser 1992 b, S.38) - lässt die Hermeneutik als kulturelle Erneuerungspraxis erscheinen, in der alles Neue erneuertes Altes ist. Und in der Tat, die sich nacheinander durch die Geschichte ziehenden Neugründungen religiöser Orden kommen immer dann zustande, wenn einige Bibelexegeten einen eklatanten Widerspruch zwischen dem vermeintlichen Wortlaut der Heiligen Schrift und der herrschenden klösterlichen Lebenspraxis sahen. Ordensneugründungen setzten stets an dem ursprünglichen Wortlaut der Bibel an. Dass es trotz dieses Zirkulierens Fortschritte in der Entwicklung der Kirchenorden gab, lag offensichtlich an der durch den gesellschaftlichen Entwicklungsstand jeweils gewandelten Sicht auf das, was sich im Grunde nie änderte. Man könnte auch sagen, der Ursprung des Neuen aus dem Immer-schon-Gelesenen liegt sozusagen im Fehllesen (Honold 2000, S.14). Michele Foucault erklärt die Entwicklung und Erneuerung des Alten durch die Praxis der Interpretation folgendermaßen: „Wenn [...] Interpretieren heißt, sich eines Systems von Regeln, das in sich keine wesenhafte Bedeutung besitzt, gewaltsam oder listig zu bemächtigen, um ihm eine Richtung aufzuzwingen, es einem neuen Willen gefügig zu machen, es in einem anderen Spiel auftreten zu lassen und es anderen Regeln zu unterwerfen, dann ist das Werden der Menschheit eine Reihe von Interpretationen.“ (Foucault 1974, zit. in: Kammler 1990, S.52) D i e A u s l e g u n g d e r B i b e l . Zu einer Methodik des Verstehens formte sich die Hermeneutik mit dem Protestantismus. Im Gegensatz zum Katholizismus legte der Protestantismus das M oment der Tat aus den Händen Gottes in die aktiven Hände des Menschen. Tendenzieller ist der Protestant ein Atheist, der Gott um seine Schöpfungskraft beerbt. Um handlungsfähig zu sein, wurde es im Zeitalter der Aufklärung notwendig, den Blick von Gott abzuwenden und unter Abschaffung der Vermitteltheit durch den «einen Text» direkt auf die Tatsachenwelt zu richten. Aber es war unmöglich und sinnlos, den Text als Vermittler generell abzuschaffen, um eine direkte Schau auf die Welt zu haben, wie das zu Beginn des 20.Jahrhunderts Anthroposophie und Theosophie erreichen wollten. Der «eine» wurde durch viele Texte ersetzt, welche die direkte Schau der Realität gleichzeitig verstellten und überhaupt erst ermöglichten. Odo Marquardt stellte fest, dass sich in der Zeit der Konfessionskriege (16.Jahrhundert) der eine, «absolute» Text der Gesellschaft (die Bibel) aufgabelte – zuerst in zwei, den katholischen und den protestantischen Text, und von da ab immer weiter. In dieser Entwicklung überwandt die Hermeneutik ihre theologische Gebundenheit und ihren Dogmatismus. Sie wandelte sich zu einer Kategorie des Lebens, an der sich die Gesellschaft schulte und tolerant wurde. Denn die Spaltung in Katholizismus und Protestantismus mit gleichwertigem Wahrheitsanspruch(!) des Bibelverständnisses machte eins deutlich: Es hatte gar keinen Sinn mehr über den vermeintlich einzigen Sinn zu streiten, d enn, wie man sah, konnte für jeden Leser derselbe Text etwas anderes bedeuten. Für Marquardt beginnt damit die Neubestimmung des Menschseins als Sein zum Text (Marquardt 1995, S.131). Denn vorher war das Lesen dogmatisch gewesen: es war ein Vorlesen der Prediger gegen die Zuhörer. Eine subjektive, metaphorische Interpretation und Mündigkeit waren nicht möglich. Über das gesamte Mittelalter und die Renaissance hatten die Bibelexegeten den Zuhörern lohnendes Wissen vorgegeben und nicht lohnendes Wissen ausgeschlossen. Die Bibel erfüllte eine ideologische Funktion als freundlich-unwillige, drohende, düstere Mitteilung Gottes an den Menschen (Blumenberg 1983, S.11). Im Zuge der Aufklärung ab dem frühen 17.Jahrhundert veränderte sich die Stellung des «ersten Buches» in der Gesellschaft. Schon im 16.Jahrhundert hatte mit dem Protestantismus pri nzipiell jeder das Recht erhalten, die Bibel eigenverantwortlich zu lesen. Das lutherische Fundament des guten Jetztund-Hier-Gewissens im protestantischen Glauben hatte den Schritt ermöglicht und gefordert, die Lektüre der Bibel zu öffnen. Mit der Subjektivierung dieses «ersten Buches» und dem unmittelbaren, potentiell allen Menschen möglichen Zugang zur Heiligen Schrift und zur Schrift im allgemeinen öffnete sich die Welt der Interpretation. Allerdings war die Methode der Textauslegung schon vorher in säkularen Bereichen verbreitet - besonders in der Philosophie und Jura, denn um Fachtexte zu verstehen, hatte man zu keiner Zeit auf Hermeneutik verzichten können. Nun musste di e Hermeneutik 20 aber mit den Ansprüchen der Aufklärung im 17./ 18.Jahrhundert auch wissenschaftlich adäquat erneuert werden. W i s s e n s c h a f t l i c h e H e r m e n e u t i k . Der evangelische Theologe und Philosoph Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) war es, der andere Literatur in der Wissenschaft und Gesellschaft gleichberechtigt neben die Bibel stellte. Die Welt geriet damit in eine individuelle Verfügbarkeit. „Dieser neue Individualismus hat seinen Philosophen in Schleiermacher gefunden.“ (Simmel 1984, S.94) Als Theologe orientierte Schleiermacher selbstverständlich in erster Linie darauf, mit der Emanzipation aller Texte durch Liberalisierung die Macht des christlichen Glauben zu retten. Aber das gelang ihm nicht. Die die Gesellschaft kontrollierende Bibel- und Schriftinterpretation durch die Kirche verschwand völlig. Das Lesen wurde zu einem kreativen, subjektiven Akt und mithin Gesellschaft und Denken unkontrollierbar. Aber noch mehr veränderte sich: Aus der apriorischen Konstatierung des vorher in der Welt schlummernden «Sinns» wurde dynamisch-schöpferischer «Zweck». Da sich die eine Welt von Gottes Schöpfung in viele Welten menschlicher und somit in fehlbare Interpretationen aufspaltete, wich das apriorische Weltvertrauen und Weltbehagen einem Weltunbehagen und bisweilen einem Weltentsetzen (Wetz 1993, S.112). Hieß es vorher, Gott spreche in der Welt, kehrte sich die Lage nun um: Wenn Gott weiterhin sagen wollte, musste er zu aller erst auf ein Auch-Hören-Wollen des Lesers treffen. Aber allgemein hatte sich der Leser emanzipiert und fortan mehr zu sagen. Schnell griff eine gewisse «Wut» des säkularen Verstehens um sich. In der ersten Phase des Schaffens Schleiermachers beobachtete und kritisierte er diese Verstehenswut aus der Befürchtung um Sinnbetrug und Unsinnigkeiten, die allein und unkritisierbar durch Vernunft und Verstand gerechtfertigt würden (Hörisch 1998, S.61). Im Jahre 1810 gründete Wilhelm von Humboldt (1767-1835) die Berliner Universität. Bei der geistigen Grundlegung und dem Aufbau der Akademie unterstützte Schleiermacher von Humboldt maßgeblich. Zusammen mit Georg Friedrich Hegel und von Humboldt lehrte Schleierm acher dann in Berlin. Von Humboldt selbst war Sprachforscher und so fügte sich Schleiermachers Verdienst, die philologische Interpretationstheorie der Hermeneutik zur allgemeinen Grundlage der Sprach- und Literaturwissenschaft zu erheben, in das adäquate Spektrum einer geistigen Ausrichtung der Wissensvermittlung, in der Narrativität und Kontemplation sowie die Selbsterlangung von Wissen seitens der Studenten eine Einheit bildeten. Schleiermacher sah in der Universität ein Hort narrativen Wissens, ... „... der Darstellung der Gesamtheit der Erkenntnis [...], indem man die Prinzipien und gleichsam den Grundriß alles Wissens auf solche Art zur Anschauung bringt.“ (Schleiermacher 1808, zit. in: Lyotard 1999, S.102) Die Bedeutung der Hermeneutik als Methode beschränkte sich indes nicht allein auf die Wissenschaftstheorie. Unter den aufgeklärten Schichten des Bürgertums erlangte das lesende Verstehen eine diffus verbreitete, ganz grundsätzliche Alltagsrelevanz. Die Evolutionslehre Charles Darwins (18091882) zwang geradezu, die traditionell metaphysische Weltsicht in der Mitte des 19.Jahrhunderts zu revidieren und durch die Auffassung eines prozesshaften, beständigen Werdens, Wachsens und Vergehens zu ersetzen. Ganz neue Wissenschaften mit dezidiert hermeneutischem Ansatz entstanden – zu den ersten dieser Art zählte um 1800 die Morphologie. D i e G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n . Der deutsche Philosoph Wilhelm Dilthey (1833-1911) führte die Bedeutung der Hermeneutik für die konkrete Textauslegung über die Literaturwissenschaften hi naus. In der Literaturwissenschaft ging es der Hermeneutik um die sinnlich erfassende, ganzheitliche Wahrnehmung von literarischen Werken. Dilthey übertrug dieses Konzept auf die Geisteswissenschaften (Soziologie, Geschichte, etc.) und führte damit diesen Wissenschaftsbereich in die Legitimation. Die Hermeneutik stellte für ihn das Organon der Geisteswissenschaften dar, innerhalb welcher sich die Soziologie (das interaktive, soziale Handeln) mit der Welt des objektiven Geistes beschäftige (Dilthey 1900, S.34ff.). Die Idee des „objektiven Geistes“ hatte Dilthey von Hegel übernommen. Während die Naturwissenschaften die Welt anhand von Gesetzmäßigkeiten erklären – Gesetze, deren «absolute Wahrheit» sich in den Dingen selber beweisen lässt -, wird der Welt des Menschen und seiner Taten dagegen - zum Beispiel der in der Stadt fixierten Geschichte, da sie Kunst ist - eine interpretierende Ausprägung zuteil. „Die Kunst hat mit «relativer Wahrheit» zu tun, das heißt mit der vom Willen des Menschen gesetzten Wahrheit, die sich in menschlichen Schöpfungen offenbart. Doch gibt es Berührungspunkte zwischen der absoluten und der relativen Wahrheit.“ (Wittkower 1969, S.58) Während der Naturwissenschaftler seine Erkenntnisse auf den Forschungen seiner Vorgä nger aufbaut, 21 die für ihn nur insofern interessant sind, als dass sie ihm beim eigenen Forschen helfen, interessiert sich der Geisteswissenschaftler für die Hinterlassenschaften seiner Vorgänger, die er interpretiert. „Er ist an Zeugnissen nicht insofern interessiert, als sie aus dem Strom der Zeit auftauchen, sondern als sie in ihm untergegangen sind.“ (Panofsky 1996, S.11) Auf der Basis der Grundannahme eines sozialgeschichtlich objektivierbaren Geistes befreite Dilthey die Interpretation von ihrer bis dato ausschließlich subjektiven Konnotation. Er legte ihre Allgemeingültigkeit und Verallgemeinerbarkeit dar. Das Aufzeigen der Möglichkeit einer Verallgemeinerbarkeit und somit Objektivierbarkeit von Empfindungen und Gefühlen und allgemein von immateriellen, sich mit dem Leben beschäftigenden Fragestellungen, berechtigte Dilthey zu Abgrenzung und Definition der wissenschaftlichen Eigenständigkeit der Geisteswissenschaften. Gadamer würdigte die romantische Profilierung einer geisteswissenschaftlichen Eigenständigkeit und Gleichwertigkeit gegenüber den Naturwissenschaften durch Dilthey als größte Leistung des 19.Jahrhunderts (Gadamer 1960, S.187). D i e E n t w i c k l u n g d e r r e l a t i v e n R e g e l s t r e n g e d e s V e r s t e h e n s . Neben dem Idealismus Hegels brachte die Theorie der Verallgemeinerung subjektiver Lebesausdrücke Dilthey dem Positivismus nahe. Aber genau da negierte er den Positivismus in doppelter, dialektischer Hins icht. „Das innere Bedürfnis des menschlichen Gemüts nach einem Sinnzusammenhang des Ganzen, der auch den Sinn des eigenen Lebens und Strebens im Einklang mit der Natur begründen möchte, war durch die Wissenschaft und ihre theoretische Rechtfertigung nicht zu befriedigen.“ (Gadamer 1989, S.20f.) Das erkannte Dilthey und plädierte für ein im Grunde irrationales Verstehen des Lebens und der Geschichte (Störig 1999, S.639)! Dilthey bewahrte damit die Geisteswissenschaften davor, den ihnen notwendigen Status, eine Kunst zu sein, aufzugeben. Obwohl er den Geisteswissenschaften einen den Naturwissenschaften ähnlich strengen Aufbau und eine strenge Methodik vorschrieb, kam es ihm auf einen vertretbaren «Grad» der Aufrechterhaltung einer generellen Nicht-Methodisierbarkeit des Verstehens und der Interpretationsleistung an. Hatte Schleiermacher noch die Hermeneutik als grammatikalisch-philologisches Verstehen angesehen, wandelte Dilthey diese Art in ein psychologischinterpretierendes Verstehen durch Nach- und Neubildung jeder menschlichen Schöpfung mit Werkcharakter um. Die Benjaminsche Einfühlungstheorie ging zu Beginn des 20.Jahrhunderts noch weiter und ließ die generelle Unmöglichkeit des Verstehens nach Regeln deutlich werden (Jung 1990, S.156). Hierin ist eine Rechtfertigung zu sehen, dem Stadtlesen und –interpretieren kein Rezept an die Hand geben zu können. Im Bereich der Geschichte gelang es Dilthey, sich gegen den „beständigen Einbruch romantischer Willkür und skeptischer Subjektivität in das Gebiet der Geschichte“ zu wenden (Dilthey 1990, S.38). Für seinen «Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften» (vgl. ebenda, S.49ff.) benutzte er folgenden Gedankenschluss: In erster Linie sei die Welt um uns herum lebendige Wirklichkeit. Unser Verstand und die Gesamtheit all unserer Gemütskräfte, mit denen wir in eben dieser Wirklichkeit leben, sind dadurch, dass sie lebendige Bestandteile sind, am besten geeignet, die ebenso lebendig geartete Wirklichkeit um uns herum zu erfassen (Jung 1990, S.158). Dilth ey nutzte diesen Moment der Lebendigkeit (im Gegensatz zu einem metaphysischen Ansatz!) - also einer grundsätzlich menschlichen Fähigkeit des Hineinversetzens, Nachfühlens anderer Personen und Nachbildens von Denken und Empfinden -, um die Bedingung und die Möglichkeit geschichtlichen Verstehens begreifbar zu machen. Wie sonst hätte er behaupten können, dass der gegenwärtige Mensch die Charakteristika seiner Vorgänger gleichsam aufgehoben, wie transzendiert in sich trage? Dass überhaupt gedacht werden konnte, jede Stufe vorhergehender Entwicklung in der darauffolgenden aufgehoben wiederzufinden, dafür hatte die Dialektik Hegels den Weg geebnet. Wie es kommt, dass Personen einander verstehen können hatte Dilthey folgendermaßen geschi ldert: eine Person nimmt beim Verstehen fremdseelische Zustände zunächst äußerlich wahr. Aber es bleibt nicht bei einer bloßen Reflexion, sondern komme zu einer „reproduktiven Wiederholung der ursprünglichen gedanklichen Produktion“ (Gadamer 1974, zit. in: Jung 1999, S.155). Jeglic he Wahrnehmung ist also Aneignung, ist – abhängig vom Wahrnehmungsphänomen - bis zu gewissem Grade Einverleibung. Auf der Grundlage eigener Erfahrungen ist der Verstehende in der Lage, eben jene fremdseelischen Zustände auch über historische und kulturelle Distanzen hinweg innerlich nachzubilden und so lebendig wie ein von innen erlebter Zusammenhang zu erfahren. „Wir nennen den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die von außen sinnlich gegeben sind, ein Inneres erkennen: Verstehen.“ (Dilthey 1900, S.35) 22 V e r s t e h e n u n d M ö g l i c h k e i t . Im 20.Jahrhundert wurde Hermeneutik weiter gefasst, und zwar als lesendes Verstehen allgemeiner textlicher oder geisteswissenschaftlicher Zusamme nhänge jeglichen In-der-Welt-Seins. Die existenzialistische Philosophie Martin Heideggers (1889-1976) versuchte die philosophischen Fragen nicht auf den idealistischen Höhen des Geistes (wie Kant) zu beantworten, sondern auf der untersten, existenziellen Ebene des Seins. So ergründete er das Weltverstehen des Menschen nicht als Leistung, die an geistige Kapazität gebunden ist, sondern als Daseinsweise schlechthin. Mit Heidegger wurde das Verstehen zum Existenzial menschlichen Seins überhaupt. Wenn wir sind, seien wir immer verstehend, sagte Heidegger. „Das Verstehen betrifft als Erschließen immer die ganze Grundverfassung des In-der-Welt-Seins.“ (Heidegger 1935, S.144) Die Hermeneutik bekam durch das Werk Heideggers eine grundsätzliche Bedeutung für das Selbstverständnis des Menschen. Die Ontologie wurde zu einer Phänomenologie des Daseins, denn zu verstehen ist eine kontinuierliche Selbstaufklärung des Lebens in seinen Tiefen (Jung 1990, S.159). Heideggers Ontologie übertrug den Begriff des Verstehens auf jegliche Form des Daseins. Nicht nur den anderen Menschen könne man verstehen, oder das andere Wesen, sondern auch Erscheinungen, Phänomene, natürliche wie vom Menschen erschaffenen Dinge gleichermaßen wie auch die organische und anorganische Natur. Heidegger erweiterte den Daseinsbegriff vom Sein als feste Form auf alles „Sein als Möglichkeit“ – also als Sein-Können: „... das Dasein ist ihm selbst überantwortetes Möglichsein, durch und durch geworfene Möglichkeit.“ (Heidegger 1935, S.144) Verstehen ist nichts Statisches, sondern besitze infolge seiner ontologischen Verknüpfung mit dem «Sei n als Möglichkeit» einen Entwurfscharakter. Dadurch bekommt die Existenz eine Richtung. In ihrer Gerichtetheit gleichen sich Dasein und Verstehen. „Als solches Verstehen «weiß» es [das Sein, d.A.], woran es mit ihm selbst d.h. seinem Seinkönnen ist“ (ebenda, S.144), denn alle drei Kategorien - das Sein, das Verstehen und das Möglichsein - sind nicht freischwebend, sondern an Bedingungen und Grenzen gebunden, zum Beispiel an die Grenze, in wiefern dem Sein sein eigenes Möglichsein verständlich ist. D arin hat die Selbstverwirklichung ihre Chance. Die Auslegung im engeren Sinne stellt sich als Ausarbeitung der im Verstehen entworfenen Möglichkeit dar. Auslegung ist Ausdruck des Verstehens und Selbstverstehens. „Das Dasein ist in der Weise, daß es je verstanden bzw. nicht verstanden hat, so oder so zu sein.“ (Heidegger 1935, S.144) D e r h e r m e n e u t i s c h e Z i r k e l . Dasein resultiert aus Vorhabe und Vorsicht als Vorgriff (Heidegger 1935, S.151). Die erste, ständige und letzte Aufgabe der Auslegung, die eine Entfaltung i st, bleibt die Ausarbeitung von Vorhabe, Vorsicht und Vorgriff „aus den Sachen selbst her“ (ebenda, S.153). In diesem Postulat steckt die Dinggebundenheit des sanften Lesens. Da Sein und Verstehen einen allgemeinen Möglichkeitscharakter besitzen und im Laufe ihrer Entwicklung scheinbar verschiedene Möglichkeiten einer Spielidee folgend durchspielen, räumte Heidegger der Möglichkeit ein, dass es dazu kommen kann, sich zu verkennen und zu verlaufen.VII Das Entwerfen (einer Interpretation) hin auf eine im Rahmen liegende Möglichkeit ist aber nicht anders erklärbar als durch ein vorweg genommenes Seinsverständnis – ein Vorverständnis. Das Verstehen besitze demzufolge eine Zirkelstruktur - den «hermeneutischen Zirkel», so Heidegger. Anders als in den mathematischen Wissenschaften beruht die Erkennbarkeit in den Geisteswissenschaften (oder immer dann, wenn sich das lebendige Sein mit sich selbst beschäftigt) auf dieser ontologischen Zirkelstruktur, die der Nacherlebensfähigkeit ähnlich ist, die schon Dilthey theoretisierte. „Alle Auslegung, die Verständnis beistellen soll, muß schon das Auszulegende verstanden haben.“ ( ebenda, S.152) Das bedeutet einen «circulus vitiosus», denn man versteht nur das, wovon man schon irgendein inneres Bild vom Ganzen besitzt, das nicht aus der empirischen Erfahrung erklärbar ist. Auf der einen Seite kann das Verstehen aus ihr nicht ausbrechen, auf der anderen Seite gäbe es gar kein Verstehen, wenn diese Zirkelstruktur nicht vorhanden wäre. Der Zirkel ist positive Möglichkeit für ursprüng liche Erkenntnis. Er ist eine Vorstruktur unseres Daseins. Erkennen ist also streng genommen ein platonisches Wiedererkennen. „Das Entscheidende ist nicht, aus dem Zirkel heraus-, sondern in ihn nach der rechten Weise hineinzukommen.“ (ebenda, S.152) Die «Vor-Urteile» müssen am Ende der Lektüre durch Vernunfterkenntnis kritisch gerechtfertigt werden, wie Gadamer als Maßstab ergänzt – ein Maßstab, der seit der modernen Aufklärung gilt (Gadamer 1960, S.184; 199). Die Aufklärung hatte durch ihr Objektivitäts- und Vernunftideal ganz in der Tradition Auguste Comtes (1798-1957) das empfindungsbegründete Vor-Urteil durch die absolute Vernunfterkenntnis ersetzen wollen, ohne zu verstehen, dass ohne Vorverständnis gar kein Verständnis möglich ist. Dadurch, dass sich die Romantik gegen die absolute Vernunftherrschaft auflehnte, spielte Damit sanktioniert Heidegger meiner Meinung nach auch jede ungerechtfertigte Spielart des Daseins, sofern sie in den natürlichen Grenzen mögliche Seinsweise ist. VII 23 sie eine wichtige Rolle, diesen Irrtum der Aufklärung korrigiert zu haben (Gadamer 1960, S.194) – wenngleich nicht allzu dauerhaft. In der Industriegesellschaft konnte narratives Wissen nur unter dem strengen Legitimierungsmaßstab überleben, wie Lyotard konstatiert. In dieser Strukturierung hat sich geisteswissenschaftliche Wissen formiert und ist dennoch mehr oder minder frei geblieben. „Die Erzählungen sind Fabeln, Mythen, Legenden, gut für Frauen und Kinder. Im besten Fall wird man versuchen, Licht in diesen Obskurantismus zu bringen [...] Es ist die ganze Geschichte des kulturellen Imperialismus seit den Anfängen des Abendlandes. Es ist wichtig, seinen Gehalt zu kennen, der ihn von allen anderen unterscheidet: Er ist vom Erfordernis der Legitimierung bestimmt.“ (Lyotard 1999, S.85f.) H e r m e n e u t i s c h e r U n i v e r s a l i s m u s . Heideggers Nachfolger im Geiste, Hans-Georg Gadamer (geb.1900), befreite die Hermeneutik endgültig von ihren traditionellen Fesseln als Methode des Verstehens und sah in ihr die allgemeine «Philosophie der menschlichen Welterfahrung» (Lessing 1999, S.10). Schon die philosophische Linie des logischen Positivismus versuchte im 20.Jahrhundert, die Vielzahl philosophischer Systeme zu einer positiven Ganzheit zusammenzuführen und Unvereinbarkeiten darin aufzuheben. In dieser Tradition gliedert sich der Versuch Gadamers ein, der Hermeneutik einen ähnlichen universalen Charakter zu verleihen. Die Hermeneutik ist theoretisch dazu geeignet, in alle Wissenschaften Einzug zu halten, so Gadamers Auffassung. Sein Verdienst ist es, dass die Hermeneutik im 20.Jahrhundert eine eigene Schule der Philosophie begründete, denn Gadamer unterstrich die praktische Bedeutung des Verstehens als ein universales Problem – nicht nur für Rede, Text und die philosophische Kategorie des Daseins, sondern für jegliches menschliches Wissen und alltägliches Handeln. Dennoch bleibt die Hermeneutik eine Art methodisches Prinzip und kann gerade wegen ihrer Anwendbarkeit auf die Gesamtheit der Probleme keine Wissenschaft mit eigenem Inhalt sein. Nachdem der Schriftsteller und Kulturwissenschaftler Walter Benjamin (1892-1940) deutlich gemacht hatte, dass es bei der Einfühlung in Sachverhalte des Verstehens keine allgemein verbindlichen Regeln geben kann, klang der Methodenstreit darüber ab, wie denn Einfühlung in der Praxis auszusehen habe. Dennoch übersieht Gadamer keineswegs das grundsätzliche Übersetzungsproblem der Hermeneutik: nämlich ob und wie es gelingt, „einen Sinnzusammenhang aus einer anderen «Welt» in die eigene zu übertragen“ (Gadamer 1974, zit. in: Jung 1990, S.154). Als Wissenschaftshaltung steht die He rmeneutik dem Strukturalismus gegenüber, verschiedenen Kommunikations- und Interaktionstheorien, dem Marxismus, der Psychoanalyse oder Kombinationen (Bogdal 1990, S.20). Heute bedeutet Hermeneutik mehr denn je die „für den Menschen lebensnotwendige Kunst, sich in bestehenden Kontingenzen zurechtzufinden“ (Marquardt 1995, S.20). Um die hermeneutische Vorgehensweise des Lesens deutlich zu machen, ist es angebracht, sie der Semiotik gegenüberzustellen, denn beide Ansätze bedienen sich der Interpretation, um zu hermeneutischem Verständnis bzw. semiotisch-strukturaler Erkenntnis zu führen (Eco 1990, S.29). IV.2 Semiotik im Vergleich zur Hermeneutik Die Semiotik ist die Wissenschaft von den Zeichen. Im Vergleich zur Hermeneutik ist die Sem iotik eine sehr junge Wissenschaft. Sie ist im 19.Jahrhundert als Logik- und Sprachwissenschaft entstanden. Sprache stellt das komplexeste Zeichensystem dar, das der Mensch hervorgebracht hat. Zu Beginn des 20.Jahrhunderts wurde die «Lehre von den Zeichen» dann besonders im angloamerikanischen Raum auf allgemeinere Wissenschaftsgebiete überführt. Besonderer Verdienst kommt dem amerikanischen Philosophen Charles Sanders Peirce (1839-1914) zu, der das Denken konsequent unter der Funktion des Zeichens sah. In dieser Erweiterung des Anwendungsbereiches ist die Semiotik der Hermeneutik ganz ähnlich (wie im Abschnitt IV.1 dargelegt). Die Hermeneutik begreift die Zusammenhänge, die sie untersucht, als Text; die Semiotik sieht in ihnen Zeichen. Da Zeichen eigene Systeme bilden, zählen Gebärden, Gesten, Hinweise etc. zu Zeichen in erweitertem Sinne. Jedes System von Zeichen oder Symbolen ist Sprachform (Mersch 1998, S.7). Sie will die dem Menschen etwas sagen. „Tagelang geht der Mensch zwischen Bäumen und Steinen umher. Selten verweilt das Auge auf einem Ding, nämlich wenn er es als Zeichen für etwas anderes erkannt hat: eine Spur im Sand d eutet auf das Vorbeikommen eines Tigers, eine Pfütze verheißt eine Wasserader, eine Hibi skusblüte das Ende des Winters. Alles übrige ist stumm und auswechselbar; Bäume und Steine sind nur, was sie sind.“ 24 (Calvino 2000, S.17) Im Vergleich zwischen Semiotik und Hermeneutik fällt der Unterschied der Bezugssysteme ins Auge. Die Hermeneutik bezieht sich auf die Schrift, die Semiotik auf die Sprache. Im Gegensatz zu Sprache ist Schrift kein Symbolsystem, denn Schrift kann man lesen. Ein System von Symbolen hingegen kann man nicht lesen, sondern nur besprechen, also diskutieren. Sprechen ist «actio» - ist ein Formen und Bilden im Unterschied zum Schreiben und zum Lesen, welches «passio» ist – ein Aufnehmen, Einverleiben. Die Andersheit der Schrift gegenüber der Sprache hat der französische Philosoph Jaques Derrida in seiner «Grammatologie» eingehend dargelegt. Schreiben ist keinesfalls ein bloßes Niederlegen von Gesprochenem. Die Dialektik von Sprechen und Schreiben entspricht etwa der von Erklären und Verstehen – also Semiotik und Hermeneutik. Semiotik und Hermeneutik stehen sich gegenüber wie das Entziffern von Buchstaben und das Lesen von Text. Die Semiotik geht davon aus, dass die gesamte Wirklichkeit unserer Welt ein kommunikatives Zeichensystem ist und nur als solches überhaupt in unserer Wahrnehmung funktioniert. Wenn wir sehen, sähen wir „Zeichen über Zeichen“ (vgl. Mersch 1998). Die Semiotik findet Parallelen zum Kantschen Ansatz der Sicht auf die Erscheinungen einer Welt, in der hinter der sichtbaren Wirk lichkeit das eigentliche Wesen der Dinge liegt – ein Ansatz, den Walter Benjamin kritisierte. Anders als Kant dagegen hegt die Semiotik nicht die Absicht, das Dahinter aufzudecken, weil es nach semiotischer Ansicht kein Dahinter gibt – hierin ist sie wiederum der Hermeneutik ähnlich. Im Prinzip trachtet die Semiotik, die Kantsche Resignation vor dem in letzter Instanz unerkennbaren Wesen hinter den Erscheinungen der Dinge zu überwinden, indem sie die Zeichenwelt nicht vor die wirkliche Welt stellt, sondern beide an der Oberfläche miteinander verschmilzt. Zeichen sind wie Filter, sind Medien, durch deren Bedeutung hindurch die Welt als Zeichen erschlossen wird. Eine Welt als Zeichen ist dem Menschen aber grundlegend fremd und vorab unverständlich. Im Laufe des Lebens muss er lernen, die Zeichen zu verstehen und sie entsprechend den Anweisungen, die sie bezeigen, zu benutzen – so stellt sich für die Semiotik das Erwachsenwerden dar. Das Subjekt kann mit Hilfe seines Verstandes die Zeichen zum Sprechen bringen, das heißt, sie dekodieren und sich dadurch in der Welt orientieren. Der Erklärungsansatz, den die Semiotik verfolgt, ist ein kausalanalytischer. Ein Zeichen verstehen meint ein Code knacken. „Die harte Wissenschaft des Rätselratens ist daran, alles weiche Interpretieren aus der zu lesenden Welt zu eliminieren.“ (Flusser 1992 b, S.73) Die Welt erkennen heißt, die Bedeutung der Zeichen, welche ja die Dinge und Erscheinungen sind, zu erschließen. Eine Bedeutung erschließen heißt wiederum erkennen, worauf sie hindeutet. Das Zeichen ist ein Zeigen. Zeichen sind somit Funktionen (Mersch 1998, S.9). Funktionen implizieren ein Handeln; sie orientieren auf die Tat. Ein Zeichensystem kommt deshalb einem «denotativen Text» gleich. Aufgrund der Eindeutigkeit der Botschaft ist dieser Text bewusst auf einen Empfänger ausgerichtet, den er zum Handeln anleitet. An dieser Stelle verbinden sich Semiotik und Pragmatismus – nicht zuletzt in persona von Charles Sanders Peirce. Für Peirce nämlich weist das Zeichen in zwei Richtun gen: auf dasjenige, das es bezeichnet sowie auf denjenigen, der es empfängt. Das Zeichen ist Bedeutung von etwas, jedoch hauptsächlich für jemanden(!). Der amerikanische Architekt Kevin Lynch sah in der Orientierbarkeitsanforderung an die Stadt die Forderung nach einem solchen, eher wissenschaftlich gearbeiteten Text des Zeigens, der eine relative Gleichinterpretation von allen Stadtbenutzern zulässt – eine Stadt, die von allen gleichverstanden wird und in der man sich „gut zurechtfindet“ (Lynch 1989, S.13). Die Aussagen der Hermeneutik sind dagegen «konnotative Aussagen», das heißt, sie vermitteln expressionistische, lyrische, mehrdeutige Inhalte, aus denen keine logische Spur zu einer Handlung führt (Lyotard 1999, S.117). Aus hermeneutischer Sicht ist die Stadt keine Gebrauchsanweisung. Wie in Abschnitt IV.1 gezeigt, geht die Hermeneutik nicht von einer dem menschlichen Dasein fremd gegenüberstehenden Zeichenwelt aus, sondern von einer grundsätzlich vertrauten, schon verstandenen Welt (vgl. Platon, Kant, Heidegger). Die Hermeneutik kennt keine Verschlüsselungsmetapher, sondern eher das Gegenteil: das im Gestaltausdruck entschlüsselte Sein. Sofern Texte nicht willentlich zeichenhaft verschlüsselt sind (und ich denke, das sind die kulturellen Texte nicht), geht es auch nicht darum, sie zu entschlüsseln. Statt der semiotischen Kategorie des «Codes» ist «Geschichte» die Kategorie der Hermeneutik (Marquardt 1995, S.136) Im Gegenschluss kann «Geschichte» auch keine wirkliche Kategorie der Semiotik sein – sie ist nur ihr Alibi. Die Hermeneutik stützt sich nicht direkt auf die Dinge. Sie rückt im Gegenteil von den Dingen ab; die Dinge interessieren sie nur in einem Überlieferungszusammenhang (Gadamer 1960, S.209). Das Subjekt der Hermeneutik (der Leser) verhält sich eher zu den Randbedingungen, während bei der Semiotik die 25 Zeichen direkt im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit stehen. Einen Zusammenhang hermeneutisch auszulegen kommt nicht von außen über den Zusammenhang, sondern produziert sich gewissermaßen aus dessen Innerem heraus, dieses Innere umkreisend. Der im Stadttext eing eschlossene Sinngehalt zeichnet sich im Laufe des Lesens gewissermaßen mit jeder umgeschlagenen Seite immer deutlicher ab; ganz klar kann er aber erst hervortreten, wenn die letzte Seite erreicht ist. Erst dann sperrt der Text die Türen auf für das Begreifen des in der Gesamtaussage liegenden Weltbezugs. In der Semiotik sind alle Zeichen gleichzeitig sichtbar und harren der Entschlüsselung auf einen persönlichen Bezug zum Dekodierer hin. An die Stelle des zweckfreien Verstehens der Hermeneutik stellt die Semiotik die nützliche Absicht. Die Semiotik steht – anders als die Hermeneutik - in der positivistisch-pragmatischen Wissenschaftstradition, die in ihrer Art eher den Naturwissenschaft als den Geisteswissenschaften verwandt ist. Dennoch bleibt auch die Semiotik geisteswissenschaftlich konnotiert. Dem Stigma vermeintlicher Unwissenschaftlichkeit versucht sie dadurch zu begegnen, dass sie die wesentliche Grundabstraktion an den Anfang stellt: der gesamten Welt liegt die grundsätzliche Ordnungskategorie der Zeichen zu Grunde. Dass der Mensch die Welt als ein Zeichensystem auffassen soll, ist nach meinem Dafürhalten ein Akt der Willkür in der Form, Dinge und Erscheinungen in der Anschau ung erst zu Zeichen zu machen. „Gegenstand der semiotischen Forschung ist eigentlich alles, weil alles zum Zeichen gemacht und als Zeichen interpretiert werden kann. Das Feld der Semiotik entspricht dem Bereich der menschlichen Kultur selbst.“ (Mersch 1998, S.9) Nach dieser Theorie ist es das Arbeitsfeld der Semiotik, kulturelle Ursachen zu erklären, welche Zeichen hervorbringen, beziehungsweise auf die Zeichen verweisen, wie sie untereinander verbunden sind und eigene Regeln hervorbringen. Die Semiotik behauptet, erst dadurch, dass sich die Welt in Zeichen ausdrückt, eigne sie sich überhaupt für die wissenschaftliche Erkenntnis, Analyse und Erklärbarkeit. Zu einem gewissen Grade scheint es so, als schaffe die Semiotik erst das Problem, für das sie die Lösung darstellt. A r c h i t e k t u r . Im Bereich der Architektur biete die Semiotik, anders als die Hermeneutik, einen praktischen Zugang zu den Phänomenen. VIII Kevin Lynch war einer der ersten, die Mitte der 1960er Jahre den städtischen Raum auf seine Zeichenwirkung untersucht hat. Ihm kommt der Verdienst zu, auf der theoretischen Basis der Semiotik, den Vorrang der visuellen Gestaltung der baulich -räumlichen Umwelt gegenüber der rein funktional-technischen gefordert zu haben. Überhaupt gebührt der Semiotik der Verdienst, das Augenmerk auf die sinnlich-psychologische Wahrnehmung der physischen Realität orientiert zu haben. In seinem Buch «Das Bild der Stadt», das 1965 auf deutsch erschien, ve rtritt Lynch die Auffassung, die Zeichenanalyse stellt die Methode dar, auf deren Basis man die Stadtgestalt und die architektonische Form beurteilen hann. In Bezug auf die zeichenorientierte Wahrnehmung des Menschen, von der Lynch ausgeht, fordert er von städtischen Räumen, drei wesentliche Kriterien zu erfüllen: sie müssen einprägsam, lesbar und vorstellbar sein (Lynch 1989, S.5). Unter Lesbarkeit versteht Lynch eine in erster Linie visuelle Abbildbarkeit, aber kein Verstehen. Es geht ihm um ein reproduziertes Vorstellungsbild. Um eine Stadt aus dem Gedächtnis heraus zu beschreiben, müsse sie ein logisches Vorstellungsbild hinterlassen haben (Lynch 1989, S.175). Aber weder ist Ablesen, das zum Beschreiben führt, gleichzusetzen mit dem Verstehen erwerbenden Lesen, um das es uns geht, noch ist ein bildliches Reproduzieren gleich ein Erinnern. P h i l o s o p h i e . Die Semiotik basiert auf der Philosophie des Pragmatismus. Um diesen Zusammenhang besser zu verstehen, möchte ich ihn hier näher untersuchen. Wie schon weiter oben festgestellt, steht die Semiotik in der Tradition des Positivismus und besonders der Lebensphilosophien des Utilitarismus. Der Utilitarismus war Frucht eines humanistischen Gedankens, der zu Anfang des 19.Jahrhunderts im vorindustriell geprägten England aufkam und in der 2.Hälfte des 19.Jahrhunderts in den Pragmatismus überging. Übersiedler führten utilitaristisches und pragmatisches Denken nach Nordamerika, wo solcherart philosophisches Alltagsdenken zur breiten Grundlage der Gesellschaft wurde. Die amerikanische Verfassung von 1776 fußte auf den utilitaristisch-pragmatischen Prinzipien der angelsächsischen Rechtstradition und prägt die amerikanische Lebenseinstellung bis heute. Der Gedanke des Utilitarismus, als dessen Begründer der englische Jurist und Philosoph Jeremy Bentham (1748-1823) gilt, ging davon aus, dass die Menschen ihr Streben nach dem «Prinzip des größtmöglichen Glücks» motivieren. Aber bald darauf wurde die antike Kategorie des Glücks durch den weitaus moderneren Begriff der Lust ersetzt, der Ähnlichkeit mit Arthur Schopenhauers «Wille» und Friedrich Nietzsches «Dionysisches und Apollinisches» aufweist. Auf die Stadt bezogen leitet sich VIII 26 Wir erinnern uns, dass die Hermeneutik eher theoretisch bleibt. daraus die ethisch-moralische Verpflichtung des Stadtplaners ab, die Stadt so zu gestalten, dass sie zur Quelle täglicher Freude für ihre Einwohner gereiche (Lynch 1989, S.142). IX Dem Utilitarismus entstammt das humanistische Moment des amerikanischen Gesellschafts - und Stadtmodells. Mit ihm paart sich ein missionarisches Moment. Dieses nun entstammt dem Pragmatismus. Mithin ist es nicht verwunderlich, dass der Pragmatismus eine Umformung des Utilitarismus unter den Bedingungen der Industrialisierung ist. Wie der Philosoph Manfred S. Frings konstatierte, herrschte in der Geschichte der Philosophie jeweils «Pragmatismus» vor, wenn der Wirklichkeitsbezug gesellschaftlichen Denkens Vorrang genoss, während «Idealismus» bei vorrangiger Wesensforschung vorherrschte (Frings, in: Scheler 1977, S.IX). Das kommt daher, dass sich der Pragmatismus, wie erwähnt, mit den Dingen und Handlungen beschäftigt statt mit den Ideen. Von den Tatsachen, Früchten oder Folgen, die aus praktischem Handeln resultieren, bedeutet Pragmatismus, von einem möglichen, in der Zukunft liegenden, gewünschten Ergebnis ausgehend, das notwendige Handeln im Jetzt und Hier zu orientieren, um die fernen Ziele zu erreichen. Im Spannungsfeld zwischen Zukunft und Gegenwart – im Gegensatz zur Hermeneutik, die in der Vergangenheit nach dem Verstehen des Heutigen und des Morgigen sucht - sind auch die Wahrheitskategorien des Pragmatismus angesiedelt. Dadurch, dass das Heute im Pragma tismus zur Funktion der Zukunft wird, kann nie etwas als fertig oder abgeschlossen angesehen werden. Die Welt bekommt dadurch etwas sehr Dynamisches. Anstelle der Nichtexistenz eines Endresultats kennzeichnete Kevin Lynch das Eigentliche des semiotisch geleiteten Stadtbauprozesses mit der ständigen Aufeinanderfolge von Phasen (Lynch 1989, S.11). Die Frage nach der Wahrheit im antiken, metaphysischen Verständnis (der Übereinstimmung von Geist und Sache) stellte der Pragmatismus nicht. Für ihn ist wahr, was nützlich ist; und nützlich, was einen Wert (einen Barwert: «cash value») erwirtschaftet oder was zum Erfolg führt. Wie James sagte, ist das wahr, „was sich durch seine praktischen Konsequenzen bewährt“ (zit. nach: Störig 1999, S.640). Der Pragmatismus stellt als Grundfrage nicht die metaphysische Warumfrage, sondern die Bedürfnisfrage. Pragmatismus und Semiotik stützen sich gleichermaßen auf die Empirie. Im Widerspruch zur Ontologie behauptet die Empirie, Erkenntnis komme durch Abstraktion von den Dingen der Wahrnehmung zustande. Das Wesen einer Sache erkennen die Empiriker der Wahrnehmung nachgeschaltet. Wie im Abschnitt IV.1 gesehen, gehen die Hermeneutiker hingegen von einem Vorverständnis einer Sache aus. Die Idee der Sache existiert für sie also vor der Wahrnehmung.X Erkenntnis wird hermeneutisch durch Denken, Reflexion oder Disput gewonnen – pragmatische Erkenntnis hingegen resultiert aus der Arbeit. Das Wesenswissen des Pragmatikers resultiert vornehmlich als Arbeits-, Leistungs- und Lösungswissen. Das auf pragmatischem Wege entstehende Neue verlässt die Spirale des hermeneutischen Zirkels, erneuertes Altes zu sein und ist Überraschung (Scheler 1977, S.22). Z u r ü c k z u r A r c h i t e k t u r . Pragmatismus ist einfacher als Hermeneutik. Denn es ist einfacher, empirische Details im Raum (Häuser) auf eine Ganzheit (Stadt) hin zu synthetisieren, anstatt Einzelteile von der Gestalt und Funktion des holistischen Ganzen her zu betrachten. Von der gestalt des Ganzen auszugehen bedeutet, die gewohnte Verständnispyramide auf den Kopf zu stellen, wie es die Hermeneutik zu tun bemüht ist. Der Vorteil des Pragmatismus allerdings besteht darin, das Handeln aus jeglicher Befangenheit zu lösen. XI Im Gegensatz zur Hermeneutik ist es frei und operationell, seine Die Philosophen Thomas Hobbes (1588-1679) und Herbert Spencer (1820-1903) meinten, wenn alle einzeln nach Glück oder Lust strebten (eine Grundvoraussetzung für Demokratie), funktioniere die Gesel lschaft, Recht Moral etc. ganz von alleine. Darin bestünde auch das Maximum an individueller Freiheit. Der französische Soziologe Emil e Durkheim (1858-1917) widersprach der Auffassung von einer Gesellschaft als bloßes Aggregat von Individuen. Er verband die Geschichtsschreibung mit strukturaler Soziologie und führte den Begriff der Gesel lschaft hinaus in die figürliche Eigenständigkeit eines kollektiven, vom Einzelnen abgelösten Corpus. Zum Beispiel heißt es bei Durkheim: „Recht und Moral sind die Gesamtheit der Bande, die uns miteinander und mit der Gesel lschaft verbinden, die aus einer Masse von Individuen ein kohärentes Aggregat werden lassen.“ (Durkheim, 1988, S.468) Das Individuum befindet sich in der Gesellschaft im Zustand maximaler Abhängigkeiten und nicht in absoluter Freiheit. Nie von der Gesellschaft abgeschieden, sondern nur innerhalb dieser könne es ein moralisches Individuum sein (Durkheim, 1988, S.469). Und nur dort, unter den Zwängen der Gesellschaft, kann das Individuum zur Person reifen - zur autonomen Quelle seines Handelns in freier, gesellschaftsemanzipierter Entscheidung (Durkheim, 1988, S.474). X Max Scheler lehnt beide Standpunkte ab und meint: Wissen komme weder vor noch nach den Dingen, sondern mit ihnen (Frings, in: Scheler 1977, S.XIV). XI In Verlängerung des Positivismus lehnten die Utilitarier alles nicht rational B egründbare ab, wie zum Beispiel die Religion und andere „Absurditäten“. Die Pragmatiker taten das auch, allerdings besaß die Auseinandersetzung mit mystischen Kategorien für sie gar keine thematische Relevanz. IX 27 Inhalte und sein Sinn sind vorgezeigt. Bemerkenswert ist die in der Semiotik hervorgehobene Betonung des beeinflussenden Subjekts. „Um dem Zeichensystem eine Botschaft zu entnehmen, nähere ich mich ihm zunächst in sprun ghafter Weise, mit wild umherzuckenden Augenbewegungen, dann rekonstruiere ich den Zeichencode [...] und färbe den so entstehenden Text ein – mit Emotionen, Empfindungen, Eingebungen, Kenntnissen, Seele -, und alles hängt davon ab, wer ich bin und wie ich zu dem wurde, der ich bin.“ (Manguel 1999, S.51 - unter Berufung auf Al Hakim) Die Semiotik geht von der Wahrnehmung der Welt in Bildern aus, die ja in semiotischem Verständnis komplexe Zeichensysteme darstellen. Die abwesende Orientierung auf eine innere Ganzheitlichkeit maskiert sie mit der äußerlichen, semantischen Überzeugungskraft von Bildern. Das «Bild der Stadt» gilt ihr als Potenzial - als „Feuerwerk“ gestalterischer und sozialer Möglichkeiten, das zu einer funktionierenden, lebensfähigen und gesunden Organisation entzündet werden müsse. Und das gelänge nur, so der englische Stadtplaner Gordon Cullen ganz pragmatisch, indem der Spielraum der wissenschaftlichen Lösungen für die Stadt gestalterisch sinnvoll ausgedeutet wird (Cullen 1991, S.7). Bildzeichen produzieren sich im Kopf aus der Überlagerung zweier zeitlich versetzter Erfahrungen: der unmittelbaren Jetzterfahrung und der Erinnerung an eine vergangene Erfahrung. Darin besteht, Lynch zufolge, die Grundlage sowohl für die Orientierung des Einzelnen, als auch für die Kollektivierung, Gruppenkommunikation und das Sicherheitsgefühl (Lynch 1989, S.14). Zur Gestaltung des Bildes der Stadt schlägt er vor, den Raum mit „Formen, die das Auge begeistern“ zu gestalten (Lynch 1989, S.110). Diese formale Gestaltung unter ästhetischen (und in letzter Konsequenz ideologischen) Gesichtspunkten stehen für «städtisches Leben» (Lynch 1989, S.110). Die Benutzung der Stadt (die Orientierung) erfolgt dekodierend durch die sukzessive Deutung der Bilder hindurch, deren Zeichen der Mensch, wenn er durch die Stadt geht, zu entschlüsseln beschäftigt ist. Urbane Bildzeichen würden das Wohin des Handelns leiten. Da die semiotische Analyse ein Dechiffrieren und D ekodieren ist, leidet aber das umgekehrte Verfahren – der syntaktische Entwurf - darunter, dass die einmal geknackten Codes nicht mehr dieselben wie vorher sind. Sie sind nicht mehr vertextbar sondern nur noch funktional hintereinander schaltbar. In einem solchen Verständnis greift Lynch der Postmoderne vor, in der sich das Individuum zum Rezeptor von in Architektur ausgedrückten Bedeutungsvorgaben wandelt. Das alternierende, europäische Wechselverhältnis zwischen Gesellschaft und Raumproduktion wurde da in die einseitige Richtung der Determinierung der Individuen ausgerichtet. Semiotisch betrachtet, dient die zeichenhaft geplante Stadt dazu (bei positiver Unterstellung), die Einwohner mit Glück und Freude zu berauschen (wie Disneyland) oder zu guten Amerikanern zu machen (auch wie Disneyland). Frank Lloyd Wright (1867-1959) war der Auffassung, wenn jeder Einzelne erst einmal in seinem eigenen Heim in Siedlungsagglomeraten wie «Usonia» lebten, „wäre so der Bürger von Broadacre nicht nur unerschütterlich. Er wäre unverletzlich. Unsere Nation unzerstörbar“ (Wright 1997, S.209). Auf der Grundlage der Semiotik unternahm der amerikanische Mathematiker Christopher Alexander gegen Ende der 1970er Jahre den Versuch, eine bilderorientierte Entwurfssprache zu entwickeln: «A pattern language» (eine Mustersprache). Dezidiert auf Ganzheitlichkeit ausgerichtet, sollte sie von der Regionalplanung bis zur Konstruktion anwendbar zu sein. XII Alexander ging dabei von einer These in der Chaostheorie aus, nach der sich die große Einheit aus selbstähnlichen, immer kleiner gebrochenen Fraktalen zusammensetzen, von der Region über die Stadt bis zum Wohnzimmer . Die «Mustersprache» beginnt so: „Wir beginnen mit jenem Teil der Sprache, durch den eine Stadt oder Gemeinde definiert wird, darauf angelegt, dass jede individuelle Maßnahme zur Entstehung dieser [...] Muster beiträgt, wird langsam und sicher über Jahre ein Gemeinwesen herbeiführen.“ (Alexander 1995, S.3) Alexander ist optimistisch. Am Beginn des ersten Teils der «pattern language», «Städte», wird in regionalem Maßstab ein typisch amerikanisches Siedlungsideal evoziert: in Agglomerationen von «neighbourho ods» finden sich unter dem amerikanischen Verfassungswortlaut chancengleiche Individuen zusammen, die sich mit urbanistischen Vexierbildern ausstatten. «A pattern language» postuliert dieses Siedlungsmodell als das einzig legitim-freiheitliche. Auf der Stadt-, regionalen, Landes- und schließlich Weltebene erhebt es den Anspruch, ein demokratisches Universalrezept für die ganze «Weltgemeinschaft» darstellen zu können. Selbst habe ich diese «Mustersprache» während meiner Architektur-Entwurfsausbildung begeistert studiert. «A pattern language» ist der einzige Versuch, der mir bekannt ist, den städtebaulich-architektonischen Entwurf ganzheitlich im Sinne einer Sprache (und eines Textes) kohärent zu strukturieren. Doch es gibt Grenzen. Die Kritik richtet sich hier vornehmlich auf den Aspekt der weltanschaulichen Ideologie. XII 28 So erfolgreich und qualitätvoll die «pattern language» im Architekturentwurf arbeitet XIII, versagt sie letztendlich in städtischen Maßstab durch ihr missionarisches Diktum. Bei universaler Anwendung liefe die «pattern language» darauf hinaus, alle Kulturen unter die Haube des amerikanischen Ideals zu zwängen. Diesen missionarischen Impetus halte ich für illegitim – ja hier gerät der der Semiotik geschuldete Ansatz sogar zur Falle. F a z i t . Utilitarismus, Pragmatismus und Semiotik sind moderne Philosophien des Protesta ntismus und der Industriegesellschaft. Metaphysik, Idealismus und Hermeneutik hingeg en gehören ihrer Entstehung nach der vorindustriellen Gesellschaft an. Eine utilitaristische Orientierung und ein pragmatisches Handeln haben aber nicht nur die Menschen in Nordamerika, sondern auch in Europa seit der Antike immer begleitet. Allerdings hatten Utilitarismus und Pragmatismus vor der Industrialisierung keine Chance, sich gegenüber den anderen Philosophien durchzusetzen. Erst mit der Industrialisierung haben sie in globalem Maßstab die Oberhand und Dominanz im Denken gewonnen. Es bleibt die Frage offen, ob die verdrängten philosophischen Aspekte der Metaphysik, des Idealismus und der Hermeneutik in erneuerter Form in der nachindustriellen Gesellschaft nicht an ideellem Wert bei der Gestaltung der Lebensumwelt an Bedeutung zurückgewinnen... In den Fällen, in denen der funktionell-semiotische bislang als ausschließlicher Ansatz fungierte, um urbane Phänomene zu begreifen und zu gestalten, lehrt die Erfahrung, dass Lösungen des Erkennens und Erklärens gegenüber Lösungen des Verstehens auf Dauer unbefriedigend sind. Daraus folgt: nicht ein visuelles Image (Leitbild) wie beispielsweise Lynch die Aufstellung eines visuellen Plans fordert, in dem ein visuelles Vorstellungsbild vorgegeben wird (Lynch 1989, S.137), kann ein für die Stadtgestaltung hinreichendes Ideal sein. Zumindest für die europäische Stadt gilt: es liegt in ihren Wurzeln und in ihrer Natur, zum arabesk sich windenden Weg auf der Suche nach Wahrheit zurückzufinden. Ihr Schicksal und Glück ist es, dem Wahrheitsanspruch in seiner Total ität nie gerecht zu werden und die absolute Wahrheit nie zu erreichen, sondern bestenfalls zu umkreisen. Das Sinnverstehen der Wahrheit in der Stadt, das der hermeneutische Ansatz will, fußt - verglichen dem Erklären des semiotischen Ansatzes – auf einer ursprünglicheren, tieferen, elementareren Stufe der Erkenntnistheorie. In ihr ist das Erklären aufgehoben – gewissermaßen umgreift die Hermeneutik die Semiotik. Nach diesen Betrachtungen komme ich nun zum Lesen. Schickt sich jemand an, Städte zu lesen, tauchen viele Parallelen zur Lektüre im wörtlichen Sinne auf. Es lohnt sich daher, den Lesevorgang eingehender zu betrachten. IV.3 Lektüre Einen Text lesen heißt, seinen Sinngehalt epistemologisch zu erschließen und hermeneutisch zu verstehen. Lesen und Verstehen stehen sich dabei nicht wie Mittel und Zweck gegenüber (man liest nicht, um zu verstehen). Es sind auch keine aufeinanderfolgenden Tätigkeiten, denn genau in dem Moment, in dem man liest, versteht man. Lesen und Verstehen sind dasselbe! Da man sich an unverstandenen Text nicht erinnern kann, wird niemand sagen können, er habe das Gelesene erst später verstanden. Allenfalls kann man es später „richtig“ verstanden haben, wenn man es vorher wenigstens irgendwie verstanden hat. Die Interpretation beginnt mit der Initiative des Interpreten und oszilliert zwischen Werktreue und Intention (Eco 1990, S.35). Das Verstehen städtischer Zusammenhänge sucht in zwei Richtungen: nach der Intention der Gesellschaft, im besonderen der Planer, Architekten, Bauherren und Bürgermeisters etc., die den kulturellen Raum hervorgebracht haben und nach der Intention des fertigen Werkes - also nach dem, was der Text unabhängig von der Intention seiner Autoren sagt. In diesem Spannungsfeld umkreist die Interpretation eine objektive Wahrheit, ohne sie je ganz zu erreichen. Ähnliches behauptete Max Scheler, als er sagte: „Alle Tätigkeiten des Denkens, Beobachtens, Erkennens usw. sind nur Operationen, die zu einem Wissen führen - nicht aber sind sie selbst das Wissen.“ (Scheler 1977, S.17) In kleinerem Maßstab (auf der Ebene der Siedlungsgemeinschaft und der Architektur) denkt die Methode sehr schön von Bildmotiven her (den «patterns»). Die Basisbilder orientieren sich an Archetypen (zum Beispiel: Mauer, Weg, Schwelle, Sitzplatz im Schatten etc.), welche der Entwerfer die Aufgabe hat, in einer Grammatik geschickt organisch miteinander zu verknüpfen. XIII 29 Der kulturelle Text einer Stadt ist neutral und zunächst gedanklich frei für jegliche Interpretation eine in bestimmten Grenzen recht unverbindliche Variable. Die Offenheit des Textes macht seine Interpretation potentiell unendlich. Jede Stadt ist - einem literarischen Text gleich - unvollendet und offen. Der Sinn des Textes bleibt in der Schwebe. In dieser Freiheit besteht die Möglichkeit seiner Fortsetzung - seiner Fortschreibung. Eine Bedeutung erhält eine Textaussage hauptsächlich zum Zeitpunkt des Lesens und durch das Lesen. Die Aussage – in sofern sie Wahrheit repräsentiert - bezieht ihren Wahrheitsgehalt nicht nur aus der Wahrheit des oder der Autoren zum Zeitpunkt des Schre ibens (bei der Stadt: zum Zeitpunkt des Bauens), sondern aus der Wahrheit des Interpreten (des Benutzers) zum Zeitpunkt des Lesens. Beim Lesen ergänzt und systematisiert der Leser das Werk. In sofern ist Lesen Schöpfung. „Um einen Text zu verstehen, [...] lesen wir ihn nicht im einfachen Wortsinn, vielmehr konstruieren wir für ihn eine Bedeutung. In diesem komplizierten Prozeß bearbeiten die Leser den Text. Sie erschaffen Bilder und verbale Umwandlungen, um seine Bedeutung zu erfassen. Das Beeindruckende daran ist, daß sie die Bedeutung erst erschaffen, indem sie beim Lesen Beziehungen zwischen ihrem Wissen, ihren Erfahrungen und den geschriebenen Sätzen und Passagen des Textes herstellen./ Folglich ist das Lesen [...] ein verwirrender, labyrinthischer Reproduktionsprozeß, der bei allen Menschen ähnlich verläuft, aber doch einen höchst persönlichen Charakter behält.“ (Manguel 1999, S.52) XIV Auch das Buch der Stadt entsteht erst als Ergebnis des Lesens (des fortdauernden U mgangs mit ihr) und nicht im Akt des Bauens. Das rückwärtige, geistige Verständnis einer Schöpfung besitzt viele mögliche Erklärungen, allein eingedenk der Tatsache, dass ein Werk im Laufe der Zeit eine eigendynamische Entwicklung entfaltet. Die Interpretation einer historischen Überlieferung im Heute auf der Basis des psychologischen Schlusses vom Eigenen auf das zurückliegend Fremde erscheint gleichwohl möglich wie fragwürdig (Jung 1990, S.163). Denn auch der Leser bleibt nicht unb erührt: „Ich, der Leser, finde mich nur, indem ich mich verliere. Die Lektüre bringt mich in die imaginativen Veränderungen des Ich. Die Verwandlung der Welt im Spiel ist auch die spielerische Verwandlung des Ich.“ (Ricœur 1974, zit. in: Jung 1990, S.169) Grundsätzlich kann man davon ausgehen, dass Schreiber und Leser an einem identischen Verstehen interessiert sind. Diese Grundannahme macht es möglich, alte Kulturtexte zu verstehen, auch wenn zwischenzeitlich viele Generationen vergangen sind. Auf dem Wege zur Entdeckung von Wahrheit und Sinn einer textlichen Aussage tun sich viele Hindernisse auf. Zum Beispiel kann der Leser eine Aussage so verstehen, wie der Autor sie gerne hätte verstanden wissen wollen – ganz so, als hätte der Autor die Möglichkeit einer späteren Bedeutungskonstruktion (in ihrer Unendlichkeit) schon im Text angelegt. Freilich kann der Leser den Autor auch gründlich missverstehen. Oder er versteht etwas, das der Autor so zwar nicht gemeint hat (oder nicht einmal daran gedacht hat, irgendetwas zu meinen), der Text aber durchaus eine entsprechende Interpretationen zulässt, von der der Leser dann möglicherweise meint, der Autor hätte genau diese Botschaften im Text versteckt. Er kann die vermeintliche Aussage, die ein Text seiner Meinung nach trifft, teilen oder anderer Meinung sein – dies sowohl aufgrund eines korrekten Verständnisses wie auch eines Missverständnisses. Von der Stadt kommt jede Generation und jede Epoche zu ihrer eigenen Deutung. „Die Literatur richtet sich an einem Empfänger, von dem sie verlangt, daß er sie vollende. Der Schreibende webt Fäden, die vom Empfänger aufgelesen sein wollen, um durchwoben zu werden. Erst dadurch gewinnt der Text an Bedeutung. So viele Leser ein Text hat, so viele Bedeutungen besitzt er [...]/ Also «hat» er kein Schicksal, er «ist» ein Schicksal [...] Das Schicksal, das der Text «ist» (die Botschaft, die er ist), vollendet sich im Empfänger. Unempfangene, ungelesenen Texte sind bedeutungslose Buchstabenzeichen, die erst Bedeutung erhalten, falls sie gelesen werden.“ (Flusser 1992 b, S.36) Bei allem Respekt, den der Leser vor der Wahrheit der Aussage eines Bedeutungszusammenhanges besitzen mag, ist es doch zum einen der weitgehend inobjektivierbare Lesakt selber, der einer Objektivierung der Interpretation entgegengesetzt. Die andere Grenze setzt der subjektiv beschränkte Erlebnishorizont des Lesers. Zum Beispiel sind Grenzen des Verstehens gegeben, wenn wir in unserem Erlebnis- und Erfahrungsschatz nicht mehr das beherbergen, wovon ein Werk Ausdruck ist. Das Erkenntnisresultat des Leseaktes (genau wie die Motivation zu Erkenntnis zu gelangen), ist ein zwar an XIV 30 ... hier unter Berufung auf Merlin C. Wittrocks Studien aus den 1970er Ja hren Objektivität geläuterter, letztendlich jedoch subjektiver Ausdruck der „unhintergehbaren Individualität“ des Leseaktes (Jung 1990, S.172). Er ist nicht methodisierbar und ohne Patentrezept. Das Lesen ist angesiedelt zwischen Materialismus und Theologie. Im ersten Fall regt das Außen das Interesse des Lesers unbewusst an. Meist sind es zuerst die Orte, die wir schön oder an denen wir die Menschen interessant finden. Im zweiten Fall unterwirft der Leser das Lesen einer gerichteten Absicht zum Beispiel kann man Stadt von ihrer Orographie her lesen oder von dem her, wie die Menschen die Stadt benutzen. Oder aber ein Zusammenhang wird auf ein bestimmtes Verständnis hingelesen – zum Beispiel die Stadt als Marginalisationsinstrument sozial schwacher Einwohnerschichten. Im dritten Fall versucht der «geniale Interpret» (siehe weiter unten) in einer persönlichen Gestimmtheit abzutauchen und Materialität und Idealität ineinander zu stülpen. „Es schmeichelt mir der Gedanke, hier im Zentrum der Ausschweifung zu sitzen, und mit «hier» war nich t etwa die Stadt, sondern der kleine, nicht sehr ereignisreiche Fleck g emeint, auf dem ich mich befand. Aber die Ereignisse kamen eben so zustande, daß die Erscheinung mich mit einem Zauberstab berührte und ich in einen Traum von ihr versank.“ (Benjamin 1974, S.115) In jedem Fall führt das Lesen zu einer unheimlichen Vertrautheit mit der Stadt und setzt gleichermaßen deren intuitives Verständnis voraus. In der Umschreibung dessen, worum es beim Lesen geht, und der aufgezeigten Entwicklungslinie der Hermeneutik von der Literatur- auf andere, auch materielle Ausdruckszusammenhänge, wird das Lesen dabei nicht materieller. Es bleibt eine ideelle Kategorie mit hoher Eigenständigkeit. Für einen Augenblick flammt die Tradition des Idealismus auf – zu Recht, denn in eine Ablehnung von Kant und Hegel zu verfallen wäre voreilig, denn nicht zuletzt beruft sich die Grundthese der Lesbarkeit auf ein hohes Maß an Eigenständigkeit des ideellen Produkts. Worte, Sätze und Kapitel (Aspekte des Städtischen) zu lesen und die Inhalte auszulegen, ist ein sehr komplexes Verfahren. Es hängt von vielen Bedingungen ab, die stillschweigend berücksichtigt werden müssen, will man das, was Stadt in ihrer Stadträumlichkeit und Phänomenologie ausdrückt, relativ richtig verstehen. Innerhalb des Bedingungsgefüges nimmt der Leser in seiner Zurückhaltung eine wichtige Stellung ein. Die Art und Weise, wie Zusammenhänge aufgenommen, aufgefasst und verstanden werden, ist stark an die Kompetenz der Persönlichkeit des Lesers gebunden. Die Kompetenz des Interpreten ist das Ergebnis einer langen Sozialisations- und Bildungsgeschichte seiner Persönlichkeit, in der seine Auffassungsgabe an Souveränität gewinnt. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu würde nicht nur die Bildungs-, sondern auch die Klassenzugehörigkeit einrechnen, über welche der Interpret einem strukturellen Wahrnehmungscode folgt (Dörner, Vogt 1990, S.142). Die Person selbst stellt den individuellen Filter des objektiven LesegegenstandesXV dar. „Indem der Leser einen Text liest, erschließt er dessen Bedeutung mit Hilfe eines vielfältig verknüpften Netzwerks aus erlernten Bedeutungen, sozialen Konventionen, früheren Lese - und Lebenserfahrungen und dem persönlichen Geschmack.“ (Manguel 1999, S.51) Die beim jeweiligen Leser hervorgerufenen subjektiven Eindrücke begründen den Interpretationsakt als eine sehr subjektive Angelegenheit. Zu den Praktiken des Lesens gehören Inspiration, Intuition und Empfinden. Empfindung besteht in einer Einheit aus Erleben und dem gleichzeitigen Setzen hypothetischer Denkgebilde (Scheler 1977, S.129). Dabei decken sich Empfindungsinhalt und Gegenstandsqualität nicht phänomenal. Eine Gestaltempfindung hat nichts zu tun mit einer Denkschöpfung. Das Erleben ist ontisch und entwicklungsgenetisch einfacher - es ist sowohl im Gegenstand als auch im Menschsein vorgegeben (Scheler 1977, S.189). Aus dem heraus, wie der Leser etwas erlebt, urteilt er mit «genialer Intuition» (dieser Mischung aus Subjektivität und Positivi smus), versteht mit diesem, seinem Urteil das Werk und macht es so für andere verständlich. Dass jedes Individuum etwas anderes aus ein und demselben Text herauszulesen in der Lage ist, ist nicht nur der Beweis für die Individualität des Interpreten, sondern vor allem für die Nich texistenz der Wahrheitsverbindlichkeit eines Textes. All die subjektiven Teil- oder Gesamtaussagen einer Interpretation entspringen zwar aus dem Urtext; die Vielzahl der möglichen Interpretationen zeigen aber, dass der Text eine allgemeinverbindliche Aussage eigentlich gar nicht en thält. Im Rahmen der Grenzen der Auslegung ein und desselben Textes gibt es Hunderte individueller Sichtweisen. Umberto Das Wort «Gegenstand» trägt hier die Bedeutung von Zusammenhang, denn – im Gegensatz zu den Naturwissenschaften - kennt die Hermeneutik eigentlich gar keine Untersuchungsgegenstände, sondern nur Zusammenhänge. XV 31 Eco bediente bezüglich der Unendlichkeit der Interpretationsmöglichkeiten die Metapher des Labyrinths (Mersch 1998, S.26). D e r « g e n i a l e I n t e r p r e t » . Und doch gibt es so etwas, wie die tatsächliche, quasi-objektive Wahrheit. Das Verstehensinteresse dieser relativen Wahrheit, welche das Lesen leitet, richtet sich auf das, was das raumfigürliche Sein der Stadt vermittels ihrer Gestalt sagt. Durch das Lesen der Raumgestalt gewinnt der Leser nicht nur Einblick oder Wissen, sondern er kommt zu einem Sinnverstehen. Der Philosoph von Ehrenfels (siehe Abschnitt III.1) war die «Gestalt» betreffend der Meinung, die Leistung des Menschen könne nicht in der Neuschöpfung bestehen, sondern liege in der Entdeckung von Gestalt – eine gewonnene Gestalt, die einer platonischen Idee irdischen Ausdruck verleihe. Die Gestalt eines Ausdruckszusammenhangs «divinatorisch» zu erkennen, ist an eine geistige Kapazität gebunden, die nicht alle, sondern nur ein kleiner Teil der Menschen besitzt (von Ehrenfels 1922, S.52). Sie zu erkennen - der Intention des Werkes einer Stadt nahe -, führte Dilthey die Figur des «genialen Interpreten» ein. Der «geniale Interpret» genießt keine absolute, etwa künstlerische Freiheit, sondern eine Freiheit in Kontingenzen. Was im Hinblick auf den geschriebenen Text der geniale Interpret Diltheys ist und im Hinblick auf die Gestalt der Morphologe, ist für die Stadt der Flaneur – eine Mischung aus beidem. Wie bereits dargelegt, bewegt sich das Lesen und Auslegen als schöpferischer Prozess im Spannungsfeld der Verschmelzung von Objektivität und Subjektivität. Die skeptische Kritik der Sinneswahrnehmung hatte die Erkenntnistheorie Hegels auf das erkennende Subjekt zugeführt. Das erkennende Subjekt (der Mensch) war Hegel letztendlich die höchste Stufe im Erkenntnisprozess. In dem, was das Subjekt erkennt, erkennt es sich selbst, sagte Hegel (Russell 1999, S.741). Textinterpret und Flaneur sind zwei Figuren, in denen das Verstandene mit dem Subjekt des Verstehens zu einem Einzigen verschmilzt. Lesend versteht der Flaneur die vergangenen und gegenwärtigen kulturellen Hinterlassenschaften und sich selbst, denn für ihn trifft zu, was Bogdanović feststellte: „Die Stadt spiegelt sich im Menschen wie im Wasser.“ (Bogdanović 1993, S.57) Bei dem Soziologen Georg Simmel geht es hinsichtlich der Interpretation weniger um den Wahrheitsgehalt. Der Interpretationsakt stellte sich ihm vielmehr als das Gelingen der gesellschaftlichen Praxis des in einer Sache angelegten Kommunikationsaktes dar. Die Untersuchung des Gegenüber von Ich und Du - respektive dem Eigenen und dem Fremden - durchzieht das Schaffen Simmels wie ein roter Faden. Für Simmel ist die eigentliche Wahrheit eines Werkes das Schema, das es bereithält, um mit aktuellen Inhalten angefüllt und da heraus interpretiert zu werden (Jung 1990, 162f.). „Hat ein Schöpfungsvorgang erst einmal die Form des objektiven Geistes gefunden, so sind alle und sehr mannigfaltige Verständnisse in dem Maße gleichberechtigt, in dem eine jede in sich bündig, exakt, sachlich befriedigend ist.“ (Simmel 1984, zit. in: Jung 1990, S.163) Derjenige, der Stadt zu verstehen sucht, ist gleichzeitig das Medium ihres Selbstve rständnisses, und zwar in dreifacher Hinsicht: einerseits des Lesegegenstandes gegenüber sich selbst, andererseits des Lesers gegenüber dem Lesegegenstand (und umgekehrt) und drittens des Lesers gegenüber seiner eigenen Person. Der Leser steht zwischen den Fronten; seine Aufmerksamkeit richtet sich auf den Text (bzw. der Text sich an ihn) und seine Interpretation entweder an sich selbst (in Form einer Selbstvergewisserung seiner persönlichen Haltung) oder nach außen an einen Zuhörer. Im letzten Fall wird der Stadtleser zum Vorleser, der seine Kompetenz zur Performanz gebraucht, um die kommunikativen Potenzen des Stadttextes zu entfalten. Diese Potenzen liegen in einem sprachlich evozierten Bild von den Phänomenen. Über städtische Phänomene zu erzählen bedeutet, Raum in Sprache zu überführen. Die Erzählung ist der Kampf mit der Schwierigkeit der Linearisierung von Raum und seiner rückwirkenden Entfaltung aus der Linie. „Eine räumliche Konfiguration erscheint uns immer als Ganzheit. Wie nehmen sie simultan wahr. Die Umsetzung in Sprache setzt eine Auflösung der mehrdimensionalen Raumwahrnehmung in eine lineare Struktur voraus.“ (Wenz 1997, S.57) Bei entsprechender Meisterschaft transzendiert sich die Entfaltung eines räumlichen Vorste llungsbildes beim Zuhörer in Erlebniswirkung. Dabei ist die Wirkung von der konkreten Wahrnehmungstatsache völlig abgelöst. Sie hebt sie völlig in sich auf. Im Sprachraum findet die Selbstmächtigkeit des ungegenständlichen, imaginierten, metatextlichen Bildes einer erzählten Stadt ein adäquates Mittel der 32 Evokation. Bei der Überführung von Raum in Schrift ist das Problem nicht vorhanden, da Text nicht linear ist. „Licht. Die Straßen von Svolvaer sind leer. Und hinter den Fenstern sind die Papierrouleaus heruntergelassen. Schlafen die Menschen? Es ist nach Mitternacht; aus einer Wohnung kommen Stimmen, aus einer anderen Geräusche von einer Mahlzeit. Und jeder Ton, der über die Straße hallt, macht diese Nacht in einen Tag umschlagen, der nicht im Kalender steht. Du bist ins Magazin der Zeit gedrung en und blickst auf Stapel unbenutzter Tage, die sich die Erde vor Jahrtausenden auf dies Eis legte. Der Mensch verbraucht in vierundzwanzig Stunden seinen Tag – diese Erde den ihren nur alle Halbjahr. Darum blieben die Dinge so unverletzt. Weder Zeit noch Hände haben die Sträucher in dem windstillen Garten und die Boote im glatten Wasser berührt. Zwei Dämmerungen begegnen sich über i hnen, teilen sich in ihren Besitz wie in den Wolken, und schicken dich mit leeren Händen nach Hause.“ (Benjamin 1992, S.71f.) Im klassischen Fall beschränkt sich der zum Erzähler werdende Leser darauf, seine kontemplativ zustande gekommene Interpretation wie auch immer in schriftlicher oder mündlicher Form zu kommunizieren, nicht aber konvertiert er sie in Handlung oder Handlungsanweisung. Der Flaneur ist kein Agitator. Oder doch? Denn er kann ein Lehrer sein. Durch seine Lehre nimmt er am Prozess der Wirklichkeitsgestaltung teil. Das ambigue Geschäft des Interpreten, wie es Martina Düttmann’s Meinung nach Juan Pablo Bonta in seinem Buch «Über Interpretation von Architektur» sieht, gestaltet sich folgendermaßen: „Bonta beschreibt das Geschäft des Interpreten, seine Arbeitsweise, seinen Handlungsspielraum, sein Mißtrauen gegenüber dem Neuen und sein Vertrauen in das Bewährte [...], seine Macht und Ohnmacht gegenüber der Architektur – er kann sie nicht bauen, er kann sie nicht zeichnen, aber er kann ihr Freunde schaffen, oder Feinde – und seine Macht gegenüber dem Publikum, das die Dinge so sieht, wie er sie beschreibt, wenn er sie so beschreibt, wie das Publikum sie sehen will. Das Geschäft des Interpreten ist nicht einfach; denn seine Interpretationen werden nicht an der Wirklichkeit gemessen, die sie beschreiben, sondern an der Allgemeingültigkeit, die sie erlangen.“ (Düttmann 1992, S.23) In neuerer Zeit wurde verstärkt darüber nachgedacht, in wieweit das Lesen von Zusammenhängen nicht nur in eine Richtung wirkt, nämlich vom Lesegegenstand zum Leser. Der französische Philosoph Michel Foucault (1926-1984) forschte über die Wechselwirkung von Autor, Werk und Leser. Mit Dilthey stimmte Foucault darin überein, dass primär Werk und Leser verschmelzen anstatt Werk und Autor, da in dem Moment, da ein Text öffentlich ist, der subjektive Geist des Autors, der den Text ursprünglich hervorgebracht hat, verschwindet (Foucault 1991, S.22). Für die Stadt ist der einzelne Architekt nicht mehr zu belangen. Die Autorenschaft der Stadt ist vielmehr die Gemeinschaft, für welche wiederum die Stadtgestalt beredt ist. Der subjektive Geist der Schöpfer wird ersetzt durch den «objektiven» des Werks. Die eigentliche Geistigkeit eines Werkes – ob Buch oder Stadt - besteht genau in dieser Qualität: der Absolutheit, die das Werk ausstrahlt. Da weder die Autoren noch ein lauter Touristenführer in irgendeiner Form das Werk zu relativieren imstande sind, zählt am Ende nur das Wort oder der Stein in seiner abstrakten Totalität. Der «objektive» Geist einer räumlichen Aussage ruht völlig in sich selbst und kann dank seiner Autonomie von jedwedem geschulten Leser erkannt werden. Die Interpretation des objektiven Geistes ist aber nicht nur vom Subjekt des Lesens abhängig, sondern auch von der allgemeinen Form der gesellschaftlichen Rede über den Gegenstand, der in der Epoche des Lesens vo rherrscht. Ohne dass sich die Materie wandelt, ändert sich doch beständig die Sicht auf die neue wie die alte Stadt. „Ein Werk spiegelt nicht nur seine Zeit, sondern es erschließt eine neue Welt, jene Welt, die es in sich trägt.“ (Ricœur 1971, S.276) Hermeneutisch vorgehen heißt, die der spezifischen Schöpfung innenwohnende Idee herausstellen, welche den die Stadt unbewusst organisierenden Zusammenhang ausmacht. Hermeneutisch kann die Idee freigelegt werden, indem sie aus der inneren Form des Ganzen herausschält wird. „Worte zu dem finden, was man vor Augen hat – wie schwer kann das sein. Wenn sie dann aber kommen, stoßen sie mit kleinen Hämmern gegen das Wirkliche, bis sie das Bild aus ihm wie aus einer kupfernen Platte getrieben haben. «Abends versammeln sich die Frauen am Brunnen vorm Stadttor, um in großen Krügen Wasser zu holen» - erst als ich diese Worte gefunden hatte, trat aus dem allzu blendenden Erlebten mit harten Beulen und mit tiefen Schatten das Bild.“ (Benjamin über San Gimignano, in: Opitz 1996, S.18) 33 Ist der Logos der Zugang zur Interpretation, setzt die Vernunft ihr die Grenzen. Nicht alle Lesarten sind gleichermaßen gültig, ja zuweilen falsch. Einige Interpretationen wiederum erfassen die Struktur tiefer als andere. Die Parameter der Interpretation liegen im Text selbst (Eco 1990, S.51). Das Ziel der Interpretation besteht nicht im Darlegen «irgend eines Sinns», sondern im Erfassen des «rechten Sinns». Um sich dem rechten Sinn anzunähern, binden sich Logos und Vernunft weniger an die Person des Interpreten, sondern werden eher vom Gegenstand her determiniert. Die Freiheit der Interpretation ist eine durch die formale Struktur des Werkes eingeschränkte Freiheit (Eco 1990, S.33). In Bezug auf Literatur würde man sagen: man muss nach altem philologischen Ideal den Buchstaben die Treue halten (an ihnen kleben), Sätze genau lesen und Zusammenhänge texttreu und vernunftgeläutert auslegen.XVI Grundsätzlich kommt der in einem Werk getroffenen Aussage eine für alle verbindliche Wahrheit zu. „Schließlich gilt die Aussage von altersher als der primäre und eigentliche «Ort» der Wahrheit.“ (Heidegger 1935, S.154) Im Logos besitzt der Mensch einen Leitfaden für den entsprechenden Zugang zur Wahrheit. Wahrheit ist seit der Antike Sachübereinstimmung und das Wissen um die Wahrheit muss teilhaben an dem ausgewählten Sosein (Scheler 1977, S.19). Um der Intention des Textes so nahe wie möglich zu kommen und der Gefahr einer Überinterpretation zu entgehen, schlägt Eco das «Prinzip des geringsten Aufwandes» vor, das für ihn zum entscheidenden Kriterium beim hermeneutischen Versuch am Text wird (Eco 1990, S.19). Das Lesen innerhalb eines kulturellen Textes verfolgt die Spuren der Empirie und hält dem Unbedeutenden Andacht, aus dem eine magische Kraft entspringt (Honold 2000, S.21). Gadamer verbindet diesen Gedanken mit der Sicht auf die Ganzheit: Wir gehen beim Lesen von der Vollkommenheit des Textes aus - auf diese Vollkommenheit gewissermaßen vorgreifend (Gadamer 1960, S.202). Da, wie ich schon festgehalten habe, das Lesen im Grunde gar nicht darauf abzielt, die eine gültige Aussage zu verstehen, besteht der eigentliche Sinn des Lesens im Aufzeigen aller möglichen Interpretationen, die der gelesene Zusammenhang im Rahmen der Vernunft zulässt. Die Wah rheit liegt nicht in den richtig erkannten Bedeutungen, sondern zwischen ihnen: in der Leere (Eco 1990, S.75). Zwischen den Dingen liegen die Wurzeln der Ethik und die Verantwortung des Interpreten: nicht für den Text, aber für den Sinn. Interpretiert wird, „was in den Dingen selbst hätte nicht gesagt werden können, weil es in Hinblick auf Zeit und Ort entweder nicht darstellungsmöglich oder nicht vorstellungsmöglich gewesen wäre“ (Panofsky 1974, S.93). Im Wesenssinn offenbart sich das grundsätzliche Verhältnis des Interpreten zur Welt des Schöpfers, einer Epoche, eines Volkes oder einer Kulturgemeinschaft. Die in einem Kunstwerk eingeschlossene Weltanschauungsenergie strahlt von dort auf den Betrachter aus (ebenda, S.93). Sich intuitiv an dem Gegenstand in all seinen materiellen Dimensionen und immateriellen Ausstrahlung zu messen, ist die schwierige Aufgabe eines genialen Interpreten. Wenn wir schauen, wie sich das Wissen der Gesellschaft verändert hat, wird uns der Hintergrund des gesellschaftlichen Diskurses klar, aus dem heraus die Fähigkeit resultiert, die Welt und die Stadt zu lesen und wie es heute darum bestellt ist und in Zukunft bestellt sein kann. D a s W i s s e n d e r A u f k l ä r u n g . Bis zum 18.Jahrhundert waren die großen Inhalte des geschichtlichen Lebens (Sprache, Religion, Staatenbildung, Kultur) wesentlich auf die «Erfindung» einzelner Persönlichkeiten zurückzuführen und nur durch den Appell zu vergesellschaften (Simmel 1984, S.16). Mit der Französischen Bürgerlichen Revolution hingegen nehmen Bemühungen ihren Ausgang, subjektive Interpretationen einzudämmen, zu systematisieren und zu objektivieren. „Mitteleuropa arbeitete ab 1800 verstärkt in allen Bereichen an der Austreibung von Pluralitäten.“ (Hörisch 1998, S.71) Die Aufklärung (18./ 19.Jahrhundert) hatte den Prozess der Wissensoptimierung mit der Heraushebung der Vernunftbegabung des Menschen eingeleitet. Es begann sich die Auffassung durchzusetzen, die Vernunftbegabung versetze ihn nicht nur in die Lage, sondern verpflichte ihn geradezu, keine andere als nur die objektive Wahrheit zuzulassen. Die Zulässigkeit der Welterkenntnis verlegte sich weg von dem, was der eine oder andere persönlich von den Dingen oder Phänomenen hielt, auf eine Wahrheit, die offensichtlich nirgends anders stecken konnte und verlässlicher war, als in den Dingen selber. Diese Auffassung stimmte überein mit dem antiken Wahrheitsideal der Entsprechung von Begriff und Sache. Wie allerdings bereits dargelegt, hat das Wissen um eine Sache aber zwei Seiten: zum einen liegt es in der Sache, zum andern in ihrer mentalen Reproduktion. Historisch betrachtet, besaß die Kirche das Monopol der Reflexion über die Wahrheit in der Welt in Europa für ca. fünfzehn Jahrhunderte. Erst im Einer der eingängigsten (Meta-)Texte, den ich je über eine Stadt gelesen habe, da er eine geschriebene Form gefunden hat, sind die „Vier Lektionen über 24 Jahrhunderte Städtebau von Rom“ von Ludovico Qu aroni. XVI 34 18.Jahrhundert, nachdem sich die Fesseln einer religiös motivierten Wahrheitsdoktrin durch den konfessionellen Liberalismus lockerten, entideologisierte sich die Wahrheit. Die Meinung eines Einzelnen über eine Wahrnehmung wurde mehr und mehr von der «öffentlichen Meinung» abgelöst. Unter den Bedingungen der humanistischen, konfessionsliberalen, protestantischen Aufklärung war es offiziell möglich und erlaubt, in der «Natur der Sache» zu lesen und die Dinge von ihrem Eige nsinn her zu betrachten. Denn nicht mehr die Kirche sprach nun Recht über die Dinge, sondern die Dinge und Phänomene über sich selbst im Lichte der Forschung. Um den Rückfall in die Epoche des Meinens zu vermeiden, sollte fortan allein eine wissenschaftliche Beweisbarkeit der Wahrnehmung zu Akzeptanz verhelfen. Unabhängig vom Gewicht der Meinung der Mächtigsten wurde gesellschaftsfähig, was «zu beweisen war». Für das wissenschaftliche Wissen der Naturwissenschaften mochte das gelten. Aber galt das auch uneingeschränkt für die Mehrheit des narrativen, kulturellen Wissens? Offensichtlich stel lte man sich diese Frage nicht, denn das Objektivitätskriterium wurde an allen Bereichen der Wissenschaft und des Lebens angesetzt. Alles, was objektivierbar und vergleichbar war, verschlang das Individuelle, Unvergleichliche. Der Objektivierungszwang übte eine so radikale Wirkung aus, da er (nach christlichreligiösem Muster) zu humanistisch-ethischer Verpflichtung und moralischem Impetus erklärt wurde. Kulturwissen, wenn es wissenschaftlich auf gleicher Stufe anerkannt werden wollte, sah sich mit einem grundsätzlichen Legitimationsproblem konfrontiert (Lyotard 1999, S.14). Michel Foucault bemerkte dazu, dass sich in der Regel im Laufe der Zeit diejenigen Aussagen als wahr durchsetzen und sich als gesellschaftliche Meinung etablieren würden, die nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit der tatsächlichen Wahrheit am nächsten kommen und dabei am geschicktesten der «Ausschlussmaschinerie» des geordneten Diskurses entgehen (Foucault 1991, S.11). Zum Ende des 19. und zu Beginn des 20.Jahrhunderts lief die erklärende Wissenschaft der Semiotik gegenüber der verstehenden Wisse nschaft der Hermeneutik den Rang ab, da sich die Semiotik besser in das Diskursmodell der Gesellschaft einfügte. W i s s e n i m 1 9 . J a h r h u n d e r t . Die Hermeneutik ist der Philologie verwandt. Die helenistische Philologie in der Zeit der sagenhaften Alexandrinischen Bibliothek (Gründung um 300 v.Chr.) begriff die Philologie als schöne Wissenschaft - ein intimer, in Müßigkeit befangener Selbstdiskurs des Lesers mit der Dingwelt, der Erscheinungen und Phänomenen. Deswegen mutet die Hermeneutik heute veraltet an. Am besten wachsen und gedeihen konnte die «Kunst der Interpretation» im 19.Jahrhundert, als in Europa noch die lateinische Kulturtradition dominierte, die Mythen noch nicht abgeschafft und die Beweislastigkeit geisteswissenschaftlicher Diskurse durch die Romantik vorerst erfolgreich gegen das Objektivitätsdogma verteidigt worden war. Die Romantiker hatten erkannt, dass die mathematisch erfasste Welt ohne Sprache und kühl ist und dagegen rebelliert. Durch den „romantischen Rückschlag“ auf den Traditionsbruch der Französischen Revolution (Gadamer 1989, S.42) gewann das durch die Kritik an der Metaphysik in die Hände von Outsidern gelangte Weltanschauungswissen (Gadamer 1989, S.20) an Akzeptanz zurück. Im 19.Jahrhundert besaß bildungsbürgerliches Wissen einen gewissen Selbstzweck. Unter Bildung verstand man zunächst die freie Selbstentfaltung aller Geisteskräfte der Person. In der «Bildung des Geistes» und der Persönlichkeit bestanden die vornehmlichen Aufgaben des höheren bürgerlichen Bildungswesens. Die Bildungsbemühungen galten der Ergründung der Phänomene. „Ihre Denkbewegung zielt[e] in letzter Linie stets auf die Frage, wie der Grund und die Ursache der Welttotalität beschaffen sein müsse, damit ein «Solches» – eine solche Wesensstruktur der Welt – möglich sei.“ (Scheler 1977, S.22) Wissen verlor seine bisherige Statik als Traditionswissen ging in experimentelles Wissen über. „Das wird besonders sichtbar, wenn man auf das Ende dieser Traditionsgeschichte der europäischen Kultur blickt, die sich [...] in einer großen Folge von Kunststilen darstellt, bevor sie in die historische und reduktionistische Experimentalphase des 19. und 20.Jahrhunderts ausgelaufen ist. Es ist wie ein Traditionsbruch, der hier mit Händen zu greifen ist und der gewiß mit der Französischen Revolu tion und ihrer bewußten Absage an die Vergangenheit eingesetzt hat.“ (Gadamer 1989, S.41) In der (Humboldt-) Universität in Berlin erhielt das Bildungswissen eine Institution. Die Universität erneuerte das griechische Ideal einer universalen Erziehung und wandte sich gegen eine bloße, pragmatische Berufsformation. Sie unternahm den Versuch der Rehablierung eines Ortes philosophischer Spekulation. Die Hermeneutik etablierte sich dabei zum Lehrprinzip auf allen Fachgebieten. „Die Entfaltung des spekulativen Idealismus von Fichte bis Hegel [...] stellt den Versuch dar, Tradition und Revolution, [...] älteste Metaphysik und neueste Wissenschaft in einer letzten 35 Synthese aufzuheben.“ (Gadamer 1989, S.42) Mit dem Ziel der Aus-Bildung eines personalen Seins verband die Wissensvermittlung und -aneignung die Forderung nach Verwirklichung der verschiedenartigen Individualität jeder einzelnen Person (Simmel 1984, S.94). Die Berliner Universität wurde zum Vorbild für viele höhere Bildungsstätten des 19. und 20.Jahrhunderts. W i s s e n i m 2 0 . J a h r h u n d e r t . Am Ende des 19.Jahrhunderts wurde in die rein wissenschaftliche Betrachtung der Gegenstände und Phänomene zunehmend ihre gesellschaftliche Bedingtheit in sich herausbildenden Arbeitsgesellschaft mit eingerechnet. Aus bloßer Betrachtung wurde kritische Betrachtung. Die im 19.Jahrhunder hermeneutisch angelegten Wissenschaften wurden zwangsläufig zur kritischen Wissenschaften. In der Ganzheitlichkeit der Betrachtung verloren die Untersuchungsgegenstände ihre nicht-ökonomische und a-politische Unschuld. Durch die kritische Betrachtung kamen die Klassen - besonders das Bürgertum - zu mehr Selbstbewusstsein. Das Buch wurde zum vertraulichen Lebensgefährten der Bürger – zu einem ewiglichen Bezugspunkt in einer immer dynamischer werdenden Wirklichkeit. Mit dem Buch konnte man vertrauliche Zwiesprache halten (Wetz 1993, S.106). In den Salons trat man miteinander in öffentlichen Austausch über das, was man sich still lesend angeeignet hatte, Meinungen wurden verlautbart und Diskussionen geführt. Unter den gelehrten Diskurs der hohen Bildung (der Hermeneutik) um die Wahrheit mischte sich der volkstümliche Diskurs des dichten Lebens um Recht und Unrecht. Das schärfte die Urteilskraft – ein Urteilsvermögen, das Jahrhunderte lang ein feudales Standesprivileg gewesen ist (Honold 2000, S.24). In der Forschung wurde begonnen, neben den nüchternen Forschungsgegenständen auch über die Lage der Forschung und der Forscher selbst zu reflektieren. Kaum noch ein Untersuchungsgegenstand stand neutral und nur für sich da. Die Betrachtung der Welt wurde struktureller. Der Forscher als Person erschien in die Forschungszusammenhänge integriert. Das führte dazu, dass sich die objektive Wahrheit relativierte und von einer mehr intentionalen Steuerung abhing. Besonders durch die neuen Medien der Fotografie, Tonübertragung und Bildprojektion erkannte man die Einflussnahme der Forschungsumstände auf das Resultat. Mit der Industrialisierung wurde Wissen zu «produktivem Wissen», ja selbst zur Produktivkraft und Ware (Lyotard 1999, S.24). Die Maschine – das verlängerte Organ des menschlichen Hirns - vergegenständlichte eine Wissenskraft, die vordem dem menschlichen Geist allein zugekommen war (Lyotard 1999, S.25). „Neue maschinelle Vermittlungen vielfältigster Art haben die Erscheinungsweisen des modernen Forschers von dem alten Bild entfernt, das der homo literatus ehemals bot, wenn er mit seinem Tintenfaß und seiner Schreibfeder vor dem leeren Papier saß oder gedruckte oder geschriebene alte Folianten mühsam studierte.“ (Gadamer 1989, S.51) Am Ende schien alles miteinander verwoben zu sein. Durch die Prozesse der Industrialisierung adoptierte die zivile Gesellschaft den Charakter einer Prozessualität. Die Gesellschaft sah sich veranlasst, die irrationale Verwobenheit der städtischen Alltagswelt selbst zu prozessieren, dadurch zu ordnen und so an die neuen Bedingungen anzupassen, beziehungsweise Voraussetzungen für die neuen Erfordernisse zu schaffen. „Es sieht so aus, als ob die moderne Massengesellschaft und die gesellschaftswissenschaftlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Probleme, die sie aufgibt, einer Wissenschaftsauffassung den Weg bahn[t]en, die sich ihrem methodischen Bewusstsein nach von den Naturwissenschaften nur wenig unterscheidet.“ (Gadamer 1989, S.50) Im Erkenntnisprozess wurde wichtiger, sich Dinge zu merken als Dinge abzuleiten (Marquardt 1991, S.7). Die Moderne schloss die Hermeneutik als angewandte Praxis aus, denn in Bezug auf das erreichbare Resultat war ein ganzheitlicher Verstehensansatz vom Sinn des Einzelnen und des Ganzen bei der Problemlösung zu langsam und zu ineffektiv. Hermeneutik wurde nicht nur vernachlässigt, sondern zurückgedrängt. Dagegen wurden zunehmend nur solche Dinge und Phänomene aus der gesamten Vielschichtigkeit der Stadt herausgefiltert und erlangten die Berechtigung einer wissenschaftlichen Betrachtung, die Relevanz hinsichtlich einer Verwertung im produktiven Umgang besaßen oder besitzen konnten. In einer derartig positivierten Wahrnehmung der Welt zeigen sich Phänomene aber nur noch, wenn sie sich in den Zusammenhängen der Arbeit und der Beschäftigung bewähren. Wissen wurde somit pragmatisch. Alles, was sich gegen eine Vergegenwärtigung im Arbeitsprozess sträubte oder dafür uninteressant war, verlor (zumindest auf gesellschaftlicher Ebene) seine Bedeutung und schließlich sein Sein (Frings, in: Scheler 1977, S.XI). Ähnliches passierte mit dem Verständnis und der Akzeptanz der ewigen Wesenheiten der europäischen Stadt in der Industriezeit. Als sie keinen effektiven Nutzen mehr versprach, ließ das Stadtverständnis nach und wurde obsolet. „Wer nicht mehr schreiben kann ohne Schreibmaschine, wer nicht mehr rechnen kann ohne R echenmaschine, wer nicht mehr leben kann ohne den genauen Fahrplan eines ihn überströmenden Informationsflusses, für den 36 hat sich die Findung seiner eigenen Identität, und das ist zugleich die Findung des Ausdrucks für sich selbst, an wesentlich fernere Grenzen verschoben. Wo ist seine eigenen Handschrift oder Geiste sschrift?“ (Gadamer 1989, S.51f.) In der Moderne lernte der Mensch, sich selbst als Arbeitsmensch zu begreifen. Immer schon war er, aber besonders in der Phase des Kalten Krieges durch politische Systematisierung (christdemokratisch, aber tendenziell sozialdemokratisch) in ein gesellschaftliches Bedeutungsgewebe verstrickt. Nach der Auflösung der ideologischen Blöcke im Jahre 1989 dagegen ersetzen heute zunehmend selbst gesponnene Bedeutungsgewebe die vormals gesellschaftlich vorgegebenen. Kaum noch jemand trachtet heute danach, die Widersprüche seines Lebens im Laufe seiner Lebensjahre aufzulösen. Vielmehr werden präexistente Widersprüche als zu den Seinsbedingungen unabdingbar hinzugehörend anerkannt. Die Menschen haben allgemein die Einsicht gewonnen, ihre Widersprüche nicht auflösen zu können , sondern sich der Passivität hingegeben, diese aushalten zu müssen. Die Widersprüche aufzulösen, würde ja auch erst einmal bedeuten, sich gründlich von dem zu lösen, was man ist, um von vorn anzufangen. Dazu hat niemand die Zeit (Marquardt 1995, S.7). Jeder muss so, wie er nun einmal in die Welt «geworfen» ist, an das Existierende anknüpfen und sich beeilen, den Tag zu nutzen, denn Leben ist das Leben hin zum Tod, wie Heidegger sagte. (Heidegger 1935, S.235ff.) Heidegger leitete d en Existenzgrund des «hermeneutischen Zirkels» aus der Endlichkeit des menschlichen Daseins ab. Aber: „Nur indem das geschichtlich Vorhandene immer schon ohne zutun als Vorgabe da ist, hat das eigene Zutun eine Chance.“ (Marquardt 1995, S.78) Dabei ist der versteckte Fortbestand der Lesbarkeitsmetapher wichtig, denn ohne die Lesbarkeit gäbe es keine Experimente. Das Zutun als Chance zu begreifen, bekommt besonders in der nachindustriellen Phase eine neue und erhöhte Bedeutung. D i e R ü c k k e h r d e r H e r m e n e u t i k . Wir können den Kreis schließen zum Prozess der Wissensaneignung von heute. Max Scheler hat das «Wissen um etwas» von einer spannungsvollen Dreiheit in eine anthropologische Einheit zusammengeführt. Demnach besteht dieses Ding- oder Phänomenwissen aus: 1. Erkenntnis, die aus der Arbeit an der ihr mit Hilfe der Technik gewonnen wird: Leistungs- und Herrschaftswissen auf der Grundlage der Pragmatik 2. Erkenntnis aus Verwunderung und geistiger Liebe zum Wesenhaften: Bildungswissen auf der Grundlage der Metaphysik 3. Erkenntnis als Resultat der dionysischen Hingabe an das Dasein, einer Einsfühlung und Einswerdung mit dem Dasein: Weltdaseins- oder Erlösungswissen auf der Grundlage der Anthropologie (Scheler 1977, S.13; 236). Diese Einheit in Überwindung der Spannung zwischen den drei Aspekten des Wissens muss im Prozess der Persönlichkeitsbildung hergestellt werden. Scheler äußerte sich konkreter, wie das aussehen kön nte: “«Gebildet» ist nicht derjenige, der «viel» zufälliges Sosein der Dinge weiß und kennt, oder derjenige, der Vorgänge maximal nach Gesetzen voraussehen und beherrschen kann – der «große Gelehrte» resp. «Forscher» -, sondern wer sich eine persönliche Struktur, einen Inbegriff aufeinander zur Einheit eines Stiles angelegter idealer beweglicher Schemata für die Anschauung, das Denken, die Auffassung, die Bewertung und Behandlung der Welt und irgendwelcher zufälliger Dinge in ihr aneignete und sie funktionalisierte – Schemata, die allen zufälligen Erfahrungen vorgegeben sind, sie einheitlich verarbeiten und dem Ganzen der personhaften «Welt» eingliedern. Erlösungswissen aber kann nur ein Wissen sein um Dasein, Wesen und Wert des absolut Realen in allen Dingen, d.h. metaphysisches Wissen. Keine dieser Arten des Wissens kann die andere je «ersetzen» oder «vertreten». Wo die eine Art die b eiden anderen (oder nur die eine andere) zurückdrängt, daß sie schließlich die Alleingeltung und –herrschaft beansprucht, da entsteht für die Einheit und Harmonie des gesamten kulturellen Daseins des Menschen und für die Einheit der leiblichen und geistigen Natur des Menschen stets ein schwerer Schaden.“ (Scheler 1977, S.24) In der nachindustriellen Phase erlangt die Art, einzelne Zusammenhänge querbeet-lesend auf eine narrative Weise zu erfahren, wieder an Bedeutung. Denn eins ist inzwischen klar geworden: „Sich über den «Sinnverlust» in der Postmoderne zu beklagen, bedeutet zu bedauern, daß das Wissen hier nicht mehr hauptsächlich narrativ ist.“ (Lyotard 1999, S.84) Der Marxismus hatte lange Zeit die Determination des Überbaus durch die materiell-ökonomische Basis behauptet – eine zu einseitige Wirkweise, die spätere dialektische Theorien revidierten und einer determinierenden Rückwirkung des Überbaus (zum Beispiel Traditionen und revolutionärer Geist) auf 37 die Basis stärker in Rechnung stellten. Infolge der Industrialisierung hat sich in vielen Fällen die Basis sogar rascher als der Überbau gewandelt, besonders in Diktaturen oder in Ländern, in denen der Überbau überwiegend religiös beherrscht ist. In anderen Fällen läuft der Überbau der Basis in der Entwicklung voraus. Die neuen, medial orientierten Zweige der Wissenschaften entstehen gar nicht mehr auf empirischem Wege des Sammelns von Fakten, sondern gleich als interdisziplinäre Überblickswissenschaften, die sich der bereits gesammelten Fakten bedienen. D abei können zum Beispiel die Kommunikations- und Medienwissenschaften gar nicht anders als hermeneutisch vorgehen. Andere, historische Wissenschaften erleben einen Schub an Interdisziplinarität. Da die meisten Fakten heute bereits empirisch zusammengetragen und in Datenbanken abgelegt sind, besteht die eigentliche Aufgabe der Wissenschaften darin, das zur Verfügung stehende Material zu benutzen und durch überraschende Neukombination zu neuen Erkenntnissen zu bringen. Statt von mühsam empirisch gesammelten Fakten zu abstrahieren, schließt man immer öfter mit Hilfe fremddisziplinärer Erkenntnisse hermeneutisch auf neue Detailaspekte in der eigenen Fachdisziplin. Die Art, in den Fachdisziplinen hermeneutisch vorzugehen, trägt die klaren Züge einer postmodernen und poststrukturalistischen Wissenschaft. Kapitel V Städte schreiben und lesen V.1 Spekulation zum Verhältnis Welt -Stadt und Sprache -Text Auf Schreiben und Lesen gründen sich Denken, Bauen und Wohnen. Stadt lesen heißt, Einheiten kohärenter Ideen in Bezug zur Gesamtheit herzustellen. Um die Vielschichtigkeit eines Stadttextes zu erfassen und den Kulturausdruck heraus- oder hineinzulesen, gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Zum Beispiel kann man den Blickwinkel ändern (ohne den Überblick zu verlieren), man kann schichtenweise lesen (ohne die überlagerte Verzahntheit der Schichten zu vergessen) oder man kann Teilaspekte herauslesen (ohne die Affinität von allem mit allem und mit sich selbst zu mis sachten). Bei aller Komplexität der Zusammenhänge kommt es beim Lesen von Stadt auf das Erkennen der jeweils tragenden Ideen an. Die Ideen sind in Gestalt und Form gefroren und textuell miteinander verwoben. Im materiellen Prozess des Stadtbauens entstanden, tritt die geheime Erzählung (das Epos) einer Stadt auf der Rückseite ihrer materiellen Realität mit hervor. Walter Benjamin erklärte das Phänomen des Hangs der Stadt zum Narrativen damit, dass der Geist ihrer Dramatik derjenigen von Büchern verwandt sei. Für Paris träfe das wie für keine zweite Stadt zu: die fesselnden Motive ihres Aufbaus, der Höhepunkt (der Eiffelturm), die unabsehbaren leeren Plätze - „feierliche Seiten, Vollbilder in den Bänden der Weltgeschichte“ (Benjamin in: Opitz 1996, S.496). „Unter allen Städten ist keine, die sich inniger mit dem Buche verband als Paris. Wenn Giroudoux recht hat und es das höchste menschlicher Freiheitsgefühle ist, schlendernd dem Lauf eines Flusses zu folgen, führt hier noch der vollendetste Müßiggang, die beglückteste Freiheit also, zum Buch und ins Buch hin ein. Denn über die kahlen Seine-Quais hat sich seit Jahrhunderten der Efeu gelehrter Blätter gelegt: Paris ist ein großer Bibliotheksaal, der von der Seine durchströmt wird.“ (Benjamin, in: Opitz 1996, S.496) Da die Stadt nur eine Vielzahl namenloser Autoren kennt, ist ihr Gesamtwerk selbstvergessen. Der Aspekt der Selbstvergessenheit des Produktes dennoch ursächlich menschlicher Handlungen, äußert sich als wortmächtige Erzählung. Die narrative Macht steht über der gegenständlichen Macht wie eine eigene Selbstheit. Hinter den Oberflächen des selbstlosen Stadtbildes generiert sie diese zweite (oder wahre) Natur der Stadt. Auch Goethes Faust hatte vorübergehend die Urgewalt des Wortes vermutet er sagte: „im Anfang war das Wort“. Immerhin verwarf Faust die im Wort steckende Schöpfungsmacht nicht völlig, als er dann doch verneinte und die Urgewalt des Wortes praktisch aufhob im Ausspruch: „im Anfang war die Tat!“ (Goethe 1996, S.42) 38 Realität, Wort- und Bildmacht gehen wechselseitig auseinander hervor und ineinander über. Unsere vielleicht unbewusste Anziehung respektive Abstoßung gegenüber der einen oder and eren Stadt rührt daher. Man kann dem Ursprungspunkt dieses narrativen Komplexes auf hermeneut ischen Pfaden nahe kommen. Bogdan Bogdanović behauptete, das ursprüngliche Wort der Stadt verbinde sich zu einer spezifischen, starken, supralingualen Schrift, die jeder ohne große Schwierigkeiten entziffern könne: „Deshalb schlage ich in diesem Augenblick auch das einzige mir Mögliche vor: die Menschen, den einzelnen, uns alle wieder die vergessene Fertigkeit des Städtelesens zu lehren.“ (Bogdanović 1993, S.27) Die Stadt als Ver-Wirklichung. „Irgendwo zwischen der Schicht des Sehens und der Schicht des Verstehens, irgendwo zwischen der realen Welt und der Welt der Ideen, befand sich die Stadt Hûrqualyâ, das schiitische Pendant zur manichäischen Terra lucida. [...] Die platonische Vorstellung verweist auf die einfache Wahrheit, daß die Stadt [...] s owohl eine verehrte diesseitige Erscheinung sein konnte, als auch ein kognitives Modell, ein Lehrmittel, ein verheißenes Instrumentarium, ein Instrumentarium zum Verständnis der Welt.“ (Bogdanović 1993, S.51) Wie bereits im Kapitel II festgestellt, bedeutet der ontologische Ansatz Heideggers auf die Gestalt der Stadt und des öffentlichen Raums bezogen, dass der Stadtraum eine hervorragende Kategorie darstellt, in welcher sich das grundlegende Weltverhältnis des Menschen und seine Seinsweise in der Gesellschaft entwickelt. Mit der Stadt gab sich der Mensch im Vergleich zu allen, der Entstehung der Stadt vorhergegangenen Gebilden (dem Hof, dem Oikos, der dörflichen Ansiedlung), ein überlege nes Instrumentarium des Denkens sowie die Chance für Entwicklung und Fortschritt auf der Grundlage von sukzessiver Erkenntnis. Die Stadt ist ein analoges Erkenntnismodell, das es in dieser Form nie vorher gegeben hatte (Bogdanović 1993, S.20). Alles, was der Mensch von der Stadt aus verstehen kann, versteht er im Horizont eines bestimmten Verständnisses, also immer schon in einer bestimmten Auslegung (Bollnow 1937, S.165). Ein Trugschluss ist es zu glauben, die Welt wäre den Menschen kleiner geworden, als sie sich aus der Natur zurückzogen und in Städten ansiedelten. Das Gegenteil ist der Fall: die Welt wurde ihnen größer; nicht büßten sie Freiheit und Unabhängigkeit ein, sondern gewannen diese. „Ich habe nicht übertrieben, als ich einmal sagte, die Stadt [...] sei eine hervorragende Beobac htungsplattform der Welt bzw. ein unersetzliches Instrument ihres Allwissens.“ (Bogdanović 1993, S.50) Alle Bewohner gleichermaßen, sobald sie in der Stadt geboren werden und aufwachsen, finden sich ohne Alternative in diese Stadtwelt wie zufällig, achtlos und gegen ihren eigenen Willen hineingeworfen. Sich gegen diesen groben Umgang zu wehren, ist dem Kind nicht vergönnt, denn schon vor der Geburt ist das Kind „Referent der von seiner Umwelt erzählten Geschichte“ (Lyotard 1999, S.56). Das Kind wird sofort und in jedem Augenblick in all seinem Sein städtisch geprägt und prägt es gleichzeitig. Nie existiert der Mensch losgelöst von den Sinn-Räumen seines Umfeldes, das permanent Mentalität kommuniziert, tradiert und verändert (Dörner, Vogt 1990, S.136). Erst mit der Ausprägung eines eigenen Willens beginnt das Kind, sein Verhältnis zur städtischen Umwelt selbst zu bestimmen und sich von dieser zu emanzipieren. „Jedes Kind wird vor seinem weißen Blatt bereits in die Position des Industriellen, des Städtebauers oder des cartesianischen Philosophen versetzt – in die Position, den eigenen und abgetrennten Raum organisieren zu müssen, in dem ein eigenes Wollen ins Werk gesetzt werden soll.“ (de Certeau 1988, S.246) Da jede Stadt nach den Prinzipien der allgemeinen Verständlichkeit eingerichtet wird, eröffnet sie - im Gegensatz zur Natur - die Möglichkeit, zu einer Objektivität zu gelangen, die zur gesellschaftlichen Entwicklung von Normen, Recht und Bildung führt (Bollnow 1937, S.168). Das Erlangen von Erkenntnis verlegte sich von vordem akustischer Fixiertheit auf das lange, dauerhafte Gedächtnis der Materie, das so etwas wie ein kollektives Gedächtnis ist: „So gibt es kein kollektives Gedächtnis, das sich nicht innerhalb eines räumlichen Rahmens bewegt. Der Raum indessen ist eine Realität, die andauert: unsere Eindrücke jagen einander, nichts bleibt in unserem Gedächtnis haften, und es wäre unverständlich, daß wir die Vergangenheit wiedererfassen können, wenn sie nicht tatsächlich durch das materielle Milieu aufbewahrt würde, das uns umgibt.“ „Aber gerade so kann man das Gedächtnis definieren; und allein der Raum ist beständig genug, um ohne uns zu altern, einen seiner Teile zu verlieren oder fortdauern zu können.“ 39 (Halbwachs 1967, S.142; 163) Die Stadt als Hort der Erinnerung bedingt die Kommunikation. Im um ihn herum gebauten städtischen Raum ist es dem Individuum vergönnt, sich „in der Retrospektive zu sehen und die Ströme seines eigenen Schicksals fast mit den Händen zu greifen“ (Bogdanović 1993, S.20) und die Handlungen der einen Generation auf der anderen aufbauen zu lassen. Nur in der Stadt kann es Entwicklung und Fortschritt geben in der Art, dass ein heutiges Ergebnis auf einem gestern erreichten Stand aufbaut, sich aber gleichzeitig als etwas Neues im Vergleich zum immer noch vorhandenen Alten deutlich abhebt. Die dinggestützte Erinnerung entlastet das Gedächtnis. „Die Sprache hat es unmißverständlich bedeutet, daß das Gedächtnis nicht ein Instrument für die Erkundung des Vergangenen ist, vielmehr das Medium.“ (Benjamin 1974, S.100) Auch entdeckt er von der Stadt aus altbekannte Dinge ganz neu, die sich die Gesellschaft kulturell einverleibt. Hier ein geschichtliches Beispiel: Natur und Landschaft sind nicht dasselbe. In der Malerei ist man der Auffassung, der Mensch habe erst in der Epoche der Renaissance die Landschaft entdeckt; vorher gab es nur Natur. Denn bevor Landschaft bildlich dargestellt oder zum Beispiel von Piero della Francesca um die Mitte des 15.Jahrhunderts beim Bau des Palastes von Urbino architektonisch in Szene gesetzt wurde, lebte der Mensch seit Jahrtausenden in der Natur ohne sie zu bemerken. Durch das Dispositiv der Malerei, bei der es in der Porträtkunst üblich wurde, im Hintergrund den Blick in die Landschaft frei zu geben, schauten Maler, Architekt und mit ihnen die Betrachter nun auf eine Natur, die Landschaft geworden war. Denn in dem Moment, als Ausschnitte der Natur ausgewählt, auf Gemälden festgehalten oder durch Fenstergewände wie Bildmotive gerahmt wurden, kam sie den Menschen als Landschaft zu Bewusstsein. Dabei ist es wichtig, den Schwerpunkt auf den Aspekt der Auswahl zu legen. Die intentional den Ausschnitt auswählende Beobachtung gab gewissermaßen den Lesestoff vor. Es kann behauptet werden, die Beobachtung beeinflusse den Beobachtungsgegenstand in dem Moment, in dem sie ihn als solchen zur Kenntnis nimmt. Bei dem Vorgang der Zu-Bewusstsein-Bringung nähert sich nicht das Bewusstsein dem ausgewählten Gegenstand an. Es erfährt keine Objektivierung, sondern umgekehrt: der Gegenstand wird der Betrachtung einverleibt und subjektiviert, wie Vilém Flusser mehrfach beschrieben hat.XVII Um den Lesegegenstand zu verstehen, wird er im Lesakt gewissermaßen anthropomorphisiert. In unserem Beispiel helfen die Malerei und die Architektur – beides eine Hervorbringungen der Stadtkultur -, einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Ob die Kunst Ausdruck oder Resultat des Paradigmenwechsels in der Beziehung von Mensch und Natur war, führt hier in der Erörterung zu weit. Es wird j edoch klar, was die Folgen sind: Vorher konnte man die Gaben der Natur nur empfangen (wie im Mittelalte r), nun konnte man die Natur hingegen lesen (verstehen) und zu eigenen Gunsten gestalten.XVIII Die Stadt als Ent-Wirklichung. „Über die Stadt Dorotea kann man auf zweierlei Weise sprechen: Man kann sagen, daß sich vier Aluminiumtürme von ihren Mauern erheben, die sieben Tore flankieren, deren Federzugbrücke sich über einen Graben legt, dessen Wasser vier grüne Kanäle speist, die durch die Stadt fließen und sie in neun Bezirke mit je dreihundert Häusern und siebenhundert Rauchfängen aufteilen [...] bis man al les weiß, was man will von der Stadt in Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft; oder man kann sagen, wie der Kameltreiber, der mich herumführte «Ich kam in meiner frühen Jugend eines Morgens her, viele Leute eilten durch die Straßen zum Markt, die Frauen hatten schöne Zähne und sahen einem offen in die Augen [...]» An einem Morgen in Dorotea fühlte ich, daß es kein Glück auf der Welt gab, das ich mir nicht hätte erwarten kö nnen. [...] nun weiß ich, daß dies nur einer von vielen Wegen ist, die sich mir an jenem M orgen in Dorotea auftaten.“ (Calvino 2000, S.12) Was phänomenologisch vor sich geht, wenn wir etwas verstehen, hat Flusser beschrieben: Verstehen erfolgt in drei Phasen: In einer ersten wird das Phänomen/ der Gegenstand aus seinem natürlichen Umfeld isoliert. Er wird zu Bewusstsein gebracht. Dann wird er geistig durchdrungen. Durchdringen heißt, (i hn in) seinen Bestandteile zu entfalten. Anschließend wieder zusammengesetzt, ist der Sachverhalt nicht mehr derselbe wie vorher, denn er ist nun verstanden! Er ist subjektiviert, das heißt, zu einem dem Menschen bekannten, internen, nicht mehr fremden Etwas geworden. Erkennen heißt, ein Objekt selbst zu verwirklichen. Ja, es ist überhaupt erst wirklich, wenn es begreifbar und begrifflich fassbar ist (Flusser 1993 a, S.75). XVIII Unter anderem öffnete sich so der mittelalterliche Klostergarten in der Renaissanc e nach außen und wandte sich als offener Garten der Landschaft zu. XVII 40 Calvino deutet auf eine Rettung vor dem ontologischen Zwangcharakter des Stadtdispositivs hin – eine Rettung, die das Subjekt nicht völlig zwischen den Walzen der Determination zermahlen lässt. Dadurch nämlich, dass der Raum den Menschen im Prinzip gar nicht nötig habe, und dadurch, dass der Mensch das einzige mit Geist begabten Wesen sei, bleibt sein Wesen der sonst geistlosen Welt gegenüber grundlegend fremd (Scheler 1995, S.38ff.). In der integrierten Fremdheit des Menschen resultierte sein In-die-Welt-Geworfensein als ein Geworfensein in die freie Möglichkeit, also des Sein-Könnens einer Möglichkeit im Rahmen, denn „das Dasein ist ihm selbst überantwortetes Möglichsein, durch und durch geworfene Möglichkeit“ (Heidegger 1935, S.144). Die Grenzen des Stadtdaseins implizieren die Offenheit der Möglichkeit als Mensch zu sein. Die Stadt ist das Bett einer Vielzahl von Möglichkeiten. Sie ist ein Gefäß mit durchsichtigen Wänden, in dem der Mensch beständig damit beschäftigt ist, gegen die ihm kulturell durch die Stadt aufoktruierten Wände anzukämpfen und diesen Kampf zu gewinnen. Das urbane, zuweilen einengende Zusammenleben formiert einen Geist, der den Menschen in die Lage versetzt, sein Handlungsfeld über alle materiellen Grenzen hinaus zu projizieren. Es eröffnet sich ihm die Möglichkeit, sein eigenes Selbst frei zu entwerfen. Aus dem Druck gegen die ihn beengende Situation heraus lernt er die Welt im Laufe seines Lebens kennen (Bollnow 2000, S.125). Der Lebensentwurf bewegt sich im Spannungsverhältnis zwischen dem durch Stadt gesetzten Rahmen sowie dessen steter und bewusster(!) Überwindung. Menschsein heißt nämlich, nicht nur duldsam die Dinge der Welt anzunehmen, darin zu wohnen (Heidegger 1954, S.145ff.) und dumpf in der Wirklichkeit vor sich hin zu leben, sondern dieser Wirklichkeit vor allem ein kräftiges «Nein» entgegenzuschleudern(!) (Scheler 1995, S.52). Philosophiegeschichtlich betrachtet, gelangte der menschliche Geist durch die Technik der Entwirklichung von der omnipräsenten sozialräumlichen Determiniertheit zu der Autonomie, die Descartes herausarbeitete. Aufgrund seiner Geistesbegabung hebt sich das menschliche Individuum sowohl aus der Zugehörigkeit zum Tierreich ab als auch vom Gefangensein in den Dingen und je entwickelter eine Gesellschaft ist, auch von der Befangenheit in den Mitmenschen. Das durch die Stadt Vor-Augen-geführt-Bekommen der eigenen geschichtlichen Dimension und der gleichzeitig relativen Unabhängigkeit von dieser machte das Individuum zunehmend zum selbständigen und selbstverantwortlichen Individualisten. Nur der in den Dingen, Personen und Phänomenen integrierte und sich von Allem gleichzeitig distanzierende Mensch kann den Dingen, der Gesellschaft und den Phänomenen lesend gegenübertreten. Im Wachstumsprozess jedes Einzelnen wiederholen sich die zwei Phasen dieser großen, zivilisatorischen Entwicklung: Der Übergang von der Zugehörigkeit und dem passiven Gefangensein in den Dingen hin zum aktiven Vermögen des Lesens und Handelns kommt dem Übergang vom Kindheit zum Erwachsensein gleich und - historisch gesprochen - dem Übergang vom Mittelalter zur Renaissance. S t a d t u n d S p r a c h e . Das Sprechen ist älter als das Schreiben, denn es ist nicht an die Sesshaftwerdung gebunden, sondern an das Menschsein überhaupt. Sprechen konnte der Mensch schon immer – sonst würden wir ihn nicht Mensch nennen. Dilthey zufolge ist Sprache die Form, in der „das menschliche Innere seinen vollständigen, erschöpfenden und objektiv verständlichen Ausdruck findet “ (Dilthey 1900, S.36). Sprache erscheint ihrer Art nach in jeder Entwicklungsphase des Menschen ein vollständiger und externalisierter Komplex wie ein eigener Kosmos. Von diesem Sprach- und Schriftkosmos her wirken Sprache und Schrift in die Gesellschaft zurück, brechen zuweilen (wie Foucault und Derrida dargelegt haben) unkontrolliert und unkontrollierbar in die Normalität ein. Der französische Literaturkritiker Roland Barthes (1915-1980) charakterisierte die heutige Art und Weise «städtisch» miteinander zu sprechen wie folgt: „Die Imaginaria der Sprache aufspüren, das heißt: das Wort als singuläre Einheit, magische Monade; das Reden als Instrument oder Ausdruck des Denkens; das Schreiben als Transliteration des Redens; den Satz als logisches, geschlossenes Maß; selbst das Fehlen oder die Verweigerung von Sprache als ursprüngliche, spontane, pragmatische Gewalt.“ (Barthes 1974, S.50) Die frühesten Formen der Erkenntnis - in der Epoche der Sammler und Jäger - bildeten sich allein mittels Kommunikation durch das Sprechen. Radius und Reichweite der Erkenntnis waren entsprechend auf die flüchtige Dauer der Akustik begrenzt. Da der Sprachraum ein line arer, diskursiver Raum ist (Wenz 1997, S.135), beschränkte sich der Zweck der schriftlosen Sprache auf die Verständigung. Die Erinnerung konnte nur als lebendige Erinnerung in die Vergangenheit der eigenen Erfahrung zurückreichen oder sich an Gegenstände knüpfen. Darüber hinaus war aller Vergangenheitsbezug ritualisiert. Im Ritus wurde die Vergangenheit der Ahnen geb unden, aber kaum 41 durch mündliche Überlieferung. „Immer bleibt der Sprechende von der Gegenwart besessen. Also ist er verflucht: nie das Vergangene zu sagen, das er doch meint.“ (Benjamin 1989, S.93) In der Sprachgesellschaft überwog das «lebendige Wissen» der Worte - später, als es Schrift und Bücher gab, das «tote Wissen». Aber erst da wurde Sprache erzählerisch. Wenn ein Kind aufwächst, lernt es als Angehöriger einer bestimmten Sprachgemeinschaft sprechen. Sein Weltverstehen ist von vorn herein an die in der Stadt vorhandene sprachliche Gemeinschaftsformen gebunden (Bollnow 1937, S.166). In der Sprache liegt ein struktureller Horizont von Erkenntnis und Verstehen begründet (Jung 1990, S.155), über den nur schwer von selbst hinausgelangt werden kann, aber ohne den wiederum gar keine Erkenntnis und kein Verstehen möglich wäre. Überlieferte und einsozialisierte Sprachstrukturen vermischen sich mit der innovativen Mitarbeit des Sprechers an der Sprache. Das Hin- und Herpendeln zwischen dem kulturell vorgegebenen, sprachlichen Komplex und ihrer subjektiven Verwendung lässt eine sprachliche Mittelung letztendlich nie objektiv wahr erscheinen. Gleiches stellten wir schon in ähnlicher Form für die Schrift und die noch so geniale Interpretation fest. Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb über das Bilden der Sprache durch die Stadt und das Bilden der Stadt durch das Sprechen: „Unsere Sprache kann man ansehen als eine alte Stadt: Ein Gewinkel aus Gäßchen und Plätzen, a lten und neuen Häusern, und Häusern mit Zubauten aus verschiedenen Zeiten; und dies umgeben von einer Menge neuer Vororte mit geraden und regelmäßigen Straßen und mit einförmigen Häusern.“ (Wittgenstein 1933, zit. in: Lyotard 1999, S.119) Ein Vorverstehen des Anderen ist der tragende Untergrund, auf dem das individuelle Leben des Einzelnen ruht. Es enthält eine ganz bestimmte innere Gliederung und ist begrenzt durch eine ganz bestimmte Reichweite. In der Natur eingeschlossen stand ein Mitglied der Sippe dem andern nicht fremd gegenüber, sondern war ihm nahezu identisch. Anders hätte zum Beispiel die Jagd nicht funktioniert. Auf der gemeinsamen Grundlage des Dispositivs Stadt, unter dem aus dem Andern der Fremde im Eigenen wurde, entfernten sich zwar die Menschen voneinander, aber gleichzeitig lernten sie sich untereinander verstehen bzw. ihr Nichtverstehen zu artikulieren. Dem Fremden als Eigener gegenübertreten und ihn verstehen und nicht mehr den Andern im Selbst vorfinden, kommt dem Paradigmenwechsel von der reinen Emotion zur Intuition gleich. In der Intuition mischt sich die Emotionalität mit dem Intellekt. Die Unvoreingenommenheit gegenüber dem Mitmenschen wandelt sich in Voreingenommenheit. Aus dem natürlichen Selbstsein des Anderen trotz der Stammeshi erarchie wird in der Stadt gegebenenfalls Annäherung. Die Stadt löste nicht Stammeshierarchien auf, sondern verschärfte sie. Die Verlegung der „bloß naturwüchsig vermittelten Gesellschaftszusammenhänge“ auf die Stadtzivilisation bedeutete das Ende der Urgesellschaft (Berndt 1978, S.41). Trotz des Voranschreitens der arbeitsteiligen Ausdifferenzierung der sozialen Ordnung in der Stadtgesellschaft, trotz der Zunahme der Entfremdung und Entfernung der Menschen bei größerer physischer Nähe wirkte die Stadt wie ein Medium, die autonome Gewalt der individuellen Artikulationsverschiedenheiten zu bezähmen. Da die subjektive Erkenntnisfähigkeit und –tätigkeit des Einzelnen in der Stadt gemeinsam mit allen anderen geteilt wurde, wurde der Alltag sozial übergreifend homogenisiert und eine ständeübergreifende Verständigung in der Regel ermöglicht. Unter den in der Stadt Zusammenwohnenden veränderte sich die Form der sprachlichen Kommunikation. Aus der knappen, zweckdienlichen Mitteilung wurde die «gemeinsame Sprache» der Erzählung - wurde der Roman. „Es heißt, der Roman sei eine eminent urbane Literaturform, zum Unterschied zum Heldenlied oder der Sage, die sowohl ihrer Herkunft als auch ihrer sozialen Funktion nach prä-urbane Formen sind. Es heißt, es gebe keinen großen Roman, der nicht zumindest eine große Stadt in sich birgt. Es heißt auch, es gebe keine große Stadt, in der sich nicht wenigstens ein ungeschriebener Roman verbirgt. Simulationen urbanologischer Techniken, sogar die sie begleitenden mathematischen Modelle, beruhen häufig auf Analogien mi t der Struktur und Narration eines idealen Romans. “ (Bogdanović 1993, S.46f.) Wir haben gesehen, dass der Sprachraum ein linearer Raum ist. Ein narrativer Raum dagegen überwindet diese Charakteristik. Narrativer Raum ist potenziell ein Schriftraum und flächig. Als Sprache zu einer städtischen Schriftsprache wurde, wurde sie gleich erzählerisch. Unfähig, die stadtbedingte, voreingenommene Distanziertheit (Konstituente der Blasiertheit) aufzulösen und soziale Hierarchien abzuschaffen, bot die erzählerische Kommunikation zwischen den Menschen und schließlich vor dem Hintergrund der als Erzählung begriffenen Stadt die Chance, soziale Differenzen auf friedlichem Wege zu überwinden. Das hatte der Marxismus an der Stadt immer mystifizierend gefundenen (Corboz 2001, S.56). 42 S t a d t u n d S c h r i f t . Lesen kommt von Schreiben. Bevor der Mensch schreiben konnte und es Städte gab, sah er zwar und mag gedeutet haben, aber er las noch nicht. Als er zur Sesshaftigkeit überging, musste er bereits eine Veranlagung zum Lesen mitgebracht haben, denn so ganz als Analphabet wäre er vielleicht nie sesshaft geworden. Mit der ausschließlichen Fähigkeit zum Schauen, das in der Natur ein Spähen war, hätte er seinen Sprung in die Sesshaftigkeit nicht vorbereiten können. Flusser zufolge begann das Lesen mit dem Lesen von Erbsen (Flusser 1992 b, S.71). „Die Vorstellung, daß wir schon fähig zum Lesen sind, bevor wir es gelernt haben – ja, bevor wir je eine aufgeschlagene Seite vor uns erblickt haben -, greift zurück auf einen platonischen Begriff des Wissens, das schon in uns existiert, bevor es durch die äußere Wahrnehmung bestätigt wird [...] Wir «entdecken» ein Wort, weil der Gegenstand oder die Vorstellung, für die es stehen soll, schon im Bewußtsein vorhanden ist «und darauf wartet, mit einem Wort belegt zu werden».“ (Manguel 1999, S.48 – unter Bezugnahme auf D.N.Stern 1993) Mit der Sesshaftwerdung fing der Mensch an zu lesen und zu schreiben. Oder man kann auch sagen, als er zu lesen und zu schreiben begann, wurde er sesshaft. Archäologische Untersuchungen haben ergeben, dass die Entstehung der Schrift überall auf der Welt einherging mit der Sesshaftwerdung und dem Bau von Städten (Butor 1992, S.13) - vor dem Hintergrund der Despotie, wie Benjamin anfügte (Benjamin, in: Opitz 1996, S.526). Wohnen und Schreiben stehen in einer bemerkenswert en gen Beziehung. Man kann sagen, als der Mensch zu schreiben anfing, fing er überhaupt erst an zu wo hnen. Schrift als textliches Vorverständnis des Seins kann in dem Sinne metaphorisch verstanden werden: Schreiben ist die Produktion eines Systems von sozialem Handeln, welches zeitgleich im Text niedergelegt unmittelbar die ersten Städte texturierte. Denn so, wie die Künstler ihre Linien führten, drückten sie ihre innere Gesinnung in ihrer Zeit aus (Panofsky 1974, S.19). Dem Raum wird ein Ausdruckswert einbeschrieben, der selbst im Kontext seines technischen Entstehungsprozesses das Seelische ausdrückt. Da Schrift texträumlich befangen bleibt, verzeitlicht sich Raum beim Einschreiben in den städtischen Text. Umgekehrt verräumlicht sich die Textzeitlichkeit beim Lesen (Wenz 1997, S.58). „Die Metaphern des Textes beziehen sich auf Orte, auf die man verweisen kann und konstruieren den Text als statischen Raum. Es handelt sich um einen Raum, der aus Überschriften, K apiteln und Absätzen besteht, zu denen ein Bezug hergestellt werden kann.“ (Wenz 1997, S.139) Während, wie hier weiter oben festgestellt, die Sprechräumlichkeit effimär ist und tendenziell Anweisungscharakter trägt, impliziert die Texträumlichkeit die Ewigkeit einer unterschwelligen Ordnung. Mit dem Schreiben erhielt das Deuten seine Bedeutung. Das vorverstandene Selbstsein des Menschen zum Text schreibt dieser, wenn er Stadt baut, in die soziale und physische Form dieser Stadt ein – eine Form, die dann ihrerseits Autonomie gewinnt. Auf der einen Seite determiniert die Form die nachfolgenden Menschen, da die Form die Vergangenheit stets in der jeweiligen Gegenwart vergegenwärtigt. Auf der anderen Seite repräsentiert sie die Gesellschaft in einer zeitunabhängigen Wirklichkeit des Hier und Jetzt. Die vierdimensionale Räumlichkeit des Textens (den Zeitfaktor eingerechnet) ist eine Imagination. Sie ist unbewusst geschichtlich konditioniert und verarbeitet die unmittelbar soziale Wirklichkeit in Raumausdruck gebrochen. „Der Reisende, der die Stadt noch nicht kennt, die ihn an seinem Weg erwartet, fragt sich, wie wohl das Königsschloß sein wird, die Mühle, das Theater, der Basar [...] So – sagen viele – bewahrheitet sich die Hypothese, daß jeder in seinem Sinn eine nur aus Unterschieden bestehende Stadt trägt, eine Stadt ohne Figuren und ohne Form, und daß die einzelnen Städte diese anfü llen. Nicht so in Zoe. An jeder Stelle dieser Stadt könnte man von mal zu Mal schlafen, Gerä tschaften herstellen, kochen, Goldmünzen anhäufen, sich entkleiden, herrschen, verkaufen, Orakel befragen. Jedwedes Giebeldach könnte ebenso gut das Spital der Leprakranken wie die Thermen der Odalisken zud ecken. Der Reisende geht umher und wieder umher und hat nichts als Zweifel: Es gelingt ihm nicht, die einzelnen Punkte der Stadt zu unterscheiden, und selbst die Punkte, die er in seinem Geiste unterscheidet, geraten ihm durcheinander. Er folgert daraus: Wenn die Existenz in allen ihren Momenten ganz sie selbst ist, so ist die Stadt Zoe der Ort der unteilbaren Existenz. Doch weshalb dann die Stadt?“ (Calvino 2000, S.41) Die Ausdrucksanalyse der städtebaulich-räumlichen Gestalt, die Walter Benjamin so überzeugend betrieb, gibt Auskunft über die zeitliche Entwicklung des menschlichen Daseins in Ep ochen. 43 V.2 Zeit lesen Zunächst gilt es festzuhalten, dass die Abschnitte V.2 «Zeit lesen» und V.3 «Raum lesen» eigentlich gar nicht voneinander zu trennen sind. Dennoch fokussiere ich das «Lesen von Zeit» auf den Aspekt der Geschichte, der sich nicht vorrangig baulich-räumlich artikuliert, während ich unter «Raum lesen» eben den baulich-räumlichen Aspekt in den Mittelpunkt rücke. Die christliche Geschichtsschreibung begann als Darstellungsaufzeichnung – gewissermaßen als notarieller Text im wörtlichen Sinne. Gegenüber der antiken Geschichtsschreibung (Salust, Tacitus), die ja eine Geschichtenschreibung war, beschränkte sich die christliche Geschichtsschreibung zunächst auf die Eintragung der Ereignisse des Kirchenjahres in Jahrbücher (Chadwick 1996, S.9). In diesen Jahrbüchern - den Annalen - wurden Geschehnisse versachlicht niedergelegt; sie reihten sich wie Perlen auf eine Kette. Dabei hatte das Festhalten der Ereignisse gar nichts Retrospektives. Es häufte sich so der Stoff einer materiellen Geschichtsdarstellung an für die dann intensiv im 19.Jahrh undert einsetzende Geschichtsschreibung, wie wir sie heute gewohnt sind. Erste Versuche, aus Einzeleintragungen in den Kirchenbüchern Zusammenhänge jahrhunder tweise chronologisch zu erfassen, wurden in der Renaissance zur Mitte des 16.Jahrhunders unternomm en. Dazu mussten erinnernswerte Eintragungen von nicht erinnernswerten getrennt werden. Die Geschichtserzählung wanderte von Faktum zu Faktum einer Diplomatie- und Ereignisgeschichte. In der Epoche der Aufklärung, die auf die Neubestimmung der Stellung des Menschen in seiner Lebensumwelt drängte, schärfte sich ein Bewusstsein von Historizität. Es wurde erforderlich, Geschichte in größeren Zusammenhängen zu erfassen und die dokumentierten Tatsachen gewissermaßen wie Knoten miteinander zu verflechten (Engell 1995, S.11) und in ein erzählerisches Kontinuum zu überführen. Dadurch wurde man sich des geschichtlichen Fließens bewusst. Geschichte wurde als langfristiger Strukturwandel von Sozialität, Psyche und Verhaltensformen (Dörner, Vogt 1990, S.133) begriffen und erschien als Prozess der Zivilisation (vgl. Elias 1997). Die eigentliche Erzählung begann aber auch, sich nicht mehr allein aus den Fakten, sondern zwischen den Fakten her zu entspinnen. Am Geschriebenen las man das Ungeschriebene: die unterschwelligen Assoziationen, die mitlaufenden Obertöne und magischen Zeichen (Honold 2000, S.17). Um 1900 wurde (z.B. mit Henri Bergson) die Sicht auf die Geschichte zur Sicht auf den gewaltigen Lebensstrom eines Werdens, der bis an die Gegenwart heranreichte (Russell 1999, S.799ff.). Medial betrachtet formulierte sich in der 2.Hälfte des 20.Jahrhundert der Geschichtsstrom in ein Netz um. Hielten bislang die Knoten (die Geschichtsereignisse) die strömende Geschichte zusammen, scheinen sie sich heutzutage aus dem horizontal vor uns ausgebreiteten Gewebe eines kontextuellen Bedingungsgefüges (Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, etc.) heraus zu formi eren und so Ereigniss zu Fall zu bringen (Flusser 1992 a, S.17 – mit Wittgenstein). Das historische Ereignis nimmt sich dadurch in seiner Bedeutung als Ereignis stark zurück - ins Zeitlose. Lyotard sieht den Menschen eingewoben in die Netzstruktur eines dynamischen Spielfeldes, auf dem heute Spielzüge den Einzelnen prägen - je nach dem als Empfänger, Sender und/ oder Referent seiner Umwelt. Die Erzählung, die dem Spielfeld unterliegt, sei „die Form des Wissens par excellence“ (Lyotard 1999, S.67). Das Interesse der Medienund Geschichtswissenschaften richtet sich deshalb gegenwärtig stärker auf den diffusen Text als Generator des historischen Falls. „Text heißt Gewebe; aber während man dieses Gewebe bisher immer als ein Produkt, einen fertigen Schleier aufgefaßt hat, hinter dem sich mehr oder weniger verborgen, der Sinn (die Wah rheit) aufhält, betonen wir jetzt bei dem Gewebe die generative Vorstellung, daß der Text durch ein ständiges Flec hten entsteht und sich selbst bearbeitet; in diesem Gewebe – dieser Textur – verloren, löst sich das Subjekt auf wie eine Spinne, die selbst in die konstruktiven Sekretionen ihres Netzes aufginge.“ (Barthes 1974, S.94) D i e B e w e g u n g s g e s t a l t d e r G e s c h i c h t e . Das Erkennen der Gestalt zeitlicher Abläufe unterscheidet sich wesentlich vom Erkennen der Raumgestalt, die im Abschnitt V.3 b ehandelt wird. Zum Verhältnis von Raum und Zeit äußerte Kant: während Raum eine äußere, vorgegebene Omnipräsenz ist (denn es gibt keine Vorstellung von Nichtraum), ist Zeit eine subjektive, innere Kategorie des Menschen - damit gewissermaßen den Ideen des Philosophen Henri Bergson vorgreifend. Kant zufolge steht also die harte, äußere, räumliche Tatsachenwelt mit ihren kausalen, logisch zu erforschenden Verknüpfungen einer weichen, inneren, zeitlichen Welt gegenüber (Russell 1999, S.720), 44 die auf sinnlicher Wahrnehmung beruht. Sprache nun übersetzt den Raum in Zeit. Wie Wenz feststellte, ist der Raum das Tätigkeitsfeld des Malers und Zeit das des Dichters (Wenz 1997, S.58). Die aktive, lebendige Seite des Menschen tritt bei der Erfassung zeitlicher Zusamme nhänge deutlicher heraus als bei der Erfassung räumlicher Zusammenhänge. Der Raum in seiner materiell-physischen Beschaffenheit ist das vordergründige Forschungsfeld der Naturwissenschaften. In vergangenen Zeiten entstanden, ist er dauerhaft physisch präsent. Allein die Omnipräsenz des physischen Raums ist es, die unsere Fähigkeit benebelt, Raum gestalthaft zu abstrahieren. Von vergangener Zeiten hingegen muss nicht erst abstrahiert werden, denn sie ist immer schon abstrakt, da ja unwiederbringlich verga ngen. Gegenstände der Betrachtung in der Stadt verlieren an materiell-räumlicher Konsistenz, wenn sie in ihren zeitlichen Ablauf hineingestellt werden – so, als besäße die Zeit eine Eigenmacht, der harten Materialität und Faktizität entgegenzuarbeiten. Die physisch wahrzunehmende Stadt (Plätze, Straßen, Häuser), die in ihrem Geschichtsverlauf gelesen wird, immaterialisiert und nähert sich durch das Lesen der Immaterialität des Wortes oder des Gedankens an. Walter Benjamin stellte in diesem Zusammenhang heraus, dass der Zweck des historischen Verstehens in der Gewinnung des eigenen , gegenwärtigen Standortes liegt. „Der Schein der geschlossenen Faktizität schwindet in dem Grade, in dem der Gegenstand in der histor ischen Perspektive konstruiert wird. Die Fluchtlinien dieser Konstruktion laufen in unserer eigenen historischen Erfahrung zusammen.“ (Benjamin 1990, S.1104) Auch die Methode der Erfassung von Raum und Zeit ist jeweils anders. Während die Perzeption von geographisch-statischen Räumen die Bewegung des Rezipienten erfordern, wird die Dynamik eines Zeitzusammenhangs eher deutlich, wenn der Rezipient stillsteht und somit frei wird, auf die Dynamik zu achten, mit der die geschichtlichen Ereignisse ihren Lauf genommen haben oder gerade unmittelbar vorüberziehen. Die Sesshaftwerdung und der Bau von Städten bekommt über die Bedeutung der räumlichen Fixierung (von Handlungsraum) hinaus in erster Linie eine zeitfixierende Bedeutung. Die Textur der Stadt materialisiert die ansonsten flüchtige Zeitstrukturen. Sie entfernt das Individuum von der Endlosigkeit des Durchlebens von Naturgegebenheiten und ersetzt die Endlosigkeit durch das Bewusstsein der Endlichkeit des eigenen Lebens. Aus der Außenfokussierung des Lebens wird in der Stadt eine Innenfokussierung. Aus diffusem Raum wird konkrete Zeit. Wie der frühchristliche Kirchenlehrer Augustinus (354-430) feststellte, bedeutet Geschichtsbewusstsein die Gegenwärtigkeit dreier Zeiten im Heute: der Gegenwart der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft (Fahle 1997, S.473). Geschichte ist immer geschichtlicher Wandel. Geschichtsschreibung ist der Versuch, den geschichtlich ereigneten Wandel – also Bewegung – im Geiste emotionsgestützt wiederzubeleben, zu erfassen und durch Beschreibung festzuhalten. Dabei ist dieser Prozess völlig abstrakt, denn was gestern war, ist ja vorbei und nur noch eine Spur führt von den überlieferten Gegenständen zu dem rein ideellen Konstrukt der zurückliegenden Entstehungs - und Entwicklungszeit. Geschichtsschreibung ist ein formbildender Prozess. Geschichte manifestiert sich deutlich in Form der Aufzeichnung sozialen Handelns in der Stadt. „Mit dieser aus den Erinnerungen zurückkehrenden Woge saugt sich die Stadt voll wie ein Schwamm und breitet sich aus. Eine Beschreibung Zairas, wie es heute ist, müßte Zairas g esamte Vergangenheit enthalten. Aber die Stadt sagt nicht ihre Vergangenheit, sie hält sie wie die Linien einer Hand, geschrieben in die Straßenränder, die Fenstergitter, die Brüstungen der Treppengeländer, die Blitzableiter, die Fahnenmasten, jedes Segment seinerseits schraffiert von Kratzern, Sägspuren, Einkerbungen, Einschlägen.“ (Calvino 2000, S.14) Den toten Geschichtsdaten verhilft erzählte Geschichte zu einer Physiognomie (Bollerey 2001, S.363). Sie ist darin befangen und kann nicht anders, als die tatsächliche Geschichte aus der Retrospektive nur verfremdet wiederzugeben. Die Verfremdung geschieht, da die Ursachen aus der Kenntnis ihrer Wirkungen betrachtet werden. Aber ohne diesen komplexen Überblick über die Entstehung von Dingen und Phänomenen, ihrem Werden und Wandel, wäre es gar unmöglich, dynamische Zusammenhänge als Geschichte zu erkennen und darzustellen. Lebensphilosophie und Geisteswissenschaften (Geschichte, Soziologie, Ökonomie, Kunst- und Literaturwissenschaft, Religionswissenschaft, Psychologie, Sprachwissenschaft etc.) – Wissenschaften also, die sich auf die Erforschung des Menschen richten – umkreisen derartig immaterielle Gestaltkategorien. Unser Geschichtsbild ergebe sich allein aus der Wirkung von Texten, sagte Wilhelm Dilthey. „Daher hat die Kunst des Verstehens ihren Mittelpunkt in der Auslegung oder Interpretation der in der Schrift enthaltenen Reste menschlichen Daseins.“ (Dilthey 1900, S.36) Die relative Abgeschlossenheit eines Textdokuments, das ja grundsätzlich immer für wahr gehalten wird, qualifiziert es dafür, leicht der 45 Interpretation eines jeden und jeder nachfolgenden Generation zugänglich zu sein - selbst über große zeitliche Intervalle hinweg. Die hermeneutische Wissenschaft nun „ist die Kunstlehre der Ausl egung von Schriftdenkmalen“ (ebenda, S.37). Erst von den Texten aus strahlt Licht auf andere Denkmale einer Zeit (ebenda, S.36). Das Denken der gesamten Nachwelt wird durch nichts so sehr wie durch die Interpretation überlieferter Texte beeinflusst. Das historische Bewusstsein des Menschen, das sich mit seinem Wirklichkeitsbewusstsein verbindet, ermöglicht es, über die Schranken der eigenen Zeit hinaus tief in die Vergangenheit der Kulturen zu blicken. Das historische Bewusstsein bildet ein System, welches aufgrund seiner Ansiedlung in der raumzeitlichen Struktur der Geisteswissenschaften außerhalb der Gegenwart steht. Es kann durch diese Ent-Gegenwärtigung im Prinzip jedwedes, auch lange vergangenes Phänomen als Wirklic hkeit erfahren. Der heutige Mensch nehme so die Kraft der Kulturen in sich auf und kann ihren Zauber nachge nießen, meinte Dilthey (Dilthey 1900, S.34). Anhand von Überlieferungen lassen sich heute und zu jeder Zeit ganze Charakteristika längst vergangener Zivilisationsepochen rekonstruieren und lange Entwicklungsprozesse darstellen - ja überhaupt die gesamte Vergangenheit des Menschen, die wesentlich die Geschichte des menschlichen Zusammenlebens ist (ebenda, S.34). Schriftliche Überlieferungen und sprachkommunikative Modi dienen dabei als Transportoren. Hans -Georg Gadamer stimmte Wilhelm Dilthey zu, indem er die Lebendigkeit der Evokation hervorhob: „Jeder weiß ja, wie sehr uns etwa die Sprache der Kunst, und selbst der religiöse Klang der Sprache der Kunst ferner Kulturen, fast wie eine unmittelbare Selbstbegegnung erscheinen können.“ (Gadamer 1989, S.14) Die Vergangenheit mit den absoluten Maßstäben der Gegenwart zu messen, war in der Nachfolge Diltheys nicht mehr möglich. Historisch vergangenen Zeiten kann in dieser Basis des Denkens ein jeweils eigenständiger Wert zugesprochen werden. Diltheys Überlegungen legitimierten die epochale Differenzierung historischer Zeiten (vgl. Dilthey 1910, S.49ff.). Ich möchte nun ein historisches Beispiel des Lesens betachten. Dem Beispiel liegt die Hypoth ese zu Grunde, die Textinterpretation sei für die Entwicklung des europäischen Kulturzusammenhangs der Moderne von außerordentlicher Wichtigkeit gewesen, denn letztendlich war es das Lesen, das zur Entstehung der Neuzeit führte! Die Renaissance - ein historisches Beispiel des Lesens. „Bücher sind voll von Worten oder Weisen, voll von Beispielen aus alten Zeiten, voll von Bräuchen, Gesetzen und Religion. Sie leben, verkehren und sprechen mit uns, lehren, bilden und trösten uns, ze igen uns die Dinge, die unserem Gedächtnis besonders fern stehen, so als ob sie gegenwärtig sind, und stellen sie uns vor Augen. So groß ist ihre Macht, Würde und Hoheit und sogar göttliche Kraft, daß wir alle, gäbe es nicht die Bücher, ungebildet und unwissend wären, kein geschichtliches Wissen um die Vergangenheit, kein Beispiel, ja keine Kenntnis von menschlichen und göttlichen Dingen hätten. Dasselbe Grab, das den Leib des Menschen deckt, würde auch ihren Namen verschütten.“ (der aus Griechenland stammende, venezianische Kardinal Bessarion in einem Brief aus dem Jahre 1468 an den Dogen Cristoforo Moro, zit. in: Garin 1961, S.451) Die desolate wirtschaftliche Lage der meisten Städte und des verkümmerten Gewerbes am Ende des MittelaltersXIX hätte die natürliche gesellschaftliche Entwicklung den Rückfall in eine Landwirtschaft mit quasi-feudalem Charakter bedeutet (Garin 1961, S.432). Aber erstaunlicherweise kam es nicht dazu, sondern zum Gegenteil: künstlerische Handlungsfelder wie Malerei, Architektur und Bildhauerei blühten auf und die Poesie und andere literarische Zweige verfeinerten sich beständig. Offensichtlich gründete sich der schöpferische Aufschwung auf einen kollektiven Willensakt, denn anders als durch eine willentliche Überspringung der renitenten Materialität ist der gewaltige Sprung in der Entwicklung des Denkens und Schaffens, das sich von den mittelalterlichen Fesseln befreite, nicht zu erklären. Die Epoche der Renaissance in Italien (Mitte 14.- Anfang 16.Jahrhundert) ist bekanntlich von der Rückbesinnung auf die griechisch-römische Antike gekennzeichnet. Ab Mitte des 14.Jahrhunderts griff das römisch-griechische Altertum mächtig in das italienische Leben „als Anhalt und Quelle der Ku ltur, als Ziel und Ideal des Daseins, teilweise auch als bewusster neuer Gegensatz“ ein (Burckhardt 1947, S.162).XX Das Studium von aus dem Griechischen oder Lateinischen überlieferten Schriftdokumenten, „Der drastische ökonomische Einbruch vom ersten Drittel des 14. bis zur Mitte des 15.Jahrhunderts verhi nderte, daß sich die europäischen Städte weiterentwickelten.“ (Benevolo 1993, S.96) XX Der Schweizer Kunsthistoriker Jakob Burckhardt (1818-1897) selbst gibt uns das Beispiel eines hohen Interpreten. In der Wertung Erwin Panofskys legt Burckhardt seinem Buch «Die Kunst der Renaissance in Italien» (das er bescheiden „ein Versuch“ untertitelt) die Gesamtheit der Dokumente der Epoche der Renaissance und deren XIX 46 Dramen und epischen Werken von Mythologie (Homer) und Geschichtsschreibung (Tacitus), ging Hand in Hand mit dem interpretierend reproduzierendem Kunstschaffen, das die nachempfundenen geistigen Werte Griechenlands und Roms durch Kunstwerke und Architektur stilistisch-ästhetisch medialisierte. Zwar vermittelte die antike Literatur keinen unmittelbaren Umwelt-Bezug – sie vermittelte mehr sogar: einen Welt-Bezug(!) – ein Bezug, der indirekt und nicht ostentativ im Text steckt (Ricœur 1971, S.267). Durch die Vermischung dieses antiken Weltbezuges der Griechen mit dem direkten Umwelt-Bezug der Menschen mehr als Tausend Jahre später gelang es, die unmittelbare Umwelt von ihrer Begrenztheit zu befreien und sie zur «neuen Welt» zu machen.XXI In der Prosa begannen die Dichter, Cicero nachzuahmen, der in der Antike der «humanitas» das Wort geführt hatte; in der Kunst und Architektur galt das Hauptinteresse dem Erbe Vitruvs (Burckhardt 1947, S.131). „Unendlich wichtiger aber als die baulichen und überhaupt künstlerischen Reste des Altertums waren natürlich die schriftlichen, griechische sowohl als lateinische. Man hielt sie ja für Quellen der Erkenntnis im absoluten Sinne.“ (Burckhardt 1947, S.176) Sprache und Schrift stellten aufgrund ihrer Flexibilität geeignete Mittel dar, die widerständige Realität zu überspringen. Die Poesie genoss daher eine besondere Stellung. „Das Beste, was so entsteht, ist nicht mehr Nachahmung, sondern eigene freie Schöpfung.“ (Burckhardt 1947, S.234) Die eigene freie Schöpfung war in der Renaissance bestrebt, den idealen poetischen Text zu schreiben, der alle möglichen, auch die widersprüchlichste Auslegung erlaubte (Eco 1990, S.36). Von dem italienischen Dichter Giovan Giorgio Trissino (1478-1550) berichtet der Kunsthistoriker Rudolf Wittkower: „Er versuchte, das griechische Epos wiederzuerwecken, und verpflanzte, mit seiner Sofonisba (1514-15), die Tragödie im griechischen Stil nach Italien. In seiner Komödie I Simillimi (1548) folgte er Plautus, in seinen Canzoni ahmte er Pindar nach. Er schrieb lateinische Gedichte und Eklogen und übersetzte Horaz. Sprachliche Probleme fesselten ihn besonders, wie alle Humanisten seiner Zeit. Er veröffentlichte eine Ars Poetica und grammatikalische Schriften; an seinen Namen knüpft sich die Erinnerung an einen Versuch, Orthographie und Aussprache des Italienischen zu hellenisieren und so eine künstliche italienische Schriftsprache zu schaffen. Hierin bekämpfte er die allgemeine humanistische Tendenz, [...] das Volgar e (den toskanischen Dialekt) zur Wissenschaftssprache zu erheben.“ (Wittkower 1969, S.51f.) Ohne Zweifel erfolgte ein Nachfühlen und Nachleben der antiken Texte nicht ohne Idealisi erung, denn es ist einfach, zu idealisieren, was man verehrt. (Burckhardt 1947, S.232f.). Die Nachahmung der «Welt der Griechen» ist den Nachfahren ja möglich vermittels der symbolischen Dimension des Lebens, das man in den Texten vorfand oder da heraus- oder hineinlas. Der Kunsthistoriker Erwin Panofsky schilderte das Kunstschöpfen der Renaissance wie folgt: „... ein italienischer Dichter überträgt den Ovid in die Sprache seiner Zeit und seines Volkes, ein italienischer Maler gestaltet danach die Szene im Sinne der antikisierenden Quattrocentokunst unter Aufbietung des ganzen Apparates von Satyrn, Nereiden, Eroten, fliehenden Nyphen, wehenden Gewändern, flatternden Haaren.“ (Panofsky 1998, S.253f.) Pathos und Distanz, die in die Kunst Einzug hielten, waren notwendig, um sich vom Mittelalter abzulösen (Panofsky 1998, S.247). In der Kunst lernte man den Körperausdruck und die Körperschönheit der griechisch-römischen Plastiken schätzen (den Ausdruck) und künstlerisch nachzuahmen (ebenda, S.249). Nachahmung und Überidealisierung sind es zu verdanken, dass der neu auflebende Humanismus die gotische Barbarei und selbst die grobe «griechische Manier» überwand (Garin 1961, S.449). Weltliche Bürger begannen, ein kultivierteres Latein als die mittelalterlichen Kirchengelehrten zu sprechen. War das Latein vordem die Sprache des Klerus und der Gelehrten, wurde mit dem «Volgare» die Volkssprache nun auch als Schriftsprache kultiviert. Die in Volgare verfassten Werke der Dichter Dante Alighieri (1265-1321) und Francesco Petrarca (1304-1374) trugen daran einen entscheidenden Anteil, der in der ersten Hälfte 15.Jahrhunderts erfundene Buchdruck an der Verbreitung. Wirkungsgeschichte als wahren Ausdruck eines einheitlichen Weltanschauungssinns ebendieser Ep oche zu Grunde (Panofsky 1974, S.93). XXI Sicherlich unterstützte die Theorie des Nachlebens auch der Athropomorphismus der Griechen: „Die Griechen sind ein anthropomorpistisches Volk war, das Alles menschlich zu veredeln, Alles in die Kreise schöner Gestalten zu erheben strebt.“ (von Humboldt 1959, zit. in: Blumenberg 1999, S.282) 47 Ich möchte hier den geschichtlichen Exkurs kurz zu Ende führen. Nicht nur in zeitl icher Hinsicht kam es in der Renaissance zur Erneuerung der Antike, sondern auch in räumlicher Hinsicht. Dazu gehe ich zeitlich noch einmal einen Schritt zurück, um die Differenz und den Übergang vom Mittelalter zur Renaissance deutlich zu machen. V.3 Raum lesen M i t t e l a l t e r . Über die Unwirren der Völkerwanderung (4.- 6./10.Jahrhundert) war der lebendige Faden der Überlieferung durch Tradition von der antiken Vergangenheit zum Mittelalter XXII abgerissen. Die Tradition, die Wissen von Generation zu Generation weitergibt, war unterbrochen oder nur unbewusst weitergeführt worden. Im Bauen von Stadt musste das Mittelalter andere als die antiken Bezugspunkte finden, die ja mit dem Untergang des Weströmischen Reiches (476) gar keine Basis mehr hatten. Als zwischen dem 9. und 14.Jahrhundert die Mehrheit der Städte Europas entstanden, hatte sich inzwischen der christliche Glaube der römisch-katholischen Kirche verbreitet und war erstarkt, so dass Architektur und Stadtbaukunst nun eine vordergründig christlich-religiöse Motivation erfuhr. Bis zum 14.Jahrhundert versuchten die Mönche in der Klosterbaukunst, aus dem scholas tischen Denken adäquate bauliche Formen abzuleiten. Denn nach scholastischem Ideal fallen Handeln und Denken in Gott zusammen (Panofsky, 1998, S.26). Gelang es in ausgewählten Bereichen der Architektur noch, solche Theoriegebäude auf die architektonische Praxis zu übertragen, konnte man das im Städtebau nicht leisten. In der Stadtbaukunst musste gewissermaßen auf ein allgemein wirksameres Mittel ausgewichen werden: auf das Bild(!) - das fiktive Bild der Gottesstadt. Gleichsam der höheren Idee einer paradiesischen, hermetischen Schönheitsvorstellung verpflichtet, wurde städtischer Raum quasi außerhalb seiner selbst (Fumagalli 1999, S.20) auf dem Weg zu Gott gesta ltet. „Von der Welt Erfahrung zu machen, wie man sie einem Buch oder einem Brief verdanken kann, s etzt nicht nur Alphabetismus, nicht nur die Vorprägung der Wünsche durch Sinnzugang durch Schrift und Buch voraus, sondern auch die kulturelle Idee des Buches selbst.“ (Blumenberg 1983, S.10) Die mittelalterlichen Menschen empfingen die Welt im Buch Gottes lesend. Die Stadt war in dieser Welt das vom Menschen aufgeschlagene Buch Gottes. Die Fiktion von einer Natur der Gottesstadt besaß ein ganz konkretes, irdisches Abbild: Jerusalem (Corboz 2001, S.61)! Von Jerusalem existierten Stiche, die immer neue Vor-Bilder generierten, nach denen die europäischen Städte bildorientiert gestaltet wurden. „Entgegen der verbreiteten Meinung ist der mittelalterliche Dom nicht unbedingt mitten in der Stadt gelegen, sondern oft unmittelbar an die Mauer, an den Rand der Siedlung gebaut worden. Der Ursprung der Stellung ist wahrscheinlich auf die Lage des Tempels von Jerusalem zurückzuführen; im Fall von Pisa handelt es sich sogar um ein Resümee der Heiligen Stätte: Die Taufkirche stimmt mit dem Heil igen Grab überein, der Dom selbst mit dem Tempel (darum die seltsame Kuppel), die Grünfläche mit der Tempelterrasse. Der schiefe Turm entspricht wohl einer der beiden Tempelsäulen, was vermuten lässt, dass das Projekt einen zweiten symmetrischen Turm vorsah. Die Nachahmung Roms oder Jerusalems und die implizite Einschreibung von Zeichen ins Territorium sind während des ganzen Mittelalters normale städtebauliche Maßnahmen.“ (Corboz 2001, S.61) Gott verpflichtet, kam den Menschen die Aufgabe zu, sich in der Stadt ein Umfeld zu schaffe n, das gestattete, der Versuchung durch den Teufel zu widerstehen. In der schönen Gestaltung der Stadt stellte sich der siegreiche Widerstand gegen das Böse am sichtbarsten dar und begleitete jeden Bürger in seinem Alltag. Schönheit bedeutete unmittelbare Anschaubarkeit des Wahren und Guten. Nahezu platonisch konnte der mittelalterliche Stadtmensch formulieren: „Die Dinge sind schön, weil sie uns in der Anschauung das Sein offenbaren, an dem sie teilhaben.“ (Assunto 1997, S.45) Im Schönen schauten die Menschen Gott selbst an (Assunto 1997, S.43; 45). Das Schönheitsideal war ein hermetisches, durch die Religion präzise kodifiziertes Ideal, das von allen gleichermaßen geteilt wurde. Selbst private Bauherren teilten es und hießen die Baumeister die Stadt für ihre Einwohner in der Schau Gottes zu schreiben. Dinge wurden nicht beliebig erfunden, sondern schienen durch göttlichen Entscheid Das Mittelalter begann 476 mit dem Untergang des Weströmischen Reiches und endete im 15.Jahrhundert mit dem Beginn der Renaissance. XXII 48 festgelegt und platziert zu werden. Das mittelalterliche Sein und die mittelalterliche Natur der Stadt besaßen die Qualität eines Ganzen aus einem Wurf. Zwar existierten im Mittelalter die baulichen Hinterlassenschaften in Städten wie Athen, Rom und anderen, wenngleich sie vielfach zu Ruinen zerfallen und stark verschüttet waren. Aber Athen war in die Bedeutungslosigkeit und Rom in die Provinzialität abgerutscht. Über die Herkunft und den Sinn der antiken Monumente, denen die Menschen in der Stadt begegneten, hatte sich der Schleier der Unerklärbarkeit gesenkt. Niemand hatte das Bedürfnis oder Interesse an einer realistischen Erklä rung. Stattdessen wurde ihnen vielfach ein phantastischer Ursprung zugeschrieben (Benevolo 1993, S.43). Aber die Antike war in Italien - anders als in Deutschland – über das gesamte Mittelalter „ein Garten, der noch immer Blüten und Früchte trug, noch ein Trümmerfeld, dessen Quadern und Säulen bei neuen Bauten benutzt werden konnten“ (Panofsky 1998, S.247). In der Renaissance änderte sich das. R e n a i s s a n c e . Während seinerzeit in einem sehr natürlichen Entstehungsprozess die mittelalterliche Stadt aus dem Land hervorgegangen war (Berndt 1978, S.109), quoll die Idee der Stadt der Renaissance gleichermaßen wie die des ganzen Lebens auf eine weitaus künstliche Art aus dem Text. Im Bauen von Stadt wurde der mittelalterliche Bezugspunkt des Bildes durch den renaissancenen des Textes abgelöst. Die im Mittelalter vorherrschende Form/ der Raum verlagerte sich auf einen zeitlichen Schwerpunkt! Die Frührenaissance versuchte noch eine Harmonisierung zwischen dem Buchcharakter der mittelalterlichen Welt und den neuen Texten. Aber durch die wiedergelesene Antike veränderte der Mensch seine Stellung in der Welt. Im Mittelalter hatte er Gott gegenübergestanden. In der Renaissance gewann er die die antike Distanzierung und Gegenüberstellung zum Tier (dem Barbar) zurück. Der Religiosität tat das keinen Abbruch – im Gegenteil: Der Mensch sah sich von Gott in die Mitte des Universums gestellt (Panofsky 1996, S.8) und in dieser Zentralen Position in der Welt stand er seinen eigenen Entfaltungsmöglichkeiten gegenüber. Auch der Schönheitsbegriff stellte sich anders dar. Er verließ das Göttliche und wurde das Göttliche im Menschen. „Christus als der Inbegriff der Vollkommenheit und Harmonie trat an die Stelle dessen, der am Kreuz für die Menschheit gelitten hatte, der Pankrator an die Stelle des Schmerzensmannes.“ (Wittkower 1969, S.30) Wie Leon Battista Alberti formulierte, ist Harmonie, „die dem Bauwerk innewohnt; eine Harmonie, welche [...] nicht ein Ergebnis künstlerischer Phantasie, sondern vernunftgemäßer Überlegung ist“ (Wittkower 1969, S.33). Alberti weiter: Die Widerbelebung des klassischen Schönheitsideals in bewusster Ablehnung der Fortsetzung des mittelalterlichen Ideals im Bauen, drücke sich „in der planvollen Anordnung und Verschmelzung der Proportionen aller Teile eines Gebäudes, derart [aus], dass jeder Teil seine absolut feststehende Form und Größe hat und nichts hinzugefügt und weggenommen werden kann, ohne die Harmonie des ganzen zu zerstören“ (Wittkower 1969, S.15). Von besonderer Wichtigkeit stellte sich die Veränderung des gesellschaftlichen Umgangs mit baulichen Hinterlassenschaften der Antike dar. In der Renaissance gelang die Rückgewinnung ihrer realistischen Erklärbarkeit. Die Erklärung der Ruinen kam nicht aus den Monumenten se lber oder von Gott, sondern aus der Literatur – dem Text. Der erste Stadtinterpret war das geschriebene Wort. (Es war nicht die erklärende Zeichnung, denn die Zeichnung in der Architektur erlangte erst zu Anfang des 16.Jahrhunderts einen Wert.) Im Gegensatz zum Mittelalter konnte und musst e die Renaissance theoretisch werden (Panofsky 1974, S.65). 1415 wurde ein altbekannter Text zum wirklichen Erklärungstext: die Bücher der Baukunst «De achitectura» von Vitruv. XXIII Im Mittelalter wurden die Bücher Vitruvs zwar von Mönchen und Gelehrten in den Klosterbibliotheken studiert, aber nur als technische Anleitung (und nichts anderes waren sie eigentlich). Die Bücher wurden abgeschrieben, kommentiert und zum Teil seitenweise in den Werken mittelalterlicher Gelehrter zitiert. Mittelalterliche Produktion war im wesentlichen Reproduktion. Ein Ding «verstehen» hieß, seine Existenz konstatieren und gegebenenfalls kommentieren. Aber keinen Menschen überkam die romantische Anwandlung, Dinge oder Texte zu interpretieren ohne zu zitieren. Die zitatlose Interpretation machte den entscheidenden Unterschied zwischen mittelalterlichem Verstehen und dem Verstehen in der Renaissance aus. War der mittelalterliche Umgang mit Text ein Anschauen der durch den Text vermittelten, ewigen Gottesidee, setzte mit der Renaissance die Ausübung von Gewalt auf die Dinge ein: sie wurden ausgelegt. Dabei mischte der Mensch seine eigene Person in den archäologischen Text. Wichtiger als das Werk selbst wurde, wer es und wie es jemand las, auslegte und gegebenenfalls kommunizierte – also auf welche Art Der römische Militärbaumeister und Ingenieur Vitruvius Pollio hatte sie wahrscheinlich in der Herrschaftsperiode Kaiser Augustus’ (Pont.Max. 27 v.Chr.-14) geschrieben. XXIII 49 und Weise der dialektische Prozess des Nachschaffens in Gang gesetzt wurde. Die vom Menschen vorgenommene Auslegung der Dinge, Phänomene und Erscheinungen machte die Ewigkeit und Unfehlbarkeit des unumstößlichen Wortes Gottes in jedwedem Text zunichte. Sie ersetzte die Unfehlbarkeit durch die menschliche Fehlbarkeit und Bestechlichkeit unter dem Vorzeichen der Konzentration der Macht in den Händen weniger Adelsfamilien (zum Beispiel der Medici in Florenz, die sich in das Erbe des Republikanischen Roms stellten). Dem Adel war es möglich, den Textes der Stadt machtsymbolisch und programmatisch einzusetzen. A l b e r t i . Zu den ersten und genialsten Künstlern der Frührenaissance, die Vitruvs Bücher interpretierten, zählt der Humanist und Kunsttheoretiker Leon Battista Alberti (1406-1472). Alberti, der allseitig begabte Gewaltmensch, als den ihn Jacob Burckhardt beschreibt, war vielleicht einer der er sten Leser in der Renaissance. „Endlich aber wird auch die tiefste Quelle seines Wesens namhaft gemacht : ein fast nervös zu nennendes, höchst sympathisches Mitleben an und in allen Dingen. Beim Anblick prächtiger Bäume und Erntefelder mußte er weinen; schöne, würdevolle Greise verehrte er als eine „Wonne der Natur“ und konnte sie nicht genug betrachten; auch Tiere von vollkommener Bildung [...], weil sie von der Natur besonders begnadigt seien; mehr als einmal , wenn er krank war, hat ihn der Anblick einer schönen Gegend g esund gemacht.“ (Burckhardt 1947, S.131f.) Vitruvs Bücher muss Alberti noch im lateinischen Original gelesen haben, denn erst etwa Einhundert Jahre nachdem sie anlässlich des Konzils von 1418 in ein neues Licht gerückt wurden, wurden die Bücher im Jahre 1511 erstmals (und dann häufig) wieder verlegt – nun aber in italienischer Übersetzung und mit Illustrationen, die es im Original nicht gab. Allein die den Text erläuternde Illustration stellen eine Interpretation dar. Die bekannteste Illustration einer entsprechenden Textstelle XXIV Vitruvs ist wohl Leonardos «homo ad quadratum» und «ad circulum» (Wittkower 1969, S.20). Zu jener Zeit kamen Übersetzungen auch in anderen Sprachen in ganz Europa in Umlauf und es setzte um 1510 ein breites Studium der antiken Reste, Inschriften, Autoren und Baumeister unter Zurückdrängung der Phantasie ein (Burckhardt 1947, S.168). Vitruv interpretierend wurden die antiken Hinterlassenschaften in der Stadt plötzlich gelesen. Durch ein Nachvollziehen (oder geistiges oder praktisches Nachschaffen) konnten die archäologischen Reste, die man mit Augen bis dato nur hatte sehen können, nun auch verstanden werden. „Die wirkliche Antwort liegt in dem Umstand, daß intuitives, ästhetisches Forschen so mitei nander verknüpft sind, daß sie abermals das schaffen, was wir eine «organische Situation» g enannt haben. Es stimmt nicht, daß ein Kunsthistoriker zuerst seinen Gegenstand vermittels einer nachschaffenden Synthese konstituiert und dann mit der archäologischen Forschung beginnt – wie man zuerst eine Fahrkarte kauft und dann einen Zug besteigt. In Wirklichkeit folgen diese beiden Prozesse nicht aufeinander, sie durchdringen sich gegenseitig; nicht nur, daß die nachschaffende Synthese als Grundlage für die archäologische Forschung dient, auch die archäologische Forschung dient ihrerseits als Grundlage für den Prozeß des Nachschaffen s, beide modifizieren und rektifizieren sich wechselweise.“ (Panowsky 1998,S.20) «De achitectura» war kaum mehr als technisch-nüchterne Anleitung und weit entfernt vom Charakter eines Architekturführers. Aber offensichtlich reichte diese Anleitung dennoch aus, die geistige Tätigkeit derjenigen, welche die noch unillustrierten Schriften Vitruvs studierten, zu einem eigenen Weiterdenken zu inspirieren. „Mit Hilfe Vitruvs erkannte man bald, daß die Grundlage der verschiedenen antiken Stilformen in der Säulenordnung zu finden sei.“ (Pevsner 1989, S.190) Das wäre im Mittelalter undenkbar gewesen(!): das Erkennen von Stilprinzipien als geistiger Ausdruck einer Zeit (Panofsky 1974, S.65). „Die Bemühungen um das Verständnis und die Auslegung des Vitruv gipfelten in der Gründung der Vitruvianischen Akademie in Rom im Jahre 1542, deren gewaltiges gelehrtes Programm indessen niemals durchgeführt wurde.“ (Wittkower 1969, S.19) Bei Vitruv heißt es da: „Desgleichen ist des Körpers natürlicher Mittelpunkt der Nabel, denn wenn ein Mensch sich rückwärts mit auseinander gestreckten Händen und Füßen hinlegt, und man ihm den spitzen Sche nkel des Zirkels in den Naben stellt, so werden bey Beschreibung des Kreises die Spitzen sowohl der Finger beyder Hände, als der Zähen beyder Füße von der Zirkellinie berührt werden./ Gleichwie aber die Figur eines Zirkels im Körper zu bilden ist, so ist darin nicht minder die eines Vierecks anzutreffen; denn wenn man dessen Maaß von der Fußsohle bis zum Wi rbel nimmt, und dieß mit dem, von Einer ausgestreckten Hand zur Andern vergleicht, so wird sich ergeben, daß dessen Breite der Länge völlig, so wie in einem nach dem Winkelmaaße abgemessenen Quadrate gleich sey.“ (Vitruv 1995, S.15) XXIV 50 Um die Alten zu verstehen, musste man gelehrt sein – man musste lesen können. Aus den Baumeistern (die im Mittelalter hauptsächlich Ingenieure waren) entwickelte sich in der Renaissance die Gelehrtenprofession des Architekten. Als Architekt musste man lesen und schreiben können – eine Befähigung, die damals nur sehr wenige Menschen erlangten. Aber ganz allgemein wurde damit das Ende der oralen Epoche eingeleitet. Mit der Alphabetisierung aller wichtigen Berufsgruppen wurde die Position des Einzelnen von der Kontrolle durch Lehrinstitutionen wie Kirche und Zunftwesen unabhängig. Die neu gewonnene Unabhängigkeit von den Institutionen kehrte sich aber sofort in die vielleicht noch viel tiefgreifendere Abhängigkeit von Texten um. (Siehe Abschnitt IV.1.) Gebäude begannen, die Handschrift von Architekten zu tragen. Anders als die mittelalterliche Ingenieurbaukunst erwarb die Architektur in der Renaissance den Status einer freien Kunst. Architekten errichteten private Gebäude und selbst Kirchen auf den Gegendruck von Auftraggebern hin. Dazu müssen sich die Akteure in einer Art Schwurgemeinschaft zusammengefunden haben, deren geistige Verbindung nicht mehr ein gemeinsames Gottesansinnen war, sondern das gemeinsame Bildungsgut der Antike. So unterschiedliche private Interessen aufeinander trafen, verband sie dennoch das Ziel, die Gegenwart ausdrucksgestalterisch zu missionieren und jeden Stadtbewohner durch den schönen griechisch-römischen Ausdruck der Werke zu erziehen. Aus dem religiösen wurde ein politisches Engagement (Flusser 1992 b, S.43). Alberti sah sich von Vitruv inspiriert, zur Mitte des 15.Jahrhunderts eine Reihe von eigenen Traktaten über Malerei, Bildhauerei und Architektur zu schreiben (in italienischer Sprache), darunter die «Zehn Bücher über Baukunst» («De re aedificatoria») - ganz im Geiste seines Vorbildes Vitruv. Um 1452 waren die Bücher Albertis weitgehend vollendet; der Verfasser war damals 48 Jahre alt (Wittkower 1969, S.35). Auch der Maler und Bildhauer der Frührenaissance Francesco di Giorgio Martini (1439 -1501) und der Bildhauer und Mailänder Architekt Filarete (1400-1501) verfassten Traktate in italienischer Sprache. Zum Zeitpunkt der Verbreitung der Vitruvianischen Bücher und derjenigen Albertis „begannen viele Künstler, Bücher über die Intentionen ihrer Arbeiten zu schreiben“ (Benevolo 2000, S.572). Wohl im neuen Bewusstsein der Endlichkeit des irdischen Daseins und dem Zweifel an des Fortlebens im Jenseits, von dem man im erneuerten Glauben nicht mehr sicher ausgehen konnte, bekamen Texte als Hinterlassenschaft an die Nachwelt einen wichtigen Stellenwert. P a l l a d i o . Auch der Architekt Andrea Palladio (1508-1580) studierte Vitruv. „Giuseppe Gualdo, Palladios Altersgenosse, schreibt in seiner zuverlässigen Biographie des Architekten: «Als Trissino [Palladios Meister, d.A.] bemerkte, daß Palladio ein sehr begabter junger Mann war, und große Neigung zur Mathematik hatte, beschloß er, um seinen Geist zu bilden, ihn in den Vitruv einzuführen, und nahm ihn dreimal nach Rom mit...»“ (Wittkower 1969, S.54). „Wahrscheinlich war er ein besserer VitruvKenner als irgendein anderer Architekt seiner Zeit; [... er glaubte, d.A.] daß Vitruv die tiefsten Geheimnisse antiker Architektur enthüllte. Wie feinsinnig und verständnisvoll er sich in den VitruvText eingefühlt[!] hatte, lassen seine Illustrationen zur Ausgabe des Barbaro von 1556 erkennen. Lesen wir, was Barbaro selbst über Palladios Mitarbeit an diesem Werk sagt: «Als Vorlagen für die wichtigen Illustrationen benutze ich die Arbeiten von Messer Andrea Palladio, Architekt in Vicenza, welcher von allen, die ich persönlich oder vom Hörensagen kannte, nach dem Urteil hervorragender Männer das wahre Wesen der Baukunst am besten verstand. Nicht allein erfaßte er die Hoheit und Schönheit ihrer Prinzipien, sondern er wandte sie auch praktisch an, sei es in seinen außerordentlich feinen und vollendeten Zeichnungen für Grundrisse, Aufrisse und Schnitte, sei es durch die Ausführung und Errichtung vieler prachtvoller Bauten sowohl in seiner Heimatstadt als auch auswärts; Werke, welche mit denen den alten wetteifern, seine Zeitgenossen erleuchten, und die Bewund erung der Nachwelt erwecken werden. Was aber den Vitruvius anbelangt, so hat er (Palladio) den Bau von Theatern, Tempeln, Basiliken und allen solchen Gebäuden, deren Proportionen (compartimenti) die tiefsten und lockendsten Geheimnisse bergen, mit offenem Sinn und kunstreicher Hand erklärt und ausgedeutet[!]; er war es, der die schönsten Denkmäler der Alten in ganz Italien auswählte und alle ihre erhaltenen Werke aufmaß.»“ (Wittkower 1969, S.56f.) XXV Später, als Palladio seine Lehrbücher schrieb, die auf Vitruv und der Ve rmessung römischer Bauten beruhten, ging er im Vierten Buch (über Maß- und Proportionsstudien antiker Tempel) sogar soweit, als einziges, damals zeitgenössisches Bauwerk Bramantes Tempietto (1503, Tempietto di San Pietro in Montorio) mit der Begründung zu integrieren: „Da Bramante der erste war, der gute und schöne Baukunst ans Licht brac hte, welche seit dem Altertum bis auf seinen Zeit vergessen war, so schien es mir gerecht, daß sein Werk einen Platz unter den Alten habe.“ (Wittk ower 1969, S.26) XXV 51 Palladios Lehrbücher «Quattro libri dell’architettura» erschienen 1570. Auf der Basis seines gründlichen und tiefen, in Rom erworbenen Antikenverständnisses schrieb er auch einen schm alen Touristenführer, der gut zweihundert Jahre lang den Reisenden ein Bild des alten Rom vermittelte und „Keimzelle der meisten römischen Führer für Pilger bis ins 18.Jahrhundert hinein“ war (Wittkower 1969, S.55). Die «Accademia Olimpica», die im Jahre 1555 in Vicenza ins Leben gerufen wurde und zu deren geistigen Vätern Palladio gehörte, diente der Förderung des «uomo universale» nach dem Vorbild der antiken Akademie (Wittkower 1969, S.59). Ich gehe in der Entwicklung des Umgangs mit der Stadt schnell in die Moderne voran. A u f k l ä r u n g u n d I n d u s t r i e m o d e r n e . Da man ab der Renaissance den unbedingten Gottesglauben an die Stadt verloren hatte, begann man, sie mehr und mehr zu analysieren. Hinsichtlich der Kenntnisse der Stadt machte man besonders im 18.Jahrhundert Fortschritte. Der wissenschaftliche Umgang mit der Stadt (statt wie vordem der religiös-künstlerische), die feiner werdenden Analysen ihrer Bestandteile und Wirkungen brachten dadurch ihrer Probleme zum Vorschein. Im Angesicht des gesellschaftlichen Wandels vermehrten sie sich beständig auf eine entmutigende Weise (Wetz 1993, S.110). Anstatt wie vordem ein Wesen zu sein, mit dem der Stadtbewohner eine Art persönliche Beziehung unterhielt, erschien die Stadt in der analytischen Betrachtung eher als ein Durcheinander sich überlagernder Funktionen – ein fremdes Durcheinander, das besonders im 20.Jahrhundert nach dem Maßstäben der neuen, wissenschaftlichen Erkenntnis dringlich nach Ordnung verlangte. Die Arbeit mit der Stadt im 20.Jahrhundert verhalf den Planern zu einer Form der Erkenntnis als ein äußerst komplex funktionierendes, kybernetisches System. Das Stadtempfinden löste sich in der 2.Hälfte des 19.Jahrhunderts gleichermaßen auf wie ebenso die traditionellen Möglichkeiten des Ausdrucks. „Nachdem die antike Mythologie nicht mehr Teil der allgemeinen Bildung ist und auch die christliche zu verschwinden scheint, ist es schwer geworden, das Netz der Absichten, Anspielungen und Mitteilungen zu verstehen, die die Selbstdarstellung der führenden Gruppen in Fassaden und Grundrissen mittels kombinierter, mit Sinn beladener Formen möglich machte.“ (Corboz 2001, S.56) Die Stadt wurde zum Werkzeug einer Vielzahl sich zunehmend emanzipierender, gesellschaftlicher Akteure. Aus der Stadt als alte, papierne Bibliothek wurde ein Experimentierfeld. Parallel zur verbreiteten Großstadtfeindlichkeit stammen aus der Zeit um 1900 Versuche von Archit ekten und Künstlern, die Großstadt metaphorisch textuell zu lesen. Der Berliner Jugendstilarchitekt August Endell (1871-1925) gibt dafür in seinem euphorischen Buch: «Die Schönheit der großen Stadt» (Endell 1984) ein Beispiel. An den Textdokumenten der damaligen Großstadtenthusiasten verwundert das hohe Maß an sprachlicher Aggressivität bei der literarischen Widergabe von Stadt – eine Auffassung, die scheinbar mutwillig ihre tatsächlichen, historischen Wesenheiten in der Tradition Georges Eugéne Baron Haussmanns ignorierte. Veröffentlichungen wie die des italienischen Futuristen Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944) oder von August Endell haben den Anschein, als wären es gerade die Architekten und Planer gewesen, die am wenigsten um ein Verstehen rangen, was europäische Stadt ihrem Wesen nach bedeutete. Es verwundert zum Beispiel, dass Endell all diejenigen modernen Tendenzen der Stadtentwicklung seiner Zeit emphatisierte, die tendenziell die Wesen- und Sinnheiten der alten Stadt vernichteten, anstatt sie verträglich und kompromisshaft zu modernisieren, wie es ja gleichfalls Vorschläge gab: zum Beispiel der des Wiener Baumeisters und Städteplaners Camillo Si tte (1843-1903). Sitte schlug vor, die im antiken Schönheitsverständnis defekte Industriestadt zu repari eren - ein ehrenwerter Versuch, der aber scheitern musste. Der Industrieschock hingegen, als den ich ihn bezeichnen möchte, führte zur Dominanz von Tendenzen, die sich der Wesenheit der alten europäischen Stadt absichtlich entgegenrichteten. Endell ging sie in seinem Buch begeistert durch: die omnipotente Vergegenwärtigung (Endell 1984, S.11), mit erforderlicher restloser Hingabe an das Sichtbare (ebd. S.30), die Stadt als Erlebniswelt (ebd. S.15), die rhythmische Taktung des städtischen Lebens (ebd. S.15), die Stadt als Forschungsfeld empirischer und positivistischer Wissenschaften (ebd. S.18) und als kybernetisches Funktionssystem (ebd. S.20), als apolitischer Ort (ebd. S.18) sowie die Auflösung des Schönheitskodexes. Auch Schmutz und Lärm wurden nun als schön aufgefasst, wenn sie als Ausdruck des dahinterstehenden Arbeitsprozesses gesehen wurden (ebd. S.20f.) ecc. – die Stadt als Maschine der Arbeit. Kein mittelalterliches, kein renaissancenes, kein barockes Schönheitsideal mehr, auch keine Bemühungen um die Rückgewinnung des griechischen, sondern das Gegenteil: die Lust am Widerspruch, die Ästhetisierung das Unästhetischen durch Poesie. 52 “Wie fein sind oft die kranken Farben der Großstadtkinder, wie bekommen ihre Züge manchmal gerade durch Not und Entbehrung wundervolle, strenge Schönheit.“ (Endell 1984, S.46) Das nimmt fast postmoderne Züge an: die Ästhetisierung des Hässlichen als Chance, sich dem Hässlichen nicht ab-, sondern zuzuwenden. Die modernen Architekten entdeckten zu Beginn des 20.Jahrhunderts ästhetisch die neue, spröde Poesie einer de-facto-Stadt und lauschten den Geräuschen ihres lebendigen Jetzt-Textes: den „Stimmen der Maschinen, deren Geräusche Sprache werden“ (Endell 1984, S.21), den „Stimmen der Automobile“ und dem „Schrei der Hupen“ (ebd. S.24). Klassische Versuche des Lesens nach der Art des Flaneurs können darin nicht erkannt werden. Da die Architekten und Stadtplaner der Moderne keine Flaneure waren, gab es ihrerseits keine lesenden Verstehensversuche von Stadt. Eher finden wir die moderne Praxis der künstlerischen TextKonsumtion wieder. Warum diffundierte die Manier des Flanierens nicht in die Berufsgruppe der Planer und Architekten und etablierte sich als deren Praxis der Erkenntnis? Die Antworten haben ich teilweise schon zu geben versucht oder versuche das noch im Abschnitt V.4. Hier zur kurzen Erinnerung und als Vorgriff: ich denke, der Grund liegt darin, dass hermeneutische Erkenntnisse aus dem Flanieren in eine retroaktive, im wesentlichen inopertionierbare Kulturpraxis eingebunden sind und im Prinzip nicht oder aber erst über lange Umwege indirekt zu einer aktiven Handlungsbasis werden können. Eine Ursache für die Härte der künstlerischen Reflexion über die Stadt in der Umbruchphase der vorindustriellen zur industriellen Gesellschaft liegt auch in der unmittelbaren Berührung der Architektur (im Gegensatz zu anderen Kunstrichtungen) mit der Industrie. Spätestens die Arts -and-CraftsBewegung zur Reform des Kunsthandwerks um die Jahrhundertwende in England ließ vermuten, dass ein handwerkliches Baugewerbe der Vergangenheit angehörte und in Zukunft das massenhafte Baugeschehen industriell betrieben werden musste. Und das städtebauliche und Architekturschaffen wurde postitivistisch in den rigiden, technischen Raumproduktions- und Reproduktionsprozess eingegliedert. Im folgenden Abschnitt wende ich mich den Städtelesern zu. V.4 Stadt lesen W e r l i e s t S t a d t ? Es wurde bereits festgestellt, dass sich die Phänomene der Stadt nicht selbst auslegen. Sie bedürfen eines gebildeten Deuters, der sich auf das Schrifttum ihres Textes versteht. Walter Benjamin fand einen kongenialen Deuter in der Figur des Flaneurs, die im 19.Jahrhundert in Paris auftaucht. Der Flaneur ist der Prototyp des Städtelesers. Merkwürdigerweise war es nicht der Literat und – wie dargelegt - schon gar nicht jemand, der eine direkte Verantwortung für Architektur oder Städtebau trug. Denn zum Verhältnis von Literat und Stadt heißt es, „Schriftsteller nennen es meist studieren, wie sie sich einer Stadt nähern“ (Benjamin, in: Opitz 1996, S.475). Anders nennt es der Flaneur: Er studiert Stadt nicht, sondern kauft dem Literaten den Schneid ab und er liest sie. Mehr als mit einer Wissenschaft stimmt das Flanieren mit der Hermeneutik darin überein, eine Kunst zu sein. Benjamin hat es so verstanden: mit dem Flaneur verleiht sich die Stadt ein Rezeptionsorgan, durch das sie sich gewissermaßen selber liest und versteht. Denn „wo keine Selbsterkenntnis, da ist keine Erkenntnis“ (Honold 2000, S.29). Die Figur des Flaneurs ist ein Medium. Durch das Medium hindurch wird sich die Stadt ihrer selbst bewusst. Die Stadtlektüre des Flaneurs ist die Selbsterkenntnis des Lektüregegenstandes und sein Gewissen - entgegen der Richtung des Zeitlaufs. Benjamin sah in diesem Aspekt sein Geschichtsverständnis bestätigt, bei dem das Vergangene einen Erlösungsanspruch an die Gegenwart stellt. Der Flaneur löst es für die Stadt ein, denn es sieht ganz so aus, als hä tte die Existenz des Raums und seiner Phänomene bis ins 19.Jahrhundert auf die Interpretation durch den Flaneur gewartet. Der Flaneurs ist ein weltvergessener Urbanist. Wahrnehmungstechnisch geht er von den Phänomenen aus und arbeitet knapp unter deren Oberfläche. „In ähnlicher Weise geht der Geometer vor, wenn er ein Volumen mittels einer Ebene durchschneidet, um bestimmte versteckte Eigentümlichkeiten offenzulegen.“ (Corboz 2001, S.58) Und da die Stadt übervoll an phänomenalen Geschichten ist, die im und durch den Raum zum Vorschein kommen, braucht der Flaneur nichts anderes zu tun, als sich am phänomenologischen Handlauf leiten zu lassen. Dabei ist er ganz still. Mit den Augen überfliegt er Straßen, Plätze, Fassaden und Menschen wie Seiten von Büchern, von denen er schon irgendwie vorher 53 weiß, was auf ihnen geschrieben steht. Mit Gleichmaß blättert er eine Seite nach der anderen um. Er kann das auch zu Hause tun, mit halbgeschlossenen Augen im Sessel sitzend und rauchend, was ihm zuweilen lieber ist. Der Flaneur ist ein Geisteswissenschaftler, denn gemeinsam mit den Geisteswissenschaften obliegt ihm, die in den zeitlichen Phänomenen stehen gebliebene Zeit wieder in Gang zu bringen. „Indem sie auf jene erstarrten, ruhenden Zeugnisse blicken, von denen ich gesagt habe, sie tauchen «aus dem Strom der Zeit» auf, [...] in deren Verlauf diese Zeugnisse entstanden und zu dem wurden, was sie sind. Indem sie dergestalt statische Zeugnisse mit dynamischem Leben versehen, statt vergängliche Ereignisse auf statische Gesetze zurückzuführen, stehen die Geisteswissenschaften nicht in Konflikt mit den Naturwissenschaften, sondern ergänzen sie.“ (Panofsky, 1996, S.27) Der Flaneur ist ein Transzendetalmetaphysiker. Die Öffnung des Raums in unbekan nte Fernen, die die Renaissance und Baron Haussmann den Städten bescherten, holt er zurück in die Endlichkeit einer metaphysisch geläuterten Stadt. Hier, in der Stadt, sieht er den ganzen Kosmos versammelt, von dem er sonst nur ahnen kann. Hier unmittelbar vor ihm eröffnen sich ihm ganz neue Welten - hier durchstößt er Horizonte und gibt sich tranceartigen Anwandlungen hin, die ihn schwindeld machen. Er tut der Stadt nichts. Er legt an sie keine Hand an. Er will nur schauen, riechen, empfinden, staunen und sich berauschen. Eine Metapher Flussers lässt sich hier umkehren: Flusser meinte, der Leser ziehe aus dem Bibliotheksregal ein Buch heraus und muss es umdrehen, um es zu lesen und die Geste des Umdrehens stehe für Revolution (Flusser 1992 b, S.87f.). Da nun der Flaneur beim Flanieren von außen durch die Wand des Bibliotheksgebäudes direkt in die offene Seite des Buches schaut, braucht er das Buch nicht umzudrehen. Er ist kein Revolutionär. Ja, der Flaneur steht der Revolution feindlich gegenüber. Im Gegensatz zum Avantgardisten, der ein Moderner ist - ist er das konservative XXVI Gewissen der Stadt. Der Flaneur ist ein gebildeter, elitärer, bürgerlicher Müßiggänger, ein Schwärmer und Bohemien. Dem Müßiggang des Flaneurs erteilte Benjamin die Absolution, denn Muße (grch. «schole», lat. «otium») ist ein antikes Medium des Verstehens: die Einnahme eines nicht praktischen, kontemplativen Standpunktes im bewussten Gegensatz zur Praxis und Aktion. „Der Müßiggang des Flaneurs ist eine Demonstration gegen die Arbeitsteilung.“ (Benjamin 1983, S.538) Von der großstädtischen Betriebsamkeit ist er durchaus fasziniert, ohne sich davon jedoch vereinnahmen zu lassen. Am Strom der Massen findet er nur Vergnügen, wenn er in die Gegenrichtung geht. Er ist eher einer, der G efallen am Bizarren und Zufälligen hat, statt an der Masse und dem Massenhaften. Von der Hast distanziert er sich mit dem Habitus der Gelassenheit. Der Industriegesellschaft später ist die Muße verhasst und sie kämpft beständig darum, sie abzuschaffen (Horkheimer 1987, S.339). W a s l i e s t m a n a n d e r S t a d t ? Benjamin stellt fest, dem Einheimischen gelänge es schwieriger als dem Fremden, einen Blick von außen auf die Phänomene der eigenen Stadt zu werfen, um das Exotische und Pittoreske an ihr – also das Eigene – wahrzunehmen und nicht der Geschichte aufzuopfern, denn „immer wird das Stadtbuch des Einheimischen Verwandtschaft mit Memoiren haben“ (Benjamin, in: Opitz 1996, S.471). Das Eigene einer Stadt manifestiert sich in einer Vitalität des Rätselhaften, Plötzlichen, Vieldeutigen, Karnevalistischen, Subversiven, Destruktiven und der Unordnung. Aber selbst bei Einheimischen ruft das einsame Schlendern (das ja ein Traumwandeln ist) „mehr herauf als dessen Kindheit und Jugend, mehr als ihre eigene Geschichte“ (Benjamin, in: Opitz 1996, S.471). Das leicht gelangweilte, einsame Schlendern eröffnet einen Pfad zur Landschaft aus dem Vielen und wird zum unbekannten Labyrinth in unserer Mitte. Damit beschäftigt, Stadt zu lesen, nimmt der Flaneur Abstand von allen kausalanalytischen Erklärungsschemata, wie zum Beispiel der Geschichte der Stadtbaukunst. Dafür unternimmt er einen anderen, folgenschweren Schritt: er trennt das Dasein der Dinge von ihrem Wesen! An den Dingen interessiert ihn nur das Dasein (Heidegger würde sagen, ihr Sosein). A ndernfalls wäre er Philosoph oder Historiker geworden. So aber wurde er Romancier. Sein Wissen ist ein bloßes, narratives Wissen. Es ist unvollständig, aber doch umfassend, es ist semantisch inhomogen, aber vielfältig - es ist ein «gefühltes Wissen» toter Daten (Benjamin, in: Opitz 1996, S.489). „Die großen Reminiszenzen, die historischen Schauer – sie sind dem wahren Flaneur ja ein Bettel, den er gerne dem Reisenden überläßt. Und all sein Wissen [...] gibt er für die Witt erung einer einzigen Schwelle oder das Tastgefühl einer einzigen Fliese dahin.“ XXVI 54 in seiner weiten Bedeutung des Wortes auch als «konservierend»... (Benjamin, in: Opitz 1996, S.472) Den städtischen Raum benutzt er, um sich dieses seines Wissens zu erinnern. Um an das Wissen zu kommen, geht er weder analytisch nach den Gesetzen der Logik vor, noch historisch. Dem narrativen Wissen des Flaneurs ist eine andere Mentalität zugeordnet als die der Unterwerfung unter die strenge Wissenschaftlichkeit von Argumentation und Beweis, die Hegel in der Dreiheit von Thesis, Antithesis und Synthesis vorweg genommen hatte (Russell 1999, S.740). W i e l i e s t m a n S t a d t ? Sich einen Überblick über räumliche Zusammenhänge zu verschaffen, kann man auf zwei Arten tun. Zum einen auf eine sehr naheliegende, praktische Art: durch sie hindurchgehend, sie erwandernd. Das ist die Technik der unmittelbaren Anschauung in ihrer Einheit aus Erleben und Ausdrucksverstehen. Zum anderen ist es möglich, Raum auf eine abstrakte, vermittelte Art und Weise zu erobern: durch ein Foto, einen Plan, Grundriss oder eine Karte. Diese Methode besitzt den Vorteil, direkt neben der Form des Buches zu stehen, da sie das genaueste Einzelne zum Ganzen in Beziehung setzt (Benjamin, in: Opitz 1996, S.497). Beide Methoden sind dem Flaneur bekannt, aber beim Flanieren vertraut er eher der zweiten, selbst in der Praktizierung der er sten. Benjamin schrieb, wenn der Flaneur im Buch der Stadt lese, höre er vornehmlich. Wie von Ehrenfe ls bemerkt, ist das Hören einer Melodie der räumlichen Wahrnehmung verwandt. Vielleicht können wir uns dieses Hören heute etwa so vorstellen, wie es der holländische Schriftsteller Cees Nooteboom beschreibt (wenngleich ein wenig zu wörtlich genommen, wie ich finde): „Denn woraus besteht eine Stadt? Aus allem, was in ihr gesagt, geträumt, zerstört, geschehen ist. Aus dem Gebauten, dem Verschwundenen, dem Geträumten, das nie verwirklicht wurde. Aus dem Lebenden und dem Toten. [...] Eine Stadt, das sind alle Worte, die dort je gesprochen wurden, ein unaufhörliches, nie endendes Murmeln, Flüstern, Singen und Schreien, das durch die Jahrhunderte hier ertönte und wieder verwehte. [...] Wer will, kann es hören. Es lebt fort in Archiven, Gedichten, in Straßennamen u nd Sprichwörtern, in Wortschatz und Tonfall der Sprache [...] Die Stadt ist ein Buch, der Spaziergänger sein Leser. Er kann auf jeder beliebigen Seite beginnen, vor- und zurückgehen in Raum und Zeit. Das Buch hat vielleicht einen Beginn, aber noch lange kein Ende.“ (Nooteboom 2000, S.11f.) Das Lesen ist gebunden an das In-die-Nähe-Holen der Dinge und Zusammenhänge aus einer zeitlichen und räumlichen Ferne (Benjamin, in: Opitz 1996, S.297) – oft in anthropomorphisierten Formen. Die ästhetische Methode der Einfühlungstheorie in der Ausdrucksanalyse (Benjamin mit Dilthey) schaut das Selbst der Dinge. Sie korreliert mit der Intuition Bergsonscher Prägung, um welche Georg Simmel schließlich Diltheys Ansatz erweiterte. Stadt zu lesen wird von einer entsprechenden Intention begleitet. Damit der Ansatz des flaneurhaften Lesens gelinge, muss man sich in einen bestimmten, für das Lesen geeigneten Zustand versetzen. Man muss eine entsprechende Absicht vorhaben, aber gleichzeitig dieses Vorhaben mit Hilfe des Zufalls ignorieren. Das gelingt, wenn man sich in eine Stimmung fallen lässt. Gestimmt ist das Umherwandern des Flaneurs, das in der Stadt ein Schlendern ist. Das einsame Schlendern, Wandern, Flanieren und Träumen zeigt Wirkung, denn um das ganze, schrille Panorama des Urbanen zu sehen und zu fühlen, darf man nicht hellwach sein. Man muss schlummern. Schlummernd entgeht dem Flaneur nichts. Sein Lesen ist ein Sondern mit Maß, je nach Herzschlag, den eine Wahrnehmung bei ihm auslöst. Alles Wesentliche fügt sich von Nebensächlichkeiten umkränzt schlafwandlerisch in ein großes Gemälde, in dem der Flaneur selbst eine nur untergeordnete Rolle spielt, aber das er auf eine mit seiner Weltsicht grundierte Leinwand malt. Er produziert einen Garten, in dem die Welt zusammengetragen und verkleinert wird (de Certeau 1988, S.306). Beim Müßiggang dehnt der Flaneur den Sinnesraum auf die Dimensionen des Handlungsraums aus. Unbewusst versucht er, den Handlungsraum dem Sinnesraum einzuverleiben, denn potentiell will er den ganzen Raum lesen, alle Phänomene, die ganze Stadt – deren Rückseite. Er ist ein Ganzheitsfanatiker. Dem Flaneur verwandelte sich die ganze Stadt in einen Sinnesraum, denn er denkt: nur gelesen durchdrungener Raum erhält möglicherweise als Sinnesraum Dauerhaftigkeit. Und an Dauerhaftigkeit ist ihm ja gelegen. Wenn er unmittelbar den physischen Raum durchschlendert, liest der Flaneur die Erscheinungen und Phänomene aus seinem subjektiven Sinnesraum heraus. Er verlässt sich also überwiegend auf seine Sinne - von denen er sicher sein kann, dass sie ihn nicht täuschen, um den Fängen der gewohnten kausalanalytischen Erklärungsmuster zu entgehen. Dabei verknüpft er die Sensation des Neuen mit der Wiederkehr des Immergleichen. 55 D e r W a n d e r e r . Der Flaneur ist mit dem Wanderer verwandt. Was dem Flaneur die Stadt ist, ist dem Wanderer die Natur. Man könnte sagen, der Wanderer ist des Flaneurs ländlicher Bruder. Be sser: der Wanderer ist eine ländlich angenommene Maske des Stadtmenschen. Flaneur und Wanderer verbindet viel miteinander. Beide bleiben stehen, wo es ihnen gefällt. Dazu bedarf es manchmal nicht einmal eines äußeren Anlasses, sondern es genügt, in Gedanken versunken zu sein, denn auch „der Wanderer ist immer zur Träumerei geneigt“ (Bollnow 2000, S.112). „Zeit und Welt versi nken [ihm, d.A.] in einem Glück der reinen Gegenwart.“ (Bollnow 2000, S.116) Beide Tätigkeiten - das Flanieren wie das Wandern – sind im eigentlichen Sinne keine Taten, denn sie sind zweckfrei und deshalb unvernünftig. Ihr einziger Zweck – jeder auf seine Weise - liegt im Erreichen einer befriedeten Seelenverfassung. Obwohl ihre Bewegungstempi verschieden sind - der Flaneur führt Schildkröten aus (Benjamin 1983, S.1054), der Wanderer schreitet zuweilen kräftig aus - ignoriert das jeweilige fußläufige Tempo die eigentliche Absicht der Straße, die Bewegung tendenziell in Beschleunigung zu verwandeln. Die Fußläufigkeit fördert eine taktile Aneignung der Umgebung. Die bewusste Opposition der beiden Protagonisten gegen die Beschleunigung ist ihre Praxis der Entwirklichung. „Gehen bedeutet, den Ort zu verfehlen. Es ist der unendliche Prozeß, abwesend zu sein und nach dem Eigenen zu suchen.“ (de Certeau 1988, S.197) D a s f u ß l ä u f i g e T e m p o . Würden sie sich eines Transportmittels bedienen, hätte das den Effekt, die Straße als intentionales Medium beiseite zu räumen. Aber sie können gerade auf die Straße nicht verzichten. Straße oder Pfad sind ihnen Heimat. Ihr Missbrauch („Wozu ist die Straße da? Zum Marschieren...“, oder zumindest um die Distanz zwischen A nach B zu überwinden) eint Wanderer und Flaneur in ihrer Weltfremdheit. Wenn er schaut, schaut der Wanderer kaum auf den Wegesrand, sondern so weit das Auge reicht. Alles, was ihm außerhalb seines schmalen Pfades liegt, liegt wirklich außerhalb seiner Betrachtung und wird ihm zum Panorama in der Seele. Er genießt den Ausblick, in ihm versinkend. Er ist ein Romantiker, denn das Panorama genießt er sinnlich. Bei einer höheren, technisch erzeugten Geschwindigkeit hingegen würde die Umweltbeziehung (das Sehen und das Lesen) weit mehr über den Intellekt als über die Sinne gesteuert ablaufen. Demzufolge würde sich das landschaftliche Panorama auf vorbeiziehende Bilder reduzieren. Aus dem urbanen Schwelgen des Flaneurs würde das Überfliegen eines monotonen Textes. Trotzdem sie Gemeinsames verbindet, ist der Flaneur durch und durch ein Kunstprodukt – ein (ein)gebildeter Snob und Dandy. Er ist dekadent und elitär. Sein Geschmack ist der feinsinnige Geschmack höherer Bürgerschichten. Von Notwendigkeiten des Lebens distanziert und ökonomisch unabhängig ist er frei. Hatte man auch die bürgerliche Abstammung familiär in die Wiege gelegt bekommen, ein Flaneur musste man absichtsvoll werden. Wanderer dagegen konnte man einfach sein. Der Wanderer ist ein Volksvertreter. Er greift auf einfache, alltägliche Techniken der Wahrnehmung zurück. Der Flaneur dagegen verfügt über einen „breiten Fächer auf hohen Schulen erworbener Rezeptionscodes“ (Dörner, Vogt 1990, S.142). Das mag auch erklären, warum die Figur des Flaneurs im 19.Jahrhundert ein e episodenhafte Erscheinung Weniger geblieben ist. Seine Dekadenz hat ihn vor der Vermassung durch die Arbeitsgesellschaft des 20.Jahrhunderts bewahrt. Außerdem vertritt er nicht das disziplinierte Industriebürgertum, sondern die großbürgerliche Elite, die in der Massengesellschaft (zum Glück) keine Chance hat, ihre aristokratischen Schrullen zur Kulturdominanz auszubauen. Das Wandern hingegen hat sich um 1900 zu einer wahren Volksbewegung ausgebreitet. Um 1900 entstand zum Beispiel in Berlin der «Wandervogel» – eine Jugendorganisation zur Selbsterziehung und Selbstgestaltung, die von Berlin auf das ganze Reich ausstrahlte, in dem sich überall, bis nach Ö sterreich hin, Wandervereine gründeten. Mit der Zeit ist das Wandern dann vom Ausziehen eines Taugenichts in die Welt (vgl. Eichendorff 1915) zu einer aktiven Freizeitgestaltung des Städters und schließlich zu einem Sport geworden. Der Wanderer flieht der Stadt. Er will sich aus ihrer Enge befreien. Auch der Flaneur tut das, aber umgekehrt: indem er völlig in sie eingeht und sich in ihr auflöst. Das „Glück des Aufbruchs“ und die „Befriedigung der Rückkehr“ (Bollnow 2000, S.117) in einem zwischenzeitlich durch das Wandern erneuerten Zustand sind dem Flaneur fremd. Aus der Ferne (dem Abstand) dagegen kommt dem Wanderer die Hoffnung auf Selbsterneuerung (Bollnow 2000, S.94f.). Weder der Wanderer noch der Flaneur hat Eile. Beide ziehen ziellose Pfade, obwohl der Wanderer – anders als der Flaneur – irgendwo ankommen will, und zwar letztendlich bei sich selbst. Das Wandern dreht sich um einen Kern, der im Menschen selber liegt. (Bollnow 2000, S.118) Der Wanderer befindet sich immer auf der Suche. Dem Flaneur dagegen ist nichts so gewiss wie er sich seiner selbst. Er bleibt sich immer selbst gleich und treu. Wenn er sich durchs Urbane bewegt, führt er innere Monologe (Wenz 1997, S.104). Nach 56 seinen Exkursionen kommt er als ganz der Alte zurück – ja, vielleicht älter, zumindest aber irgendwie reicher und gewisser. So kann er sich zufrieden in seine gepolsterte Schlafstatt legen. D e r F u ß g ä n g e r . Von den gegenwärtigen, künstlerischen Metaphern der Stadt-als-Text können wir lernen. In seiner Untersuchung über den modernen Leseakt arbeitet Roland Barthes das Ep isodenhafte am Konsum eines Textzusammenhangs heraus. Barthes zufolge basiere das Lesen sprunghaft auf dem Lustprinzip, das den Leser uninteressante Textstellen überfliegen und immer auf Höhepunkte zueilen lasse. Er gibt sich einer Lust am Spiel hin - contra die melancholische Schwere tiefer Bedeutungen. Der Rhythmus, der entsteht zwischen dem, was man liest und dem, was man überspringt, begründet Barthes zufolge die «Lust am Text» (vgl. Bartes 1974). Text-Lesen habe etwas Erotisches - es sei eine Wollust, die aus dem Text selbst hervorquillt und weder etwas mit dem Inhalt, noch mit dessen Struktur zu tun hat, sondern in erster Linie mit dem Verlangen nach Genuss und Vergnügen (Barthes 1978, S.18). Dieses Lesen ist die Art des Fußgängers. Das Zu-Fuß-Gehen ist verbunden mit einer sequenziellen Raumwahrnehmung. Ist das Flanieren eine Art Schreiben sieht de Certeau das Gehen in der Stadt der sprachlichen Form eng verwandt (de Certeau 1988, S.197). Und in der Tat: während das Flanieren mit dem Lesen harmoniert, ist das Zu-Fuß-Gehen eher ein Sprechen. Es ist dem Visuellen und dem Textkonsum verwandt, wie ihn Roland Barthes darstellt. „Ich genieße an einer Erzählung also nicht direkt ihren Inhalt, nicht einmal ihre Struktur, sondern vielmehr die Kratzer, die ich auf dem schönen Umschlag hinterlasse: ich überfliege, ich überspring e, ich sehe von der Lektüre auf, ich versenke mich wieder in sie. Das hat nichts zu tun mit dem tiefen Riß, den der Text der Wollust in der Sprache selbst hervorruft und nicht in der bloßen Zeitlichkeit der Le ktüre.“ (Barthes 1974, S.19) Trotz gleichbleibender Bewegungsgeschwindigkeit eröffnet sich dem Fußgänger das Bild der Stadt „in Serien von Sprüngen und plötzlichen Ausblicken“ (Cullen 1991, S.9), während der Flaneur harmonisiert. Die Wahrnehmung des Fußgängers resultiert als Abfolge von Ausblicken. Er belässt die Rezeption in ihrer nicht nivellierten Inhomogenität, die nicht in der Struktur der Sprache begründet ist, sondern zweifach entsteht: im Moment und durch den Konsum (Barthes 1978, S.18). In den zwei Komponenten des seriellen Sehens - dem beständigen Bilde (dem Hintergrund) und dem auftauchenden Ausblick (das Ereignis) - verbirgt sich das, was wir in der Beziehung von Szene und Schauspieler im Theater wiederfinden. Das Verhältnis von Figur und Grund ist ein dramatisches. Dieses archetypische Wahrnehmungsverhältnis verwandelt Bilder in Emotionen (Cullen 1991, S.9). Worin es sie nicht verwandelt, ist das ruhige, gefühlte Wissen des Flaneurs. Die Emotionen verbinden sich mit dem räumlichen Empfinden des Menschen. Der Körper setzt sich ständig in Beziehung zur Umwelt. Grundsätzlich empfindet man sich beispielsweise entweder «innen» (hier, dies), «außen» (dort, das) oder als «ein Teil von etwas». Empfindungen wie Enge und Weite, Helligkeit und Dunkel sind objektive miteinander verwobene Konstanten, welche die Stimmungsdramatik unterstützen, von der aus Raum zu manipulieren beginnt (Cullen 1991, S.9). Die serielle, sprunghafte, von Brüchen gekennzeichnete und auf Ereignisse erpichte Wahrnehmung des Fußgängers ist im Vergleich mit dem Gemäldeverfertigen des Flaneurs und der Panoramaschau des Wanderers ganz verschiedenen. Der persönliche Charakter des Fußgängers ist unsicherer und empfänglicher für das Spektakuläre. Auf seinem Weg ist er gereizter und wacher als ein Flaneur. Er scheint das Spektakuläre geradezu einzufordern. Konstituiert sich der Flaneur als Konsument von Ereignissen, ist der Fußgänger gewissermaßen deren Produkt (oder Opfer). Kriecht der eine unter die mehr oder minder graue Oberfläche der Phänomene (denn nur auf der Rückseite sind sie bunt), lenkt der andere seinen Weg nach den interessanten Oberfläche des Geschehnissen. In adäquaten Bahnen bewegt sich das Verstehen. Was man die Ewigkeit des Buches oder der Literatur des Flaneurs nennen könnte, ist beim Fußgänger inhomogener, sprunghafter, fragmentarischer Text. Die Fragmente wollen und können sich nicht mehr so einfach zum Bild eines Ganzen (zu einer Gestalt, wie ehedem der Geist eines literarischen Werkes) fügen. Dem Fußgänger scheint die Stadt Sprechblasen vorzusetzen wie semiotische Handlungsanweisungen. Sachverhalte wahrzunehmen heißt für ihn, das Spiel oder den Dialog der Dinge zu verstehen, denn dann „fängt der ganze Bau an, dir die Hand zu schütteln“ (Cullen 1991, S.14). Die Sicht auf den Raum bleibt stark ästhetisch auf seine emotiona le Wirkung ausgerichtet. Das Comic- oder Computerbild ist eine treffendere Metapher für die Wahrnehmung des Fußgängers als die antiquiert scheinende, weise Form des Lesens. Während seinerzeit der Flaneur ein wandelnder Müßiggänger war, befindet sich der Fußgänger in steter Eile. Ihm ist die Zeitersparnis wichtiger als der Raum, den er zu überwinden sucht. Beim schnellen Gehen hat der Fußgänger einen erhöhten Wirklichkeitseindruck (ohnehin Techniken der 57 Entwirklichung ledig), denn er erlebt die Welt als Widerstand – einen räumlich-zeitlichen Widerstand, der ihm zu überwinden aufgetragen ist, um endlich anzukommen. Deshalb nimmt er normalerweise ohnehin das Auto. Der Strukturalismus der 1960er Jahre schon hatte klargemacht: in sofern die Menschen nicht mehr der Welt gegenüberstehen, sondern als Teil in derselben aufgehen (Bollnow 2000, S.304), wird ihr Verhältnis zum Raum durch die Intention der Überwindung bestimmt. Die räumliche Indeterminiertheit der meisten heutigen Stadträume verbindet sich paradigmatisch mit dem eigentlich ohnehin Überflüssigsein des Menschen im Raum. Sie befördert maßgeblich das Gefühl von Entwurzeltsein und Heimatlosigkeit (Bollnow 2000, S.275). Der Fußgänger schwebt in einem Nicht-Ort. In der haptischen Distanzierung vom Ort entdeckt er ein künstlerisches Mittel möglicher Entwirklichung. Seinerzeit kostete der Flaneur ein anderes Mittel der Entwirklichung aus: das der Entzeitlichung. Beide halten sich auf ihre Weise aus den undurchschaubaren Verflechtungen des täglichen Tuns heraus – der Flaneur mehr, der Fußgänger weniger - und werden diesem in einem gewissen Maß fremd. Im Sonntagsspaziergang hat das zu-FußGehen einen schwachen Abglanz des Flanierens aufgehoben und dem Lesen von Stadt im 21.Jahrhundert eine Chance eingeräumt. Resümee H a l t e n w i r z u m A b s c h l u s s f e s t : Die Lebensphilosophie am Ausgang des 19.Jahrhunderts hat wichtige Schritte unternommen, die idealistische Trennung von Materie und Geist unter die allgemeine Bewegung des Lebens zu subsummieren – eine Tendenz, die über die Praxis der Moderne in der zweiten Hälfte des 20.Jahrhunderts allgemein (und nicht zuletzt im Umgang mit der Stadt) vernachlässigt worden ist. Ich denke, dieser Mangel hat in der nachindustriellen Gesellschaft Aussicht, sich in eine Herausforderung umzuformulieren. Die Hermeneutik besitzt in einem positiven Verständnis die Merkmale einer geeigneten, nachmodernen Wissensphilosophie. Das Lesen verspricht die Aussicht auf die Möglichkeit der Wiederbelebung einer schonenden Kulturtheorie, die uns unseren ontologischen Lebens- und Erlebensraum Stadt ganzheitlich und trotz seiner faktisch zunehmenden Fragmentierung geschlossener begreifen lässt. Durchaus können theoretisch alle Einzelteile, die Stadt ausmachen, vereinigt und durchdrungen miteinander in Beziehung gedacht werden. Berechtigte Skepsis darf uns hinsichtlich der Frage begleiten, ob es genügt, die gegenwärtige Realität als Ausgangspunkt lediglich ganzheitlich zu lesen und zu denken, um sie daraufhin möglicherweise auch ganzheitlich gestalten zu können. Aber wenn hier die Metapher der «Lesbarkeit der Stadt» überhaupt behauptet wurde, bedeutet den Versuch einer Kohärenz, das Disparate und Auseinanderliegende als Einheit zu begreifen. Um zu begreifen, spielen Sinnverstehen und Wesenserkenntnis auch des nur mühsam Verständlichen eine wichtige Rolle. Sinnverstehen und Wesenserkenntnis sind an der Wirklichkeitserfahrung geschulte Werdeprozesse (Frings, in: Scheler 1977, S.XVI). Die Authentizität der Deutung von städtischen Erscheinungen muss sich dabei in der Wirklichkeitserfahrung selbst halten. Dafür trägt der Interpret die Verantwortung. Sicherlich bannt ein Lesen, obwohl es ein Schonen nach Heideggers Art ist, etwas „in seinem Wesen [zu, d.A.] hüten“ (Heidegger 1954, S.151), nicht die Gefahr der Idolisierung und Remystifizierung - das heißt, einer Anpassung der kommunizierten Interpretation an ein Funktionieren innerhalb des bestehenden Kulturapparates. Die willentliche Orientierung am antiken, metaphysischen Ganzheitsideal, auf welches das nachindustrielle Lesen abzielt, stößt zudem an gesellschaftliche Grenzen. Aber innerhalb der Grenzen und Gefahren der Theorie liegt gleichzeitig der Schlüssel, die Verzerrung einer Anschmiegung der Stadtinterpretation an allgemeine gesellschaftliche Vorstellungen zu vermeiden. Aus einer aus dem kulturellen Hintergrund gewonnenen, an der Stadt selbstüberprüften Haltung heraus besteht die Chance, gestalterisch und planerisch ganzheitlich und verantwortlich zu operieren. In diesem Rahmen besitzt die Anwendung pragmatischer Methoden der Erkenntnis ihre Berechtigung. Da sie dazu tendieren, die Erkenntnis von etwas von diesem Etwas abzulösen, kommt der Pragmatik Operationalität zu. Sie muss aber in die Hermeneutik eingebettet sein – so, als wäre die Hermeneutik das Gewissen der Pragmatik. Beide Philosophien verbinden sich so zu einem angewandten Praxismodell: das Lesen - die Hermeneutik - als kultureller Hintergrund eines sozialverantwortlichen Verstehens der Stadt und das Schreiben – als ein pragmatisches, dank der Hermeneutik ganzheitsbewusstes, planerisches Handeln. Zusammen mit der gegenwärtig diskutierten, dynamischen Metapher der «Stadt als Text» oder der «Stadt als Erzählung» bieten sich dem Planer als gewollte Leser Ansätze zur Überwindung 58 funktionalistischer Methodologisierungen und auch zur konzeptionellen Lösung der Legitimationskrise der Hermeneutik (Bogdal 1990, S.23). Wenn existierende städtische Texturen nach der Manier des Flaneurs lesend verstanden und neue (wie alte) schreibend konzipiert würden, eröffnete sich die Chance für eine freie Erzählung. „Dabei spielt die Erzählung eine entscheidende Rolle. Gewiß, sie beschreibt nur, aber jede Beschreibung ist mehr als eine Festschreibung, sie ist ein kulturell schöpferischer Akt. [... Sie hat, d.A.] eine performative Kraft [...]. Somit schafft sie Räume. Umgekehrt gilt, dort, wo die Erzählungen verschwinden, (oder zu musealen Gegenständen verkommen), gibt es einen Raumverlust: wird eine Gruppe oder ein Individuum seiner Erzählung beraubt, [...] kommt es zu einem Rückfall in die beunruhigende und schicksalhafte Erfahrung einer unförmigen, ungeschiedenen und finsteren Totalität.“ (de Certeau 1988, S.228) Konsultierte Literatur Alexander, Christopher; Sara Ishikawa, Murray Silverstein: «Eine Mustersprache. Städte Gebäude Konstruktion», (Orig.: 1977), Löcker Verlag, Wien, 1995 Assunto, Rosario: «Die Theorie des Schönen im Mittelalter», Reihe: Klassiker der Kunstgeschichte, DuMont, Köln, 1997 Augé, Marc: «Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit», (Orig.: 1992), S.Fischer Verlag, Frankfurt/ M., 1994 Bartes, Roland: «Die Lust am Text», (Orig. 1973), Bibliothek Suhrkamp 378, Suhrkamp Verlag Frankfurt/ M., 1974 «Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften», Bd.I/1: «Abhandlungen» sowie Bd.I/3, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1990 Benjamin, Walter: «Das Passagen-Werk»«, edition suhrkamp 1200, Neue Folge Band 200, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1983 Benjamin, Walter: «Denkbilder», suhrkamp taschenbuch 2315, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1974 Benjamin, Walter: «Städtebilder. Fotografiert von Anna Blau», Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1992 Berndt, Heide: «Die Natur der Stadt», Verlag Neue Kritik, Frankfurt, 1978 Benevolo, Leonardo: «Die Geschichte der Stadt», (Orig.: 1975), Campus Verlag, Frankfurt/ Ne w York, 2000 Benevolo, Leonardo: «Die Stadt in der europäischen Geschichte», (Orig.1993), Reihe: Europa Bauen, Verlag C.H.Beck, München, 1993 Bloomer, Kent C.; Charles W. Moore: «Architektur für den „Einprägsamen Ort“. Überlegungen zu Körper, Erinnerung und Bauen», (Orig.: 1977), Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart, 1980 Blumenberg, Hans: «Die Lesbarkeit der Welt», suhrkamp taschenbuch wissenschaft 592, (1.Aufl: 1986), 4.Aufl., Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M., 1999 Bogdal, Klaus-Michael (Hrsg.): «Neue Literaturtheorien. Eine Einführung», Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990 Bogdanović, Bogdan: «Die Stadt und der Tod. Essays», Wieser Verlag, Klagenfurt- Salzburg, 1993 Bollerey, Franziska: «The gentle Way of Reading and the Montage of the Masses», in: Arie Graafland (editor): «Cities in Transition», 010 Publishers, Rotterdam, 2001 Bollnow, Otto Friedrich: «Mensch und Raum», (1.Aufl.: 1963), 9.Aufl., Kohlhammer, Stuttgart Berlin Köln, 2000 Bollnow, Otto Friedrich: «Zur Frage nach der Objektivität der Geisteswissenschaften» (1937), Aufsatz abgedruckt in: Lessing, Hans-Ulrich (Hrsg.): «Philosophische Hermeneutik. Texte», Alber-Texte Philosophie, Bd.7, 1.Aufl., Verlag Karl Alber, Freiburg (Breisgau) München, 1999 Bonta, Juan Pablo: «Über die Interpretation von Architektur. Vom Auf und Ab der Formen und die Rolle der Kritik», (Orig.: 1979), Archibook, Berlin, 1982 Boudon, Philippe: «Der architektonische Raum. Über das Verhältnis von Bauen und Erkennen», (Orig.: 1971), Birkhäuser Verlag, Basel Berlin Boston, 1991 59 Burckhardt, Jacob: «Die Kultur der Renaissance in Italien. Ein Versuch», (1.Aufl.: 1927) Kröners Taschenbuchausgabe, Alfred Kröner Verlag, Stuttgart, 1947 Butor, Michel: «Die Stadt als Text», Literaturverlag Droschl, Graz, 1992 Calvino, Italo: «Die unsichtbaren Städte», (Orig.: 1972), Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 2000 Chadwick, Owen: «Die Geschichte des Christentums», (Orig.: 1995), Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1996 Chtouris, S., Elisabeth Heidenreich, Detlef Ipsen: «Von der Wildnis zum urbanen Raum», Campus Verlag, Frankfurt/ M., 1993 Corboz, André: «Die Kunst, Stadt und Land zum Sprechen zu bringen», Bauwelt-Fundamente 123, Birkhäuser, Basel- Boston- Berlin, 2001 Cullen, Gordon: «Townscape. Das Vokabular der Stadt», (Orig.: 1961), Birkhäuser, Basel- Berlin- Boston, 1991 de Certeau, Michel: «Kunst des Handelns», (Orig.: 1980), Merve Verlag, Berlin, 1988 Deleuze, Gilles: «Logik des Sinns. Aestetica», (Orig.: 1969), edition suhrkamp 1707, 1.Aufl., Frankfurt/ M., 1993 Derrida, Jaques: «Grammatologie», (Orig.: 1967), Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1996 Dilthey, Wilhelm: «Die Entstehung der Hermeneutik» (1900), Aufsatz abgedruckt in: Lessing, Hans -Ulrich (Hrsg.): «Philosophische Hermeneutik. Texte», Alber-Texte Philosophie, Bd.7, 1.Aufl., Verlag Karl Alber, Freiburg (Breisgau) München, 1999 Dilthey, Wilhelm: «Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften» (1910), Auszug abgedruckt in: ebenda Dörner, Andreas; Ludgera Vogt: «Kultursoziologie (Bourdieu – Mentalitätsgeschichte – Zivilisationsgeschichte)», in: Bogdal, Klaus-Michael Hrsg.): «Neue Literaturtheorien. Eine Einführung», Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990 Durkheim, Emile: «Über die soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften », (Orig.: 1930), 2.Aufl., Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1988 Düttmann, Martina: «Wie die Architektur zur Sprache kommt. Aufsätze 1972-1992», Birkhäuser Verlag, BaselBerlin- Boston, 1992 Eco, Umberto: «Die Grenzen der Interpretation», (Orig.: 1990), Carl Hanser Verlag, München- Wien, 1992 von Ehrenfels, Christian: «Über Gestaltqualitäten», (1890), in: Weinhandl, Ferdinand (Hrsg.): «Gestalthaftes Sehen. Ergebnisse und Aufgaben der Morphologie. Zum hundertjährigen Geburtstag von Christian von Ehrenfels», (1.Aufl.: 1960), 4. Aufl., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darm stadt, 1978 von Ehrenfels, Christian: «Weiterführende Bemerkungen», Auszug aus: «Das Primzahlengesetz» (1922), in: ebenda von Eichendorff, Josef: „Aus dem Leben eines Taugenichts“, Frauen-Verlag, Jena, 1915 Elias, Norbert: «Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen», suhrkamp taschenbuch wissenschaft 158, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1997 Endell, August: «Die Schönheit der großen Stadt», Archibook Verlag, Berlin, 1984 Engell, Lorenz: «Sinn und Industrie. Einführung in die Filmgeschichte», Edition Pandora, Bd.7, Campus Verlag, Frankfurt- New York, 1995 Fahle, Oliver; Lorenz Engell (Hrsg.): «Der Film bei Deleuze», Verlag der Bauhaus-Universität Weimar, Weimar, 1997 Flusser, Vilém: «Dinge und Undinge. Phänomenologische Skizzen», Carl Hanser Verlag, München Wien, 1993 a Flusser, Vilém: «Ende der Geschichte, Ende der Stadt?», (Vortrag im Wiener Rathaus am 13.März 1991), Picus Verlag, Wien, 1992 a Flusser, Vilém: «Nachgeschichte. Eine korrigierte Geschichtsschreibung», (1.Aufl.: 1990), Bollmann Verlag, Bensheim/ Düsseldorf, 1993 b Flusser, Vilém: «Die Schrift. Hat Schreiben Zukunft?», Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/ M., 1992 b Foucault, Michele: «Die Ordnung des Diskurses. Mit einem Essay von Ralf Kon serman», (Inauguralvorlesung am Collège de France, 2.12.1970), Erweiterte Ausgabe, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/ M., 1991 60 Fumagalli, Vito: «Wenn der Himmel sich verdunkelt. Lebensgefühl im Mittelalter», (Orig.: 1987), Wagenbach 332, Berlin, 1999 Garin, Eugenio: «Die Kultur der Renaissance», in: «Propyläen Weltgeschichte, Bd.6», Propyläen Verlag, Berlin, 1961 Gadamer, Hans-Georg: «Das Erbe Europas. Beiträge», Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1989 Gadamer, Hans-Georg: «Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik» (1960), dieses Kapitel abgedruckt in: Lessing, Hans-Ulrich (Hrsg.): «Philosophische Hermeneutik. Texte», Alber-Texte Philosophie, Bd.7, 1.Aufl., Verlag Karl Alber, Freiburg (Breisgau) München, 1999 Goethe, Johann Wolfgang: «Faust. Der Tragödie Erster Teil», Königs-Lektüren, Bd.3003, C.Bange Verlag, Hollfeld, 1996 Goethe, Johann Wolfgang: «Schriften zur Naturwissenschaft. Von 1796-1815. Zur Morphologie», Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar, 1986 Halbwachs, Maurice: «Das kollektive Gedächtnis», Fischer Taschenbuch, 1967 Heidegger, Martin: «Sein und Zeit», Erste Hälfte, (1.Aufl.: 1926), 4.Aufl., Max Niemeyer Verlag, Halle a.d.S., 1935 Heidegger, Martin: «Vorträge und Aufsätze», Verlag Günther Neske, Pfullingen, 1954 Hall, Peter; Ulrich Pfeiffer: «Urban 21. Der Expertenbericht zur Zukunft der Städte», Deutsche Verlags -Anstalt, Stuttgart- München, 2000 Honold, Alexander: «Der Leser Walter Benjamin. Bruchstücke einer deutschen Literaturgeschichte », Verlag Vorwerk 8, Berlin, 2000 Hörisch, Jochen: «Die Wut des Verstehens», (1.Aufl.: 1988), edition suhrkamp 1485, Neue Folge 485, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1998 Jung, Werner: «Neue Hermeneutikkonzepte», in: Bogdal, Klaus-Michael (Hrsg.): «Neue Literaturtheorien. Eine Einführung», Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990 Kammler, Clemens: «Historische Diskurananlyse (Michel Foucault)», in: Bogdal, Klaus-Michael (Hrsg.): «Neue Literaturtheorien. Eine Einführung», Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990 Lefébvre, Henri: «Writings on cities», (1st edition: 1996), Blackwell Publishers Ltd., Oxford, 1997 Lefébvre, Henri: «Die Revolution der Städte», (Orig.: 1970), Verlag Anton Hain Meisenheim, Frankfurt/ M., 1990 Lessing, Hans-Ulrich (Hrsg.): «Philosophische Hermeneutik. Texte», Alber-Texte Philosophie, Bd.7, 1.Aufl., Verlag Karl Alber, Freiburg (Breisgau) München, 1999 Lynch, Kevin: «Das Bild der Stadt», (Orig.: 1960), Bauwelt Fundamente 16, Friedr.Viehweg & Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig Wiesbaden, 1989 Lyotard, J.F. : «Das postmoderne Wissen», (Orig.: 1982), 4., unveränderte Neuauflage, herausgegeben von Peter Engelmann, Passagen-Verlag, Wien, 1999 Manguel, Alberto: «Eine Geschichte des Lesens», (Orig.: 1996), Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbeck bei Hamburg, Oktober 1999 Marquardt, Odo: «Abschied vom Prinzipiellen», Reclam Universal-Bibliothek, Stuttgart, 1995 Mersch, Dieter (Hrsg.): «Zeichen über Zeichen. Texte zur Semiotik von Charles Sanders Peirce bis zu Umberto Eco und Jacques Derrida», Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1998 Mitscherlich, Alexander: «Die Unwirtlichkeit unserer Städte. Anstiftung zum Unfrieden», (1.Aufl.: 1965), einmalige Sonderausgaben, Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1996 Müller, Jürgen E.: «Literaturwissenschaftliche Rezeptions- und Handlungstheorien», in: Bogdal, Klaus-Michael (Hrsg.): «Neue Literaturtheorien. Eine Einführung», Westdeutscher Verlag, Opladen, 1990 Nooteboom, Cees: «Die Dame mit dem Einhorn. Europäische Reisen», (Orig.: 1997), Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 2000 Norberg-Schulz, Christian: «Genius loci. Landschaft Lebensraum Baukunst», (Orig.: 1979), Klett -Cotta, Stuttgart, 1982 Opitz, Michael (Hrsg.): «Walter Benjamin. Ein Lesebuch», edition suhrkamp 1838, Neue Folge Bd.838 (1.Aufl.), Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1996 61 «Panofsky, Erwin», Reihe: Klassiker der Kunstgeschichte, DuMont, Köln, (1978-) 1996 Panofsky, Erwin: «Aufsätze zu Grundfragen der Kunstwissenschaften», Wissenschaftsverlag Volker Spiess, Berlin, 1974 Pevsner, Nicolaus: «Europäische Architektur», (Orig.: 1943), 7.Aufl. der Studien-Ausgabe, Prestel-Verlag, München, 1989 Quadroni, Ludovico: «Una cittá eterna. Quattro lezioni da ventisette secoli», estratto dal n.27 di «Urbanistica», Torino, 1958 Ricœur, Paul: «Der Text als Modell: hermeneutisches Verstehen» (1971), abgedruckt in: Lessing, Hans-Ulrich (Hrsg.): «Philosophische Hermeneutik. Texte», Alber-Texte Philosophie, Bd.7, 1.Aufl., Verlag Karl Alber, Freiburg (Breisgau) München, 1999 Rizzi, Renato; Giovanni Salvatore De Bindis: «Miseria e riscatto. La città europea nello sguardo del pensiero», Arsenale Editrice, Venezia, 1999 Roth, Jürgen, Rayk Wieland (Hrsg.): «Öde Orte. Ausgesuchte Stadtkritiken von Aachen bis Zwickau», Reclam Verlag, Leipzig, 1998 Rowohlt Kursbuch «Die Zukunft der Moderne», Heft 122,A 20281 F, Rowohlt Berlin Verlag, Berlin, 1995 Russell, Bertrand: «Philosophie des Abendlandes. Ihr Zusammenhang mit der politischen und sozialen Entwicklung», (Orig.: 1945), 8.Aufl., Europa Verlag AG, Zürich, 1999 Salzmann, Dieter: «Der räumliche Aspekt im architektonischen Entwurf. Ein Beitrag zur Theorie und Praxis der Architekturgestaltung», HAB Dissertation 7, Verlag der HAB, Weimar, 1985 Sauerland, Karol: «Einführung in die Ästhetik Adornos», De Gruyter Studienbuch, Berlin- New York, 1979 Scheler, Max: «Die Stellung des Menschen im Kosmos», (1.Aufl.: 1928), 13. Aufl., Bouvier, Bonn, 1995 Scheler, Max: «Erkenntnis und Arbeit. Eine Studie über Wert und Grenzen des pragmatischen Motivs in der Erkenntnis der Welt», (1.Aufl.: 1960), Verlag Vittorio Klostermann, Frankfurt/ M., 1977 Schlögel, Karl: «Moskau lesen. Die Stadt als Buch», Siedler Verlag, Berlin, 2000 Schreiter, Jörg: «Hermeneutik – Wahrheit und Verstehen», Reihe: Studien spätbürgerliche Ideologie. Darstellung und Texte, Akademie-Verlag, Berlin, 1988 Schürmann-Emanuely, Alexander: «Der http://contextxxi.mediaweb.at/texte/archiv/c21990112.html verdammte Baumeister», Sennett, Richard: «Fleisch und Stein. Der Körper und die Stadt in der westlichen Zivilisation», (Orig.: 1994), Berlin Verlag, Berlin, 1995 Sieverts, Thomas: «Zwischenstadt. Zwischen Ort und Welt, Raum und Zeit, Stadt und Land», Bauwelt Fundamente 118, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, Braunschweig- Wiesbaden, 1997 «Simmel, Georg: Gesamtausgabe 7, Aufsätze und Abhandlungen 1901-1908», Aufsatz: «Die Großstadt und das Geistesleben», Suhrkamp Verlag, Frankfurt/ M., 1995 Simmel, Georg: «Grundfragen der Soziologie: Individuum und Gesellschaft», Sammlung Göschen 101, Verlag Walter de Gruyter & Co., Berlin- New York, 1984 Störig, Hans-Joachim: «Kleine Weltgeschichte der Philosophie», Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/ M., 1999 Vitruv: «Baukunst. 1.Band, Bücher I-V», (1.Aufl.: 1987), Birkhäuser Verlag, Basel- Boston- Berlin, 1995 Wästberg, Per: «The Landscape under the Stone», in: Nyström, Louise (Hrsg.): «City and Culture. Cultural Process and Urban Sustainability», The Swedish Urban Environment Council, Lenanders Tryckeri AB, Kalmar, 1999 Weinhandl, Ferdinand (Hrsg.): «Gestalthaftes Sehen. Ergebnisse und Aufgaben der Morphologie. Zum hundertjährigen Geburtstag von Christian von Ehrenfels», 4. Aufl., Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1978 Wenz, Karin: «Raum, Raumsprache und Sprachräume. Zur Textsemiotik der Raumbeschreibung», Gunter Narr Verlag, Tübingen, 1997 Wetz, Franz Josef: «Hans Blumenberg. Zur Einführung», Junius Verlag, Hamburg, 1993 Wittkower, Rudolf: «Grundlagen der Architektur im Zeitalter des Humanismus», Verlag C.H.Beck, München, 1969 62 Wright, Frank Lloyd: «Schriften und Bauten», Gebrüder Mann Verlag, Berlin, 1997 63