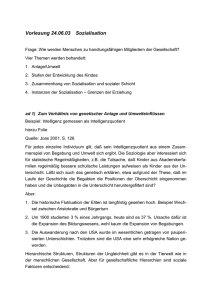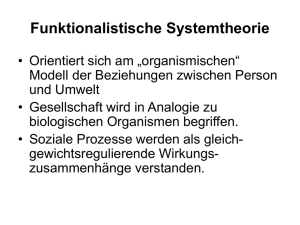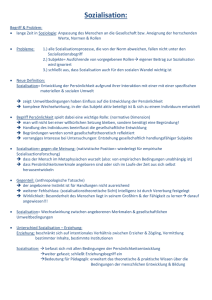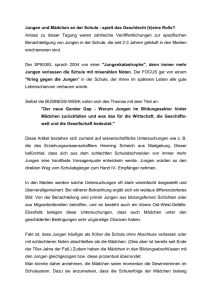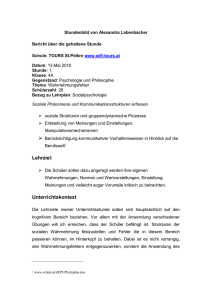Theorien beruflicher Sozialisation
Werbung
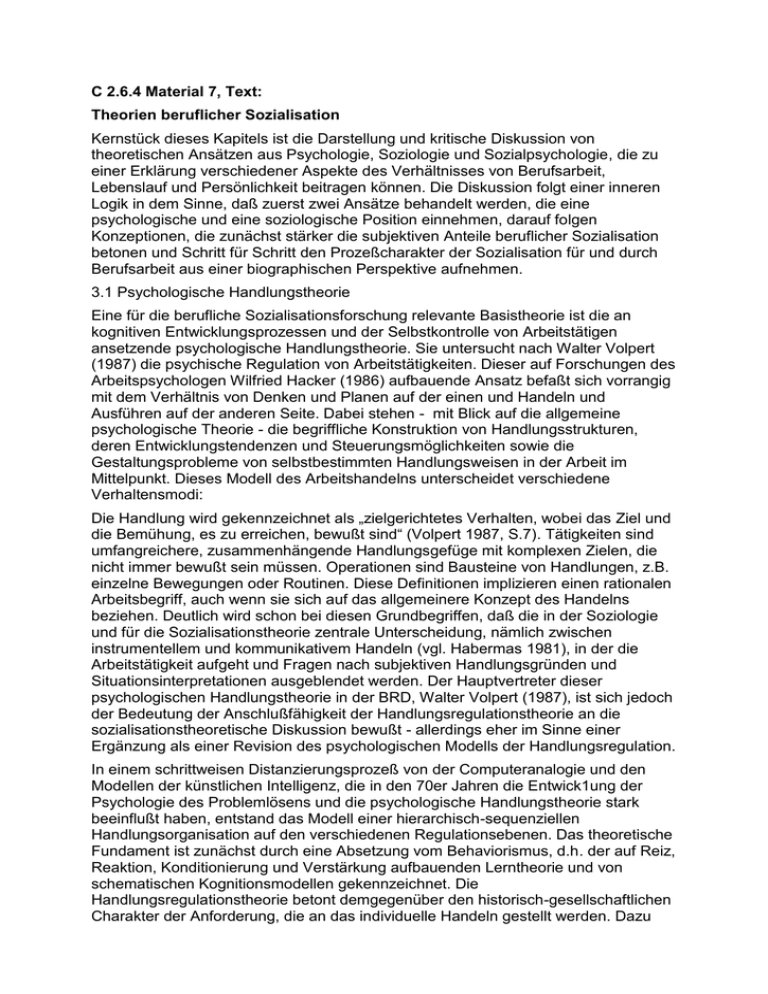
C 2.6.4 Material 7, Text: Theorien beruflicher Sozialisation Kernstück dieses Kapitels ist die Darstellung und kritische Diskussion von theoretischen Ansätzen aus Psychologie, Soziologie und Sozialpsychologie, die zu einer Erklärung verschiedener Aspekte des Verhältnisses von Berufsarbeit, Lebenslauf und Persönlichkeit beitragen können. Die Diskussion folgt einer inneren Logik in dem Sinne, daß zuerst zwei Ansätze behandelt werden, die eine psychologische und eine soziologische Position einnehmen, darauf folgen Konzeptionen, die zunächst stärker die subjektiven Anteile beruflicher Sozialisation betonen und Schritt für Schritt den Prozeßcharakter der Sozialisation für und durch Berufsarbeit aus einer biographischen Perspektive aufnehmen. 3.1 Psychologische Handlungstheorie Eine für die berufliche Sozialisationsforschung relevante Basistheorie ist die an kognitiven Entwicklungsprozessen und der Selbstkontrolle von Arbeitstätigen ansetzende psychologische Handlungstheorie. Sie untersucht nach Walter Volpert (1987) die psychische Regulation von Arbeitstätigkeiten. Dieser auf Forschungen des Arbeitspsychologen Wilfried Hacker (1986) aufbauende Ansatz befaßt sich vorrangig mit dem Verhältnis von Denken und Planen auf der einen und Handeln und Ausführen auf der anderen Seite. Dabei stehen - mit Blick auf die allgemeine psychologische Theorie - die begriffliche Konstruktion von Handlungsstrukturen, deren Entwicklungstendenzen und Steuerungsmöglichkeiten sowie die Gestaltungsprobleme von selbstbestimmten Handlungsweisen in der Arbeit im Mittelpunkt. Dieses Modell des Arbeitshandelns unterscheidet verschiedene Verhaltensmodi: Die Handlung wird gekennzeichnet als „zielgerichtetes Verhalten, wobei das Ziel und die Bemühung, es zu erreichen, bewußt sind“ (Volpert 1987, S.7). Tätigkeiten sind umfangreichere, zusammenhängende Handlungsgefüge mit komplexen Zielen, die nicht immer bewußt sein müssen. Operationen sind Bausteine von Handlungen, z.B. einzelne Bewegungen oder Routinen. Diese Definitionen implizieren einen rationalen Arbeitsbegriff, auch wenn sie sich auf das allgemeinere Konzept des Handelns beziehen. Deutlich wird schon bei diesen Grundbegriffen, daß die in der Soziologie und für die Sozialisationstheorie zentrale Unterscheidung, nämlich zwischen instrumentellem und kommunikativem Handeln (vgl. Habermas 1981), in der die Arbeitstätigkeit aufgeht und Fragen nach subjektiven Handlungsgründen und Situationsinterpretationen ausgeblendet werden. Der Hauptvertreter dieser psychologischen Handlungstheorie in der BRD, Walter Volpert (1987), ist sich jedoch der Bedeutung der Anschlußfähigkeit der Handlungsregulationstheorie an die sozialisationstheoretische Diskussion bewußt - allerdings eher im Sinne einer Ergänzung als einer Revision des psychologischen Modells der Handlungsregulation. In einem schrittweisen Distanzierungsprozeß von der Computeranalogie und den Modellen der künstlichen Intelligenz, die in den 70er Jahren die Entwick1ung der Psychologie des Problemlösens und die psychologische Handlungstheorie stark beeinflußt haben, entstand das Modell einer hierarchisch-sequenziellen Handlungsorganisation auf den verschiedenen Regulationsebenen. Das theoretische Fundament ist zunächst durch eine Absetzung vom Behaviorismus, d.h. der auf Reiz, Reaktion, Konditionierung und Verstärkung aufbauenden Lerntheorie und von schematischen Kognitionsmodellen gekennzeichnet. Die Handlungsregulationstheorie betont demgegenüber den historisch-gesellschaftlichen Charakter der Anforderung, die an das individuelle Handeln gestellt werden. Dazu kommt, daß die aktive Rolle der Person betont wird, die den Anforderungen entsprechende innere Handlungsstrukturen entwickelt und prinzipiell auf die Bedingungen und Inhalte des Arbeitsprozesses zurückwirken, sie also auch verändern kann. Somit sind es die Arbeitsaufgaben am Schnittpunkt zwischen Organisation und Person, die für die psychologische Handlungsanalyse besonders relevant sind. Für die Arbeitsgestaltung im Sinne der Erweiterung von Handlungsspielräumen sind die Qualifizierungsprozesse und die Komplexität der Tätigkeit von größter Bedeutung. Hacker (1980, S.54) macht den gesellschaftlichen Hintergrund dieser Perspektive deutlich: „Die sozialökonomisch bedingte Struktur der bewußt projektierten oder zugelassenen Arbeitsaufgaben beeinflußt wesentlich die psychischen Eigenschaften der Werktätigen“. Dieser zehn Jahre vor dem politischen und ökonomischen Niedergang des real existierenden Sozialismus in der DDR formulierte Satz verweist darauf, daß die gesellschaftlich organisierten Arbeitsverhältnisse die persönlichen Bildungsprozesse aufs Tiefste beeinflussen. Diese für die berufliche Sozialisationsforschung zentrale These läßt bei nüchterner Betrachtung der Defizite in der betrieblichen und technisch-organisatorischen Gestaltung der Arbeitsprozesse in der ehemaligen DDR nur den Schluß zu, daß die Werktätigen erhebliche psychische Einschränkungen vor allem im Bereich der Handlungsspielräume zu bewältigen hatten. Die psychosozialen Folgen der real-sozialistischen Arbeitsbedingungen können aus sozialisationstheoretischer Sicht nicht von einem zum anderen Tag aufgeklärt werden. Sie erfordern vielmehr den Aufbau neuer Handlungsziele und Regulationsansprüche bei den Erwerbstätigen. Dieses wird jedoch durch die hohe Arbeitslosigkeit nach der Vereinigung mit dem politischen und ökonomischen System der westdeutschen Marktwirtschaft erschwert (vgl. Buttler/Klauder 1993). Doch zurück zum Modell der Handlungsregulationstheorie. Handlungen bestehen in diesem Konzept aus Obereinheiten und Basiseinheiten, die durch Rückkopplungsschleifen auf verschiedenen Regulationsebenen verbunden sind, Qualität und Abfolge von Handlungen festlegen. Der Planungsprozeß wird durch gedankliches Probehandeln ergänzt und dadurch kann der Verlauf der eigentlichen Handlung von der Person durchgespielt und Abläufe sowie Resultate von Handlungen können mehr oder weniger genau antizipiert werden. Wenn beispielsweise das Risiko hoch ist, daß sich Handlungsfehler bis zum Scheitern des vorgenommenen Ziels addieren, dann kann dieses Risiko durch eine exakt geplante Strategie vorweggenommen werden. Im Modell des umfassenden Arbeitshandelns wird hervorgehoben, daß Arbeitstätigkeiten nicht nur aus einzelnen Verrichtungen zusammengesetzt sind, sondern auch Denken und Planen dazu gehören. Dabei werden verschiedene Ebenen, von der Ausführung einzelner Handlungen, über die Bestimmung von Teilzielen, bis zur Einrichtung eines neuen Produktionsablaufs unterschieden. Die Ableitungen der Handlungsregulationstheorie gehen vom Idealkonzept einer „vollständigen Handlung“ aus. Dazu gehört nach Hacker (1980, S.389), daß - komplexe Ziele in einen umfassenden Sinnzusammenhang höherer Zielsetzungen eingeordnet und selbständig gesetzt werden können; - die Entscheidung für adäquate Mittel der Zielerreichung eigenständig getroffen werden kann; - die Handlungsvorbereitung auf umfassenden Kenntnissen beruht und auch zu neuartigen Lösungen führen kann; - die Reichweite der Antizipation der Handlungssituation angemessen ist. Dieses Konzept kann auch als Basiskatalog für die Einrichtung persönlichkeitsförderlicher Arbeitsprozesse gelesen werden. Entsprechend argumentiert Volpert (1987, S.19): „Die jeweils vorgegebene Arbeitsaufgabe bestimmt das Ausmaß, in welchem sich der individuelle Handlungsvollzug dem Idealbild einer vollständigen Handlung annähern kann oder nicht. Die Arbeitsaufgabe …eröffnet oder verschließt damit auch Regulationschancen“. Arbeitsgestaltung bedeutet dann in diesem Modell, daß die kognitiven Regulationsanfordernisse der Aufgabe erhöht und der Handlungsspielraum der Person erweitert werden muß. Hiervon läßt sich auch eine Kritik an Arbeitsaufgaben ableiten, die restriktiv und partialisiert sind, also einen geringen Handlungsspiel und wenig Komplexität aufweisen, denn solche Arbeitsbedingungen können die Persönlichkeit schädigen. Die tragenden Begriffe der psychologischen Handlungstheorie für eine kritische Arbeitsanalyse, wie sie z.B. im Verfahren zur Ermittlung von Regulationserfordernissen in der Arbeitstätigkeit (,‚VERA“, Volpert u.a. 1983) eingesetzt werden, sind der Handlungsspielraum, der aus Tätigkeitsspielraum und Entscheidungs- bzw. Dispositionsspielraum besteht und die intellektuelle Komplexität der Aufgabenstellung. Diese zwei Dimensionen ergeben im Hinblick auf die Arbeitsanalyse und Gestaltung von Arbeitsaufgaben quasi Richtwerte, die zwischen dem Ziel der Autonomie und dem Faktum der Fremdbestimmung liegen. In diesem Zusammenhang sind auch Ergebnisse der US-amerikanischen Forschung über Sozialisation durch Arbeit relevant, die über positive Auswirkungen des Handlungsspielraums auf das Wohlbefinden, die intellektuelle Flexibilität und das politische Engagement von Beschäftigten berichten (vgl. Kohn und Schooler 1981, 1983). Allerdings ist im Rahmen der beruflichen Sozialisation neben Handlungsspielraum und Komplexität der Aufgabe noch eine dritte Dimension von Bedeutung, nämlich die der Kommunikations- und Interaktionschancen. Auf diesem dreidimensionalen Feld lassen sich dann Berufe mit unterschiedlichen Mischungsverhältnissen persönlichkeitsförderlicher Aspekte einordnen oder die in einem Betrieb vorhandenen Arbeitsplätze entsprechend einstufen (vgl. Volmerg 1978). Im Unterschied zu den subjektorientierten und sozialpsychologischen Ansätzen sind bei der handlungstheoretischen Arbeitsanalyse die Arbeitspsychologen die Experten, die eine empirische Einstufung und Bewertung der Arbeitsverhältnisse vornehmen. Dunkelfelder in der kognitiv ausgerichteten Handlungsregulationstheorie sind daher das Motivationsproblem und das soziale Handeln. Die Ziele im Arbeitsprozeß müssen sich weder analytisch noch empirisch mit den Motiven der Arbeitstätigen decken, die sich aus übergeordneten, außerbetrieblichen bzw. auf den Lebenslauf bezogenen Wertvorstellungen ergeben können. Volpert stellt als übergreifendes Motiv der Dynamik individueller Handlungssysteme das „Kontrollstreben“ heraus, das als gemeinsamer Nenner dem menschlichen Handeln in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen zugrundeliegen soll. Dies ist eine im Vergleich zur Konzeption der Sozialpsychologie der Arbeit, wie sie z.B. von Marie Jahoda (1983) vertreten und auch in der psychoanalytischen Variante (Leithäuser und Volmerg 1988) weiterentwickelt wurde, eingeengte Bestimmung, die den gesellschaftlichen und individuellen Dimensionen von Arbeitsmotiven nicht voll gerecht werden kann. Dies gilt insbesondere angesichts zunehmender Ansprüche an sinnvolle Arbeitsgestaltung und einem Spektrum verschiedener Arbeitsmotive, die beispielsweise junge Arbeitnehmer (vgl. Baethge u.a. 1988) und Frauen mit der Erwerbstätigkeit verbinden. Was die Einbeziehung des sozialen Handelns angeht, so ist die Ebene zwischenmenschlicher Beziehungen, der Kommunikationsprozesse und normierten Interaktionen bislang in der Handlungsregulationstheorie nicht angemessen berücksichtigt. Aufgrund ihrer klar strukturierten Konzepte und Operationalisierungsschritte für die planvolle Organisation von Arbeitshandeln greifen aktuelle Trainingsprogramme im Rahmen der beruflichen Qualifizierung auf die psychologische Handlungstheorie zurück (vgl. Kapitel 5.4). 3.2 Der berufliche Habitus In Anlehnung an den französischen Bildungs- und Kultursoziologen Pierre Bourdieu (vgl. z.B. 1974) hat Windolf (1981) das Konzept des „beruflichen Habitus“ in die berufliche Sozialisationsanalyse eingebracht. Bourdieu versteht unter „Habitus“ ein System internalisierter Handlungsmuster einer Kultur oder sozialen Klasse. Ein Habitus resultiert aus der Verknüpfung der Sozialisationsprozesse in Familie, Schule, Hochschule und Erwerbstätigkeit, die allesamt zur gesellschaftlichen Reproduktion sozialer Unterschiede beitragen. Der berufliche Habitus ist ein stabiles System verinnerlichter Handlungsregeln, die nicht nur der Anpassung an die Arbeitsanforderungen, sondern auch der Selbstinterpretation und der Deutung gesellschaftlicher Verhältnisse dienen. Es sind insbesondere die sozialen Anforderungen beim Erlernen und Ausüben eines Berufs, wie z.B. Umgangsformen und Sprachstil, die Personen mit einem gleichen Habitus, also mit gemeinsamen Denk- und Beurteilungsmustern sowie Handlungsschemata hervorbringen. Der berufliche Habitus ist ein idealtypisches Konstrukt, ein Bezugsrahmen für die Analyse des Vergesellschaftungsaspekts von Sozialisationsprozessen. Er konkretisiert sich durch die Beteiligung am Arbeitsprozeß, durch den die Erwerbstätigen in den jeweiligen kulturellen Code der Arbeitsorganisation eingefügt werden: Nachdem die betrieblichen Selektionshürden überwunden sind, geschieht dies durch Initiationsprozesse und Statuspassagen. Dabei geht es darum, die impliziten Spielregeln oder den „geheimen Lehrplan“ der Arbeitsorganisation zu entschlüsseln. Der Betrieb oder die Behörde rekrutieren Mitglieder, die soziale und kulturelle Grundqualifikationen mitbringen, und unterziehen sie einer Einweisungsphase (z.B. als Trainee, Referendar/in, Volontär/in, Assistent/ in), um das für den jeweiligen beruflichen Habitus konstitutive „Betriebswissen“ zu vermitteln. Auch wenn der Betrieb keine expliziten Lernprozesse neben Berufsausbildung und Weiterbildung organisiert, so bildet sich der berufliche Habitus nach mehr oder weniger langen beruflichen Orientierungsphasen heraus, die vor allem für die akademischen Berufe und Professionen von Bedeutung sind (vgl. Kap. 6.3.4). Die Habituskonzeption steht in der Tradition der Erforschung des Zusammenhangs zwischen Klassenlage und Sozialcharakter, von Arbeiterbewußtsein und Bildungsbürgertum. Die unterschiedlichen sozialen Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsmuster geben dem Arbeitshandeln der Individuen einen berufsspezifischen und damit vergesellschafteten Charakter. An diese Fragestellung anschließend hat Klaus Ottomeyer (1991) einen Begriffsrahmen zum Zusammenhang von Identitätsbildung und (kapitalistischen) gesellschaftlichen Verhältnissen skizziert. Er unterscheidet die Verhaltensanforderungen in der Zirkulationssphäre (Warentausch), in der Produktionssphäre (Arbeitstätigkeit) und in der Konsumptionssphäre (private Reproduktion). Jede dieser gesellschaftlichen Sphären verlangt von den Personen, in eine andere „Charaktermaske oder Rolle“ zu schlüpfen, d.h. einen anderen Habitus anzunehmen. In der Zirkulationssphäre sei die Identität durch den Konkurrenzkampf und damit durch zwischenmenschliche Gleichgültigkeit bestimmt. Für die Optimierung der Leistung - Lohn -Relation sei es notwendig, als rationaler Marktteilnehmer zu denken und zu handeln. Jedoch sei es für eine erfolgreiche Markttransaktion ratsam, sich in konkreten Interaktionen auf die Interessen des anderen einzustellen, um die Realisierungschancen der eigenen Erwartungen zu optimieren. Dieser Widerspruch müsse in der Identität durch Syntheseleistungen aufgefangen werden: „Soll Sozialisation in Richtung auf ein Individuum gelingen, das sich ökonomisch selbständig … zu reproduzieren vermag, so müssen im ontogenetischen (d.h. persönlichen) Sozialisationsprozeß … die Fähigkeiten zur sozialen Instrumentalisierung, zu mißtrauischer Antizipation, Härte, Konkurrenzverhalten usw. vermittelt und angeeignet werden (Ottomeyer 1991, S.l74). Dieses nach der Entfremdungstheorie von Karl Marx modellierte Menschenbild erinnert eher an den „Menschenfeind“ von Moliére als an die in einer Marktgesellschaft flexibel agierenden, den gesellschaftlichen Verhältnissen mit einer Mischung aus Distanz und Vertrauen begegnenden Erwerbstätigen. In der Produktionssphäre, also im Betrieb, wird Arbeitsleistung gegen Lohn getauscht und dies unter fremdbestimmten Arbeitsbedingungen. Dies hat gemäß der Entfremdungstheorie von Marx zur Folge, daß die Erwerbstätigen im Interesse ihrer Identitätserhaltung gegenüber ihrer Arbeit, ihren Kollegen und ihrem Arbeitsprodukt sich gleichgültig verhalten müssen. Sie entwickeln ein instrumentelles Verhältnis zu sich und zu ihrer Arbeitsrolle: „Die Fähigkeit zu einer isolierten und zähen Selbstinstrumentalisierung unter der Dominanz von reproduktiven und Lohninteressen ist ein zentrales Erfordernis der Identitätsentwicklung von Lohnarbeitern.“ (Ottomeyer 1991. S. 175). Wie aber z.B. Gudrun Knapp (1981) gezeigt hat, wird die instrumentelle Haltung gegenüber Lohnarbeit im Arbeiterbewußtsein durch die Bedeutung der Arbeitstätigkeit für die gesellschaftliche Identität und die soziale Anerkennung von Arbeitsleistung und Berufsrolle relativiert. Belastende und monotone Arbeit mit geringem Handlungsspielraum produziert wohl Gleichgültigkeit, überdeckt aber nicht notwendig das Interesse an sinnvoller Arbeit und Kollegialität. Für die Konsumptionssphäre schließlich sieht Ottomeyer den Aufbau stabiler Privatbeziehungen vor, die zur psychosozialen Reproduktion des Arbeitnehmers in der Freizeit beitragen. In diesem Bereich stehe die Suche nach dem privaten Ich im Zentrum und die möglichst effektive Verdrängung von zwischenmenschlichen Konflikten. Hier reproduziere sich auch die geschlechtsspezifische Sozialisation: Hausarbeit und die vom Familienernährer abgeleitete soziale Position werden als spezifische Identitätsformen im weiblichen Lebenszusammenhang benannt. Auch hier überzeichnet dieses Habitusmodell die strukturelle Trennung der gesellschaftlichen Sphären auf der Bewußtseins- und Handlungsebene. Wie z.B. die Studie von Baethge u.a. (1988) belegt, vertreten junge Erwachsene Lebenskonzepte, die sich an sinnvollen Arbeitstätigkeiten, der Verbindung von Arbeit und Familie, bzw. von Arbeit und Freizeit orientieren. Junge Frauen verfolgen einen Kompromiß zwischen Berufsarbeit und Familie, wie dies in einer Doppelstrategie bei ihrer Lebenslaufplanung zum Ausdruck kommt (Geissler/Oechsle 1994). Die Schwächen der Habitustheorie liegen in der Betonung der sozialstrukturellen Determinanten beruflicher Sozialisationsprozesse. Diese Überbetonung der Vergesellschaftung geht zu Lasten der individuellen Interessen und der aktiven Auseinandersetzung mit den Arbeitsverhältnissen. 3.3 Berufsrolle und soziale Identität Die soziologische Rollentheorie betrachtet Berufstätigkeit aus der Sicht der gesellschaftlichen Normen und konkreten betrieblichen Handlungserwartungen. Berufsrollen verweisen über ihren innerbetrieblichen Anwendungsbereich hinaus auf gesellschaftliche Leistungsstandards und Wertvorstellungen, die sich auch im unterschiedlichen gesellschaftlichen Ansehen der verschiedenen Berufe niederschlagen. Gegenwärtig besteht trotz konkurrierender Forschungsrichtungen ein Minimalkonsens darin, die soziale Rolle als „Bündel normativer Verhaltenserwartungen, die sich an das Verhalten von Positionsinhabern richten“ (Joas 1991, 5.146) zu bezeichnen. Begrifflich ausgearbeitet wurde die Rollentheorie in der funktionalistischen Soziologie von Talcott Parsons. Nach seinem Konzept verläuft Sozialisation über die Verinnerlichung von Handlungsnormen und Rollenerwartungen, die das vergesellschaftete Individuum zum „Rollenakteur“ macht. Parsons (vgl. 1979) greift bei seinen Überlegungen auf die Kulturanthropologie und die Psychoanalyse zurück, um die Sozialisation des Kindes und des Jugendlichen im Einflußbereich von Familie und Schule als schrittweise Verklammerung von Bedürfnissen und Motiven mit den dominanten Wertvorstellungen und institutionellen Normen verständlich zu machen. Dabei hat er die psychoanalytische Vorstellung der Über-Ich-Bildung als internalisierte (verinnerlichte) Gewissensinstanz mit dem Ansatz der sozialen Positions- und Rollenstrukturen verbunden. In Parsons Konzeption sind das soziale System und das Persönlichkeitssystem nicht über das Individuum verknüpft, sondern durch die soziale Rolle oder einen Komplex von Rollen. Diese Sichtweise von Sozialisation betont eine für die Person und die Institution - die Erwerbstätigen und den Betrieb - gleichermaßen nützliche Handlungskonvergenz bei der Aneignung oder Ausführung der Arbeitnehmerrolle. Damit wird vor allem der Aspekt der Handlungskoordination thematisiert; die ungleichen Rechte und Pflichten, die individuelle Interpretation von Rollenerwartungen und die Austragung von Rollenkonflikten treten dabei im Interesse der Systemintegration in den Hintergrund. An der Theorie Parsons ist erheblich Kritik geübt worden: In der Grundtendenz ist sie auf Konsens mit den herrschenden Verhältnissen, also auf konformes Handeln ausgerichtet. Auch die durch Klassen- und Schichtungsstrukturen fixierten Privilegien und Wohlstandsdifferenzen sind in dem als allgemeine Sozialisationstheorie konzipierten Ansatz des Rollenakteurs irrelevant. Dennoch spiegelt Parsons Rollentheorie die gesellschaftliche Tatsache, daß Arbeitsnormen in der Betriebsorganisation institutionalisiert sind und die Erwerbstätigen sich am gemeinsamen Bezugspunkt der arbeitsorganisatorischen und beruflichen Normen orientieren, um zu koordiniertem Arbeitshandeln beizutragen. Damit werden aber zugleich die hierarchischen Sozialbeziehungen im Unternehmen stabilisiert: „Rollen haben Orientierungs- und Motivationsfunktion für den einzelnen Handelnden sowie Integrationsfunktion für das soziale System“ (Joas 1991, S.141). Überträgt man das Rollenkonzept von Parsons auf die Analyse beruflicher Sozialisation, so zeigen sich vor allem Unschärfen bei der Analyse von Macht und Herrschaft, die im Betriebsgeschehen als Rollenkonflikte auftreten können. Welche Voraussetzungen bringen Erwerbstätige dafür mit, mit widersprüchlichen Rollen fertig zu werden, z.B. als Industrie- meister und Arbeitsgruppenmitglied, als Sachbearbeiterin und Mutter? Und wie gehen sie mit Diskrepanzen in einer Rolle um, die in Arbeitssituationen auftreten können: unter Zeitdruck noch genau zu arbeiten, als Ingenieur eine Arbeitsgruppe zu koordinieren und gleichzeitig die Interessen der Betriebsleitung zu vertreten? Die individuelle Verarbeitung von Rollenkonflikten, die in der Struktur der Lohnarbeit angelegt sind, ist für die berufliche Sozialisationsforschung ein wichtiges Thema. Hier geht es nämlich auch um die Förderung und Blockierung der Entwicklung und Anwendung von Handlungskompetenzen, die für Berufsidentität und Berufsbiographie entscheidende Voraussetzungen sind. Die vom soziologischen Funktionalismus für lange Zeit verdrängte sozialpsychologische Tradition des symbolischen Interaktionismus besitzt für eine verstehende Analyse beruflicher Sozialisationsprozesse - gerade unter sich wandelnden Arbeitsverhältnissen - erheblich mehr Relevanz als die konventionellen Rollenmodelle sozialen Handelns. Diese ursprünglich von George H. Mead (1934; 1968) formulierte Konzeption hebt die kommunikative Basis von menschlichen Lern-, Entwicklungs- und Interaktionsprozessen in den Vordergrund der Sozialisationsforschung. Menschen organisieren ihr eigenes und antizipieren das Handeln anderer Personen durch das ihnen kulturell gemeinsame Medium signifikanter Symbole, d.h. der sprachlichen und nonverbalen Informationen, als Grundstock für zwischenmenschliche Verständigung im Alltag und in Arbeitsprozessen. Aus diesem Ansatz speist sich die interaktionstheoretische Sozialisationsforschung, die vom Zentralbegriff der „Rollenübernahme“ oder „Perspektivenübernahme“ ausgeht. Dieses Konzept bezieht sich auf die Antizipation oder Vorwegnahme der Handlungen der anderen Akteure in spezifischen sozialen Situationen. Die psychosoziale Entwicklung entfaltet sich als ein Bildungsprozeß von Selbstvorstellungen, die aus der subjektiven Reflexion der Bewertungen und der Kontakte mit Bezugspersonen in Familie, Schule, Freundesgruppe oder Betrieb entstehen. Diese Bezugspersonen repräsentieren gesellschaftliche Funktionszusammenhänge, wie sie in Familien, sozialen Milieus, Schulen, Universitäten. Ausbildungswerkstätten, Betrieben oder Verwaltungen sozial organisiert sind. So wird das Individuum im Sozialisationsprozeß allmählich mit den verschiedenen Institutionen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung verwoben und eignet sich Schritt für Schritt die jeweils gültigen Spielregeln und Mitgliedschaftsentwürfe für die Selbstpräsentation und die Kooperation an. Aus den in seiner Biographie relevanten Interaktionen mit sozialen Referenzpersonen und Bezugsgruppen leitet das Individuum die Facetten seines Selbstbildes her, die es jedoch von Handlungssituation zu Handlungssituation und von Lebensabschnitt zu Lebensabschnitt mit seinen Bedürfnissen, Erfahrungen und sozialen Verpflichtungen in Einklang bringen muß. Wie ist nun eine Brücke zwischen dem normativen Positions- Rollenmodell von Parsons und dem interpretativen Situations-Rollenmodell von Mead zu schlagen? Einen nützlichen Vorschlag macht Hans Joas (1991, S.141), der nach einer Darstellung und kritischen Analyse der Entwicklung der Rollentheorie die soziale Rolle definiert als „die normative Erwartung eines situationsspezifisch sinnvollen Verhaltens“. Dieser Brückenschlag bedeutet für die Theorie beruflicher Sozialisation, daß der subjektive Sinn von Arbeitshandlungen sowohl aus den unmittelbaren Aufgaben und Interaktionsbeziehungen und deren Bewertung durch die Erwerbstätigen, als auch aus den Handlungsanforderungen im Herrschaftssystem des Betriebs rekonstruiert werden muß. Dieses Vorhaben in die Empirie umzusetzen, ist ebenso kompliziert wie der vorstehende Satz klingt. Es erfordert, Sozial- bzw. Organisationsstruktur, betriebliche Handlungsmuster und individuelle Lebensgeschichte, akzentuiert auf die Ausbildungs- und Berufsbildungsbiographie, aufeinander zu beziehen. In den folgenden Kapiteln werden wir den Stand der Forschung hierzu kennenlernen und dabei den Stellenwert der theoretischen Kontroversen besser beurteilen können. Die Rollen- und soziale Identitätstheorie wurde vor allem für die Analyse der Sozialisation von Erwachsenen z.B. bei der Eingliederung in Arbeitsorganisationen und der Übernahme berufsspezifischer Handlungsstile herangezogen. So hat Brim (in Brim/Wheeler 1974) in Rückgriff auf die gerade skizzierten rollentheoretischen und identitätstheoretischen Annahmen die Persönlichkeitsentwicklung als eine erfolgreiche Abfolge von Prozessen des Rollenlernens thematisiert, die durch Veränderungen im Sozialgefüge und im Lebenszyklus notwendig werden. Der Zweck von Sozialisation liegt nach diesem Ansatz in der Förderung von Motivation, Fähigkeiten und Kenntnissen, die für die Ausübung von Berufsrollen nützlich sein können. Dies bedeutet, daß die Erwachsenensozialisation sich von Kindheit und Jugend weniger in Form als durch Inhalte unterscheidet. Für sie ist die Erweiterung von Verhaltensstrategien charakteristisch, die auf basalen Wertorientierungen aufbauen; die Synthese von Kenntnissen wird auf spezifische betriebliche und private Rollenerwartungen ausgerichtet. In diesem Erklärungsansatz ist das Resultat der beruflichen Sozialisation ein „psychischer Kontrakt“, ein modus vivendi zwischen Individuum und Arbeitsorganisation. Eine Differenzierung der eher sozialtechnischen Anpassungskonzepte der konventionellen Rollentheorie wird in den Analysen zur „Organisationssozialisation“ (van Maanen 1976; Schein 1988) vorgenommen, die aus Interaktionen zwischen persönlichen Erwartungen und institutionellen Vorgaben und Anforderungen besteht. Bewerber versuchen, die Kriterien und Kultur des Unternehmens zu antizipieren und präsentieren sich mit einem entsprechend zugeschnittenen Lebenslauf. Dies entspricht den Strategien der Personalauswahl, bei der kommunikative Kompetenz und Innovationsbereitschaft sowie die bisherige Ausbildungs- und Berufsbiographie gegenüber rein fachlichen Kenntnissen eine immer wichtigere Rolle spielen (vgl. Windolf/Holin 1984). Berufliche Sozialisation bedeutet im symbolischen Interaktionismus eine Balance zwischen den eigenen Interessen und den beruflichen bzw. betrieblichen Erwartungen herzustellen, nämlich in Gestalt einer unverwechselbaren „Ich-Identität“. Diese ermöglicht trotz Korrekturen und Wendepunkten im Berufsverlauf biographische Kontinuität und eine realistische Selbstbewertung. Neben der Betonung des aktiven Parts, den das Individuum bei der Interpretation und Aktualisierung von Rollen spielen muß, haben sich aus der Sozialpsychologie von Erving Goffman (z.B. 1973, vgl. auch Hettlage/Lenz 1991) grundlegende Differenzierungen ergeben. Goffman betont die Fähigkeit der Person zur „Rollendistanz“, zur Darstellung einer Diskrepanz zwischen dem Selbstkonzept und der zu spielenden Rolle (sozusagen „Dienst unter Vorbehalt“). Rollendistanz ist notwendig, um nicht der Mechanik der internalisierten Handlungsnormen bewußtlos zu folgen, sondern die Ich-Identität ins Spiel zu bringen. Für vielfältige alltägliche Interaktionssituationen gilt daher, daß die Beteiligten ihre sozialen Beziehungen nicht nach den Rollenschablonen aufbauen, sondern durch „Rollengestaltung“ den vorhandenen Interpretations- und Handlungsspielraum zur Realisierung von Interessen und wechselseitigen Ansprüchen ausnutzen. Diese Gestaltung von Rollen ist für kooperative Arbeitstätigkeiten von Bedeutung, die Koordination und Absprachen über die nächsten Handlungsschritte erforderlich machen. Dies tritt in restriktiven Arbeitssituationen und hochritualisierten Bürokratien selten auf, ist aber bei Innovationen im Betrieb, etwa bei der Einrichtung von Arbeitsgruppen, Qualitätszirkeln und computergestützten Fertigungsprozessen, vor allem aber bei Übergängen und Brüchen in der Berufsbiogrphie von großer Bedeutung. Während das normative Positions-Rollenmodell die Internalisierung von Werten und Normen als Kern der Sozialisation betrachtet, wird in der Tradition des symbolischen Interaktionismus die Identitätsbildung als Resultat der Auseinandersetzung mit Handlungsanforderungen und als flexible Synthese von Rollenerwartungen in den Mittelpunkt gerückt. Diese Konzeption trägt zu einer Analyse der beruflichen Sozialisation als Teil einer lebenslangen Persönlichkeitsentwicklung deswegen zentrale Einsichten bei, weil die berufliche Identität in ihren psychosozialen Prozessdimensionen beleuchtet wird, ohne dabei die Sozialstruktur und die Akteursperspektive auszublenden. 3.4 Subjektorientierte Berufstheorien Hier sind eine entwicklungspsychologische und eine berufssoziologische Richtung zu unterscheiden. Berufsbezogene Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung im Kontext gesellschaftlicher Arbeitsteilung und kognitiver sowie sozialer Tätigkeitsanforderungen thematisiert die interaktionstheoretische Konzeption von Hoff und Lempert (vgl. Hoff 1985). Diese Position entstand aus der Kritik affirmativer rollentheoretischer Untersuchungen zur beruflichen Sozialisation, die individuelle Handlungskompetenzen und gesellschaftlich -herrschaftliche Bedingungen von Berufsarbeit aus ihrem Hypothesensystem fernhalten. Arbeitsrelevante Persönlichkeitsmerkmale werden bei Hoff als Bindeglieder zwischen Berufstätigkeit und Lernen betrachtet, nämlich Qualifikationen (technische Fertigkeiten und Fähigkeiten) und Orientierungen (soziale Normen und Wertvorstellungen). Diese Grunddimensionen beruflicher Sozialisation können sowohl auf Merkmale der Arbeitssituation als auch auf die Strukturierung der Persönlichkeit bezogen werden. Berufliches Lernen wird als Interaktionsprozess zwischen Arbeits- und Persönlichkeitsstrukturen konzeptualisiert, der zur Entwicklung und Veränderung von Handlungskompetenzen der Individuen beiträgt. Dieser kategoriale Bezugsrahmen zur Analyse beruflicher Sozialisation in emanzipatorischer Absicht trägt deutlich entwicklungspsychologisch - kognitivistische Züge, die eine enge Beziehung zwischen der Ausübung selbständiger und anspruchsvoller Tätigkeit und dem Niveau autonomer Handlungsfähigkeit postulieren (vgl. auch Kapitel 6.4.2). Dem Zusammenhang zwischen den Chancen zur Fähigkeitsentwicklung und den hierarchisch strukturierten Berufsanforderungen wird in der subjektorientierten Theorie der gesellschaftlichen Konstitution von Berufen (vgl. Bolte / Treutner 1983) ein zentraler Stellenwert eingeräumt. Dieser berufssoziologische Ansatz kann wichtige Impulse für die Theorie beruflicher Sozialisation geben. Er beruht auf der Annahme, daß ein Beruf nicht nur aus einzelnen Arbeitsaufgaben, sondern aus einer gesellschaftlich standardisierten Zusammensetzung und Abgrenzung von Fähigkeitselementen zu festen, überindividuellen Kombinationen besteht. In berufsbezogenen Sozialisationsprozessen werden diese Fähigkeitskombinationen als Berufsbilder mit dem Arbeitsvermögen der Individuen verbunden. Der springende Punkt dieser Überlegungen ist, daß mit dem Erlernen bestimmter Fähigkeitsbündel der Zugang zu anderen Fähigkeitskombinationen abgeschnitten oder zumindest erschwert wird. Der Erwerb von Qualifikationen unterliegt somit einem Selektionsprozeß, der soziale Ungleichheit reproduziert, da z.B. handwerklich manuelle Fähigkeitskombinationen von geistig - planenden abgegrenzt werden. Diese „Schneidung von Fähigkeiten“ ist nicht allein durch die technisch ökonomische Organisation von Arbeitsvorgängen begründet, sie wurzelt vielmehr in den historisch entstandenen gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen, die zu schicht- und geschlechtsspezifischen Beteiligungschancen an allgemeinen und beruflichen Bildungsprozessen geführt haben. Dauer und Inhalte beruflicher Lernprozesse sind somit durch Strukturen sozialer Ungleichheit determiniert; diese fixieren die Fähigkeitsentwicklung durch eine sachlich nicht begründbare Begrenzung des Zugangs zu höheren Qualifikationsstufen. Von den bislang diskutierten Theorien unterscheiden sich die subjekt-orientierten Ansätze dadurch, daß die soziale und personale Bedeutung der Arbeit, die kollektive Artikulation von Interessen und das unterschiedliche gesellschaftliche Ansehen der Berufe für die individuellen Entwicklungschancen ebenso thematisiert werden wie die technisch-organisatorischen Aspekte der Arbeitstätigkeit. Die Bedeutung des Berufs für die Arbeitstätigen beruht dementsprechend auf der gesellschaftlichen Bewertung der ihnen zugänglichen Kombination von Fähigkeiten und den mit ihrer Berufsarbeit gegebenen Chancen und Grenzen für die Persönlichkeitsentwicklung. Im Arbeitsprozeß stehen die meisten Beschäftigten vor einseitigen inhaltlichen Arbeitsaufgaben, restriktiven Arbeitsbedingungen und begrenzten Möglichkeiten zur Fähigkeitserweiterung. Sie sehen sich einer Problemstruktur gegenüber, die aus einem sachlichen Aspekt (dem Arbeitsprozeß) und einem ökonomischen Aspekt (dem Verwertungsprozeß) besteht. Diese Konstellation fordert von den Individuen, gegensätzliche Zielsetzungen auszubalancieren. Die „doppelte Zweckstruktur“ der Berufsarbeit bedeutet, daß Arbeitende im Prinzip lernen müssen, nicht ihre arbeitsinhaltlichen Interessen und die Aufgabenerfüllung als Richtschnur für ihr berufliches Handeln anzusehen, sondern auch auf ihre individuellen Reproduktionsinteressen zu achten, deren Wahrung von einem pfleglichen Umgang mit dem eigenen Arbeitsvermögen bei der Gestaltung der Berufsbiographie abhängt (vgl. Brock u.a. 1989). Berufe sind als soziale Konstrukte quasi objektivierte Bündel von persönlichen Kompetenzen, die von Arbeitskräften erwartet werden; in diesem Sinne stellen sie auch Entwicklungs- und Äußerungsschablonen für Subjektivität dar. Das Kernstück der subjektorientierten Berufssoziologie ist, im Unterschied zum entwicklungspsychologischen Ansatz, aufzuzeigen, welche Entwicklungsprogramme im Sinne von Subjektivierungschancen in den Berufen enthalten sind. Dies soll explizit ohne Rückgriff auf persönlichkeitspsychologische Annahmen geschehen. Da diese Theorie nur Eckdaten für konkretes Arbeitshandeln formuliert, reicht sie aber für ein Verständnis beruflicher Sozialisation nicht aus. Sie muß daher um die Dimensionen der subjektiven Ansprüche an die Arbeit und der Identitätsveränderung im Verlauf der Berufsbiographie ergänzt werden. Dies kann durch die Annahme geschehen, daß die beruflichen Entwicklungsprogramme und die Handlungskompetenzen des Individuums im beruflichen Sozialisationsprozess eine identitätsgestaltende Verbindung eingehen. Diese Beziehung wird durch den Spielraum für Entwicklung, Anwendung und Erweiterung subjektiver Fähigkeiten und Interessen definiert und durch inner- und außerbetriebliche Interaktionsbeziehungen stabilisiert. Die Berufsarbeit determiniert also die Sozialisationsprozesse nicht, sie ist vielmehr durch die Erwerbstätigen subjektiv in bestimmten Grenzen gestaltbar. In den Berufsbiographien werden die Erfahrungen der vorberuflichen Sozialisation, der Berufsfindung, Berufsausbildung und betrieblichen Arbeitserfahrungen als subjektive Bausteine eingelagert. Die durch die soziale Herkunft, beruflichen Ausbildungsstrukturen, Arbeitsmarktverhältnisse und die betriebliche Personalpolitik bestimmte Kontinuität oder Brüchigkeit von Berufsbiographien erweist sich aus dieser Sicht als Prozeß der Persönlichkeitsstrukturierung, der mit darüber entscheidet, wie Arbeitsumstände interpretiert und in betriebliche sowie private Handlungsweisen umgesetzt werden. Diese Betrachtungsweise beruflicher Sozialisationsprozesse werde ich im letzten Abschnitt dieses Kapitels ausführlicher vorstellen. Quelle: Walter R. Heinz, Arbeit, Beruf und Lebenslauf, Eine Einführung in die berufliche Sozialisation, Weinheim und München 1995,daraus: Kapitel 3, 47 bis 60