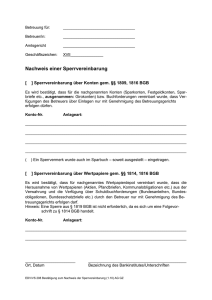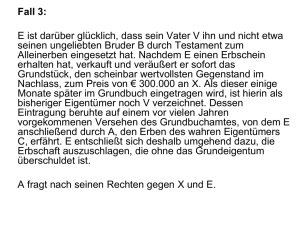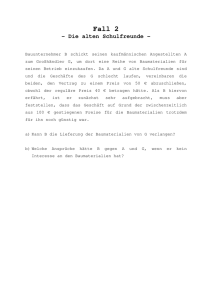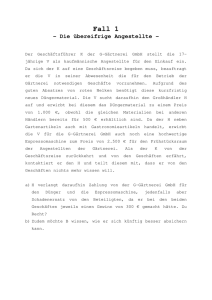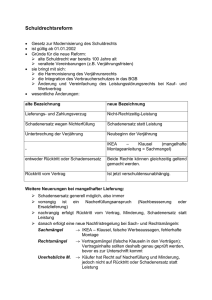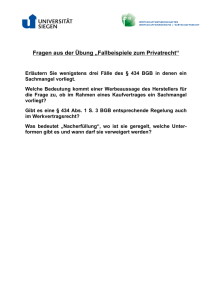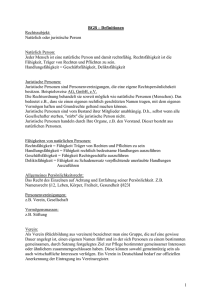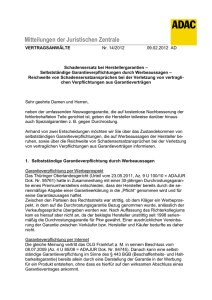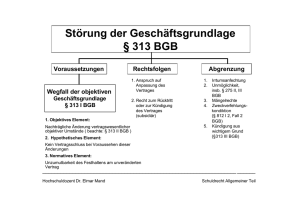Hanka Dieler
Werbung

Hanka Dieler Sommersemester 2002 Der Verbrauchsgüterkauf §§ 474 - 479 BGB, § 377 HGB Prof. Dr. Grunewald Seminar zur Schuldrechtsreform II Gliederung Gliederung.......................................................................................................................................................................I Literaturverzeichnis......................................................................................................................................................V A. Einführung..........................................................................................................................................1 I. europarechtliche Vorgaben...............................................................................................................................1 II. Vorläufer der jetzigen Reform........................................................................................................................1 III. Entstehungsgeschichte des Regierungsentwurfs........................................................................................1 B. Verbrauchsgüterkauf.........................................................................................................................2 I. § 474 BGB............................................................................................................................................................2 1. Anwendungsbereich....................................................................................................................................2 a. Verbraucher.........................................................................................................................................3 aa. § 13 BGB.......................................................................................................................................3 bb. Richtlinie 1999/44/EG..............................................................................................................3 cc. Personenmehrheiten................................................................................................................... 3 b. Unternehmer........................................................................................................................................3 aa. § 14 BGB.......................................................................................................................................3 bb. Richtlinie 1999/44/EG..............................................................................................................3 cc. Existenzaufgabe / -gründung....................................................................................................4 c. Bewegliche Sache.................................................................................................................................4 d. Verbrauchsgüter...................................................................................................................................4 2. Ausnahme der §§ 445 und 447 BGB von der Anwendung..................................................................4 a. § 445 BGB.............................................................................................................................................4 b. § 447 BGB.............................................................................................................................................4 II. §§ 475 – 477 BGB.............................................................................................................................................5 1. § 475 BGB....................................................................................................................................................5 a. § 475 I BGB...…...........................................................................................................….......….…..5 b. § 475 II BGB.........................................................................................................................................6 c. § 475 III BGB........................................................................................................................................7 2. § 476 BGB....................................................................................................................................................7 a. Regelungsgehalt.....................................................................................................................................7 b. Probleme................................................................................................................................................8 aa. Gebrauchtwagenkauf.................................................................................................................8 bb. Tierkauf........................................................................................................................................9 cc. Zweck der Beweislast zu Lasten des Unternehmers.........................................................9 c. Ausschluss der Beweislastumkehr.....................................................................................................9 aa. Voraussetzung..............................................................................................................................9 bb. Beispiele........................................................................................................................................9 (aa). Unvereinbar mit der Art der Sache.................................................................................9 (bb). Unvereinbar mit der Art des Mangels..........................................................................10 III 3. § 477 BGB.............................................................................................................................…………...10 a. § 477 I 1 BGB...............................................................................................................…….............10 b. § 477 I 2 BGB..........................................................................................................………….…...10 c. § 477 II BGB.......................................................................................................................................11 d. § 477 III BGB.....................................................................................................................................11 II. §§ 478 und 479 BGB......................................................................................................................................12 1. § 478 BGB..................................................................................................................................................12 a. Art. 4 der Richtlinie 99/44/EG.......................................................................................................12 aa. erste Ansicht...............................................................................................................................12 bb. zweite Ansicht............................................................................................................................13 b. §§ 478 I und II BGB – Regresskonzepte.......................................................................................13 aa. § 478 I BGB – Modifizierung des gültigen Kaufrechts.......................................................13 (aa). Rücknahme.......................................................................................................................13 (bb). Minderung........................................................................................................................13 (cc). Einschränkungen des Anwendungsbereiches..............................................................14 (dd). Rechtsfolge.......................................................................................................................14 bb. § 478 II BGB – Eigenständiger Rückgriffsanspruch...........................................................14 (aa). Voraussetzungen................................................................................................15 (bb). Aufwand..............................................................................................................15 (cc). Verhältnis zu den §§ 437 ff. BGB....................................................................15 ((aa)). Bindung................................................................................................................15 ((bb)). Grenze.................................................................................................................15 (dd). Konkurrenzen.................................................................................................................16 c. § 478 III BGB – Beweiserleichterungen.........................................................................................16 d. § 478 IV BGB - Einschränkungen der Vertragsfreiheit...............................................................16 e. § 478 V BGB – Lieferketten.............................................................................................................17 f. § 478 VI BGB – Unberührtheit des § 377 HGB............................................................................17 2. § 479 BGB..................................................................................................................................................18 a. § 479 I BGB........................................................................................................................................18 b. § 479 II BGB.......................................................................................................................................18 c. § 479 III BGB......................................................................................................................................19 C. Fälle....................................................................................................................................................19 I. Fall......................................................................................................................................19 1. Sachverhalt........................................................................................................................................19 2. Lösung nach altem Recht................................................................................................................19 3. Lösung nach neuem Recht..............................................................................................................19 4. Vergleich.............................................................................................................................................20 II. Fall....................................................................................................................................21 1. Sachverhalt...........................................................................................................................................21 2. Lösung nach altem Recht..................................................................................................................21 3. Lösung nach neuem Recht................................................................................................................21 4. Vergleich..............................................................................................................................................22 IV III. Fall...................................................................................................................................22 1. Sachverhalt..........................................................................................................................................22 2. Lösung nach altem Recht.................................................................................................................23 3. Lösung nach neuem Recht...............................................................................................................23 4. Vergleich.............................................................................................................................................23 V Literaturverzeichnis 1. Kommentare Dauner-Lieb, Barbara Heidel, Thomas Lepa, Manfried Ring, Gerhard Anwaltskommentar – Schuldrecht Deutscher Anwaltverein Bonn, 2002 zit: Büdenbender, Ulrich / Pfeiffer, Thomas Palandt Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts Ergänzungsband zum Palandt BGB 61. Auflage München, 2002 zit: Putzo, Hans 2. Lehrbücher Brox, Hans Allgemeiner Teil des BGB 23. Auflage, Köln / Berlin / Bonn / München, 1999 Dauner-Lieb, Barbara Heidel, Thomas Lepa, Manfred Ring, Gerhard Das neue Schuldrecht Anwaltspraxis Dauner-Lieb, Barbara Arnold, Arnd Dötsch, Wolfgang Kitz, Volker Fälle zum neuen Schuldrecht Heidelberg, 2002 Olzen, Dirk Wank, Rolf Die Schuldrechtsreform Köln / Berlin / Bonn / München, 2002 Deutscher Anwaltverein Heidelberg, 2002 3. Aufsätze Adolphsen, Jens in Agrarrecht 2001, 169 Die Schuldrechtsreform und der Wegfall des Viehgewährleistungsrechts Brüggemeier, Gert in Juristen Zeitung 2000, 529 Zur Reform des deutschen Kaufrechts – Herausforderungen durch die EG-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie Brüggemeier, Gert in Betriebsberater 2001, 213 Europäisierung des BGB durch die große Schuldrechtsreform? - Stellungnahme zum Entwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes Büdenbender, Ulrich in Deutsches Steuerrecht 2002, 312 Das Kaufrecht nach dem Schuldrechtsreformgesetz (Teil I) Büdenbender, Ulrich in Deutsches Steuerrecht 2002, 361 VI Das Kaufrecht nach dem Schuldrechtsreformgesetz (Teil II) Däubler-Gmelin, Herta in Neue Juristische Wochenschrift 2001, 2281 Die Entscheidung für die sog. große Lösung bei der Schuldrechtsreform - Zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts Dauner-Lieb, Barbara in Juristenzeitung 2001, 8 Die geplante Schuldrechtsmodernisierung – Durchbruch oder Schnellschuss? Ernst, Wolfgang Gsell, Beate in Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 1812 Nochmals für die kleine Lösung Ernst, Wolfgang Gsell, Beate in Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2001, 1389 Kritisches zum Stand der Schuldrechtsmodernisierung – Beispiele fragwürdiger Richtlinienumsetzung Prinz von Sachsen Gessaphe in Recht der internationalen Wirtschaft 2001, 721 Europäisches und deutsches Kaufrecht: Rückgriff des Letztverkäufers Gsell, Beate in Juristenzeitung 2001, 65 Kaufrechtsrichtlinie und Schuldrechtsmodernisierung Haas, Lothar in Betriebs-Berater 2001, 1313 Entwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes: Kauf- und Werkvertragsrecht Hoffmann, Jan in ZRP 2001, 347 Verbrauchsgüterkaufrichtlinie und Schuldrechtsmodernisierungsgesetz Honsell, Heinrich in Juristenzeitung 2001, 278 Die EU-Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf und ihre Umsetzung ins BGB Jorden, Simone Lehmann, Michael in Juristenzeitung 2001, 952 Verbrauchsgüterkauf und Schuldrechtsmodernisierung – zur geplanten Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG im Rahmen eines Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts Lehmann, Michael in Juristen Zeitung 2000, 280 Informationsverantwortung und Gewährleistung für Werbeangaben beim Verbrauchsgüterkauf Mansel, Heinz-Peter in Neue juristische Wochenschrift 2002, 89 Die Neuregelung des Verjährungsrechts Pick, Eckhart in Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2001, 1173 Zum Stand der Schuldrechtsmodernisierung Reich, Norbert in Neue Juristische Wochenschrift 1999, 2397 Die Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG in das deutsche Recht VII Reinking, Kurt in Deutsches Autorecht 2001, 8 Auswirkungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes auf den Neu- und Gebrauchtwagenkauf Reinking, Kurt in Deutsches Autorecht 2002, 15 Die Haftung des Autoverkäufers für Sach- und Rechtsmängel nach neuem Recht Schmidt-Räutsch, Jürgen in Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 1998, 849 Zum Stand der Kaufrechtsrichtlinie Schmidt-Räutsch, Jürgen Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2000, 1639 Der Entwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes Schubel, Christian in Juristenzeitung 2001, 1113 Schuldrechtsreform: Perspektivenwechsel im Bürgerlichen Recht und AGB-Kontrolle für den Handelskauf Schubel, Christian in Juristische Schulung 2002, 313 Schuldrechtsmodernisierung 2001/2002 – Das neue Kaufrecht Schwab, Martin in Juristische Schulung 2002, 5 Das neue Schuldrecht im Überblick Staudenmayer, Dirk in Neue juristische Wochenschrift 1999, 2393 Die EG-Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf Westermann, Harm Peter in Juristenzeitung 2001, 530 Das neue Kaufrecht einschließlich des Verbrauchsgüterkaufs Westermann, Harm Peter in Neue Juristische Wochenschrift 2002, 241 Das neue Kaufrecht Westphalen Graf von, Friedrich in Der Betrieb 1999, 2553 Die Umsetzung der Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie im Blick auf den Regress zwischen Händler und Hersteller 4. Sonstiges Diskussionsentwurf des Bundesjustizministeriums vom 6.3.2000 Regierungsentwurf der Bundesregierung vom 9.5.2001 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.5.1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter Hemmer/Wüst Die Schuldrechtsreform 2002 1 A. Einführung I. europarechtliche Vorgaben Anlass für die Schuldrechtsreform war die Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland zur Umsetzung dreier verschiedener Richtlinien. Die hier wesentliche Richtlinie ist die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 1999/44/EG, die gem. ihrem Art. 11 I von Deutschland bis zum 31.12.2001 in nationales Recht umgesetzt werden musste1. II. Vorläufer der jetzigen Reform 1984 setzt die damalige CDU/CSU-Regierung die Kommission zur Überarbeitung des Schuldrechts ein. Diese übergab 1991 dem damaligen Bundesjustizminister einen Entwurf, der insbesondere im Leistungsrecht und im Kaufrecht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf (CISG) entsprach. Auf diesen Entwurf wurde allerdings erst im Zuge der Schuldrechtsreform zurück gegriffen2. III. Entstehen des Regierungsentwurfs3 04.08.2000: Bundesregierung stellte einen Diskussionsentwurf zur Schuldrechtsmodernisierung vor; dieser basierte auf dem Entwurf der Kommission von 1991 und gab deshalb Anlass zur Kritik der Veraltung4 06.03.2001: eine Expertenkommission lies den Diskussionsentwurf, nachdem sie ihn in vielen Punkten überarbeitet hatte, als sog. kollidierte Fassung neu veröffentlichen; wieder gab es erhebliche Kritik Mai 2001: Bundesregierung und Regierungsfraktionen haben nach erneuter Überarbeitung einen Entwurf der Bundesregierung zur Modernisierung des Schuldrechts in das Parlament eingebracht 18.05.2001: erste Beratung des Fraktionsentwurfs im Bundestag und Weiterleitung an den Rechtsausschuss 13.07.2001: erste Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf der Bundesregierung; keine grundsätzliche Kritik 31.08.2001: Gegenäußerung der Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates 27.09.2001: erste Lesung des Regierungsentwurfes im Bundestag 09.10.2001: Erscheinen des Berichts und der Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses des Bundestages Olzen/Wank – Rn. 2 / Jorden/Lehmann – JZ 2001, 952 (952) / Das neue SchuldR, S. 1 / Palandt – Vorbemerkung zu §§ 474 – 479 BGB n.F., Rn. 1 und § 474, Rn. 1 / Brüggemeier – JZ 2000, 529 (529) / Büdenbender – DStR 2002, 312 (312) 2 Olzen/Wank, Rn. 6, 7 / Reich – NJW 1999, 2397 (2399, 2401) / Das neue SchuldR, S. 1 3 Olzen/Wank, Rn. 8 - 14 4 Dauner-Lieb – JZ 2001, 8 (15) 1 2 20.11.2001: nach zweiter und dritter Lesung von Regierungs- und Fraktionsentwurf Verabschiedung des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts in der Fassung des Bundestag-Druckes 29.11.2001: das Gesetz passierte den Bundesrat, ohne dass ein Vermittlungsausschuss angerufen wurde; Verkündung des Gesetzes im Bundesgesetzblatt 01.01.2002: Inkrafttreten des Gesetzes B. Verbrauchsgüterkauf Die Reform macht erstmals im Bereich des Kaufrechts zwingendes Verbraucherrecht zum gesetzlichen Regelungstatbestand5. Dies wurde von Art. 7 I 1 RiLi gefordert6. Mit der Umsetzung wird das europäische Kaufrecht angeglichen, um dem Verbraucher die Nutzung des Binnenmarktes mit größerem Vertrauen zu ermöglichen. Die bestehenden Unterschiede im Kaufrecht sollen durch ein Mindestmaß an gemeinsamen Verbraucherrechten ausgeglichen werden7. In Deutschland wurde die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie komplett im BGB umgesetzt, um eine Aufspaltung des Kaufrechts zu vermeiden8. Für den Verbrauchsgüterkauf gelten die §§ 433 ff. BGB, sofern das grundsätzlich dispositive Kaufrecht nicht infolge des § 474 II spezialgesetzlich außer Kraft gesetzt wird9. Im Übrigen ist der Verbrauchsgüterkauf in den §§ 474 bis 479 BGB geregelt. Da die Richtlinie vor allem im „normalen Kaufrecht“ umgesetzt wurde, sind die Sonderregelungen für den Verbrauchsgüterkauf nicht sehr umfangreich, dafür aber gewichtig. I. § 474 BGB – Begriff des Verbrauchsgüterkaufs 1. Anwendungsbereich Nach der Legaldefinition des § 474 I BGB liegt ein Verbrauchsgüterkauf vor, wenn ein Verbraucher von einem Unternehmer eine bewegliche Sache kauft10. Nicht erfasst werden somit Geschäfte zwischen 2 Verbrauchern bzw. 2 Unternehmern oder Verkäufe von Verbrauchern an Unternehmer11. Erfasst werden neue und gebrauchte bewegliche Sachen, allerdings nicht solche gebrauchten Sachen, die in einer öffentlichen Versteigerung verkauft werden, an der ein Verbraucher persönlich teilnehmen kann, § 474 I 2 BGB12. Es kommt nicht darauf an, dass der Verbraucher auch tatsächlich Schubel – JZ 2001, 1113 (1113) / Dauner-Lieb – JZ 2001, 8 (13) Gsell – JZ 2001, 65 (74) / Art. 7 der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 / Schubel – JuS 2002, 313 (314) 7 Richtlinie 1999/44/EG Abs. 2 und 5; Art.1 8 Brüggemeier/Reich – BB 2001, 213 (215) / Hoffmann – ZRP 2001, 347 (348) / Brüggemeier – JZ 2000, 529 (529) / Gessaphe – RIW 2001, 721 (725) 9 Anwaltskommentar – § 474, Rn. 6 / Westermann – JZ 2001, 530 (536) / Das neue SchuldR, S. 218, Rn. 79 / Palandt – Vorbemerkung zu §§ 474 – 479 BGB n.F., Rn. 1 und § 474 BGB n.F., Rn. 1 und § 474 BGB n.F., Rn. 6 10 Das neue SchuldR, S. 218, Rn. 79n / Palandt - § 474 BGB n.F., Rn. 2 / Schubel – JuS 2002, 313 (313) / Brüggemeier – JZ 2000, 529 (530) / Büdenbender – DStR 2002, 362 (363) / Reinking – DAR 2002, 21 (22) 11 Jordan/Lehmann – JZ 2001, 952 (952) / Schubel – JZ 2001, 1113 (1115) / Honsell – JZ 2001, 278 (278) / Das neue SchuldR, S. 218, Rn. 80 / Brüggemeier – JZ 2000, 529 (530) / Reinking – DAR 2001, 8 (9) / Reinking – DAR 2002, 21 (22) / Haas – BB 2001, 1313 (1313) 12 Olzen/Wank, Rn. 424 / Westermann, NJW 2002, 241 (251) / Das neue SchuldR, S. 218, Rn. 81 / Palandt - § 474 BGB n.F., Rn. 2 5 6 3 13 teilgenommen hat . Fraglich ist, ob unter derartigen Versteigerungen, bei denen die Verbraucher die Möglichkeit haben, dem Verkauf beizuwohnen, auch sog. Online-Auktionen fallen14. a. Verbraucher aa. § 13 BGB Gem. § 13 BGB ist Verbraucher jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Allerdings werden hierbei diejenigen, die ein Rechtsgeschäft tätigen, das in Zusammenhang mit einer abhängigen beruflichen Tätigkeit (z.B. Kauf eines PKW durch einen Angestellten für die täglichen Fahrten zur Arbeitsstelle) steht, aus dem Kreis der Verbraucher nicht ausgeschlossen15. bb. Richtlinie 1999/44/EG Der Verbraucherbegriff der Richtlinie ist insoweit enger als der Verbraucherbegriff des § 13 BGB, als er Personen, die zu einem Zweck handeln, der ihrer unselbständigen Tätigkeit zuzurechnen ist, nicht mit einbezieht16. cc. Personenmehrheiten Natürliche Personen iSd § 13 BGB ist der Einzelverbraucher. Er verliert seine Verbrauchereigenschaft nicht dadurch, dass er mit anderen Verbrauchern als Gesamtschuldner ein privates Rechtsgeschäft abschliesst (z.B. Kfz-Kauf von Eheleuten). So schließt § 13 BGB wohl auch Personenmehrheiten in Gestalt einer GbR oder Erbengemeinschaft ein, nicht aber OHG und KG als eigenständige Träger von Rechten und Pflichten17. b. Unternehmer aa. § 14 BGB Gem. § 14 BGB ist Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft (GbR, OHG, KG), die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. bb. Richtlinie 1999/44/EG Der Unternehmerbegriff der Richtlinie ist insoweit weiter als der Unternehmerbegriff des § 14 BGB, als er auch Akteure umfasst, die in Ausübung einer unselbständigen Berufstätigkeit handeln 18. Im übrigen kommt es nach der Richtlinie nicht darauf an, dass der Verkauf von Gegenständen zum typischen Geschäftsbereich des Unternehmers gehört19. 13 Palandt - § 474 BGB n.F., Rn. 2 Brüggemeier – JZ 2000, 529 (531) 15 Reinking – DAR 2001, 8 (8) 16 Jordan/Lehmann – JZ 2001, 952 (952) 17 Reinking – DAR 2001, 8 (9) 18 Jordan/Lehmann – JZ 2001, 952 (952) 14 4 cc. Existenzaufgabe / -gründung Rechtsgeschäfte im Bereich der Existenzaufgabe gehören fraglos zur gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit, so dass in diesem Stadium die Unternehmereigenschaft fortbesteht. Nach der Legaldefinition des § 14 BGB wird die Phase der Existenzgründung ausgegrenzt, da die Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit deren Vorhandensein voraussetzt20. c. bewegliche Sache Bewegliche Sachen sind alle Gegenstände iSd § 90 BGB, die nicht Grundstücke sind21. Hierzu zählen auch Tiere22, für die die besonderen Vorschriften der §§ 481 ff. BGB a.F. aufgehoben wurden23. d. Verbrauchsgüter Verbrauchsgüter sind neue oder gebrauchte bewegliche Sachen (§§ 90, 90a BGB), die an einen Verbraucher verkauft werden24. Ausgenommen sind solche Sachen, die im Wege der Zwangsvollstreckung oder durch gerichtliche Maßnahmen verkauft werden, ferner Strom, Wasser, und Gas, wenn sie nicht in einem begrenzten Volumen bestehen oder abgefüllt sind25. 2. Ausnahme der §§ 445 und 447 BGB von der Anwendung § 474 II BGB nimmt die §§ 445 und 447 BGB aus der Anwendung beim Verbrauchsgüterkauf heraus. Diese Regelung trägt insgesamt den Interessen eines Verbrauchers Rechnung, der jetzt die Ware erst bezahlen muss, wenn er sie auch erhalten hat26. a. § 445 BGB – Haftungsbegrenzung bei öffentlichen Versteigerungen § 445 BGB wurde ausgeklammert, weil die dort angeordnete Haftungserleichterung für den Verkäufer (dem Käufer einer versteigerten Sache stehen nur unter bestimmten Bedingungen, namentlich Arglist und Garantie des Verkäufers, die Mängelrechte der §§ 437 ff. zu) nicht den Anforderungen der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie entspricht27. Was dazu führt, dass auch bei Versteigerungen Mängelrechte, die nicht unter § 474 I S.2 BGB fallen, gewährleistet werden. b. § 447 BGB – Gefahrübergang beim Versendungsverkauf § 447 BGB findet nach § 474 II BGB ebenfalls keine Anwendung. Die hat zur Folge, dass auch beim Versendungskauf die Gefahr gem. § 446 BGB erst mit Besitzerlangung des Käufers auf diesen Hemmer – Das neue Schuldrecht, S. 115, Rn. 256 / Reinking – DAR 2001, 8 (9) Reinking – DAR 2001, 8 (9) 21 Brox, AT des BGB, Rn. 752 22 Palandt – Vorbemerkung zu §§ 474 – 479 BGB n.F., Rn. 2 / Brüggemeier – JZ 2000, 529 (530) 23 Däubler-Gmelin – NJW 2001, 2281 (2283) 24 Art. 1 II b der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 / Adolphsen – AgrarR 2001, 169 (170) 25 Palandt – Vorbemerkung zu §§ 474 – 479 BGB n.F., Rn. 3 und § 474 BGB n.F., Rn. 3 / Adolphsen – AgrarR 2001, 169 (170) 26 Olzen/Wank, Rn. 427 27 Anwaltskommentar – § 474, Rn. 6 19 20 5 28 übergeht . Der Grund für die Ausklammerung ist die Annahme, dass der Unternehmer mehr als der Verbraucher Einfluss auf die Beförderung hat. Im übrigen entspricht es der Verkehrsauffassung, dass die Versendung einer Ware in den Risikobereich des Verkäufers fällt29. Darüber hinaus kann der Verkäufer eine Transportversicherung abschließen, welche er dann im Kaufpreis der Ware mit einkalkuliert30. Umständliche Konstruktionen zum Schutze des Käufers, wie die Drittschadensliquidation, sind nun entbehrlich geworden. Beim Untergang der Sache kann der Verkäufer innerhalb seiner vertraglichen Beziehungen seinen eigenen Schaden gegenüber dem Transportunternehmen geltend machen. Der Käufer wird gleichzeitig gem. § 326 I S.1, 1.HS BGB von seiner Kaufpreiszahlungspflicht befreit, da er gemäß § 275 I BGB nicht zu leisten braucht. II. §§ 475 – 477 BGB Die §§ 475 – 477 BGB verbessern die Rechtsstellung des Verbrauchers, indem abweichende Vereinbarungen gegenüber §§ 433 ff. BGB zu Lasten des Verbrauchers in den Grenzen des § 475 I und II für unwirksam erklärt werden. Insoweit wird das Verbrauchsgüterkaufrecht partiell zum zwingenden Recht31. 1. § 475 BGB – Abweichende Vereinbarungen § 475 BGB schreibt die Vorschriften des Verbrauchsgüterkaufs und bestimmte allgemeine kaufrechtliche Bestimmungen zwingend fest. Die Vorschrift setzt den Art. 7 I der RiLi um 32, geht über diesen jedoch insoweit hinaus, als § 475 BGB auch für die Rechtsmängelhaftung gilt33. a. § 475 I BGB – Vereinbarungen zum Nachteil des Verbrauchers § 475 I BGB erklärt eine Verkürzung von Verbraucherrechten vor Mitteilung eines Mangels an den Unternehmer für unwirksam, wenn sie vom Inhalt der §§ 433 – 435, 437, 439 – 443 BGB abweicht. Somit ist ein Haftungsausschluss für Nacherfüllung, Minderung und Rücktritt nicht mehr möglich. Im „normalen Kaufrecht“ gilt dies gem. § 444 BGB nur bei Vorliegen einer Garantieerklärung oder bei Arglist des Verkäufers. Eine Abweichung von den nicht zur Position der Vertragsparteien gestellten gesetzlichen Regelungen liegt immer dann vor, wenn die dortige Rechtsfolge zu Lasten des Verbrauchers gänzlich ausgeschlossen wird, für den Verbraucher vorteilhafte Rechtsfolgen in sachlicher oder zeitlicher Anwaltskommentar – § 474, Rn. 7 Westermann, JZ 2001, 530 (536) / Anwaltskommentar – § 474, Rn. 7 30 Regierungsentwurf vom 9.5.2001 S. 573 31 Anwaltskommentar – § 474, Rn. 8 / Reinking – DAR 2001, 8 (9) / Schwab – JuS 2002, 5 (6) / Haas – BB 2001, 1313 (1319) 32 Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 1 / Art. 7 I der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 / Schubel – JuS 2002, 313 (314) / Hoffmann – ZRP 2001, 347 (347) 33 Jordan/Lehmann – JZ 2001, 952 (963) 28 29 6 Hinsicht beschränkt werden, ungünstige Beweislastregelungen vereinbart werden, und bei mit der Durchsetzung verbundener Kostenübernahme34. Durch § 475 I 2 BGB werden auch Umgehungsgeschäfte für unzulässig erklärt, was ohnehin aus § 134 BGB folgen würde35. Umgehen bedeutet eine rechtsgeschäftliche Vereinbarung, welche die Wirkungen einer Vorschrift auf einem anderen Weg beseitigt oder herbeiführt36. Hierbei kommt es allein auf die wirtschaftliche Gleichwertigkeit des angestrebten mit dem gesetzlich untersagten Ergebnis an37. Rechtsfolge: Auf abweichende Vorschriften, die gegen Absatz I verstoßen, kann sich der Verkäufer kraft Gesetzes nicht berufen. Dies bedeutet die Unwirksamkeit der Gewährleistungseinschränkung unter voller Aufrechterhaltung des Kaufvertrages im Übrigen38. Vertragsabsprachen, die für den Verbraucher von Vorteil sind, können vom Verkäufer nicht zu Fall gebracht werden. Das gilt auch dann, wenn die vorteilhafte und die nachteilige Regelung miteinander verknüpft sind39. b. § 475 II BGB - Verjährungsfristen Diese Vorschrift setzt Art. 5und 7 der RiLi um40. Nach § 475 II BGB gilt beim Verbrauchsgüterkauf eine Sonderregelung gegenüber § 202 BGB. Die Vorschrift ist nur auf § 437 Nr. 1 und 3 BGB anwendbar, mit der logischen Folge, dass Rücktritt und Minderung (§ 437 Nr. 2 BGB) als Gestaltungsrechte nicht verjähren, aber vom vorangegangenen Nacherfüllungsanspruch (§ 437 Nr. 1 BGB) abhängen41. § 475 II BGB erklärt eine Verjährungsfrist von weniger als 2 Jahren, bei gebrauchten Sachen von weniger als 1 Jahr, für unzulässig, während § 202 BGB grundsätzlich Regelungen zur Erleichterung der Verjährung, mit Ausnahme von Fällen einer Haftung wegen Vorsatzes, gestattet. Die Vorschrift gilt auch für Tiere, so dass auch hier in Zukunft eine Unterscheidung zwischen neu und gebraucht gemacht werden muss; was äußerst kompliziert sein dürfte42. Gebraucht ist eine Sache jedenfalls dann, wenn sie in Benutzung genommen ist43. Bei § 475 II BGB geht es nur um Abreden, die vor Mitteilung eines Mangels an den Verkäufer zu dessen Nachteil erfolgen, so dass einem späteren Vergleich nach erfolgter Mängelanzeige nicht entgegensteht44. Hiermit soll erreicht werden, dass die Vertragsparteien bei mangelhafter Ware die Abwicklung flexibel vollziehen können45. Die Mitteilung ist empfangsbedürftig (§ 130 BGB); daher besteht die Unzulässigkeit bis zum Zugang (§ 130 BGB). An die betreffende Mitteilung sind dieselben Anwaltskommentar – § 475, Rn. 3 / Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 3 Büdenbender – DStR 2002, 362 (264) 36 Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 6 37 Anwaltskommentar – § 475, Rn. 4 / Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 6 38 Anwaltskommentar – § 475, Rn. 10 / Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 5 / Reinking – DAR 2002, 21 (22) 39 Reinking – DAR 2002, 21 (22) 40 Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 9 / Art. 5 und 7 der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 41 Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 10 42 Olzen/Wank, Rn. 432 / Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 11 / BGH, NJW-RR 1986, 52 (52) 43 Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 11 44 Olzen/Wank, Rn. 431 / Das neue SchuldR, S. 219, Rn. 84 / Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 3 45 Anwaltskommentar - § 475, Rn. 8 34 35 7 46 Anforderungen zu stellen wie an eine Mängelanzeige nach altem Recht; d.h. sie muss die Tatsachen bezeichnen, die den angezeigten Sach- oder Rechtsmangel ausmachen und erkennen lassen, dass der Verbraucher sie Vertragswidrigkeit (§ 433 I 2 BGB) geltend macht47. Nachteil ist auf die Rechtsstellung des Verbrauchers zu beziehen und kann unmittelbar oder mittelbar sein48. Problem: Es besteht die Gefahr, dass die zweijährige Verjährungsfrist für Sachmängel dadurch unterlaufen wird, dass Neuwaren als Gebrauchtwaren deklariert werden. Speziell beim Kfz-Handel ist diese Gefahr sehr groß, da so etwas schon heute zuweilen mit Fahrzeugen geschieht, die zuvor im Ausland auf den Händler oder einen Dritten zugelassen waren oder die eine Tages- oder Kurzzulassung aufweisen. Dies macht erforderlich, die Begriffe Neuwagen und Gebrauchtwagen noch schärfer als bisher voneinander abzugrenzen. Ausschlaggebend für die Beurteilung dürfte sein, ob ein Fahrzeug bereits zum Zweck der Teilnahme am StV in gebrauch genommen wurde49. Rechtsfolge: Hier fehlt im Gegensatz zu Absatz I eine ausdrückliche Anordnung der Unwirksamkeit, dennoch treten bei Verstoß die gleichen Rechtsfolgen wie bei Absatz I ein, also eine partielle Unwirksamkeit50. c. § 475 III BGB – Ausnahme von der Anwendbarkeit § 475 III BGB nimmt den Ausschluss oder die Beschränkung des Anspruchs auf Schadensersatz aus der Anwendbarkeit der Absätze I und II heraus. Eine Kontrolle im Rahmen der §§ 307 – 309 BGB (~ §§ 9 – 11 AGBG) soll ausreichen51. Somit kann der Anspruch auf Schadensersatz (z.B. im Individualarbeitsvertrag) also ausgeschlossen werden52. Dies ist zweifach zu begründen. Zunächst hat die Richtlinie dem nationalen Gesetzgeber hinsichtlich der Schadensersatzansprüche keine Vorgaben gemacht hat. Außerdem erschien diese Ausnahme dem Gesetzgeber deshalb gerechtfertigt, weil die Schadensersatzansprüche den Verkäufer, insbesondere bei Mangelfolgeschäden, stärker belasten als die sonstigen rechtlichen Möglichkeiten eines Käufers, so dass das Interessengewicht gestört würde53. 2. § 476 BGB - Beweislastumkehr Die Vorschrift setzt den Art. 5 III der RiLi um54. a. Regelungsgehalt § 476 BGB gehört zum Recht der Mängelgewährleistung55 und führt Beweiserleichterungen zugunsten des Verbrauchers ein. Es wird vermutet, dass, wenn sich ein Mangel innerhalb von 6 Monaten ab 46 Palandt-Putzo Ergänzungsband zu Palandt BGB 61. Auflage §475, Rn.3 Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 3 48 Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 4 49 Reinking – DAR 2001, 8 (10) 50 Anwaltskommentar, § 475, Rn. 10 / Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 13 51 Das neue SchuldR, S. 219, Rn. 83 / Palandt - § 475 BGB n.F., Rn. 14 52 Schwab – JuS 2002, 5 (6) 53 Olzen/Wank, Rn. 431 / Jorden/Lehmann – JZ 2001, 952 (963) 54 Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 1 / Art. 5 III der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 / Brüggemeier – JZ 2000, 529 (531) 47 8 Gefahrübergang zeigt, die Sache bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war, es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art des Gutes oder Mangels nicht vereinbar56. Die Berechnung rechnet sich nach § 188 II BGB und der Fristbeginn nach § 187 I BGB57. Es wird die an sich den Käufer treffende Beweislast für die Mangelhaftigkeit der Sache auf den Verkäufer verlagert; allerdings nur für diese ersten 6 Monate58. Diese Norm enthält keine Fiktion, sondern eine widerlegbare Vermutung. Soweit ihre Voraussetzungen bestehen, kann sie der Verkäufer durch einen geeigneten Sachvortrag erschüttern59. Der Abschluss eines wirksamen Kaufvertrages, die gegenwärtige Mangelhaftigkeit des Kaufgegenstandes, sowie das Auftreten des Mangels innerhalb einer Frist von 6 Monaten fallen uneingeschränkt in die Darlegungs- und Beweislast des Käufers60. § 476 BGB gilt nur für den Verbrauchsgüterkauf iSd § 474 BGB und nur für Sachmängel iSd § 434 BGB61. Dies ist damit zu begründen, dass die erheblichen Beweisschwierigkeiten für den Käufer nur bei Vorliegen eines Sachmangels relevant sind; nicht dagegen bei Rechtsmängeln 62. Der Sachmangel muss sich innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit Gefahrübergang (§ 446 BGB) zeigen, d.h. er muss erkennbar, also bereits optisch deutlich, werden63; was allerdings nicht bedeutet, dass sich der Mangel „von sich aus“ zeigen muss64. Nicht verlangt wird, dass der Käufer den Mangel bereits innerhalb von 6 Monaten dem Verkäufer anzeigt, allerdings könnte das seine Beweislast bzgl. des Auftretens des Mangels innerhalb von 6 Monaten wesentlich erleichtern65. Aus § 475 I 1 BGB ergibt sich die Unabdingbarkeit der Vorschrift. Eine abweichende Vereinbarung ist erst ab Mitteilung des Sachmangels zulässig (wie bei § 475 BGB)66. § 476 soll dem Umstand Rechnung tragen, dass es für den Unternehmer idR leichter ist, den Beweis zu führen, dass ein Mangel bei Gefahrübergang nicht vorlag, als das Umgekehrte für den Käufer67. b. Probleme aa. Abgesehen von den notwendigen konkreten Betrachtungen zu dem, was insoweit die „gewöhnliche Verwendung“ und der Erwartungshorizont des Verkäufers „nach Art der Sache“ iSd § 434 I 2 BGB ist, wird hier zu prüfen sein, ob nicht bei Gebrauchtwagen ein Auftreten eines Mangels innerhalb der 6- Anwaltskommentar – § 476, Rn. 4 Gsell – JZ 2001, 65 (73) / Honsell – JZ 2001, 278 (280) 57 Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 6 58 Westermann – JZ 2001, 530 (540) / Reinking – DAR 2001, 8 (14) 59 Anwaltskommentar – § 476, Rn. 2 / Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 8 / Reinking – DAR 2002, 21 (23) 60 Anwaltskommentar – § 476, Rn. 3 / Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 5 61 Anwaltskommentar – § 476, Rn. 6 und 7 / Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 3 62 Anwaltskommentar - § 476, Rn. 7 63 Anwaltskommentar – § 476, Rn. 11 / Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 7 64 Reinking – Dar 2001, 8 (15) 65 Büdenbender - DStR 2002, 312 (364) 66 Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 4 67 Olzen/Wank, Rn. 436 / Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 2 / Reinking – DAR 2001, 8 (14) 55 56 9 Monatsfrist nur eine einfache Verschleißerscheinung ist, die keinen Schluss darauf zulässt, dass gerade dieser Mangel schon bei Gefahrübergang vorhanden war68. bb. Ein zweiter Problemkreis eröffnet sich bzgl. des Viehkaufs, dessen Sonderbehandlung durch gänzliche Streichung der §§ 481 ff BGB a.F. beseitigt worden ist. Hierbei dürfte der Vorrang der Nacherfüllung vor Rücktritt und Minderung nur selten relevant werden69. Fraglich ist, ob man nicht bei vielen Tierkäufen sagen kann, dass die genannte Vermutung mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist, denn bei Tierkäufen besteht eine zu hohe Ungewissheit über den Zeitraum zwischen Infektion und Ausbruch der Krankheit deren Anlage bei Kauf des Tieres nicht typisch ist70. Außerdem beeinträchtigen die Beweislastregeln hier die Verkäuferinteressen massiv, da sich der Zustand eines Tieres, in Abhängigkeit von Haltung, Pflege und Belastung in dieser Zeit erheblich verändert 71. cc. Außerdem wird beim Zweck der Beweislast zu Lasten des Unternehmers übersehen, dass der Verbrauchsgüterkauf auch solche Unternehmer betrifft, deren Gewerbe oder selbständige berufliche Tätigkeit nicht darin besteht, Waren zu verkaufen72. Bsp.: Der selbständige Architekt, der sein beruflich genutztes Kfz an einen Kfz-Meister zum Zwecke der privaten Nutzung verkauft, verfügt idR über eine geringere Sachkunde als sein Vertragspartner, muss aber trotzdem die Vermutung gegen sich gelten lassen. c. Ausschluss der Beweislastumkehr aa. Voraussetzung § 476 Hs. 2 BGB schließt die Beweislastumkehr aus, wenn sie mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist. Der Verkäufer trägt dabei die Darlegungs- und Beweislast für die tatsächlichen Voraussetzungen dieser Ausnahmeregelung73. Liegt die Ausnahmeregelung vor, bleibt es bei der Beweislast des Käufers für das Vorliegen eines Mangels bei Gefahrübergang. bb. Beispiele (aa). Unvereinbar mit Art der Sache Bei Kaufverträgen über gebrauchte Sachen besteht bereits wegen des sehr unterschiedlichen Grades der Abnutzung kein Erfahrungssatz, wie er § 476 Hs. 1 BGB zugrunde liegt. Deshalb betrifft die Ausnahme vor allem Verbrauchsgegenstände mit kurzfristiger Nutzung wie Lebensmittel, Schnittblumen usw.74. So wäre es z.B. mit der Art des Kaufgegenstandes unvereinbar, wenn ein Käufer 4 Monate nach der Übergabe rügt, dass das gelieferte Obst faul sei. Westermann, NJW 2002, 241 (252) / Reinking – DAR 2001, 8 (14) Adolphsen, AgrarR 2001, 169 (171) 70 Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 11 / Honsell – JZ 2001, 278 (280) / Adolphsen – AgrarR 2001, 160 (171, 172) 71 Adolphsen – AgrarR 2001, 169 (172) 72 Reinking – DAR 2001, 8 (14) 73 Anwaltskommentar – § 476, Rn. 13 / Palandt - § 476 BGB n.F., Rn. 9 68 69 10 (bb). Unvereinbar mit Art des Mangels Hierzu zählen vor allem klassische Umgangs- und Bedienungsfehler des Käufers, wie z.B. abgerissene Knöpfe75. Beim Gebrauchtwagenkauf lässt sich ganz allgemein sagen, dass die Einschränkung nach Art des Mangels erst dann eingreift, wenn sich aufgrund technischer Gründe eindeutig ergibt, dass der Mangel bei Gefahrübergang nicht vorhanden gewesen sein kann, oder dass er seiner Natur nach erst im Laufe der Zeit –also nach Gefahrübergang- eingetreten sein muss76. 3. § 477 BGB – Sonderbestimmungen für Garantien Die Vorschrift setzt Art. 6 II und III der RiLi um77. § 477 BGB stellt formelle Anforderungen für Garantien nach § 443 BGB auf, die zugunsten des Käufers in Verbrauchsgüterverträgen abgegeben werden. Sinn der Vorschrift ist es, dem Verbraucher etwaige Beweisschwierigkeiten hinsichtlich des Inhalts der Garantie zu ersparen 78. Garantien sind die vom Verkäufer oder Hersteller beim Kauf ohne Aufpreis eingegangene Verpflichtung, den Kaufpreis zu erstatten, die verkaufte Sache zu ersetzen oder sonst Abhilfe zu schaffen, wenn das Verbrauchsgut der Garantieerklärung oder den in der Werbung genannten Eigenschaften nicht entspricht79. a. § 477 I 1 BGB – einfache und verständliche Abfassung § 477 I 1 BGB stellt klar, dass die Sprache von Garantieerklärungen einfach und verständlich sein muss. Im Regelfall erfordert die Verständlichkeit der Garantieerklärung die deutsche Sprache. Dies ist allerdings nicht vorgeschrieben, was Art. 6 IV der Richtlinie feststellt80. Ausnahmsweise kann auch englisch genügen, wenn die Verwendung (z.B. bei Computern) üblich ist81. Maßgeblich ist stets, dass ein durchschnittlicher Verbraucher Voraussetzungen, Inhalt und Reichweite der Garantieerklärung verstehen kann. Fachausdrücke und Fremdwörter dürfen nur dann verwendet werden, wenn zu erwarten ist, dass sie vom Adressatenkreis verstanden werden82. b. § 477 I 2 BGB – Hinweise und Inhalt Art. 477 I 2 BGB stellt bestimmte Hinweis– und Informationspflichten für die Garantieerklärungen auf. Die Hinweise betreffen gesetzliche Rechte des Verbrauchers (sie müssen sich auf § 437 BGB Anwaltskommentar – § 476, Rn. 14 / Büdenbender – DStR 2002, 362 (364) Anwaltskommentar – § 476, Rn. 15 76 Reinking – DAR 2002, 21 (23) 77 Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 1 / Art. 6 II und II der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 78 Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 2 79 Palandt – Vorbemerkungen zu §§ 474 – 479 BGB n.F., Rn. 7 80 Art. 6 der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 81 Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 6 82 Anwaltskommentar – § 477, Rn. 4 und 5 / Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 7 und 8 74 75 11 beziehen und klarstellen, dass diese Rechte bestehen, wenn die Sache bei Gefahrübergang nicht mangelfrei war) und auf den uneingeschränkten Bestand der gesetzlichen Rechte (unabhängig davon, ob der Garantiefall eintritt und ob die Garantie in Anspruch genommen wird)83. Die Informationen betreffen zunächst einmal die Abgrenzung zwischen der Garantie nach § 443 BGB und den Gewährleistungsrechten nach §§ 437 ff. BGB. Der Garantiegeber hat den Verbraucher auf die von der Garantie abzugrenzenden Rechte aus §§ 437 ff. BGB hinzuweisen sowie deren Unabhängigkeit von der Garantiezusage hervorzuheben84. Des Weiteren betreffen die Informationen den Inhalt der Garantiezusage. Hierzu zählen der Inhalt, die Dauer, der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes sowie Name und Anschrift des Garantiegebers85. c. § 477 II BGB - Textform Grundsätzlich ist die Form auch beim Verbrauchsgüterkauf frei, daher mündlich und stillschweigend möglich86. Nach § 477 II BGB kann der Verbraucher verlangen, dass ihm die Garantieerklärung in Anlehnung an § 126b BGB87 in Textform mitgeteilt wird. Dies bedeutet eine in lesbaren Schriftzeichen fixierte Erklärung, wobei anders als bei der Schriftform keine Unterschrift des Erklärenden, sondern lediglich ein erkennbarer Abschluss der Erklärung verlangt wird. Zulässig sind neben Erklärungen auf Papier auch solche auf elektronischen Datenträgern (Diskette, CD-Rom). Auch E-Mails genügen der Textform, wenn sie auf einem Server bei einem Online-Provider ankommen, auf den der Empfänger zugreifen kann88; Art. 6 III der Richtlinie verlangt dabei allerdings eine Garantieerklärung entweder in Schriftform oder auf eine dauerhaften Datenträger89. Ausreichend ist also z.B. nicht eine Garantieerklärung auf einer jederzeit vom Garantiegeber abänderbaren Homepage90. d. § 477 III BGB - Rechtsfolge § 477 III BGB stellt als Sonderregelung zu § 139 BGB klar, dass Verstöße gegen die genannten Vorgaben die Wirksamkeit der Garantieverpflichtung unberührt lassen. Allerdings kann eine Pflichtverletzung des Unternehmers nach §§ 311 II, 241 II, 280 I BGB zu einer Schadensersatzverpflichtung führen, deren Folge die Aufhebung des Vertrages wäre91. Dies setzt aber voraus, dass die fehlerhafte Unterrichtung über die Garantie kausal für den Abschluss des Vertrages war. 83 Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 8 und 9 Anwaltskommentar – § 477, Rn. 6 / Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 10 und 11 85 Anwaltskommentar – § 477, Rn. 7 / Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 12 86 Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 13 87 Palandt-Putzo, § 477 BGB n.F.., Rn. 13 88 Anwaltskommentar – § 477, Rn. 8 / Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 13 89 Art. 6 der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 90 Anwaltskommentar – § 477, Rn. 8 91 Westermann, NJW 2002, 241 (251) / Palandt - § 477 BGB n.F., Rn. 14 84 12 II. §§ 478 und 479 BGB Die §§ 478 und 479 BGB stellen dem Unternehmer erleichterte Rückgriffsvorschriften gegenüber dem Lieferanten zur Seite. Die Vorschriften setzen Art. 4 der RiLi um92. 1. § 478 BGB – Rückgriff des Unternehmers § 478 BGB regelt den Rückgriff des Unternehmers und der vorhergehenden Glieder in der Lieferkette. § 478 BGB gibt dem Letztverkäufer allerdings keine neuen Rechte, sondern modifiziert nur den Rückgriff gegen den Lieferanten nach den allg. Vorschriften der §§ 434 ff. BGB. § 478 BGB betrifft ausschließlich Rechtsbeziehungen zwischen Unternehmen in der Lieferkette bis hin zum Produzenten. Die Rückgriffsmöglichkeit stellt sicher, dass die wirtschaftlichen Folgen einer mangelhaften Lieferung bei dem Verursacher des Mangels landen und leistet so einen Beitrag zur Vertragsgerechtigkeit93. Ansonsten würde es zu einer inadäquaten Benachteiligung des Letztverkäufers kommen, dem eine „Regressfalle“ drohen würde, wenn seine Gewährleistungsrechte gegenüber seinem eigenen Lieferanten hinter den Rechten des Verbrauchers gegenüber ihm zurückbleiben94. Betroffen sind nur Kaufverträge über neue Sachen, wie Absatz I und II deutlich zum Ausdruck bringen. Dies wird damit begründet, dass bei gebrauchten Sachen der Bedarf einer Sonderregelung fehlt, da geschlossene Vertriebssysteme für gebrauchte Sachen mit der Möglichkeit eines durchgreifenden Rückgriffs in der Praxis nicht bestehen95. Die RiLi dagegen erstreckt sich ohne jeden Zweifel auch auf gebrauchte Güter96, weshalb insofern fraglich ist, ob die §§ 478, 479 BGB die Richtlinienvorgaben ausreichend umsetzen97. a. Art. 4 der Richtlinie 99/44/EG Umstritten ist, ob Art. 4 der Richtlinie eine solche Rückgriffsregelung, wie sie durch § 478 BGB normiert wurde, überhaupt fordert. Der Wortlaut ist nicht eindeutig, denn es wird lediglich angeordnet, dass der Letztverkäufer innerhalb der Lieferkette Regress nehmen kann. Dagegen wurde die Umsetzung und Ausgestaltung dem nationalen Recht überlassen. aa. eine Ansicht Teilweise wird vertreten, es müsse nur überhaupt ein98 bzw. ein irgendwie gearteter Rückgriffsanspruch99 gegeben sein, so dass die früher geltenden Vorschriften des deutschen Palandt - § 478 BGB n.F., Rn. 2 / Art. 4 der Richtlinie 1999/44/EG vom 25.5.1999 / Schubel – JZ 2001. 1113 (1116) Anwaltskommentar – § 478, Rn. 1 / Büdenbender – DStR 2002, 362 (364) / Schwab – JuS 2002, 5 (6) 94 Ernst/Gsell - ZIP 2001, 1389 (1393) / Gsell - JZ 2001, 65 (73) 95 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 3 96 Art. 1 II b, III, Art. 7 I 2 der RiLi 97 Ernst/Gsell – ZIP 2001, 1389 (1402) 98 Schmidt-Räutsch – ZIP 98, 849 (850) 99 Staudenmayer – NJW 1999, 2393 (2396) 92 93 13 Kaufrechts aus gemeinschaftrechtlicher Hinsicht ausreichten. Es hätte sich nur ein faktischer Zwang für den Gesetzgeber auch die für Kaufverträge unter Gewerbetreibenden über bewegliche Sachen geltende Verjährungsfrist nach § 477 I BGB auf 2 Jahre zu verlängern100. bb. andere Ansicht Nach einer anderen Ansicht fordert Art. 4 der Richtlinie eine solche Rückgriffsregelung, ohne aber deren Inhalt vorzugeben101. Vorgeschrieben wird lediglich, dass der Anspruchsgegner der Vertragskette angehören und, dass ihm der Sachmangel zurechenbar sein müsste102. b. § 478 I und II BGB - Regresskonzepte Absatz I und II des § 478 BGB verfolgen zwei grundsätzlich verschiedene Regresskonzepte. aa. § 478 I BGB – Modifizierung generell gültigen Kaufrechts § 478 I BGB gilt für die Fälle, in denen der Letztverkäufer die Sache wegen ihrer Mangelhaftigkeit auf Verlangen des Käufers zurücknehmen musste oder er sich einer Minderung des Käufers ausgesetzt sieht103, also nicht für alle Fälle der Inanspruchnahme von Gewährleistungsrechten des Letztverkäufers104. Diese Begrenzung hat ihren Grund darin, dass die Rechtsfolge des § 478 I BGB, den Letztverkäufer von der sonst gem. §§ 281 I, 323 I iVm 437 Nr. 2 und 3 BGB einschlägigen Nachfristsetzung freizustellen, nur bei Bestehen eines solchen Erfordernisses eingreifen kann105. Absatz I gibt allerdings keine eigenständige Anspruchsgrundlage, sondern führt den Regress des Letztverkäufers gegenüber seinem Vorlieferanten im Rahmen des Kaufvertrages und der dort angesiedelten Mängelhaftung nach §§ 437 ff. BGB durch106. (aa). Rücknahme Zur Rücknahme der mangelhaften Sache kommt es, wenn der Verbraucher sein Rücktrittsrecht nach §§ 437 Nr. 2, 323 ff. BGB ausübt, wenn ein Fall des großen Schadensersatzes nach §§ 437 Nr. 3, 280, 281 I 3 BGB vorliegt107 und, wenn er sein Wahlrecht nach § 439 I BGB zugunsten einer Neulieferung ausübt und der Verkäufer daher die mangelhafte Sache nach § 439 IV BGB zurücknimmt. Dieser letzte Fall fällt nicht in den Anwendungsbereich des § 478 I BGB, weil § 478 I und II BGB in einem Verhältnis der Exklusivität stehen und die Folgen der Nachlieferung durch den Verkäufer zu Lasten des Vorlieferanten allein unter § 478 II BGB fallen108. (bb). Minderung Die in § 478 I BGB genannte Minderung betrifft die Fälle, in denen der Verbraucher direkt nach §§ 437 Nr. 2, 441 BGB vorgeht109. Bzgl. Forderungen des kleinen Schadensersatzes aus §§ 437 Nr. 3, 280 Lehmann – JZ 2000, 280 (289) / Schmidt-Räutsch – ZIP 2000, 1639 (1639) Pick – ZIP 2001, 1173 (1176) / Ernst/Gsell – ZIP 2000, 1812 (1815) 102 Gessaphe – RIW 2001, 721 (729) 103 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 6 104 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 21 105 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 21 106 Das neue SchuldR, S. 220, Rn. 87 / Gessaphe – RIW 2001, 721 (731) 107 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 22 108 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 23 / Das neue SchuldR, S. 220, Rn. 87 109 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 28 100 101 BGB besteht eine Regelungslücke, da sie weder in Absatz I noch in Absatz II geregelt sind 110 14 . Da wirtschaftlich diese Fälle der Minderung insoweit vergleichbar sind, als der Käufer in beiden Fällen die fehlerhafte Sache behält und sich wegen der daraus resultierenden Nachteile schadlos hält, wird § 478 I BGB auf sie analog angewendet111. Der Umfang der Minderung richtet sich gem. § 441 III BGB nach dem Verhältnis Vorlieferant – Verkäufer. Daraus folgt, dass der anteilige Verlust der Handelsspanne des Verkäufers nicht zu Lasten des Vorlieferanten geht112. (cc). Einschränkungen des Anwendungsbereiches § 478 I BGB greift nur ein, wenn der Letztverkäufer zur Rücknahme der Kaufsache oder Akzeptanz der Minderung verpflichtet war113 und, wenn die Möglichkeit des Verbrauchers zurückzutreten, zu mindern oder Schadensersatz zu verlangen nicht dadurch begründet worden ist, dass der Letztverkäufer seiner Nacherfüllungspflicht in zu vertretender Weise nicht nachgekommen ist 114. Es müssen überhaupt Mängelgewährleistungsansprüche des Verkäufers gegen den Vorlieferanten bestehen. Dies entspricht im Ergebnis der Rechtslage zu § 478 II BGB115. Von § 479 I BGB betroffen sind Rücktritt, Minderung und Schadensersatz nach § 437 Nr. 2 BGB116. (dd). Rechtsfolge Rechtspolitisch wird durch § 478 I BGB der an sich auch im Verhältnis Vorlieferant – Verkäufer bestehende Vorrang der Nacherfüllung des Kaufvertrages bei Lieferung einer mangelhaften Sache (§ 439 I BGB) für die genannten Konstellationen aufgegeben. bb. § 478 II BGB – Eigenständiger Rückgriffsanspruch § 478 II BGB betrifft den Fall, dass der Letztverkäufer von einem Käufer im Wege des Nachlieferungsanspruches nach § 439 I BGB in Anspruch genommen wird. Da der Letztverkäufer gem. § 439 I BGB den hieraus resultierenden Aufwand zu tragen hat, kann er ihn nach Absatz II auf seinen Vorlieferanten verlagern117. Insoweit handelt es sich um eine eigenständige Anspruchsgrundlage im Rahmen der Regresssystematik des § 478 BGB und zwar einen verschuldensunabhängigen Aufwendungsersatzanspruch118. Hiernach besteht die Möglichkeit, dem jeweiligen Verkäufer für die Inanspruchnahme durch seinen Käufer außerhalb des Kaufvertrages mit seinem Vorlieferanten einen gesetzlichen Rückgriffsanspruch zu geben119. Rechtssystematisch lässt sich § 478 II BGB als die „Aufwertung“ der bilateralen120 Kostenzuordnungsregel des § 439 II BGB zur Anspruchsgrundlage auf entsprechende Kostenerstattung in Regressfällen verstehen121. 110 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 29 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 30 / Das neue SchuldR, S. 220, Rn. 87 112 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 36 113 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 32 / Das neue SchuldR, S. 220, Rn. 87 114 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 33 115 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 34 116 Ernst/Gsell – ZIP, 2001, 1389 (1398) 117 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 5 / Ernst/Gsell, - ZIP, 1389 (1394) 118 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 19 / Das neue SchuldR, S. 221, Rn. 89 / Pick – ZIP 2001, 1173 (1177) / Gessaphe – RIW 2001, 721 (731) 119 Ernst/Gsell – ZIP 2001, 1389 (1394) 120 zweiseitig; zwei Seiten betreffend (bei Verträgen) 111 15 (aa). Voraussetzungen Ein Aufwendungsersatzanspruch kommt nur bei Vorliegen aller Voraussetzungen einer Nachlieferungspflicht in Betracht, insbesondere muss ein Fehler bestehen. Dies ergibt sich aus der Formulierung, dass der Verkäufer die Aufwendungen „zu tragen hätte“122. Zweite Voraussetzung ist, dass eine Mängelgewährleistung auch im Verhältnis zwischen Vorlieferant und Verkäufer besteht. Diese Voraussetzung ist z.B. nicht erfüllt, wenn der Vorlieferant die Fehlerhaftigkeit gegenüber dem Verkäufer als seinem Käufer offen gelegt hat, oder wenn der Letztverkäufer in seiner Funktion als Käufer seiner Rügeobliegenheit nach § 377 HGB nicht nachgekommen ist. Diese Voraussetzung folgt aus der Funktion des § 478 II BGB als Regressnorm 123. (bb). Aufwand Aufwand bedeutet bei dem Letztverkäufer entstehender Reparaturaufwand für die Nachbesserung sowie der Aufwand für eine Ersatzlieferung, je nach dem für welche Variante sich der Verbraucher nach § 439 I BGB entscheidet. Somit unterscheidet sich dieser Aufwendungsbegriff insoweit von dem der §§ 256, 670 BGB, als in jenen Tatbeständen Aufwendungen als „freiwillige Vermögensopfer“ verstanden werden. Freiwilligkeit kann bei § 478 II BGB dagegen nicht angenommen werden; vielmehr besteht nach § 439 BGB eine Pflicht des Letztverkäufers. Abgesehen davon sind die beiden Begriffe allerdings identisch124. (cc). Verhältnis zu den §§ 437 ff. BGB ((aa)). Bindung Zwischen dem Letztverkäufer und seinem Verkäufer bestehen wiederum eigene vertragliche Bindungen, die der Letztverkäufer beachten muss, denn das Mängelgewährleistungssystem dieses Kaufvertrages wird nicht durch § 478 II BGB außer Kraft gesetzt. Beispiel: So darf der Letztverkäufer sich z.B. bei Entscheidung für Nachlieferung nach § 439 I BGB die neu zu liefernde Sache nicht einfach auf dem Markt besorgen125. Gleiches gilt, wenn er sich für Nachbesserung entscheidet und er mangels „Reparaturabteilung“ auf dem Markt einkaufen will126. ((bb)). Grenze Diese grundsätzliche Bindung des Letztverkäufers an seine vertraglichen Pflichten im Verhältnis zum Vorlieferanten findet ihre Grenze dort, wo ihre Einhaltung mit den im Verhältnis Verbraucher – Letztverkäufer gültigen Normen in Kontakt geriete. Beispiel: Dies wäre z.B. dann gegeben, wenn der Verbraucher dem Letztverkäufer eine bestimmte Frist zur Nachlieferung setzt. Der Vorlieferer (also Verkäufer des Letztverkäufers) muss die Chance haben, das ihm gegenüber dem Letztverkäufer zustehende Recht zur 2. Andienung dadurch wahrzunehmen, dass er innerhalb der Frist an den Verbraucher (Käufer des Letztverkäufers = Dritter Anwaltskommentar – § 478, Rn. 7 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 8 123 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 9 und 10 124 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 11 / Das neue SchuldR, S. 221, Rn. 89 125 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 12 / Das neue SchuldR, S. 221, Rn. 90 126 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 13 121 122 16 iSd § 276 BGB) nachbessert (er könnte auch an den Letztverkäufer nachliefern, allerdings verkürzt sich dann wiederum die Frist). Erst, wenn feststeht, dass die Wahrnehmung des Nacherfüllungsrechts des Vorlieferers nicht in dieser Frist erfolgt, entsteht ein Recht des Letztverkäufers zur Fremdbeschaffung und Kostenabwälzung auf den Vorlieferer gem. § 478 II BGB127. (dd). Konkurrenzen Neben § 478 II BGB kann ein Anspruch aus § 437 Nr. 3, 280 BGB bei schuldhafter mangelhafter Lieferung durch den Vorlieferanten bestehen, der zu dem Aufwendungsersatzanspruch des § 478 II BGB in Anspruchskonkurrenz steht und alle adäquat-kausalen Vermögenseinbußen umfasst128. c. § 478 III BGB – Beweislasterleichterung § 478 III BGB erweitert die Wirkung des § 476 BGB auf die Regresstatbestände des § 478 I und II BGB. Wobei allerdings der Fristbeginn nach § 476 mit dem Übergang der Gefahr auf den Verbraucher in dessen Verhältnis zum Letztverkäufer zu laufen beginnt 129. Problematisch stellt sich hierbei allerdings dar, dass die 6-Monats-Frist so, je nach den Umständen des Falles, auf mehrere Jahre anwachsen kann130. d. § 478 IV BGB - Einschränkungen der Vertragsfreiheit Die grundsätzlich zwischen Vorlieferant und Letztverkäufer bestehende Vertragsfreiheit wird durch § 478 IV BGB in enger Anlehnung an § 475 I BGB eingeschränkt. Die betroffenen Abweichungen von den gesetzlichen Vorgaben sind in beiden Tatbeständen identisch. § 478 IV BGB schließt solche Abweichungen zum Nachteil des Letztverkäufers von §§ 433 bis 435, 437, 439 bis 443 aus, die nicht zumindest einen gleichwertigen Ausgleich erfahren131. Allerdings ist die Voraussetzung nicht erfüllt, wenn der Ausschluss der Mangelgewährleistungsrechte und der dafür gewährte Vorteil in einem völlig unangemessenen Verhältnis stehen oder wenn die Vorteile gar nichts mit der mangelhaften Lieferung zu tun haben132. Rechtsfolge: Liegen die genannten Voraussetzungen nicht vor, wird dem Lieferanten die Berufung auf die vereinbarten Abweichungen versagt. Dies entspricht der gesetzlichen Ausgestaltung in §§ 444, 475 I BGB und bedeutet im Ergebnis nichts anderes als eine partielle Nichtigkeitsregelung, die sicherstellen soll, dass der Vertrag im Übrigen entgegen § 139 BGB wirksam bleibt 133. Gem. § 478 IV 2 BGB wird § 478 IV 1 BGB auch dann für anwendbar erklärt, wenn die dort im Ergebnis untersagte Regelung durch eine anderweitige Gestaltung umgangen wird. Problem: EG-rechtlich werfen die §§ 478, 479 BGB insofern ein Problem auf, als sie den in Satz 4 des 9. Erwägungsgrundes zur Richtlinie angesprochenen Grundsatz der Vertragsfreiheit mit dem 127 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 14 / Das neue SchuldR, S. 222, Rn. 90 Anwaltskommentar - § 478, Rn. 19 129 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 40 130 Ernst/Gsell – ZIP 2001, 13 89 (1397) / Gessaphe – RIW 2001, 721 (732) 131 Schubel – JZ 2001, 1113 (1118) / Ernst/Gsell – ZIP 2001, 1389 (1401) 132 Anwaltskommentar – § 478, RN. 43 128 17 Regelungsinhalt des § 478 IV BGB einschränken. Bei grenzüberschreitenden Lieferverträgen führen die §§ 478, 479 BGB zu folgender seltsamer Konsequenz: Im Falle der -nach Art. 6 CISG möglichen und rechtstatsächlich häufig vorgenommenen- Abbedingung des UN-Kaufrechts zugunsten des autonomen nationalen Rechts sind deutsche Vorlieferanten (weil für deren Lieferungen nach Art. 3 I EVÜ / 18 I und II EGBGB deutsches Recht gilt) durch § 478 IV BGB beschränkt wohingegen ausländische Lieferanten bei ihren Geschäften mit deutschen Letztverkäufern (hier gilt das Recht des Sitzes des ausländischen Lieferanten, Art. 3 I EVÜ / 28 I und II EGBGB) keiner solchen Bindung unterliegen134. e. § 478 V BGB - Lieferkette § 478 I bis IV BGB unter Einbeziehung des § 478 VI BGB betreffen unmittelbar das Verhältnis des Letztverkäufers zu seinem Vorlieferanten. § 478 V BGB erklärt die Regelungen bzgl. des Verhältnisses Vorlieferant/Letztverkäufer auch für alle Kaufverträge in der Lieferkette bis hin zum Produzenten für entsprechend anwendbar, wenn die jeweiligen Schuldner Unternehmer sind. Hiermit wird sicher gestellt, dass gewährte Erleichterungen für einen verbesserten Regress letztlich bis zu der Stelle führen, wo die Verursachung des Mangels erfolgt ist135. Allerdings ist für das jeweilige bilaterale Vertragsverhältnis zu prüfen, ob überhaupt eine Mängelhaftung des dort als Verkäufer fungierenden Unternehmers besteht oder ob diese nicht nach § 442 BGB oder nach § 478 VI BGB iVm § 377 HGB ausgeschlossen ist. Auch die Möglichkeiten zur Erhebung der Verjährungseinrede sind zu beachten (§§ 438, 214, 218 BGB). Im Übrigen gelten alle Beweislastregeln, also die des §§ 478 I und II, 476 (über § 478 III und V BGB) und auch die Begrenzung der Privatautonomie des § 478 IV BGB136. § 478 V BGB ist auf Fälle, in denen die Sache wegen ihrer Mangelhaftigkeit bei einem Unternehmer als Käufer „hängen bleibt“ analog anzuwenden137. f. § 478 VI BGB – Unberührtheit des § 377 HGB Gem. § 478 VI BGB bleibt § 377 HGB unberührt. Nach § 377 HGB hat der Käufer eines beiderseitigen Handelsgeschäftes die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Diese Regelung stellt nur noch einmal klar, dass der Erfolg des Verkäuferregresses gem. §§ 437 ff. BGB gegenüber seinem Vorlieferanten davon abhängt, dass dieser beim Bezug der Ware seinen handelsrechtlichen Rügepflichten (§ 377 HGB) nachgekommen ist138. Soweit die handelsrechtlichen Voraussetzungen für die Anwendung des § 377 HGB gegeben sind, ist dieser daher anzuwenden. Im Anwaltskommentar – § 478, Rn. 44 Anwaltskommentar – Art. 4 Kauf-RL – Rn. 11 135 Anwaltskommentar _ § 478, Rn. 46 / Schubel – JZ 2001, 1113 (1116) / Das neue SchuldR, S. 224, Rn. 99 136 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 47 und 48 137 Anwaltskommentar – § 478, Rn. 48 138 Das neue SchuldR, S. 222, Rn. 92 / Graf von Westphalen - DB 1999, 2553 (2553) 133 134 18 Ergebnis steht sich der Letztverkäufer durch diese Rechtslage in Regressfällen genauso, wie er behandelt wird, wenn er seine Prüf- und Rügeobliegenheit aus § 377 HGB missachtet und sich die Ware noch bei ihm befindet139. Diese den Verkäufer/Händler in seiner Funktion als Käufer einer fehlerhaften Sache treffende Rügepflicht gilt unabhängig davon, welche AGB-Klauseln im Verhältnis zwischen Verkäufer/Händler und Hersteller zur Anwendung kommen140. Zweck der Bestimmung (§ 377 HGB) ist es, die Interessen des Verkäufers zu schützen, um ihm Gelegenheit zu geben, sich über die Berechtigung einer Mängelrüge unverzüglich zu unterrichten und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen141. 2. § 479 BGB – Verjährung von Rückgriffsansprüchen a. § 479 I BGB – Verjährung bei § 478 II BGB § 479 BGB regelt die Verjährung von Rückgriffsansprüchen. § 479, BGB der in engem sachlichen Zusammenhang mit § 478 BGB steht, stellt auch in verjährungsrechtlicher Hinsicht den Regress in der gesamten Lieferkette vor dem Hintergrund der jeweils bilateral gültigen zweijährigen Verjährungsfrist sicher. Die zweijährige Verjährungsfrist beginnt jeweils erst bei Ablieferung zu laufen. Gemeint ist damit die jeweilige Übergabe der Sache in dem Lieferverhältnis, um dessen Anspruchsverjährung es geht (§ 478 V BGB). Dies entspricht der Verjährungsfrist des § 438 I Nr. 3 BGB für bewegliche Sachen142. b. § 479 II BGB – Verjährung bei §§ 437 und 478 II BGB § 479 BGB verlängert nicht die jeweilige Verjährungsfrist pauschal, sondern es hemmt § 479 II BGB deren Ablauf; auf der anderen Seite wird die „Basis-Verjährung“ nicht verkürzt. Es tritt also die Verjährung (für neue Sachen) frühestens zwei Monate nach dem Zeitpunkt ein, in dem der Unternehmer die Ansprüche des Verbrauchers erfüllt hat143. Lief zu diesem Zeitpunkt –wegen rechtzeitiger Geltendmachung der Käuferrechte- noch eine längere Restfrist für die Verjährung, gilt diese. Es handelt sich bei § 479 II BGB insoweit um eine Sonderregelung zu §§ 203 ff. BGB144. § 479 II 2 BGB legt eine Höchstfrist von 5 Jahren für die Ablaufhemmung fest, welche sich nach der Ablieferung der Sache seitens des Vorlieferanten an den Letztverkäufer bemisst145. Somit ergibt sich eine maximale Frist, innerhalb derer Ansprüche verjähren, von 7 Jahren146. 139 Das neue SchuldR, S. 223, Rn. 92 Graf von Westphalen – DB 1999, 2553 (2553) 141 Graf von Westphalen –DB 1999, 2553 (2554) 142 Anwaltskommentar – § 479, Rn. 2 143 Mansel – NJW 2002, 89 (95) 144 Anwaltskommentar - § 479, Rn. 3 / Das neue SchuldR, S. 223, Rn. 96 / Ernst/Gsell – ZIP 2001, 1389 (1399) 145 Anwaltskommentar - § 479, Rn. 4 / Das neue SchuldR, S. 224, Rn. 98 146 Reinking – DAR 2002, 21 (23) 140 19 c. § 479 III BGB - Lieferkette § 479 III BGB erweitert den Geltungsbereich der Absätze I und II auf Ansprüche des Lieferanten und der übrigen Käufer in der Lieferkette gegen die jeweiligen Verkäufer entsprechend, wenn die Schuldner Unternehmer sind. C. Fälle I. Fall147 1. Sachverhalt Privatmann K kauft vom Vertragshändler V einen Neuwagen. 2 Monate nach Übergabe fällt der Motor aus. Es kann nicht festgestellt werden, ob dieser Defekt auf einen schon bei Übergabe vorliegenden Materialfehler des Wagens oder auf unsachgemäße Benutzung durch K zurückzuführen ist. Kann K gegen V Gewährleistungsrechte geltend machen? 2. Lösung nach altem Recht K konnte unter den Voraussetzungen des § 469 BGB a.F. die Rechte des § 462 BGB a.F. geltend machen. Allerdings verlangte § 459 BGB a.F. vom Käufer den Nachweis, dass der Mangel bei Gefahrübergang vorgelegen hatte. Diese Beweislast des Käufers ergab sich aus dem Rechtsgedanken des § 363 BGB. Da K diesen Nachweis nicht erbringen konnte, konnte er gegen V keine Gewährleistungsansprüche geltend machen. 3. Lösung nach neuem Recht K könnte gegen V einen Nacherfüllungsanspruch gem. §§ 439, 437 Nr. 1, 434 I 2 Nr. 2 BGB haben. a. Mangel Die setzt einen Mangel des verkauften Wagens voraus. Da K und V weder eine besondere Beschaffenheit noch einen besonderen Vertragszweck des Wagens vereinbart haben, kommt nur ein Sachmangel nach § 434 I 2 Nr.2 BGB in Betracht. aa. Sachmangel iSd § 434 I 2 Nr. 2 BGB Ein solcher liegt vor, wenn sich die Kaufsache nicht zur gewöhnlichen Verwendung eignet. Dies ist bei Ausfalle des Motors zu bejahen. bb. maßgeblicher Zeitpunkt Abzustellen ist, wie sich aus § 434 I 1 BGB ergibt, auf den Zustand der Kaufsache bei Gefahrübergang. Hier ist ungeklärt, ob der Neuwagen bereits bei Gefahrübergang mit einem Materialfehler behaftet war. b. § 476 BGB 20 Es könnte hier gem. § 476 BGB eine 6-monatige-Beweislastumkehr zuungunsten des Verkäufers bestehen. Voraussetzung ist das Vorliegen eines Verbrauchsgüterkauf iSd § 474 I BGB. aa. K als Verbraucher Zunächst müsste K Verbraucher sein. K ist eine natürliche Person und hat den Wagen als Privatmann gekauft, somit ist er Verbraucher. bb. V als Unternehmer Außerdem müsste V Unternehmer sein. Als Kfz-Händler hat V den Vertrag mit K im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit abgeschlossen und ist somit Unternehmer. cc. Bewegliche Sache Bei dem Verkaufsgegenstand muss es sich um eine bewegliche Sache handeln, was bei einem Auto zu bejahen ist. dd. Zwischenergebnis Die §§ 474 ff BGB sind anwendbar, somit besteht grds. eine 6-monatige Beweislastumkehr zugunsten des Verbrauchers, also K. ee. § 476 2. HS BGB Die Vermutung könnte gem. § 476 2. HS ausgeschlossen sein. Das ist der Fall, wenn sie mit der Art des Mangels oder der Kaufsache nicht vereinbar ist. Hier geht es allerdings um eine normale Sachverhaltsunsicherheit. Ein Sonderfall iSd § 476 2. HS BGB liegt nicht vor. ff. Ergebnis Zugunsten des K greift hier die 6-monatige Beweislastumkehr des § 476 BGB ein. Erbringt V keinen Gegenbeweis, wird vermutet, dass der von K gekaufte Wagen schon bei Gefahrübergang mangelhaft war. c. Ergebnis K kann von V Nacherfüllung gem. §§ 439, 437 Nr. 1, 434 I 2 Nr. 2 BGB verlangen. 4. Vergleich K hat nur nach neuem Recht einen Anspruch gegenüber V. Die Lösung nach neuem Recht entspricht wesentlich mehr der Vertragsgerechtigkeit, als die nach altem Recht. Es dürfte dem privaten Käufer wesentlich schwerer fallen, zu beweisen, dass ein bestimmter Mangel schon bei Gefahrübergang vorgelegen habe, als es dem Verkäufer fallen dürfte, das Gegenteil zu beiweisen. Dem Verkäufer stehen hierbei sowohl fachliche Kenntnisse als auch die geeigneten Untersuchungsgeräte zur Verfügung, während der Käufer weder das eine noch das andere besitzt. 147 Fälle zum neuen Schuldrecht – Fall 82 21 II. Fall148 1. Sachverhalt Wie Fall 82. V nimmt den Wagen zurück und liefert K ein Ersatzmodell. V möchte wissen, ob der Hersteller H, von dem er den Wagen gekauft hat, seinerseits das defekte Exemplar gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen muss, obwohl seit dieser Übergabe schon 8 Monate vergangen sind und V den H auch nicht über die Mangelhaftigkeit des Wagens in Kenntnis gesetzt hat. 2. Lösung nach altem Recht V konnte unter den Voraussetzungen der §§ 459, 462 BGB a.F. von H Wandelung verlangen. Ebenso wie K gegenüber V (s. Fall 82) traf auch V gegenüber H die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels nach § 459 BGB a.F. bei Gefahrübergang. Da ungeklärt war, was zu dem Motorschaden geführt hat, konnte V den Nachweis nicht erbringen. Eine Berufung des V auf die Rechte der §§ 459 f. BGB a.F. schied damit von vornherein aus. Weiterhin hätte Gewährleistungsansprüchen des V auch § 337 BGB entgegengestanden. Da zwischen V und H ein beiderseitiges Handelsgeschäft iSd § 434 HGB vorlag, hätte V die Rügeobliegenheit des § 377 HGB beachten müssen, um seine Gewährleistungsrechte nicht zu verlieren. Hier ging es um einen versteckten Mangel, der nach § 377 II HGB unverzüglich nach Entdeckung angezeigt werden musste. Diese Anzeige hatte V versäumt. Schließlich wären entsprechende Gewährleistungsrechte des V gegenüber H auch nach § 447 BGB a.F. verjährt gewesen. 3. Lösung nach neuem Recht V könnte gegen H einen Anspruch auf Rückzahlung des Kaufpreises gegen Rückgabe des defekten Wagens gem. §§ 346 I, 323 I, 478 I, 437 Nr. 2 Alt.1, 434 I 2 Nr. 1 BGB haben. a. mangelhafte Ware bei Gefahrübergang an V In Betracht kommt ein Mangel gem. § 434 I 2 Nr. 1 BGB. Bei einem Kaufvertrag zwischen Hersteller und Wiederverkäufer ist die vertraglich vorausgesetzte Verwendung der Kaufsache deren Weiterverkauf. Hatte der Wagen bei Gefahrübergang tatsächlich einen Materialfehler, so eignete er sich nicht für den Weiterverkauf. Diese Frage lässt sich aber nicht mehr aufklären. b. § 478 III BGB § 478 II BGB erklärt die Regelung des § 476 BGB auch zugunsten des Letztverkäufers gegenüber seinem Lieferanten für anwendbar. Voraussetzung ist, dass es sich hier (beim letzten Verkauf in der Lieferkette – also beim Geschäft zwischen V und K) um einen Verbrauchsgüterkauf iSd §§ 474 ff. BGB handelt. Das ist hier zu Bejahen (s. Fall 82). Zusätzlich müssen die Voraussetzungen der §§ 476, 478 BGB erfüllt sein. 148 Fälle zum neuen Schuldrecht – Fall 83 22 aa. neu hergestellte Sache Es muss sich beim Kaufgegenstand gem. § 478 I BGB um eine neu hergestellte Sache handeln. Dies ist bei dem Neuwagen zu bejahen. bb. Rückgriffsanspruch des Käufers gegen den Letztverkäufer Der Unternehmer muss die Sache von dem Verbraucher als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zurücknehmen muss. Eine solche Pflicht des V ergab sich hier aus §§ 439, 437 Nr. 1, 434 I 2 Nr. 2 BGB. cc. Zwischenergebnis Die Voraussetzungen des § 478 I BGB sind erfüllt. Somit wird gem. §§ 476, 478 III BGB vermutet, dass der Neuwagen schon bei Gefahrübergang von H auf V mangelhaft war. V stehen damit die in § 437 BGB bezeichneten Rechte zu. c. Rechte aus § 437 BGB Gem. § 437 Nr. 2 1.Alt BGB kann V nach Maßgabe des § 323 I BGB vom Kaufvertrag zurücktreten. Die von § 323 BGB grds. geforderte Nachfristsetzung ist gem. § 478 I BGB innerhalb der Lieferkette entfallen. d. Rügepflicht gem. § 377 HGB Ein Rücktrittsrecht des V könnte gem. § 377 HGB ausgeschlossen sein. Gewährleistungsrechte des V scheitern (wie nach altem Recht) an § 377 HGB, da er seiner Rügepflicht nicht nachgekommen ist. 4. Vergleich V hat weder nach neuem, noch nach altem Recht einen Anspruch gegen H. Der Unterschied liegt allerdings darin, dass nach altem Recht im vorliegenden Fall nie ein solcher Anspruch bestehen könnte, während es nach neuem Recht nur an der Rüge nach § 377 HGB fehlt. Mit dieser Lösung wird sicher gestellt, dass der Mangel und die sich daraus ergebenden Folgen denjenigen in der Lieferkette treffen, der diesen zu verantworten hat. Die Rügepflicht stellt dabei allerdings klar, dass die Interessen des Verkäufers dabei insoweit geschützt sind, dass er die Gelegenheit hat, sich über die Berechtigung einer Mängelrüge unverzüglich zu unterrichten und die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen. Somit sind die Interessen beider Seiten (Letztverkäufer und Verkäufer) berücksichtigt. III. Fall149 1. Sachverhalt Wie Fall 82. V musste den Wagen nachbessern. Kann V von H Ersatz seiner Aufwendungen verlangen? 149 Fälle zum neuen Schuldrecht – Fall 84 23 2. Lösung nach altem Recht s. Fall 83 3. Lösung nach neuem Recht Ein Ersatzanspruch des V gegen H könnte sich aus § 478 II BGB ergeben. a. Verbrauchsgüterkauf Hierfür müsste zunächst ein Verbrauchsgüterkauf iSd § 474 BGB vorliegen. Dies ist zu bejahen (s. Fall 83). b. neu hergestellte Sache Weiterhin müsste es sich um eine neu hergestellte Sache handeln, was auch erfüllt ist (s. Fall 83). c. Nacherfüllungspflicht des Letztverkäufers V müsste gem. § 478 II BGB zur Nacherfüllung verpflichtet gewesen sein, was ebenfalls zu bejahen ist (s. Fall 83). d. Mangelhaftigkeit bei Gefahrübergang auf den Letztverkäufer Gem. § 478 II 1 BGB muss die betreffende Kaufsache bei Übergang der Gefahr auf den Letztverkäufer mangelhaft gewesen sein. Auch hier gilt gem. § 478 III BGB die Beweislastumkehr des § 476 BGB, womit die Voraussetzungen des § 478 II BGB erfüllt sind. e. § 377 HGB Wie im vorherigen Fall scheitert die Geltendmachung des Anspruchs an der nicht eingehaltenen Rügepflicht gem. § 377 HGB. 4. Vergleich V hat nach neuem wie nach altem Recht keinen Anspruch gegen H. BZGL: DER Vor- und Nachteile s.o. (Fall 83).