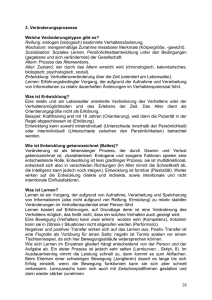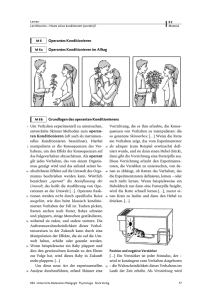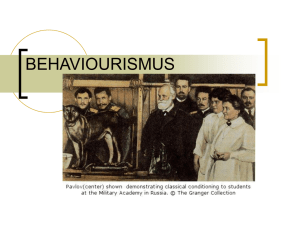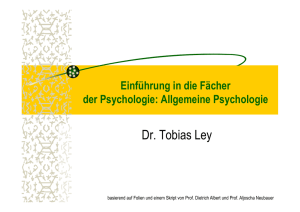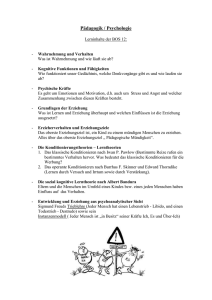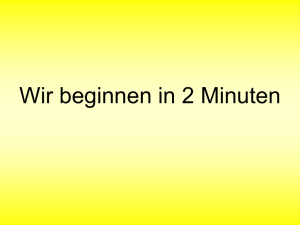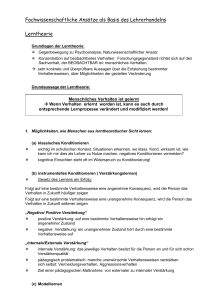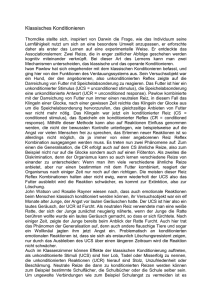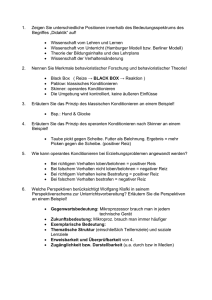SoSe 2015 Münchner Skript zum EWS-StEx Funk ▪ Bär ▪ Doll ▪ Forbrig ▪ Klampke ▪ Meier ▪ Schmidt ▪ Zehetner PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE DES LERNENS UND LEHRENS 0. INHALT 0. Inhalt ................................................................................................................................. 4 1. Grundbegriffe .................................................................................................................... 4 1.1. Psychologie ................................................................................................................ 4 1.2. Lernen aus verschiedenen Perspektiven .................................................................... 4 1.3. Die drei Hauptströmungen im Überblick ..................................................................... 6 2. Behavioristische Lerntheorien ........................................................................................... 7 2.1. Assoziatives Lernen ................................................................................................... 7 2.2. Klassisches Konditionieren......................................................................................... 8 2.3. Operantes Konditionieren ......................................................................................... 16 2.4. Erlernte Hilflosigkeit .................................................................................................. 28 3. Sozial-kognitive Lerntheorie ............................................................................................ 31 3.1. Das Bobo-Doll Experiment (Bandura, 1965)............................................................. 31 3.2. Phasen des Beobachtungslernens ........................................................................... 32 3.3. Wirkungen des Beobachtungslernens ...................................................................... 34 3.4. Modellernen und Mediengewalt ................................................................................ 35 4. Theorien des kognitiven Lernens .................................................................................... 37 4.1. Das Gedächtnis & Wissen: Überblick ....................................................................... 37 4.2. Gedächtnismodelle ................................................................................................... 40 4.3. Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens ........................................ 46 4.4. Speicherung Prozeduralen Wissens & die ACT-Theorie .......................................... 54 4.5. Wissenserwerb/ Aufbau von Wissen ........................................................................ 56 4.6. Konzeptuelle Veränderungen ................................................................................... 58 4.7. Vergessenstheorien ................................................................................................. 60 4.8. Schlussfolgerungen für den Unterricht ..................................................................... 61 5. Konstruktivistische Lerntheorien ..................................................................................... 64 5.1. Formen des Konstruktivismus .................................................................................. 64 5.2. Wissenserwerb gemäß konstruktivistischer Theorien ............................................... 64 5.3. Implikationen für den Unterricht ................................................................................ 65 6. Selbstgesteuertes Lernen ............................................................................................... 66 6.1. Steuerung des eigenen Lernens .............................................................................. 66 6.2. Theorien des Selbstgesteuerten Lernens ................................................................. 67 6.3. Förderung von Selbstreguliertem Lernen ................................................................. 69 7. Problemlösung, Transfer & Expertensettings .................................................................. 73 7.1. Problemlösen ........................................................................................................... 73 7.2. Ergebnisse der Experten-Novizen-Forschung .......................................................... 77 7.3. Transfer .................................................................................................................... 78 8. Gedächtnis- und Lernhilfen, Lernstrategien .................................................................... 80 8.1. Unterscheidung von Lernstrategien .......................................................................... 80 8.2. Beispiele für Lernstrategien ...................................................................................... 82 8.3. Metakognition ........................................................................................................... 85 8.4. Förderung im Unterricht............................................................................................ 86 8.5. Gute und schlechte Strategienutzer ......................................................................... 87 8.6. Empirie zu Metakognition und Lernstrategien........................................................... 87 9. Unterrichtsqualität ........................................................................................................... 88 9.1. Unterrichtsmodelle und Forschungsrichtungen ........................................................ 88 9.2. Die Qualitätsmerkmale nach Helmke ....................................................................... 89 9.3. Lehrermerkmale ....................................................................................................... 93 9.4. Aptitude-Treatment-Interaction (ATI) ........................................................................ 95 9.5. Exkurs: Hausaufgaben und ihre Relevanz für Lernen .............................................. 95 10. Lehrstrategien ............................................................................................................... 97 10.1. Darstellende Methoden .......................................................................................... 97 10.2. Problemorientiert-entdeckendes Lernen ................................................................. 99 10.3. Kooperatives Lernen ............................................................................................ 104 Anhang ............................................................................................................................. 106 A1 Exkurs: Umgang mit ADHS ...................................................................................... 106 A2 Überblick über die Hattie-Studie 2009...................................................................... 106 4 1.1 Psychologie 1. GRUNDBEGRIFFE 1.1. Psychologie Definition (Pongratz, 1967): Psychologie ist die Erfahrungswissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Psychologie ist eine empirische Wissenschaft: Erkenntnisgewinn durch Untersuchungen, Befragungen, Experimente, Tests etc. Beschreibung psychotischer Sachverhalte, wie Motivation, Kognition (Vorgänge, um Kenntnis von seiner Umwelt zu erlangen = Denken, Wahrnehmung, Gedächtnis und Sprache ), Lernen, Wahrnehmung, etc. Definition (Fischer, 1917): Der Gegenstand der pädagogischen Psychologie ist Erziehung, die Erforschung von Erziehung aus der Perspektive und mit den Mitteln der Psychologie. 1.2. Lernen aus verschiedenen Perspektiven Eine Definition, die alle Aspekte des Lernens umfasst, ist nicht bekannt. Definition (Edelmann, 2000) Lernen lässt sich kennzeichnen als jede Verhaltensänderung, die durch Übung oder Beobachtung entstanden ist (Erwerb motorischer und sprachlicher Fertigkeiten). Informationsaufnahme und -Verarbeitung (Wissenserwerb). Vorgänge, bei denen die Person Ziele und Mittel zur Erreichung der Ziele willentlich und verantwortlich auswählt (zielgerichtetes Denken). Definition (Zimbardo, 2008): Lernen ist ein Prozess, der in einer relativ konsistenten Änderung des Verhaltens oder im Verhaltenspotentials resultiert und auf Erfahrung aufbaut. […] Lernen ist nicht direkt zu beobachten, es muss aus der Leistung, also dessen Ausdruck im beobachtbaren Verhalten, erschlossen werden. Lernen kann somit als relativ überdauernde Verhaltensveränderung aufgrund von Erfahrungen betrachtet werden, welche sich das Individuum meist durch eigenständige häufig wiederholte Aktivitäten erarbeitet hat. Lehren und Lernen stehen in unmittelbarem Zusammenhang. Man kann keinen der beiden Prozesse einzeln für sich behandeln! Verschiedenen Arten des Wissenserwerbs Intentionelles Lernen: absichtlich, zielgerichtet Inzidentielles Lernen: beiläufig, häufig effektiver, unbewusst, manchmal unerwünscht! Lernen aus traditionell behavioristischer Sicht Definition: (Skinner, 1953) [Lernen aus behavioristischer Sicht] Lernen ist eine dauerhafte Veränderung beobachtbaren Verhaltens als Ergebnis von Erfahrungen 1.2 Lernen aus verschiedenen Perspektiven Beschränkung auf beobachtbare Dinge und Verzicht auf Interpretation und Inanspruchnahme innerer Prozesse → Traditioneller Behaviorismus Auslöser einer Verhaltensweise/ Reaktion ist ein Reiz/ Stimulus → Lernender ist reaktiv bzw. passiv, d.h. „unter der Kontrolle der Umwelt“ Unterricht: viel Drill und mechanische Übungen mit dem Ziel, die Anzahl der richtigen Reaktionen/Verhaltensweisen zu erhöhen. Übergang zu kognitiven Theorie: Sozial-kognitive Lerntheorie Begründer: Alfred Bandura Grundlage bildet das Bobo-Doll-Experiment, das beweist, dass Verhalten auch an Modellen (also in sozialen Kontexten) erlernt wird Unter anderem Fokus auf Aufmerksamkeits-Prozess → Übergang zur Betrachtung psychologischer Prozesse im „Inneren“ Kognitive Wende: Lernen als Wissenserwerb (Kognitivismus) Definition (Lukesch, 1998) [aus kognitiv-behavioristischer Sicht]: Lernen im Sinne des Wissenserwerbs ist ein bereichsspezifischer, komplexer und mehrstufiger Prozess, der die Teilprozesse des Verstehens, Speicherns und Abrufens einschließt und unter der Voraussetzung, dass die drei genannten Prozesse erfolgreich verlaufen auch zum Gebrauch (Transfer) des erworbenen Wissens führen kann. „kognitiver Behaviorismus“: Psychologen erkannten in den 50- und 60er Jahren die Ähnlichkeit zwischen Rechnern und Lernen als Informationsverarbeitung Lernen: relativ überdauernde Veränderungen des Wissens als Folge von Erfahrungen Wissen ist objektiv und unabhängig vom individuell Lernenden Zunehmende Aktivität des Lernenden, mehr Selbstkontrolle, Beobachtung und Kontrolle eigener kognitiver Prozesse → komplexere Lernformen Lernen ist der Prozess, durch den deklaratives und prozedurales Wissen über die Welt sowohl aufgrund externer Anregungen wie auch durch die Eigenaktivität des Lernens entsteht oder verändert wird. Wissenselemente sind im Gedächtnis gespeicherte und wieder abrufbare Informationen. Lernen ohne die Fähigkeit der gedächtnismäßigen Speicherung ist unmöglich! Lernen aus konstruktivistischer Sicht Wissen wird von jedem Schüler selbst aufgebaut Lernen von kritischem Denken, Lösung komplexer Probleme, Entwicklung von Strategien, Fähigkeit und Motivation, das ganze Leben lang selbstständig zu lernen (Lin 1996), Wissen existiert nicht außerhalb des Lernenden ( Konstruktion /Interpretation nötig) 5 1.3 Die drei Hauptströmungen im Überblick LERNEN ALS INFORMATIONSVERARBEITUNG LERNEN AUS KONSTRUKTIVISTISCHER SICHT Skinner Anderson Piaget / Wygotski WISSEN Bestimmter Fundus wird erworben; Anreize von außen Bestimmter Fundus wird erworben; Anreize von außen; Art des Lernens durch Vorwissen bestimmt Wissen wird individuell oder sozial konstruiert Grundlage: Voraussetzungen des Lerners oder der Umgebung LERNEN Erwerb von Wissen, Tatsachen durch mechanischen Üben Erwerb von Fakten, Strategien und Fertigkeiten aktive oder kooperative Konstruktion Transmission Anleitung von Schülern zu vollständigem Wissen Herausforderung zu vollständigem Wissen / KoKonstruktion mit Schülern LEHRERROLLE Manager, führt Aufsicht und korrigiert Vermittlung und Vorführung effektiver Strategien und Korrektur Erleichterung und Anleitung mit Rücksicht auf individuelle Vorstellungen und Anhören der entstandenen Konzeptionen Nicht einbezogen Nicht nötig, können Verarbeitung beeinflussen Teil des Lernprozesses (bzw. regen Denken an) Passive Aufnahme und Befolger von Anweisungen Aktiver Verarbeiter, Strategienutzer und Organisator von Informationen Aktiver Denker, Erklärer, Deuter, Frager und soziale Teilnahme LEHRE LERNEN ALS VERHALTENSÄNDERUNG PEERS 1.3. Die drei Hauptströmungen im Überblick LERNER -ROLLE 6 Nach Woolfolk, 2008 (adaptiert) 2.1 Assoziatives Lernen 2. BEHAVIORISTISCHE LERNTHEORIEN Definition (Zimbardo, 2008): Behaviorismus ist ein wissenschaftlicher Ansatz, der das Feld der Psychologie auf messbares, beobachtbares Verhalten reduziert. Aus behavioristischer Perspektive interessiert damit nur objektiv bestimmbares Verhalten und dessen Beziehungen zu Umweltstimuli. Als Begründer des Behaviorismus gilt Watson (1878-1958): "… a purely objective experimental branch of natural science" (Watson, 1913) „Bewusstseinszustände sind nicht objektiv verifizierbar, und aus diesem Grund können daraus nie wissenschaftliche Daten werden“ (Watson, 1913) → Blackbox: Mensch hat keinen freien Willen; bestimmter Reiz führt zu Verhalten → Ansatz, der auf beobachtbarem Verhalten beruht Der Behaviorismus ist eine Richtung der objektiven Psychologie: Die Lehre vom Verhalten, von Handlungen und Reaktionen. Behaviorismus konzentriert sich alleine auf nach außen erkennbare Verhaltensweisen/ Handlungen/ Reaktionen und ignoriert dabei nach innen gerichteten Reaktionen. Einfluss behavioristischer Lernforschung auf den Unterricht: Hauptaufgabe der Lehrer sind Veränderungen von beobachtbarem Verhalten → Konzentration auf verhaltensorientierte Lehrziele Beachtung des unterschiedlichen Zeitbedarfs der Schülern Unterscheidung zwischen aktiver und passiver Beteiligung im Unterricht → Ziel aus behavioristischer Sicht: möglichst hohes Maß an Aktivität Angemessene Verhaltenskonsequenzen einhalten (Lehrerlob/ Tadel) Behavioristische Lerntheorien Klassisches Konditionieren Pawlow Operantes Konditionieren Skinner 2.1. Assoziatives Lernen „Lernen lässt sich durch Bildung von Assoziationen erklären. Der Menschliche Geist verknüpft Ereignisse, die in enger zeitlicher Abfolge auftreten.“ (Aristoteles) Assoziatives Lernen: Jede Reaktion (Response, R), die mit einem Reiz (Stimulus, S) wiederholt in Kontiguität stand, wird auch in Zukunft durch diesen Reiz ausgelöst. 7 8 2.2 Klassisches Konditionieren Kontiguität meint direkte zeitliche Nachbarschaft (Grundlage für S-R-Theorien von Thorndike, Hull, Guthrie) → zwei Reize werden assoziiert, wenn sie oft zusammen vorkommen → kommt später nur eines der beiden Ereignisse vor (Reiz oder Stimulus), wird das andere auch erinnert (Reaktion) Klassisches und operantes Konditionieren sind zwei spezielle Formen des assoziativen Lernens. 2.2. Klassisches Konditionieren Vertreter: Iwan Petrovic Pawlow (1849-1936) Klassisches Konditionieren ist eine Art des Lernens, bei der Verhalten (konditionierte Reaktion, CR) durch einen Stimulus (konditionierter Stimulus, CS) hervorgerufen wird, welcher seine Wirkung durch die Assoziation mit einem biologisch bedeutsamen Stimulus (unkonditionierter Stimulus, UCS) erlangte. NS: Neutraler Stimulus Reiz, der keine bestimmte Reaktion hervorruft (außer evtl. Aufmerksamkeit) UCS: Unkonditionierter Stimulus Reiz, der auf natürlichem Weg eine bestimmte Reaktion hervorruft UCR: Unkonditionierte Reaktion (Response) Nicht gelernte, biologisch vorgeformte Reaktion, durch einen US hervorgerufen CS: Konditionierter Stimulus Ursprünglich neutraler Reiz, der durch kontingentes Auftreten mit einem US die (annähernd) gleiche Reaktion hervorruft wie US CR: Konditionierte Reaktion (Response) Reaktion, durch einen CS hervorgerufen (CR ≠ UR) 2.2.1. Klassisches Konditionieren - Überblick Die Natur gibt uns eine Assoziation UCS - UCR vor, klassisches Konditionieren produziert hingegen eine Assoziation CS - CR. Das funktioniert folgendermaßen: Ein NS wird wiederholt mit dem UCS gepaart. Nach einigen Wiederholungen folgt der UCR (jetzt CR) vorhersagbar dem NS (jetzt CS). Vor der Konditionierung Nach der Konditionierung UCS → UCR UCS → UCR NS → keine Reaktion CS →CR Motivation und Einsicht spielen beim klassischen Konditionieren keine Rolle. Beim klassischen Konditionieren wird keine neue Reaktion gelernt, es entsteht lediglich eine neue Reiz-Reaktions-Verbindung! 2.2 Klassisches Konditionieren 2.2.2. Der Pawlowsche Hund Nach dem Experiment des Physiologen Iwan Pawlow (1849-1936) lässt sich das oben beschriebene Prinzip des klassischen Konditionierens bei einem Hund zeigen. Phasen des Klassischen Konditionierens 1.Kontrollphase (vor dem Versuch) / Vor-Konditionierungsphase: Futter (UCS) Glockenton (NS) → → Speichelfluss (UCR) kein Speichelfluss 2.Erwerbsphase (während des Versuchs) / Konditionierungsphase: Paarung von NS und UCS → UCR 3.Nachkonditionierungsphase: Glockenton (CS) → Speichelfluss (CR) Nach der Konditionierung setzte der Speichelfluss schon beim Glockenton ein. Nach Verbindung des UCS mit dem NS folgt tatsächlich eine konditionierte Reaktion (CR) auf den Glockenton (dann CS). Beim klassischen Konditionieren ist das Timing entscheidend. CS und UCS müssen zeitlich eng beieinander liegen (Kontiguität: zeitlich-räumliches gemeinsames Auftreten der Reize), damit der Organismus sie als zeitlich verbunden wahrnimmt ( Grundlage des Lernprozesses). Beispiel: Das Verteilen von Redbull-Proben bei Surf-, Skateboard-, MTB-, Freeride-Turnieren schafft eine Verbindung zwischen der Produktmarke und den abenteuerlichen Erlebnissen 2.2.3. Die Phasen des Konditionierens genauer betrachtet Phase 1: Kontrolle und Voraussetzungen UCS → UCR (folgt auf UCS wirklich UCR?) NS → wirklich neutrale Reaktion? 9 10 2.2 Klassisches Konditionieren Phase 2: Konditionierung NS + UCS → UC CS → CR Phase 3: Extinktion CR wird schwächer, wenn CS alleine auftritt (ohne UCS) schwieriger als Konditionierung Ängste sehr löschungswiderstandsfähig (meist nur mit Gegenkonditionierung) Phase 4: Spontanerholung (= Remission) gelöschte Reaktion tritt nach Ruhephase wieder schwach auf, wenn CS alleine dargeboten wurde Phase 5: Ersparnis bei erneutem Konditionieren nach erfolgreicher Löschung gewinnt CR schneller an Stärke als ursprünglich Einflussfaktoren auf die klassische Konditionierung: Unabhängige Variablen Abhängige Variablen Anzahl der Durchgänge Stärke der Reaktion Intensität und Qualität des/der Reize Zeitdauer der Darbietung CS und CR Zeitlicher Abstand zwischen CS und UCS Verlauf des Konditionierungsprozesses Resistenz gegenüber Lösungen Weitere Einflüsse auf das klassische Konditionieren in der Erwerbsphase: Kontingenz (Vorhersagbarkeit des Auftretens des UCS auf den CS) Nach Versuchen von Rescorla (1988) reicht die Kontiguität alleine nicht aus. Der CS (Ton) muss zudem zuverlässig das Auftreten des UCS (Futter) voraussagen (Kontingenz), damit klassisches Konditionieren stattfindet. Informativität (deutliches Abheben des CS von der restlichen Umgebung) Nach Versuchen von Kamin (1969) mit Ratten erfolgt eine Konditionierung dann am schnellsten, wenn der CS sich deutlich von anderen in der Umgebung vorhandenen Reizen hervorhebt. Fazit: Klassisches Konditionieren ist komplexer als Pawlow angenommen hatte: Ein NS wird nur dann ein effektiver CS, wenn er kontingent und informativ ist. 2.2.4. Weitere Konditionierungsprozesse Reizgeneralisierung = die automatische Erweiterung konditionierten Verhaltens auf ähnliche Stimuli, die niemals mit dem unkonditionierten Stimulus gepaart wurden. 2.2 Klassisches Konditionieren Je ähnlicher der Reiz dem ursprünglichen CS ist, desto stärker die Reaktion ( Generalisierungsgradient) Generalisierung ist in der Natur eine Art Sicherheitspolster: neue aber vergleichbare Ereignisse bekommen dieselbe Bedeutung → gleiche Reaktion Beispiel: Ein Raubtier gibt einen anderen, aber ähnlichen Laut von sich → das Beutetier erkennt die Gefahr und reagiert entsprechend! Reizdiskrimination Ein Konditionierungsprozess, bei dem der Organismus lernt, unterschiedlich auf Reize zu reagieren, die sich von dem CS entlang einer Dimension (z.B. Unterschiede in Farbton oder Tonhöhe) unterscheiden. Beispiel: Eine Maus läuft nur vor der grauen Katze, nicht aber vor der braunen Katze weg. Diskrimination: Nur auf exakt diesen CS wird eine CR ausgelöst Schärfung der Diskriminationsfähigkeit durch Diskriminationstraining: Schaffung von Erfahrungen, bei denen nur einer dieser Töne mit dem UCS auftritt, während die anderen wiederholt ohne den UCS dargeboten werden. Konditionierung höherer Ordnung CS wird mit einem neuen NS verknüpft, um auf den NS eine CR auszubilden. Durch Konditionierung hat der CS einiges von der Macht des biologisch bedeutsamen UCS übernommen (da er nun die Reaktion CR auslösen kann) CS ist in gewissem Sinne zum Stellvertreter des US geworden. Glockenton (CS) Speichelfluss (CR) Nun können konditionierte Reize eingesetzt werden, um einen weiteren Reiz zur Auslösung der gleichen Reaktion zu konditionierten. Hinzufügen eines NS (Licht): Glockenton (CS) + Licht (NS) Speichelfluss (CR) Licht (CS1) Speichelfluss (CR) 11 12 2.2 Klassisches Konditionieren Assoziative Konditionierung Späterer CS1 und CS2 werden nur vor dem Aufbau einer Konditionierung miteinander gekoppelt. (↔ Konditionierung höherer Ordnung: Zuerst wird Konditionierung aufgebaut, dann Stimuli miteinander gekoppelt) Beträchtliche Erweiterung des Bereichs der klassischen Konditionierung: Nicht mehr daran gebunden, dass ein biologisch relevanter Reiz auftritt Verhaltensreaktionen sind durch ein unbegrenztes Repertoire von Reizen kontrollierbar Konditionieren umfasst nicht nur die Entwicklung einer Verhaltensreaktion, sondern auch Assoziationen zwischen Reizereignissen, die als Signale von Lust und Schmerz neu bewertet werden. Wichtiger Prozess für das Verständnis vieler Arten komplexen menschlichen Verhaltens! 2.2.5. Anwendungsbereiche des Klassischen Konditionierens Viele unserer Einstellungen und Emotionen sind durch Konditionierungsprozesse, die außerhalb unseres Bewusstseins stattfinden oder stattgefunden haben, entstanden. Konditionierte Furcht Versuch nach Watson & Rayner (1920): „Der kleine Albert“ (11 Monate alt) Ziel: Nachweis, dass viele Furchtreaktionen als eine Paarung aus einem NS mit etwas natürlich Furchtauslösendem verstanden werden können. Frage: Ob bzw. welche angeborenen Reiz-Reaktionsverbindungen beim Kleinkind auf dem emotionalen Gebiet vorhanden sind und ob diese im Entwicklungsverlauf durch Lernvorgänge auf Basis konditionierter Reflexe erweitert werden. Methode: Kopplung der bestehenden Reiz-Reaktionsverbindung (Gongschlag - Angst) mit einem neutralen Stimulus (Ratte): Ergebnis: Nach wiederholter Kopplung zeigte Albert auf den Reiz "Ratte" die konditionierte Reaktion Angst. 2.2 Klassisches Konditionieren Vor dem Versuch (Kontrollphase): Lautes Geräusch (UCS) Ratte (NS) Weinen (UCR) Freude/ Interesse (OR*) *Orientierungsreaktion Erwerbsphase: Lautes Geräusch (UCS) + Ratte (NS) Weinen (UCR) Nach mehrfachen Wiederholungen: Ratte (CS) Weinen (CR) Es kann sogar zur Reizgeneralisierung kommen: Grauer Bart ähnelt dem CS Weinendes Kind Konditionierte Furchtreaktionen könne über Jahre hinweg anhalten, auch wenn der ursprüngliche furchteinflößende UCS nie wieder Auftritt. → Kann folglich nur sehr schwer wieder gelöscht werden. Ist intensive Angst beteiligt, dann kann es sogar nach nur einmaliger Koppelung des NS mit UCS zur Konditionierung kommen (z.B. Autounfall bei Regen Panik bei Regen im Auto). Behandlungstechniken für Patienten mit Angst- und Furchtstörungen: Gegenkonditionierung nach Jones (1924): Der kleine Peter Peter (3 J.) hat Angst vor Kaninchen; Behandlung: Gegenkonditionierung mit Süßigkeiten Gebäck (UCS) angeboten angenehme Reaktion (UCR) gleichzeitig Kaninchen (CS) Furcht (CR), aber nur in Ecke des Raumes Folgende Tage: immer wenn Peter Gebäck aß, Kaninchen etwas näher zu ihm Freude an Keksen ersetzte Angst vor Kaninchen Systematische Desensibilisierung nach Wolpe (1958) Ausgangspunkt: Bestimmte Reaktionen sind unvereinbar Mensch kann sich nicht im Zustand der Entspannung befinden und zugleich Furchterlebnisse empfinden. 13 14 2.2 Klassisches Konditionieren Methode: Menschen durch geeignete Übungen zur völligen Entspannung bringen und in diesem Zustand mit dem furchtauslösenden Reiz konfrontieren Überwindung der Furcht a) Erstellung einer Angsthierarchie von der am wenigsten bis zur am stärksten furchteinflößenden Situation b) Erlernen einer Entspannungstechnik c) Durcharbeiten der Angsthierarchie auf rein mentaler Ebene; dabei Einsatz von Entspannungstechniken (wenn Angstgefühl einsetzt) d) Durcharbeiten der Angsthierarchie auf realer Ebene Schulangst Klassenzimmer bietet viele Möglichkeiten für Schüler, Assoziationen zwischen bestimmten Ereignissen und emotionalen Reaktionen entstehen zu lassen: 1) 2) 3) 4) Lehrer Unterrichtsfach Unterrichtsmaterialien Schule als Institution Diese NS erlebt der Schüler häufig mit Maßnahmen wie Lob und Tadel, die bei ihm Stolz, Freude oder Unzufriedenheit auslösen → bei mehrfacher Wiederholung werden NS zu CS Erklärung für Schulangst: Angst vor Lehrperson (Klassisches Konditionieren) Nachdem durch klassisches Konditionieren Angst vor dem Lehrer entstanden ist, kann sich diese Angst durch weitere Konditionierung auf Schulfächer und andere Lehrer übertragen. 2.2 Klassisches Konditionieren Übertragung der Schulangst auf Fächer (= Konditionierung höherer Ordnung) Übertragung der Schulangst auf andere Lehrer/-innen (Generalisierung) Prüfungsangst Prüfungsangst: sich mit Schwierigkeiten zu beschäftigen bevor man diese hat. Zwei-Komponenten-Theorie der Prüfungsangst Worry (Sorgengedanken) Kognitiv: Fähigkeiten für die Bewältigung der Prüfung als nicht ausreichend betrachtet Leistungshinderlich: Teil des Abreitsgedächtnisses für Sorgengedanken verbraucht Emotionality (Aufgeregtheit) Subjektiv wahrgenommene und interpretierte physiologische Reaktionen, wie z.B. erhöhter Herzschlag Verhalten: wenig effiziente Prüfungsvorbereitung Vermeidung, Fluchtverhalten (Aufschieben von Lernverhalten) 15 16 2.3 Operantes Konditionieren Prävention von und Maßnahmen gegen Schulangst Maßnahmen im Unterricht: Lehrer sollte das Klassenzimmer stets mit positiven Gefühlen verbinden Positives Klassenklima Schüler dürfen Misserfolge nicht auf Schule allgemein, sondern nur auf konkrete Aufgabenstellungen beziehen Behandlungstechnik bei Schul-/ Prüfungsangst:(analog: system. Desensibilisierung) 1. Hierarchie von Angstauslösern aufschreiben: schwächste als 1. 2. Schüler soll sich völlig entspannen, und dann jeden Punkt durchgehen/vorstellen, bis er keine Angst mehr hat 3. Pausen mit Entspannungsübungen zwischen jeder Stufe 2.3. Operantes Konditionieren Operantes (instrumentelles) Konditionieren = Lernen durch Konsequenzen von Verhalten. Operantes Konditionieren ist eine Lernform, bei der die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Wirkverhaltens unter bestimmten Zuständen ab- bzw. zunimmt. (Verhalten steht in Verbindung mit Ereignissen, die ihm nachfolgen.) Operant: jedes Verhalten, das von einem Organismus gezeigt wird und anhand seiner beobachtbaren Effekte auf die Umwelt des Organismus beschrieben werden kann. (wörtlich: Operant = die Umwelt beeinflussend) → Instrumentelle Konditionierung: Eine Aktivität ist ein Mittel /Instrument zur Erreichung einer bestimmten Konsequenz 2.3.1. Operantes Konditionieren - Überblick Versuch nach Thorndike (1898): Instrumentelles Konditionieren Beobachtung von Katzen, die versuchten, sich aus der sogenannten „Puzzlebox“ zu befreien. Hungrige Katze wurde in einen Käfig gesperrt, vor dem Futter stand Durch einen Tritt auf eine Taste konnte das Versuchstier die Tür öffnen und somit an das Futter gelangen Katze zeigte zuerst spontane Verhaltensweisen, um sich zu befreien (z.B. Kratzen an den Gitterstäben) → trial & error (Lernen durch Versuch und Irrtum) Zufälliger Tritt auf die Taste → Tür öffnet sich → Katze gelangt an das Futter Unmittelbar vorausgehendes (zufälliges) Verhalten wird verstärkt → law of effect (Effektgesetz, Thorndike 1898): Die Kraft eines Stimulus, eine Reaktion hervorzurufen, wird verstärkt, wenn der Reaktion eine Belohnung folgt, und geschwächt, wenn keine Belohnung folgt Konsequenzen als entscheidende Determinante des Verhaltens 2.3 Operantes Konditionieren 17 Law of Effect (Effektgesetz) Reaktion (Verhalten) → befriedigende Konsequenz Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Reaktion steigt. Reaktion → nicht befriedigende Konsequenz Auftretenswahrscheinlichkeit dieser Reaktion sinkt. Ergebnis: Lernen ist keine Assoziation zwischen zwei Reizen, sondern zwischen Reizen (Stimuli) und einer Reaktion (R), gelernt wird durch eine S-R-Verbindung. Verhaltensweise wird so zum Instrument, eine angenehme Konsequenz herbeizuführen und eine unangenehme zu vermeiden Instrumentelles Konditionieren Versuch nach Skinner (1909-1990): Skinner Box Der Lernpsychologe Burrhus Frederic Skinner setzte sich mit den Arbeiten Thorndikes auseinander. Seine grundlegende Frage war jedoch nicht wie bei Thorndike, unter welchen Bedingungen sich das Verhalten verändern lässt, sondern wie sich das Verhalten durch vorausgegangene Reize unter Kontrolle bringen lassen kann. Skinner-Box (1930) ist ein Beispiel für operantes Konditionieren: Futterpille für die Ratte nach Drücken des Hebels keinen Einfluss jedoch auf den Zeitpunkt des Drückens Zusätzliche vorausgehende Reizbedingung (= diskriminativer Reiz, z.B. Lichtquelle) Ratte erhält nur Futter (S+) wenn die Lichtquelle (S) eingeschaltet ist Tier lernt somit den Hebel nur zu drücken, wenn das Licht angeschaltet ist Lernen durch Konsequenzen; Das Verhalten (R) ist durch vorangehenden Reiz kontrollierbar 18 2.3 Operantes Konditionieren Schema: Vorausgehender Reiz S (Licht an) → Verhalten R (Hebel drücken) → Nachfolgendes ReizErlebnis S+ (Futter) Diskriminativer Reiz: Die Reize, die einer Situation vorangehen, erlangen durch Assoziation mit Verstärkung oder Bestrafung die Funktion, das Verhalten festzulegen. Organismen lernen, dass ihr Verhalten bei manchen Reizgegebenheiten, nicht jedoch bei anderen eine bestimmte Wirkung (Verstärkung/Bestrafung) hat. Beispiele: Andere Reaktion bei roter als bei grüner Ampel Kind soll bim Unterricht ruhig sitzen, darf aber in den Pausen laut und rege sein Unter Laborbedingungen kann bei Vorliegen diskriminativer Reize durch die Manipulation der Verhaltenskonsequenzen das Verhalten eines Organismus weitgehend kontrolliert werden. Beispiel: Tauben können Körner nach dem Picken auf eine Scheibe nur gegeben werden, wenn grünes Licht scheint, und nicht bei rotem. grünes Licht = diskriminativer Hinweisreiz Ein Reiz, der Verstärkung signalisiert, wird als positiver diskriminativer Reiz (𝑆 𝐷 ) bezeichnet. Der Reiz, der keine Verstärkung signalisiert, wird als negativer diskriminativer Reiz (𝑆 𝛿 ) bezeichnet Beispiel: Taube Grünes Licht = 𝑆 𝐷 , rotes Licht = 𝑆 𝛿 Generalisierung: Die Verhaltensweise, die ein Organismus als Reaktion auf diskriminatorische Reize zeigt, wird auf andere Reize, die dem diskriminativen Reiz ähneln, generalisiert. 2.3.2. Grundprinzipien des Operanten Konditionierens Voraussetzungen für operantes Konditionieren - also dafür, dass man eine Reaktion über einen diskriminativen Reiz und der Konsequenz auf die Reaktion kontrollieren kann – sind, wie beim klassischen Konditionieren: Kontiguität (zeitliche und räumliche Nachbarschaft S-R-S+) Beispiel: betätigen des Hebels bei Licht zuverlässige Gabe von Futter Kontingenz (Zuverlässige Beziehung zwischen Reaktion und Konsequenz) Informativität (Abheben des diskriminativen Reizes vom Rest der Umwelt) 2.3.3. Reaktions-Konsequenz-Konstellation Prinzip der Verstärkung & Bestrafung Verstärkung Gabe eines Verstärkers in der Folge einer Reaktion → Auftretenswahrscheinlichkeit der Reaktion wird erhöht 2.3 Operantes Konditionieren z.B. soziale Belohnung (Lob), konkrete Belohnung (Preis), Befreiungsbelohnung (keine Hausaufgaben) Bestrafung Bestrafungsreiz in der Folge einer Reaktion → Auftretenswahrscheinlichkeit der Reaktion wird gesenkt z.B. Verlust von Privilegien, Strafarbeit Darbietung/positiv Angenehme Konsequenz z.B. Zuneigung, Fernsehen Unangenehme Konsequenz z.B. Ohrfeige, Verweis Keine Konsequenz Entzug/negativ Positive Verstärkung Bestrafung Typ 2 Darbietung eines angenehmen Reizes z.B. Futter, Lob, Geld Entzug eines angenehmen Reizes z.B. Fernsehverbot Bestrafung Typ 1 Negative Verstärkung Darbietung eines unangenehmen Reizes z.B. Bußgeld Entzug eines negativen Reizes z.B. Hausaufgaben weg Löschung Löschung Achtung: „positiv“ (hier: hinzugeben) bzw. „negativ“ (hier: wegnehmen) sind in diesem Zusammenhang nicht wertend! Ein Reiz ist dann aversiv, wenn Organismen auf diesen mit Flucht bzw. Vermeidung reagieren! Positive und negative Verstärker haben dieselbe Wirkung, beide erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer operanten Verhaltensweise! Bestrafungen sind allerdings häufig nicht effektiv: Bedingungen des instrumentellen Lernens müssten alle Beachtung finden Das Verhalten wird meist nur unterdrückt, tritt dann wieder auf, wenn die Strafandrohung ausbleibt. Bei übermäßigem Einsatz von aversiven Reizen im Klassenzimmer können unerwünschte Nebeneffekte auftreten, die das Lernen behindern, wie beispielsweise Angst oder Aggressivität: Strafreize sind nur wirksam, wenn… …die unerwünschte Verhaltensweise nicht besonders stabil etabliert ist und keine besonders starke Motivation zu ihrer Ausführung besteht …der Strafreiz möglichst sofort, möglichst stark und mindestens am Anfang immer dargeboten wird …ein alternatives Verhalten angeboten werden kann, das dann positiv verstärkt wird Ausnahme: Informative Strafstimuli bei intellektuellen Tätigkeiten (Kritik, Korrekturen) können sehr wirksam sein, wenn sie in einer sonst unterstützenden und wertschätzenden Atmosphäre geschehen. 19 20 2.3 Operantes Konditionieren Diskriminative Reize in der Schule Man will die Wahrscheinlichkeit einer Reaktion nicht für alle Umstände ändern (Generalisierung), vielmehr will man sie nur in einem bestimmten Kontext ändern. Schule: Jede Frage/Aufforderung im Unterricht, die eine Antwort nach sich zieht, besitzt die Funktion eines diskriminativen Reizes. (wenn alle Schüler dieser Aufforderung nachkommen) Gründe für das Ignorieren einer Frage durch die Klasse Lehrer hat nicht immer eine „differentielle Verstärkung“ durchgeführt. Differentielle Verstärkung: Nur dann Verstärkung geben, wenn auch wirklich auf den positiven diskriminativen Reiz reagiert wurde, nicht wenn Verhalten zufällig passiert ist! Experiment nach Tuckmann (1992): Hefte sollen auf Tisch gelegt werden o Schüler tut es Lob o Schüler schwätzt, legt aber Heft dennoch auf den Tisch nicht verstärken! o Diskriminativer Reiz hebt sich nicht ausreichend von anderen Reizen ab. Für Unterscheidungslernen können diskriminative Hilfsreize (prompts) eingesetzt werden o Beispiel: Lehrerfrage nicht klar Frage: Ist Wort „singen“ ein Verb? Keine Antwort. Hilfsreiz: Beschreibt das Wort eine Tätigkeit? Richtige Antwort ( Verstärkung) richtig Verstärkung: „richtig, singen ist ein Verb“ o Hilfsreize sollten so schnell wie möglich wieder ausgeblendet werden (fading) Ziel: Gewünschte Reaktion direkt auf den diskriminativen Reiz (Wort singen reicht, um es als Verb zu identifizieren) Allgemeine Möglichkeiten der Verstärkung Arten von Verstärkern: PRIMÄRE VERSTÄRKER o Biologisch begründete Verstärker wie Nahrung und Wasser o Problem der Sättigung SEKUNDÄRE (KONDITIONIERTE) VERSTÄRKER o Wirkung durch assoziative Paarung mit Primärverstärkern (Geld, Noten) o Menschliches Verhalten wird meist von konditionierten Verstärkern beeinflusst, v.a. von materiellen und sozialen o Konditionierte Verstärker sind leichter zu verwenden als primäre (transportabel, leicht zu verteilen) o Setzen bestimmte Lerngeschichte voraus! Schule: Verwendung vieler konditionierter Verstärker (Noten, Lob…) 2.3 Operantes Konditionieren Premack-Prinzip (David Premack, 1965): Eine bevorzugte Verhaltensweise (welche häufig & gerne ausgeführt wird) kann ein effektiver Verstärker sein für Verhaltensweisen mit geringer Häufigkeit! Bsp.: Erst Mathehausaufgaben, danach Nintendo spielen Verstärkungspläne Kontinuierliche Verstärkungsprogramme: o Verhalten wird immer (Verhaltensaufbau) oder nie (Extinktion) verstärkt. o schneller Auf- bzw. Abbau Intermittierende Verstärkungsprogramme o Zu lernendes Verhalten wird nicht jedes Mal verstärkt. Hohe Löschungsresistenz Je nach zeitlicher oder anzahlbedingter Verstärkung unterscheidet man verschiedene Verstärkungspläne Optimaler Einsatz von Verstärkern Beginnen mit kontinuierlicher Verstärkung (rascher Aufbau von Verhalten) dann intermittierende Verstärkung (hohes Niveau der Häufigkeit, hohe Löschungsresistenz) Effekt nach Bittermann (1975): Reaktionen, die unter intermittierender Verstärkung erworben wurden, sind löschungsresistenter als bei kontinuierlicher Verstärkung. Beispiel: Wenn Schüler sich häufig meldet nicht jedes Mal aufrufen, sondern partiell verstärken [Grund: fehlender Anreiz, wenn Schüler ohnehin weiß, dass er dran kommt] Quotenplan Intervallplan Verstärkung nach gewisser Anzahl von Reaktionen Verstärkung nach bestimmtem Zeitintervall (unabhängig von Reaktion) Fixierter Quotenplan Variabler Quotenplan Fixierter Intervallplan Verstärker für die Verstärker wird nach Reaktion wird nach einer variablen Zahl Verstärker wird für die erste Reaktion einer festen Anzahl von Reaktionen nach einem be(durchschnittl. Anz. von Reaktionen stimmten Zeitgegeben (z.B. jede festgelegt) gegeben. intervall gegeben. 5.). Hohe Auftretenswahrscheinlichkeit von Reaktionen, wegen unmittelbarer Korrelation Reaktion-Verstärker Beispiele: Taube kann so viel Futter erhalten wie sie will, sie muss nur oft Höchste Reaktionsrate und größter Löschungswiderstand Beispiele: Glücksspiel Variabler Intervallplan Verstärker für die erste Reaktion wird nach einer variablen Zeitspanne (Mittelwert fest) gegeben. Direkt nach Verstärkung nur wenige Reaktionen, wenn Zeit der Belohnung näher rückt, steigt die Reaktionsrate Mäßige, aber sehr stabile Verhaltensrate. Löschung langsamer als unter fixierten Intervallplänen. Beispiel: Vokabeltest immer am letzten Tag der Woche Beispiel: Schüler müssen jederzeit damit rechnen, einen 21 22 2.3 Operantes Konditionieren genug picken (z. B. 5x) Schüler, der mit Arbeitsauftrag fertig ist, darf mit Hausaufgabe beginnen Lehrer ruft Schüler auf, der sich mehrmals vergeblich gemeldet hat. Vokabeltest zu schreiben, oder aufgerufen zu werden. Gefahr: Schüler bereiten sich nur für diesen Tag vor Gefahr: Prüfungsangst 2.3.4. Shaping und Chaining Shaping: Verhaltensformung Veränderung des Verhaltens in aufeinander folgenden kleinen Schritten, wobei jeder eine weitere Annäherung an die erwünschte Leistung bedeutet. Zunächst Verstärkung jedes Elements der erwünschten Leistung, nach regelmäßigem Auftreten eines Elements: nur noch Verstärkung von zielnäheren Reaktionen Chaining: Kettenbildung Operantes Verfahren, bei dem jeder Reaktion innerhalb einer Kette von Einzelreaktionen ein konditionierter Verstärker folgt, bis auf die letzte Reaktion ein unkonditionierter oder primärer Verstärker folgt. Jedes Glied der Kette ist ein diskriminativer Reiz für die nächste Reaktion und ein konditionierter Verstärker der unmittelbar vorausgehenden. 2.3.5. Möglichkeiten zum Verhaltensauf- und abbau in der Schule Überblick über positive/negative Verstärkung/Bestrafung: Positive Verstärkung Darbietung eines angenehmen Reizes Negative Verstärkung Entzug neg. Reiz Bestrafung Typ 1 Darbietung eines unangenehmen Reizes Bestrafung Typ 2 Entzug eines angenehmen Reizes Soziale Verstärker Materieller Verstärker Aktivitäten als Verstärker Lob, Zuwendung, Freundlichkeit Gutpunkte, Token, Striche Rumtoben, Wandertag Kein Tadel Keine Hausaufgabe, keine Strafaufgabe Kein Nachsitzen Tadel Hausaufgabe, Strafaufgabe Hausaufgabe, Nachsitzen Keine Anerkennung, Soz. Ausschluss Gutpunkte, Token wegnehmen, neg. Striche Rumtoben, Wandertag streichen 2.3 Operantes Konditionieren A) VERHALTENSAUFBAU durch individuell angepassten Einsatz von negativen und positiven Verstärkern! Soziale Verstärker: Menschen mit pos. sozialer Beziehung → Lob, Zuwendung; Interesse zeigen, Freundlichkeit, gemeinsame Zeit verbringen Materielle Verstärker → Gabe von Süßigkeiten, Geld, Weglassen von Hausaufgaben… Token-Economy: o Gutpunkte, Striche etc. werden als systematische, symbolische Verstärker eingesetzt diese können in reale Verstärker (= Bonbons, Aktivitäten…) eingetauscht werden o Bedingungen nach O’Leary & Drabman (1971): Verständliche Erklärung, strikte Regeleinhaltung, Einsichtigkeit der Regeln, einfache Möglichkeit der Verteilung, Punktestand leicht überprüfbar, keine Störung des Unterrichts durch Token-Vergabe o Vorteile nach Selg (1977): Universeller Verstärkereinsatz, kaum Sättigung, leicht anwendbar, keine Unterrichtsunterbrechung, kurze Zeit zw. Verhalten & Verstärkung, breiter Bereich des Umtausches Kritik am Tokensystem: Langfristige Folgen unbekannt, keine Vorbereitung auf reales Leben, Reduktion auf materielle Aspekte, nur mit Mitarbeit der Eltern möglich, gesteigertes Konkurrenzerhalten nur vorübergehend einsetzen, gleichzeitig soz. Verstärker aufbauen, Hinführung zur Selbstkontrolle Einsatzmöglichkeiten: Lese- & Rechtschreibtraining, Reduktion hyperaktiven Verhaltens, IntelligenzTraining (v.a. bei Kindern!) Aktivitäten als positive Verstärker: → Spielen, Toben lassen, Nachsitzen, Hausarrest wegnehmen (vgl. PremackPrinzip) Kontingenzverstärker (Kontingenz-Vertrag): o Übereinkommen zwischen zwei Vertragsparteien (schriftlich) mit dem Inhalt „ Wenn A bestimmtes Verhalten zeigt, bekommt er bestimmte Dinge etc.“ o Bedingungen (Hommeet al., 1971): Kleine Vertragsschritte, belohnende Kontingenz nach erwünschtem Verhalten, Klarheit des Vertrags, Fairness, Akzeptanz und Respekt beider Seiten, Änderungen müssen möglich sein o Vorteile: zielt auf positive Verhaltensweisen, höhere Verbundenheit (da selbst ausgehandelt) o Nachteil: „Bezahlung“ von Verhalten durch Verhalten Tauschcharakter 23 24 2.3 Operantes Konditionieren o Kontingenzverträge sind empfehlenswert bei sehr aversiven Interaktionen (z.B. Familienstreit) B) VERHALTENSABBAU Sollten nicht alleine eingesetzt werden (sonst: negative Verhaltensbilanz), sondern mit gleichzeitigen Aufbau alternativen Verhaltens verbunden werden Positive Bestrafung: Darbietung aversiver Reize wenig sinnvoll, muss aber manchmal eingesetzt werden (andere Methoden wirkungslos, Überschreitung vereinbarter Verhaltensregeln) Grundregeln: o milde Strafe gleich anfangs (sofortige Verhaltensunterdrückung) und in angemessener Stärke, bei guter Lehrer-Schüler-Beziehung eher möglich (Drohung genügt) o Begründung der Strafe und Erklärung des erwünschten Verhaltens o Variation der aversiven Reize (sonst: Gewöhnung) o Kein Zielverhalten (z.B. Hausaufgaben) als aversiven Reiz einsetzen Problematik der Bestrafung im Unterricht: (gilt auch für negative Bestrafung) Zitat Skinner (1989): „Ein Lehrer, der straft, bringt Schülern bei, dass Bestrafung ein Weg ist, Probleme zu lösen. Das eigentliche Ziel, eine unerwünschte Verhaltensweise auszulöschen, erreicht er dabei nicht. Stattdessen nimmt der Lehrer einige Nebeneffekte in Kauf, die seine Arbeit auf längere Sicht eher erschweren als erleichtern.“ Unerwünschte Nebeneffekte: o Auslösen von Gegenaggression (Förderung von Gewaltbereitschaft), o Angst, Verärgerung, Verletzung des Selbstbildes, ernsthafte Körperschäden Gefahr des klassischen Konditionierens: Negative Erfahrungen werden mit der Schule assoziiert o Bestrafung ist mit Aufmerksamkeitszuwendung verbunden (kann zu Verstärker werden) o O’Leary (1970): Schüler nur leise bzw. alleine tadeln wirkungsvoller als vor der ganzen Klasse o Bestrafung kann auch dann verstärkend wirken, wenn die Strafe nicht konsequent jedes Mal eintritt (Bandura, 1977, 1986) Bsp.: Zu schnelles Fahren im Straßenverkehr wird mit einer Geldbuße geahndet! Gelegentlich folgt dieser Verhaltensweise keine Bestrafung Verhaltensweise tritt häufiger auf o Oft erfährt der Bestrafte nicht, welches Alternativerhalten erwünscht wäre (Skinner, 1953) o Interesse an schulischer Arbeit kann sich nicht dadurch entwickeln, dass Desinteresse bestraft wird (Skinner) 2.3 Operantes Konditionieren Bestrafung beeinflusst die Beziehung zwischen Strafendem und Bestraftem ungünstig Bsp.: Lehrer schimpft Schüler immer wieder aversive Gefühle Gefühle werden auf Lehrer/ Schule übertragen Schüler will diese Gefühle vermeiden Schüler geht nicht mehr in den Unterricht/ verweigert Mitarbeit Wichtig: Nach Bestrafung sollte auch wieder verstärkt werden! Negative Bestrafung: Entzug positiver Konsequenzen Response-cost-Verfahren (Privilegienentzug) o Entzug erworbener Tokens nach festem Regelwerk o Vorteil: Wirksamkeit, keine starken emotionalen Nebenwirkungen Time-out-Verfahren (sozialer Ausschluss) o Person wird kontingent auf das Störverhalten aus einer sozial verstärkenden Situation herausgenommen und verbleibt in einem verstärkungsarmen Raum 5-15 Minuten → in der Schule nur bei Extremfällen möglich o Problematik: Herausnahme des Schülers aus dem „langweiligen“ Unterricht kann verstärkend wirken und ist nur bei starken Störungen vertretbar Operante Löschung o Verminderung der Auftretenswahrscheinlichkeit durch Extinktion/Löschung ( auf zuvor verstärkte operante Verhaltensweise folgt keine Konsequenz mehr) o Bei Beginn des Extinktionsprozesses kann eine vorübergehende Erhöhung des Verhaltens stattfinden (Ausbleiben des Verstärkers Frustration) o Tempo der Löschung hängt von der Lernvorgeschichte ab (kontinuierliche Verstärkung ist weniger löschresistent als partielle Verstärkung) o Löschung alleine reicht nicht aus um ungewünschtes Verhalten abzubauen o Anwendung in der Schule: Auffälligen Schüler ignorieren (Ermahnung ist oft eher Verstärkung) o Vorteile: effektive Reduktion, langanhaltende Wirkung, vollständiger Abbau, Verzicht auf aversive Kontrolle (Abbau anstelle von Unterdrückung unerwünschten Verhaltens!) o Probleme: Identifikation der bisherigen Verstärker, konsequentes Ausbleiben des Verstärkers nötig, Schulklassenproblem (Ignorieren nicht immer möglich Mitschüler reagieren auch auf das Störverhalten) o Vorsicht: Löschung sollte nicht bei aggressivem Verhalten oder Selbstgefährdung eingesetzt werden! o Dauer der Extinktion: Verhalten, das zuvor kontinuierlich verstärkt wurde, wird sehr schnell abnehmen 25 26 2.3 Operantes Konditionieren Beispiel: Defekter Automat: Normalerweise Geld gegen Ware (immer)! Wenn nichts rauskommt schmeiße ich auch nichts mehr so schnell hinein! Verhalten mit partieller Verstärkung wird langsamer abnehmen Beispiel: Spielautomat defekt und zahlt keine Gewinne mehr aus! Spieler wird dennoch länger weiterspielen! o Schulbezug: Ermahnungen im Unterricht können unbeabsichtigter Weise als Verstärkung wirken! Besser wäre eine Nichtbeachtung seitens des Lehrers Kombination mit Verstärkung von erwünschtem Verhalten sinnvoll! Verstärkung inkompatiblen Verhaltens o Förderung erwünschten Verhaltens Unvereinbarkeit mit dem unerwünschten Verhalten nimmt daher zwangsweise ab o Vorteile: positive Kontrollmethode, gut kombinierbar, langanhaltende Reduktion / häufig völliger Abbau, konstruktive Methode, keine schädigende/ belastende Wirkung o Nachteil: Bei längerem Vorhandensein des unerwünschten Verhaltens keine kurzfristigen Erfolge Stimuluskontrolle o Verhalten ist durch Hinweisreize steuerbar o Reduzierung des Verhaltens durch Vermeidung von Reizen, die zu störendem Verhalten geführt haben (Lehrermonolog etc.) o Schaffung von Reizen, die zu erwünschtem Verhalten führen o Vorteil: relativ einfach einsetzbar, keine negativen Nebenwirkungen Negative Praxis/ Sättigung: (aus der verhaltenstherap.-klinischen Praxis) o „Ausleben“ der störenden Verhaltensweise, bis sie nicht mehr verstärkend wirkt o Wiederholung Ermüdung/ reaktive Hemmung Beendigung (Erleichterung!) o Anwendung: Schüler stört durch Tierlaute in separatem Raum 10 min Tierlaute von sich geben lassen Beendigung des Verhaltens (Blackham & Silberman, 1975) Verzögerung des Handlungsablaufs: o Komplizierung und Hinauszögern des Handlungsablaufs (= Gegenteil von Unterbrechung der Verhaltenskette) 2.3 Operantes Konditionieren 2.3.6. Einflüsse behavioristisch orientierter Lernforschung für die Unterrichtsarbeit Konzentration auf beobachtbares Schülerverhalten Lernen ist eine relativ dauerhafte Verhaltensänderung als Ergebnis von Erfahrungen. Forderung nach operationalisierten Lernzielen als Grundlage von Verhaltensbeobachtungen Ralph & Tyler (1934): Curriculum und Unterricht (1973): Zur Beschreibung von Lernzielen solle man eindeutige Begriffe (Operatoren) wie Auswählen, Unterscheiden oder Aufzählen verwenden. Ziel hierbei ist es, sich verstärkt dem Schülerverhalten zuzuwenden und benennbare Zielkriterien zu nennen. Unterschiedlicher Zeitbedarf zum Erlernen Bloom (1976) & Carrol (1963): Schülererfolge sind nicht von der Leistungsfähigkeit abhängig, sondern lediglich der Zeitbedarf, um Lernziele zu erreichen, ist bei einigen Schülern unterschiedlich! Somit ist nicht der Ausprägungsgrad der Leistungsfähigkeit entscheidend, sondern die Schnelligkeit des Lernens! → Individuelle Förderung der einzelnen Schüler bzgl. Zeit und Verwendung kleiner Schritte, sodass jeder Schüler in der Lage ist, ein Lernziel erreichen zu können. Manifestiert ist dies (Masterylearning) in Blooms Konzept des zielgerichteten Unterrichts Problem im Schulalltag: Woher soll man die Zeit nehmen, die die schwächeren Schüler benötigen? Unterscheidung zwischen passiver und aktiver Beteiligung Unterscheidung der Schüler nach: 1. Leistungsniveau 2. Schnelligkeit des Lernfortschritts 3. Umfang aktiver Beteiligung Schüler mit besseren Leistungen beteiligen sich intensiver am Unterricht als leistungsschwächere. Dabei kann die Aktivität des Schülers von Fach zu Fach unterschiedlich sein. Aktive Beteiligung = sichtbares „Tun“ Passive Beteiligung = Keine Reaktion ohne Aufforderung durch Lehrkraft Wichtig: Aufgaben stellen, die Erfolge garantieren positive Konsequenz 27 28 2.4 Erlernte Hilflosigkeit 2.3.7. Vergleich von Klassischem und Operantem Konditionieren Klassisches Konditionieren Operantes Konditionieren Beide sind Mittel zur Verhaltensänderung Kernpunkt: Reflexe (unkontrollierbare physiologische Reaktionen, z.B. Speichelfluss) und Reaktionen, die nach der Konditionierung auch durch einen zuvor neutralen Stimulus ausgelöst werden. Kernpunkt: Konsequenzen bzw. Verstärker (z.B. Belohnung, Bestrafung), die nach der Konditionierung eine Reaktion wahrscheinlicher machen Ausgangspunkt des Lernens bildet also eine physiologische Reaktion, die durch einen bestimmten, festgelegten Reiz ausgelöst wird. Ausgangspunkt des Lernens bildet also eine beliebige Reaktion, die ohne inhaltlich zwingenden Bezug zu vorangehenden Reizen ausgelöst wird. Prinzip: Kontiguität plus Signalfunktion Prinzip: Kontingenzen Reiz – Reaktion: UCS – UCR CS - CR Dreifachkontingenz: Reiz – Reaktion – Konsequenz Handlung von spezifischem Reiz ausgelöst (z.B. Futtersuche) Handlung nicht von spezifischem Reiz ausgelöst Der Lernprozess zielt auf den Reiz ab Lernprozess zielt auf die Reaktion bzw. das Zielverhalten ab Reaktion durch US bzw. CS hervorgerufen (elicit) Reaktion vom Organismus selbst hervorgebracht (emit) Zentral für das Lernen sind die dem Verhalten vorausgehenden Bedingungen. Zentral für das Lernen sind die auf ein Verhalten folgenden Bedingungen. 2.4. Erlernte Hilflosigkeit Erlernte Hilflosigkeit (Seligmann, 1979): Menschen, die die Überzeugung entwickeln, dass sie Ereignisse und Ergebnisse ihrer Bemühungen in Leistungssituationen nicht mehr kontrollieren können, befinden sich im Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Experiment von Seligmann & Maier (1967) mit Hunden: Hierbei handelt es sich um eine Verknüpfung von Ideen des klassischen und operanten Konditionierens! Vortraining: Hunde werden in 2 Gruppen aufgeteilt und in Käfigen mit elektri-fizierbarem Bodengitter fixiert. Beide Gruppen werden klassisch konditioniert: Ton (NS) + Schock (UCS) UCR (Furcht) Ton (CS) Furcht (CR) 2.4 Erlernte Hilflosigkeit Gruppe 1: Kann dem Schock (US) weder entgehen, noch ihn beenden → Lernen, dass Schock (US) unvermeidbar & unkontrollierbar ist 29 Gruppe 2: Kann Schock mit Hilfe einer Platte, die neben Kopf angebracht ist, beenden. → Schock ist zwar auch unvermeidbar, aber kontrollierbar. Erlernte Hilflosigkeit: [nach Vortraining] Beide Gruppen befinden sich in einem Käfig, in dem eine Hälfte unter Strom gesetzt werden kann, die andere nicht. Beide Hälften sind voneinander durch eine (für die Hunde schulterhohe) Barriere getrennt. Die erste Käfighälfte wird unter Strom gesetzt, nachdem kurz zuvor der aus dem Vortraining bekannte Ton erklang. Die Hunde können dem Schock entgehen, indem sie über die Barriere springen (Fluchtverhalten beim Erklingen des CS (Ton)) Gruppe 1: Findet den Ausweg nicht und verhält sich untätig; auch nach mehreren Durchgängen lernen 2/3 dieser Gruppe das Fluchtverhalten nicht! → Erlernte Hilflosigkeit Gruppe 2: Zeigt zunächst trial & error, springt dann über die Barriere (law of effect: Sprung erfolgt in zukünftigen Versuchsdurchgängen immer schneller). Operantes Konditionieren SD (Ton) CR (Sprung) C (Beendigung der Furcht) Folgen erlernter Hilflosigkeit (Aloy & Seligmann, 1979) Passivität (vermindertes Auftreten von willentlichen Reaktionen) = Motivationales Defizit Eingeschränkte Möglichkeit, zu erkennen, dass man zukünftige Ereignisse kontrollieren kann = Kognitives Defizit Apathie, Hilflosigkeit, Depression, sobald man überzeugt ist, das negative Ereignis nicht mehr kontrollieren zu können = Emotionales Defizit 30 2.4 Erlernte Hilflosigkeit Erlernte Hilflosigkeit in der Schule Motivation ist aufgrund der Hoffnungslosigkeit nicht mehr möglich Besonders gefährdet: Schüler, die Scheitern internal, stabil kontrollierbar attribuieren (misserfolgsorientiert) Wahrnehmungsverzerrung (nicht ohne weiteres zu beseitigen!) Idee: Nur noch Vermittlung von Erfolgen (werden aber nicht mehr wahrgenommen, Fehleinschätzungen!) Hohe Anstrengung, um solche Schüler wieder aus dem Brunnen der Hilflosigkeit zu holen! sowie un- Maßnahmen gegen erlernte Hilflosigkeit: „Re-Attribuierungstraining“ Schüler sollen dabei lernen, dass ihre Misserfolge nicht auf mangelnde Fähigkeiten, sondern auf mangelnde Anstrengung zurückzuführen ist. Denn Anstrengung wird im Gegensatz zur Fähigkeit als kontrollierbar wahrgenommen. Empirie um Erleben von Kontrolle: Altersheim-Studie von Langer (1993) Zwei Stockerwerke eines Altersheims wurden zufällig ausgewählz o A: durften Blumen gießen und Essen selbst entscheiden o B: gleiche Routine wie bisher Ergebnis: A zeigen besseres Wohbefinden und subjektiv besseren körperl. Zustand bis hin zur reduzierten Sterberate 3.1 Das Bobo-Doll Experiment (Bandura, 1965) 3. SOZIAL-KOGNITIVE LERNTHEORIE Übergang von behavioristischen zu kognitiven Lerntheorien Vertreter: Albert Bandura (*1925) Empirische Basis: Bobo-Doll Experiment (Bandura, 1965) Prinzip: Lernen durch Beobachtung des Verhaltens anderer Unterschied zu behavioristischen Lerntheorien Bandura (1986): „Lernen ist eine informationsverarbeitende Aktivität, durch die Informationen über Verhaltensweisen und Umweltereignisse in symbolische Repräsentationen, die als Wegweiser für Handlungen dienen, umgewandelt werden.“ Skinner (1953): Hält es zwar für möglich, dass kognitive Prozesse Verhaltensänderungen begleiten, er schließt jedoch aus, dass sie auf solche Einfluss nehmen können. Grundlagen der sozial-kognitiven Theorie Im Gehirn existieren Nervenzellen (Spiegelneuronen), die bei Betrachtung von Vorgängen ebenso reagieren, wie wenn dieser Vorgang selbst ausgeführt würde (Rizzolatti et al. 2000, 2006) REZIPROKER DETERMINISMUS: Wechselwirkung zwischen Verhalten, der Umgebung und Faktoren der Person, die sich alle drei wechselseitig beeinflussen → nicht ausschließlich die Umwelt bestimmt, wann und was gelernt wird, sondern das Verhalten schafft teilweise die Umwelt und die resultierende Umwelt beeinflusst ihrerseits das Verhalten (Bandura, 1977) Beispiel: Aggressive Kinder erwarten auch bei anderen aggressive Verhaltensweisen und verhalten sich dementsprechend Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer Verhaltensweise wird nur dann erhöht, wenn man meint oder sogar weiß, dass man dafür eine Verstärkung erhält → Erwartungen über wahrscheinliche zukünftige Konsequenzen Definition (Tausch & Tausch, 1971): „Unter Beobachtungslernen (Modelllernen) ist zu verstehen, dass sich das Verhalten eines Individuums auf Grund der Wahrnehmung von Verhaltensweisen anderer Personen (sogenannter Modelle) oder auf Grund verbaler Darstellung über das Verhalten anderer Personen ändert, und zwar in Richtung größerer Ähnlichkeit mit der beobachteten oder auf Grund verbaler Übermittlung vorgestellten Verhalten.“ 3.1. Das Bobo-Doll Experiment (Bandura, 1965) Fragestellung: Führt das Beobachten von Verhaltensweisen in einem Film zur Veränderung der eigenen Verhaltensweise? Methode: 33 Jungen, 33 Mädchen (3-5 Jahre) der Stanford University Nursery School. Kinder sehen in einem Film, wie eine erwachsene Person eine lebensgroße Plastikpuppe mit verschiedenen Verhaltensweisen verletzt (Schlag auf die Nase, Holzhammer, durch den Raum Stoßen, mit Gummibällen abwerfen). Dazu werden jeweils charakteristische Laute verwendet (z.B. „Sokerooo“ beim Holzhammer) → Verhaltensweisen sind für Kinder in jedem Fall völlig neu 31 32 3.2 Phasen des Beobachtungslernens Varianten des Films: verschiedene Konsequenzen für Modell: (1) Positive Konsequenz (2) Bestrafung (3) Keine Konsequenz Kinder werden anschließend in einen Spielraum gebracht, in dem sich auch die Utensilien aus dem Film befanden. Die Kinder wurden zunächst allein gelassen und das Verhalten dokumentiert, später wurden Süßigkeiten für jede Nachahmung versprochen. Ergebnis: Die Reproduktion der Verhaltensweisen hängt zunächst vom Geschlecht und davon ab, ob das Modell bestraft oder belohnt wurde. Mit dem Anreiz kann jedoch über alle Gruppen hinweg ein großer Anteil das Verhalten zeigen. Die Kinder haben durch Beobachtung von aggressivem Verhalten in einem Film also die Kompetenz erworben, selbst aggressives Verhalten zu zeigen. Direkte externe Verstärkung und stellvertretende Verstärkung erhöhten die Bereitschaft zur Performanz. Bandura schloss daraus, dass die Kinder das Modell-Verhalten gleichermaßen erlernt, aber je nach Folgen unterschiedliche reproduziert haben. Einfluss der Medienart auf das Modelllernen (Bandura, 1965) Gesamtzahl der Gelernten Handlungen Imitierte Handlungen kein Modell kein Modell Nichtaggrissives Modell Nichtaggrissives Modell Comicmodel Comicmodel Filmmodell Filmmodell Lebendes Modell Lebendes Modell 3.2. Phasen des Beobachtungslernens Von was ist es abhängig, ob und wann ein Beobachter Verhalten anderer imitiert? Dieser Verarbeitungsprozess wird nach Bandura (1969) in zwei Phasen und vier Schritte unterteilt: Aufmerksamkeit Gedächtnisprozesse Aneignungs-/ Lernphase (Akquisition) Reproduktion Motivation Äußerungs- / Ausführungs-/ Verhaltensphase (Performanz) 3.2 Phasen des Beobachtungslernens Je nachdem, wie diese Prozesse verlaufen, wird nur die Kompetenz zu bestimmtem Verhalten erworben, die Nachbildungsleistung auf Verhaltensebene ausgeprägt oder es findet gar kein Lernprozess statt. 1. Aufmerksamkeit Prozess, der aus dem gesamten Reizangebot der Umwelt eine Auswahl für die weitere Verarbeitung vornimmt. Diese Selektion wird durch mehrere Faktoren bestimmt, z.B.: EIGENSCHAFTEN DES BEOBACHTERS: Motivation, Fähigkeit der Wahrnehmung, Fähigkeit zum Nachvollzug der Handlungen MODELLEIGENSCHAFTEN: Respektiert und statushoch, mächtig und attraktiv, eher erfolgreich als wiederholt bestraft VERHÄLTNIS ZWISCHEN MODELL Sympathieempfinden etc. UND BEOBACHTER: Ähnlichkeit mit dem Beobachter, Maximale Aufmerksamkeit entsteht, wenn Modell kompetent, freundlich und mächtig ist (meist Lehrer) und wenn Beobachter emotional erregt, engagiert, abhängig ist und Zweifel über angemessenes Verhalten hat. Drei Arten von Modellen: a) NATÜRLICHE MODELLE, mit denen ein Lernender unmittelbar in Kontakt steht (Eltern, Lehrer, Mitschüler) b) SYMBOLISCHE MODELLE, die als Cartoons oder Zeichentrickfiguren bestimmte Verhaltensweisen abbilden, die Lernende beobachten und evtl. nachahmen c) Eine SPRACHLICH FORMULIERTE ERLÄUTERUNG oder Anweisung, die Schritt für Schritt angibt, welcher Weg zu einem bestimmten Ziel führt (Plakat zum Rechenweg) 2. Gedächtnis/Behalten Vor der Nachahmung des beobachteten Verhaltens muss es ins Gedächtnis transferiert und dort in bildlicher und/oder sprachlicher Form gespeichert werden. Um das erlernte Verhalten zu behalten, ist Wiederholen erforderlich (auf Vorstellungsebene oder durch körperliche Nachahmung), Bewegungsabläufe sollten automatisiert werden. 3. Reproduktion Theoretisch sollte nun die Reproduktion des Verhaltens möglich sein. Jedoch wird man häufig durch Selbstbeobachtung oder objektive Rückmeldung (Feedback) auf Fehler aufmerksam. Daher sollte keine negative Reaktion auf falsche Ausführungen erfolgen, sondern eine „informative Rückmeldung“. 4. Motivation Ob ein beobachtbares Verhalten nachgeahmt wird, hängt von der Motivation des Lernenden in einer gegebenen sozialen Situation ab. 33 34 3.3 Wirkungen des Beobachtungslernens 3 Formen der Verstärkung (Bandura) Direkte Verstärkung Beobachter ahmt Verhalten nach und bekommt dafür direkten Verstärker Stellvertretende Verstärkung Beobachtung von Verhalten, das belohnt wurde (Verstärkung) Selbstverstärkung Beobachter verstärkt sich selbst. Ziel pädagogischer Einwirkung: Selbststeuerung des Lernenden 3.3. Wirkungen des Beobachtungslernens Entwicklung allgemeiner Vorstellungen Bsp: Bobo-Doll-Studie: Kinder zeigen auch eigene, kreative aggressive Verhaltensweisen → Entwicklung einer allgemeinen Einstellung zu Aggressivität → Nachahmungseffekt unerwünschter oder krimineller Handlungen Neuerwerb von Verhaltensweisen (sog. Modellierender Effekt) Modell führt für den Beobachter neue Verhaltensweisen vor; diese werden vom Beobachter mehr oder minder identisch reproduziert Es findet jedoch keine reine Imitation, sondern eine kognitive Auseinandersetzung statt. Modellieren geht also über das Kopieren von Verhaltensweisen hinaus. Durch Modellieren kann die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens erhöht oder gesenkt werden (Erwerb von Schemata/Verhaltensstile) Beispiele: Essen von Austern, Lernen des Zehnerübergangs von älteren Schülern Erlernen kognitiver Strategien o Modell kann genutzt werden, um bestimmte Vorgehensweisen bei der Lösung von Aufgaben zu demonstrieren. o Schulbezug: Lehrer (Modell) gibt den Lernenden nicht nur Erklärungen, sondern verbalisiert zusätzlich seine Gedanken und nennt Gründe für seine eigene Vorgehensweise. Effekte von Beobachtung HEMMUNGSEFFEKT Reduktion der Häufigkeit früher erworbener Verhaltensweisen, abhängig von der Beobachtung aversiver Verhaltensfolgen einer Handlung (Bestrafung etc.) ENTHEMMUNGSEFFEKT Beim Beobachten werden vorher gehemmte Verhaltensweisen häufiger oder treten wieder auf, nachdem ein Modell beobachtet wurde, das vorher verbotene oder bedrohliche Handlungen ohne negative Folgen ausführt und/ oder damit sogar Erfolg hat. 3.4 Modellernen und Mediengewalt AUSLÖSEEFFEKTE Modelle können Verhalten auslösen, das der Beobachter schon voll und ganz beherrscht (z.B. Schüler lesen sich in Pause nochmal Hefteintrag durch → Mitschüler lässt von seiner ursprünglichen Tätigkeit ab und lernt auch) INTENSIVIERUNG DER REAKTIONSBEREITSCHAFT Wenn ein Modell durch sein Verhalten Beobachtern die Möglichkeit aufzeigt, dieses Verhalten ebenfalls zu zeigen; Verhaltensweisen sind sozial akzeptiert (z.B. Lehrer schmeißt Müll in Papierkorb → sozial erwünschtes Verhalten wird von den Schülern übernommen) NULLWIRKUNG Verhaltensweise bereits bekannt → keine Lernwirkung 3.4. Modellernen und Mediengewalt Untersuchungen über Fernsehgewohnheiten und Aggressivität zeigen keine vollständig eindeutige Tendenz: „Während die Mehrzahl der Untersuchungen eine kausale Beziehung zwischen Gewalt im Fernsehen und aggressivem Verhalten nachweist, bleiben die zahlenmäßig weit geringeren - Verfechter der Gegenposition bei ihrer Auffassung, dass keine Wirkungen nachgewiesen werden können.“ (Television and Behavior, 1982) Verschiedene Thesen zur Wirkung medialer Gewalt: 1. Habitualisierungshypothese: 5. Lerntheoretische Überlegungen: ständiger Konsum Abnahme der Lernen beim beobachten medialer Sensibilität in der Realität Gewaltdarstellungen und Aggression als normales Anwendung einzelner Elemente in Alltagsverhalten angesehen der Realität 2. Erregungshypothese: realitätsnahe Gewaltdarstellung emotionale Erregung aggressives Verhalten je nach Umgebungsbedingungen 3. Stimulationshypothese: Förderung der Bereitschaft zur Gewaltanwendung bei Frustration in kritischen Situationen Gewaltdarstellungen als Auslöser 4. Suggestionshypothese: direkte Nachahmung der Gewaltdarstellung in der Realität 6. Medienspezifische Katharsishypothese: angeborene Aggression verringert, wenn beobachtete Gewaltakte an fiktiven Modellen in der Fantasie nachvollzogen werden Miterleben von Gewalt Reinigung von Aggression 7. Rechtfertigungshypothese: nachträglich als Rechtfertigung für Gewaltanwendung 8. Hypothese der Wirkungslosigkeit: keine Auswirkungen Heute widerlegt: Hypothese der Wirkungslosigkeit und Katharsishypothese! 35 36 3.4 Modellernen und Mediengewalt Eine Gewaltstimulation tritt unter anderem dann ein, wenn an Gewaltkonsum schrittweise herangeführt wird und das Anschauen von Gewaltfilmen subtil, z.B. durch Zustimmung in der Peergroup, belohnt wird. Wenn keine solchen Vorbedingungen vorliegen, können Gewaltfilme auch Angst auslösen. Die stellvertretende Verstärkung eines Modellverhaltens bezüglich Gewalt hat eine besondere und weitreichende Wirkung. Abbau des Aggressionsverhaltens der Schüler durch den Lehrer vorsichtig und wohlüberlegt bestimmte Fernsehsendungen empfehlen Modell für nichtaggressives Verhalten sein ehrliche Diskussionen im Unterricht, um Voraussetzung für Verarbeitung und Kontrolle von Aggression, Feindseligkeit, etc. zu schaffen Dem sozialen und emotionalen Klima, in dem der Schüler aufwächst, Aufmerksamkeit schenken 4.1 Das Gedächtnis & Wissen: Überblick 4. THEORIEN DES KOGNITIVEN LERNENS Definition: Eine kognitive Sicht des Lernens begreift Lernen als aktiven geistigen Prozess des Erwerbs, Behaltens, Abrufens und Anwendens von Wissen. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den behavioristischen Lerntheorien Behaviorismus Kognitivismus Lerninhalt neue Verhaltensweisen Assoziationen Auffassung des Lernprozesses Dem Lerner werden unbeschriebenes Blatt) Assoziationen beigebracht Auffassung des Lerners Passiv; Lernen wird durch Umwelt Aktiv: Lerner wählt induziert Entscheidungen Methodik Tierlabors unter experimentellen Bedingungen Ziel: Entdeckung universeller Verhaltensweisen und Wissen, das ermöglicht neues Verhalten (als Der Lerner erweitert selbst sein neue Wissen über die Welt aus, trifft Untersuchung verschiedenster Lernsituationen Ziel: Bestimmung von individuellen und EntwicklungsDifferenzen Verstärkung ist beiden wichtig: … zur Festigung des Verhaltens …als Rückmeldung Folge von Lernen über die Nach: Woofolk, 2008 Kritik an Informations-Verarbeitungs-Theorien Wissen wird nicht nur „eingefüllt“ in den Schüler Unangemessener Vergleich des menschlichen Gehirns mit einem Computer (dieser wird von einer externer Kraft entwickelt, Sylvester 1995) Wegen der Dekontextualisierung darf man keine allzu großen Erwartungen an die Transferleistung oder Anwendung auf andere Situationen stellen (Ertmer & Newby 1993) 4.1. Das Gedächtnis & Wissen: Überblick 4.1.1. Definition und Eigenschaften Definition (nach Zimbardo, 2008) Gedächtnis bezeichnet die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen, zu speichern und bei Bedarf wieder abzurufen. Das Gedächtnis ist somit kein passiver Informationsspeicher, sondern ist abhängig von der Aktivität des Lerners bei der Aneignung. Die höchste Aufnahmeschnelligkeit ist im Schulalter zu finden. Die Qualität des Gedächtnisses und die Fähigkeit sich zu erinnern, ist abhängig von Anzahl der Wiederholungen Zeitabstand zwischen Lernen und Abruf 37 38 4.1 Das Gedächtnis & Wissen: Überblick Konzentration & Aufmerksamkeit (z.B. Ermüdungsgrad) Äußeren und inneren Umständen - Interesse am Lernstoff: o individuelles Interesse: überdauernde Person-Objekt-Beziehung, dispositionales Merkmal des Lerners o situationales Interesse:motivationaler Zustand, der aus den Anreizbedingungen einer Lernsituation entsteht o aktualisiertes Interesse: bestehendes individuelles Interesse durch Merkmale der Lernumgebung wieder aktualisiert Individuelle Einstellung zum Lernstoff Übertragung der Informationen ins Gedächtnis: Automatische Verarbeitung (z.B. Mittagessen vom Vortag) Anstrengungsbedingte Verarbeitung (z.B. Vokabeln) In den meisten Fällen erfordert das Einspeichern oder Abrufen von Informationen eine Mischung aus implizitem und explizitem Gedächtnis. 4.1.2. Gedächtnisprozesse Modellvorstellung: Das menschliche Gedächtnis kann mit einer Bibliothek verglichen werden. Ziel der Literaturbeschaffung ist das Bereitstellen (Speicherung) in Bibliotheksregalen, welche dann bei Bedarf ausgeliehen werden können (Abruf). Drei mentale Prozesse sind also nötig, um Wissen zu einem späteren Zeitpunkt nutzen zu können, unabhängig von der Form des Gedächtnisses: Information Enkodierung (Einprägung) Speicherung Abruf bei Bedarf Enkodierung Prozess , der die mentale Repräsentation im Gedächtnis aufbaut. ENKODIERUNGSSPEZIFITÄT: Abruf verbessert, wenn Hinweisreize bei Enkodierung mit denen bei Abruf übereinstimmen SERIELLER POSITIONSEFFEKT: o Primacy-Effekt: verbesserte Erinnerungsleistung für Items am Anfang einer Liste o Recency-Effekt: verbesserte Erinnerungsleistung für Items am Ende einer Liste KONTEXTUELLE UNTERSCHEIDBARKEIT: Serieller Positionseffekt kann durch Kontext und Unterscheidbarkeit der abzurufenden Erfahrung verändert werden. Speicherung Behalten enkodierter Informationen über eine Zeitspanne hinweg. Abruf Wiedergewinnung gespeicherter Information zu einem späteren Zeitpunkt. Möglichkeiten beim Abruf: ABRUF (RECALL): Suche, bei der die Informationen reproduziert werden sollen WIEDERERKENNEN: Suche, bei der die Reize als zuvor gesehen beurteilt werden sollen 4.1 Das Gedächtnis & Wissen: Überblick HINWEISREIZE beim Abruf: Intern oder extern generierte Reize, die den Abruf erleichtern Hinweisreize sind sowohl beim recall wie auch beim Wiedererkennen erforderlich. Die Leistung beim Wiedererkennen ist hingegen in der Regel höher als beim Abruf (Beispiel: Multiple-Choice Test). Allgemein: Das Gedächtnis funktioniert am besten, wenn Enkodierungs- und Abrufprozesse gut zusammenpassen. Theorie der Verarbeitungstiefe (levels of processing, Craick & Lockhart, 1972): Bei größerer Tiefe ist eine Einprägung im Gedächtnis wahrscheinlicher. Oft muss man implizite Gedächtnisinhalte abrufen, die man explizit enkodiert hat. Implizite Inhalte sind stabil, wenn Enkodieren und Abruf sehr gut übereinstimmen (= transferadäquate Verarbeitung). Die drei Gedächtnisprozesse vollziehen sich, so wird angenommen, in einem Gedächtnissystem. → Es gibt verschiedene Theorien über Aufbau des Gedächtnisses: 4.1.3. Wissensformen nach Paris & Cunningham, 1996 Wissensformen im LZG Deklaratives Wissen Prozedurales Wissen Konditionales Wissen Deklaratives Wissen Wissen, das in Worten oder anderen Symbolen gespeichert werden kann; „Wissen, dass…“ Im semantischen Gedächtnis (allgemeine Fakten) oder episodischen Gedächtnis abgespeichert (persönliche Erfahrungen) Speicherungsform: bildhafte Vorstellungen oder Propositionen Prozedurales Wissen „Wissen, wie“ etwas auszuführen ist (z.B. einen Bruch dividieren) Kann nur durch Handlungen überprüft werden (sonst: deklaratives Wissen) Speicherungsformen: Wenn-Dann-Regeln Konditionales Wissen „Wissen, wann und warum“: Wissen über die korrekte Anwendung von Prozeduren und Regeln 39 40 4.2 Gedächtnismodelle 4.2. Gedächtnismodelle 4.2.1. „Drei-Komponenten-Modell“ von Atkinson & Shiffrin (1965) Das sensorische Register Rezeptoren in den Sinnesorganen wandeln Umweltreize in Signale um, welche eine Weiterleitung durch das Nervensystem ermöglichen o Vergleich von wahrgenommenen Reizen mit Informationen aus dem LZG o Diese Interpretation kann in das Kurzzeitgedächtnis übertragen werden o Bsp.: orangene Frucht Apfelsine, aber nur da im LZG Aussehen der Apfelsine gespeichert ist. Informationen in diesem System werden nur für sehr kurze Zeit gespeichert (Matlin, 2005): o Ikonisches Gedächtnis (visuelle Informationen, Wahrnehmung von Bewegung): ca. 1 sec o Echoisches Gedächtnis (akustische Informationen): ca. 2-4 sec Untersuchung zur Kapazität des ikonischen Gedächtnisses (Sperling, 1960) o Buchstabenmix mit 3 Zeilen und 4 Spalten wurde für 50ms gezeigt o Werden Personen danach gefragt, alle wiederzugeben, scheitern die meistens o Wird allerding per Ton signalisiert, welche Reihe sie wiedergeben sollten, sind die Probanden dazu in der Lage o Verstrich außerdem nach der Darstellung ca. 1 sec, so konnten sie Probanden genauso wenig erinnern wie im ersten Szenario o Erklärung: nur Artikulationsdauer verhindert teilweise die Wiedergabe, d.h. Speicherung ist kürzer als es dauert, alle Buchstaben zu sagen Das Sensorische Register ist im Vergleich zum Kurzzeitgedächtnis sehr groß → Prozess der Datenverringerung im sensorischen Register durch Kontrollprozesse: 4.2 Gedächtnismodelle Aufmerksamkeit1: Verschiedene Sinnesorgane werden von sehr vielen Informationen „bombardiert“ → diese geht aber verloren, wenn ihnen keine Aufmerksamkeit geschenkt wird Probleme: o Schüler haben anfangs Schwierigkeiten, aus zwei verschiedenen Quellen gleichzeitig Informationen zu verarbeiten o Bei der Diagnostik aktueller Aufmerksamkeitszuwendungen; Schüler haben stets ihre Augen auf den Lehrer gerichtet, ohne ihm die volle Aufmerksamkeit zu schenken Bedeutungszuschreibung: Mit Hilfe der im LZG gespeicherten Information wird dem Inhalt im sensorischen Register Bedeutung zugeschrieben z.B.: Die Reizgegebenheit 7 gewinnt für Hannes an Bedeutung, da er über das Wissen verfügt, dass die Zahl 7 zu den Primzahlen gehört Schulbezug Im Unterricht: Abwechslungsreicher Unterricht zur Förderung aufmerksamer Zuwendung Lernende auffordern, genau zuzuhören oder besonders acht zu geben Angemessener Einsatz von Medien wie Overheadfolien, Wandbilder, mitgebrachten Gegenständen,… In gewissen Abständen im Klassenzimmer umher bewegen Stimme gezielt variieren (lauter, leiser, schneller, langsamer) Schüler müssen lernen, ablenkende Reize zu ignorieren Erhöhung der Kapazität durch Automatisierung grundlegender Dinge Das Arbeitsgedächtnis Arbeitsgedächtnis ist die neuere Bezeichnung für Kurzzeitgedächtnis nach A. Baddeley (2000, 2007) Neue Bezeichnung: Arbeitsgedächtnis Gedächtnissystem, welches die übertragene Information aus dem sensorischen Register so lange zwischenspeichert, bis diese mit Hilfe des bereits vorhandenen Wissens aufgearbeitet worden ist (Baddeley; 2000, 2007) Kurzzeitgedächtnis Komponente des Arbeitsgedächtnisses, welche Informationen in diesem System nur passiv zwischenlagert 1 Begrenzte Speicherkapazität: 7±2 Informationseinheiten (Miller, 1956) Eng begrenzte Speicherdauer: Informationen können nur ca. 20 bis 30 sec im Arbeitsgedächtnis gespeichert werden (Peterson & Peterson, 1959) Bewahrung von Informationen im Arbeitsgedächtnis durch: Siehe auch: Anhang (A1 Exkurs: Umgang mit ADHS) 41 42 4.2 Gedächtnismodelle o Aufmerksamkeitszuwendung Wenn man nicht darauf achtet, dass Inhalte des Arbeitsgedächtnisses „in Bewegung bleiben“, gehen sie verloren z.B.: Wenn ich mir eine Telefonnummer für einen Rückruf merken will, darf ich nicht gestört werden, sonst ist diese Information weg o Erhaltende Wiederholung Die Information wird so lange „geistig“ oder leise wiederholt, bis sie benötigt wird [vgl. phonologische Schleife bei Baddeley] z.B. Ich sage die Telefonnummer so lange vor mich hin, bis ich endlich jemanden erreiche. o Aufarbeitende Wiederholung Dabei wird die Bedeutung neuer Informationen erschlossen, indem ich versuche, die Inhalte mit dem Wissen aus dem Langzeitgedächtnis aufzuarbeiten und zu verbinden → spontane Aufarbeitung wächst bei Kindern mit dem Alter (Pressley & Levin, 1977) Theorie von Baddeley & Hitch (1974, 2000, 2007) Arbeitsgedächtnis umfasst sowohl eine kurzzeitige Speicherung (Kurzzeitgedächtnis) als auch die Möglichkeit zur aktiven Verarbeitung von Informationen. Die zentrale Exekutive: Diese Komponente überwacht und koordiniert die anderen Sub-Systeme; besitzt selbst keine Speicherkapazität Räumlich-visueller Notizblock: Dieses Sub-System speichert visuelle Informationen, die sprachliche Zusammenhänge veranschaulichen Phonologische Schleife: Dieses Sub-System speichert akustische und sprachbasierte Informationen für ca. 2 sec, falls diese nicht aufgrund von Wiederholungen (z.B. zu sich selbst sprechen) erhalten bleiben z.B.: Einem Schüler gelingt es häufig im Unterricht, Mitteilungen des Lehrers zu wiederholen, obwohl er gerade nicht aufgepasst hatte 4.2 Gedächtnismodelle Episodischer Puffer: Sub-System, welches mit dem episodischen Langzeitgedächtnis in engem Kontakt steht und persönliche Ereignisse aus der phonologischen Schleife und dem räumlich-visuellen Notizblock abspeichert. → „Kommunikation“ der Systeme Beispiel2: „Wie viele Fenster hat deine Wohnung/ dein Haus?“ Im Großteil der Fälle geht man die Wohnung im Geiste ab (visuell-räumlicher Notizblock) und verwendet dabei die Anschauung welche im episodischen Puffer zwischen gespeichert wird, um im Kopf durchzuzählen (phonologische Schleife). Ausgedacht und koordiniert hat diese Strategie die zentrale Exekutive. Empirische Befunde zur Existenz der Phonologischen Schleife PHONOLOGISCHER ÄHNLICHKEITSEFFEKT: Die Tendenz, dass Fehler der Probanden phonologisch ähnlich zum korrekten Item sind und die Tatsache, dass phonologisch ähnliche Items schwieriger zu erinnern sind (Baddeley, 1966). IRRELEVANTER SPRACHEFFEKT: Präsentation von irrelevanter, zu ignorierender gesprochener Sprache beeinträchtigt das KZG für visuell präsentierte Ziffern. Der Effekt ist unabhängig davon ob die irrelevante Sprache Englisch, deutsch oder arabisch ist; irrelevante nichtsprachliche Stimuli erzeugen ihn aber nicht (Salamé & Baddeley, 1982, 1989). Annahme daher: nur sprachliches Material (keine Geräusche) kann in den phonologischen Speicher gelangen. Der EFFEKT DER W ORTLÄNGE auf die Gedächtnisspanne: Lange Worte → kürzere Gedächtnisspanne (Baddeley et al., 1975). Dieser Effekt liegt vermutlich am rehearsal (innerer Wiederholung), das für längere Worte länger dauert, so dass die Gedächtnisspur vorher präsentierter Wörter leichter zerfällt. ARTIKULATORISCHE SUPPRESSION eliminiert den phonologischen Ähnlichkeitseffekt bei visueller Präsentation. Das heißt: Probanden müssen ein Wort stets wiederholen (= Suppression) und sich parallel angezeigt Wörter merken. Ergebnis: sind immer ähnlich schlecht, egal wie lang die zu merkenden Worte sind. Interpretation: Material kann nicht in den phonologischen Speicher transferiert werden. (Baddeley et al. 1975) Empirie zum Ereignisspeicher Mit der Zeit entdeckte Baddeley Effekte, die sich mit dem Drei-Komponenten-Modell nicht mehr erklären lassen. Normalerweise kann man sich ca. 5 Wörter merken, wenn die Wörter aber einen Zusammenhang haben (z. B. einen Satz bilden, sog. Chunking), kann man sich ca. 16 Wörter merken. Der ursprüngliche Gedanke, dass daran das Langzeitgedächtnis beteiligt ist, musste verworfen werden, da sich Menschen mit geschädigten Kurzzeitgedächtnis und funktionierendem Langzeitgedächtnis nur ca. 5 Wörter merken können. Das Langzeitgedächtnis ist also offensichtlich nicht beteiligt. Zur Erklärung hat Baddeley im Jahr 2000 den episodischen Puffer zu seinem Modell hinzugefügt. Es handelt sich dabei um ein multimodales Speichersystem mit begrenzter Kapazität, es kann sowohl visuelle als auch phonologische Informationen in Form von „Episoden“ speichern. 2 Tatsächlich stammt dieses Beispiel von Baddeley selbst. 43 Speicherung von Faktenwissen (Schulwissen, Gesetzmäßigkeiten ,…) z.B.: Pflanzennamen Speicherung von persönlichen Erinnerungen und Erfahrungen z.B.: Was habe ich zum Frühstück gegessen Das Langzeitgedächtnis speichert sämtliche Informationen, die über längere Zeit zu Verfügung stehen Gedächtnisinhalte werden als Grundlage für logische Schlüsse genutzt z.B.: Schalten beim Autofahren Speicherung von Verhaltensroutinen, Fertigkeiten, unausgesprochene n Regeln Prozedurales Gedächtnis Lernen erfolgt nach dem Prinzip des klassischen Konditionieren Prozeduren werden durch Üben bis hin zur Automatisierung gelernt „Wenn… Dann…“ - Abfolge z.B.: das Geräusch des Rasenmähers wird mit Sommer verbunden Speicherung von konditionierten, (emotionalen) Reaktionen Klassisches Konditionieren z.B.: Ge… wird häufiger mit Gedächtnis beendet wenn man gerade das Skript gelesen hat unbewusste Aktivierung von Begriffen und Konzepten im Langzeitgedächtnis Priming Implizites Gedächtnis (nicht-deklarativ, unbewusst) Wissen, das wir nicht bewusst abrufen, das aber unser Verhalten und unsere Gedanken beeinflusst Beispiel: Dividieren von Brüchen Deklaratives Wissen = ich kenne die Regel „mit dem Kehrbruch multiplizieren“ Prozedurales Wissen = ich kann die Regel anwenden Direkter und abrupter Lernvorgang Bildhafte und symbolische Abspeicherung in Netzwerken Semantisches Gedächtnis Episodisches Gedächtnis Explizites Gedächtnis (deklarativ, bewusst) Langzeiterinnerungen, die bewusst und absichtlich abgerufen werden können Gedächtnis (nach Woolfolk, 2008) 44 4.2 Gedächtnismodelle Das Langzeitgedächtnis 4.2 Gedächtnismodelle Die im Langzeitgedächtnis gespeicherte Information wird nicht gelöscht; sondern bei seltener Nutzung gehen die zur Enkodierung nützlichen Pfade verloren (diese können aber bei geeigneter Aktivierung durch Hinweise wieder benutzt werden) Total-Time-Hypothese: Wieviel gelernt wird, hängt direkt von der Menge der Zeit ab, die mit dem Lernvorgang verbracht wird 4.2.2. Theorie der Verarbeitungstiefe nach Craik und Lockhart (1972) Annahme Der Verarbeitungsprozess in der Aneignungsphase ist entscheidend für die spätere Erinnerungsleistung Oberflächliche Verarbeitung: Registrierung von sensorischen/ physikalischen Aspekten ohne genaueres Eingehen auf die Bedeutung der Information → Entstandene Gedächtnisspur ist nur von sehr kurzer Dauer (Mittlere Verarbeitung: Verarbeitung z.B. nur auf phonologischer Ebene) Tiefere Verarbeitung: Bedeutung der Information wird mit semantischem Hintergrundwissen (Vorwissen) verknüpft und so in dem bestehenden kognitiven Netzwerk verankert → Gedächtnisspuren werden dauerhaft Empirische Befunde Hyde & Jenkins, 1973 3 Gruppen von Probanden sollten das gleiche Wortmaterial auf unterschiedliche Weise lernen Gruppe 1: Wörter nach Angenehmheit einstufen Gruppe 2: Beurteilung, ob in den Wörtern bestimmte Buchstaben enthalten sind Gruppe 3: Entscheidung, ob das Wort in syntaktische Satzgruppen passt Ergebnis: Erinnerungstest: Gruppe 1 erinnert deutlich mehr als die anderen Gruppen Erklärung: Für das Fällen eines Angenehmheitsurteils muss der Anwendungskontext eines Wortes überdacht werden → führt zur Aktivierung semantischer Wissensstrukturen und zu einem reichhaltigem Aufbau von Assoziationen zwischen dem Wort und der vorhandenen Wissensstruktur Drei-Ebenen-Experiment von Craik & Tulving, 1975 Versuchspersonen mussten sich 60 Worte ansehen, zu denen jeweils eine Frage gestellt wurde o OBERFLÄCHLICHE Verarbeitung (z.B. Ist Begriff in Großbuchstaben geschrieben?) o MITTLERE Verarbeitung (z.B. Reimt sich das Wort auf…)? → phonologische Ebene o TIEFERE Verarbeitung (z.B. Kann das Wort ausgetauscht werden durch…?) Ergebnis: tiefer verarbeitete Worte wurden deutlich besser erinnert. 45 46 4.3 Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens Craik und Tulving (1975): semantische Verarbeitung ist unterschiedlich tief Probanden mussten entscheiden, ob unterschiedlich komplexe Satzanfänge mit den präsentierten Zielwörtern sinnvoll zu vervollständigen sind Ergebnis: Zielwörter für komplexere Sätze wurden besser erinnert Erklärung: Verarbeitung der komplexeren Sätze führte aufgrund von tieferen, mehr aktivierten Assoziationen zu stabileren Gedächtnisspuren Probleme Die Theorie macht keine Aussage darüber, wann eine Verarbeitung als „tief“ zu bezeichnen ist. Es gibt Personen mit Gehirnschäden, die zwar noch Aufgaben mit dem KZG ausführen können, jedoch keinen Zugriff mehr auf ihr LZG haben (Baddeley, 1974) → spricht für Dreispeichermodell 4.3. Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens 4.3.1. Begriffe und der Begriffserwerb Definition (Ferrari & Elik, 2003): Begriffe sind Kategorien, in der sich Gegenstände, Vorstellungen und Ereignisse anordnen lassen, die gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. Das Kategorisieren ermöglicht dem Menschen eine schnellere Verarbeitung. Man spricht von Begriffen als der „kleinsten Einheit des Denkens.“ Bsp.: Die Farbe Rot zeigt sich in den verschiedensten Farbtönen! Aber meist spricht man nur von Rot! Dewey (1933): Ein Begriff lässt sich am besten als eine Kategorie verstehen, die als ein kognitives Werkzeug in jeweils bestimmten alltäglichen Situationen verwendet werden kann. → Man muss auch wissen, wie man es verwendet! Begriffe repräsentieren Klassen von Objekten („Autos“), Aktivitäten („lesen“), Eigenschaften („groß“), Abstraktionen („Liebe“), Beziehungen („klüger als“) Hohe Ähnlichkeit zu Schemata: Begriffe beinhalten definitorische Merkmale, positive und negative Beispiele, Vorgehensweisen zur Klassifizierung, Beziehungen zu anderen Begriffen, affektive Assoziationen und Anwendungsregeln (Tessmer et al. 1990) 4.3 Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens Merkmale des Begriffswissens (nach Hoffmann) Hierarchische Struktur - Allgemeinere Begriffe umfassen spezifischere Begriffe: Pflanze Blume Rose Baum Tulpe Laubbaum Nadelbaum Kreuzklassifikation - Gleiches Objekt kann verschiedenen Begriffen zugeordnet sein: Herz Liebe Herzchirurgie Typikalität - Einige Objekte sind charakteristische Vertreter eines Begriffs: z.B. Rose als klassischer Vertreter von Blumen Einordnung von Beobachtetem in Kategorien Kategorisierung nach einer festgelegten Anzahl relevanter Merkmale – nach der (klassischen) Studie von Clark Hull (1920) – Ein Begriff wird gesehen als Bezeichnung für eine Kategorie, die nach bestimmten Regeln, Objekte/ Ereignisse einordnet. → Erlernen eines Begriffs = Lernen von relevanten Merkmalen Methode im Unterricht: Bildung und Prüfung von Hypothesen (nach Bruner, 1956) 1. Jede Kategorisierung durch das Vorhandensein einer kleinen Anzahl von relevanten Merkmalen definiert Bsp.: relevantes Merkmal = Dreieckig 2. Ein Objekt/ Ereignis ist nur dann Beispiel für eine Kategorie, wenn es Träger des relevanten Merkmals ist 3. Innerhalb einer bestimmten Abstraktionsebene sind einzelne Kategorien klar voneinander trennbar (→ nie zwei Kategorien gleichzeitig) und können nur auf einer höheren Ebene zusammengefasst werden 4. Relevante Merkmale nicht nach ihrer Bedeutung unterscheidbar, sondern alle sind gleich wichtig! Bsp.: Rechtwinklig und Dreieck sind als Merkmal gleich wichtig! Anwendbarkeit auf den Unterricht ist begrenzt: effektivere Lernleistung von Begriffen durch exakte Definitionen von Lehrern 47 48 4.3 Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens Prototypenansatz (Rosch, 1978) (vgl. Typikalität) Begriffe sind meist eher unscharf zu definieren (sog. Fuzzy-concept Theorie, engl. schwammig). Bsp: alltägliche Gebrauchsgegenstände sind nicht immer über eine bestimmte Anzahl von Merkmalen definierbar, z.B. kann eine Tasse verschiedenste Formen haben und nur schwer von „Becher“ zu unterscheiden sein Definition Ein Prototyp ist eine Art Mittelwert aller bisher gesehenen Beispiele und damit ein Muster-Beispiel, das den Begriff am besten darstellt. Dieser entsteht aus Erfahrungen und ändert sich ständig. Vogel Penguin Amsel Typisch ist ein Beispiel, wenn es möglichst nahe am Prototypen ist und wenig Abweichungen hat. Daher konzentriert man sich auf charakteristische (d.h. typische) Merkmale, nicht auf die relevanten. Z.B würde man Vögel durch die Fähigkeit zum Fliegen charakterisieren (!), obwohl es Vögel gibt, die nicht fliegen können (Pinguine) und auch flugfähige Tiere gibt, die keine Vögel sind (Fledermaus). Kritik an Prototypentheorie: Lässt situative Bedingungen unberücksichtigt (was ist in best. Umfeld typisch und was nicht?), bei abstrakten Begriffen (Gerechtigkeit) nicht anwendbar Prototyp Vogel fliegt Federn Eier Pinguin Schnabel Schnabel Eier → Pinguin ist damit kein typischer Vogel, wird aber als solcher erkannt Kategorisierung nach zahlreichen Musterbeispielen Theorie einiger Psychologen (z.B. Medin, 2000): Menschen speichern nicht nur einen Prototypen, sondern mehrere Förderung des Begriffslernens im Unterricht Frühe Protoypenbildung Kinder leiten Begriff von Beispielen ab, die als Prototypen gespeichert werden Kennenlernen eines neuen Objektes: wird mit dem bereits vorhandenem Prototypen verglichen und nach Ähnlichkeitsausdruck entscheiden, ob es einer gespeicherten Kategorie zugeordnet werden kann [vgl. Piaget’s Akkomodation und Akkumulation] 4.3 Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens Dies ist kognitiv einfacher handzuhaben und flexibler als eine Definition von Begriffen über feste Merkmale (z.B. auch wenn ein Hund nicht bellt, gehört er eindeutig in diese Kategorie, Bsp. von Lindsay & Norman 1977) Es ist nicht sinnvoll, wenn eine Klassifikation nur nach relevanten Merkmalen oder nur nach Prototypen vorgenommen wird. Lehrer sollten somit stets mit klassischen Beispielen beginnen und dann Merkmale herausarbeiten. Herausarbeiten von Netzwerk-Strukturen z.B. durch Concept Maps, in denen Schüler gelernte Dinge in Verbindung bringen Regeln zum Umgang mit Begriffen (nach Ditsch, 1978) Regelmäßige Wiederholung bekannter Begriffe In der Lernphase: Beschränkung auf einen prototypischen Anwendungsbereich Später: Übertragung auf andere Themenfelder 4.3.2. Propositionen Auf Grundlage von Lernerfahrungen entstehen zwischen den verschiedenen Begriffen Assoziationen, sogenannte Propositionen. Definition (Schunk, 2004): Eine Proposition ist die kleinste Bedeutungseinheit, die ein Urteil darüber zulässt, ob sie wahr oder falsch ist. Besteht aus mind. 1 Argument (Begriff) und 1 Relation (Verb oder Adjektiv) Bello gibt Susi den Knochen. = Argument = Relation = Argument = Argument Ermöglicht Reduktion von komplexen Informationen Behaltensleistung ist nicht von der Länge der Sätze abhängig, sondern von der Anzahl der Propositionen (Kintsch, 1998) Erwerb neuer Propositionen nach Gagné et al. (1993) Was passiert, wenn dem vorhandenen Netzwerk neue Informationen hinzugefügt werden sollen? 1. Darstellung einer neuen Informationseinheit durch den Lehrer 2. Der Lernende muss die Aussage des Lehrers zunächst in eine Proposition übersetzen 49 50 4.3 Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens 3. Begriffe dieser Proposition aktivieren die Erinnerung an bereits gespeicherte Zusammenhänge mehrere bereits bekannte und eine neue Proposition sind im Arbeitsspeicher aktiv 4. Ausgehend von den neuen Begriffen sowie den bereits bekannten Propositionen findet eine Aktivierungsausweitung statt, die eine neue Proposition aktiviert 5. Schlussfolgerndes Denken hat eine neue Proposition entstehen lassen. Sie ist als Ergebnis aufarbeitender Prozesse zustande gekommen. Elaborative Proposition Begriffe, die nicht mit Bekanntem in Verbindung gebracht werden können, gehen verloren! Problem: Mit Propositionen lassen sich keine größeren Wissenskomplexe speichern! 4.3.3. Das Schema als komplexe Wissenseinheit des Gedächtnisses Definition (Koriat, 2000) Ein Schema ist eine verallgemeinerte geordnete Wissensstruktur, die aus vorausgegangenen Erfahrungen mit einem Ereignis, einem Objekt oder einer Person entstanden sind. Beispiel: Das Schema Buch umfasst alle Erfahrungen, Merkmale die man im Laufe seines Lebens gesammelt mit Büchern und Lesen von Büchern gesammelt hat. Schemata fassen thematisch zusammenhängende Informationen (z.B. Begriffe / Propositionen) zu begrifflichen Teilsystemen eines Netzwerks zusammen. Sie reduzieren die Komplexität der Umweltereignisse durch Bildung überschaubarer Einheiten (Schulschemata, Alltagsschemata) und erlauben Schlussfolgerungen. Eigenschaften von Schemata KONTEXTSPEZIFISCH (Erfahrungs- und Kulturbedingt) z.B.: Kinder haben aus alltäglicher Erfahrung ein Schema zur Form der Erde gewonnen, das sich nicht in Einklang mit den Ergebnissen physikalischer Erkenntnisse bringen lässt EMOTIONSBESETZT (Claxton, 1990) z.B.: einige Menschen verbinden das Unterrichtsfach Mathematik mit negativen Erfahrungen, weil die Auseinandersetzung mit dort gestellten Aufgaben bei ihnen unangenehme Gefühle ausgelöst hat Schemata enthalten auch MENTALE MODELLE Definition Mentale Modelle (→ Bildhafte Vorstellung) sind umfassende, ganzheitliche Wissensstruktur mit verschiedenen Arten von Wissen mit unterschiedlichen Formaten (andere Modelle fließen mit ein). z.B.: physikalische Gegebenheiten wie „Warum springt der Ball?“ Definition Skripts sind Schemata, die typische Abfolgen von Ereignissen in einer alltäglichen Situation repräsentieren (auch Ereignis-Schemata genannt). Beispiel: Das Wissen, wie man sich beim Betreten eines Restaurants verhält. 4.3 Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens Arten von Skripts SITUATIONAL (bestimmte soziale Situation; z.B. Restaurantbesuch) PERSONAL (Erwartungshaltung; z.B. wie läuft eine Freundschaft ab) INSTRUMENTELL (gewisses Ziel; z.B. Schulweg) Empirie zur Bedeutung von Schemata: Liam Brewer, James Treyens (1981) Studenten wurden gebeten, in einem Arbeitszimmer eines Professors Platz zu nehmen. Nach 35 sec wurden sie in einen zweiten Raum gebracht und sollten völlig unerwartet aufzählen, was sich in dem Arbeitszimmer befand. Ergebnis: Studenten erinnerten sich an alles, was typischerweise in einem Arbeitszimmer zu finden ist. Aber es waren auch untypische Objekte im Arbeitszimmer, die nur von wenigen erinnert wurden (z.B. ein Totenschädel). Viele reproduzierten außerdem typische Objekte, die sich gar nicht in dem Zimmer befanden (z.B. Bücher). Erklärung: Während der Erinnerungsphase erfolgt eine Aufarbeitung der gespeicherten Informationen; dabei wurden… … Einzelheiten, die sinnlos vorkommen (nicht in das Schema passen), vergessen … Einzelheiten, die logisch sind (in das Schema passen), einfach hinzugefügt Vor- und Nachteile von Schemata Vorteile Schemata ersparen es dem Lernenden, für jeden neuen Reiz einen Speicherplatz zur Verfügung zu stellen → Unterstützung von Gedächtnisleistung Schemata strukturieren unübersichtliche Mengen an Informationen Schemata erhalten „freie Plätze“, sodass wichtige Informationen einfach hinzugefügt werden können Z.B.: Schema „Büro“ kann man „dienstlich“ oder „häuslich“ hinzufügen Viele Ereignisse lassen sich verlässlich vorhersagen Nachteile Beobachtungen/ Nacherzählungen können aufgrund von Schemata verfälscht werden (meist werden nur schema-konforme Reize wahrgenommen) 4.3.4. Wissensspeicherung in bildhaften Darstellungen Neben den Präpostionen besteht noch ein weiteres Konzept zur Speicherung von Wissensbeständen. Vorstellungsbilder (images) Theorie, dass Informationen oder Gegenstände bildartig im Gedächtnis abgespeichert werden (nach Anderson, 1995) Empirische Begründung (Mendell, 1971) Vergleiche das Fenster-in-der-Wohnung-Zählen-Beispiel: wäre diese Information im LZG als Proposition abgespeichert, so wäre die Abrufzeit unabhängig von der Größe 51 52 4.3 Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens der Wohnung etc. Dies ist allerdings tatsächlich nicht der Fall (d.h. je mehr Fenster, desto länger zählt man) Umstrittenes Konzept Manche Psychologen verneinen diese Speicherung und gehen davon aus, dass nur das Arbeitsgedächtnis die Propositionen in solche Bilder „umrechnet“. Dual-Encoding-Theory (Paivio, 1986) Experiment von Shepard (1967): 600 Kärtchen mit Wörtern, Sätzen oder Abbildungen wurden Probanden vorgelegt. Die Versuchspersonen bekamen immer 2 Karten vorgelegt (eine neue und eine aus dem Stapel). Sie sollten die Karte benennen, die aus dem Stapel war. Ergebnis: Bilder wurden zu 100%, Sätze zu 89% und Wörter zu 88% wiedererkannt. Prinzip der dualen Kodierung („Bild-Überlegenheitskonzept“, Paivio, 1986): Neues Wissen in Form von Bilder wird deshalb besser behalten, weil es auf zwei verschiedene Arten abgespeichert werden kann: im verbalen (symbolischsprachlichen) und im imaginalen (anschaulich-bildhaften) System. Sprachliches Material dagegen wird nur semantisch codiert und gespeichert. visuelle Vorstellun gsbilder verbale Einheiten Repräsentation im LZG Die Wahrscheinlichkeit, sich an eine der beiden Codierungen zu erinnern, ist damit höher. 4.3.5. Die Propositionale Vernetzungs-Theorie von John Anderson (2000) Diese Theorie stellt eine Zusammenführung der bisher diskutierten Konzepte der Begriffe, Präpositionen und Schemata dar. Informationen im deklarativen Gedächtnis werden mithilfe von unzähligen Propositionen abgespeichert, die miteinander in Beziehung stehen (Beispiel: das propositionale Netzwerk des Satzes „Peter wirft den neuen Ball“ ) 4.3 Netzwerktheorien der Speicherung deklarativen Wissens Wissensnetzwerke bestehen aus… … kleinen Knoten = Propositionen, mentale Vorstellungen, Schemata … großen Knoten = Schemata aus mehreren Wissenseinheiten … Kanten = Propositionen Beim Erinnern einer Information werden die im Netzwerk repräsentierten Bedeutungen in vertraute Sätze/ Phrasen oder Bilder übersetzt (man aktiviert einen Knoten) Aufgrund der propositionalen Vernetzung kann die Erinnerung einer Informationseinheit auch die Erinnerung anderer Informationen aktivieren → Aktivierungsausbreitung (Collins & Loftus, 1975) Wie schnell und wie viel uns zu einem Begriff/ Reiz einfällt, hängt von der Assoziationsstärke (höher bei häufiger erfolgreicher Verwendung der Wissenseinheit) der Knoten und der Anzahl der Verknüpfungen ab z.B.: Bei dem Wort „Vogel“ denken wir zuerst an Amseln, Rotkehlchen,… und später erst an Pinguine Jaqueline Sachs (1967) Probanden hörten eine Geschichte und am Ende wurde getestet, ob sie Sätze (aus der Mitte und vom Ende) wiedererkennen. Ergebnis: Sätze am Ende können getreu wiedergegeben werden Bei Sätzen aus der Mitte konnte nur deren Bedeutung wiedergegeben werden Bedeutung Ein Satz ist unmittelbar nach seiner Darbietung im Gedächtnis gespeichert; nach etwas Zeit, kann aber nur noch die Bedeutung der Aussage wiederholt werden Propositionale Netzwerke speichern nur die Bedeutung und nicht die wörtliche Formulierung 53 54 4.4 Speicherung Prozeduralen Wissens & die ACT-Theorie 4.4. Speicherung Prozeduralen Wissens & die ACT-Theorie 4.4.1. Einführung Definition Prozedurales Wissens ist das Wissen über Fertigkeiten, Operationen und Prozeduren („Wissen, wie“) Prozedurales Wissen: wird in der Regel aus deklarativem Wissen gewonnen wird durch Übung verbessert und automatisiert! (z.B. Sprechen, Fahrradfahren…) ist ohne große Anstrengung abrufbar ist oft schwieriger zu beschreiben als anzuwenden (z.B. Schuhebinden…) kann auch nach Jahren (wenn gut geübt) wieder schnell erworben werden wird unterschieden nach psychomotorischen Fertigkeiten (Autofahren) und kognitiven Fertigkeiten (Bruchrechnen) 4.4.2. ACT-Theorie (Anderson,1983) ACT steht für Adaptive Control of Thoughts. Es handelt sich dabei um eine komplette Theorie der menschlichen Informationsverarbeitung (Wahrnehmung, Sprache, Problemlösen etc.), die wir aber nur in Ausschnitten behandeln. Wissensstruktur für Fertigkeiten Fertigkeiten lassen sich mit Hilfe von „Handlungsvollzugsregeln“ beschreiben, die aus einer Reihe aufeinander bezogener Produktionsregeln bestehen. Bedingungsteil: Handlungsregel: WENN DANN eine oder mehrere Voraussetzungen eine oder mehrere Handlungen Bsp.: WENN Auto im 1. Gang und schneller als 20 km/h und es hat Schalthebel, Kupplung etc. DANN drücke Kupplung, ziehe Schalhebel in 2. Gang, etc. Unterscheidung von drei Gedächtnissystemen in der ACT-Theorie DEKLARATIVES GEDÄCHTNIS: Speicherung von Wissen in Form von Netzwerken aus Propositionen (Wissen in abstrahierender Weise, also nach Sinngehalt), Reihenfolgen (Wissen über die Reihenfolge selbst, nicht voll ausformuliert) und räumlichen Bildern. PROZEDURALES GEDÄCHTNIS: Hier sind Prozeduren (Fertigkeiten) als WENNDANN-Verknüpfung (Produktion) gespeichert. Es finden sich auch unbewusste Selektionsmechanismen. ARBEITSGEDÄCHTNIS (AG):Hier sind alle Informationen, die dem Bewusstsein im Moment zugänglich sind, aktiviert (z.B. Sinneseindrücke, die gerade enkodiert werden). 4.4 Speicherung Prozeduralen Wissens & die ACT-Theorie DEKLARATIVES GEDÄCHTNIS PROZEDURALES GEDÄCHTNIS Direkt und abrupt (kognitive Einheiten im Arbeitsgedächtnis werden zu Spuren in LZG) Indirekt und über allmähliche Schwächung bzw. Stärkung neuer Prozeduren (z. B. Umlernen auf Schreibmaschine). Prozeduren können erst nach langem Üben erworben werden, es wird solange geübt, bis Fertigkeit automatisiert ist (z. B. Sprechen) Auf vielfältige Weise möglich Die Richtung ist hier vorgegeben: WENN DANN Wenn Information im Arbeits-gedächtnis dem Bedingungsteil (WENN) genügt, so wird Handlungs-wissen (Aktionsteil, DANN) abgerufen. Abruf Lernvorgang Prozess des Wissenserwerbs im deklarativen ↔ prozeduralen Gedächtnis Stufenmodell zum Fertigkeitserwerb nach Fitts und Posner (1967) Kognitive Stufe Erwerb deklarativen Wissens über die Fertigkeit Assoziative Stufe Überführung deklarativen in prozedurales Wissen Autonome Stufe Verbesserung der Fertigkeit Stufe 1: (Kognitive Stufe) Beschreibung der Prozedur Lerner erwirbt Wissen über den genauen Ablauf der Fertigkeit und deren Ausführung (= Produktionsregel) Regel ist dann als Wissen in deklarativer Form im Gedächtnis präsent. Beispiel: Autofahren: Der erste Gang ist vorne links. Stufe 2: (Assoziative Stufe): Ausbildung einer Prozedur für die Ausführung Bei weiterer Übung wird eine spezielle Prozedur für die Fertigkeitsausführung ausgebildet, indem das deklarative Wissen (d.h. die Regel für die Fertigkeit, z.B. Position der Gänge) in eine prozedurale Form überführt wird (Vorgang der Wissenskompilierung). Man braucht sich die Regel nicht mehr ständig vergegenwärtigen (Entlastung des AG) Handlungsausführung wird immer flüssiger deklaratives Wissen bleibt verfügbar, aber prozedurales Wissen bestimmt Handlungsausführung („friedliche Koexistenz“) Beispiel: Lernen, Kupplung kommen mit Gas geben zu kombinieren, um ruckfrei anzufahren Stufe 3: (Autonome Stufe): Automatisierung der Fertigkeit schnellere und sichere Ausführung Vorsagen der Regel verschwindet (keine kognitive Steuerung mehr!) unbewusst 55 56 4.5 Wissenserwerb/ Aufbau von Wissen Deklaratives Wissen tritt vollständig zurück (z.T. keine Verbalisierung mehr möglich) Beispiel: Position der Gänge nur durch direkte Ausführung, unbewusstes Handeln Zusätzliche Vorgänge bei der Wissensoptimierung: Generalisation: Erweiterung der Anwendungsbedingungen einer Produktion auf weitere Fälle o Bsp.: WENN Mantel mir gehört, DANN sage ich „mein Mantel“ - WENN Ball mir gehört, DANN sage ich „mein Ball“ o Generalisierung: WENN Objekt mir gehört, DANN sage ich „mein Objekt“ Diskrimination: Anwendung von Produktionen wird durch Zusatzbedingungen spezifiziert und somit auf geeignete Umstände beschränkt! o Bsp. von oben: übermäßig allgemein, „Objekt“ an bestimmte Werte gebunden gesonderte Regel: WENN Objekt mir gehört und Objekt weiblich ist, DANN sage ich „meine Objekt“) Verstärkung: Falsche Regeln werden eliminiert, erfolgreich angewandte bekräftigt Besonderheiten beim Erlernen von Fertigkeiten Reeminiszenseffekt: Leistungssteigerung ohne Lernen! Ist man dabei, eine Fertigkeit zu lernen, so beherrscht man diese nach einer Pause besser als vorher! (Irion, 1949) Auch Fertigkeitserwerb ohne vorhergehendes deklaratives Regelwissen und ohne Erinnerung an die Lernepisode (z.B. Lautbildung bei Kleinkindern; Kontrolle des Muskelapparats, etc.) 4.5. Wissenserwerb/ Aufbau von Wissen Informationen aus dem sensorischen Register müssen erst intensiv aufbereitet werden, wenn sie in das Langzeitgedächtnis übertragen werden sollen. Dies kann nur unter gewissen Umständen stattfinden: 4.5.1. Allgemeine Aspekte Elaboration Verknüpfung neuer Wissensinhalte (Begriffe, Propositionen, Schemata etc.) mit bereits bestehendem, d.h. im Gedächtnis repräsentiertem, Wissen! Dadurch wird neuer Informationen mehr Sinn verliehen. Elaborative Prozesse: Notwendige Elaboration: Vorwissen muss notwendigerweise aktiviert werden (ohne Vorwissen Verständnisschwierigkeiten). Bsp.: „Vitamin C fördert die Bildung weißer Blutkörperchen“ Lerner muss Infomationen, die darin enthalten sind, aktivieren (Was ist Vitamin C?) 4.5 Wissenserwerb/ Aufbau von Wissen Fakultative Elaboration: Anregung zu Gedanken/ Assoziationen/ Schlussfolgerungen, die nicht unbedingt zum Verstehen erforderlich sind, aber eine vielfältige Verknüpfung der Informationen mit der eigenen Wissensstruktur bewirken. Elaboration ist auch wichtig für das Behalten von Wissen über Sachverhalte. Enkodieren eines Sachverhaltes durch Zufügen vieler Propositionen zum Netzwerk bessere Erinnerung Rekonstruktion kann auf mehr Anhaltspunkte zurückgreifen (Anderson & Reder, 1979). Organisation: Eine gute Organisation ist vor allem beim Lernen komplexer und weit ausholender Informationen sehr wichtig. Organisationsprozesse: Ordnen der Lerninhalte nach thematischen Kategorien (Clustering) Bsp.: Wortliste lernen einordnen in Kategorien Reduktion der Lerninhalte auf das Wesentliche Überführen des Wissens in übliche Darstellungsformen Erwerb komplexer Texte: Aufbau von semantischen Strukturen durch wiederholte Anwendung von Makrooperationen: Weglassen, Selektion, Generalisation, Konstruktion, Rückgriff auf bereits Bekanntes Lernen mit Vergleichen ist sinnvoll, da neue Informationen besser vorstellbar sind und eine strukturierende Funktion aufweisen. Durch Vorstellungen werden neue Informationen aktiv assimiliert neue Information in der „Bibliothek“ des Lerners Kontext Aspekte wie die Umwelt oder Emotionen bei Lernprozessen werden mit den Informationen gespeichert. Abrufen wird erleichtert, wenn der Kontext beim Abruf der gleiche ist wie beim Speichern (sog. Enkodierungsspezifität). Bsp.: Werden Vokabeln unter Wasser gelernt, so werden diese dort auch besser erinnert als an Land. 4.5.2. Bedeutung des Vorwissens Unterschiede im Vorwissen wirken sich auf die Informationsaufnahme und die Informationsverarbeitung von Informationen aus. Ausbubel (1978) sagt sogar, dass Vorwissen der wichtigste Faktor bei Lernprozessen ist. Empirische Befunde: Klassische Studie von Bartlett zur Konstruktionshypothese (1932) Probanden wurde eine Geschichte aus fremdem Kulturkreis erzählt Diese sollten sie erneut wiedergeben Eintreten von drei Effekten o Nivellierung: Vereinfachung von Zusammenhängen 57 58 4.6 Konzeptuelle Veränderungen o Akzentuierung: Hervorheben bestimmter Details o Assimilation: Veränderung zur besseren Passung mit eigenem Vorwissen Besonders die letzten beiden deuten auf eine Schema-Anwendung hin, die die Aufnahme beeinträchtigt hat Deutlich: auch negative Folgen von Vorwissen (Wahrnehmungsverzerrung) Pressley und Brewester (1990) Fünft- und Sechtsklässler hatten gelernt, Landschaftsbilder zu den zugehörigen Orten zuzuordnen Danach: sollten Details aus den Bildern lernen Ergebnis: Nur wenn Schüler aufgefordert wurden, ihr Vorwissen einzusetzen, zeigten sich deutliche Vorteile gegenüber einer Kontrollgruppe Vgl. Brewer und Treyens (bei Schemata) 4.6. Konzeptuelle Veränderungen Schüler halten oft sehr lange an Vorwissen fest, auch wenn Lehrer wiederholt dazu widersprüchliche Erfahrungen darstellt Beispiel aus NatWi-Unterricht der 5. Klasse (nach Anderson & Smith, 1984) Falsches Vorwissen: „Damit ich einen Baum sehen kann, muss die Sonne ihn anleuchten.“ Richtige Aussage: „Einen Baum sehe ich, wenn Lichtstahlen auf ihn treffen und von ihm reflektiert werden. → Ende der Unterrichtssequenz waren dennoch nur 20% von der ursprünglichen Aussage abgewichen Roth (1990): Wenn man Schülern erklärt, ihre Vorstellungen seien falsch, und ihnen sagt, sie müssten durch bessere ersetzt werden, führt dies nicht zur aktiven Wissenskonstruktion Gründe für das Festhalten an altem Wissen Schüler „lernen“, dass es in der Schule reicht, auf bestimmte Fragen die richtigen Antworten zu geben, nicht die Problematik zu verstehen, was eine Änderung eigener Vorstellung nötig machen würde Confirmation bias: Menschen suchen stets tendenziell nach Befunden, die eigene Vermutungen stützen; während andere einfach ignoriert werden Übereinstimmung eigenen Vorwissens mit Alltagserfahrungen über eine langen Zeitraum hinweg (das Vorwissen gibt einem damit auch Sicherheit) – die oft sehr abstrakten Gegenbegründungen dagegen erscheinen als Ersatz wenig attraktiv Trotz widersprüchlicher Informationen verhindern Schüler konzeptuelle Veränderungen: sie leugnen dann die Realität oder beschäftigen sich nur oberflächlich mit den neuen Aussagen 4.6 Konzeptuelle Veränderungen Umgang mit neuen Informationen nach Appleton (1993) Tatsächliche oder vermeintliche Übereinstimmung mit bestehenden Vorstellungen [Assimilation]: Ein kognitiver Konflikt → zurecht oder zu Unrecht wird Vorwissen bestätigt Anlass für Maßnahmen zur Veränderung eigener Vorstellungen: Kognitiver Konflikt wegen fehlender Passung neuer Informationen; Beseitigung durch Akkomodation, d.h. durch Anpassung der eigenen Vorstellungen Neue Information wird nur oberflächlich gespeichert Diskrepanz wird wahrgenommen, ohne eigenes Wissen zu ändern; stattdessen wird Info nur oberflächlich gespeichert und steht in anderen Kontexten nicht zur Verfügung → Gelerntes wird in schulischen Kontexten abgerufen, aber das eigenen Konzept bleibt gleich! Lernsituation wird ohne irgendwelche Abspeicherung oder Veränderung verlassen Förderung konzeptueller Veränderungen Zunächst ist eine Diagnostik unzureichenden Wissens und dazu offene, fehlertolerante Unterrichts-Atmosphäre nötig. Danach folgt die Vorführung eines Experiments oder Zusammenhangs, der Fehlkonzepten widerspricht. Damit sich die Schüler weiter mit der Problematik auseinandersetzen, sollten Strategien angewandt werden: Voraussetzung für konzeptuelle Veränderungen (Posner, 1982) o Unzufriedenheit mit bisherigen Vorstellungen [Vertrauen, dass eigene Vorstellung richtig ist, muss beseitigt werden; radikale Veränderung eigener Vorstellungen als einziger Ausweg] o Existenz einer plausiblen Alternative o Erkennen des Unvereinbarkeit zwischen Vorwissen und neuer Information o Akzeptanz der alternativen Konzeption o Bewährung der alternativen Konzeption: muss der alten Vorstellung eindeutig überlegen sein Gedankliche Konfrontation (Champagne, 1985) o Vorhersage der Schüler über Experimentausgang o Erklärung der Vorhersage o Demonstration des Experiments durch Lehrer und Erklärung o Diskussion zwischen Lehrer und Schülern Einfluss von Mitschülern o Überprüfungen eigener (nicht fremder!) Vorstellung im Gespräch o Ziel: Entdeckung eigener Wissenslücken bzw. Unzulänglichkeiten und explizite, also geordnete Darstellung eigener Theorien o Prozess schließt ein, Beispiele für eigene Theorie zu finden und Einwänden zuvorzukommen (→ Perspektivenwechsel) Hoher Zeitaufwand zur Konstruktion und Durchführung solcher Lernsituationen 59 4.7 Vergessenstheorien 4.7. Vergessenstheorien Sowohl im Arbeits- als auch im Langzeitgedächtnis findet Vergessen statt. Folgende Theorien zur Erklärung sind vorherrschend. Teilweise wird auch die Meinung vertreten, dass Informationen im Langzeitgedächtnis nie vergessen werden und durch geeignete Hinweisreize stets abgerufen werden können. Vergessenskurve nach Ebbinghaus (1885) und Baddeley (1986) Ebbinghaus (1885) gilt als Begründer der experimentellen Gedächtnispsychologie. Er ging von einem einzigen undifferenzierten Gedächtnisspeicher aus und untersuchte das reine Maß an Gedächtnis. Sein Maß der Kapazität war der Ersparnisgrad: er lernte eine Liste völlig unsinniger Wörter und Sätze auswendig, bis er sie perfekt beherrschte und zählte die Durchgänge. Anschließend lernte er die Liste nach ein paar Tagen wieder. Falls er weniger Versuche benötigte, war eine Ersparnis eingetreten. Vergessenskurve 58% 44% 21% 31 Tage 25% 6 Tage 28% 2 Tage 33% 1 Tag 9 Stunden 1 Stunde 36% 20min 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% sofort 60 Vergessenskurve: Prozent der behaltenen Inhalte nach bestimmten Zeiträumen Theorie des Spurenverfalls Wissen (d.h. die Verbindung von Nervenzellen, daher Spuren) verschwindet mit der Zeit Biologische Begründung: Nervenverbindungen werden schwächer und können irgendwann nicht mehr reaktiviert werden; manchen sterben gänzlich ab. Problem: Oftmals können solche Informationen durch richtige Hinweise/ Umgebung etc. doch wieder abgerufen werden → Theorie ist fragwürdig Interferenztheorie Interferenz tritt auf, wenn sich neuere und frühere Lerninhalte hochgradig ähneln. z. B. Schüler muss im Unterricht wiederholt auf ähnliche Fragen unterschiedliche Antworten geben 4.8 Schlussfolgerungen für den Unterricht Bei der Interferenztheorie unterschieden wird zwischen 2 verschiedenen Möglichkeiten 1. „proaktive Hemmung“ = Interferenz (Störung) Erlernen von Liste 1 Erlernen von Liste 2 Gedächtnisverlust bei Wiedergabe der Liste 2 Ein unmittelbar vorhergegangener Lernprozess beeinträchtigt das Lernen folgender Inhalte. 2. „retroaktive Hemmung“ Erlernen von Liste 1 Erlernen von Liste 2 Gedächtnisverlust bei Wiedergabe der Liste 1 Interferenzen sind besonders bei hohem Umfang des Lernstoffs sowie fehlender Verarbeitungstiefe (Verarbeitung führt zu besserer Ordnung und besserem Behalten) bedeutsam. Fehlen geeigneter Abrufreize Vergessen als misslungener Abrufversuch von Inhalten Vergessen bzw. Beeinträchtigung des Behaltens bedeutet nicht gleichzeitig, dass die entsprechenden Gedächtnisinhalte ausgelöscht worden sind. Ashcraft (2002): Aus dem Langzeitgedächtnis geht nichts verloren, was diesem einmal übergeben worden ist → Vergessen ist Misslingen des Abrufs von Inhalten aus diesem Speicher. Vergleich mit Bibliothek: man findet das Buch nicht, obwohl es da ist (steht thematisch falsch). 4.8. Schlussfolgerungen für den Unterricht Die Qualität der Unterrichtsarbeit beeinflusst, wie schnell schulisches Wissen im Verlauf weiterer Lebensjahre wieder vergessen wird. 4.8.1. Lehrer- und Lernerrollen Aufgabe des Lehrers in kognitiven Theorien 1. Vermittlung von objektivem Wissen (ähnlich einer Datenweitergabe von USB-Stick auf PC), 61 62 4.8 Schlussfolgerungen für den Unterricht 2. Vermittlung zerlegbarer und dekontextualisierter (abstrakt, kein sinnvoller Kontext) Wissenselemente, 3. Überprüfung des Gelernten nach dem Grad der Übereinstimmung von Input und Output (je größer die Übereinstimmung, desto größer die Annäherung an das Lernziel) Aufgabe des Schülers Aufnahme, Behalten, Speicherung und Abruf des („Schwammmethode“: aufsaugen, sammeln, herauspressen) vermittelten Wissens 4.8.2. Hinweise für den Unterricht Anknüpfen an Vorwissen Diagnostik: Inwiefern verfügen Schüler bereits über Wissen, an das angeknüpft werden kann? Wiederholung nötiger Informationen (Reaktivieren von Wissen) → Einstieg als besonders wichtiges Unterrichtselement Aufmerksamkeit Der Lehrende muss dafür sorgen, dass der Lernende seine Aufmerksamkeit auf die Inhalte richtet (z.B.: Entwicklung von Fragen bei den Schülern) Motivierender Einstieg Vielseitige Auseinandersetzung mit dem Stoff Verwendung von Beispielen, graphische Darstellungen Wiedergabe in eigenen Worten, Erklären von Zusammenhängen Einsatz des erworbenen Wissens auch außerhalb der Schule Präinstruktionale Maßnahmen (= dem Unterricht vorangestellt): Ziel: Überbrückung von Lücken zwischen Vorwissen und zu erlernendem Wissen Vortests: Aufgabe besteht darin, dem Lerner wesentliche Aspekte des zu erarbeitenden Stoffes zukommen zu lassen, ohne diese ausdrücklich zu benennen Strukturierungs- und Selektionsprozess Advanced Organizer (Ausubel, 1960): geistige Stütze Strukturierungshilfe, die beim Lernenden relevantes Vorwissen aktivieren und so eine Brücke zwischen vorhandenem und neuem Wissen herstellen soll bessere Einordnung Einsatz von Techniken Aufarbeitungsstrategien: Markieren, Mind-Maps etc. Mnemotechniken für schwer zu merkende Fakten 4.8 Schlussfolgerungen für den Unterricht Materialien im Unterricht geordnet darbieten Ausubel (1963): Lernmaterial kann nur potentiell sinnvoll sein; Verständnis kann bei Schüler nur durch aktives Interpretieren seiner Erfahrungen enstehen Aufgabe des Lehrers ist es, die Erfahrungen mitzugestalten. Die Klarheit der Lehrerdarstellung durch Anwendung von Beispielen, Abbildungen, die Ordnung des Lernmaterials nach logischen Gesichtspunkten und die Strukturierung des Lernstoffes sind Kennzeichen geordneten Unterrichts! Einsatz von Tabellen, Hierarchien, Mindmaps etc. Ziel: durch zeitlich aufeinanderfolgende zusammenhängende Wissensstrukturen aufbauen. Informationen beim Lesen 4.8.3. Empirische Befunde Die Absicht, neues Lernmaterial gut im Gedächtnis zu verankern, tritt erst in der frühen Adoleszenz auf (Flavell et al., 2002) Aufarbeitungsprozesse werden gefördert, indem Schüler auf bereits verfügbaren Erfahrungen und Wissen aufbauen (Sigmund Tobias, 1982) Intensivere Verarbeitung fördert die spätere Erinnerungsleistung → beste Behaltensleistung, nachdem Begriffe semantisch verarbeitet wurden (→ Theorie der Verarbeitungstiefe) Langsames und sorgfältiges Lesen eines Textes = oberflächliche Verarbeitung; erst wenn der gelesene Inhalt in eigenen Worten wiedergegeben werden soll wird die Behaltensleistung gefördert (Glover et al., 1981) → PQ4R-Verfahren Bilder werden besser als akustische Reize behalten, da sie sich in bildhafter und sprachlicher Form enkodieren lassen (→ Shepard, 1967) Problem: keine wirklichkeitsgetreue Wiedergabe bildhafter Vorstellungen, da das Gedächtnis nur Merkmale speichert, welche zur Identifikation und zur Unterscheidung wichtig sind (Nicherson & Adams, 1979; Jones, 1990) z.B.: täglicher Gebrauch des 10-Euro-Scheins, aber wo genau steht die 10 auf dem Schein? „Selbstbezugseffekte“ fördern die Lernmotivation und die Gedächtnisleistung (Klein & Kihstrom, 1986; Rogers et al., 1999) Wiederholte Misserfolge führen dazu, dass Kinder keine Anstrengung mehr in die Verarbeitung investieren (Appleton, 1997) Zur Strukturierung: Vergleich von Erinnerungsleistung Studierender bei Begriffen angeordnet nach Zufallsprinzip und bei angeordneten Begriffen → mit Anordnung: dreimal mehr Begriffe reproduziert (Bower, 1969) 63 64 5.1 Formen des Konstruktivismus 5. KONSTRUKTIVISTISCHE LERNTHEORIEN Definition (Woolfolk, 2008): Der Konstruktivismus ist ein Lernauffassung, nach der Lernen nicht nur als das Empfangen und Verarbeiten von Informationen gesehen wird. Lernen ist vielmehr die aktive und individuelle Konstruktion von Wissen. Aufgrund der Entwicklungen und Fortschritte der Menschheit und der damit verbundenen Probleme (Umweltverschmutzung, Epidemien, globale Erwärmung) scheint die Erziehung von „passiven“ Lernern nicht mehr auszureichen, was zur Entstehung dieser neuartigen Theorien führte. Kernannahmen Wissen wird individuell aufgebaut, nicht mechanisch abgebildet Lerner: sucht aktiv und zielgerichtet nach Informationen, interpretiert diese und leitet neue Konzepte ab Betonung von selbstgesteuertem Lernen und Selbstkontrolle 5.1. Formen des Konstruktivismus Hauptanliegen: Konstruktion individuellen Wissens, Überzeugungen, des Selbstkonzepts mit Fokus auf das Innenleben der Menschen Kognitiver Konstruktivismus in Anlehnung an Piaget Beschäftigt sich damit, wie Logik und universales Wissen entsteht, das nicht direkt durch Umweltfaktoren beeinflusst wird Wissen ist subjektiv, da selbst aufgebaut und kein wirklichkeitstreues Bild Piaget: Umwelt ist wichtig, kann aber nicht zu einer Änderung im Denken führen Unterscheidung zwischen A) RADIKALEM KONSTRUKTIVISMUS kein eindeutiges Wissen von dieser Welt, jeder konstruiert sich seine eigene Wirklichkeit, Lernen selbst initiiert und selbst überwacht - Lehrer überflüssig? B) GEMÄßIGTEM KONSTRUKTIVISMUS Mitglieder einer Lerngemeinschaft können sich beim Aufbau von Wissen gegenseitig beeinflussen, Lernen auch extern initiiert und motiviert Diese Form wird in der pädagogischen Psychologie näher betrachtet. Sozialer Konstruktivismus in Anlehnung an Wygostski Lernen ist geprägt durch soziale Interaktion und kulturelle Hilfsmittel Lerner eignen sich Wissen durch Teilnahme an Aktivitäten mit anderen an → Lernen in sozialen und kulturellen Kontexten 5.2. Wissenserwerb gemäß konstruktivistischer Theorien Es existieren drei mögliche Erklärungen für den Wissenserwerb 1. Die Realität leitet die direkte Wissenskonstruktion an Lerner re-konstruieren die äußere Wirklichkeit in Form von Repräsentationen. Je mehr eine Person lernt, desto detaillierter wird diese Darstellung Bsp.: Informationsverarbeitungs-Theorien 5.3 Implikationen für den Unterricht 2. Interne Prozesse steuern die Konstruktion Beispiele dafür wären Akkomodation und Assimilation von Schemeta nach Piaget; dabei wird neues Wissen aus Altem abstrahiert 3. Externe und interne Faktoren steuern die Wissenskonstruktion Beispiel: Wygotskis Theorie, nach der kognitive Entwicklung durch kulturelle Teilhabe stattfindet 5.3. Implikationen für den Unterricht Aufgabe des Schülers: Ähnlich zu kognitiven Behaviorismus, aber mit Fokus auf selbstständiges Finden und Anwendung von Wissen (Aktiv statt passiv) Aufgabe des Lehrers: 1. SCHAFFUNG VON UMGEBUNGEN, durch die den Lernenden geholfen wird, diese Wege selbst zu gehen. Beispiel: Konstruktivismus: Lehrer unterrichtet, stellt Ziegelsteine bereit, reicht sie den Schülern, damit diese dann ihr Haus (= Wissen) selbst bauen können Informationsverarbeitungstheorien: Lehrer unterrichtet, setzt selbst Ziegelstein auf Ziegelstein und errichtet das Haus 2. AUFMERKSAMKEIT DER SCHÜLER auf ihr z. T. unzulängliches Verständnis und ihre falschen Überzeugungen richten 3. SCHAFFUNG VON MOTIVIERENDEN UNTERRICHTSSITUATIONEN für eine soziale Abstimmung über die subjektiven Wissenskonstruktionen der Schüler (durch Kommunikation, gegenseitiges Fragenstellen, Wissen vergleichen, überprüfen, abstimmen) gemeinsame Erarbeitung eines tieferen Verständnisses Konkrete Hinweise Lernen sollte in komplexe und realistische Umgebungen eingebettet sein Keine Behandlung von einfachen Schritt-für-Schritt-Aufgaben, sondern komplexer Probleme Soziale Verhandlungen als Teil des Lernens Erörterung und Verteidigung der eigenen Position Zusammenarbeit mit anderen und Respekt vor anderen Standpunkten Einsatz vielfältiger Ansätze und Benutzung multipler Repräsentationen Bei zu engen Beispielen verfügen Lerner nur über eine, zu eingeschränkte Sichtweise von Konzepten Selbstaufmerksamkeit seitens des Lehrers und Bewusstsein, dass Wissen konstruiert ist Schüler sollten darüber aufgeklärt werden, dass sie eine zentrale Rolle bei der Konstruktion von Wissen spielen 65 66 6.1 Steuerung des eigenen Lernens 6. SELBSTGESTEUERTES LERNEN 6.1. Steuerung des eigenen Lernens Aus sozial-kognitiver und vor allem konstruktivistischer Perspektive ist nötig, den Lerner in sein eigenes Lernen einzubinden und ihm Verantwortung zu übertragen. „Selbststeuerung ist eine notwendige, sinnvolle und zielführende Form der individuellen Anpassung, die Lerner selbst vornehmen können (und sollen).“ (Hasselhorn & Gold, 2013) – Begründungen: Solche Lerner nehmen sich auch außerhalb des Unterrichts die benötigte Zeit, um zusätzlich zu üben Nach den klassischen Bildungsinstitutionen sind wir darauf angewiesen, selbstständig zu lernen 6.1.1. Definitionen Definition (Zeidner, Boekarts & Pintrich, 2000): Selbststeuerung des Lernens ist ein aktiver, konstruktiver Prozess, bei dem sich Lernende eigenständig Ziele setzen sowie ihre Kognitionen, ihre Motivation und ihr Verhalten während des Lernens stetig überwachen, regulieren und kontrollieren. Definition (Weinert, 1982): Lernformen werden als selbstgesteuert bezeichnet, bei denen "der Handelnde die wesentlichen Entscheidungen, ob, was, wann, wie und woraufhin er lernt, gravierend und folgenreich beeinflussen kann". Ebenen, auf die sich selbstreguliertes Lernen stets bezieht (Hasselhorn & Gold, 2013) Kognitionen Metakognition Motivation Emotion Selbstreguliertes Lernen ist nicht eine allgemeine geistige Fähigkeit oder eine akademische Fertigkeit, sondern ein transaktionaler, selbstdirektiver Prozess, bei dem Lernende ihre geistigen Fähigkeiten nutzen, um aufgabenbezogene akademische Fertigkeiten zu entwickeln und elaboriertes/ anschlussfähiges Wissen aufzubauen. Selbstreguliert Lernende als Meister des eigenen Lernprozesses Selbstreguliert lernende Schüler gestalten, kontrollieren und beeinflussen ihren Denkund Lernprozess, ihre Gefühle und ihr Verhalten, um ihre Lernziele zu erreichen. Sie setzen sich anspruchsvolle Ziele und konkretisieren diese in Handlungsplänen. Zudem sind sie überzeugt, dass Ziele erreichbar sind. Sie wenden ihre umfangreichen Kenntnisse über Lernstrategien an. Sie beobachten, vergleichen und korrigieren Lernprozesse. Sie nutzen effektive Umwelt- (wann? Wo?) und Sozialbedingungen (mit wem?) → selbstreguliert lernende Schüler weisen günstigere Lernprozesse auf, erzielen bessere Leistungen und sind motivierter (Zimmermann & Schunk, 2001) Voraussetzungen selbstgesteuerten Lernens: Freiheit im Treffen von Entscheidungen (Zimmermann, 1994, 1998) Übernahme von Verantwortung (Deci & Ryan, 1991) 6.2 Theorien des Selbstgesteuerten Lernens Lehrer müssen bereit sein, sich von der strikten Kontrolle des Schülerverhaltens zu lösen und allenfalls beratend, in zurückhaltender Weise auch lenkend auf Lernende einwirken, sich selbständig und selbstverantwortlich mit Aufgaben auseinanderzusetzen 6.2. Theorien des Selbstgesteuerten Lernens 6.2.1. Phasen der Selbststeuerung (nach Zimmermann, 2008) Vorausschauphase [prä-aktional] SelbstreflexionsPhase [postaktional] Performanzphase [aktional] Vorausschauphase o MOTIVATIONALE ÜBERZEUGUNGEN (Wirksamkeitserwartungen, Wissensbestände, Interesse, Emotionen etc.) o AUFGABENANALYSE: Zielsetzung und strategische Planungen aktuelle Performanzphase: Ausführung der geplanten Strategien o SELBSTKONTROLLE: Selbstinstruktion [Strategien vorsagen], Fokussierung der Aufmerksamkeit, Strategieanwendung o SELBSTBEOBACHTUNG: metakognitives Monitoring, Self-recording [Registrierung und Protokollierung eigener Leistungen] Selbstreflexionsphase o SELBSTBEURTEILUNG: Evaluation und Kausalattributionen o SELBSTREAKTION: Zufriedenheit mit Leistung, Beibehaltung des Vorgehens (defensiv) oder Motifikation der Arbeitsweise (adaptiv) Im Gegensatz zu Prozessmodellen, die den Ablauf von selbstreguliertem Lernen schildern, beschreiben Komponentenmodelle, welche Wissensbestände zum selbstregulierten Lernen nötig sind. 67 68 6.2 Theorien des Selbstgesteuerten Lernens 6.2.2. Drei-Schichten-Modell des selbstregulierten Lernens (Boekaerts, 1999) Innere Schicht: Regulation der Informationsverarbeitung (kognitiv): konzeptuelles und prozedurales Wissen; Wissen über aufgabenspezifische kognitive Strategien (einschließlich ihrer Anwendungsbedingungen) Mittlere Schicht: Regulation des Lernprozesses (metakognitiv): Kontrolle der eingesetzten Strategien, Einsatz metakognitiven Wissen und metakognitiver Strategien Äußere Schicht: Regulation des Selbst (motivational und volitional): dienen der Initiierung (Selbstmotivierung) und Aufrechterhaltung (Willenskontrolle) von Lernaktivitäten; adaptive Bewertungen eigener Lernergebnisse 6.2.3. Entwicklung der Selbststeuerung (Deci & Ryan, 2000) 1. Stadium der äußerlichen Regulation: Tätigkeiten werden nur ausgeführt, weil nach einem erfolgreichen Abschluss lobende Anerkennung erwartet wird (v.a. jüngere Schüler). 2. Introjizierte Regulation: Aufgaben werden ausgeführt, da sonst ein schlechtes Gewissen bestehen würde; Instanzen in der Person übernehmen eine gewisse Kontrolle, aber die Veranlassung erfolgt immer noch von außen, denn man folgt, um andere zufrieden zu stellen (Pintrich & Schunk 2002); Werte werden unkritisch übernommen. 3. Identifizierte Regulation: Auseinandersetzung mit einem Arbeitsgebiet, dass für einen persönlich wichtig ist; Schüler verfolgt sein eigenes Ziel, aber erfüllt immer noch Anforderungen, die andere ihm gesetzt haben 4. Integrierte Regulation: Schüler setzt sich selbst Leistungsziele, die er um ihrer selbst willen anstrebt; viele Menschen erreichen dieses letzte Stadium nie; diejenigen, die sich integriert zu steuern vermögen, fühlen sich ferner liegenden Zielen verpflichtet und haben gute Aussichten, erfolgreich im Leben zu sein (Pintrich & Schunk 2002) 6.3 Förderung von Selbstreguliertem Lernen 6.3. Förderung von Selbstreguliertem Lernen 6.3.1. Allgemeine Hinweise Förderung der Selbstwirksamkeitserwartung Selbstwirksamkeitserwartungen betreffen die subjektive Einschätzung eines Menschen über die zur Bewältigung einer bestimmten Aufgabenart erforderlichen Voraussetzungen (Fähigkeiten, Fertigkeiten…) zu verfügen. Selbstwirksamkeit ist aufgabenspezifisch und abhängig von: welchen besonderen Aufgabensituationen er sich zuwendet welchen Anstrengungsgrad er einbringt wie ausdauernd er sich bei Schwierigkeiten bemüht wie gut es ihm geling, Angstgefühle zu kontrollieren Ob sich ein Mensch als wirksam erlebt, wird dadurch bestimmt, ob er meint, dass sich sein Potenzial nach erfolgreicher Lösung der Aufgabe verändert hat. Bsp.: Erst wenn sich beim Schüler der Eindruck einstellt, dass sich sein zurückliegendes Wissen durch die Bearbeitung von Matheaufgaben erweitert und sich das mathematische Können verbessert hat, ist mit dem Urteil zu rechnen, die eigene Wirksamkeit gesteigert zu haben. Einflussfaktoren: 1. Bisherige Erfolgsgeschichte 2. Stellvertretende Erfahrungen (Erfolg von Bezugspersonen) 3. Ermunterndes Zureden(erhöht die Bereitschaft härter zu arbeiten) 4. Physiologischer Ergebniszustand (Erregung bei Prüfungen soll kein Anlass zu Sorge sein und nicht auf mangelnde Vorbereitung zurückführen ) Setzen von herausfordernden Zielen Bestimmung von Lernzielen ist eine wichtige Aktivität beim selbstgesteuerten Lernen. Während leichte Überschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit, als leistungsförderlich gilt (weniger Frustration, mehr Mut und Audauer), ist eine deutliche Überschätzung mit Nachteilen verbunden (illusionärer Optimismus ist mit Frust verbunden). Merkregel: Ziele müssen SMART sein, also spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert (Doran, 1981). Ziele sollten dabei nicht zu weit in der Zukunft liegen und vom Schwierigkeitsgrad her anspruchsvoll, aber dennoch erreichbar sein. Steigerung der Selbstwirksamkeit Kontrolle eigener Leistungsergebnisse durch Selbstbeobachtung Selbstbeobachtung: wichtiger Bestandteil selbstgesteuerten Lernens Schüler erhält wichtige Informationen über das eigene Verhalten, Stärken und Schwächen. Lernende, die ihr Verhalten in hohem Maße selbst steuern, achten ständig darauf, welche Fortschritte ihnen auf dem Weg zum Ziel gelingen und sie 69 70 6.3 Förderung von Selbstreguliertem Lernen wissen, wann sie ihre Lernstrategie verändern sollten (Zimmermann & Risemberg, 1997) Bsp.: Rauchen kann durch Anlegen einer Strichliste abgewöhnt werden Wirkung der Selbstbeobachtung nicht unterschätzen; Studierende, die die Zeiten des Selbststudiums vermerkten, hatten bessere Zensuren nachzuweisen Bewertung eigenen Verhaltens Zu Beginn der Schulzeit ist häufig eine sehr optimistische Selbsteinschätzung der Kinder der Fall, wobei diese Selbsteinschätzung im Laufe der Schulzeit immer realistischer wird. Die realistische Einschätzung der Schüler wird v.a. durch öffentliche Leistungsrückmeldungen der Lehrkräfte verstärkt. Schüler können lernen, ihre eigenen Leistungen selbst zu beurteilen, wenn der Lehrer mit ihnen die Kriterien dafür erarbeitet (Stiggins 2005) Selbstbeurteilung setzt Gütemaßstäbe voraus: a) Absolut (vorher gesetztes Ziel erreicht oder nicht erreicht) b) Sozial-bezogen (Einzelleistung wird mit anderen Verglichen) c) Individual-bezogen (Vergleich der Einzelleistung heute & früher) → Experiment von Bandura & Kupers 1964: Eltern oder Lehrer, die bei der Beurteilung von Leistungen sowohl im Handeln als auch in Worten Nachsicht zeigen, müssen damit rechnen, dass sich auch ihre Kinder bzw. Schüler mit mittelmäßigen Leistungen zufrieden geben (Jones & Evans 1980) Bestimmung eigener Verhaltenskonsequenzen Selbstverstärkung: Liegt vor, wenn man eine uneingeschränkte Kontrolle über verfügbare Verstärker besitzt, die man sich nach Erreichen eines Ziels verabreichen kann. Menschen, die sich für ihr eigenes Verhalten belohnen, erreichen höhere Leistungsniveaus als jene, die dieselben Aktivitäten nach Anweisung ohne Verstärkung ausführen, die nicht kontingent (=unregelmäßig) belohnt werden oder die ihr eigenes Verhalten zwar überwachen und sich Ziele setzen, sich aber für das Erreichte nicht belohnen (Bandura, 1978) Bei ungünstiger Bewertung sind auch negative Konsequenzen möglich… (z.B. attraktive Tätigkeiten versagen) 6.3.2. Konkretes im Unterricht Auswahl geeigneter Lehrmethoden Vor allem entdeckende und problemorientierte Lehrformen geeignet (Marschner, 2011) Effektives selbstgesteuertes Lernen vor allem bei komplexen, sinnvollen Aufgaben, die über längeren Zeitraum bearbeitet werden (Zimmermann, 2002) Prinzipien der Unterrichtsgestaltung nach Paris & Paris, 2011 Anleitung zur Selbstbeobachtung und Selbstverstärkung 6.3 Förderung von Selbstreguliertem Lernen Modellieren und Erklären von Maßnahmen der Selbstregulation Übertragen der Verantwortung von Lernzeit und Anstrengung Kontinuierliches Feedback zu Fortschritten Hausaufgaben-Trainings (Perels, 2007 für Mathematik) Vermittlung von mathematischen Problemlösestrategien und deren Einsatz Beachtung aller drei Phasen im Zimmermann-Modell Einbezug der Eltern (Otto, 2007) Trainingsprogramm für Eltern bei der Hausaufgabenunterstützung Idee: Eltern als Modelle für das selbstregulierte Lernen Wirksamkeit von Trainingsmethoden Hattie, 2009: mittlere Effektstärke der Einbettung von kognitiven und metakognitiven Strategien; vor allem bei expliziter Einführung der Strategien Hattie, 1996: effektiver Erwerb von Strategien vor allem bei kontextgebundener Einführung Strategieprogramm zur Förderung selbstgesteuerten Lernen (Meichenbaum, 1977): 1. Kognitive Modellierung: Der Lehrende löst eine Aufgabe und kommentiert dabei laut sein eigenes Vorgehen. 4. Reduzierte offene Selbststeuerung: Der Lernende flüstert sich die Instruktion bei der Aufgabenlösung selbst zu. 2. Offene Fremdsteuerung: Der Lernende löst die gleiche Aufgabe mit Instruktion durch den Lehrenden. 5. Verdeckte Selbststeuerung: Der Lernende löst die Aufgabe und kontrolliert seinen Lösungsprozess durch inneres Sprechen. 3. Offene Selbststeuerung: Der Lernende löst die Aufgabe und spricht dabei die Instruktion laut zu sich selbst. Etwas Empirie Förderung von SRL im Unterricht (Studie von Perry et al. 2002) Vorgehen: 16 Grundschullehrer mit 6 Klassen 2 Phasen: Baseline-Phase (6 Monate, welche Lehrformen werden bereits eingesetzt?, Fragebogen zur Motivation und zu Lernstrategien) Interventionsphase (15 Monate, Entwicklung von Konzepten, die SRL fördern, durch die Lehrer gemeinsam: von Forschern moderierte Diskussionen) 71 72 6.3 Förderung von Selbstreguliertem Lernen Beobachtungsphase Auswirkungen) (erneute Unterrichtsbesuche und Evaluation der Ergebnis Breiteres Spektrum an Lernstrategien bei Schülern Besseres Verständnis von Lernstrategien: können sie anderen erklären Bessere Selbstwirksamkeitseinschätzung Aufgaben, post: 26%) Verbesserte Fehlerkultur: 22% glauben post, Lehrer habe negative Emotionen bei Fehlern (prä: 47%) (prä: 50% bevorzugen leichte 7.1 Problemlösen 7. PROBLEMLÖSUNG, TRANSFER & EXPERTENSETTINGS 7.1. Problemlösen Ein Individuum steht dann einem Problem gegenüber, wenn es sich in einem inneren und äußeren Zustand befindet, den es aus irgendwelchen Gründen nicht erstrebenswert empfindet, aber im Moment nicht weiß, wie er die unerwünschte Ausgangslage in den wünschenswerten Endzustande überführt.(Lukesch). Die 3 Kennzeichen einer Problemsituation: unerwünschter Anfangszustand (IST) Barriere (verschlungene Wege, mehrere Maßnahmen) erwünschter Endzustand (SOLL) Zur Erreichung des erwünschten Endzustands sind Teilziele nötig, die eine Annäherung an das Hauptziel ermöglichen. Dieses Verhalten ist kognitiv bestimmt und erfordert die Anwendung von Regeln und Strategien. Dies ist auch der Unterschied zur Aufgabenbewältigung: Die Maßnahmen müssen selbst gefunden werden. Arten von Problemen (Simon, 1978) Klar definierte Probleme well-defined Unklar definierte Probleme ill-defined Klares Ziel benannt Ziele eher unbestimmt Für die Lösung relevante Informationen liegen vor Hohe Unsicherheit über mögliche Lösungswege Nur eindeutige Lösungskriterien Keine eindeutigen Lösungskriterien z.B. Puzzle, Matheaufgabe z.B. Frage zur Familie, Beruf, Freizeit Meistens in der Schule Im „wahren“ Leben zu finden Problem: Schüler werden nicht ausreichend auf das Leben vorbereitet, da sie im Unterricht nur mit klar definierten Problemen, nicht aber mit den im Alltag überwiegenden unklar definierten Problemen konfrontiert werden. 73 74 7.1 Problemlösen Arten der Problemlösung VERSUCH UND IRRTUM (THORNDIKE): Eine hungrige Katze wird in einem Käfig gesperrt und muss sich aus diesem befreien, um zum Futter zu gelangen. → Äußerliche Lösung, da nur ausprobiert wird EINSICHT (KÖHLER, 1917): Schimpansen sitzen in einem Käfig und erhalten zwei Stöckchen, um zum außen liegenden Futter zu gelangen. Nach einiger Zeit erkennen die Schimpansen, dass sie die beiden Stöckchen zusammenstecken (= verlängern) müssen.3 → Innerliche Lösung, da über die Situation nachgedacht wird Kritik: Es muss davon ausgegangen werden, dass auch die Schimpansen zuvor eine Fehler-Irrtum-Phase durchliefen. Die beiden Arten scheinen also eher aufeinander aufzubauen. 7.1.1. Allgemeine Strategien: Der IDEAL-Problemlöser (Bransford & Stein, 1984) Bransford und Stein versuchten, eine allgemeine Strategie zur Lösung von Problemen zu finden. Sie entwickelten das IDEAL-Modell, wobei der Name auf die Anfangsbuchstaben der fünf Phasen zurückzuführen ist. 1. Identifikation eines Problems Oftmals ist es schwieriger, das Problem zu finden, als eine Lösung dafür Bsp.: Wer schon mal Dr. House gesehen hat, weiß, wovon hier die Rede ist. Schülern fehlt die Erfahrung mit schwer zu entdeckenden, unklar definierten Problemen (z.B. wird das Problem zu schnell erkannt, „Es ist Lupus!“) → Notwendigkeit, Probleme zu schaffen, die erst als solche identifiziert werden müssen 2. Definition der Ziele und Repräsentation des Problems Aufmerksamkeit auf relevante Informationen konzentrieren, irrelevante ignorieren Verstehen der Formulierung und Beschreibung in eigenen Worten Zusammentragen der Informationen und Verständnis eines ganzen Problem [sonst: voreilige Anwendung bestimmter, ungeeigneter Schemata] Transformation oder Übersetzung des Problems in eigene sprachliche oder oft auch graphische Darstellung 3. Explorieren möglicher Strategien 3 Algorithmische Strategien der Lösungssuche Hierbei handelt es sich um festgelegte Anweisungen, die schrittweise zur Lösung führen (z.B. Backrezept). Alle möglichen Wege zum Ziel werden berücksichtigt. Köhler wird für dieses Experiment auch kritisiert. Die Affen hatten wohl zuvor genügend Zeit, im Urwald auch durch Trial und Error auf diese Lösung zu kommen. 7.1 Problemlösen Probleme: o Diese Strategie wird schnell zu aufwändig (z.B. gibt es bei der Aufgabe, EDRISHCLAM in die richtige Reihenfolge zu bringen, über drei Millionen Möglichkeiten). o Schüler wenden Algorithmen oft unsystematisch an und können oft den Lösungsweg nicht rekonstruieren Heuristische Strategien der Lösungssuche Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Suchstrategien für Lösungen, wobei Faustregeln oder intelligente Abkürzungen genutzt werden. Der Zeitaufwand ist gering. Bsp.: EDRISHCLAM wird in im Deutschen übliche Buchstabenfolgen eingeteilt. Schnell kommt man zur Lösung MARSCHLIED. Beispiele für wichtige heuristische Strategien o ZIEL-MITTEL-ANALYSE: Einteilung des Problems in eine kleinschrittige Unterziele, die schrittweise abgearbeitet werden; dadurch wird der Abstand zum SOLL-Zustand schrittweise verkleinert BSP: Schreiben einer Hausarbeit (Themenwahl, Recherche…) o RÜCKWÄRTS-ARBEITEN: Ausgehend vom Ziel werden Lösungsschritte abgleitet o ANALOGIE-DENKEN: Lösungen für ähnliche Probleme werden verglichen [dabei: auch zu starke Einschränkung möglich; es muss auf tatsächliche Genauigkeiten geachtet werden] Problem: Heuristiken können den richtigen Weg zur Lösung nicht garantieren. 4. Antizipieren von Ergebnissen und Vorgehensweisen Entscheidung für einen geeigneten Lösungsweg Gleichzeitige Vorhersage der Ergebnisse (z.B. Überschlag) 5. Lernen aus der Rückschau Ist das Ergebnis sinnvoll? Kontrollstrategien v.a. in der Mathematik Förderung von Problemlösen im Unterricht Förderung des Verstehens einer Problemsituation ist Voraussetzung Motivierung durch Diskrepanzen: Schaffung von Situationen, die bei den Schülern auf den ersten Blick für Verwirrung sorgen. (Bsp.: Cola-Dose geht im Wasser unter, Cola Light schwimmt → Dichtekonzept) Schaffung von Problemsituationen in einem natürlichen Kontext: Situationen, mit denen sich Schüler in ihrem Leben wirklich auseinandersetzen müssen (Bsp.: Zurechtfinden im Wald/ fremder Stadt bei Klassenfahrten mit Karten). Virtuelle Lernumgebungen (Woodbury, 1991): Woodbury entwickelte ein Computer-Programm, in dem den Schülern Probleme der Hauptfigur Jasper präsentiert werden. Beispielsweise befindet sich Jasper mit seinem Boot auf 75 76 7.1 Problemlösen einem See und sein Benzin wird knapp. Die Schüler sollen nun den kürzesten Weg zum Ufer finden. Das Jasper-Lernprogramm zeigte positive Auswirkungen auf die Leistungen der Schüler, auch in anderen Schulfächern und bei Alltagsproblemen. Überprüfung des sprachlichen Verständnisses (z.B. Lerner muss Aufgaben sprachlich verstehen). Hierzu gehört auch, dass Kinder in Mathematik ein korrektes Zahlenverständnis entwickeln (Teilmengen-Mengen-Prinzip,…). Konkretisierung von Textaufgaben (z.B. graphisch darstellen) Darstellung vollständiger Beispiele (Sweller, 1985): Es ist ratsam, den Schülern erst vollständig ausgearbeitete Beispiele zu präsentieren. Dadurch wird das Arbeitsgedächtnis nicht überlastet und es bleibt mehr Zeit für Übungsaufgaben, da die dann schon schneller bearbeitet werden können. Wichtig hierbei ist, dass die Schüler die ausgearbeiteten Beispiele selbst nachvollziehen und nicht in eine passive Rolle rutschen. Achtung: Bei der Wirkung ausgearbeiteter Beispiele liegen intraindividuelle Unterschiede vor. Deshalb sollte der Lehrer den Fokus auch auf Metastrategien legen. Verbessern der Qualität von Verständnisfragen (Suchman): Fragen sind die Voraussetzung für die Gewinnung einer tieferen Verständnisses. Suchman hat dazu ein Erkundungstraining entwickelt: Er präsentierte Schülern Problemstellungen. Zur Lösung durften die Schüler ihren Lehrern Fragen stellen, die mit ja oder nein beantwortet werden können. (-> Lehrer bleibt im Hintergrund, Schüler muss sich konkrete Fragen überlegen) Hierbei setzt sich der Schüler kritisch mit der Fragestellung auseinander und kann so tieferes Verständnis erlangen. Allgemein: An alltägliches Vorwissen und Interessen der Schüler anknüpfen Automatisierungs- und Übungsphasen anschließen. Nur Anregungen, keine Lösung geben! Behinderung des Problemlösens Funktionale Gebundenheit: Unfähigkeit, Werkzeuge und Gegenstände auf unkonventionelle Art & Weise einzusetzen. Rigidität: Die Tendenz, auf die übliche Weise zu reagieren. Überzeugungsperseveranz: Die Tendenz, an Überzeugungen auch bei widersprechenden Informationen festzuhalten. Tendenz zur Bestätigung: Suche nach Informationen, die unsere Entscheidungen und Überzeugungen bestätigen, während widersprechende Informationen ignoriert werden. Falsche Heuristiken o Verfügbarkeitsheuristik: Leicht abrufbare Ereignisse werden für häufig gehalten. o Repräsentativitätsheuristik: Je ähnlicher ein Ereignis einem Prototyp ist, desto häufiger ist es. 7.2 Ergebnisse der Experten-Novizen-Forschung 7.2. Ergebnisse der Experten-Novizen-Forschung Experten sind Personen mit sehr hohem Kenntnisstand auf einem bestimmten Gebiet, während sich Novizen in dieses Gebiert erst einarbeiten. Experiment nach de Groot (1965): Schachspieler sollten sich nur kurz (2-15 sec) gezeigte Positionen merken4 Ergebnis: Schachmeister erinnern die Anordnungen deutlich schneller und mit weniger Fehlern Der Vorteil verschwindet, wenn es sich um sinnfreie Stellungen handelt. 7.2.1. Voraussetzungen, um Experte zu werden Hoher Übungsaufwand: Problemlösekompetenz entsteht nicht durch theoretischen Nachvollzug oder Lernen allgemeiner Prinzipien, sondern durch viele Erfahrungen in dem betreffenden Bereich Meist werden international anerkannte Leistungen erst nach min. 10 Jahren Arbeit erbracht (Ericsson, 1990) Insbesondere ist aber auch die Qualität der Übung entscheidend 7.2.2. Merkmale von Experten im Vergleich zu Novizen Experten unterscheiden sich nicht nur in der Quantität ihres Wissens, sondern vor allem auch in der Qualität, also der Strukturierung des Wissens (Bransford, 2000) Umfangreiches Grundlagenwissen Hochgradig vernetztes Wissen in einem Fachgebiet, das schnell aus dem LZG abgerufen werden kann Sämtliche Formen: deklaratives, prozedurales und konditionelles Wissen Schnelle Problemerkennung Relevante Informationen werden aufgrund vorhandener Schemata schnell erkannt Aktivierung der Schemata, die tatsächlich zur Lösung führen Novizen: eher oberflächliche Einordnung von Aufgaben, die oft wenig nützlich ist Hoher Zeitaufwand bei Erarbeitung neuer Probleme Experten untersuchen neuartige Probleme erst sehr genau, während Novizen oft voreilige Schlüsse ziehen Dafür laufen der anschließende Lösungsprozess und die Strategiewahl sehr schnell ab Insgesamt also Zeitvorteil der Experten 4 Ein analoges Experiment zur Entwicklung von Kindern stammt von Chi, 1978. Vgl. Skript zur EntPsy. 77 78 7.3 Transfer Automatisierung kognitiver Prozesse Das prozedurales Wissen von Experten ist stark automatisiert → Entlastung des Arbeitsgedächtnisses Zudem: sog. „opportunistisches Denken“, das heißt, Experten reagieren schnell auf die Bedingungen und brauchen wenig Zeit zur Anpassung Nachteil: Automatisierung führt zu Routine Unkonzentriertheit, Flexibilität oft eingeschränkt [z.B. Wissenschaftliche Entdeckungen meinst in jungen Jahren] Bessere Kontrolle der Metakognitionen häufiger Kommentare zu den eigenen Denkprozessen gute Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit und des Zeitaufwands Zugleich: Unterschätzung der Zeit, die Novizen benötigen 7.3. Transfer Definition (Greeno et al., 1996 oder Gentile, 2000) Transfer ist die Übertragung von Gelerntem auf neue Lernsituationen. z. B. Ingenieurstudent wendet eine mathematische Formel an, um ein praktisches Problem zu lösen Schüler sind nicht ohne weiteres in der Lage, Gelerntes auf praktische Situationen anzuwenden (Cox, 1997) → der Unterricht muss darauf gestaltet sein 7.3.1. Kennzeichen des Transfers und einige seiner Bedingungen: Unterscheidung zwischen positivem und negativem Transfer nach Mayer und Wittrock, 1996: Positiver Transfer (Lernübertragung hat wünschenswerte Wirkung): Schüler kann früher Gelerntes anwenden, um späteres Lernen oder Problemlösen zu erleichtern Aber: Lernen ist stets situativ gebunden → pos. Transfer schwierig o Hirschfeld und Gelman, 1994: Wissensinhalte, die in einem Kontext entstanden sind können kaum außerhalb dieses Kontexts angewandt werden o Anderson et al., 2000: Lesen und Grundlagen der Mathematik werden sehr wohl in außerschulische Situation übertragen o Perkins, 1995: Lernstrategien werden fächerübergreifend angewandt Negativer Transfer (Lernübertragung hat unerwünschte Wirkung) z. B. muttersprachliche Aussprache von Wörtern beim Erlernen einer Fremdsprache (Littlewood, 1984) Automatischem und bewusstem Transfer nach Salomon und Perkins, 1989: Automatischer Transfer spontaner automatischer Transfer, ohne jegliche Notwendigkeit des Nachdenkens hochgradig geübte Fertigkeit in vielfältigen Situationen Kommt bei deklarativem Wissen zum Einsatz 7.3 Transfer Bewusster Transfer explizit bewusste Formulierung einer Abstraktion (Analyse: welche Strategie, welche Vorgehensweise etc.) Rückgriff auf konditionales Wissen Vorwärts gerichteter Transfer: Strategie beinhaltet die Absicht, sie in der Zukunft anzuwenden. Voraussetzung: Kenntnis von zukünftiger Situation z. B. Lehramtsstudent lernt Unterrichtseinstiege in der Uni Rückwärts gerichteter Transfer: gegenwärtige Situation zu lösen Erinnerungen an frühere Situation, um Träges Wissen (Whitehead, 1929) Grundsätzliche Kenntnis, wie man Probleme lösen kann, aber keine Kenntnis, wie man Wissen spontan anwendet. kein Transfer (oder Transfer erst nach Anregung) Unter schulischen Bedingungen entsteht häufig träges Wissen, da die Schulschemata meist unabhängig von den Alltagsschemata sind (Claxton, 1990) 7.3.2. Förderung von Transfer im Unterricht Ziel ist es, dem Entstehen von trägem Wissen entgegenzuwirken! Daraus ergeben sich gewisse Empfehlungen für den Unterricht: Förderung tieferer Verarbeitung unterrichtlicher Inhalte Vernetzung mit anderen Wissensinhalten nicht zu viel in kurzer Zeit, weniger ist mehr umso länger sich Schüler mit einem Themengebiet beschäftigen, desto größer die Wahrscheinlichkeit für Transfer (Schmidt und Bjork, 1992) Systematisches Entkontextualisieren des Lernens: Lernen in verschiedenen Kontexten begünstigt Schaffung von "Allgemeinheit", die als Konstante erhalten bleibt (Perkins und Salomon, 1989) Nach Singley & Anderson (1989): Verbindungen lösen, die zwischen einem bestimmten Wissensinhalt und irrelevanten Aspekten der Lernsituation bestehen. Problemorientierter und anwendungsbezogener Unterricht: theoretische Darstellungen müssen mit Anwendungsbezug aufgearbeitet werden; Lernender muss wissen, wann und wo Wissen anwendbar ist. Anerkennung und Akzeptierung der Lernziele: Lernen muss bekannt sein, welches Ziel das Lernen unter künstlichen Bedingungen in der Schule hat → eigenen Nutzen aufzeigen (Savery und Duffy, 1996) Hierbei orientierten sich die Behavioristen an einem passiven Menschenbild, dessen informationsverarbeitende Prozesse von außen kontrolliert werden. Erst durch einen aktiven Lerner, welcher neue Informationen auf eine besondere Art und Weise verarbeitet, kommt es zur Erforschung kognitiver Prozesse. 79 80 8.1 Unterscheidung von Lernstrategien 8. GEDÄCHTNIS- UND LERNHILFEN, LERNSTRATEGIEN Definition (Seidel & Krapp, 2014) „Als Lernstrategien bezeichnet man mental repräsentierte, situationsübergreifende Schemata oder Handlungspläne zur Steuerung des eigenen Lernverhaltens, die sich aus einzelnen Handlungssequenzen zusammensetzen und situationsspezifisch abrufbar sind“ In Abgrenzung dazu sind Lerntechniken konkrete Methoden, um bestimmte Ziele zu erreichen. Lernstrategien dagegen sind Vorstellungen in Form von „Generalplänen“, um Lernprozesse zu steuern. Bedeutung von Lernstrategien: Verbesserung von Aufnehmen, Verstehen, Behalten und Erinnern Lernstrategien als prozedurales Wissen zur Erreichung von Lernzielen Lernstrategien als kognitive oder verhaltensbezogene Lernaktivität, die zu besseren Lernaktivitäten beitragen kann Lernstrategien als „Plan für eine Handlungskonsequenz, die auf Erreichung eines Lernziels gerichtet ist.“ (Klauer, 1996) Erwerb von Lernstrategien: einfache Behaltensstrategien schon ab GS, komplexe ab 15 Jahren zunächst keine spontane Anwendung, keine eigene Produktion, auch nach Anweisung (Mediationsdefizit) nur mit Hilfe sind Schüler in der Lage, Strategien einzusetzen (Produktionsdefizit) spontane Anwendung, aber kein Nutzen (Nutzungsdefizit) → Kinder müssen von Nutzen der Strategie überzeugt sein 8.1. Unterscheidung von Lernstrategien Nach Seidel & Krapp, 2014; oder Wild/ Schiefele, 1994 Lernstrategien Kognitive Lernstrategien - Organisation - Zusammenhänge - Elaboration - Wiederholen - Kritisches Prüfen Metakognitive Lernstrategien - Planung - Selbstüberwachung - Regulation Ressourcenbezogene Lernstrategien Interne Ressourcen - Anstrengung - Aufmerksamkeit - Zeitmanagement Externe Ressourcen - Lernumgebung - Lernen mit Kollegen - Literatur 8.1 Unterscheidung von Lernstrategien Bemerkung: in einer anderen, klassischen Schematik nach Ballstaedt werden Kognitive Strategien als Primärstrategien, metakognitive als Kontrollstrategien und ressourcenbezogene als Stützstrategien bezeichnet. Kognitive Strategien Organisation o Informationsreduzierende Vorgehensweisen o Auswahl/ Zusammenfassen von Information sinnstiftende Gliederung o Gliederung anfertigen, Diagramm/MindMaps erstellen o o Beispiel: Giraffe, Otto, Kamel, Rettich, Oswald, Melone Merke einfacher: Giraffe, Kamel, Otto, Oswald, Rettich, Melone) Elaborationsstrategien (= Wissen richtig verknüpfen) erzeugen tieferes Verständnis o Herausarbeitung von Sinnstrukturen in zu lernender Information o Anreicherung der Information durch Herstellung von Assoziationen o Konstruktion (Stoff mit eigenen Worten wiedergeben) o Integration (Stoff mit gespeichertem Wissen vernetzen) o Transfer (Übertragung auf andere Kontexte) o o Beispiel: Eselsbrücken, mentale Bilder, Mnemotechniken, Fragen selbst überlegen Wiederholungsstrategien (= Wissen auswendig lernen) dienen vorrangig dem Auswendiglernen unabhängiger Fakten o Gelerntes im Arbeitsspeicher behalten o Unterstützung des Übergang ins LZG und Speicherung o Lautes/ stilles Wiederholen; schreiben/ unterstreichen wichtiger Passagen o Beispiel: Definitionen mehrfach aufsagen. Kritisches Prüfen Metakognitive Strategien: Lernprozesse steuern/ kontrollieren Planung: Vorbereitung der Lernhandlung o Das Setzen von Lernzielen, Auswahl von Lernstrategien o Unterscheidung nach Klauer, 2000 Planungsziele (primäre Ziele): Text durcharbeiten Effizienzziele (sekundäre Ziele): 3 Stunden zu lernen und gute Benotung Selbstüberwachung: Kontrollieren des Lernprozesses o Kontrollfragen o Feststellung von Ist-Soll-Diskrepanzen o Korrektur der eigenen Aufgabenbearbeitung (kritisches Begleiten) o Vorhersagen (welches Ergebnis, wenn ich so weiter arbeite?) o Überprüfung, ob Gelesenes verstanden wurde o Beispiel: Lernstrategien zielführend? 81 82 8.2 Beispiele für Lernstrategien Regulation o Anpassung des eigenen Lernens an Anforderungen o Beispiel: langsameres Lesen bei schwierigen Texten (Bewertung) nicht bei Wild & Schiefele, aber bei vielen anderen Modellen o nach Beendigung einer Aufgabe o gesetzte Ziele vs. Erreichte Ziele o Lernprozess wie geplant abgelaufen? o Strategien sinnvollgewählt? Ressourcenbezogene Strategien: Interne Ressourcen (unterstützen das Lernen; schirmen störende Einflüsse ab) o Motivationale Maßnahmen Selbstmotivation o Kontrolle von Aufmerksamkeit und Anstrengung o Sinnvolle Zeitplanung Externe Ressourcen o Optimale Nutzung institutioneller Ressourcen (z.B. Bibliothek) o Soziale Ressourcen (z.B. Arbeitsgruppe, Lerngruppe, Tutorien) o Gestaltung einer geeigneten Lernumgebung 8.2. Beispiele für Lernstrategien 8.2.1. Allgemeine Lernstrategien HIERARCHISCHES ZUSAMMENFASSEN, REKONSTRUKTION DURCH LERNER: Gliederung des Stoffes, Kategorien bilden, Struktur in die Fülle von Informationen bringen. o Beispiele: Text in Unterabschnitte gliedern, Überschriften bilden, immer wieder zusammenfassen VORWEGNAHME ZENTRALER AUSSAGEN durch vorausgehende Übersicht: Erstellung von Übersichten und MindMaps, die zentrale Aussagen enthalten. o Nach Hartley& Davies (1976) führen vorausgehende Übersichten in neues Material ein und machen mit der zentralen Aussage vertraut (Zusammenfassungen der nachfolgenden Lerneinheit in Prosaform, Fotos, Bilder…) sehr wirkungsvoll! SELBSTREZITATIONSTECHNIK: Fragen an sich selbst stellen, Inhalte für sich selbst laut zusammenfassen. o Beispiele: Bei Lernen von Texten, Definitionen, Vokabeln, Rechtschreibung, etc. 8.2 Beispiele für Lernstrategien PQ4R-METHODE (ROBINSON, 1972) o Preview (Überblick), Question (fragen), Read (lesen), Reflect (überlegen), Recite (wiedergeben), Review (überprüfen) o Zentrales Merkmal der PQ4R-Methode: Fragen formulieren und beantworten, Text in einem Rückblick mit den Fragen im Kopf nochmals durchgehen o Annahme: Fragen führen zu einer tieferen und elaborativeren Verarbeitung des Textmaterials → eine Rückschau auf den Text mit Fragen im Kopf, erbringt einen Gewinn allgemeinerer Art GEZIELTES UNTERSTREICHEN, MARKIEREN VON TEXTTEILEN: Überblick, Absatz kurz lesen, unterstreichen, Wiederholung, Einprägen des Unterstrichenen o zentrale Aussagen herausschreiben, Unwichtiges weglassen o nur mit Suchauftrag sinnvoll, z.B. nur eine Aussage pro Absatz (Snowman, 1986) o sinnbezogenes Verarbeiten mit fortlaufenden Entscheidungen (Anderson & Armbruster, 1984) o Ziel: Unterscheidung bedeutsamer und unwichtiger Textteile ERSTELLEN EIGENER TEXTE (wirksam nach King, 1994) ANFERTIGEN VON NOTIZEN o kein mechanisches Mitschreiben, Formulierung in eigenen Worten, nur das wesentliche (Peverley et al., 2003) o Lehrer können dazu anregen, indem sie das wichtige hervorheben und Zeit geben, Schlüsselbegriffe geben etc. o Abrufreiz z. B. am Rand "Stichwort des Absatzes" GRAPHISCHE METHODE: Anfertigen von MindMaps. o Wissen wird in Form von Begriffen und Reaktionen zwischen Begriffen abgebildet. Begriffe als Knoten, Relationen als Pfeile. o Reduktion: nur wesentliche Infos herausarbeiten (Aufbau einer Makrostruktur) o Systematische Zusammenfassen verbaler Infos und graphische Darstellung der Info in einer Art Landkarte (MAP / Mapping) o Organisation des Wissens in semantischen Netzwerken o Sehr effizient, wegen Visualisierung, aktiver Auseinandersetzung mit Informationen, Reduktion der Komplexität des Inhalts auf wesentliche Aspekte, Verbesserung der Rückmeldung über eigenes Wissen (vollständig? Anregung metakognitiver Prozesse) und der Verknüpfung der Begriffe. 83 84 8.2 Beispiele für Lernstrategien VORANGESTELLTE EINORDNUNGSHILFEN: Darstellung des Kontextes, in den sich das Lernmaterial einordnen lässt o Nach Mayer (1979, 1984) aktiviert eine gute Einordnungshilfe geeignete Schemata, die dem Lernenden helfen, neue Informationen zu assimilieren. (Analogien!) 8.2.2. Sonderfall: Mnemotechniken Definition (Woolfolk, 2008) Mnemotechniken (mneme, griech.: Gedächtnis, Erinnerung) sind systematische Ansätze zur Verbesserung der Behaltensleistungen. Wenn Informationen für sich genommen keine Bedeutung haben, bauen mnemotechnische Verfahren diese durch Verknüpfung neuer zu lernender Wörter und Bilder mit vorhandenen, gelernten, auf. Nach Untersuchungen von Atkinson (1975) ist die Anwendung von Mnemotechniken in der Schule und in der Uni sinnvoll. BILDORIENTIERTE STRATEGIEN Erst Kinder ab 8 Jahren sind in der Lage, Sachverhalte in bildhafte Vorstellungen umzuwandeln LOCI-METHODE (mnemonische Technik): Zu lernende Items werden im Kopf an bestimmten Orten (z.B. Stellen in der eigenen Wohnung) abgelegt; beim Erinnern „geht“ man dann geistig diese Orte ab → kann man anwenden, wenn Material nicht sinnvoll erscheint oder man es in einer bestimmten (willkürlich erscheinenden) Reihenfolge wiedergeben muss. Die Wirksamkeit beruht nach Adams (1976) auf 2 Prinzipien o Erzwingen von Organisation einer unorganisierten Liste o Herstellung von Verbindungen zwischen Orten und Items verwendbar zum Lernen von Listen (z.B. Einkaufsliste), nicht aber zum tieferen Verständnis von Texten und Sachverhalten SPRACHORIENTIERTE STRATEGIEN SCHLÜSSELWORT-METHODE (Levin et al., 2000): sinnvoll beim Vokabellernen! Drei-Schritte nach Levin et al. Rekodieren: neues Wort wird mit einem bekannten, konkreten Wort („Schlüsselwort) verbunden [window = Wind] Verbinden: des Schlüsselwortes mit der Vokabel durch einen Satz [„Durch das Window pfeift der Wind.“] Abrufen: der Bedeutung duch Erinnern des Satzes vor allem beim Vokabellernen einsetzbar: Reproduktion mit Bild Wirksamkeit: beste Ergebnisse bei Kombination mit der Kontextmethode Probleme: o Assoziationen werden meist zu etwas Falschem gebildet 8.3 Metakognition o Vor allem bei Jüngeren: Schwierigkeit, eigene Verbindungen zu finden (→ erst ab 8 Jahren sinnvoll) RHYTHMUS UND REIM: Bei jüngeren Kindern wirkungsvoll (besser als Bilder) o Reim aus den zu merkenden Zusammenhängen oder Wörtern bilden. o gut für einfache Merkaufgaben o Äußere Strukturen erleichtern die Rekonstruktion → Bildung von Eselsbrücken! Beispiele: „Sieben, fünf, drei - Rom schlüpft aus dem Ei“, „Trenne nie st - denn es tut den beiden weh“ MERKWÖRTER/ AKRONYME: Aus Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter gebildetes Merkwort Beispiel: EDEKA: Anfangsbuchstaben der fettlöslichen Vitamine AKROSTICHA/ KETTENMNEMONIK: Merksätze, bei denen der Anfangsbuchstabe jedes Wortes den zu merkenden Inhalt bezeichnet Beispiele: Dur-Tonarten: Geh Du Alter Esel Hole Fische, Reihenfolge der Planeten: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neun Planeten. NARRATIVE VERKNÜPFUNG/ KONTEXTMETHODE: Zu lernende Wörter in Geschichten einkleiden → Verknüpfung o Reihenfolge der Infos wird beibehalten o Beispiele: Festlegung des Tagesplans, Einkaufsliste 8.3. Metakognition Definition (nach Flavell, 1979) Metakognition ist Kognition über Kognition. Sie bildet einen speziellen Teil des Weltwissens eines Menschen, der sich auf seine Kognitionen und Anwendung des Wissens bezieht. Metakognition setzt sich zusammen aus (Schunk, 2004): deklaratives Wissen: Wissen über Prozesse, die Lernen und Behalten betreffen; Kenntnis eigener Fertigkeiten und Ressourcen als Voraussetzung zu Bewältigung von Aufgaben prozedurales Wissen: Kenntnis darüber, wie man Strategien nutzt konditionales Wissen: wann und warum sind bestimmte Strategien anzuwenden? 8.3.1. Wissen über eigene Aufmerksamkeitsprozesse Aspekte der Aufmerksamkeit nach Flavell, 2002 1) Zunehmende Kontrolle der Aufmerksamkeit mit fortschreitendem Alter Verbesserung der Aufmerksamkeitsspanne (= Konzentrationsfähigkeit) durch Ignorieren ablenkender Reize 85 86 8.4 Förderung im Unterricht 2) Verbesserung der Einschätzung von Anforderungsmerkmalen einer Aufgaben 3) Verbesserung der Unterscheidung zwischen mehr oder weniger wichtigen Reizmerkmalen der Umgebung mit zunehmenden Alter Z.B. veränderte Stimme oder bestimmte Gesten des Lehrers 8.3.2. Wissen über eigene Gedächtnisprozesse Entwicklung Jüngere Kinder: über-optimistische Einschätzung des eigenen Gedächtnisses: ein Drittel der Fünfjährigen denken, dass sie nie etwas vergessen (Kreutzer, 1975) realistischere Einschätzung mit zunehmendem Alter und Einsetzen von Lernstrategien (Flavell, 1970) Zunehmende Kenntnis und Nutzung von Strategien als Ergebnis schulischer Erfahrungen Bereits bei Grundschülern Tendenzen, Begriffe zu sortieren, aber kein spontaner Gebrauch dieser Strategie (Bjorklund, 1994) Geschichtenentwickeln (für Wortreihen) erst ab Sekundarstufe I (Siegler & Wagner Alibali 2005) Entwicklung von Lernstrategien abhängig von Dauer des Schulbesuches, nicht vom Alter (Sharp et al., 1978) Lernstrategien im Unterricht Vermittlung von Gedächtnisstrategien durch den Lehrer Selten Vermittlung von Lernstrategien → Eigenerarbeitung nur sehr langsam und unzureichend Aber: nicht jeder Strategie ist jedem Schüler (in jedem Alter) vermittelbar! Fehlende Nutzung von Gedächtnisstrategien - Gründe Schüler denken einfach nicht daran (kleiner Hinweis hilft) Vom Nutzen der Strategie nicht überzeugt (Aufgabe des Lehrers: Vorkehrungen treffen, dass der Schüler Vorteile selbst erkennt und akzeptiert) 8.4. Förderung im Unterricht Vermittlung von Lernstrategien Vermittlung einer kleinen Anzahl von Strategien für spezifische Aufgaben Vorgehen: o Explizite Beschreibung und ausführliche Begründung o Demonstration der Strategie sowie Verbalisierung des Denkprozesses o Angabe, wann wo und wie sich die Strategie einsetzen lässt Genügend Zeit zum Einüben von Strategien Rücksichtnahme auf Voraussetzungen der Schüler und Individualisierung 8.5 Gute und schlechte Strategienutzer 8.5. Gute und schlechte Strategienutzer Erfolgreiche Lerner nutzen zahlreiche, sowohl spezifische als auch generelle Lernstrategien aus, die sie flexibel und reflexiv einsetzen können. Gute Strategienutzer (nach Pressley, 1986) Überzeugung der Kontrollierbarkeit der Lernvorgangs Wertschätzung systematischen Vorgehens und Überzeugung vom Nutzen von Lernstrategien Gerichtetheit der motivationalen Dynamik (inhaltlich) Bewusste Kontrolle der Aufrechterhaltung der Motivation (bei schwacher Intention) Schlechte Strategienutzer Inaktive Lerner Produktions- und Anwendungsdefizit Überwachen ihr Lernen seltener, Bemerken deshalb Fehler seltener Vermeiden Anstrengung, auf Strategien zurückzugreifen Kennen weniger Strategien, die ihnen in Problemfällen weiterhelfen könnten Lehrer sollte Schüler auf Vorteile von Lernstrategien aufmerksam machen, bei konkreten Aufgaben darauf hinweisen! 8.6. Empirie zu Metakognition und Lernstrategien Schiefele, Wild und Winteler (1995) Korrelation zwischen Studienleistung und Einsatz von Elaborationsstrategien 𝑟 = .21 Dansereau (1998) Studenten nahmen an Training zum kognitiven Strukturieren von Texten teil Danach Aufgabe: Fachtext ohne Notizen lesen Ergebnis: Studenten mit Training erinnerten doppelt so viel wie Kontrollgruppe Metaanalyse von Schneider (1985) 27 Studien über Metakognition und Leistung Ergebnis: mittlerer Koeffizient von 𝑟 = .41 87 88 9.1 Unterrichtsmodelle und Forschungsrichtungen 9. UNTERRICHTSQUALITÄT 9.1. Unterrichtsmodelle und Forschungsrichtungen „Guter Unterricht ist Unterricht, in dem mehr gelernt als gelehrt wird.“ (Weinert, 1998) Ein Allgemeines Angebots-Nutzen-Modell des Unterrichts (Helmke, 2012) Das Modell betont einerseits die professionellen Kompetenzen des Lehrers für die Qualität des Angebots. Dieses entstehende Angebot muss die Schüler zugleich zur seiner Nutzung anregen. Je stärker diese Anregung ist, desto besser der Unterricht. Weitere Kontextfaktoren werden ebenso berücksichtigt. Paradigmen der Unterrichtsforschung Frühzeit der Unterrichtsforschung: Interesse für Lehrerpersönlichkeit, d.h. Voraussetzungen für guten Unterricht waren schwer erlernbare persönliche Eigenschaften des Lehrers Heute: anstatt einzelner isolierter Unterrichtsvariablen (variablenorientierter Ansatz), wird eher das Zusammenwirken einzelner Variablen und Merkmalsverknüpfungen innerhalb der Person des Lehrers (dies erfordert kognitive und motivationale Mediationsprozesse der Schüler) → „Mediationsparadigma“ (Doyle 1977) 9.2 Die Qualitätsmerkmale nach Helmke 2 Perspektiven der Unterrichtsqualität Prozessorientiert: Untersuchung der eigentlichen Durchführung /Inszenierung des Unterrichts gemeint (alles, was man während des Unterrichts registrieren bzw. evaluieren kann). → i. A. von Didaktik bestimmt, starke normativ-präskriptive Komponente, wenig empirisch orientiert Produktorientiert: Erforschung der Wirkung von Unterricht → von Pädagogischen Psychologie bestimmt Trend: zunehmende Konzentration des Interesses auf nachweisliche Ergebnisse „Output-Orientierung“ Methoden für die Bewertung von Unterrichtsqualität Fragebogen, Interviews, Audio- & Videoaufnahmen, Rating besonders aussichtsreich: Studien, die verschiedene Perspektiven (Lehrer, Schüler, Eltern) der Erfassung von Unterricht filmen und miteinander kombinieren 9.2. Die Qualitätsmerkmale nach Helmke Nach Helmke (2006) gelten folgende Punkte als unterrichtsrelevante Qualitätsbereiche und sollen im Folgenden skizziert werden: 1. Klassenführung 6. Lernförderliches Klima 2. Klarheit und Strukturiertheit 7. Schülerorientierung 3. Konsolidierung und Sicherung 8. Kompetenzorientierung 4. Aktivierung 9. Umgang mit Heterogenität 5. Motivierung 10. Angebotsvariation 9.2.1. Klassenführung Definition (Kunter & Voss, 2011) Unter Klassenführung (oder Classroom Management) versteht man die Koordination des sozialen Geschehens im Klassenzimmer mit dem Ziel, Lernzeit optimal zu nutzen und Zeitverluste durch nicht lernbezogene Aktivitäten zu vermeiden. Klassenführung wird in der Schule als zentrale Grundlage für Unterricht und Erziehung angesehen, weil sie einen nötigen Rahmen für Unterricht schafft und ein hohes Maß an aktiver Lernzeit ermöglicht. Erfolgreiche Klassenführung zeichnet sich weniger durch den Umgang mit Disziplinstörungen, sondern eher durch wirksame Vorbeugung durch Verabredung klarer & konsistent eingehaltener Regeln, Rituale und lernpsychologischer Prinzipien aus. (Wellenreuther 2004) Effektive Klassenführung zielt durch darauf ab, disziplinarische Probleme präventiv zu unterbinden bzw. ihnen angemessen entgegenzutreten Prinzipien guter Klassenführung nach Kounin, 2006 1. ALLGEGENWÄRTIGKEIT. Zumindest Eindruck erwecken, dass man über jedes Geschehen in der Klasse Bescheid weiß. Aspekte sind Präsenz, also die sofortige 89 90 9.2 Die Qualitätsmerkmale nach Helmke Reaktion auf Störungen und auffälliges Verhalten, sowie die Überlappung, d.h. die Fähigkeit, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun [also erklären und zugleich die ganze Klasse im Blick haben] 2. REIBUNGSLOSER UNTERRICHTSABLAUF. Der Unterrichtsfluss bleibt auch beim Wechsel zwischen verschiedenen Methoden erhalten und Verzögerungen werden vermieden. Aspekte sind Schwung, also keine Abschweifungen, sowie die Geschmeidigkeit, also logische Zusammenhänge und Übergänge. 3. AUFRECHTERHALTUNG DES GRUPPENFOKUS. Ziel des Unterrichts ist es, möglichst viele Schüler zu aktivieren: dies geschieht durch Aufmerksamkeit der ganzen Klasse (z.B. jederzeit die Chance, aufgerufen zu werden) sowie stete Leistungsverantwortlichkeit (z.B. durch Kontrolle von Hausaufgaben) 4. ÜBERDRUSSVERMEIDUNG. Vermeidung von Langeweile durch Abwechslung in Methoden und Inhalten. Weinstein (2003) betont zudem die Notwendigkeit von Routinen, z.B. für Anfang und Ende der Stunde sowie für Verwaltungsaufgaben. Empirie Seidel & Sharvelson, 2007: positive Effekte der Klassenführung auf kognitive sowie affektiv-motivationale Kriterien Aber: Auf die Leistungen wirkt sich die Unterstützungen von Lernen stärker aus Wang et al., 1993: stärkstes Merkmal für Leistungsfortschritt einer Schulklasse Effiziente Klassenführung und guter Unterricht beeinflussen sich nach Helmke (2007) gegenseitig: Motivierender Unterricht hat aktive Schüler zur Folge, die sich im Unterrichtsgesehen mehr engagieren und somit die aktive Lernzeit gesteigert wird. 9.2.2. Klarheit und Strukturiertheit Hierbei handelt es sich um die Stimmigkeit von Zielen, Inhalten und Methoden; Angemessenheit des methodischen Grundrhythmus, sowie Regel- und Rollenklarheit ( Überschneidungen mit Aspekten der Klassenführung). Klarheit ist bezogen auf auf Akustik, Sprache (Prägnanz), Inhalt (Kohärenz) und Fachlichkeit (Korrektheit) Strukturiertheit meint alle Merkmale des Informationsangebots psychologische Sicht) und Planung/ Sequenzierung des Unterrichts. (gedächtnis- Die Lernleistung der Schüler kann durch mangelnde Klarheit (z.B. falsche Grammatik, Unsicherheitsausdrücke, Sprechverzögerungen, langatmige Darstellungen) verringert werden. Dies ist von enormer Wichtigkeit, denn Lehrpersonen dienen häufig als Modelle. Die Strukturierung dient dem Ziel, Unterrichtsstoff so zu vermitteln, sodass eine gut organisierte Wissensbasis entsteht. Um dieses Ziel zu erreichen, werden häufig funktional unterschiedliche Phasen miteinander verknüpft. 9.2 Die Qualitätsmerkmale nach Helmke 9.2.3. Konsolidierung und Sicherung Der Prozess des Lernens ist durch Wiederholung und Übung charakterisiert. Unterschieden werden kann hier zwischen: MECHANISCHES ÜBEN: Auswendiglernen von Daten ELABORIERTES ÜBEN: Strategien sind notwendig, um den Transfer bewältigen zu können REPETITIVES ÜBEN: Aufgaben gleicher Art immer nach demselben Schema lösen → Grundlage für die Beherrschung grundlegender Fertigkeiten (Lesen, Rechnen und dies auch in komplizierteren Zusammenhängen verstehen zu können) Guter Unterricht muss grundlegenden lernErkenntnissen Rechnung tragen: Häufigkeit des Übens muss ausreichend sein und gedächtnispsychologischen Das ungeliebte Üben muss durch geeignete Übungsformen motivierend wirken Variation von Übungsaufgaben, sodass keine Langeweile aufkommt 9.2.4. Aktivierung Das Konzept der Aktivierung umfasst 4 Aspekte: KOGNITIVE AKTIVIERUNG: Aktivierung im Sinne des SRL → Tiefe Verarbeitung durch anspruchsvolle Lernstrategien SOZIALE AKTIVIERUNG: Formen kooperativen Lernens AKTIVE TEILHABE: Schüler sollen an Planung/ Gestaltung des Unterrichts teilnehmen KÖRPERLICHE AKTIVIERUNG: Kontrast zu passiv-sitzender Lernhaltung 9.2.5. Motivierung Motive sind die Motoren des Handelns. Während es sich bei „Motiven“ um gewachsene, dispositionelle Verhaltenstendenzen (traits) handelt, handelt es sich bei „Motivation“ um einen bestimmten Zustand in einer konkreten Situation (state). Für Lernprozesse ist ein gewisser Grad an Motivierung über den kompletten Zeitraum unabdingbar. Ziel hierbei ist es, dass der Lehrer in der Lage ist die motivationale Fremdsteuerung (durch den Lehrer selbst) durch die motivationale Selbststeuerung (SuS sollen in der Lage sein ihre eigenen Lernsituationen selber motivierend zu gestalten) ersetzt werden. Motive sind hierbei unterschiedlich stark ausgeprägt und beziehen sich auf unterschiedliche Gegenstandsbereiche: Leistungsmotiv: sich selber zu übertreffen Machtmotiv: an Einfluss zu gewinnen Anschlussmotiv: neue Kontakte zu finden 91 92 9.2 Die Qualitätsmerkmale nach Helmke Es werden 2 Motivationsarten unterschieden: Intrinsische Motivation Wunsch/ Absicht, eine best. Handlung durchzuführen, weil die Handlung selbst als interessant, spannend, herausfordernd etc. erscheint. Extrinsische Motivation Wunsch/ Absicht, eine best. Handlung durchzuführen, um damit positive Folgen herbeizuführen oder negative Folgen zu vermeiden. 9.2.6. Lernförderliches Klima Lernumgebungen schaffen, die das Lernen der Schüler erleichtern, begünstigen oder positiv beeinflussen. Die Schaffung vieler Erfolgssituationen stellt den Kern eines lernförderlichen Klimas dar. Bei Fehlern der Schüler ist es stets sinnvoll, den Schülern alternative Strategien zur Bewältigung der missglückten Aufgabe zu geben. Vor allem, wenn die Schüler in der Lage sind, ihre eigenen Fehler zu berichtigen, hat dies positive Auswirkungen auf das Lernklima. Eine angenehme Atmosphäre im Klassenraum (z.B. auch Lachen im Unterricht), d.h. ein Mittelweg aus Ernsthaftigkeit und entspannter Atmosphäre, wirkt sich positiv auf das Klassenklima und somit auf die Unterrichtsqualität aus. 9.2.7. Schülerorientierung Die Wertschätzung des Schülers als Person hat enormen Einfluss auf den affektiven Aspekt des Wohlbefindens. Ein schülerorientierter Unterricht ist dadurch gekennzeichnet, dass die SuS die Lehrperson auch als Ansprechpartner in nicht-fachlichen Fragen erleben und sie als Schülerperson respektiert, interessiert und fair/ gerecht wahrnimmt. Schüler wollen als gleichwertiger Teil des Unterrichtsgeschehens angesehen werden und aktiv in den Unterricht eingebunden werden. 9.2.8. Kompetenzorientierung Definition (Weinberg, 2004) Kompetenz umfasst, was ein Mensch wirklich kann und weiß, das heißt alle Fähigkeiten, Wissensbestände und Denkmethoden, die ein Mensch in seinem Leben erwirbt und zur Verfügung hat. Damit impliziert der Begriff auch ein individuelles Vermögen, Befähigung und Potenzial Ein wesentliches Ziel von Unterricht ist der Erwerb von Kompetenzen, wie sie in Bildungsstandards beschrieben sind. Hierbei wird das Hauptaugenmerk nicht auf die Inhalte gelegt – nicht nur Durchnehmen, sondern etwas können. Schüleraktivität 9.3 Lehrermerkmale 9.2.9. Umgang mit Heterogenität PISA und IGLU zeigen auf, dass Länder mit einer hohen Heterogenität (wie es in Deutschland der Fall ist) scheinbar schlechter abschneiden als vorwiegend homogen geprägte Länder. Eine Differenzierung und Individualisierung in diesen Ländern scheint im Unterricht unumgänglich zu sein. Ziel muss es nämlich sein, neues Wissen erwerben zu können ohne dabei über- oder unterfordert zu werden. Aufgrund der enormen Heterogenität sind folgende 4 Lernermerkmale zu betrachten: 1. Vorwissen: Häufig unterschiedliches Vorwissen erschwert die Situation alle SuS auf ein gleiches Niveau zu bringen, ohne sie dabei zu unter- bzw. zu überfordern. Derselbe Unterricht für alle SuS mit unterschiedlichem Vorwissen hat unterschiedliche Auswirkungen. (ATI-Forschung) 2. Migrationshintergrund: Kinder, deren Eltern ursprünglich im Ausland geboren wurden, haben meist Leistungsrückstände im Vergleich zu ihren Altersgenossen. Die kulturelle Diversität kann somit in Bezug auf die sprachlichen Fähigkeiten einen negativen Einfluss haben. 3. Entwicklungsstand: Unterricht muss altersgerecht sein, d.h. der Lehrer muss an die kindlichen bzw. jugendlichen Vorstellungen anknüpfen. 4. Lernstile: Eine Differenzierung zwischen den unterschiedlichen Lerntypen ist unerlässlich (z.B. auditiv, haptisch, visueller und intellektueller Lerntyp) 9.2.10. Angebotsvariation Hiermit ist eine große Varianz an allen verfügbaren Inszenierungstechniken gemeint, wie beispielsweise bezogen auf Sozialformen, Medien, Aufgabentypen etc. Dadurch wird Interesse, Neugier, Spannung und Aufmerksamkeit gefördert und der Unterrichtsstoff dadurch besser enkodiert und im LZG vernetzt. Methodenvielfalt & Individualisierung: Einsatz verschiedener Methoden, um verschiedenen Schülern gerecht zu werden Optimale Zahl der verwendeten Methoden liegt bei 3-4, darunter eher schlechte Ergebnisse (Helmke & Jäger, 1987) 9.3. Lehrermerkmale 9.3.1. Lehrerpersönlichkeit Nach Weinert (1998) gibt es bestimmte Eigenschaften, die ein Lehrer „mehr oder minder mitbringen muss“. Dazu zählt er: Sensibilität gegenüber Schülern Freude an der Arbeit mit Jugendlichen Frustrations- und Misserfolgstoleranz 93 94 9.3 Lehrermerkmale 9.3.2. Schlüsselkompetenzen von Lehrkräften Ein zentrales Modell von Baumert und Kunter (2011) gliedert Lehrerkompetenzen in vier Bereiche: Schlüsselkompetenzen Professionswissen Überzeugungen Motivation Selbstregulation Professionswissen Definition (ebd.) Als Professionswissen oder Lehrerexpertise bezeichnet man berufsbezogenes Wissen und Können von Lehrern. Man unterscheidet folgende Wissensarten FACHWISSEN: Kenntnis des eigenen Unterrichtsstoffes FACHDIDAKTISCHES W ISSEN: Wissen über Aufgabentypen und –schwierigkeit, über häufige Fehlkonzeptionen, über mögliche Erklärungsansätze sowie curriculares Wissen über Lehrpläne und Kompetenzen PÄDAGOGISCH-PSYCHOLOGISCHES Lernprozesse ORGANISATIONSWISSEN BERATUNGSWISSEN Baumert & Kunter: didaktisches Wissen sagt Unterrichtserfolg besser voraus als Fachliches Wissen Zugleich: Fachliche Mängel schränken Anwendung didaktischer Methoden ein W ISSEN: Wissen über Diagnostik und Überzeugungen und Werthaltungen Einstellungen zum eigenen Fach (epistemologische Überzeugungen) Subjektive Theorien zum Lernen o Analyse der PISA-Studie durch Baumert: negativer Zusammenhang zwischen Erfolg in Mathematik und transmissiven Überzeugungen (→ darstellende Methoden) o Positiver Zusammenhang von Konstruktivistischen Methoden zu Lernerfolg; sowie zu Schüleraktivierung und Unterstützung beim Lernen Motivationale Orientierung und Selbstregulation Individuelle Motivation für die Berufswahl („Warum werde ich Leerer?“) Selbstwirksamkeit zum Unterricht („Ich kann schwache Schüler erreichen.“) Emotionaler Umgang mit Belastungen („Ich bin nicht für alles verantwortlich.“) 9.4 Aptitude-Treatment-Interaction (ATI) Baumert (2011): bei der Berufswahl ist für die Unterrichtsqualität das Interesse für die pädagogische Tätigkeit wichtiger als Interesse am Fach Problematisch für die Selbstregulation sind vor allem die Tendenz zur Überarbeitung sowie eine schnelle Resignation (Schaarschmidt, 2005) 9.4. Aptitude-Treatment-Interaction (ATI) Grundannahme: individuelle Lernvoraussetzungen (Aptitudes) und die verwendeten Unterrichtsmethoden (Treatment) stehen in einer wechselseitigen Beziehung (Interaction) zueinander. Für den optimalen Lerneffekt sollten die Lehrmethoden auf die Voraussetzungen der Lernenden abgestimmt sein. Beispielsweise lernen Schüler bei ungünstigen Lernvoraussetzungen (z.B. hohes Angstpotential, niedriges Intelligenzniveau) besser bei lehrerzentriertem, hochstrukturiertem Unterricht. 9.5. Exkurs: Hausaufgaben und ihre Relevanz für Lernen Definition (Trautwein & Köller, 2003) Hausaufgaben sind Aufgaben, die von den Schülern außerhalb der Schule bearbeitet werden . Status von Hausaufgaben fester Bestandteil der Schule Nahtstelle Elternhaus und Schule Abgrenzung zu Vorbereitung auf Klassenarbeiten und Referatsvorbereitung Durcchnittlich täglich 30-180 Min. (Wagner und Spiel, 2002) Funktionen didaktisch-methodische Funktion (Vorbereitung und Unterstützung Lernprozess) erzieherische Funktion (selbstgesteuertes Lernen) Diskussion des Status Pro Hausaufgaben o mehr Lernzeit: Schulleistungsmodell von Walberg: Quantität des Lernzeit als einer der wichtigsten Faktoren o Beispiel: Haag, 1991 o Vorbereitende Hausaufgaben können nützlich sein, um das Interesse am Unterricht zu erhöhen o Hausaufgaben und selbstgesteuertes Lernen --> Optimierung Selbststeuerungsvariablen Contra Hausaufgaben o verstärkte Hausaufgabenbelastung zu einer Verschärfung der Leistungsunterschiede zwischen den Schülern (Helmke, 1988, S. 65). o Kritiker z. B. Becker & Kohler, 1988 95 96 9.5 Exkurs: Hausaufgaben und ihre Relevanz für Lernen Empirische Befunde Angloamerikanischer Raum: Cooper 1989 Metaanalyse mittlere Effektstärke d = .21 (höhere Klassenstufen profitieren mehr als jüngere) Trautwein, Köller und Baumert, 2001 = positiver Leistungseffekt o Beginn und am Ende der 7. Klasse, Erfassung Mathematikleistung bei ca. 2000 Schülern o Zusammenhang investierte Zeit negativer Zusammenhang o Einfluss Schulform, bessere Leistung am Gymnasium o regelmäßige Vergabe von Hausaufgaben positive Entwicklung auf Leistung Hattie Studie (2009) d= 0,29 → leicht pos. Effekt aber oft methodische Probleme Hausaufgabenzeit und Lernzeit) der Studien (keine klare Abgrenzung 10.1 Darstellende Methoden 10. LEHRSTRATEGIEN Bei Lehrstrategien (auch Lehrmethoden oder Unterrichtsmethoden genannt) handelt es sich um verschiedene, theoretisch fundierte Formen der Wissensvermittlung. Generell kann zwischen kognitiven und konstruktiven Methoden unterschieden werden. Wir folgen der Unterscheidung der Lehrmethoden nach Hasselhorn & Gold, 2013. Diese bezeichnen die dem Kognitivismus entsprechenden Lehrformen als darstellende Methoden, die konstruktiven als problemorientierte Methoden und behandeln zusätzlich das Kooperative Lernen als wichtige Unterrichtsform. Lehrstrategien Darstellende Methoden problemorientierte Methoden Kooperatives Lernen 10.1. Darstellende Methoden Wichtigstes Merkmal dieser Methoden: hohe Anleitungs- und Steuerungskomponente Beispiele: Frontalunterricht, Unterrichtsvortrag [z.B. Vorlesung], gelenktes Unterrichtsgespräch 10.1.1. Die direkte Instruktion Aus empirischen Untersuchungen gewonnene Merkmale effektiven Unterrichts. Zwei wichtige Säulen sind die sichtbare Lenkung durch den Lehrer und die hohe Außensteuerung des Lernens. Wissen wird dabei als fertiges Produkt präsentiert. Leitbild: Wissensvermittlung als Transmission von Lernstoff zu Lernendem Merkmale dieser Lerhrform nach Hasselhorn & Gold, 2013 1. Lernziele werden ausdrücklich formuliert 2. Rückblick auf und Wiederholung von altem Stoff: z.B. durch Hausaufgaben oder Abfragen, auch explizit („Was haben wir letzte Stunde gemacht?“) → Reaktivierung von Vorwissen, kritisiert als „Überlernen“ 3. Neuer Stoff wird darbietend vermittelt: inhaltlicher Kern, zunächst wird das Thema benannt und eine Vorausschau gegeben. Sodann kleinschrittige und enthusiastische Präsentation des Stoffes; Erläuterung abstrakter Begriffe an konkreten Beispielen 97 98 10.1 Darstellende Methoden 4. Anleitung zum gemeinsamen Üben und anschließende Rückmeldungen: zur Überprüfung, wie erfolgreich Vermittlung war; Aufdeckung von Fehlkonzepten 5. Kontinuierliche Lernüberwachung mit stetiger Fehlerkorrektur und Feedback: Lehrerfragen als Strukturierung des Unterrichts und Ermittlung von Wissen der Schüler; Fragen auf verschiedenem Niveau (Reproduktion, Transfer etc.) Reaktionen auf Schülerantworten: kurze Reaktion auf richtige Antworten („Richtig!“), ausführlicher bei zögerlichen Antworten („Stimmt, weil…“), falsche Antworten werden immer korrigiert! Lehrerfragen müssen stets beantwortet werden 6. Selbstständiges Üben: zunächst unter Aufsicht, selbstständig erst bei Hausaufgaben nach ausreichendem Verständnis; Ziel: Festigung und Automatisierung 7. Regelmäßige Überprüfung des Lernfortschritts: Zusammenfassung der Inhalte und Leistungstests Umgang mit Übungen: Charakterisierung von Rosenshine & Stevens, 1986 „Die Hauptkomponenten systematischen Unterrichtens beinhalten das Vorgehen in kleinen Schritten mit Übungsphasen nach jedem Schritt, das Anleiten der Schüler während der anfänglichen Übungen und das Ermöglichen eines großen Ausmaßes erfolgreichen Übens für alle Schüler. [….] Die effektivsten Lehrer verwirklichen die meisten dieser Aspekte fast jeden Tag.“ Zur Wirksamkeit der direkten Instruktion Korrelative Analysen: durch Leistungstests werden starke und schwache Klassen ermitteln, in denen dann die Lehrmethoden untersucht werden Ergebnis: direkte Instruktion ist sehr effektiv (z.B. Walberg, 1986), insbesondere wenn die Präsentation gut strukturiert ist, wenig Unterrichtszeit für Disziplin und Orga verloren geht und je stärker der Unterricht Aufgabenorientiert ist Interventionsstudien: vergleichbaren Gruppen werden die gleichen Inhalte mit verschiedenen Methoden vermittelt Ergebnisse (Good & Grouws, 1979): bestätigen obige Erkenntnisse, zudem sind Prinzipien leicht erlernbar Kritik: eher geeignet für Wissensvermittlung, weniger für Transfer oder affektive und soziale Lernziele In Deutschland sehr weit verbreitet! 10.1.2. Theorie des bedeutungsvollen Lernens Diese Lehrform geht auf David Ausubel (1968) zurück. Er zieht das rezeptive (i.e. Präsentation fertiger Strukturen) dem entdeckenden Lernen vor. Wesentliche Leitideen Ziel des Unterrichts: Wissensstruktur Aufbau einer neuen, hierarchisch gegliederten 10.2 Problemorientiert-entdeckendes Lernen Neues Wissens muss an vorhandene, gesicherte Konzepte anknüpfen oder in diese eingeordnet werden („inklusive Ideen“) Advance Organizer Die vorhandenen Ideen im Vorwissen müssen anfangs aktiviert werden Methode: eine vorangestellte Strukturierungshilfe, sog. Advance Organizers Ziel: Rückgriff auf bereits sicher gefestigte Konzepte Richtlinien für den effektiven Einsatz nach Derry (1984) o Herstellung einer Beziehung zwischen Neuem und Bekannten o Erzeugen von Aufmerksamkeit o Konkrete Formulierung Progressive Differenzierung und sequenzielle Organisation Zunächst werden Allgemeine Regeln präsentiert Diese werden dann zunehmend präzisiert und ausdifferenziert Gleichzeitig: Ausarbeitung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Ideen zur Kohärenzbildung Beispiel: die „Regel-Beispiel-Regel-Technik“: o Erlernen einer Regel, dann Erläuterung mit Beispielen (deduktiv) o Anhand der Beispiele kann dann eine neue Regel erarbeitet werden (induktiv) o Inhalt werden also der Reihenfolge (bzw. einer kausalen Folge) nach präsentiert Maßnahmen zur Festigung und Konsolidierung Ziel: Verhinderung des Vergessens des Stoffes Methoden: Wiederholung, Übung und Rückmeldung 10.2. Problemorientiert-entdeckendes Lernen Alternative Bezeichnungen: „Offener“ Unterricht, konstruktivistische Methoden Kritik an den traditionellen Formen: Lernen wird stets in einem bestimmten Kontext erworben, ist also situiert. Das bedeutet allerdings auch schlechte Übertragbarkeit. Sinnvolles Lernen stellt die Inhalte also stets in bestimmte, und auch verschiedene Anwendungskontexte, um die Entstehung trägen Wissens zu vermeiden (Collins, 1989). 10.2.1. Überblick und Allgemeines Zielvorstellung dieser Methoden: hohe individuelle Lernförderung durch Anregung zum selbstständigen und selbsttätigen Lernen. Dinge, die selbst „entdeckt“ wurden, werden besser behalten Definition (Zumbach, 2003) Problemorientiertes Lernen ist eine Unterrichtsform, die unterschiedliche Merkmale in sich vereint: Komplexe und authentische Problemstellungen werden in Kleingruppenarbeit unter tutorieller Betreuung gelöst. 99 100 10.2 Problemorientiert-entdeckendes Lernen Wichtige Ziele und Merkmale Vermittlung von heuristischen Fähigkeiten des Problemlösens zusätzlich zum Lerninhalt (Bruner, 1981) Entwicklung von selbstgesteuertem Lernen sowie Zusammenarbeit in sozialen Gruppen Grundidee nach Bruner (1973): Präsentation geeigneter, angemessener Probleme und Begleitung der Schüler bei der Lösung (= gelenktes Entdeckenlassen) → selbstständige, induktive Regelerschließung und -überprüfung Weckung von Neugier und Motivation durch kognitive Konflikte Wissens wird nicht als Produkt präsentiert, sondern vom Lerner aktiv konstruiert Üblicher Ablauf 1. KONFRONTATIONSPHASE: Präsentation eines neuartigen Problems 2. ENTDECKUNGSPHASE: aktive und eigenständige Erarbeitung einer Problemlösung 3. AUFLÖSUNGSPHASE: Darstellung, Erprobung und Diskussion der Lösungen 10.2.2. Der Sokratische Dialog (Collins, 1987) Denken der Schüler wird durch gezielte Fragen in eine bestimmte Richtung gelenkt. Mögliche Strategien hierzu sind (1) Positive und negative Beispiele auswählen: zunächst völlig typische oder atypische, dann auch Grenzfälle (6) Hypothesen testen lassen: statt unmittelbarer Rückmeldung über deren Richtigkeit (2) Beispielmerkmale systematisch variieren (7) Alternative Vorhersagen untersuchen lassen (3) Gegenbeispiele wählen als Reaktion auf falsche Hypothesen des Lernenden (8) Kleine Fallen aufstellen: Konfrontation mit inhaltlich falschen Hypothesen zur Überprüfung möglicher Fehlkonzepte) (4) Hypothetische Situationen vorgeben: bei schwer realisierbarem Fall (5) Hypothesen aufstellen lassen: konkrete Vorhersagen über einen Sacherhalt (→ tiefere Verarbeitung) (9) Widersprüche aufzeigen: Konsequentes und systematisches Nachfragen zur Wissensüberprüfung (10) Zu eigenständigem Denken anregen: keine direkte Beantwortung von Fragen Nach Schnotz, 2009 10.2.3. Grundformen nach Neber (1999) Lernen durch Problemlösen Herbeiführen kognitiver Konflikte Notwendigkeit der Lenkung: unterstützende Hilfe, Lösungsstrategien modellieren, direkte Erklärungen anbieten 10.2 Problemorientiert-entdeckendes Lernen Lernen durch Beispiele Z.B. Fallbasiertes Lernen bei Medizinern, auch unter Vorgabe der vollständigen Lösung Umgang mit Lösungen: Selbsterklärungen o Ausgearbeitete Lösungen sind bei oberflächlichem Nachvollzug wenig wirksam o Notwendigkeit, Elaborationsstrategien anzuwenden o Qualität von Selbsterklärungen muss (v.a. bei lernschwachen) gefördert werden Eher Kompromiss zwischen entdeckenden und darbietenden Methoden Lernen durch Explorieren und Experimentieren (v.a. für Physik) Ablauf: Frage formulieren, Hypothesen aufstellen und prüfen [auch mit Simulationen], Übertragbarkeit der Gesetzmäßigkeit Begleitende Verbalisierung der Gedanken als metakognitive Kontrolle Verschiedene Stufen der Lenkung o Struktuiertes Explorieren: Frage und Vorgehenshinweise gegeben o Gelenktes Explorieren: Frage, aber kein Vorgehen angegeben o Authentisches Explorieren: auch Frage muss erschlossen werden 10.2.4. Drei Beispiele Cognitive Apprenticeship Als Mischform zwischen darstellenden, problemorientierten und kooperativen Methoden anzusehen. Ansatz: Schüler werden als Novizen, Lehrer als Experten gesehen. Die klassische „Handwerkerausbildung“ oder „Meisterlehre“ (≈ apprenticeship) soll auf kognitives, schulisches Lernen anhand praxisorientierter Probleme übertragen werden. Merkmale Gelenkte Beobachtung, minimale Anleitung und konstruktive Unterstützung Experte zieht sich zunehmend aus Lernprozess zurück Idee: individualisierte Meisterlehre als natürlichste Form des Lernens Vorgehen nach Collins et al. (1989) 1. Modellieren. Vorführung einer neuen Fertigkeit unter Offenlegung der Lernstrategien und mentalen Prozesse 2. Angeleitetes Üben (Coaching). Ausführung der Aufgabe unter Hilfestellung. 3. Lernhilfen und –steuerung. Aufbau eines Lerngerüsts (Scaffolding), z.B. Übernahme von schwierigen Aufgaben durch Lehrer; späterer Abbau der Lernhilfen (sog. Fading) 4. Artikulation. Denkprozesse werden verbalisiert. Ziel: metakognitives Wissen und eigene Entscheidungsfähigkeit 5. Exploration. Anregung, neue Probleme selbst zu explorieren. 101 102 10.2 Problemorientiert-entdeckendes Lernen Empirie Entsprechende Programme sind oft sehr wirksam (Brown, 1997) Erklärung: vereinen erwiesene Vorteile der direkten Instruktion mit aktivierendem und sozialem Lernen Wechselseitiges Lehren (Reciprocal Teaching, Palinscar & Brown, 1984) Eine konkrete Anwendung des cognitve apprenticeship. Grundidee: Schüler nehmen wechselseitig Lehrer-Rolle (Fragen Abschnitte zusammenfasse) und Schüler-Rolle (Antworten) ein Basierend auf der Theorie Wygotskys, ursprünglich für den Lese-Unterricht der siebten Klasse entwickelt (zeitl v.a. auf schwächere Schüler ab) Einstieg: Einüben Grundlegender Strategien (i.d.R. durch Lernen am Modell) o Texte selbstständig zusammenfassen o Fragen formulieren o Vorhersagen zum Text machen o Erlärung des Gelesenen Zur Wirksamkeit: Hattie (2009): Effektstärke von 𝑑 = 0.74 Begründung der Effizienz: Verknüpfung von strategischem und metastrategischen Elementen; Verbindung von Modelllernen, Einüben und Selbsttätigkeit stellen, Methode der Verstehensanker (Anchored Instruction) Besonderes Merkmal: Einsatz von Medien als „Anker“ (Aufhänger) für die Inhalte Ablauf o Darbietung von „spannenden“ Abenteuergeschichten als Filme o Einbettung des zu lernenden Wissens in diese Filme → Verankerung der Lerninhalte, um Neugier zu wecken o Zusätzliche Unterstützung durch den Lehrer teilweise erforderlich Beispiel: Adventures of Jasper Woodbury-Serie (Vanderbilt-Uni Nashville, 80er) o Verschiedene mathematische Inhaltsbereiche der Sekundarstufe o Serienheld Jasper und Freund Larry müssen ein mathematisches Problem erkennen, in Operatoren formulieren, eine Strategie vorschlagen und das Problem lösen o Kinder müssen während der Videos den Protagonisten helfen Gestaltungsprinzipien solcher Video-Lernumgebungen 1. VIDEOBASIERTES FORMAT: Verpackung komplexer Probleme in authentische Handlungen. 2. NARRATIVE STRUKTUR: Erzählung spannender Geschichten, zugleich und Verbindung mit bekannten Charakteren 3. GENERATIVE PROBLEMLÖSUNG: offenes Ende; das Problem muss von den Schülern gelöst werden (es gibt jedoch eine Beispiellösung) 10.2 Problemorientiert-entdeckendes Lernen 4. SELBSTSTÄNDIGES LERNEN. Schüler müssen die relevanten Informationen selbstständig finden. 5. AUTHENTISCHE PROBLEME: Probleme sind lebensnah, d.h. auch überflüssige und teils widersprüchliche Informationen vorhanden 6. TRANSFER: Verschiedene Lerngeschichten zu einem Inhalt verfügbar; dadurch erhöte Flexbilität der Lehrkraft Empirische Prüfung Hickey et al. 2001: Vergleich von 19 fünften Klassen an verschiedenen Schulen (auch verschiedene Sozialschichten etc.) o Unterschiede in der Problemlösekompetenz, nicht aber unbedingt beim fachlichen Wissen o V.a. wirksam in Verbindung mit einer insgesamt eher reformorientierten Ausrichtung der Schule o Insgesamt eher geringe Effektstärken o Problem: Filme wurden von Lehrern oft als Unterhaltung eingesetzt, Schüler mussten keine Fragen etc. selbst stellen → mangelhafte praktische Umsetzung! 10.2.5. Probleme und Chancen der konstruktivistischen Methoden PRO CONTRA - Tiefere Verarbeitung der Inhalte - Förderung von eigenständigem Denken und Metakognition - Fähigkeit der Problemlösung und des Transfers - Nicht allgemein einsetzbar (Überforderung des Lernenden) - Wissensstrukturen als kulturelle Leistung, die einzelner nicht einfach nachmachen kann - Deutlich ineffizienter als direkte Instruktion (insbes. für lernschwache Schüler) - Vernachlässigung der Vermittlung von Wissen zugunsten der Vermittlung von Fähigkeiten - Problemlösestrategien Hilfestellung erworben besser durch Empirische Studien Allgemein: Wirksamkeit konnte nicht wirklich bestätigt werden (Mayer, 2004) Loyens und Rikers (2011): größere Effekte bei stärkerer Strukturierung → Bedarf einiger Lenkung seitens der Lehrkraft (Guided Discovery) 103 104 10.3 Kooperatives Lernen 10.3. Kooperatives Lernen Hier arbeiten Schüler in Kleingruppen zusammen, um sich beim Wissenserwerb zu unterstützen. Die Lehrperson tritt in den Hintergrund, Lernen ist aktiv, selbstständig und sozial. Merkmale und Eigenschaften Gruppen können Aufgaben nur gemeinsam lösen („positive Interdependenz“ zwischen Einzel- und Gruppenleistung) Ziel: höhere Motivation wegen Vermeidung von Konkurrenzdenken 5 Basismerkmale 1. POSITIVE INTERDEPENDENZ: Abhängigkeit der Lernenden voneinander → Unmöglichkeit, Aufgabe alleine zu lösen, als Voraussetzung 2. INDIVIDUELLE VERANTWORTLICHKEIT: Einzelbeiträge sind nach wie vor erkennbar [Vermeidung des Trittbrett-Fahrer-Effekts und Sicherung eines gleichen Lernerfolgs] 3. FÖRDERLICHE INTERAKTIONEN: Gruppenmitglieder müssen kommmunizieren (keine schiere Arbeitsteilung) und zusammenkommen 4. KOOPERATIVE ARBEITSTECHNIKEN: Fähigkeit zur Kommunikation und zur Gestaltung eines förderlichen Klimas sowie zur Bewältigung von Konflikten 5. REFLEXIVE PROZESSE: Austausch über positive und negative Gruppenprozesse Perspektiven des kooperativen Lernens Entwicklungsperspektive: o Verbindung von Piaget und Wygotski o Entwicklung in der Zone der proximalen Entwicklung kann besonders gut durch heterogene Gruppen verwirklicht werden o Größere Wahrscheinlichkeit von adaptiv-unterstützenden Lehraktivitäten durch geringeres Autoritäts- und Wissensgefälle Perspektive der kognitiven Elaboration o Integration von neuem Wissen ist einfacher, je größer Anknüpfungspunkte sind o Tiefere Verarbeitung in Umgebungen, die zum Hinterfragen, Kritisieren und Verteidigen eigener Positionen anregen o Voraussetzung: geeignete Strukturierung der Lernsituation Motivationale Perspektive: o Gruppenbelohnungen als extrinsische Motivation o Anreiz zur Kooperation durch Notwendigkeit der Kooperation o Optimal: Verknüpfung von individuellen mit Gruppenbelohnungen Perspektive der sozialen Kohäsion o Zusammenhalt der Gruppen aus eigenem Antrieb (intrinsische Motivation) o Strikte Ablehnung von Belohnungen Beispiele für Kooperative Arrangements: Gruppenpuzzle, Skriptkooperation 10.3 Kooperatives Lernen Etwas Empirie Hattie (2009): Effektstärke von 𝑑 = 0.54 (= mittlere Stärke) Rohrbeck et al. (2003): v.a. schwächere Schüler profitieren Rohrbeck et al. (2006): positive Auswirkungen auf soziale Kompetenzen, kooperativem Verhalten und Fähigkeitsselbstkonzept 105 106 A1 Exkurs: Umgang mit ADHS ANHANG A1 Exkurs: Umgang mit ADHS ADHS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) = Kinder mit einer ungewöhnlich hoher Aktivität und einer gleichzeitig sehr geringen Aufmerksamkeitsspanne Schwierigkeiten, kognitive Funktionen zu kontrollieren und Verhalten zu steuern Kennzeichen: Hyperaktivität, Impulsivität, Unaufmerksamkeit, störendes Sozialverhalten Empirische Befunde: o Zu sehr hohem Prozentsatz erblich (Astrid Neuy-Bartmann, 2005) o Erstmals mit 2-3 Jahren; ohne Behandlung noch im Erwachsenenalter (Schäfer & Ruther, 2005) Empfehlungen für den Umgang mit ADHS-Kindern: o Regelmäßige körperliche Aktivität o Anweisungshilfen durch den Lehrer (klare und kurze Anweisungen) o Regelmäßige & häufige Aufgabenkontrolle o Wesentliches stets aufschreiben o Vermittlung und Einüben von Strategien zur Kontrolle der eigenen Aufmerksamkeit o Individueller Stundenplan & Arbeitsbedingungen anpassen (z.B.: Sitzordnung, die wichtigsten Fächer zuerst,…) mangelnde Affektkontrolle, A2 Überblick über die Hattie-Studie 2009 Empirische Befunde der Forschungssynthese von John Hattie (2009) Ergebnisse aus über 50.000 Studien mit 83. Mio. Schülerinnen und Schüler aufgearbeitet. Meta-Analyse zur Zusammenfassung vieler Studien zu erfolgreichem Lernen Mittelung der Effektstärken: Wie stark wirkt (im Mittel) eine Einflussgröße A auf das Ergebnis B? Interpretation der Effektstärke Kritik an der Studie o Auch fragwürdige Studien enthalten o Material teilweise veraltet (aus den 70er und 80er Jahren) o Basis: i.d.R. Anglo-Amerikanischer Raum 6 untersuchte Kategorien A2 Überblick über die Hattie-Studie 2009 107 108 A2 Überblick über die Hattie-Studie 2009 A2 Überblick über die Hattie-Studie 2009 Quelle: http://www.studienseminarkoblenz.de//medien/seiteneinsteiger/seiteneinsteiger2011_2/12%20Expertiseforschung %20-%20Hattie-Studie/Handout%20Hattie-Studie.pdf 109