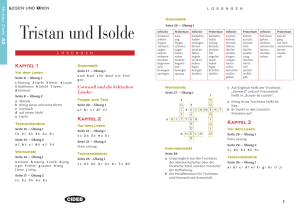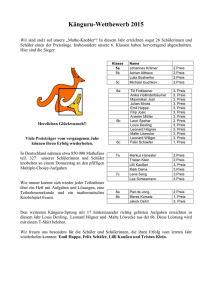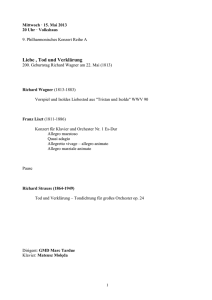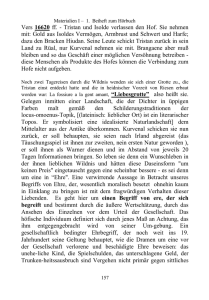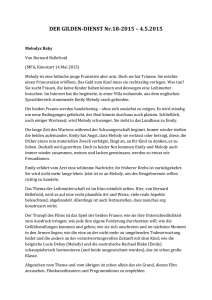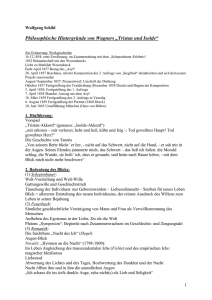Tristan und Isolde“ - Liebe als Passion
Werbung

Gottfried von Straßburg: "Tristan und Isolde“ - Liebe als Passion Aus: Geschichte der deutschen Literatur. Mitte des 12. bis Mitte des 13. Jahrhunderts, v. e. Autorenkollektiv unter Leitung v. R. Bräuer, Berlin 1990, S. 326-370. Gottfrieds Werk im städtischen Kontext Äußerer Zusammenhang und innere Vielfalt und Widersprüchlichkeit der feudalklassischen Literatur und die damit verbundene Problematik der Interpretation spiegeln sich nirgends so deutlich wie in GOTTFRIEDS "Tristan“, der trotz seines Torsocharakters nicht nur die bedeutendste Liebesdichtung des europäischen Mittelalters darstellt, sondern der trotz seiner unikalen literatursoziologischen, ideologischen und ästhetischen Position und Gegenposition so eng mit der übrigen zeitgenössischen Literatur verflochten ist, daß von dem Bildungsgipfel seiner Anschauungsweise her ganz neues Licht auf die Epoche und die ideologische und ästhetische Heterogenität ihrer Literaturgesellschaft fällt. Tatsächlich wird ja die Literaturgesellschaft - als eine auch sich selbst so begreifende - erstmals durch Gottfrieds im allgemeinen als „Dichterschau“ apostrophierter Darstellung und Einschätzung der zeitgenössischen Literatur manifest, in deren literarästhetische Tradition er sich eingebunden weiß, während er andererseits sein eigenes Publikum von dem gewöhnlichen und dessen Geschmacksvorstellungen abhebt und eine der ritterlichhöfischen Ideologie- und Erziehungslehre fundamental entgegengesetzte dialektische Weltanschauung des Individualrechts auf Selbstverwirklichung auch gegen die ethischen Zwangsmaximen der Gesellschaft (bei so gleichzeitig notwendig werdender Bejahung des Leides) gestaltet und formuliert. Hatte der in unterschiedlichen Versionen umlaufendenonkonformistische Tristan-Stoffgemeinsam mit der aus anderen Gründen ebenfalls leidbejahenden und an nationale politische Verpflichtungen erinnernden Heldenepik - die auf klassenbeschränkte Vorbildlichkeit und auf das Harmoniebedürfnis des weltlichen Feudaladels zugeschnittene ritterlich-höfische Ideologie der Einbindung des Einzelnen in das Normengefüge der höfischen Gesellschaft (vgl. courtois.doc) durch die Artusepik als Gegenreaktion eigentlich erst geschaffen, so mußte bereits die Wiederaufnahme dieses Stoffes durch Gottfried als bewußter Affront erscheinen. Doch Gottfried tut weit mehr als diesen, die gesellschaftlichen Normen sprengenden Stoff durch sich selbst sprechen zu lassen. Er baut ihn sowohl durch handlungsimmanente Neuakzentuierung und psychologische Vertiefung als auch durch bewußte theoretische Reflexion und Axiomatisierung zu einem oppositionellen theoretischen Gebäude aus, das, wie im folgenden zu zeigen sein wird, der feudalritterlichen Wertehierarchie diametral entgegengesetzt ist. Ebenso wie über die „Grundauffassung von Gottfrieds Tristan“ [2] ist ein heftiger Meinungsstreit darüber entstanden, ob und wie eine solche abweichende Haltung des Dichters sozial zu orten und soziokulturell zu begründen sei.[3] Wenngleich wir Gottfrieds Namen nur aus dem gemeinsam mit dem Torso fragmentarischen Akrostichon ,Gote (vrit)’ in der Dichtung selbst herauslesen können, so sind doch Name und Wirkungsort des Dichters durch zahlreiche literarische Zeugnisse sowie durch die Dialektbestimmung gesichert. Übereinstimmend als „Meister Gottfried von Straßburg“ wird der Tristan-Dichter rühmend genannt von Ulrich von Türheim und Rudolf von Ems (beide ca. 1230), von Konrad von Stoffeln, Konrad von Würzburg und Heinrich von Freiberg (alle zweite Hälfte des 13.Jahrhunderts), von Johann von Würzburg (1314), Jakob Püterich von Reichertshausen (1462) sowie von Ulrich Füetrer um 1478 [4]. Die ausnahmslose Bezeichnung Gottfrieds als „Meister“ bei häufig unmittelbar benachbarter Titulierung anderer Dichter als „Herr“ ist ein nicht wegzudiskutierendes Standesindiz, das sowohl mit dem städtischen Bezug auf Straßburg als auch mit dem ungewöhnlichen hohen Bildungsgrad des Dichters übereinstimmt. Der Meisterbegriff meint hier die Funktion des (vorbildlichen) Buchgelehrten und Schriftstellers und legt den Dichter auf diesen als wesentlich empfundenen sozialen Aspekt fest. Entsprechend haben auch alle großen Literaturgeschichten Gottfried von Straßburg als „Bürger“ gesehen und bezeichnet, was allerdings zu Fehlschlüssen führen muß, wenn man historisch und terminusverleitet Bürgertum mit der modernen Klasse der Bourgeoisie identifiziert. In Wirklichkeit handelt es sich in diesem Zeitraum um das aus der revolutionären Kommunebewegung geborene und sich im Schoß des Hochfeudalismus entfaltende junge Stadtbürgertum, das sowohl eine ökonomisch begründete soziokulturelle Eigenständigkeit entwickelt, als auch in die grundlegenden Gesetzmäßigkeiten der feudalen Gesellschaftsordnung innerhalb und außerhalb der Stadtmauern eingebettet bleibt. Diese Dialektik spiegelt sich in Gottfrieds „Tristan“. Im übrigen reihen auch die großen Liederhandschriften Gottfried von Straßburg in diesozial niedrigste Schicht der Stadtbürger, Gelehrten und Fahrenden ein, und das Bild Gottfrieds in der manessischen Handschrift weist keinerlei Adels- oder Ritterattribute auf, sondern zeigt ihn - von fünf männlichen Gestalten umgeben, in langem blauem Gewand auf einer Bank sitzend, eine Schreibtafel demonstrativ zum Betrachter hin auf dem Knie haltend. Bei aller Skepsis gegenüber den phantasievollen Miniaturen der Liederhandschriften vervollständigt sich damit doch das ungebrochen gleichbleibende Bild, das sich das Mittelalter selbst von Gottfried machte. Gottfried war also ein stadtbürgerlicher Gelehrter, ein Intellektueller; welchen Beruf er speziell ausgeübt hat, muß der Vermutung anheim gestellt bleiben. Die des öfteren geäußerte Annahme, daß Gottfried Geistlicher gewesen sein könne, verbietet sich nicht nur durch den poetischen Gegenstand und die Art seiner Behandlung, sondern auch durch. die Bemerkung „die pfaffen sagent uns maere“ (V. 17947), nach der sich Gottfried offensichtlich selbst nicht zu den „Pfaffen“ rechnet. Was aus den Urkunden über Träger des Namens Gottfried in Straßburg zu entschlüsseln ist, führt über fruchtlose Spekulationen nicht hinaus.[5] Man hat das auffällige Versteckspiel Gottfrieds, das auch darin besteht, daß er kaum eine verwertbare biographische Angabe macht (mit Ausnahme des allgemeinen Hinweises, die Liebe - der Minnegrotte - sei ihm zwar bereits in seinem 11. Lebensjahr begegnet, er sei jedoch nie der vollkommenen Liebe im Sinne der Tristan-und-IsoldeMinne teilhaftig geworden [V. 17 140ff. ]), wahrscheinlich mit Recht auf die komplizierte politische und ideologische Situation Straßburgs zu Beginn des 13. Jahrhunderts zurückgeführt. Straßburg war um 1200 eine wirtschaftlich blühende und wohlhabende Stadt, deren Einwohnerschaft sich in dem halben Jahrhundert zwischen 1150 und 1200 auf ungefähr 10000 verdoppelt hatte.[6] Seinen Reichtum verdankte Straßburg dem Handel und Gewerbe, wodurch sich die reichen Stadtbürger, vor allem Großhandelskaufleute und Ministeriale, wesentliche Rechte einer kommunalen Selbstverwaltung sichern konnten. So hatte sich die Stadtbürgerschaft um 1200 bereits einen aus zwölf Ratsherren bestehenden Stadtrat erkämpft, der die wichtigsten Verwaltungs- und Gerichtsbarkeitsaufgaben übernahm, darunter das schwerwiegende Hoheitsrecht der Blutgerichtsbarkeit. Obgleich der Bischof (Konrad II. von Huneburg 1190-1202 und Heinrich II. von Veringen 1202 bis 1223) weiterhin als offizieller feudaler Stadtherr fungierte, wurde seine Machtstellung gerade zu Lebzeiten Gottfrieds immer stärker eingeschränkt, wobei der zum Teil offen ausbrechende Machtkampf sich darin dokumentiert, daß Bischof Konrad II. im Jahre 1192 von Ministerialen der Stadt gefangengesetzt wurde und der städtische Rat im Jahre 1199 Straßburg an König Philipp übergab, obgleich der Bischof sich dem zu widersetzen suchte. Schon dieses Beispiel zeigt die Einbindung Straßburgs in die allgemeinen „Thronwirren“ des Reichs, wobei durch die wiederholten Wechsel von den Welfen zu den Staufern und umgekehrt auch die innerstädtischen Machtkämpfe beeinflußt wurden, in deren Verlauf die Stadtbürgerschaft insgesamt die größeren Vorteile zu verbuchen vermochte. Die Frage, auf wessen Seite Gottfried stand, ist in der Forschung - sofern man sie überhaupt gestellt hat - kontrovers beantwortet worden. Bei aller mittelalterlichen Bischöfen zugestandenen Weltlichkeit dürfte es jedoch als höchst unwahrscheinlich gelten, ausgerechnet den Liebeslust verherrlichenden „Tristan“ in die Umgebung eines Bischofshofes zu versetzen, wo zudem mit Heinrich II. auch noch einer der ersten großen Ketzerverfolger auf deutschem Boden residierte. Genau an diesem Punkt treffen Stadtgeschichte und Tristan-Text in auffälliger Weise zusammen. Mehrere Chronisten berichten, daß Bischof Heinrich im Jahre 1212 fünfhundert Menschen (also ein Zwanzigstel der Gesamtbevölkerung) unter dem Verdacht der Ketzerei verhaften ließ, wobei sich die Angeklagten aus allen Ständen rekrutierten: Zu ihnen gehörten Adlige und Bürger, Laien und Priester, Reiche und Bettler, Männer und Frauen. Bernhard Hertzog beschreibt diesen Vorgang im Jahre 1592 auf der Grundlage älterer Quellen in seiner Elsässischen Chronik: „Bey dises Bischoffs (Henricus Graff von Veringen) Zeiten / waren vil Begeinen und Zulbrüder / auch andere leut / Edel und Unedeli die heimlich großen unglauben under einander ubten / [...] jtem was Nidwendig des gürtels geschehe / das were Natürlich un nicht wider Gott gethon. [...] Dises befande der Bischoff und die statt / und fingen solcher verkerer und unglaublicher leut viel / under dene waren 80 Man und Weiber die solcher Ketzerey uberwisen und schuldig / die wurden alle 80 zu Straßburg verbrant / im jar nach Gottes geburt 1212.“ [7] Der merkwürdige Anklagepunkt, die „Ketzer“ würden alles „was unterhalb des Gürtels geschähett“ für „natürlich und nicht gegen Gott gehandelt“ betrachten, trifft auf die von Gottfried im „Tristan“ vertretene sexuell emanzipierte und enttabuisierte Liebesauffassung in besonderem Maße zu, und es erscheint kaum vorstellbar, daß Gottfried von diesem sozusagen vor seiner Haustür stattfindenden ideologischen Terror- prozeß, der den Kernpunkt seiner schriftlich dargelegten Überzeugung verurteilt, unberührt geblieben wäre. Entsprechend hält die leidenschaftlich geführte Forschungsdebatte über die Frage unvermindert an, ob Gottfried zu den Katharern zu rechnen sei oder nicht. [8] In der Tat scheint es einen unmittelbaren Reflex auf den Katharerprozeß im „Tristan“ zu geben, denn die „Marbacher Annalen“ berichten, die Straßburger Angeklagten wären dem sogenannten ‚Gottesurteil’ des „glühenden Eisens“ (vgl. Gottesurteil.doc) unterworfen worden, und das gleiche geschieht auch mit Isolde, die vor aller Öffentlichkeit das glühende Eisen berühren muß, um damit ihre vorgebliche eheliche Treue zu beweisen (V. 15 304ff.). Dieses „Gottesgericht“ findet man bereits in der Quelle, auffällig bleibt jedoch Gottfrieds scharfer Kommentar, daß sich Christus hier „wintschaffen alse ein ermel“ (wetterwendisch wie ein lockerer Ärmel; V.15740, s. S.356f.) erweist. Dies alles vermag kaum mehr als Anhaltspunkte zu Vermitteln, demonstriert jedoch deutlich die heftige und alle Bevölkerungsschichten umfassende geistig-ideologische Auseinanderseizung in der Stadt sowie die inhaltliche relevante Korrespondenz dieser Auseinandersetzung mit Gottfrieds Werk. Aus diesem gärenden Nährboden frühstadtbürgerlicher geistiger Befreiungs- und Emanzipationsversuche und ihrer barbarischen Unterdrückung durch die bischöflichorthodoxe Feudalgewalt, die damit zugleich ihre angegriffene Machtstellung zu sichern sucht, erwächst das Werk Gottfrieds als das große und einzigartige mittelalterliche Bekenntnis zum übergeordneten Recht des Einzelnen auf Freiheit und Unabhängigkeit gegenüber einer als korrupt erkannten Gesellschaft und ihrer Wertehierarchie. Aus der Kühnheit dieses Entwurfs erklärt sich auch das Schutzbedürfnis des Autors, das neben dem Verschweigen persönlicher Daten und der offenbar bewußt angelegten polysemen Ausdeutbarkeit aller möglicher häresieverdächtiger Passagen auch in dem Kryptogramm des versteckten Initialenspiels zum Ausdruck kommt. Das versteckte Buchstaben- und Zahlenspiel des Akrostichons ist noch immer nicht völlig enträtselt, doch haben vor allem jüngere Forschungen die Annahme sichern können, daß neben dem Namen „Dieterich“ im Prolog auch die jeweils vier ersten Buchstaben von „Gote(vrit)“, „Tris(tan)“ und „Isol(t)“ in den vierzeiligen Strophen versteckt sind, die sich über den gesamten, sonst paarig gereimten Text erstrecken, formal nur einen einzigen Reim aufweisen und inhaltlich einen besonders hervorgehobenen sentenzhaften Charakter tragen.[9] Am einfachsten und ehesten war „Dieterich“ zu enträtseln, da sich sein Name übersichtlich fortlaufend aus den Anfangsinitialen der Viererstrophen 2 bis 9 des Prologs ergibt. Das „G“ der ersten Strophe war unterschiedlich als „Graf“ oder „Gottfried“ gedeutet worden, bis man nachweisen konnte, daß durch die Verse der Viererstrophen I (G), 1749 (0), 5067 (T) und 12 187 (E) sich tatsächlich der Dichtername erschloß. Die Namen des Liebespaares verschränken und umschlingen sich anschließend symbolisch entsprechend der berühmten Formulierung des Prologs: ein man, ein wîp; ein wîp ein man Tristan Isolt; Isolt Tristan. (V. 129f.) Damit ergibt sich folgendes bisher entschlüsseltes[10] Kryptogramm: Prolog: GDIETERICHTIIT. Das geheimnisvolle Namen- und Buchstabenspiel läßt Gottfried auch seine Figuren selbst durchspielen, so etwa, wenn Tristan sich Tantris nennt und Isolde die absichtsvolle Buchstabenvertauschung ganz allmählich erkennt (V. 10 100ff. und 10602ff.), oder noch deutlicher, als die Liebenden die List mit den Spänen durchführen, wobei sie die Anfangsbuchstaben ihrer Namen „T“ und „I“, als geheime Botschaft für den anderen verwenden (V. 14423 ff.). In allen Fällen zwingt persönliches Schutzbedürfnis zu solchen versteckend-geheimnisvollen Sprachspielen; und wenn sich Gottfried in das Kryptogramm seiner Figuren einreiht, darf man im Zusammenhang mit der historischen Situation und seiner sonstigen privaten Verschwiegenheit mit einer für ihn analogen Begründung solcher Verfahrensweise rechnen. Trotz zum Teil gegenteiliger Versicherung der Forschung [11] besitzt das Initialenspiel des Akrostichons handlungsstrukturierenden Charakter. Dies betrifft bereits den Prolog, wo - wie später darzustellen ist - die Strophen V. 41 bis 45 und V. 131 bis 135 wichtige inhaltliche Einschnitte darstellen, es betrifft jedoch auch die im Text gruppenartig zusammenstehenden Initialen V. 1749-1867, 5067-5179, und 12 187-12 511. Die erstgenannte Gruppe markiert das Ende der Vorgeschichte, die den Eltern Tristans bis zu ihrem tragischen Tod gewidmet ist, die zweite markiert das Ende der Kindheit und Jugend Tristans bis einschließlich Schwertleite, die den Übergang zum Erwachsenendasein auch inhaltlich kennzeichnet, und die dritte Gruppe schließlich bezeichnet den Beginn der Liebe zwischen Tristan und Isolde. Das - in der Art einer geometrischen Reihe aufgebaute - Akrostichon bezeugt mit der Unabgeschlossenheit seiner Namen auch den Torsocharakter des Werkes und entkräftet damit weitgehend die immer wieder vorgetragene Forschungsmeinung, daß hier kein Fragment, sondern eine planmäßig abgeschlossene Dichtung vorläge. Eindeutig gegen diese Ansicht spricht auch die klare Aussage der beiden Fortsetzer Gottfrieds - Ulrichs von Türheim (um 1230) und Heinrichs von Freiberg (um 1290), daß der Tod den Dichter an der Vollendung seines Werkes gehindert habe (Ulrich von Türheim, Tristan V. 497,1 ff.; Heinrich von Freiberg, Tristan V. 10ff.). Genauere Hinweise auf die Schaffenszeit Gottfrieds lassen sich - mit den üblichen Vorbehalten aus dem Literaturexkurs gewinnen, in dem Veldeke und Reimar (falls er hier tatsächlich gemeint ist) als verstorben, Hartmann von Aue und Walther von der Vogelweide aber als lebend und bereits hochberühmt genannt werden (wobei Walthers Ruhm den Formulierungen nach jünger zu sein scheint). Zusammengenommen verweisen sie auf das erste Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts, ebenso wie die im Literaturexkurs anonym begonnene sogenannte Wolframfehde. Gottfried greift hier - wenngleich nicht namentlich - Wolfram von Eschenbach scharf an, wobei er wörtlich auf den „Parzival“ Bezug nimmt, der durch das berühmte „Weingärten-Datum“ relativ gut datierbar ist (s. S. 260 f.). Vor 1205 dürfte folglich der „Parzival“ Gottfried auch auszugsweise kaum bekannt geworden sein. Nach 1212 mußWolfram seinen „Willehalm“ begonnen haben, in dessen Prolog er mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls anonym auf Gottfrieds Angriff antwortet, so daß sich auf dem Boden dieser Argumente für Gottfrieds „Tristan“ ein zeitlicher Ansatz zwischen etwa 1205 und ca. 1213 ergäbe. Die ungewöhnliche sprachliche Meisterschaft Gottfrieds setzt eine langjährige gestalterische Übung an anderen Texten voraus, von denen lediglich zwei „Sprüche“ erhalten sind, die Gottfried vom Genre her zusätzlich in die Schicht der Meister, Gelehrten und sozial niederrangigen Berufsdichter einordnen. Der „Tristan“ ist in elf Handschriften und fünfzehn Fragmenten überliefert [12] wobei alle Handschriften des 13. Jahrhunderts elsässisch sind und mit hoher Wahrscheinlichkeit in Straßburg selbst hergestellt wurden, was unter anderem auf den Straßburger Meister Hesse verweist, den Rudolf von Ems um 1230 in seinem „Willehalm“ (V. 2281 ff.) als eine Art Verlagslektor bzw. Redakteur nennt, der Texte zur Annahme prüft bzw. auch stilistisch überarbeitet. Meister Hesse ist 1233 und 1237 in Urkunden der Stadt Straßburg als städtischer Notar bzw. Stadtschreiber bezeugt. Der Zusammenhang ist deswegen interessant, weil Rudolf von Ems neben anderem nicht nur die Erfindung des Literaturexkurses von Gottfried übernimmt, in dem er Gottfried einen besonders hohen Stellenwert einräumt, sondern auch Gottfrieds AkrostichonTechnik, die natürlich nur durch ein entsprechend arbeitendes Schreibbüro zu realisieren war. „Tristan und Isolde“ Prolog: Das Kunstwerk als Eucharistie der "edelen herzen“ Thomas und Gottfried (V. 1-242) Der vielumrätselte, 244 Verse umfassende programmatische Prolog [14] gewinnt durch seinen theoretischen Gehalt und seine spezifische sprachkünstlerische Ausformung fast so etwas wie den Charakter eines eigenständigen Kunstwerkes. Das Akrostichon enthüllt seinen Aufbau: Nach der einführenden G(ottfried)-Strophe folgen die neun Dieterich-Strophen, die über Literatur- und Kunstkritik handeln, mit der Tristan-Strophe V. 41-44 geht Gottfried zu Gegenstand und Zweck seines eigenen dichterischen Vorhabens über, und mit der Isolde-Strophe V. 131-134 schließlich begründet Gottfried die Wahl seiner Quelle und die sinntragende Richtung seiner eigenen Auslegung. Die einführende G(ottfried)-Strophe beschreibt im Hinblick auf das folgende Werk die grundlegenden ästhetischen Maxime Kunst als (höchsten) autonomen ethischen Wert wie folgt: Gedenkt man ir ze guote niht, / durch von den der werlde guot geschiht / so waere ez allez alse niht, / swaz guotes in der werlde geschiht. Gedächte man derer nicht im guten Sinne, die der Menschheit Gutes zuteil werden lassen, so wäre alles wie ein Nichts, was an Gutem in der Welt geschieht. (V. 1-4) Radikal formuliert bedeutet dies: Ohne das Orientierung bietende (literarische) Gedächtnis vollbrachter guter Taten wären alle guten Taten der Welt umsonst; die Ethik erfüllt sich damit in äußerster Verabsolutierung in der Ästhetik und begründet die Herrschaft der Literatur in einer ihrer klassischen Epochen mehr als ein halbes Jahrtausend vor Lessing als einer „moralischen Anstalt“. Hatte Hartmann bereits im „Iwein“ auf den Gegensatz zwischen dem zurückliegenden vorbildlichen „Handlungszeitalter“ und dem zeitgenössischen „Rezeptionszeitalter“ verwiesen, das immerhin den Vorzug hatte, sich an den Taten der „Alten“ erfreuen zu können, so wirkt dieses Bekenntnis zur feudalklassischen Literaturgesellschaft noch ausgesprochen harmlos und unverbindlich gegen den Rigorismus einer durchästhetisierten Ethik, wie sie hier und im folgenden von Gottfried vertreten wird. Eine solche hochsensibilisierte Ästhetik ist jedoch für Gottfried nicht nur Programm, sie ist für ihn auch unmittelbarer Ausdruck des Denkens und einer bis zur Sprachmagie in der Wirkung gesteigerten sprachkünstlerischen Gestaltung, wie dies die komplizierte Struktur des zitierten einreimigen Vierzeilers mit der umarmenden Wiederholung eines Reimwortes und der polysemen Mehrfachnutzung der sinntragenden Themawörter anschaulich demonstriert. Dabei wäre es nur die halbe Wahrheit, von kunstvollem Formenspiel zu sprechen, denn ebenbürtig steht diesem Formenspiel ein kompliziertes semantisches Spiel mit Polysemien, Antonymien, mit der Enge und Weite der Begriffe und der unterschiedlichen Gewichtung der Assoziationsmöglichkeiten gegenüber, das Gottfried mit unnachahmlicher Virtuosität beherrscht und die Exegese so vieldeutig macht. Die folgenden neun Widmungsstrophen, deren Initialen den Namen „Dieterich“ bilden, sind der Forschung in ihrem Sinngehalt bislang besonders dunkel geblieben, da sie hinter Dieterich den üblichen adligen „Gönner“ vermutet hat (so wurde das voranstehende G der Gottfried-Strophe ja auch fälschlich als „Graf“ interpretiert), so daß die in diesen Strophen thematisierte Literatur- und Kunstkritik keinen überzeugenden Bezug zu dem Bewidmeten ergab. Ein solcher Sinnzusammenhang stellt sich erst her, wenn wir in Dieterich einen beruflichen Vorgänger des zitierten Straßburger Meisters Hesse erblicken, dem Rudolf von Ems sein Werk nach eigener Aussage so gern zur Beurteilung (und sicher auch stilistischen Bearbeitung und Abschrift) vorgelegt hätte. Ganz abgesehen davon, daß man bei der vermuteten Dedikation an ein Mitglied des Hofadels tatsächlich nicht nur den blanken Vornamen, sondern auch einen Titel oder zumindest die Andeutung des Herrschergeschlechts erwarten dürfte, passen alle Angaben ausnahmslos und genau auf einen entsprechenden „Merker“ und Literaturkritiker, dessen Metier in der Einschätzung künstlerischer Literatur besteht. Behandelt wird die kritische Rezeptionsfähigkeit von Literatur, die literarische Urteilskraft und die Einflüsse, die sie steuern, die Notwendigkeit und Wirkung von Lob und Tadel, wobei der ehrliche und wohlwollende Kritiker eine ebenso hohe Wertschätzung erfährt wie jene mit vernichtender Kritik bedacht werden, die den von Gottfried gesetzten strengen Maßstäben nicht gerecht werden. So heißt es zunächst preisend und zugleich das Publikum ansprechend : Tiure unde wert ist mir der man, / der guot und übel betrahten kann / der mich und iegelichen man / nach sînem werde erkennen kan. Teuer und wert ist mir derjenige, der gut und schlecht gegeneinander abwägen kann, und jeden anderen nach seinem tatsächlichen Wert einzuschätzen versteht. (V. 17-2O) Wird hier - um sowohl die Widmungsmöglichkeit an den im Akrostichon Bezeichneten als auch die Identifizierungsmöglichkeit für das Publikum offen zu lassen - im allgemeinen Singular („der man“) gesprochen, so wird die negative Gegenseite auch formal deutlich durch den Plural abgegrenzt: Ir ist so vil, die des nu pflegent, / daz si daz guote ze übele wegent / und daz übel wider ze guote wegent / die pflegent niht, si widerpflegent. Es gibt heutzutage viele, die folgendes zu tun pflegen: Sie schätzen das Gute als schlecht ein: das Schlechte als gut: Solche Leute pflegen die Literatur nicht, sie gegenpflegen. (V. 29-32) Greifbar deutlich wird hier der dialektische Funktionsmechanismus einer lebendigen Literaturgesellschaft, die eine eigenständige Kunstkritik herausbildet, die wiederum auf die Qualität der Literaturentwicklung Einfluß nimmt. Nicht der Ritter steht im Mittelpunkt dieses Prozesses, sondern der Künstler; um sein Lob und seine Ehre geht es (V.21ff.); und das Urteil der Kritiker (die zugleich maßgeblich über Annahme oder Ablehnung von Abschriften entscheiden) befindet zugleich wesentlich über Dichterexistenz und Dichterruhm, wodurch die „Ehre“ des Dichters in Konkurrenz zur „ “ des Ritters tritt, wie dies - wenngleich nicht so profiliert - bereits bei Hartmann sichtbar wurde. Diese Dieterich-Strophen sind in engem Zusammenhang mit dem später zu behandelnden Literaturexkurs zu sehen, wo diese Parallelität noch dadurch verdeutlicht wird, daß die „Dichterschau“ provokativ exakt in genau jene Stelle eingerückt wird, wo eigentlich die ritterliche Schwertleite zu schildern gewesen wäre, so daß der Ruhm des Dichterstandes die ruhmvolle Aufnahme in den Ritterstand bewußt in den Hintergrund drängt. Von der Person des Kritikers und vom Gegenstand der Kunstkritik dieser DieterichStrophen leitet unmittelbar im Anschluß daran die erste Tristan-Strophe (V. 41-44) sogleich zur Ich-Person des Autors und Erzählers über, dem mit der Isolde-lnitiale der paarig gereimte Teil des Prologes folgt, dessen Beginn sogleich das grundlegende ethisch-ästhetische und literatursoziologische Bekenntnis Gottfrieds wie folgt formuliert: Ich hân mir eine unmüezekeit der werlt ze liebe vür geleit und edelen herzen zeiner hage: den herzen den ich herze trage, der werlde in die min herze siht. ine meine ir aller werlde niht als die, von der ich hoere sagen, diu keine swaere müge getragen und niwan in fröuden welle sweben: die lâze ouch got mit fröuden leben! der werlde und diseme lebene enkumt min rede niht ebene: ir leben und mînez zweigent sich. ein ander werlt die meine ich, diu sament in eime herzen treit ir süeze sûr, ir liebez leit, ir herzeliep, ir senede nôt, ir liebez leben, ir leiden tôt, ir lieben tôt, ir leidez leben. dem lebene sî mîn leben ergeben, der werlt wil ich gewerldet wesen, mit ir verderben oder genesen. (V. 45-66) Ich habe mir der Welt zuliebe eine Arbeit auferlegt und edlen Herzen zur Beglückung, jenen Herzen, denen ich von Herzen zugetan bin, und jener Welt, in die mein Herz zu blicken versteht. Ich meine nicht die Welt all jener, von denen ich sagen höre, daß sie keinen Kummer zu ertragen vermögen und die nur in Freuden schwimmen wollen: Die soll auch Gott mit Freuden leben lassen! Dieser Gesellschaft (Welt) und diesem Lebensstil vermag meine Dichtung nicht zu entsprechen: Ihr Leben und meines sind voneinander getrennt. Ich hingegen will eine andere Gesellschaft ansprechen, die gemeinsam in einem Herzen trägt: ihre süße Bitternis und ihr liebes Leid, ihre Herzensfreude und Liebesnot, ihr glückliches Leben und ihren Leidenstod, ihren glücklichen Tod und ihr leidvolles Leben: solchem Leben sei mein Leben geweiht, dieser Gesellschaft will ich zugesellt sein, mit ihr zugrunde gehen oder auferstehen. Diese zentrale Textstelle wird von der Forschung äußerst unterschiedlich interpretiert. Ohne Zweifel grenzt Gottfried sich selbst und seine Gemeinde von einem gegensätzlich orientierten, vereinseitigt nur auf Freude fixierten Publikum ab und polemisiert gegen die illusionäre höfische Ideologie der Artusepik. Doch wer bildete diese Gemeinde, die sich so prononciert vom höfischen Literaturverständnis absetzt? Die Diskussion hat sich bislang vor allem an dem Schlüsselbegriff der „edelen herzen“ entzündet; wobei es weniger um die historische Ableitung des Begriffs geht, der sowohl als Eindeutschung des provenzalischen „gentil cur“ (bzw. des altfranzösischen „gentil cuer“, oder auch als Verweltlichung der mystischen „anima nobilis“ betrachtet werden kann.) Tatsächlich bedeutet der Begriff der „edelen herzen“ als angesprochene Hörer- bzw. Leserschaft etwa gegenüber „Rittern“ oder „Herren“ eine unübersehbare soziologische Öffnung, die nicht mehr auf den Sozialstatus, sondern auf ethische und ästhetische Qualitäten des Publikums orientiert, wobei der Begriff der „edelen herzen“ in formaler Analogie, aber gleichzeitiger inhaltlicher Antithetik zu den sonst literarisch üblichen „edelen herren“ gebildet ist, so daß der standesunabhängige innere „Adel“ bewußt dem äußeren geburtsständischen entgegengesetzt wird. Gottfried grenzt sich ja gerade energisch gegen jene andere „Welt“ bzw. Gesellschaft ab, die sich nur dem Ideal der höfischen Freude verpflichtet weiß und setzt ihm das Publikum seiner eigenen, dazu im Widerspruch stehenden Anschauungsweise entgegen. Von einer „Hierarchisierung“, wie K. Ruh, J. Schwietering und andere meinen, ist nirgends die Rede, und Gottfrieds scharf formulierter Gegensatz zwischen diesen beiden Welten und Gesellschaften schließt eine Verbindbarkeit aus, wobei zumeist übersehen wird, daß Gottfried ausdrücklich daraufhinweist, diese andere (höfische) Gesellschaft nur vom Hören-Sagen zu kennen. Auch der Begriff der „Elite“ ist insofern irreführend, als er von vornherein eine adligklassenmäßige Fixierung assoziiert, die indessen gerade nicht gemeint ist. Die in der Forschung mit zunehmender Intensität vertretene Meinung, daß es sich bei dem von Gottfried apostrophierten Publikum um eine Elite innerhalb der höfischen Gesellschaft handle, läßt sich aus dem Text heraus nicht belegen. Die ethische Begrenzung auf die „Welt“ der Gebildeten, der Kunstverständigen, der intellektuell und psychisch an den existentiellen Problemen des inneren Zusammenhangs von Liebe, Leben, Leiden, Kunst und Bildung Interessierten, für die jene ritterlich-feudalherrliche Standesproblematik der Kampfbewährung und der Herrschaftslegitimation, wie sie die höfische Artusepik auszeichnet, nicht von Belang ist, bedeutet zugleich eine soziale Offnung und Identifikationsmöglichkeit für das junge Stadtbürgertum. Dies geschieht vor allem durch drei Rollen, die Tristan repräsentiert: Den Kaufmann, den Künstler und den „Meister“ und Lehrer (Isoldes). Dabei ist die Identifikation der Hauptfigur mit dem Kaufmannsstand und dessen damit verbundene vorbildhaft-positive Bewertung so augenfällig, daß es schon einiger Voreingenommenheit bedarf, um hierin kein Rezeptionsangebot für ein entsprechendes - zunächst einmal Straßburger - Publikum zu sehen. Hierfür spricht nicht nur die schon quantitativ massive Verknüpfung der Tristanfigur mit der Kaufmannsrolle (vgl. V.3094ff., 3275 ff., 3596ff., 4049ff., 4076ff., 4344ff., 7573 ff., 8800ff., 9521 ff., 1038ff.), sondern auch die damit verbundene Vorbildwertung, die durch die Bewunderung erregenden Figuren Tristans und Ruals bis zu der Einschätzung ausgebaut wird, daß auch dem Kaufmann ein „edeles Herz“ (V.4092) zugesprochen wird, was unmittelbar auf den Prolog und auf das mit diesem Terminus angesprochene Publikum verweist. Gottfried hätte die Kaufmannsfiktion durch Handlung oder Kommentar ad absurdum führen können, tut dies aber nirgends; die Kaufmannsrolle Tristans und Ruals an Markes Hof ist nach Ausweis der erhaltenen „Ersatzfassungen“ für Thomas’ Fragment eine eigenständige „Erfindung“ Gottfrieds, deren Intentionalität damit kaum noch weiterer Begründung bedarf. Bereits zu Beginn des 13. Jahrhunderts hatte sich in Straßburg neben dem mit Sonderrechten ausgestatteten Klerus ein starkes und reiches, vor allem fernhandeltreibendes Patriziat herausgebildet, das zu seinem größeren Teil von der sogenannten „bürgerlichen Ministerialität“ gebildet wurde, während ein anderer, als „milites“ (Ritter) bezeichneter Teil der Ministerialität der Bischofspartei und ihren feudaladligen Interessen zuzurechnen ist, folgerichtig stieg sie später in die Schichten des Landadels auf.[19] Die Patrizier werden Urkundlich häufig „prudentes“, „sapientores“, die „wisesten“ usw. genannt, so auch im zweiten und dritten Straßburger Stadtrecht [20], was besonders gut zu der sich gerade durch Klugheit und besondere intellektuelle Fähigkeiten auszeichnenden Kaufmannsrolle Tristans paßt. Ebenso aber auch zu seinen Rollen als Künstler und Lehrer, von denen im Textzusammenhang noch ausführlich die Rede sein soll. Mit Beginn der Isolde-Strophe (V. 131-134) begründet Gottfried seine Quellenwahl, wobei er ausdrücklich betont, daß er nicht auf die zahlreichen im Umlauf befindlichen volkstümlichen Versionen des Tristan-Stoffes zurückgreifen wolle (s. S. 102ff.), sondern daß er als Vorlage das Werk des „Thomas von Britanje“ (V. 150 ) gewählt habe und daß er erst lange habe suchen müssen sowohl in französischsprachigen als auch in lateinischen Büchern, bevor er an den für ihn maßgeblichen Text herangekommen sei. Daß er es überhaupt geschafft hat, erscheint fast als ein Wunder, denn den Fortsetzern stand diese Quelle nicht zur Verfügung, und Thomas’ Werk selbst ist nur noch in Fragmenten erhalten, die lediglich 3144 Verse umfassen und im wesentlichen den Schlußteil betreffen, so daß nur zwei kurze Textstellen zwischen Thomas und Gottfried konkordant verlaufen (Cambridge-Fragment V.1-52 mit Gottfried V.18199-18362 und Sneyd-Fragment V. 1-182 mit Gottfried V. 19423-19 552).[21] Thomas war Anglonormanne, und wahrscheinlich ebenfalls ein gelehrter „Meister“ und Städter wie Gottfried, worauf unter anderem das begeisterte Lob Londons verweist. Es ist anzunehmen, daß er in Beziehung zum Englischen Hof stand. Die Abfassungszeit seines Werkes bleibt umstritten: Nimmt man an, daß sich Chrétien de Troyes (vgl. Chrétien de Troyes.doc) in seinem „Cligès“ bereits auf Thomas bezieht, so müßte man das Werk von Thomas ungefähr auf 1170 datieren, bezieht sich Chretien indessen auf Béroul oder eine vergleichbare sogenannte volkstümliche Fassung, so ergeben sich auch wesentliche Argumente für eine Abfassungszeit um 1190. Thomas selbst gibt bereits an, daß sehr unterschiedliche Versionen der TristanÜberlieferung existierten, und daß er versuchen wolle, eine Synthese herzustellen, indem er die besten Episoden aussuche und den Rest weglasse (Thomas, V. 2107ff.). Fast wörtlich mit Gottfried übereinstimmend fährt er fort, daß es viele gäbe, die die Geschichte von Tristan vortrügen und daß er sie oft gehört habe. Doch dann bezieht er sich auf einen sonst unbekannten Erzähler namens Breri als seinen Gewährsmann, über den er die uns heutzutage erstaunende Mitteilung macht, daß er die Heldengeschichten und epischen Erzählungen über alle bretonischen Könige und Feudalherren auswendig kannte. (Thomas, V.21ff.) Bereits Thomas hatte den ihm in unterschiedlichen Versionen vorliegenden Stoff weitgehend dem modernen Geschmack der psychologischen Vertiefung und Verfeinerung und der ästhetischen Durchformung angepaßt, wobei diese „Entbarbarisierung“ auch eine gewisse Einbuße an epischer Wucht und naiver Urwüchsigkeit bedeutet. Ein annäherndes Bild von der Gesamtdichtung des Thomas kann man sich durch zwei andere Nachdichtungen verschaffen: die Prosa-Saga des norwegischen Mönchs Robert (aus dem ersten Drittel des 13. Jahrhunderts) und den mittelenglischen „Sir Tristem“, der gegen 1300 datiert wird! [22] Dadurch wird deutlich, daß Gottfried seinem Gewährsmann Thomas stofflich und kompositorisch nahezu alles verdankt; schon auf dieser unteren literarischen Ebene sind die Abweichungen von der volkstümlichen Version, wie sie „Tristrant und Isalde“ vertritt, so gravierend, daß man bereits unter diesem Aspekt von einer völlig anderen Dichtung sprechen muß. Exemplarisch deutlich wird dies am Anfangsteil, wo Thomas und Gottfried durch den gewaltigen Ausbau der Vor- und Jugendgeschichte Tristans die 296 Verse von „Tristrant und Isalde“ (V. 54-350) zu 5627 Versen bei Gottfried aufschwellen (V. 243-5870). Neu eingefügt von Thomas/Gottfried sind ferner die Gandin-Episode „Rotte und Harfe“, die Episode von dem kleinen Wunderhund Petitcriu sowie die Garten-Abschiedsszene. Ausgelassen haben Thomas / Gottfried die brutale Bestrafung Isoldes durch die Auslieferung an die Aussätzigen sowie die Artus-Episode der „Wolfsfalle“, was wohl nicht nur historische Gründe hat, da beide geschichtlich zu verschiedenen Zeiten lebten, sondern auch innerliterarisch motiviert ist. Daß Thomas auch nach Abbruch des Gottfried-Textes weitgehend änderte, braucht hier nur in Parenthese vermerkt zu werden. Bereits bei Thomas ist der Schwerpunkt der Gestaltung weitgehend von der Handlung auf die Reflexion und die Einfühlung in die Psychologie der Gestalten - also gleichsam von außen nach innen - verlagert, dargestellt in zum Teil sehr ausgedehnten Monologen, Dialogen und ethischen Disputationen. Obgleich Gottfried seinem Vorgänger stofflich folgt, schafft er doch durch Vertiefung des Gehalts, durch szenische Umarbeitung und motivische Korrekturen, durch rationale Motivierung und Ausmerzung von Widersprüchen, vor allem jedoch durch Kommentierung, Aktualisierung, weitere psychologische Vertiefung, innerliche Verlebendigung, durch subtile Verfeinerung und nicht zuletzt durch seine überragende künstlerische Kompetenz und unerreichte sprachgestalterische Meisterschaft wiederum ein letztendlich völlig neues Werk. [23] Die grundlegend unterschiedliche Haltung beider Dichter zu ihrem Gegenstand und ihrem Publikum verdeutlicht sich wohl am auffälligsten in der erhaltenen Schlußpassage von Thomas’ Werk, deren verwandelte Aussage Gottfried ebenso wie die bereits zitierte Quellenfrage in seinem Prolog vorgezogen hat. Bei Thomas heißt es: Tumas fine ci sun escrit. A tuz amanz salut i dit, As pensis e as amerus, As emveius, as desirus, A enveisiez e as purvers, A tuz cels ki orrunt ces vers. ai dit n’ai a tur lor voleir, Le milz ai dit a mun poeir E dit ai tute la verur Si cum je pramis al primur. E diz e vers i ai retrait: Pur essample issi ai fait Pur L’estorie embelir Que as amanz deive plaisir E que par lieus poissent troveir Chose u se poissent recorder: Aveir em poissent grant confort Encuntre change, encontre tort, Encuntre paine e dolur, Encuntre tuiz engins d’amur. (V. 3127-3146)[24] Thomas beendet hier seine Schrift. Er grüßt alle Liebenden, die Vergeistigten, die Leidenschaftlichen, die Empfindsamen und jene, die die Wollust verbrennt, und solche, die das Vergnügen lieben, und selbst die Perversen, ebenso wie alle Hörer seines Romans. Nicht alle werden mit meinem Stoff zufrieden sein, aber ich habe versucht, ihn so vollendet wie möglich zu gestalten, und meine Version ist authentisch, wie ich es bereits zu Beginn vorhergesagt habe. Und in Verse gefaßt habe ich die Erzählung, um sie damit so auszuschmücken, daß sie allen Liebenden gefalle und daß sie darin mancherorts etwas finden mögen, woran sie Trost finden könnten: Mögen sie daraus eine heilsame Lehre ziehen gegen Wankelmut, gegen Unrecht, gegen Pein und Schmerz, gegen alle Fallen, die man der Liebe stellt! Dagegen beendet Gottfried seinen Prolog mit folgenden berühmten Versen, die Inhalt und Form, Liebesmythos und Sprachmagie zu höchster Vollendung und Verabsolutierung steigern: Ihr [Tristans und Isoldes] Tod soll stets uns Lebenden Leben und Erneuerung sein; denn wo man auch vorlesen hören wird von ihrer Treue, der Reinheit ihrer Treue, ihrer Herzensfreude und ihrem Herzeleid, so ist dies das Brot aller edlen Herzen. Dadurch wird ihrer beider Tod zum Leben erweckt. Wir lesen (im Sinne von Vorlesen) ihr Leben, wir lesen ihren Tod: und das ist so erquicklich für uns wie Brot. Ihr Leben, ihr Tod sind unser Brot. So lebt ihr Leben, so lebt ihr Tod. So leben sie weiter und sind doch tot, und so ist ihr Tod der Lebenden Brot. Und wer nun begehrt, daß man ihm vortrage ihr Leben, ihren Tod, ihre Freude und ihre Klage, der biete Herz und Ohren her: Er wird alles finden, was er begehrt. ir tot muoz iemer mere uns lebenden leben und niuwe wesen; wan swa man noch hoeret lesen ir triuwe, ir triuwen reinekeit, ir herzeliep, ir herzeleit, Deist aller edelen herzen brot. hie mite so lebet ir bei der tot. wir lesen ir leben, wir lesen ir tot, unde ist uns daz süeze alse brot. Ir leben, ir tot sint unser brot. sus lebet ir leben, sus lebet ir tot. sus lebent si noch und sint doch tot, und ist ir tot der lebenden brot. und swer nu ger, daz man im sage ir leben, ir tot, ir fröude, ir klage, der biete herze und oren her: er vindet alle sine ger. (V. 228-242) Der feierlichen Hymnik dieser Verse entspricht die kühne Verweltlichung der christlichen Eucharistie-Vorstellung, nach der Christus durch das beim Abendmahl gereichte Brot sich im Menschen verlebendigt und ihn damit von seinen Sünden erlöst. Eine zweifellos gewagte Übertragung vom Abendmahlssakrament und dem Tode Christi auf das weltliche Liebespaar schlechthin. Minne wird damit in den Rang mythisch-religiöser Vorstellungsgehalte erhoben, die Liebenden werden zu Gestalten von ideologiegründender Relevanz, und das Anhören ihrer „Passion“ (gewinnt den zeremoniellen Charakter eines Sakraments. Man hatte die Profanierung einer so zentralen christlichen Heilsvorstellung als Zeichen häretischen Denkens gewertet, ohne zu bedenken, daß es keine einzige christliche häretische Strömung oder „Sekte“ gibt, die das predigt oder auch nur predigen könnte, was Gottfried hier als den Mythos des Jahrtausends absolut originär aufbaut: die Minne als Passion und die Heiligung der Liebe als existentielle menschliche Wesenheit. Vergleichen wir damit den ThomasText, so gewahren wir den Abstand und den unerhörten Qualitätssprung, von der formalen Glätte zur sprachkünstlerischen Virtuosität, von der freundlich-belehrenden und unterhaltenden Distanzhaltung zur identifizierenden Wir-Vereinigung von Publikum, Autor und dem Schicksal seiner Helden, von der einfachen Aufzählung aller Liebenden zu der Kommunikations- und Kommunionsgemeinschaft der „edelen herzen“, von der relativen Unverbindlichkeit exemplarischer Tröstung zum Absolutheitsanspruch einer Ideologie. Tristans Vargeschichte (24-l.788) Im Gegensatz zur Artusepik (mit Ausnahme von Wolframs „Parzival“), die nur den zentralen „Bewährungsabschnitt“ aus dem Leben ihres Helden erfaßt, handelt es sich beim „Tristan“ um einen „biographischen Roman“, der das gesamte Leben seines Helden episch darstellen will und mit der Einbettung dieser epischen Biographie in die elterliche Vorgeschichte das Schicksal des späteren Helden sowohl stofflich als auch symbolisch prädeterminiert. Bereits die tragisch verlaufende Liebeserzählung von Riwalin und Blanscheflur setzt gewichtige neue feudalkritische Akzente. In Riwalin verkörpert sich der verbreitete zeitgenössische Typus des mit Reichtum und ungeheurer Macht ausgestatteten, aber allzu jugendlichen, unerfahrenen und damit auch unbedachten Feudalherrn, dessen möglicherweise vorzügliche persönliche Eigenschaften indes nicht ausreichen, die eigenen Affekte zu kontrollieren und das Staatswesen mit dem notwendigen Bedacht zu lenken. So wird Riwalin gleich in den Eingangszeilen entsprechend vorgestellt; Ein herre in Parmenie[25] was,/ der jare ein kint, als ich ez las; Es war einmal ein Herr in Parmenie, der an Jahren noch ein Kind war, wie ich es gelesen habe. (V.243f.) Die Beschreibung des jungen Riwalin gleicht auffällig derjenigen des „Armen Heinrich“ Hartmanns vor seiner Erkrankung, nur daß hier die Jugend besonders betont erscheint; Er war „an gebürte künege genoz, / an lande fürsten ebengroz“ (V.247f.; vgl. „Armer Heinrich“: „sin burt unwandelbaere und wol den vürsten glich“,), er ist von glänzendem Aussehen und Inbegriff aller herrscherlicher Tugenden: an ime brast al der tugende niht, der herre haben solde (V.258f.) Ihm mangelte es an keiner Tugend, die ein Herrscher besitzen sollte. (Vgl. „Armer Heinrich“: „an dem enwas vergezzen deheiner der tugent die ein ritter in siner jugent ze vollem lobe haben sol.“) Man könnte die Descriptio von Heinrich und Riwalin fast problemlos miteinander vertauschen, doch in der aus paralleler Beschreibung erwachsenden Handlungs- und Schicksalbegründung streben beide Werke plötzlich in charakteristischer Richtung auseinander: Erfolgt bei Hartmann eine religiöse Motivation, indem sich aller prachtvoller äußerer Schein als gottferner „Hochmut“ entlarvt, der durch Gott selbst mit Aussatz gestraft wird, so bleibt Gottfrieds Motivation des folgenden Schicksals Riwalins absolut innerweltlich, indem Gottfried mit ausdrücklichem Blick auf Vergangenheit und Gegenwart wie folgt argumentiert: wan leider diz ist und was ie: ufgendiu jugent und vollez guot, diu zwei die füerent übermuot. (V. 264-266) Riwalin wird damit als ein Vertreter des artushaft-feudaladligen Ehrenkodex und typischer Repräsentant des Rittertums und jungen Feudaladels charakterisiert, der ebenso bedenkenlos wie mit bestem Wissen und Gewissen den Klassengesetzen der Feudallehre, der Feudalfehde und der Feudalanarchie gehorcht. Gottfried entschuldigt zwar Riwalins Verhalten mehrfach mit seiner Jugend, und er sagt auch: „Ich weiß nicht, ob es Not oder Übermut war“ (V. 340f.), was ihn veranlaßte, seinen Lehnsherrn Herzog Morgan anzugreifen, doch geht aus Riwalins vorhergehender ausführlicher Charakterzeichnung eindeutig hervor, daß Gottfried auch gegen das Schweigen der Quelle (V. 342) den plötzlich vom Zaun gebrochenen Angriffskrieg dem jugendlichen Übermut seines Helden zuschreibt. Gottfried hält dabei mit seiner Meinung nicht zurück, die in folgenden berühmten Versen gipfelt: wan ze urliuge und ze ritterschaft hoeret verlust unde gewin: hie mite so gant urliuge hin; verliesen unde gewinnen daz treit die kriege hinnen. (V. 364-368) Denn leider ist es jetzt und war auch immer so: Aufblühende Jugend und machtvoller Reichtum, die beiden gemeinsam erzeugen Übermut. Denn zu Krieg und Ritterschaft gehören Verlust und Gewinn: Damit gehen die Kriege hin; verlieren und gewinnen, das ist es, wovon sich die Kriege ernähren. Die grundsätzliche Sinnlosigkeit von Krieg und Rittertum haben in mittelalterlicher Literatur selten so prägnanten Ausdruck gefunden wie hier, wo andere Epen Gelegenheit genommen hätten, den Schlachtenruhm zu preisen oder den heldenmütigen ritterlichen Einzelkampf ihrer Protagonisten möglichst über Hunderte von Versen hinweg genüßlich auszumalen. Stattdessen wird ein provokativer Zusammenhang zwischen den sonst höchst geweihten feudaladligen Begriffen von „Turnier“ und „reicher, mächtiger Ritterschaft“ mit Landesverheerung, Raub und Brand hergestellt (V. 385 ff.). Übrigens betont Gottfried ausdrücklich, daß es die eroberten Städte sind, deren Lösesummen zur Erhaltung von Gut und Leben der Bewohner für die Aufstellung und Verstärkung der angreifenden Ritterschaft genutzt werden (V. 349 ff.). Als sich der Krieg trotzdem gegenseitig erschöpft, vereinbaren die beiden Gegner einen einjährigen Waffenstillstand, den Riwalin zu einem Aufenthalt an dem wegen seiner höfisch-modernen Sitten berühmten Hof des Königs Marke nutzt, der Herrscher über England und Cornwall ist und in Tintajoel residiert (während Thomas Marke offensichtlich in London regieren läßt). Er will dort die neue Art der Ritterschaft erlernen, fremde Sitten und Gebräuche aufnehmen und dadurch zugleich seine eigene Erziehung vervollkommnen (V.456ff.). Er übergibt das Land seinem Marschall Rual li foitenant (V. 467) (Rual dem Getreuen) und fährt mit zwölf Freunden zu Schiff über den Ärmelkanal nach England, wo er an Markes Hof herzlich aufgenommen wird. Nun entwirft Gottfried in antithetischem Kontrast zu der bewußt kurz, widerwillig und mit pejorativem Akzent versehenen Kriegsschilderung ein detailliert und in Hunderten von Versen liebevoll beschriebenes Bild des maienblühenden Frühlings, wie es verführerischer kaum je gestaltet worden ist. Während dieser vier Wochen währenden beseligenden Maienzeit, die als Antizipation des „Locus amoenus.doc“ der Minnegrottenszenerie gestaltet ist, verlieben sich Riwalin und Markes wunderschöne Schwester Blanscheflur voll tiefer Leidenschaft ineinander, und „diu gewaltaerinne Minne“ (V.959) - die Gewalthaberin Minne, eines der vielen durch Gottfrieds Sprachkraft neugeprägten Wörter - bindet beide wie freie Vögel fest, die auf die Leimruten des Vogelfängers gehen und um so stärker mit ihren Füßen daran festkleben, je stärker sie durch heftigen Flügelschlag versuchen, sich aus der Unfreiheit zu befreien (V.839ff.). Es ist auffallend, daß Gottfried als zuhöchst schmückendes Epitheton im Gegensatz zu seinen Vorgängern sehr häufig das Adjektiv „keiserlich“ verwendet, und zwar sowohl für Riwalin (V.690, 708, 1026 u.ö.) als auch für Blanscheflur (V. 1317), was - im Gegensatz etwa zu Hartmann - auf eine kaisertreue Gesinnung deutet. Während Gottfried fast vierhundert Verse aufwendet, um dieses zarte Aufkeimen und die schließliche Übergewalt der Minne zu vergegenwärtigen, hat er nur wenig mehr als zehn Verse übrig, um von einem plötzlich ausbrechenden Krieg zu berichten, in dessen Verlauf König Marke einen anonymen Aggressor über die Grenzen zurücktreibt. Riwalin wird dabei von einem feindlichen Speer getroffen und als todwunder Mann in Markes Burg zurückgebracht. Wieder werden Krieg und ritterlicher Heldentat keinerlei rühmende Beschreibung zuteil, wieder werden Krieg und ritterlicher Kampf nur als glückvernichtendes Unheil gesehen. Verzweifelt fleht Blanscheflur ihre Hofmeisterin an, daß man sie den Sterbenden noch einmal sehen ließe. Als Bettelweib verkleidet und sich dann als Ärztin ausgebend, gelingt es ihr schließlich, allein in sein Gemach vorzudringen. „Ach“, sagte sie, „heute und immer Ach!“, als sie den Geliebten totsiech vor sich liegen sieht, und legt ihre Wange an die seine, und da umfängt beide „Vor Liebe und vor Leid„ die Nacht der Ohnmacht, doch als sie wieder etwas zu Kräften kommt, „[...] da nahm sie ihren Geliebten in die Arme und legte ihren Mund an seinen Mund und küßte ihn hunderttausendmal in kurzer Zeit, bis ihm ihr Mund Sinne und Kraft zur Liebe entzündete, denn es geschah aus innerster Liebe: Ihr Mund brachte ihm die Lebensfreude zurück, ihr Mund schenkte ihm eine solche Kraft, daß er die kaiserlichherrliche Frau ganz nah und innig an seinen halbtoten Körper zwang. Danach dauerte es nicht mehr lange, bis sich ihr beider Begehren erfüllte: So geschah es, daß die zärtlich liebende Frau ein Kind von ihm empfing.“ (V.1308-1323) Zunächst ist ihnen noch eine kurze Zeit innigsten heimlichen Glücks vergönnt, wo sie beide eins sind, wie es später Tristan und Isolde sein werden: „sus waser si und si was er, / und er was ir und si was sin; / hier Blanscheflur, da Riwalin, / da Blanscheflur, da Riwalin,/ da beide, da leal amur. So war er sie, und sie war er; er gehörte ihr, sie gehörte ihm;, hier Blanscheflur, da Riwalin / hier und da beide, da Riwalin, da Blanscheflur, da und hier eins in inniger Liebe. (V.1356-1360) Aber schon dringt wieder Kriegslärm in die kurze Frist des Glücks. Morgan hat die Zeit genutzt, um ein großes Heer zu sammeln, und der kaum genesene Riwalin muß zurück, um sein Land zu verteidigen. Erst als er von Blanscheflur Abschied nimmt, gesteht sie ihm ihre Schwangerschaft und ihre Angst vor sicherer Schande als „kebse“ (V. 1493), vor Bestrafung, Enterbung und Entehrung. So entweicht sie heimlich von ihres Bruders Hof, um mit Riwalin zusammen nach Parmenie zu fahren, wo sich beide auf Ruals Rat hin aus Öffentlichkeitsgründen (!) kirchlich trauen lassen. Doch Riwalin verliert in einer blutigen, von Gottfried wiederum nur angedeuteten Schlacht gegen Herzog Morgan sein Leben. Als Blanscheflur die schreckliche Nachricht erfahrt, erstirbt und versteinert sie klaglos vor Schmerz (V. 1733 ff.). Sie quält sich noch vier Tage, gebiert Tristan und stirbt. Damit ist das „owe“ der textordnenden zweiten Gottfried-Strophe erreicht (V. 1769). Die Riwalin-Blanscheflur-Erzählung ist so etwas wie ein „Warnlied“ im Sinne von Henrik Bekker, und so endet sie denn auch in nicht nur gehaltlichem, sondern auch fast wörtlichem Zusammenklang mit der Nibelungenkatastrophe: wan al ir trost und al ir kraft, ir tuon und al ir ritterschaft, ir ere und al ir werdekeit, daz alles was do hin geleit. (1759-1762) Denn alle ihre freudige Zuversicht und all ihre Macht, ihr Handeln und all ihre Ritterschaft, ihre Ehre und all ihr Ansehen: das alles war mit einem Schlag dahin. Riwalin ist wie die nibelungischen Helden an dem ungeschriebenen Gesetz feudalritterlicher Ehrauffassung gescheitert, das Hochmut inkarniert, aus sich heraus Krieg und Totschlag inszeniert und gemeinsam mit den feudalherrlichen Protagonisten ganze Völker in Leid und Untergang treibt. Die von der Artusepik entwickelte Ideologie adliger Ehre, die vor allem auf Kampfesruhm beruht, enthüllt sich als leerer Trug, sobald die Märchenaventiuren mit den fiktiven, letztlich stets unterlegenen Gegnern durch die Realität des Krieges ersetzt sind. Riwalin ist noch eine Art Artusritter unter anderen, nämlich realen Umständen, und das Scheitern Riwalins demonstriert entsprechend nicht mehr und nicht weniger als das Scheitern der arthurisch-ritterlichen Ideologie. Riwalins Sohn Tristan, der mitten in diese Katastrophe der ritterlichen Welt hineingeboren ist, wird ein ganz anderer sein, er wird sich dieser ritterlichen Welt gegenüber durch Geist, Witz, Bildung und Kunst als überlegen erweisen, er wird seinen ganz persönlichen Kampf gegen die Ehrgesetze dieser Feudalgesellschaft führen, er wird den Tod seiner Eltern rächen und wird die gesamte bornierte ritterliche Gesellschaft auf eine für sie verheerende - das heißt intellektuelle - Weise an der Nase herumführen, und er wird dabei sein letztendliches Scheitern in einem aussichtslosen Kampf schließlich in einen über den Tod hinauswährenden moralischen Triumph verwandeln. Tristans Jugend (V. 1.789-5066) Die außergewöhnlichen Umstände von Tristans Geburt haben auch eine außergewöhnliche Erziehung, Kindheit und Jugend zur Folge. Tristan darf von vornherein nicht er selbst sein: Das Land kapituliert vor Morgan, und um das Kind vor der Rache des Herzogs zu retten, geben der getreue Marschall Rual und seine Frau Floraete, die erst von Gottfried Rolle und Namen erhält, das Kind als ihr eigenes Neugeborenes aus und lassen es auf den sprechenden Namen Tristan (von französisch „triste“ = traurig) öffentlich christlich taufen: „von triste Tristan was sin name“ (V. 2001). Bis zu seinem siebenten Lebensjahr hält ihn die Ziehmutter Floraete in liebevoller Pflege und vermittelt ihm die Grundlagen gebildeten Umgangs, Benehmens, Ausdrucks (V.2055ff.). Bis zu seinem 14. Lebensjahr wird er dann einem gelehrten Erzieher anvertraut, der mit ihm gemeinsam fremde Länder bereist, um dort seine Bildung in allen nur möglichen Wissenschaften und Künsten in jeweils höchstmöglicher Vollendung zu erwerben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem nützlichen Erlernen fremder Sprachen und der schriftlich-gelehrten Aneignung von Wissen. Ist auch für Tristan mit dem Bücherstudium das Ende seiner kindlichen Freiheit und Freuden und sehr früh die Zeit des Lebensernstes gekommen, so unterwirft er sich dieser Mühsal doch so vorbildhaft, daß er bald mehr Kenntnisse besitzt als jedes andere Kind (V. 289f.). Gleichsam nebenher befaßt er sich mit den praktischen Künsten und erlernt das Spiel der unterschiedlichsten zeitgenössischen Saiteninstrumente in höchster Perfektion. Erst am Schluß wird der körperlich-sportlichen Ausbildung „nach ritterlicher Sitte“ (V.2109) gedacht: des Reitens mit Schild und Speer und des Turnierens, des Ringens, Laufens, des Weitsprungs und des Speerwurfs. Nachdem Tristan auch noch die Jagdkunst und alle nur möglichen „höfischen Spiele“ (wozu das Schachspiel gehört) meisterhaft erlernt hat, ist er bereits mit vierzehn Jahren zu einer allseitig gebildeten und damit in der Feudalgesellschaft außergewöhnlichen Persönlichkeit herangereift, die alle Potenzen autonomer menschlicher Selbstverwirklichung in sich trägt und damit auch die Disponibilität für höchstes irdisches Glück und Leid, wie dies Gottfried ausdrücklich betont und in dem Begriff „arbeitsaelic“ (V.2128 = mühsalglücklich, leidbeglückt) zusammenfaßt. Anschließend läßt der getreue Rual seinen Stiefsohn Tristan mit seinem Lehrer heimkehren und ihn das eigene Land durchreisen, um mit seinem angestammten Land und dessen Leuten und Sitten vertraut zu werden. Dreierlei fällt auf, was als symptomatisch für die gelehrte frühstadtbürgerliche Provenienz und als Ausdruck antiritterlicher Ideologie gelten darf: 1. Die Einzigartigkeit des so beschriebenen Bildungsvorganges, die in der hoch- und spätmittelalterlichen Literatur keine Entsprechung besitzt, indem sie auf die ganzheitliche Persönlichkeitsbildung mit dem Schwerpunkt der intellektuellen und künstlerischen Leistung orientiert und mit der Sensibilisierung für das Intellektuelle, Ethische und Ästhetische damit von vornherein ein grundlegend neues Menschenbild entwickelt, das sich von dem auf Ehre, Waffenruhm, Minne und Hofesfreuden hin erzogenen Typus des höfisch-ritterlichen Helden prinzipiell unterscheidet und den Vorrang der geistigen Leistung vor der körperlich-wehrsportlichen betont. Selbst der über das Artusrittertum hinauswachsende Parzival bleibt schon von seinen Bildungsvoraussetzungen her äußerster Gegensatz zu Tristan, und Wolfram von Eschenbach hat diesen Kontrast zwischen seinem „tumben“ Parzival und dem jungen Tristan auch selbst empfunden, indem er mit ausdrücklicher Anspielung auf Tristans Lehrer Kurvenal über seinen eigenen Helden aussagt: „in zoch nehein kurvenal“ (ihn erzog kein Kurvenal). 2. Das Fehlen jeglicher religiöser Unterweisung (auch hier im Gegensatz zu Parzival, der er - wenngleich später - ausführlich zuteil wird), was ein Konstituens sowohl der Figur als auch der gesamten folgenden Handlung bildet. 3. Daß es sich hier nicht um eine ritterliche Ausbildung handelt, wird auch daran deutlich, daß sie nicht - wie sonst im 14. Lebensjahr üblich - mit der ritterlichen Schwertleite endet: Die literarischen Umstände, unter denen sie später nachgeholt wird, verweisen äußerlich wie innerlich auf ihren nachgeordneten Stellenwert. Tristans staunenerregende Bildung bestimmt auch gleich zu Beginn sein Schicksal und erstes Abenteuer. Ein norwegisches Handelsschiff hat im parmenischen Kanoel festgemacht, und Marschall Rual begibt sich mit Tristan und seinen anderen Söhnen an Bord, um die dort ausgestellten herrlichen Waren zu betrachten und Einkäufe zu tätigen. Tristan interessiert sich besonders für ein kunstvoll gefertigtes elfenbeinernes Schachspiel, und er fragt die Norweger in deren Muttersprache, ob sie auch Schachspielen könnten. Tristan redet dabei die Kaufleute ausdrücklich als „edle Kaufleute“ (V. 2228) an; es entspricht dieser Sozialcharakteristik, daß nach eigener Aussage viele von ihnen das „höfische“ Spiel beherrschen. Zwei Kaufleute spielen Schach Während sich Tristan in eine Schachpartie mit einem der Kaufherren vertieft, gehen der Marschall und alle übrigen von Bord, und nur Meister Kurvenal bleibt. Die Kaufleute finden einen solchen Gefallen an Tristan, der vor ihnen nicht nur im Schach, sondern auch mit der perfekten Kenntnis aller möglichen Sprachen und Künste brilliert, daß sie heimlich die Anker lichten und ihn entführen. Der laut um das Schicksal seines Zöglings klagende Meister Kurvenal wird in einem kleinen Beiboot zurückgesandt, doch die Norweger geraten auf hoher See in einen acht Tage währenden furchtbaren Sturm, in dem sie die Strafe Gottes zu erkennen glauben. Sie bereuen ihre Tat, tatsächlich beruhigt sich das Meer augenblicklich, und die Kaufleute setzen Tristan an Land, nicht ohne ihn mit Brot und anderen Speisen zu versorgen und ihm Gottes Segen zu wünschen (V. 2147-2479). Ohne es zu wissen, befindet sich Tristan in Kurnewal (Cornwall), dem Land seines Oheims Marke, auf dessen Jäger er trifft, die gerade einen Hirsch erlegt haben, und er erhebt Einspruch dagegen, daß sie den Hirsch „wie ein Schwein“ unweidgemäß zerlegen wollen. Auf die erstaunte Frage des Jägermeisters hin belehrt ihn Tristan, daß ein Hirsch nach der Sitte seines Landes kunstgerecht zu „entbästen“ sei. Tristan führt den verblüfften Jägern nicht nur das Entbästen vor, sondern auch die genaue Ordnung, in welche die zerlegten Teile heimzutransportieren sind, wodurch fast unvermerkt das erste uns überlieferte gelehrte Jagdtraktat in die Handlung eingewoben wird. (vgl. Tristan und die Jagd.doc) Gaston Phébus, Le livre de chasse, die curée. Als die ihn maßlos bewundernden Jäger nach seiner Herkunft fragen, erklärt er, sein Vater sei ein Kaufmann in Parmenien, er habe ihn dies alles lernen lassen, Fremdsprachen und fremde Sitten habe er durch die vielen Kaufleute anderer Länder kennengelernt, die bei seinem Vater verkehrten, bis er schließlich von zu Haus durchgebrannt und mit einem Handelsschiff hierher gekommen sei (V.3095ff.). Interessant ist, daß die Jäger, obgleich sie nun wissen oder doch zu wissen meinen, daß Tristans Vater Kaufmann sei, die Frage stellen: „dîn höfscher vater, wie nant er dich?“ (V. 3133), wo das Wort „höfisch“ seine Standesbegrenzung ebenso einbüßt wie das Wort „edel“ bei den „edelen herzen“, oder „edlen Kaufleuten“. Dies ist ideologisch und in bezug auf die Publikumsintention mit Blick auf die reiche Kaufmannsstadt London (bei Thomas) und Straßburg (bei Gottfried) von aussagefähigem Belang, denn die Verknüpfung des vorbildhaft „höfischen Tristan“ (V.2791) und der Fiktion seiner kaufmännischen Herkunft und Bildung bleibt nicht nur handlungskonstitutiv für die folgenden Szenen, sondern wiederholt sich später noch zweimal bei seinen gefährlichen Irlandfahrten. In dem gleichen literatursoziologischen Zusammenhang steht die Tatsache, daß sich Tristan den Zugang zum königlichen Hof nicht - wie sonst in den ritterlichen Dichtungen üblich - durch Heldentum und Heldenruhm, sondern durch seine erstaunliche Bildung auf allen Gebieten und sein damit verbundenes sensibles und liebenswürdiges Wesen verschafft, wodurch er gleichsam im Fluge alle Herzen gewinnt. König Marke empfängt staunend gemeinsam mit seinem Hofstaat den kunstvoll geordneten Jagdzug, der mit der Beute unter Tristans Leitung und unter ebenfalls von ihm inszeniertem berauschendem Hörnerklang auf dem Schloß Tintajoel einzieht, und Marke ist es auch, der sogleich zu ihm eine besonders starke Zuneigung empfindet, ihn zu seinem Jägermeister ernennt und wie seinen Sohn hält. Als eines Tages ein walisischer Harfenspieler, der als der Beste seines Faches galt, am königlichen Hof musiziert, hört Tristan zu, und als er bescheiden (vgl. Bescheiden.doc) zu erkennen gibt, daß er ebenfalls auf dem Instrument zu spielen verstünde, fordert ihn der Meister auf, auch einmal seine Kunst hören zu lassen, und nun offenbart Tristan seine unübertreffliche künstlerische Meisterschaft: Er harft und singt Lieder und Leiche aus allen Ländern und in allen Sprachen, und alle lauschen voller Begeisterung und Ergriffenheit und denken: „Ach ja, selig möge der Kaufmann sein, der einen so höfischen Sohn besitzt!“ (v. 3597f.) Tristan spielt Harfe (14. Jht.) Nachdem Tristan betronisch, walisisch, lateinisch und französisch gesungen hat, fragt ihn König Marke verwundert, ob er denn alle diese Sprache auch beherrsche, und Tristan antwortet: „Ja, Herr, selbstverständlich“. Unterdessen hat Rual der Getreue seinen entführten Pflegesohn vier Jahre lange in aller Herren Länder gesucht. Dabei ist er völlig verarmt, muß sein Brot erbetteln, bis er in Dänemark die beiden Pilger trifft, die ihn auf die vielversprechende Spur nach Cornwall verweisen, wo es in Tintajoel zu einem rührenden Wiedersehen zwischen dem alten treuen Mann und seinem Pflegesohn kommt. Die folgende Szene ist wieder von dem fruchtbaren sozialen Spannungsgefüge Kaufmann - Adliger - Feudalherr geprägt. Mit sichtlichem Vergnügen schildert Gottfried die „kaisergleiche“ Erscheinung des hünenhaften, vornehmen und gebildeten vermeintlichen Kaufmanns Rual. Ein Raunen erhebt sich unter den Rittern und Baronen, und sie fragen wiederum: „Ist das der höfische Kaufmann, von dem uns sein Sohn Tristan so viel Gutes erzählt hat?“ (V.40534092). Danach wird auch der Grund genannt, aus dem heraus auch ein Kaufmann in der Lage wäre, ein Kind so vorzüglich zu erziehen: wenn ein „edles Herz“ dahintersteht (V.4090 - 4092). So ist es von der Gestalt des hier bezeichneten vermeintlichen edlen und höfischen Kaufmanns Rual zu der Figur des „echten“ höfischen Kaufmanns Gerhart im „Guten Gerhart“ Rudolfs von Ems nur noch ein kurzer und konsequenter Schritt, der in unmittelbarer und ausdrücklicher Nachfolge Gottfrieds geschieht und der durch die nachweisliche Querverbindung Rudolfs zu dem Straßburger Meister und Stadtschreiber Hesse auch seine innere und historische Logik besitzt. Als Rual, frisch gebadet und neu eingekleidet, vor König Marke, Tristan und dem versammelten Hofstaat nun die wahre Geschichte berichtet, erfährt Tristan erstmals seine richtige Herkunft. Alle brechen vor innerer Rührung in ungehemmtes Weinen und Wehklagen aus, und Marke erklärt, seinen so wiedergewonnenen Neffen als Erbe einsetzen zu wollen, woraufhin Rual vorschlägt, der König solle seinen Neffen zum Ritter schlagen. Im Gegensatz zu Hartmanns „Gregorius“ (vgl. Hartmanns Gregorius.doc) - und wohl auch kontrastiv zu ihm gestaltet -, der sich nichts Schöneres als das Ritterdasein vorstellen kann, macht Tristan Vorbehalte und Einwände: Ihm fehle dazu der notwendige Besitz, Rittertum müsse von frühester Kindheit an geübt werden, und eben diese Übung besitze er nicht (V.4400ff.). Schließlich wird die ritterliche Schwertleite doch durchgeführt, doch zögert der Dichter persönlich an dieser Stelle. Es ist kaum ein Zufall, daß Gottfried gerade an dieser Stelle seinen literaturkritischen Exkurs einfügt (V. 4619-4818), wo er symbolisch Waffennahme und Erhebung in den Ritterstand doppeldeutig durch die Glorifizierung des Geistes und der Kunst und die Darstellung der Prachtentfaltung des Walrenhandwerks durch den Hymnus auf die Literatur und den Dichterruhm ersetzt.[26] Von Rittertum und ritterlichem Aufputz ist schon so viel geredet worden, daß es einen anödet, sagt Gottfried, ich könnte nichts darüber berichten, was andere vor mir nicht schon besser getan hätten; und hier findet er den Anknüpfungspunkt, um seinen literaturrühmenden und literaturkritischen Exkurs einzuflechten. Gottfried nennt und würdigt an erster Stelle ausführlich die bedeutenden Epiker, die er symbolisch interessanterweise mit dem kunsthandwerklichen Ausdruck Färber ( = Färber, Maler) bezeichnet: Hartmann von Aue, Bligger von Steinach (dessen Werk uns nicht erhalten ist) sowie Heinrich von Veldeke. Scharf kritisiert Gottfried nur einen: Wolfram von Eschenbach, der nicht einmal der Namensnennung für würdig befunden wird. Wenn Gottfried von dem „vindaere wilder maere, der maere wilderaere“ (V.4663f.) (dem Erfinder wilder Geschichten, dem Verwilderer der Poesie) spricht, den er in Anspielung auf den „Parzival“-Prolog 1,19 als „des hasen geselle“ bezeichnet, der „ûf der wortheide / hochsprünge und witweide / mit bickelworten welle sin“ (V.46371f.) (der auf der Wörterheide Hochsprünge vollführt und weitläufig sein will mit Wörtern, die durcheinander wie beim Würfelspiel fallen), so zeigen sich hier nicht nur Verachtung und mögliches Konkurrenzdenken, sondern auch tiefgreifende Unterschiede in der Auffassung dessen, was Kunst leisten könnte und sollte. Auf Wolframs bekannten „dunklen Stil“ und seine Vorliebe für das obskure Kultische und Magische anspielend, empfiehlt Gottfried mit beißender Ironie, solche Poesieverwilderer sollten am besten Interpreten zusammen mit ihren Geschichten auf die Reise gehen lassen, für „edle Herzen“ sei dies nichts, und er habe im übrigen auch nicht die Zeit, der Bedeutung der verwendeten dunklen Wörter in den schwarzen Büchern der Magie nachzuspüren (V.4636 bis 4688). Von den Lyrikern, die Gottfried als „Nachtigallen“, bezeichnet, gibt es so viele, sagt der Kritiker, die ihr Amt ordentlich ausüben, daß sie unmöglich alle genannt werden können. Obgleich die meisten Minne-Lyriker adliger und hochadliger Herkunft sind, mit deren Lobpreis Gottfried sein Werk auch hätte selbst schmücken können, preist er mit Reimar von Hagenau und Walther von der Vogelweide ausgerechnet jene beiden im übrigen auch tatsächlich bedeutendsten - Dichter, die bei aller Unterschiedlichkeit im einzelnen ebenfalls Berufskünstler und damit Kollegen des Straßburger Meisters sind. Ein Zufall? Wohl kaum. Der Literaturexkurs ebenso wie der gesamte „Tristan“ bezeugen, daß sich Gottfried mit berechtigtem Stolz als führendes Mitglied einer neu entstandenen Literaturgesellschaft empfindet, wobei er im Gegensatz zu den Späteren keine sozialen Unterschiede wie etwa zwischen „Meister“, und „Herr“ macht, sondern sie mit alleiniger Namensnennung als Kollegen betrachtet. Das verblüffende Selbstbewußtsein nicht nur des Dichters, sondern vor allem des Kritikers scheint sich indessen auf einen ganzen Kreis von (Straßburger) Kunstkennern und Literaturexperten zu stützen, wie es die Verse 4645 ff. bezeugen, die in der Wir-Form sehr nachdrücklich von dem Mitspracherecht bei der Vergabe des Lorbeerkranzes für den Dichterruhm sprechen: Es ist dies die neue kulturelle Gemeinschaft der „edlen Herzen“, die Wolfram für einen Poesieverwilderer hält und sich selbst und die im Prolog und Literaturexkurs aufgestellten inhaltlichen und formalen Kriterien zum Maßstab nimmt. Anschließend holt Gottfried die Schwertleite-Beschreibung dann doch noch in genau den zweihundert Versen nach, die auch die „Dichterschau“ beansprucht, doch setzt er zunächst seinen „Unsagbarkeitstopos“ fort, indem er alles nur halbwegs passende antike mythische Personal von Apoll über die Musen und Sirenen bis zu dem berühmten „wahren Helikon“ bemüht. Auch die Beschreibung der Schwertleite selbst erfährt eine weitgehend allegorische Ausgestaltung, Gottfried läßt sein Publikum spüren, daß er wie die Katze um den heißen Brei um einen ihm unsympathischen erzählerischen Gegenstand herumgeht, und als es schließlich zum gewöhnlichen Höhepunkt des glanzvollen Turnierens und „Buhurdierens“ kommt, hat er vollends genug, und er bricht mit den Worten ab: wie si mit scheften strechen, wie vil si der zebrrechen, daz sulen die garzune sagen ; die hulfen ez zesamene tragen. Wie sie mit Lanzen aufeinander einstachen und wie viele sie davon zerbrachen, davon mögen meinetwegen die Knappen berichten, die das einsammeln mußten. (V. 50555058) Für diejenigen, die immer noch nicht begriffen haben, daß es Gottfried trotz aller quellenbedingten Schilderungsnotwendigkeiten wie der Schwertleite gerade nicht um eine Verherrlichung des Rittertums und seiner Ruhm- und - Ehre-Ideologie geht, fügt er ebenso energisch wie ironisch an: „Ich habe keine Lust, ihre Turnierkämpfe zu schildern. Doch will ich ihnen wenigstens mit einem Wunsch zu Diensten sein: Möge sich ihr aller Ehre in jeder Beziehung vermehren und Gott ihnen ein ritterliches Leben in ihrem Ritterdasein schenken!“ (V.5059-5066) Mit dieser Formulierung an bedeutsamer Stelle des Abschlusses der Jugendgeschichte und unmittelbar vor der anschließenden dritten Gote(vrit)-Strophe, die auf persönliches Bekenntnis des Dichters verweist, zielt Gottfried zurück auf die fast gleichlautenden Verse des Prologs V. 50ff., wo er von jener anderen Welt spricht, die nicht die seine ist und die nur in Freuden schweben will und der er übereinstimmend mit der Schwertleite-Episode ironisch wünscht: „Die lasse Gott ruhig in Freuden leben.“ Die eine Stelle verdeutlicht sinnvoll die andere. Die ritterliche Gesellschaft ist nicht diejenige der „edlen Herzen“ und damit auch nicht das angesprochene intendierte Publikum. Wer etwas anderes sagt, rechnet Gottfried ausgerechnet jener Gesellschaft zu, von der er sich selbst gerade vehement und mit unüberhörbarer ironischer Verachtung abgrenzt. Beginn einer unsterblichen Liebe (V. 5067-12506) Die in der Überschrift formulierten Leitgedanken dieses dritten großen Handlungsabschnittes, der sich von der dritten Gote(vrit)-Strophe (V.5067ff.) bis zur vierten und letzten Viererstrophe (V. 12507ff.) mit dem Ausbruch der Leidenschaft durch die Wirkung des Liebestranks erstreckt, erfahren ihre programmatische Thematisierung in der dritten Gottfried- und der dritten Tristan-Strophe wie folgt: Treit ieman lebender staete leit bi staeteclîcher saelekeit, so truoc Tristan ie staete leit bi staetecllcher saelekeit. (V. 5067-5070) Trug je irgendeiner der Lebenden stetes Leid bei stetiger Glückseligkeit, so trug Tristan stets stetes Leid bei stetiger Glückseligkeit. I In der Tristan-Strophe heißt es dagegen: ir aller jehe lît dar an, haz der lige ie dem jungen man mit groezerem ernest an, dan einem stündigen man. (V. 5097-5100) Es ist allgemein bekannt, daß Haß einen jungen Mann stärker als einen gestandenen ergreift. Glück und Leid, Haß und Feindseligkeit werden nun Tristans Leben bis weit in den Beginn seiner problembelasteten Liebesbeziehung zu Isolde hinein prägen. Dies betrifft bereits seine erste „Rittertat“, mit der er auf recht „unritterliche“ Weise seinen von Herzog Morgan erschlagenenVater Riwalin rächt und damit zugleich sein Erbland Parmenien zurückgewinnt. Tristan zieht mit einer kleinen, friedfertig erscheinenden aber wohlgerüsteten Gefolgschaft in die Bretagne, wo er Herzog Morgan auf der Jagd antrifft. Tristan gibt vor, sein angestammtes Lehen aus der Hand des Mörders seines Vaters empfangen zu wollen, doch Herzog Morgan verweigert diese Bitte, indem er auf Tristans uneheliche Geburt anspielt. Nach heftigem Wortwechsel zieht Tristan plötzlich das Schwert und spaltet seinem Lehnsherrn den Kopf. Es kommt zu einem heißen Kampf zwischen Bretonen und Parmeniern, den erst das Erscheinen eines Ersatzheeres unter Befehl des getreuen Rual siegreich für Tristan entscheidet. Tristan könnte nun in Ruhe seine angestammte Landesherrschaft antreten: Doch genau dies tut er nicht. Im Zwiespalt zwischen seinem „Vater“ Rual und seinem Oheim Marke, zwischen Parmenien und Cornwall-England, zwischen sicherer Landesherrschaft und unsicherer Aussicht auf ein Königtum entscheidet er sich für letzteres, übergibt sein Land dem getreuen Marschall als Erblehen, schlägt seine Ziehbrüder und interessanterweise auch seinen Lehrmeister Kurvenal zu Rittern und begibt sich unter den Klagen seiner Zieheltern Rual und Floraete, seiner Brüder und seines Volkes zurück nach Cornwall an Markes Hof. Erst mit dem nun folgenden Morold-Kampf (V. 5871 ff.) lenkt die „Tristan“-Handlung in die alte „Estoire“ ein (dies entspricht in „Tristrant und Isalde“ Vers 351f.). Thomas war bemüht, sein Epos in den Rahmen der englischen Geschichte einzufügen, wie diese ihm entweder durch den von ihm genannten Gewährsmann oder durch den uns erhaltenen „Brut“ des Anglonormannen Wace bekannt war. So verlegt er die Handlung in die erste Zeit nach der angelsächsischen Eroberung Britanniens; die sächsischen Herren haben, ihrer inneren Fehden müde, Marke, den König von Cornwall, zum Oberherrn gewählt, und damit begann die Größe des englischen Reiches. Marke, der Eröffner der englischen Blütezeit, der erste Herrscher über die vereinigten Kleinkönige, darf demnach nicht selbst in Tributabhängigkeit von Irland geraten; die Tributpflicht muß vielmehr als ein altes Erbe aus seiner Jugendzeit erscheinen, das mittlerweile längst in Vergessenheit geraten ist und nun von Morold, dem Schwager und Beauftragten des Irenkönigs Gurmun, erneuert werden soll. Während bei Eilhart und Beroul Isoldes Vater namenlos bleibt, identifiziert Thomas Isoldes Vater mit dem geschichtlichen Irenkönig Gormo (bei Thomas auch entsprechend: Gormon) Anglicus, der 878 von König Alfred besiegt wurde und den er möglicherweise aus der Geschichtschronik des Wace kannte. Danach kam dieser Gormon aus Afrika, hatte sich vom römischen Senat mit der Eroberung Irlands beauftragen lassen und mit Hilfe der Iren auch Cornwall und England tributpflichtig gemacht. Thomas hat hier offenbar unterschiedliche Quellen kontaminiert. Die „Estoire“ gibt für die irische Tributforderung an Marke keinerlei Begründung. Der zurückkehrende Tristan findet das Land erfüllt von Gebet und Jammern. Die Iren hatten den Tribut Jahr um Jahr erhöht und forderten außer den Edelmetallen als Zugabe auch noch 30 Knaben für den Dienst am irischen Hof. Tristan hingegen erhebt in einer großen Rede vor dem Hof Widerspruch gegen die Schande solcher Tributforderung. Er setzt dabei mit diplomatischem Geschick wiederum seine List.doc und (juristische) Gelehrsamkeit ein: Durch einen siegreichen Zweikampf kann die Tributforderung für nichtig erklärt werden. Entsprechend dem altgermanischen „Holmgang“ (= Inselkampf, auch Morold ist ein germanischer Name) begeben sich beide Kämpfer nach drei Tagen jeder allein per Schiff auf eine Insel im Meer, wo zwischen beiden ein Kampf auf Leben und Tod entbrennt. Gottfried schreibt Morold Viermännerkraft zu, doch er läßt - diese „Allegorie“ (vgl. Allegorese.doc) ist Gottfrieds Erfindung - gegen ihn ebenfalls vier Streiter fechten: Gott, das Recht, ihr beider „Dienstman“, Tristan und schließlich Kühnheit, die in notvoller Lage Wunder zu wirken vermag (V.6886ff.). Trotz der allegorischen Überhöhung wird nicht wie in den Ritterromanen die Schönheit des Kampfes lustvoll glorifiziert, sondern es wird bewußt die abstoßende Grausamkeit des Kämpfens in ähnlich derber Naturalistik wie bei Herbort von Fritzlar dargestellt: Zunächst erhält Tristan eine so schwere Wunde durch Morolds vergiftetes Schwert, daß Fleisch und Knochen durch die zerfetzte Rüstung schimmern und das Blut in strömen fließt (V.6931ff.), dann erhält Tristans Pferd einen tödlichen Stich in den Bauch, woraufhin Tristan seinem Gegner die Schwerthand abhackt und dem Wehrlosen die Waffe mit solcher Gewalt auf den Kopf schlägt, daß ein Stück des Schwertes abbricht und in der „Hirnschale“ steckenbleibt. Erneut beweist Tristan seine vorausberechnende Klugheit: Da ihm Morold verraten hatte, daß die vergiftete Wunde nur durch seine heilkundige Schwester Isolde, die Königin von Irland, zu heilen sei, verbirgt er seine Wunde vor den feindlichen Iren mit dem Schild, um keinen Argwohn zu erwecken, wenn er die notwendig werdende Heilungsfahrt nach Irland antreten muß. Zunächst erweist sich Tristans gefeierter Erfolg als Pyrrhus-Sieg, denn er siecht unheilbar dahin, so daß er sich zu der gefährlichen Irland-Reise übers Meer entschließt, wo er nur mit einer Verkleidungslist auf Rettung hoffen darf, denn der irische König Gurmun hat nach der Rückführung von Morolds Leiche den Befehl erlassen, daß jedermann aus Cornwall, der irischen Boden betrete, sein Leben verwirkt habe. Während das Gerücht ausgegeben wird, Tristan begebe sich zu den berühmten Ärzten nach Salerno, fahrt er mit Kurvenal und acht Mannen nach Irland (vgl. die Werbungsfahrt der Nibelungen nach Island) bis in die Nähe derHauptstadt Develin (Dublin). Dort läßt er sich in der Nacht in ein kleines Beiboot aussetzen, ärmlich und abgerissen gekleidet und nur mit einer Harfe und ein wenig Proviant ausgerüstet, indessen das große Schiff die Rückreise antritt. Tatsächlich entdecken die Dubliner Bürger in der Frühe das einsam dahintreibende kleine Schiff, aus dem Gesang und Musik herübertönen. Von Tristans wunderbarem Harfenspiel angelockt, fahren sie ihm entgegen, und wieder ist es die Doppelung von Kunst und Kaufmannschaft, hinter der sich Tristan in seiner neuen Rolle verbirgt. Er gibt den irischen Bürgern gegenüber an, er sei einst ein „höfischer Spielmann“ gewesen und durch diese Tätigkeit so reich geworden, daß er sich mit einem reichen Kaufmann zusammengetan und Fernhandel begonnen hätte, daß ihr Schiff indessen von Seeräubern überfallen worden sei (was auch seine Wunde erklärt) und er als einziger überlebt habe (V.7563ff.). In Silbenumkehrung seines Namens nennt sich Tristan als „Spielmann“, jetzt „Tantris“. Die Dubliner Bürger sind von der musischen Kunstfertigkeit, der Sprachenkundigkeit, von Bildung und feinstem Benehmen des todwunden Spielmanns so beeindruckt, daß sich sein Ruf schnell von Haus zu Haus verbreitet und alle sein Leid beklagen, während sich auch hier die Ärzte vergebens um ihn bemühen. Doch dann gelangt die Kunde auch zu jenem Kleriker, der die junge Isolde in Kunst und Wissenschaften unterrichtet, und er bringt „Tantris“ an den Hof, wo die arzneikundige Königin ihn in zwanzig Tagen heilt. Wieder haben Tristans Intelligenz, Bildung und Meisterschaft in allen Künsten triumphiert; ihnen allein verdankt er seine Rettung. Sie sind es auch, die ihn zu seiner „unsterblichen Geliebten“ Isolde führen. Als Entgelt für die Heilung bittet die Mutter den vermeintlichen Spielmann Tantris, Isolde in den Wissenschaften und Künsten, vor allem jedoch in Sprachen und Musik zu unterrichten, um das zu perfektionieren, was der „Pfaffe“ bereits an Grundlagenkenntnissen vermittelt hatte. Dem liegt zweifellos auch symbolisch der Gedanke der Überlegenheit der neuen weltlich-höfischen Kultur ihrer Dichter, Sänger und Lehrmeister gegenüber der klerikalen zugrunde. Literarästhetisch entscheidend ist die Tatsache, daß sich die beiden Liebenden- im Gegensatz zu allen anderen episch-figürlichen Paarungen des Mittelalters - von Anfang an auf dem Gebiet des Geistigen, der Bildung und des Musischen treffen, mehr noch: Wie Tristan erst durch seine Bildung zu Tristan wird, So wird auch Isolde erst durch ihre allseitige Persönlichkeitsausbildung zu jener „sirenengleich“ anziehenden Schönheit geformt, die auf fast magische Weise alle Blicke an sich fesselt. So erklärt es sich, daß ihr wichtiger erster Auftritt absolut farblos verläuft (V.7966ff.). Dafür wird ausführlich mitgeteilt, was sie schon wußte und was sie nun bei Tristan dazulernt: Es ist ein langer Bildungskatalog vom Lesen, Schreiben, Dichten und Komponieren über das Vortragen, Singen und Musizieren aller möglichen Instrumente und Gattungen bis hin zur vieldiskutierten Lehre der „Moraliteit“ (V. 8008), einer Art Ethik- und Anstandslehre zugleich, die Unterweisungen bietet, wie man sich Gott und den Menschen gegenüber verhalten solle. Erst im Anschluß an die Lehre wird Isoldes „wunderlîchiu schoene“ (verzaubernde Schönheit, V. 8127) in der Aktion ihres künstlerisch-musikalischen Vortrages und Gesangs gezeichnet, als sie öffentlich vor ihrem stolzen Vater und dessen Gästen auftritt (V.8040 ff.). Nach einem halben Jahr drängt es Tristan heim, denn er fürchtet, entdeckt zu werden. Mit der neuerlichen Lüge, er sei verheiratet und habe Angst, daß seine Frau ihn für tot halte und einem anderen gegeben werde, gelingt ihm die glückliche Rückkehr nach Cornwall, wo er mit herzlicher Freude begrüßt und empfangen wird. An Markes Hof verkündet Tristan begeistert das Lob der jungen Isolde. Dies ist für Thomas und Gottfried der Ausgangspunkt, das Zustandekommen der Brautwerbungsfahrt Tristans für Marke plausibler zu motivieren und die Widersprüchlichkeit der alten Erzählung wenigstens zu mindern. Wie in der „Estoire“ und im „Tristrant“ sind Hofintrigen zur Verhinderung von Tristans Thronfolge in Cornwall das auslösende Moment. Doch ist der alte, auch im „Tristrant“ nur rudimentär erhalten gebliebene Märchenzug von der nistenden Schwalbe und dem Mädchen (Isolde) mit dem Goldhaar in polemischer Auseinandersetzung mit diesem irrationalen Motiv beseitigt (V. 8605 ff.). Bei Thomas und Gottfried schlagen die Barone, die Tristan nicht als Nachfolger Markes wollen, selbst Isolde als Braut und Tristan als Brautwerber vor, damit er bei diesem Unternehmen umkommen möge. Noch bei Thomas begibt sich Tristan auf die Fahrt, ohne zu wissen, wie er sein Vorhaben beenden soll. Gottfrieds Tristan aber hat schon während seines ersten Irlandaufenthaltes erfahren, daß der irische König demjenigen, der den Drachen tötet, der seit geraumer Zeit das Land verwüstet, die Hand seiner Tochter Isolde zugesagt hat. Damit ist der Stoff bei Gottfried aufs höchste zu rationalem Zusammenhang umgeprägt. Während sich in der „Estoire“ die alte imram-Reise einfach wiederholt, begründet Gottfried auch hier die höfische Neuerung durch Kritik der Altfassung: „Auch ist es höchst albern, wenn gesagt wird, daß Tristan aufs geradewohl mit einem Heer losgeschifft wäre, und nicht einmal gewußt haben solle, für wie lange und wohin die Reise führe oder wen er eigentlich dabei suche. Was haben demjenigen wohl die Bücher angetan, der so etwas aufschreiben und vorlesen ließ? Ja, sie hätten allesamt der König, der diesen Rat erteilte ebenso wie die Boten - Toren und Narren sein müssen, wenn sie so gehandelt hätten.“ (V.8620-8632) Wir haben das alte Märchenepos endgültig verlassen und befinden uns in einer anderen, moderneren poetischen Luft, auf einer Ebene dichterisch gestaltender Bewußtheit, die uns auch das bei Thomas und Gottfried verbliebene Motiv des Minnezaubertrankes mit anderen Augen sehen läßt. Die gedrängte Darstellung der „Estoire“, wie Tristan Irland von dem Drachen befreit und dadurch Isolde als Braut für Marke gewinnt - mit dem dramatischen Zwischenspiel nicht nur der Entlarvung des lügnerischen Truchsessen, sondern auch des vermeintlichen Spielmanns Tantris als Tristan und Besieger Morolds -, hat schon Thomas zu einer episch breiten Szenenfolge ausgedehnt, für die Gottfried fast 3000 Verse benötigt. Trotz eindrucksvoller Schilderung wird der Drachenkampf selbst wiederum ganz kurz abgetan. Höchst originell ist hingegen die Parodie auf das Rittertum im allgemeinen und das Minnerittertum im besonderen, die Gottfried an die traditionelle Figur des feigen und lügnerischen Truchsessen knüpft. Tristan sieht ihn schon mit drei anderen Rittern in panischer Angst vor dem Drachen flüchten, als er sich dem Untier nähert. Nachdem Tristan den Drachen erledigt und ihn als Wahrzeichen des Siegers die Zunge herausgeschnitten hat, woraufhin er, Kühlung suchend, in einem abseits gelegenen Quell ohnmächtig zusammenbricht, kommt der Truchseß, der den gewaltigen Todesschrei des Ungeheuers vernommen hat, wieder vorsichtig angeritten, erschrickt, als er den toten Drachen erblickt, so sehr, daß er vor Panik vom Pferd fallt und rennt davon, obgleich ihn niemand verfolgt; dann schleicht er wieder zurück, und als er nun bemerkt, daß der Drache tatsächlich tot ist, ruft er in Anspielung auf die ritterliche Artusepik glücklich aus: „Hier habe ich eine Aventiure gefunden“, (V.9161 vgl. âventiure.doc) und beginnt ein höchst komisches ritterliches Scheingefecht, sticht auf das tote Untier ein und schreit: „Ritter und Damen, meine blonde Isolde, meine Schöne!“ (V. 9169f.), um sich dann als heroischer Drachentöter feiern zu lassen. Dies wirkt wie eine Illustration des tatsächlichen ritterlichen Komödiantentums, wie es Johannes von Salesbury in seinem „Policraticus“ detailliert beschrieben hat. In beiden Fällen steht ein Gelehrter hinter dem scharfen Urteil über ein Rittertum, dessen Leistung vor allem im kämpferischen Aufputz und leerer Prahlsucht besteht. Drachenkampf, Tristan-HS HM, 13. Jht. Obgleich der Truchseß den Drachenkopf vorweisen kann, mißtraut ihm Isoldes Mutter und weissagt, um ihre Tochter zu trösten, die lieber sterben als diesen Mann heiraten will, daß ein Fremder den Drachen erschlagen habe. So reiten die beiden IsoIden in Begleitung eines Knappen und ihrer Vertrauten, der jungen Brangaene (die Gottfried im Gegensatz zu Thomas bereits hier einführt), zu dem Kampfplatz, wo sie Tristan entdecken und mit einer Zauberarznei ins Leben zurückrufen und heimlich bei sich in Pflege nehmen. Auf einem Hoftag macht der Truchseß seine Ansprüche auf die Hand Isoldes geltend, doch die Königin entlarvt ihn als Lügner, woraufhin er sich zu einem Gerichtskampf und Gottesurteil mit dem Fremden bereiterklärt. Kurz darauf erkennt die junge Isolde die verräterische Scharte in Tristans Schwert, vergleicht sie mit dem Splitter aus dem Kopf Morolds, erkennt jetzt auch die hinter den Namen Tristan und Tantris sich versteckende Identität und stürzt voll Enttäuschung, Zorn und Haß auf Tristan zu, um ihn im Bad mit seinem eigenen Schwert zu erschlagen. Doch die besonnenere Mutter kann im letzten Augenblick dazwischentreten. Auf Brangaenes Rat kommt es zur Versöhnung, und Tristan berichtet von seinem Brautwerbungsauftrag, dem König Gurmun seine Zustimmung erteilt, womit sich die Aussicht auf Frieden zwischen EnglandCornwall und Irland verbindet. Dadurch, daß Gottfried in kluger Dramaturgie Tristans Auftritt für den zweiten Hofund Gerichtstag, der bei Thomas ganz kurz abgetan wird, aufsparte, hat er die durch die gesamte Szenenfolge hindurchgehende Spannung zu einem Höhepunkt gesteigert. Ohne daß Gottfried die Zusammengehörigkeit von Tristan und Isolde explizit auch nur mit einem einzigen Wort erwähnt, verdeutlicht er dies durch die glanzvolle Descriptio der beiden, die Höhepunkte der feudalklassischen Beschreibungskunst darstellen, wobei er für Isolde über 200 Verse (V. 10889 bis 11024) und für Tristan insgesamt knapp die Hälfte aufwendet (V. 1043 ff., V. 11084ff.). Tristan erscheint, obgleich ihm eigentlich ein gerichtlicher Zweikampf mit dem Truchseß bevorsteht, charakteristischerweise in „Zivil“ aus reichem, golddurchwirktem Seidenstoff; ihm genügt die überzeugende juristische Argumentation und der Indizienbeweis der durch ihn vorgewiesenen Drachenzunge, um das Gericht für sich entscheiden zu lassen und den Truchseß zu entlarven. Nachdem auch die Landesherren in die Verheiratung Markes mit Isolde und die Versöhnung zwischen den Ländern eingewilligt haben, wird zur Rückreise gerüstet. Die Königin übergibt Brangaene, die Isolde begleiten soll, ein Glasgefäß mit einem Liebestrank, den sie König Marke und Isolde heimlich anstelle vorgesehenen Weins reichen soll. Damit eilt die Handlung schnell auf ihre Peripetie zu: den scheinbar jähen Umschwung von Haß in Liebe, der sich durch die innere psychologische Gestaltungskunst Gottfrieds gegenüber der alten „Estoire“ allerdings nur als das dialektische Umschlagen von sorgfältig vormotivierten Quantitäten in eine neue Qualität erweist. Ähnlich wie Brünhild im Nibelungenlied, die von rechtswegen ihrem eigentlichen Überwinder und Brautwerber Siegfried gehört, nicht aber dem König, für den sie geworben worden ist, fühlt auch Isolde sich „betrogen“ und „verkauft“ (V. 11 592 ff.), als sie nach schmerzlichem Abschied von ihren Eltern, ihren Freunden und ihrem Land auf dem Schiff ihr Schicksal beweint und beklagt. Als Tristan sie tröstend in die Arme nehmen will, stößt sie ihn zurück und gesteht, daß sie für ihn nichts anderes übrig habe als Haß (V. 11579 u.ö.); und wenn sie auch als Grund ihren von Tristan getöteten Oheim vorgibt, so ist doch in Wahrheit dieser Haß nichts anderes als Enttäuschung und die Kehrseite der Liebe. Schon dadurch, daß sie Tristan stets als „Meister“ anredet („ja meister Tristan“, V. 11 603), wird die Verbindung zu ihrem Lehrer und damit auch zu der grundlegenden Gemeinschaft der „edlen Herzen“, im Geistig-Seelischen und Musischen geknüpft. Als sie einen Hafen anlaufen und die meisten zum Spaziergang an Land gehen, sucht Tristan Isolde in ihrer Kajüte auf, und als er um etwas zu trinken bittet, kommt es zu der dramatischen Verwechslung: Ein zurückgebliebenes Kammermädchen schenkt beiden statt Wein versehentlich den Liebestrank ein, von dem es heißt: ez was diu wernde swaere, diu endelose herzenot, von der si beide lagen tot. (V.11678-11680) Es war der immerwährende schwere Schmerz, die endlose Herzensnot, an der sie beide starben. Aus dieser Stelle heraus hat Wagner später das Motiv des Todestrankes entwickelt. Hier jedoch ist der Todesgedanke nur eine weite Vorwegnahme des vermutlich erst nach mehr als 20000 Versen konzipierten Endes, so daß der Liebestod hier nur (wesentlicher) erzählerischer Horizont bleibt, zunächst und vor allem aber Liebesleben in Liebeslust und Liebesleid bedeutet. Beide trinken davon, als plötzlich Brangaene hereintritt, die Verwechslung erkennt, erschrickt und die Minnetrankflasche in böser Vorahnung laut klagend und jammernd in das tobende Meer schleudert. Ist auch das alte Motiv des zauberischen Minnetranks bis hin zu Thomas und Gottfried erhalten geblieben, so ist doch dieser Vorgang auf der hochfeudalklassischen Stufe transparent geworden, entstofflicht zu einem Symbol für das Erwachen und den Durchbruch der zwanghaften Leidenschaft, kraft derer ein Mann und eine Frau einander bedingungslos gehören. Daß trotz der hier voll entfalteten psychologischen Durchleuchtung des Minneerlebens das überkommene Motiv nicht eliminiert, ja nicht einmal ausdrücklich seines magischen Charakters automatischer Wirksamkeit entkleidet wurde, widerspricht dem nicht; diese Anschauungsweise fließt aus der auch im höfisch verfeinert und rational denkenden Menschen lebendig gebliebenen Kraft symbolischen Denkens. Das Minnetrankmotiv war so unlöslich der Tristan-Tradition eingeschmolzen, daß auch Thomas und Gottfried es nicht glaubten auslassen oder auch nur seines Gewichtes berauben zu dürfen. Es blieb einzig der Ausweg, es symbolisch zu überhöhen, indem der Genuß des Trankes und das Erwachen der Liebesleidenschaft nicht zwar ursächlich, wohl aber sinnbildlich gleichgesetzt wurden. Auch daß Gottfried die „wundersame Kraft“ der Leidenschaft Tristans und Isoldes, ihre Echtheit in so betonter Weise durch die „triuwe“ - einer Treue bis zum Tode - besiegeln läßt, also episiert, bedeutet zugleich, daß er die willenlose Mechanik der Trankwirkung, auf die sich „Tristrant und Isalde“ noch entschuldigend beziehen, in Abrede stellt. Im Gegensatz zur Allegorie, die der erläuternden Überschrift bedarf, liegt es im Wesen des echten Symbols, daß es aus sich selber wirkt und in sich selber angeschaut wird. Der Dichter glaubt nicht, es kommentieren zu müssen. Hier ist Liebe keine bloße Einwirkung von außen her, keine toxologische Zauberwirkung mehr; sie entzündet sich ganz selbstverständlich aus der durch Bildung sensibilisierten Wesenheit der Menschen selber. Wenn die feudalklassische Poesie den Liebestrank auch symbolistisch beibehält, kausal benötigt sie ihn nicht mehr. Von Anfang an läßt Gottfried in unaufdringlicher Weise Tristan und Isolde als ein auf Tod und Leben innerlich füreinander vorbestimmtes Paar erscheinen, und die ihnen innewohnende, alle Herzen bezwingende Liebenswürdigkeit wird von ihm so stark betont, daß es unverständlich erschiene, wenn ausgerechnet diese beiden so sehr füreinander Bestimmten selbst unempfindlich füreinander bleiben sollten. Wie Isolde in Tristan, so lebt auch Tristan bereits lange vor der Trankszene in seiner Schülerin Isolde. Wenngleich dies in der Forschung immer wieder diskutiert worden ist, so ist es doch gar keine Frage der Interpretation, denn Gottfried läßt es seine Figuren selbst so empfinden und ausdrücken, wenn er später, auf der Höhe ihrer Leidenschaftsgewalt, sich Isolde der einzelnen Voretappen ihrer Gemeinsamkeit mit Tristan erinnern läßt: Sie vergegenwärtigt sich, wie er „ze Develine in einem schiffelîne geflozzen wunt und eine kam“ (V. 11945 ff.) (wie er in einem kleinen Boot verwundet und allein nach Dublin kam); ihre Mutter ihn aufnahm und wie sie, Isolde, „selbst in seiner Pflege“ Schreiben, Latein, Musik und alles andere lernte. Das Erwachen der Liebesleidenschaft zwischen Tristan und Isolde ist mit unvergleichlicher psychologischer und formaler künstlerischer Meisterschaft geschildert. Der inhaltlich-formale Aufbau der Szenenfolge wird kunstvoll durch die sinn- und kryptogrammtragenden Viererstrophen strukturiert, die auch hier wieder Handlungshöhepunkt und Handlungseinschnitt (nach der letzten Viererstrophe V. 12 507ff.) anzeigen. Der erste Abschnitt umfaßt den Minnetrank und seine Liebeswirkung bis dahin (V. 11 649-11878), die erste Viererstrophe, die mit ihrer S-Initiale doch wohl eine TristanStrophe ist, im Wortspiel mit dem polysemen mittelhochdeutschen „ê“ (das sowohl Gesetz als auch „früher“ bedeutet) das „Gesetz“ der Liebe thematisiert. Der folgende Abschnitt reicht bis zur Viererstrophe mit der Gottfried-Initiale 12 187ff., und halbiert sich in zweimal 154 Verse inhaltlich in das Geständnis der Minne (V. 11 879 bis 12032) und die Liebeserfüllung (V. 12033-12186). An die Gottfried-Strophe, die ausdrücklich eine folgende Minnerede ankündigt, schließt sich in bedeutsamem Zusammenhang mit der auf Gottfried selbst zurückweisenden Initialstrophe ein Traktat über die Minneauffassung seiner Zeit an, die von der Forschung so benannte „Minnebußpredigt“ (V. 12187-12361), in der in signifikanter Beziehung zum Prolog und der dort entwickelten Dialektik von Ideal und Wirklichkeit die Liebe in der Gegenwart als mißbraucht und käuflich kritisiert wird [27] Der Abschnitt endet mit der Viererstrophe V. 12435 ff., die Isoldes charakterliche Wandlung vom „tumben“ Kind zur reifen Frau kennzeichnet, welche zur Erhaltung ihrer Liebe künftig auch der List ja der Verschlagenheit fähig sein muß und wird: Es ist dies eine Entwicklung, wie sie ähnlich die Kriemhild des Nibelungenliedes durchmacht. Diese Klugheit beweist sie auch sofort, indem sie vorschlägt, ihre Vertraute Brangaene solle in der Hochzeitsnacht das Lager mit König Marke teilen. Obgleich Brangaene vor Scham abwechselnd rot und blaß wird, verspricht sie aus Verantwortungsgefühl ihrer Herrin gegenüber, dieser „seltsamen Bitte“ Folge zu leisten. Dann enthüllt sie den beiden Liebenden das Geheimnis des Minnetranks und verkündet wiederum, er würde ihr beider Tod bedeuten. Damit schließt der Todesgedanke die gesamte Minnetrank-Szenenfolge ein, von Brangaenes ersten Worten, nachdem sie die Verwechslung entdeckt und das Minnetrankgefäß ins Meer geschleudert hatte bis zur Wiederholung des Gedankens am Ende dieses zentralen Handlungsabschnitts. Doch Tristan antwortet darauf mit seinem berühmten Bekenntnis sowohl zur Liebe als auch zum Tod: „nu walte es got!“, sprach Tristan, ez waere tot oder leben: ez hat mir sanfte vergeben. ine weiz, wie jener werden sol: dirre tot der tuot mir wol. solte diu wunnecliche isot iemer alsus sin min tot, so wolte ich gerne werben umbe ein eweclichez sterben.“ (V. 12498-12506) „Das möge Gott entscheiden!“ sagte Tristan, „ob es nun Tod bedeutet oder Leben: Das Gift hat mir wohl getan. Ich weiß nicht, wie jener Tod sein wird: Dieser hier jedenfalls hat mir gut getan. Und wenn die liebliche Isolde stets auf diese Weise mein Tod sein sollte, so wollte ich gerne alles tun, um ewig so zu sterben.“ Die Kühnheit dieses begrifflichen Spiels um Tod und Leben und vor allem um das „ewige Sterben“ das als irdische Zielvorstellung hier in absoluten Kontrast zur christlichen Jenseitsvorstellung des „ewigen Lebens“ gesetzt wird, demonstriert eine einzigartige Freiheit des Denkens, wie sie zu jener Zeit wohl nur auf gelehrt-urbanem Boden erwachsen konnte [28] Mit der letzten Viererstrophe der Dichtung überhaupt (V. 12 507ff.), die dieses Bekenntnis mit den Worten verallgemeinert: „Laßt alles Herumgerede bleiben: Wenn wir das Glück der Liebe wollen, so werden wir unausweichlich auch das Leid erfahren müssen“, endet dieser Handlungsabschnitt. Treue der Liebe als das Glück ewigen Sterbens (v: 12507-19552) Das in der letzten Viererstrophe thematisierte Leid der Liebe beginnt mit der Ankunft an Markes Hof und mit der Auslieferung der Geliebten in der Hochzeitsnacht. Diese Hochzeitsnacht mit ihrem listig-unglückseligen Partnertausch und Partnerbetrug ist epischer Dreh- und Angelpunkt alles folgenden Geschehens genau wie im Nibelungenlied. Da auch Tristan und Brangaene (als Vertraute) ebenfalls im königlichen Gemach schlafen, gelingt die List, dem König zunächst die noch jungfräuliche Brangaene unterzuschieben. Dann gelingt auch der nächtliche Tausch: Als der König nachts Wein verlangt, um so mittelalterlichem Brauch gemäß die erfolgreiche Inbesitznahme der jungfräulichen Braut anzuzeigen und zu feiern, findet er bereits Isolde in seinem Bett vor, die sich nach dem Trank „voll heimlichem Schmerz in ihrem Herzen“ nun zu dem König, ihrem Herrn. legen muß: der greif an sine fröude wider: er twanc si nahe an sinen lip. in duhte wip alse wip. (V.12668-12670) Der gab sich wieder seiner Lust hin: Er zwang sie eng an seinen Körper, für ihn war eine Frau wie die andere. Genau dies charakterisiert Marke. Er hat von Brangaene „Messing“ statt von Isolde „Gold“ erhalten, und wenngleich Gottfried beteuert, daß nie jemandem vorher so schönes Messing statt Gold als „Bettgeld“ gegeben worden sei, so vermag Marke eben doch nicht zu unterscheiden, die Einzigartigkeit eines Wertes zu erkennen. Die Goldmetapher spielt auf die Verfälschung und Käuflichkeit der urwüchsig „freien Liebe“ an, wie sie Gottfried in seinem vorangehenden Minnetraktat als charakteristisch für seine eigene Gegenwart dargestellt hatte. Diese Käuflichkeit meint vor allem die Feudalehe, die nicht nach Kriterien des Gefühls und der gegenseitigen Zuneigung, sondern unter ökonomischen und politischen Aspekten geschlossen wurde. Auch König Marke hat Isolde lediglich feudal- und eherechtlich „gekauft“, ein inneres Recht auf sie besitzt er nicht. Dieses Recht der frei entscheidenden Herzenskönigin Minne besitzt Tristan, der Isolde nicht nur zu diesem „Gold“ geformt hat, das Marke gar nicht erst zu erkennen vermag, sondern der auch sein Leben für ihre Erwerbung eingesetzt hat und - dies ist das Entscheidende - dem, aus welchen Gründen auch immer, unwandelbar ihr Herz gehört. Allein dieses Recht aber ist es, was zählt. Wie wenig König Marke seiner schönen jungen Frau würdig ist, demonstriert auch die folgende -, gegenüber der „Estoire“ neu eingeführte Episode „Rotte und Harfe“ (V. 13 101-13454). Nach dem vergeblichen und sich als töricht erweisenden Mordanschlag Isoldes auf Brangaene, wobei sich Isolde endgültig von der bedingungslosen Treue ihrer Vertrauten überzeugt, erscheint der irische Baron, Ritter und Minnesänger Gandin an Markes Hof, wo ihm der König jeden Lohn verspricht, den er begehren würde, wenn er sein Spiel auf der mitgeführten kostbaren Rotte hören ließe. Gandin besteht auf dem leichtsinnigen Blankoscheck des Versprechens: Er will die Königin Isolde haben, und da niemand sich ihm zum Zweikampf zu stellen wagt, muß Marke sie ihm freiwillig lassen. Es ist dies das berühmte Lancelot-Motiv, das sonst an König Artus und Ginover geknüpft ist und wie es auch im „Iwein“ anklingt). Während die Artusepik nur den Kampf als Mittel zur Wiedergewinnung der entführten Königin kennt, sind es hier wiederum Tristans Intelligenz, Bildung und List, die Isolde zurückgewinnen. Als Gandin in einem Zelt am Strand den Eintritt der Flut abwarten muß, weil sein Schiff auf dem Sand festsitzt, kehrt Tristan von einer Jagd zurück, eilt, erneut als Spielmann verkleidet, mit seiner Harfe zum Strand und bittet Gandin, ihn nach Irland mitzunehmen, was dieser ihm bewilligt, wenn er die weinende Frau mit seinem Harfenklang tröste. Während seines Spiels steigt die Flut so hoch, daß man ohne Pferd nicht mehr zum Schiff gelangen kann. Tristan holt sein Roß herbei, und als Gandin Isolde selbst zu Tristan in den Sattel gehoben hat, sprengt er mit der Geliebten davon. Nach einer Liebesvereinigung „in den bluomen“, treffen sie wieder am Hof ein, wo Tristan dem König doppeldeutig vorhält, er solle künftig seine Frau nicht wieder so leichtfertig „durch harfen oder durch rotten“ (V. 13449) aufs Spiel setzen. Der folgende große Abschnitt (V. 13455-16406) schildert das ebenso gefahrvolle wie listenreiche Liebesleben von Tristan und Isolde unter dem neidischen Argwohn und sich immer mehr zur Gewißheit steigernden Verdacht des öffentlich brüskierten Hofes und seines Königs bis hin zur Verbannung des Paares. Fünf Figuren sind es vor allem, die diesen Abschnitt gleichsam symmetrisch tragen: Auf der einen Seite das Liebespaar Tristan und Isolde, auf der anderen Seite ihre Neider und Verleumder der Truchseß Marjodo und der Hofzwerg Melot von Aquitanien (Melot petit von Aquitan) (Neid.doc); in der Mitte zwischen beiden Parteien steht als eigentlich tragisch-unglückselige Figur Marke der Zweifler („Marke der zwîvelaere“, V. 14014), der von einem Ereignis zum anderen zwischen Liebe und Haß, Vertrauen und Argwohn, Hoffnung und Verzweiflung ziellos hin und her getrieben und zerrieben wird. Dadurch gewinnt er trotz seiner offensichtlichen Schwäche und gleichermaßen naturgegebenen Inferiorität gegenüber der für ihn unerreichbaren Herzensbindung zwischen Tristan und Isolde doch erheblich an innerer Größe und charakterlichem Profil gegenüber der noch primitiven HahnreiRolle der alten „Estoire“ oder auch der wütenden Brutalität, die er noch im „Tristan“ verkörpert, als er die Liebenden zu schändlichem Tod und Isolde zur Auslieferung an die Aussätzigen verurteilen läßt. Noch Thomas von Bretagne hatte König Marke den Rest des Minnetranks in der Hochzeitsnacht kosten lassen und so sein Verhalten zu erklären versucht. Gottfried lehnt dies ausdrücklich ab und psychologisiert damit die Figur vollends, die er samt ihrem Verhalten zugleich zu dem Typus des Ehemanns gestaltet, dessen Ansprüche sich nur auf eheliche Besitzrechte gründen. Daß die Wahrheit, die den Bruch Markes mit Isolde bedeuten würde, solange in den folgenden Szenen verborgen bleibt, ist nicht nur durch die Geschicklichkeit der „Ehebrecher“ bedingt, sondern wird vor allem durch Marke selbst verursacht, der immer wieder vor der vollen Wahrheit zurückschreckt, weil er Isolde nicht verlieren will und aus Sinnlichkeit an seinen Gattenrechten festhält. Während die Untreue, die Isolde gegen ihren Gatten begeht, nirgendwo als Verstoß gegen eine sittliche Ordnung oder als Problem empfunden wird, demonstriert Gottfried an Marke die Zerstörung und immer tiefer greifende Zerrüttung eines Menschen durch die „überleste“ (Überlast) solcher „zwivelnôt“ (Zweifelnot), um an dem Verhalten dieses bewußt als Typus gestalteten Ehemanns die Absurdität von Bindungen zwischen Mann und Frau zu veranschaulichen, denen das wahrhaft Verbindende abgeht. Als amoralisch erscheinen nicht Ehebruch und Untreue, sondern die Zwänge der Ehe. König Marke wird so zu einer in seiner Schwäche groß angelegten Gegenfigur, die zwischen der persönlichen Liebe und Zuneigung zu Neffen und Gemahlin und den ungeliebten, aber die „Ehre“, Staatsräson und öffentliche Moral vertretenden Repräsentanten des Hofes zerrieben und zerrissen wird. Es scheint, als sei dieser Großabschnitt wiederum durch das Spiel der Tristan-Isoldelnitialen geordnet, wenngleich sie hier nicht mehr durch die auffälligen Viererstrophen gekennzeichnet sind: Sie erhalten jedoch nicht nur durch das gefährliche Liebesspiel des Paares einen tieferen Sinn, die Handlung konzentriert sich auch jeweils schwerpunktmäßig auf die durch die entsprechende Initiale bezeichnete Figur. Der erste T-Abschnitt (V. 13455-13675) behandelt Tristans von Marjodo beargwöhnte und beim König verleumdete Aktivität, der folgende I-Abschnitt (V. 13676-15050) sieht Isolde im Mittelpunkt listenreicher Abwehr und abenteuerlicher Realisierungsversuche ihrer Liebe, auch im folgenden I-Abschnitt des Gottesurteils der „glühenden Eisen“ steht naturgemäß Isolde im Zentrum der Darstellung (V. 15001-15768), während der folgende T-Abschnitt (V. 15769-16406) mit der Episode von dem kleinen Wunderhund Petitcriu ganz Tristan gehört. Der erste Tristan-Abschnitt nährt auch den ersten Verdacht. Anstelle der Tristan beschuldigenden Baronsfronde lassen Thomas und Gottfried den Truchseß Markes, Marjodo, auftreten, der Tristans Schlafgenosse ist. Eines Nachts, als der „minnaere Tristan“ sich „an sîne strichweide“ (V. 13491) (auf seinen Jagdgang) zur Königin begeben hatte, erwacht Marjodo aus einem zugleich schreckerregenden und symbolischen Alptraum: Ein wildschäumender Eber dringt aus dem Wald bis in des Königs Schlafgemach vor, beschmutzt dessen Bett, der gesamte Hof ist Augenzeuge dieses Vorfalls, und doch greift niemand dagegen ein (V. 13515 ff. ). Als der Truchseß erwachend seinen Traum dem Freund erzählen will, findet er das Bett neben sich leer, folgt Tristans Spuren im frischen Schnee und entdeckt ihn schließlich im Bett der Königin, in die auch der Truchseß selbst verliebt ist. Diese Liebe ebenso wie seine Freundschaftsgefühle zu Tristan sind mit einem Schlag in Haß verwandelt. Wieder hat der Truchseß damit wie in der feudalklassischen Literatur insgesamt die negativste Rolle übernommen. Zwar wagt er nicht, dem König das Gesehene offen zu berichten, aber er teilt ihm mit, am Hofe liefen Gerüchte über Tristan und Isolde um, die seine Ehe beträfen und seine Ehre berührten. Der „einvalte Marke“ (V. 13657) (der einfaltig leichtgläubige Marke) vermag zwar an Isoldes Schuld nicht zu glauben, doch der Keim des Argwohns in seinem Herzen ist gesät. Entsprechend behandelt der folgende Isolde-Abschnitt die Verdächtigungen und immer neuen Treueprüfungen, gegen die sich Isolde zur Wehr setzen muß. Zunächst gibt Marke vor, eine Wallfahrt unternehmen zu wollen und fragt sie scheinheilig, wen er als ihren Betreuer für die Zeit seiner Abwesenheit bestellen solle. Isolde rühmt natürlich Tristan als den Geeignetsten. Diese Antwort ruft alle Zweifel in Marke wach, und Marjodo schürt noch seinen Argwohn. Als Isolde voller Erwartungsfreude Brangaene von dem Wallfahrtsplan des Königs berichtet, wittert diese sogleich die dahinter verborgene List und rät ihr – „list wider list“ - zu einer geschickteren Antwort, und als der innerlich zerrissene König eines Nachts, seine Gattin liebkosend, bedauert, die Pilgerfahrt unternehmen zu müssen, beginnt sie zu weinen und beteuert, sie hätte diesen Plan für einen Scherz gehalten und wehklagt, daß er sie so lange allein lassen wolle. Marke weiß nicht, daß Frauen „auch ohne Beweggründe weinen können sooft sie es gutdünkt“ (V. 13904ff.), und so erklärt er dem Truchseß glücklich, daß er sich von der Treue seiner Frau überzeugt habe. Doch der gibt sich nicht geschlagen, sondern beauftragt den listigen Hofzwerg Melot von Aquitanien, das Liebespaar zu überwachen, der auch bald dem König seine Beobachtungen hinterbringt: Durch ihr Reden und ihr „so süßes Gebaren untereinander“ würden sich die Liebenden verraten. Tristan erhält daraufhin den am Hof Aufsehen erregenden Befehl, sich von der Frauenkemenate fernzuhalten und überhaupt den Umgang mit jeder Frau des Hofes zu meiden. Marke sieht nun, wie heide in verzehrender Sehnsucht nacheinander vergehen und stellt den Liebenden eine neue Falle, indem er mitteilt, er gehe für 20 Tage auf die Jagd. Melot erhält den Befehl, Tristan und Isolde scharf zu überwachen; denn Tristan läßt sich als bettlägerig krank von der Teilnahme am Jagdzug dispensieren. Um überhaupt zueinander kommen zu können, verabreden sie auf Brangaenes Rat hin die List der Späne mit den eingeschnitzten T- und I-Initialen, die Tristan dem an der Frauenkemenate vorbeifließenden Bächlein anvertraut (in der Altfassung durchfloß es in primitiver Weise noch die Kemenate selbst), um damit Isolde für ein heimliches Stelldichein im Baumgarten am Quell unter dem Ölbaum zu benachrichtigen. In acht Nächten glückt den Liebenden alles nach Wunsch, dann erspäht der Zwerg, was da am Brunnenquell im Park geschieht. Die Mitteilungen des Spions an den König führen zu der Szene vom „Belauschten Stelldichein“ (V. 14587-15050), da Marke sich selbst überzeugen will - dank der Wachsamkeit und List der Belauschten indessen sich erneut übertölpeln läßt. Marke belauscht Tristan und Isolde, 15. Jht. Gegenüber der „Estoire“ ist diese Szene zwar ausgesponnen, aber nur in Nuancen geändert. In der beklemmenden Situation, als Tristan an den Schatten der in den Ästen des Ölbaums versteckten Lauscher die Gefahr erkennt, daß die Erwartungsfreude der ahnungslos nahenden lsolde alles an den Tag zu bringen droht, was es jetzt durch kaltblütig-schlaue Verstellung zu verstecken gilt, betet er zu Gott um dessen Schutz und Schirm für seine allen christlich-sittlichen und gesellschaftlichen Normen hohnsprechende ehebrecherische Unternehmung und Verschlagenheit. Auch lsolde zeigt sich dank ihrer geistigen Beweglichkeit als Herrin der Situation. Wie Tristan sendet auch sie einen flehenden Seufzer zu Gott empor und beruft sich in ihrer Täuschungsrede gegenüber den Lauschern auf ihn als „urkünde“ (Zeuge) dafür, daß sie noch nie zu einem anderen Mann Liebe gespürt habe als zu dem einen. Solche Scheinwahrheiten und Lügen im Namen Gottes häufen sich hier in auffälliger Weise und führen in ansteigender Linie bis zu dem Höhepunkt des Gottesurteils, wo der „wintschaffene Krist“ dann ebenfalls wie auch hier für die Liebenden entscheidet. Alle Interpretationen und theologisierenden Parallelvergleiche vermögen nicht darüber hinwegzutäuschen, das die religiöse Vorstellungswelt Gottfrieds bereits von frühbürgerlich-renaissancehafter Liberalität geprägt ist und sich in Gegensatz zur Überbaufunktion des herrschenden christlichen Dogmas stellt, die ja gerade darin besteht, die herrschende Feudalordnung einschließlich ihrer gesellschaftlichen Institutionen und klassenbedingten ethischen Normen zu sanktionieren. Selbst die weltliche Artusethik weicht letztlich nirgends von dieser ideologischen Dienstleistung im Sinne der Legitimierung gesellschaftlicher Strukturen und Verhaltensweisen zur Aufrechterhaltung einer „göttlich gewollten Ordnung“ ab und bringt individuelles Wollen und gesellschaftliche Forderung, Ruhmestat zur Ehre Gottes und der Gesellschaft, Liebe, Ehre und Ehe in harmonischen Einklang. Im „Tristan“ jedoch stehen alle diese positiven höfischen und christlichen gesellschaftlichen Werte der gesellschaftlich-sozialen Integration wie Vasallentreue, Kampfesruhm, Hofesfreude, Herrschaftsausübung, öffentliche Moral und Reputation, „Maße“ und Ehre, Landesherrschaft und gottgefälliges Leben als Ziel allen ritterlich-feudalherrlichen Lebens auf der Negativseite der Werteskala. Es sind paradoxerweise nicht die christlichen Gesetze und ethischen Pflichten, die dieser ungewöhnliche Tristan-Gott beschützt, sondern Gott schützt die Liebenden. Gott steht damit nicht mehr auf seiten der Gesellschaft und der in seinem Namen verkündeten Rechtsordnung, sondern er steht auf seiten des Individuums und des in ihm verkörperten säkularisierten Naturrechts, das so als eine übergeordnete Rechtsnorm ausgewiesen wird. Damit erreicht der Indiyidualismus auch ideologiegeschichtlich seinen mittelalterlichen Kulminationspunkt auf literarischem Gebiet. Wie schon im Ansatz bei Veldeke sichtbar und zweifellos auch von der antikisierenden Dichtung beeinflußt, entsteht bei Gottfried so etwas wie eine „aufgeklärte“ heidnisch-christliche Funktionsgemeinschaft zwischen christlichem Gott (einschließlich Christus und Maria) und der heidnischen Minnegöttin, deren Kulttempel die Liebenden später in Gestalt der Minnegrotte betreten werden. Auch nachdem der „Gott der Liebenden“ Tristan und lsolde wiederum vor der Entdeckung errettet hat und Marke beiden erneut vertraut, so daß beide ihr glückerfülltes „wunschleben“ fortsetzen können, bleiben die Neider und Verleumder nicht tatenlos. Mit der Isolde-Initiale und einer Betrachtung darüber, daß Nesselkraut nicht bitterer brenne als Feindseligkeit unter Nachbarn und Hausgenossen, leitet Gottfried zu dem Isolde-Abschnitt der „glühenden Eisen“ über (V. 15051-15768). Während Tristan wieder gemeinsam mit Brangaene, Melot und einem „juncfrouwelîn“ im königlichen Gemach schlafen darf, versuchen der „Hund Marjodo“ und die „Schlange Melot“ (V. 15 104f.) dem Liebespaar neue Fallen zu stellen. Auf ihren Rat hin lädt Marke eines Tages lsolde und Tristan ein, sich mit ihm zur Ader zu lassen. Als sich der König frühmorgens zum Kirchgang begibt, bestreut Melot, der ihn begleitet, denEstrich zwischen den Betten heimlich mit Mehl. Brangaene erspäht diese List und warnt Tristan. Da „wahre Liebe keine Furcht kennt“ (V. 15 171 ff.), gelingt es ihm, mit einem einzigen gewaltigen Satz in Isoldes Bett zu springen, wobei ihm indessen die Ader aufplatzt und Isoldes Bett und nach seinem Rücksprung auch das eigene mit Blut befleckt. Der zurückgekehrte Marke findet keine Fußstapfen im Mehl, wohl aber die Blutspuren in beiden Betten: Der Beweis ist nicht eindeutig, doch Markes Zweifel sind nun hellwach, und so lädt er den Fürstenrat zu einem Konzil nach London ein, wo über Schuld und Schicksal Isoldes beraten werden soll. Obgleich der greise Bischof von Tamise (Themse) der eigentliche Wortführer der Verhandlung ist, fällt doch auf, daß im Gegensatz zu Thomas nicht er, sondern Marke selbst zum „Gottesurteil“ der glühenden Eisen rät, das auch sechs Wochen später in der Stadt Karliun festgesetzt wird. Wiederum helfen Tristan und Isolde ihre eigene, wohlbedachte List und das Vertrauen auf „gotes hövescheit“ (V. 15557), wobei hier nicht nur der Gottesbegriff, sondern auch der Begriff des Höfischen besonders deutlich seine eigenständige Semantik enthüllt, indem er nicht mehr die normenbestimmende und harmoniestiftende ritterliche Ethik als sozialintegrierendes Ordnungsprinzip und vorbildhaft-gottgefälliges Verhalten repräsentiert. Höfisch ist für Gottfried nur „die andere Welt“, „die andere Gesellschaft“ der „edlen Herzen“, die in der Spannung zwischen vitalem Naturrecht und höchstmöglicher Persönlichkeitsentfaltung durch Bildung, Kunst und seelische Sensibilisierung leben, die alle Höhen und Tiefen menschlichen Lebens, Glück und Leid kraftvoll ausloten und bejahen und die ihr Selbstwertgefühl gerade nicht wie die Artusritter auf Kampfesruhm und daraus erwachsender höfischer Reputation beziehen. Das Lexem des „Höfischen“ ist also aufs äußerste ambivalent, verbunden sind seine unterschiedlichen Bedeutungsvarianten nur durch das positiv wertende Bedeutungselement der „Vollkommenheit“ und des „Richtig-Vorbildhaften“, doch was als „vollkommen“, „richtig“ und „vorbildhaft“ empfunden wird, scheidet ganze „Welten“, von denen Gottfried spricht, das heißt unterschiedliche Gesellschaftsschichten und deren unterschiedliche Ideologie. (Zum Terminus Hof.doc) Isolde will sich zum Gerichtstag in Karliun auch ausdrücklich durch keinen der anwesenden Ritter vom Schiff an Land tragen lassen, sondern nur von einem ebenfalls dort weilenden Pilger. Es ist Tristan, der sich auf Isoldes brieflichen Hinweis dort in dieser Verkleidung eingefunden hat; und so trägt sie Tristan vor aller Welt öffentlich in seinen Armen, stolpert indessen verabredungsgemäß, so daß er plötzlich vor aller Augen in den Armen der Königin liegt. Nun kann sie - barfuß und in hährenem Hemd auf einen Reliquienschrein den Schwur leisten, sie habe niemals einem anderen Manne als Marke in den Armen gelegen - außer eben jenem Pilger. Nun kann sie auch die glühenden Eisen in ihren bloßen Händen tragen, der „wintschaffene Krist“ nimmt ihr den „gelüppeten eit“ („vergifteten“, gefälschten Eid; V. 15752) offenbar bedenkenlos ab: ist ez ernest, ist ez spil, er ist ie, swie so man wil. (V. 15747f.) Sei es im Ernst, sei es im Spiel, er ist immer so, wie man es gerade will. Geliebt, geehrt und von dem reuigen Gatten versöhnt, lebt Isolde nun erneut an Markes Seite. Mit der Tristan-Initiale einsetzend und damit das T – I – I - T -Umarmungsspiel beendend, das Tristans und Isoldes gefährliche Liebesabenteuer an Markes Hof kompositorisch zusammenfaßt und symbolisiert, folgt die Erzählung vom Wunderhündchen Petitcriu (V. 15769-16406), was (altfranzösisch) soviel wie „kleines Geschöpf“ bedeutet (V. 15801). Tristan hat Cornwall verlassen und lebt als „trauriger Gast“ bei Herzog Gilan in Swales (Süd-Wales). Dieser vertreibt Tristans Schwermut durch das wunderbar bunte Hündchen Petitcriu, das er als Geschenk von einer Fee erhalten hat und das ein Glöckchen am Halsband trägt, bei dessen Klang alle Schmerzen verfliegen. Herzog Gilan ist dem Riesen Urgan zinspflichtig und verspricht Tristan, wenn er ihn von dieser Knechtschaft befreie, ihm alles zu übereignen, was er begehre. Nach dem siegreichen Kampf gegen Urgan (in Parallele zum Kampf gegen Morold) erbittet er das Hündchen, das er durch einen walisischen Spielmann als Geschenk an Isolde schickt, damit das Glöckchen ihren Kummer stille. Isolde indessen läßt ihm antworten, er möge selbst zurückkehren, denn das Gottesurteil sei glücklich verlaufen und Marke versöhnt. Sie reißt Petitcriu das Glöckchen ab, denn sie will ohne ihren Geliebten keine Freude empfinden und den Schmerz mit dem fernen Geliebten teilen: Gerade hierin liegt der Sinn dieser reizvollen Episode, die indessen unlogisch in den epischen Gang der Handlung einstrukturiert ist und eigentlich in die spätere endgültige Trennungs- und Verbannungszeit Tristans gehörte. Selten kann man in der Literatur das Schöpfen aus dem lebendigen Fluß volkstümlicher Sage, volkstümlichen Erzählschatzes und seine Umschmelzung in die geronnene Form fester Schriftlichkeit so exakt verfolgen wie in der sich nun anbahnenden Szenerie der Verbannung vom Hof und der Flucht des Liebespaares in die Einsamkeit des Waldlebens (V. 16403-17662); selten auch kann man unterschiedliche poetische Meisterung des stofflichen Materials und unterschiedliche Dichtungskonzeption- und intention so scharf beobachten wie an den Abweichungen, die „Tristrant und Isalde“ und „Tristan und Isolde“ trotz grundsätzlicher paralleler Fabelführung im Darstellerischen voneinander trennen. Stofflich-kompositorisch und in der inneren epischen Motivation liegen die Vorzüge zunächst eindeutig auf seiten des „Tristrant“ und der volkstümlichen „Estoire“. Die Altfassung führte mit wuchtiger Akzentuierung aus dem Greuel der Verurteilung zu Feuer und Rad und der Gräßlichkeit der Preisgabe Isoldes an die Aussätzigen durch den racheglühenden Marke in geradliniger Konsequenz zu der Flucht und zum Waldleben der Liebenden; und auch moralisch war Marke durch sein beispiellos grausames Verhalten des Rechtes auf seine Gattin endgültig verlustig gegangen. Gegenüber diesem dramatisch zugespitzten Übergang zu Verbannung, Flucht und Waldleben wirkt die Schilderung der Thomas-Gottfried-Version handlungsarm, blaß und inkonsequent motiviert: Kurz, episch entschieden schwächer. Nach all den vielen Versuchen Markes, die Liebenden zu überführen, nach den ebenso vielen Widerlegungen seines Argwohns, genügt ihm zum Verbannungsspruch gegen Frau und Neffen jetzt plötzlich das bloße peinigende Gefühl ihres Anblicks, ohne sie irgendwie handgreiflich des ehebrecherischen Umgangs bezichtigen zu können. Nach dem öffentlichen Bannspruch Markes verbeugen sich die beiden Liebenden „mit kühlem Herzeleid“ (V. 16625) vor dem König und den Hofleuten und gehen Hand in Hand davon, um in der Wildnis des Waldes eine Zufluchtsstätte für ihre Liebe zu finden. Sie nehmen nur den getreuen Kurvenal und den Hund Hiudan mit, zwanzig Mark in Goldbarren, Harfe, Schwert, Armbrust und Jagdhorn und gelangen nach zwei Tagesritten plötzlich in ein paradiesisches blühendes Tal, in dem sich, „in einen wilden Berg gehauen“, die Minnegrotte befindet, die Tristan früher einmal zufällig auf einem Jagdzug entdeckt hatte. Der Gegensatz zu den Altfassungen des Tristanstoffes könnte kaum größer sein: Bei Beroul baut Tristan, aus Furcht vor Verfolgern rastlos durch die Wildnis schweifend, der Geliebten jeden Abend eine primitive Nothütte aus Laubzweigen als flüchtige Unterkunft, hier bewohnt das Liebespaar einen heidnischmythischen Minnetempel, der aufs kostbarste und künstlichste ausgebaut ist und von Gottfried folgendermaßen beschrieben wird: „Diese Grotte war einstmals in heidnischen Zeiten noch vor Korinäus in den wilden Felsen gehauen worden, als dort noch die Riesen herrschten. Dort drinnen hatten sie ihr Versteck, wo sie heimlich ihrer Liebe leben konnten. Und jede solcher Grotten war mit einem ehernen Tor verschlossen und der Minne geweiht und nach ihr benannt: „la fossiure a gent amant“, (altfranzösisch: Kammer für Liebende), was soviel wie Minnegrotte bedeutet. Der Name dafür war sehr gut gewählt. Auch verkündet uns diese Geschichte, die Grotte wäre rund gewölbt, weiträumig und hoch emporstrebend, von schneeweiß glatten Wänden umgeben. Das Gebäude war oben kunstvoll in einem Schlußstein zusammengefügt, der eine Kuppelkrone bildete, die mit feinster Schmiedearbeit verziert und mit Edelsteinen geschmückt war. Und unten war der Estrich spiegelglatt und rein von wertvollem Marmor grün wie Gras. In der Mitte stand ein Bett, herrlich und rein aus Kristall geschnitten, hoch, breit und wohlverziert, die Buchstaben, die ringsum eingegraben waren, besagten, daß es der Göttin Minne geweiht sei. Oben in der Grotte waren kleine Fenster in den Fels gehauen, um das Licht hereinzulassen.“ (V.16693-16731) Die kunstvolle kultisch-allegorische Auslegung aller hier beschriebenen Einzelheiten erfolgt erst exakt 200 Verse später (V. 16932ff.). Dabei soll die runde Wölbung der Grotte die Einfalt der Minne versinnbildlichen, die „ohne Winkel“, das heißt ohne Tücke und Falschheit sein soll. Die Weite des Raumes bedeutet die unendliche Kraft der Liebe, die Höhe den „hohen Mut“, dem nichts zuviel ist, solange er dahin emporstrebt, wo alle Edelsteintugenden im Schlußstein des Gewölbes sich zusammenschließen, die Weiße und Glätte der Wände bezeichnen Vollkommenheit, der grüne Marmorfußboden Beständigkeit, die drei Fenster des Gewölbes Güte, Zucht und Demut; das Bett ist kristallen, weil es die durchsichtig-lautere Reinheit der Minne symbolisiert. Mit der Deutung der Tür der Liebesgrotte und der Beschreibung ihrer Einzelheiten und des öffnungsvorganges durch eine zinnerne Spindel, die auch als „heftelin“, und „andaht“ umschrieben wird, die in die goldene „Falle“ der Tür führt, gipfelt die Auslegung in einer dem Wort- und Sinnbild nach zweifelsfreien, gewagten Allegorie des Liebesaktes, wie es Werner Betz richtig erkannt hat: „Zum Schluß (V. 16985 ff.) wird beschrieben, wie die eherne Tür zur Liebesgrotte verschlossen ist und wie sie geöffnet werden kann. Innen befindet sich eine Falle, die von außen durch ein heftelin geöffnet werden kann. Gottfried spielt hier wieder mit der Doppelbedeutung der Wörter: valle und heftelin bedeuten zwar auch „Klinkenfalle“ und „Türöffner“, aber sie bedeuten auch und hier in erster Linie „vagina“ und membrum virile. Durch sie allein kann die Tür zur Minnegrotte geöffnet werden. Darum ist auch kein Schloß und kein Schlüssel an dieser Tür (16994), damit nicht durch irgend etwas Äußerliches und Falsches (wie etwa die höfische Ehre) der Zugang zur Minnegrotte geöffnet werden kann. Diese von allem Äußerlichen emanzipierte, nur auf sich selbst beruhende Minne kann nur von innen, durch sich selbst, durch die Liebesvereinigung, zugänglich werden.“ [29] Schließlich wird auch noch die Lage der Grotte in der unzugänglichen Wildnis in die allegorische Auslegung einbezogen: Wahre Liebe liegt nicht „an der Straße“, es braucht unendliche Mühe, Strapazen und Anstrengungen, um zu ihr gelangen zu können. Zweifellos stand Gottfried bereits eine breite Literatur allegorischer GebäudeAuslegung als mittelbares Vorbild zur Verfügung; Ranke hatte als erster auf die Analogie zu der üblichen sinnbildlichen Auslegung des Kirchengebäudes hingewiesen, wobei sich zugleich verführerisch die allerdings nicht nachweisbare Verbindung zur Anschauungsmöglichkeit des gerade im Bau befindlichen Straßburger Münsters anbietet; Kolb indessen konnte auf die mögliche Vorbildwirkung einer - zwar erst später überlieferten –„Maison d’amour“ verweisen, die eine Vielzahl kaum zufälliger Übereinstimmungen mit Gottfrieds Grottenallegorese besitzt.[30] In keiner der Allegorien reicht indessen Gottfrieds zugleich auch noch polysem verschlüsselte ideelle Spannweite vom Sexuellen über das Ethische bis hin zum Mythisch-Religiösen. Daß Gottfried in einem der eingeschobenen autobiographischen Exkurse der Minnegrottenszene erwähnt, es gebe mehr als eine und er selbst hätte sie „erkannt“, und sei doch nie nach Cornwall gekommen, bestätigt die Allgemeingültigkeit dessen, was er im Bilde seines weltlichen Kultbaus aussagen wollte. Der Schreiber der ältesten erhaltenen, etwa zwei Jahrzehnte nach Gottfrieds Tod zu datierenden Handschrift empfand solche Angst vor der ideologischen Gefährlichkeit dieser Minnegrottenallegorese, daß er die gesamte Versgruppe fortließ, ebenso wie er auch andere Anstößigkeiten beseitigte. Die Minnegrotte und ihre paradiesische Umgebung inmitten der sie nach außen absichernden Wildnis bildet jedoch nur den äußeren Rahmen, in dem sich die eigentliche Liebeshandlung abspielt und ideell wir künstlerisch ihren absoluten Kulminationspunkt erreicht. War in der älteren Tristanpoesie das Leben in der Wildnis noch hart und entbehrungsvoll, voll Furcht und Hunger, so ist der Waldaufenthalt jetzt in eine lyrische Idylle inmitten romantisch-paradiesischer Natur verwandelt: „Auf der einen Seite war eine Ebene, da floß eine Quelle, ein frischer kühler Bach, so klar wie die Sonne selbst. Da standen obenauf drei Linden schön und in voller Pracht, die beschirmten den Brunnen vor Regen und Sonne. Die Leuchtkraft der bunten Blumen und des grünen Grases, von denen die Ebene überströmt war, lagen miteinander in süßem Widerstreit. Auch tönte dort süßer Vogelsang schöner als irgend anderswo. Auge und Ohren fanden daran gemeinsam Weide und Wonne: Das Auge seine Weide, das Ohr seine Wonne. Da gab es Schatten und Sonne, die Luft und der Wind waren sanft und lind.“ (V.16741-16764) Bei Beroul hatte Tristan die schreckliche Hofesferne des strapaziösen Waldlebens noch wie folgt beklagt: „O Gott, wie elend geht’s mir! Jetzt sollte ich am Königshof sein und hundert Knappen bei mir haben, die mir mich wappnen hülfen und mir dienten [...] Die Königin bekümmert mich, der ich Laubzweige gebe statt der Vorhänge. Im Walde haust sie und könnte mit ihrem Gesinde in schönen seidebespannten Zimmern leben.“ Das sind noch Töne eines ungebrochenen Feudalempfindens. Bei Gottfried indessen hat sich alles genau ins Gegenteil verwandelt: In reiner Minneexistenz sind sich die Liebenden völlig selbst genug; wie sie keine physische Nahrung benötigen, so entbehren sie auch nicht die höfische Geselligkeit und Kultur: „Auch kümmerte es sie wenig, daß sie in der Wildnis allein und ohne die Gesellschaft anderer Leute leben mußten. Wessen hätten sie auch bedürfen sollen oder was hätte er ihnen nutzen können ? ... Ihre zweier Gesellschaft erschien ihnen beiden so zahlreich, daß der selige Artus auf keinem seiner Schlösser je ein so großes Fest gegeben hat ... Ihr Fest war die Liebe, die Übergoldung ihrer Freuden, die schenkte ihnen durch ihre Huld jeden Tag tausendmal Artus’ Tafelrunden und alle ihre Gesellschaft. Was brauchten sie bessere Nahrung für ihre Herzen und ihre Körper? War doch der Mann bei der Frau, und da war die Frau bei dem Mann: Wessen hätten sie noch bedürfen sollen? Sie hatten, was sie brauchten, und sie waren, wo sie wollten.“ (V.16851-16855, 1686316867,16900-16912) Gottfried transzendiert die irdische Liebesvereinigung zu einem absoluten und totalen Geschehen. Ins Welthafte gekehrt, vollziehen sich hier Hingabe und Verschmelzung in derselben Unbedingtheit, wie religiöse Ekstatiker sie von ihrem Erlebnis der Unio mystica aussagen. In immer neuen Versen berichtet der Dichter von der Restlosigkeit, der Tiefe, der abgründig seligen Gewalt dieses Einswerdens der Liebenden. Es ist dies alles jedoch keineswegs eine romantische Reduktion auf das rein natürliche Leben jenseits alles Gesellschaftlichen: Es ist zugleich- mit der ausdrücklichen Nennung von Artus’ Tafelrunde auch explizit ausgewiesen - die Destruktion der zentralen höfischen Werte wie der Ehre als der öffentlichen Reputation bei Hofe, der Treue im Sinne der Vasallenverpflichtung, der Hofesfreude oder gar des kämpferischen Abenteuers. Der moderne Minne-Mythos, den Gottfried an ihre Stelle setzt und der die ganze Polarität eines irdisch-unirdischen Daseins umspannt, ist ursächlich bereits nicht mehr mit der Feudalherrenklasse und dem Rittertum verbunden, er erwächst nicht mehr aus der Lebensweise des Adels, sondern ist in bewußtem Gegensatz zu ihr konzipiert. Die ideellen und auch sozial fixierbaren Wurzeln dieser neuen „Weltanschauung“ liegen vielmehr im Bereich der seelischen und geistigen Bildung und damit einer „Selbstdarstellung“ der Ideale einer jungen Schicht der frühstadtbürgerlichen Intelligenz, die den Sinn des Lebens nicht in Ritterkämpfen und Hofesfreuden sah, sondern die von der Neuentdeckung der individuellen Liebe fasziniert war, die als einziger Wert vorangegangener Feudaldichtung sie letztendlich auch persönlich und sozial zu tangieren vermochte. Diese neue Minne-Ideologie trägt ihren unverwechselbaren sozialen Stempel nicht nur dadurch, daß sie sowohl auf die vasallische Anbetung der Herrin wie im Minnesang als auch auf das Gegenextrem patriarchalischer Unterwerfung der Frau wie in „Erec und Enite“ verzichtet und eine sehr modern anmutende „Gleichberechtigung“ der Partner anstrebt und gestaltet, sondern vor allem durch die Tatsache, daß sie sich auf für sie notwendige Bildungsvorraussetzungen gründet. Die Liebenden genießen nicht nur die idyllische Natur, sie erfreuen sich auch an den schönsten traurigen Liebesgeschichten alter Zeiten, an Phyllis, Kanace, an Byblis, an Tyrus und Dido (V. 17 186ff.). Haben sie ihr Herz daran gesättigt, so begeben sie sich in ihre Klause und verbringen die Zeit mit Musizieren, wobei Gesang und Musik sich in höchster Kunstvollendung gegenseitig umschlingen (V. 17204ff.). So klingen in der Utopie der Minnegrottenszene Mensch und Minne, Minne und Mythos, Natur und Kultur zu einer vollendet gestalteten Harmonie zusammen, an der sich bezeichnenderweise auch alle bedeutenden Künste der Zeit beteiligen: Die Architektur im Sinnbild der Grotte, die Musik und die Poesie. Die Kunst wird hier ebenso wie die Einheit mit der Natur - zu einem Wesenselement der Tristan-und-IsoldeMinne. Damit wird nicht nur ein neues Menschenbild, sondern auch eine neue ethischsoziale Verhaltensnorm begründet, die nicht mehr ritterliche Kampfesbewährung als Voraussetzung und ruhmreiche Landesherrschaft zum Ziel hat, sondern die künstlerisch-sensible Bildung und Erlebnisfähigkeit an die Stelle der Kampfestüchtigkeit und die psychische und geistige Aufschließung des Innern für das existcntielle Grunderlebnis einer augenblicksweise vollkommen erscheinenden Welt durch die sinnaufschließende Macht dcs Eros an die Stelle angestrebter vorbildhafter Landesherrschaft setzt. Es sind dies deutliche Vorboten späterer bürgerlicher „Verinnerlichung“, Relativierung des Bildungswertes und „allgemeinmenschlicher“ Zielsetzung wie der freien Entfaltung der Persönlichkeit in Opposition zu den normsetzenden Schranken der herrschenden Feudalstrukturen. Zuglcich ist die in der Utopie der Waldidylle proklamierte Freiheit gerade dadurch eine zutiefst hcidnische, als sie geistliche Darstellungsmittel und Motive nutzt, um Minneromantik zu Minnemystik, Minnetriumph zu Minneekstatik, Liebeslust zu einem sakralen Fest und Vorgang zu steigern. Nicht Gott, sondern „die Göttin Minne“ beherrscht dieses absolut irdische Paradies. Ihr ist der Liebestempel der Minnegrotte gcweiht, ebenso wie das kristallene Bett, das dem lectulus Salomones, dem berühmtcn Bett Salomos nachgebildet ist, das in der mystischen Allegorisierung des Hohen Liedes cine zentrale Rolle spiclt. Gottfried deutet nur indirekt an, daß das kristallene Liebesbett in seinem Tempel die Stclle eines Altares einnimmt. Das christliche Gotteshaus ist die Stätte der eucharistischen Liebesfeier zwischen Mensch und Gott, die Eucharistie das Zentralmysterium der Kirche: Comnunio und Unio durch Essen und Trinken. An die Stelle des eucharistischen Mittelpunktes katholischer Kultliturgie tritt bei Gottfried die Ernährung der Liebenden aus der Wunderkraft der Liebe selbst. Deshalb ist eben seine Licbesklause das Ebenbild zum kirchlichen Gotteshaus, womit sich Elemente der seit altersher in der christlichen Tradition verwurzelten, besonders durch das Hohe Lied angeregten Brautmystik verbinden. Mit dieser Sakralisicrung der irdischen Liebe hat der Dichter des deutschen Tristan-Epos an der Schwelle des 13. Jahrhunderts Unerhörtes gewagt. Er ist weit vorgestoßen und hat damit die freie Ausweitung des Meßwunders zur nahrung- und jugendspendenden „phruende“ und „wirtschaft von dem Gral“ bei Wolfram von Eschenbach weit übertroffen: Eucharistie, Gral und Minne sind nicht nur wie bei Wolfram innig benachbart und aufeinander bezogen, sondern die Minne in ihrer vitaldirekten Existenz selber ist zum Kultinhalt des Tcmpels geworden. Dies bedeutet die Proklamierung einer bewußt antikirchlichcn Diesseitsreligiosität, von deren sich kultanalog vollziehendem Mysterium her auch die Verse des Prologs erst ihr volles Gewicht erhalten, die auch Liebesdichtungen - wie dem Epos Gottfrieds - eine priesterliche Funktion zuerkennen: Solche Dichtungen sind edlen Herzen Nahrung, wie sie auch Tristan und Isolde eine Speise sind. Daher schreibt Gottfried seinen Helden nicht nur eine vorbildhafte, sondern eine wirkende Kraft zu, die der Wirkungskraft der Heiligen entspricht. Diese durch den Tristanprolog und die Minnegrottenszene vollzogene Erhebung unsterblicher Dichtung und des Dichters aus der Unterhaltungsfunktion auch über die Erziehungsaufgabe hinaus zu priesterlichen Spendern des Lebensbrotes, dessen alle „edle Herzen“ bedürfen, stellt innerhalb des gesamten Hochmittelalters Europas etwas völlig Einzigartiges dar. Jedoch nicht nur ideologisch-soziokulturell, sondern auch durch ihre unerhörte künstlerische Faszination stellt diese Darstellung des Waldlebens Tristans und Isoldes und ihrer Liebesseligkeit aus Lust und Harfenklang einen absoluten Kulminationspunkt dar, dessen unvergleichliche Bilder und unnachahmliche sprachliche Musikalität sich zur lautersten, poesievollsten Minne-Idylle innerhalb mittelalterlicher Epik finden. Das Waldleben endete auf den Altstufen noch vor der frühfeudalklassischen Fortsetzung der „Estoire“ mit dem Tod der Liebenden. Seitdem der Dichter der jüngeren Teile der „Estoire“ die Tristangeschichte als eine Liebesgeschichte über die Episode vom Waldaufenthalt hinausführte, verblieb ein Widerspruch, der durch die Thomas/Gottfried- Version noch weniger zu lösen war als durch ihre Vorgänger. Die Zeit der Waldseligkeit, der mystischen Selbsterfüllung war von Gottfried als eine solch absolute, erotisch-religiös erlebte Vollendung geschildert worden, daß nur im offenen Widerspruch hierzu und zu sich selbst die Liebenden „um Gott und ihrer Ehre willen“ ihren Liebes- und Glückseligkeitstempel vcrlassen konnten. Epischer Anlaß für die Entdeckung des Liebespaares in der Minnegrotte ist eine Jagd Markes auf den seltsamen und symboltragenden weißen Hirsch, der selbst aus dem Minnegrottenbezirk stammt und vor den Jägern entsprechend in diese Richtung davonläuft. Erst am folgenden Tag kann der Jäger die verlorene Spur wieder aufnehmen, während Gottfried ein letztes Mal die Poesie der Waldidylle und des verborgenen Liebestempels (es ist die vierte Beschreibung) aufblühen läßt. Da Tristan und Isolde an Hörnerklang und Hundegebell gemerkt haben, daß eine Jagdgesellschaft in der Gegend weilt, beschließen sie, ihre Grotte nicht zu verlassen und auch in diesem Versteck noch Vorsichtsmaßnahmen zu beachten: Sie schlafen nicht eng aneinandergeschmiegt wie Mann und Frau, sondern voneinander abgewandt, und Tristan legt zwischen Isolde und sich das blanke Schwert. Hiermit haben Urmotive der Tristansage ihre letzte Ummotivierung und Stilisierung erfahren. Thomas begründet das Getrenntliegen des Paares noch mit dem Hinweis auf die Hitze des Sommertages; daß Tristans Schwert zwischen den Liebenden liegt, bleibt bei ihm Zufall. Bei Gottfried erscheint das alte Keuschheitssymbol nun zu einem Mittel wohlberechneter Taktik rationalisiert. Markes Jägermeister geht den Fußspuren des Paares im Frühtau nach, findet die Grotte, blickt durch das Fenster und hält Isolde in der überirdischen Schönheit ihres Glücks für eine göttliche Fee. Als er dies zutiefst erschrocken seinem König berichtet, eilt Marke herbei und erblickt nun durch das Höhlenfenster selbst seine Gattin und seinen Neffen. Der Anblick stürzt ihn erneut in Unsicherheit und Zweifel, doch dann siegt das Verlangen in ihm: Isolde war ihm noch nie so schön erschienen wie jetzt. Kaum vermag „der wegelose man“ sein Auge von der Frau loszureißen, die da wie „der ôsterliche tac aller siner fröuden“ schlummernd und, nach Markes neu gefaßter Hoffnung, glühend und blühend in der Schönheit ihrer Unschuld liegt. In rührender Weise verstopft Marke das kleine Fenster mit Blumen, Laub und Gras, um Isolde vor den Strahlen der Morgensonne zu schützen und kehrt an seinen Hof zurück. Nur an den verdunkelten Fenstern und den Fußtritten auf dem Felsen sieht das Paar, daß jemand ihren Zufluchtsort entdeckt hat. In der „Estoire“ wird nur Isolde die Rückkehr an den Hof gestattet; Tristan muß die Verbannung auf sich nehmen, wodurch die Zeit seiner abenteuerlichen CornwallFahrten schon jetzt ihren Anfang nimmt. Thomas/Gottfried brauchen demnach ein nochmaliges Erwachen der Eifersucht Markes, einen neuen Anlaß, der die Trennung der Liebenden durch Exilierung Tristans zur Folge hat und somit den letzten großen Abschnitt des Romans (Cornwallfahrten, Isolde Weißhand und Tod der Liebenden) eröffnet. Bei Gottfried nun trägt Marke seine Beobachtungen im Walde seinen Räten vor; durch Kurwenal ruft er schließlich Isolde und Tristan ehrenvoll an seinen Hof zurück. Und während Marke, geblendet von der Schönheit Isoldes, sich ganz in den Wahn hineinsteigert, ihre Liebe gehöre ihm, läßt er zugleich die Bewachung der Liebenden verstärken, was zu dem berühmten „huote“-Exkurs führt (V. 17862-18118), der unter diesem konventionellen Schlagwort der Lyrik die kulturgeschichtlich aktuelle und zentrale Frage der gesellschaftlichen Stellung der Frau, nach ihrer Freiheit oder Unfreiheit, nach ihrer Wesenheit und Selbstverantwortung aufwirft. Gottfried geht ganz aktuell von der gegenwärtigen kulturgeschichtlichen Situation aus, wie viele „der Marke und der lsolde“ (V. 17775) es „heute“ noch gibt, und er bezeichnet dann Markes Bewachungsmaßnahmen der „huote“ als töricht, ehrlos, als „verfluchte Belagerungsmaschine“ und „Feindin der Minne“. Er geht sodann von der psychologischen Beobachtung aus, daß gerade das Verbot den Reiz des Verbotenen zu etwas Unwiderstehlichem zu steigern vermag. Von hier aus schlägt Gottfried einen kühnen Bogen zum bibIischen Mythos des Sündenfalls, in dem er als seine persönlichc Meinung ausspricht, daß auch Eva die verbotene Frucht nicht gegessen hätte, wenn Gott ihr gerade dies nicht verboten hätte. Mit einem kleinen Seitenhieb verweist er darauf, daß die Pfaffen die Meinung verträten, daß es sich bei diesem verbotenen „Obst“, um die Feige (als sexuelles Symbol!) gehandelt hätte. In Widerspruch zu der christlichen Verteufelung der Eva-Natur stellt sich deren elementarisches Wesen bei Gottfried unter positiven Aspekt. Die Fülle des Lebens selber spendend, ist der weibliche Lebens- und Liebestrieb eine Urwirklichkeit, wie in gleicher Vorgegebenheit sonst nur noch der Tod in das menschliche Dasein hineinragt. Tugend und Sittsamkeit, Konvention und Gesellschaftssphäre erscheinen demgegenüber als sekundäre Wirklichkeit, als Oberfläche, unterhalb derer die nackte, mächtige Wahrheit sich verbirgt, aber nicht verschüttet bleiben darf. Die Isolde-Minne gewinnt damit zugleich eine heilsgeschichtliche Dimension, die in der Frau das „lebende Paradies“ (V. 18070) sieht in der dialektischen Spannung von Verführung und Erlösung; und es gehört zu der kühnen Verweltlichung der religiösen Sphäre, daß unverkennbare inhaltliche und sprachliche Analogien zu der Gottesmutter Maria und ihrer Entsühnungsfunktion in die Charakteristik der idealen Frau einbezogen werden. Dabei verurteilt Gottfried ebenso entschieden die hemmungslose Viel-Liebe wie die ganz auf Moral und Sitte reduzierte Frau, die ihr eigenes lebendiges Wesen vergewaltigt und die für ihn nur dem Namen nach eine Frau, sonst aber ein Mann ist. Trotz der „huote“, die Marke dem Liebespaar auferlegt, kommt es so, wie es der „huote“-Exkurs erwarten läßt: An einem heißen Tage bedrängen Isolde zugleich die Hitze der Sonne und der Liebe, und so sucht sie doppelte Kühlung, indem sie sich in den Schatten des Baumgarten zurückzieht und nach ihrem Geliebten schickt. Auf einem mit königlicher Üppigkeit ausgestatteten Ruhebett empfängt „die blonde“, nur mit einem Hemd bekleidet, ihren Freund, der „rehte als Adam tete: / daz obez, daz ime sîn Eve bôt, / daz nam er und az mit ir den tot“ (V. 18 166-18 168) (... es nun genau wie Adam machte: Das Obst, das ihm seine Eva bot, das nahm er und aß mit ihr den Tod). Kaum sind die beiden entschlummert, da tritt Marke hastigen Schritts in den Garten ein, so daß die Wächterin Brangaene ihre Herrin nicht mehr warnen kann, und findet die beiden Liebenden in inniger Umarmung: „Weib und Neffen fand er eng und innig umschlungen, ihre Wange an seiner Wange, ihren Mund an seinem Mund ... und wäre ein Kunstwerk aus Erz und Gold gegossen, es hätte nicht schöner, enger und unzertrennlicher zusammengefügt sein können“. (V. 18 199-18203, 18212-1821;) Auch dieses Beispiel demonstriert, wie stark Gottfrieds Denken von den Kategorien der Künste beherrscht wird. Tristan und Isolde erscheinen hier bereits zu ihrem anbetungswürdigen Minnedenkmal stilisiert, und tatsächlich hat genau dieses Bild bereits im 13. Jahrhundert seine auch bildkünstlerische Darstellung gefunden. Was Marke nie richtig wahrhaben wollte, überwältigt ihn nun: „Er wähnte nicht mehr, er wußte“ (V. 18226), doch war der Zustand des Zweifels für ihn immer noch besser gewesen als die Gewißheit, sagt Gottfried, die für ihn nichts anderes bedeutete als seinen lebendigen Tod. Es ist dies die aufgegipfelte Aporie einer Ehesituation, wie sie heute noch täglich tausendfach vorkommt, lebenszerstörend und Gottfrieds Metapher vom „lebendigen Tod“ auch noch nach fast 800 Jahren bewahrheitend und erfüllend. Marke entfernt sich wortlos, um Zeugen und Häscher herbeizuholen. Erwachend sieht Tristan ihn enteilen, weckt die Geliebte, die dem schnell sich Verabschiedenden ihren Ring als „urküende der triuwen unde der minne“ mit auf den Weg in die Trennung gibt. Als Marke mit seinem Gefolge wiederkehrt und sein Weib nun allein vorfindet, halten ihm die Barone vor, er bezichtige sein Weib im Wahn und zerstöre selbst seine und ihre Ehre, woraufhin er sich soweit beschwichtigen läßt, daß er auf gerichtliche Ahndung verzichtet. Trotz der Dringlichkeit, mit der die plötzliche Wendung der Dinge Tristan zur Flucht treibt, läßt Gottfried die Liebenden noch heiße, die neue Situation zergliedernde Liebesreden von beträchtlicher Länge austauschen. Der Dichter hebt so auch hier wieder das ganze Geschehen auf eine ans Ekstatische streifende seelische Höhe. Dadurch hat er seine Vorlage wiederum tiefgreifend verwandelt. Zu dieser Szene der Entdeckung im Baumgarten liegt uns parallel zu Gottfried ein Bruchstück von 2 Versen des Originaltextes von Thomas vor. Es zeigt, daß Gottfried auch äußere Umgestaltungen vorgenommen hat. Bei Thomas wird Marke von dem boshaften Zwerg in den Garten geführt; Tristan hört, daß Marke die Ehebrecher auf dem Scheiterhaufen verbrennen lassen will und deshalb in die Burg eilt, um Zeugen zu holen. Während der Abschiedsreden der Liebenden beläßt Thomas diesen Zwerg seltsamerweise im Garten; trotzdem rettet sich nachher Isolde, indem sie vor den Baronen alles ableugnet, und Marke kann keinen Zeugen beibringen. Gottfried hat hier die Mitwirkung des Zwerges einfach gestrichen, dafür aber die Szene mit tiefgefühltem Abschiedsschmerz und Beteuerung ewiger Einheit lyrisch erfüllt. So ist diese Szene nicht nur beweiskräftiger Beleg für die relative Selbständigkeit, mit der Gottfried seine Vorlage umgestaltet, sondern zugleich auch ein illustratives Beispiel dafür, wie mittelalterliche Dichtung nicht erfindet, vielmehr immer von neuem Traditionsgut umprägt und umschichtet. Der trauernde Tristan segelt mit seinem Gefolge zur Normandie, von wo aus er, um von seinem übermächtigen Schmerz zu genesen, auf Ritterschaft und Aventiure auszieht, zunächst im Dienst des Römischen Reiches (V.18443-18454). Danielle Buschinger hat nachweisen können, daß Gottfried mit diesen Versen bewußt aktualisiert und Partei für das Römische Reich, die Staufer und gegen den Papst ergreift und sich gleichzeitig auf die Seite der Stadtbevölkerung und des weltlichen Stadtrates von Straßburg und gegen den Bischof stellt, der durch den Stauferkaiser Philipp seine Stadtherrenrechte in Straßburg weitgehend einbüßte [31], was die politische und soziale Position Gottfrieds als Repräsentant des frühen deutschen Stadtbürgertums verdeutlicht. Nach einem halben Jahr kehrt Tristan über die Normandie in seine Heimat Parmenien zurück, wo er sich zur Ablenkung einige Zeit der höfischen Geselligkeit hingibt. Mit der Nachdichtung der Geschichte Tristans und der Isolde Weißhand hat Gottfried noch begonnen. In den Grundzügen folgt seine Vorlage hier der „Estoire“, obwohl Thomas im Detail manches umgestaltete. Nachdem Tristan von Ruals Söhnen sich eine Ritterschar hat zu Hilfe senden lassen, befreit er nicht nur durch selbstverständliche Tapferkeit, sondern vor allem wiederum durch Kriegslist und Hinterhaltstrategie das von Feinden bedrängte Herzogtum Jovelins von Karke (bei Eilhart: Havelin von Karahes) und gewinnt die Freundschaft des Herzogssohns Kaedin (bei Eilhart: Kehenis). Daraus bahnt sich Tristans Beziehung zu Kaedins Schwester Isolde an, „diu mit den wlzen handen“ (V.18961). Die letzten 600 Verse, die Gottfried dichtete, sind dem psychologischen Rätsel gewidmet, wie Tristan zu einer Ehe mit der anderen Isolde schreiten konnte, nachdem sein Abschied von Cornwall noch als Höhepunkt seines unlöslichen, ins Mystische gesteigerten Verbundenheits- ja Identitätsgefühl mit der blonden Isolde gestaltet worden war. Die Ausführlichkeit, mit der diese Eheschließung vorbereitet wird, zeigt, wie sehr das Motiv von der Ersatzfrau gleichen Namens und der darin liegenden Motivverschlingungen und -kontraste nach Thomas auch Gottfrieds psychologisches Interesse wachgerufen haben. Der Name bildet die sinnfälligste Brücke, doch auch die Schönheit der zweiten Isolde erinnert an die „lûtere von Irlant“. Je mehr Tristan durch Isolde Weißhand an die ferne blonde Isolde erinnert wird, desto frischer und größer wird sein Schmerz und sein Verlangen; je tiefer aber sein Schmerz aufgerührt wird, desto lieber sieht er auch Isolde Weißhand an. Er fühlt sich verwirrt, Wahrheit und Trug fließen ineinander über: Einerseits trägt er das Bild der blonden Isolde und die Erinnerung an alles, was zwischen ihnen lebt, unvergeßlich in sich, andererseits muß dieLiebesbereitschaft des Mädchens, das ihn nicht nur dem Namen nach an seine Geliebte erinnert, dem liebeskranken Mann als eine Wohltat erscheinen. Und so innerlich zerrissen zieht er sich wieder ganz in die Kunst zurück und beginnt erneut zu dichten, zu musizieren und zu singen, und so entsteht auch „die edle Tristanweise, die man lieben und schätzen wird, solange die Welt besteht“. In alle seine Lieder flicht er den Refrain ein: „Isot ma drue, Isot m’âmie, / en vûs ma mort, en vûs ma vie!“ (V. 19217f.) (Isolde, meine Vertraute, Isolde, meine Geliebte, ihr seid mein Tod, ihr seid mein Leben! [altfranzösisch]). Natürlich glaubt Isolde Weißhand, diese Verse auf sich beziehen zu können und daraus die Gewißheit seiner Liebe ableiten zu dürfen. Gottfried fügt an, alle Liebenden könnten an dieser Geschichte ermessen, wie gefährlich unmittelbar-nahe Minne der fernen, unwirklichen werden könne. Zu den letzten 128 Versen Gottfrieds liegt wiederum ein direkter Paralleltext Thomas’ vor. Es handelt sich dabei um einen langen Monolog Tristans. Thomas läßt Tristan erwägen, wie die blonde Isolde die Liebe Markes genösse, während er allein und verlassen sei; doch wenn Gottfrieds Tristan über seine bittere Not klagt, so beklagt er zugleich, daß die Zeit seiner völligen Gemeinschaft mit Isolde ihr Ende gefunden habe. Gottfried hat die viel härteren Räsonnements, die er bei Thomas vorfand, um vieles gemildert, seelisch differenziert und mit Wehmut durchfärbt. Doch auch er muß Tristans Eheschließung psychologisch verständlich machen. So läßt er dessen großes Selbstgespräch mit einem Hinweis auf schriftliche Autorität (Ovid) anheben: „Soll man auf Erden in unglücklicher Liebe Erleichterung finden, dann durch andere Liebe.“ Tristan glaubt, sein Leben würde an der Seite der Isolde Weißhand immerhin weniger trostlos sein, als wenn er es ausschließlich seiner aussichtslosen großen Liebe opfern würde. Diese Tristan-Episode interpretiert Gottfried also von jener idealen Liebe her als einen Sündenfall: Weltliches durchschnittliches Denken und Begehren überwältigt den mystisch-idealen Liebhaber. Nach dem „Zweifler Marke“ ist Tristan nun selbst zum Zweifler geworden, der zerrissen ist zwischen seiner unsterblichen Liebe, die ihm nur noch Leid und keine Erfüllung mehr gewährt, und seiner Sehnsucht nach einem normalen, glücklichen Leben, das ihm scheinbar durch die andere Isolde verheißen wird, und so endet das bedeutendste fragment deutscher Dichtung mit der Klage Tristans: nu ruochet si mîn kleine, die ich minn’ unde meine mê danne sêle unde lîp. durch si mîd’ ich al ander wîp und muoz ir selber ouch enbern. ine mac von ir niht des gegern, daz mir zer werlde solte geben fröude unde frôlîchez leben. (V.19545-19552) Sie wird jetzt wohl kaum noch an mich denken, die ich mehr liebe und die ich mehr schätze als Leib und Seele. Ihretwegen meide ich alle anderen Frauen, obgleich ich nicht einmal sie selbst besitze. Sie kann mir nicht das schenken, was mir auf dieser Welt freude und ein fröhliches Leben bescheren könnte. Das sind die letzten Worte des Gottfried-Textes, die für die Deutung des folgenden einen Fingerzeig geben: Tristan kämpft mit der Versuchung, sich unter das Niveau seiner großen Liebe zu verirren, in eine Region der freude und des fröhlichen Lebens, wie alle Welt es liebt, er, dessen „edelez herze“ zur höchsten Liebe fähig ist. Die neue ideelle und ästhetische Dimension des Werkes Der Aspekt der Gesellschaftskritik verbindet alle Gipfelwerke der feudalklassischen Literatur vom „Nibelungenlied“ über Wolframs Epik und „Reinhart Fuchs“ bis hin zum „Tristan“ und zu Walthers politischer Lyrik. Gesellschaftskritik ist dem Tristanstoff von vornherein immanent, wenngleich in den verschiedenen Bearbeitungen mit sehr unterschiedlicher Akzentuierung und Gewichtung vorgetragen: Trotz pointierter Hofkritik der „Tristrant“-Fassungen Eilharts und Berouls und der pessimistischen Grundhaltung der Thomas-Version als Gegenentwurf zum Optimismus der höfischen Ideologie stellt Gottfrieds Dichtung in der Auseinandersetzung mit den feudalen materiellen und geistigen Institutionen, vor allem mit Ethos und Mentalität feudaladliger Gesellschaftsnormen und Herrschaftsstrukturen, den absoluten Höhepunkt der literarischen Entwicklung dar, der durch die fortsetzer Ulrich von Türheim und Heinrich von Freiberg dann wieder entscheidende gesellschaftsopportune Entschärfung und Einebnung erfährt. Gottfried entwickelt die aktuell-gesellschaftskritische und zugleich zukunftsweisende ideologische Dimension seiner Dichtung pointierter als sonst üblich über die Handlungsebene hinaus auf die Ebene des Kommentars, die von attributiven Kurzerläuterungen über zahlreiche Autorbemerkungen bis zu den großen Exkursen wie Prolog, Literaturschau, Minnebußpredigt, huote-Exkurs und Minnegrottenallegorese reicht. Nichts wäre indessen problematischer und der poetischen Intention inadäquater, als beide Ebenen auseinanderzudividieren und etwa einen „Kommentator“ Gottfried gegen einen „Epiker“ bzw. „Übersetzer“ Gottfried auszuspielen, wie dies in der Forschung immer wieder geschehen ist, denn Handlung und Kommentar sind über die hochentwickelte Kunstform der Sprache als Sprachmagie zu einer Einheit neuer Qualität vernetzt, die erst die quasireligiöse, quasimystische Einheit von Autor, Werk und Publikum als Kommunionsgemeinschaft der „edlen Herzen“ schafft, eine Art verschwörerischer Gemeinschaft der Liebenden gegen die Institutionen und Normen der Gesellschaft, vergleichbar der „coniuratio“, dem einigenden Schwurverband der stadtbürgerlichen Kommuneglieder gegen die feindliche feudalaristokratische Umwelt. Aus solcher revolutionär gegen das ethisch-ideologische Herrschaftssystem feudaler Normen gerichteten Denkweise erklärt sich die Aufforderung zur Akzeptierung des Leides als eines notwendigen Opfers zur Durchsetzung der als gut und richtig erkannten Zielstellungen. Die Liebe erscheint hier als das emotional packendste und rational überzeugendste und für jedermann nachvollziehbare paradigmatische Beispiel dafür, daß die Überbaustrukturen des herrschenden Gesellschaftssystems den natürlichen Interessen des Individuums widersprechen, und der „Tristan“ entwickelt den weltliterarischen Prototyp dieses Konflikts. Das rebellierende Individuum ist insofern tatsächlich ein revolutionärer Typ, als es ganz neue, in ihrem Wesenskern unritterliche und unaristokratische Eigenschaften und Verhaltensweisen präsentiert und repräsentiert: an die Stelle zentraler Kampfbewährung tritt die Überlegenheit der intellektuellen Leistung, an die Stelle öffentlicher Hofesfreude die Zweierintimität der Minnegrotte, an die ritterliche Zielvorstellung der Erwerbung von Frau und Landesherrschaft tritt der Verzicht auf Herrschaft und „glückliche“ Ehe zugunsten des Individualrechts auf Liebe in gleichberechtigter erfüllter Partnerschaft. Wirklich unglückselig oder gar charakterlich zwielichtig erscheint Tristan nur in Ausnahmemomenten seiner tatsächlich kämpferischen Ritterexistenz, überlegen und vorbildhaft hingegen in seinen dezidiert unaristokratischen Rollen als Kaufmannssohn, Kaufmann, Künstler, Spielmann oder Lehrer. Gegen die typische Veräußerlichung des ritterlich-höfischen Romans mit seiner Freude an prachtvollem Aufwand und seiner Lust an der Beschreibung aristokratischparadiesischen Genußlebens steht die Verinnerlichung der Darstellung und die Konzentration auf die inneren menschlichen Werte, unter denen Bildung und Kunst erst die sensibilisierenden Voraussetzungen für die Liebesfähigkeit als der zentralen Macht im menschlichen Leben bilden. Angesichts der ungewöhnlichen Bedeutung der Kunst - vor allem der Musik - in Gottfrieds Werk hat man sicherlich nicht ganz zu Unrecht von einem Künstlerroman gesprochen, der „Tristan“ ist aber darüber hinausgehend auch ein programmatischer philosophischer Bildungsroman, der auf der Höhe des Wissensstandes seiner Zeit auf exemplarische Weise die Forderung nach einer allseitig gebildeten und sich frei zu entfalten vermögenden Persönlichkeit aufstellt - er ist natürlich auch und vor allem der große europäische Liebesroman, der er gerade dadurch geworden ist, daß er das Erbe des ritterlich-höfischen Genres durch die genannten innovatorischen Komponenten anreichert und zu einer neuen Qualitätsstufe umfunktioniert. Gottfrieds Dichtung trägt deutlich weit in die Zukunft weisende prärenaissancehafte und prähumanistische Züge: besonders ausgeprägt in der diesseitsbezogenen Autonomie des Menschen, im Ideal seiner harmonischen Persönlichkeitsbildung, in der Rezeption der Antike, im Rekurs auf die Rechte des Individuums wie insgesamt in der überragenden Freiheit und Souveränität des Denkens und Gedankenspiels, das einmalig bleibt in der gesamten epischen Literatur des Mittelalters ebenso wie seine zu höchstem ästhetischem Raffinement entwickelte künstlerische Methode und sprachliche Ausdrucksweise. Die sakramentale ideologische Programmatik des neuen Minnemythos als Inkarnation einer im etymologischen Wortsinn neuen sozialen Weltanschauung und eines neuen, nicht auf adliges Geblüt und Rittertum, sondern Bildung, Kunst und „Herzensbildung“ gegründetes Lebens- und Gemeinschaftsgefühls bedarf zu ihrer Verdeutlichung als eines programmatischen ideologischen Entwurfs auch der ideologischen Terminologie, und als solche standen die antike Mythologie und die christliche Theologie zur Verfügung. Es ist nun ebenso unbestritten wie unbestreitbar, daß Gottfried das Vorstellungs- und Ausdruckssystem der christlichen Heilslehre adaptiert und zu einem säkularen Wertsystem umfunktioniert, wobei die Hohelied-Mystik der „unio mystica“ und ihre Auslegungen (etwa durch Bernhards Predigten), die Sakramentaltheologie (als säkulare Eucharistie-Feier der „edelen herzen“) und die progressive Gesinnungsethik und antithetisch-dialektische Denkmethodik Abaelards eine besondere Rolle spielen. Nirgends spiegelt sich das hochentwickelte theoretische und praktische Sprachbewußtsein der Scholastik so wirkungsunmittelbar und originär in der Kunst wie im „Tristan“, nirgends sonst wird die dialektische Einheit des Widersprüchlichen so vollkommen entfaltet, bejaht, ja gefeiert, die dialektische Methode also zum Anschauungs- und Schaffensprinzip erhoben wie durch Gottfried. Dies beginnt mit dem - von der Forschung häufig nicht als Einheit begriffenen - komplizierten Zusammenspiel zwischen glasklarer Rationalität und wirkungsmächtiger Emotionalität, zwischen dem „Gelehrten“ und dem „Künstler“ Gottfried, wie es Gustav Ehrismann genannt hat, und führt über die weltanschauliche Komponente der Bejahung der Einheit von Freude und Leid, Leben und Tod, Kunst und Wirklichkeit bis zu der dialektischantithetischen Aufbereitung des Sprachmaterials in der Spannung zwischen scharfsinnigem sprachlogischem Kalkül und fast eigenwertiger höchster Musikalität der Sprachformgebung. Entsprechend ist die Dichtung von einem dialektischen Struktursystem durchzogen, das sich am auffälligsten in stilistischen Antithesen äußert wie „liebe“ – „leit“ (V.60, 204f., 221 usw.), „leben“ – „tôt“ (V .234f., 237ff., 1505, 1845, 11447 usw.), „übel“- „guot“ (V.1522, 9675 f., 10272ff. usw.), „minne“ – „haz“ (V.829, 878, 13604f., 18031 f. usw.) sowie in den Paradoxen der Oxymora, die sich bis zu charakteristischen Oxymoronketten (wie den zitierten Strophen des Prologs, V.60ff., 11 884ff. usw.) steigern. So wird die „andere“ offizielle feudaladlige Welt der höfischen Gesellschaft (der Welt des Königs Marke) der individuellen Liebes- und Kunstgebildetenwelt der „edelen herzen“ nicht nur kontrastiv gegenübergestellt, sondern in ihrem klischeehaft erstarrten, „verworteten und vernamten“ Begriffs- und Wertesystem (V. 12 289) verfremdend aufgebrochen, um ihre Kritikwürdigkeit zu offenbaren. Andererseits verwirklicht sich der Sinngehalt der Musik, die als wesentliches Lebenselement der Tristan-und-Isolde-Liebe und damit auch der Welt der „edelen herzen“ dargestellt wird, auch formal in der expressiven Musikalität der Verskunst, die an Melodik, an rhythmischer Eleganz und Leichtigkeit schlechthin den Höhepunkt mittelhochdeutscher Klassik darstellt. So fließt die berühmte Süßigkeit des TristanVerses keineswegs aus bloßer formaler Virtuosität, sondern aus gehaltlichem Anlaß, innerer Anteilnahme und leidenschaftlichem Mitempfinden, wobei mit scheinbar müheloser Handhabung schwierigster und ausgefallenster Ausdrucksmöglichkeiten extreme Versinnlichung und Musikalisierung der Sprache und Klangreize von ungekannter Perfektion erreicht werden, die sich vor allem an inhaltlichen Schwerpunktstellen wie dem Prolog, der Literaturschau oder der Minnegrottenszenerie bis zu den quasimythischen Wirkungskräften der Sprachmagie steigern. Realisiert wird dies vor allem durch die Suggestivkraft rhythmischer klanglicher Wiederholung, wobei zu diesem Zweck nahezu alle möglichen Klangstilmittel eingesetzt werden: Lautwiederholungen, Alliterationen, Reime, Binnenreime, Assonanzen, Variationen, Wortwiederholungen, Parallelismen, Anaphern, Wortvariationen, alliterierende Zwillingsformeln und vergleichbare Erscheinungen in oft langen, sich gegenseitig durchschlingenden Klangketten, die dann als Wortspiele auch zugleich Sinneinheiten zusammenfassen können, wie dies in den zitierten Eingangsversen des „Tristan“, zum Beispiel durch das begriffliche Umspielen des Wortes „guot“ mit dem Zweck suggestiver Einstimmung in die Thematik und Haltung zum Kunstwerk geschieht, wobei rational die geforderte enge Relation zwischen Autor, Werk und Publikum virtuos unter dem zentralen Stichwort eingeflochten ist (V. 1-8, siehe oben). Vgl. Zur mittelalterlichen Rhetorik.doc Dieses semantische und musikalische Spiel mit den variierenden Morphem- und Wortwiederholungen führt auch zu zahlreichen sprachschöpferischen Neubildungen wie „gewerldet“ zu „werlt“, „geherzet“ zu „herz“ und zu so kühnen okkasionellen Bildungen wie „gêvet“ zu Êva“ (V. 17965) oder „gîsotet“ zu „Îsot“ (V.19010). Wenn Gottfried anläßlich des „Unsagbarkeitstopos“ seiner berühmten Dichterschau statt des sonst üblichen christlichen Gebets wie bei Wolfram und anderen - die antiken heidnischen Gottheiten der Kunst bittet, ihm aus dem helikonischen Brunnen, aus dem „die Gaben der Sprachkunst und Sinngestaltung fließen, (V. 4866f.), und von dem die Worte herkommen, „die durch das Ohr hindurchklingen und sich in das Herz hineinlachen und die Dichtung durchsichtig machen wie ein erlesenes Juwel“ (V.4898ff.), so erfüllt Gottfried dieses Stilideal in vollendeter Weise. Wie der Hochfeudalismus im Ausbau adliger Landesherrschaft auf der einen Seite und im Emporblühen des Städtewesens und der Urbanität auf der anderen Seite kulminiert, so repräsentieren auch Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg diese beiden Pole ökonomischer und soziokultureller Entwicklung. Für Wolfram von Eschenbach sind Menschen in erster Linie Ritter, und er wird in seinem charakteristischen Ringen um Gott und Welt zum poetischen Utopisten, indem er ein Wunschbild freikirchlicher Lebens- und Kultgestaltung entwirft. Gottfried aber ist an theologischen Metaphysmen im Grunde desinteressiert. Seine Augen sind ganz und gar auf das Erdenleben selbst gerichtet, seine Utopie ist die menschliche Freiheit und optimale Liebes- und Lebenserfahrung, die Bildung zur Voraussetzung hat. Wolfram vermittelt zwischen Artus- und Gralswelt, indem er visionär das Ritterdasein ins Sakrale zu erheben sucht und höfische Idealität mit religiöser überwölbt - Gottfried aber geht den der Wolframschen Synthese entgegengesetzten Weg. Er läßt den alten Begriffs- und Vorstellungsapparat zwar äußerlich bestehen, höhlt ihn aber inhaltlich bis in seine Wurzeln hinein aus, wobei er die Fortentwicklung des Menschlichen zum obersten Wertgesichtspunkt erhebt. Mit der Heiligsprechung der Tristanliebe inauguriert Gottfried eine subjekrive, vital-immanente Liebesethik, die nicht nur Emanzipation von moraltheologischen Gesichtspunkten und sogar deren Umsturz bedeutet, sondern die sich in voller Front auch gegen das Minnewesen richtet, das die Feudalgesellschaft im Dienst ihrer Klassen- und ritterlichen Berufsideologie gezüchtet hatte. Gottfrieds aus intellektuell-urbanem Geist geborene Ablehnung der zentralen ritterlichen Wertbegriffe trifft den ethizistischen Feudalidealismus im Angelpunkt seiner Ideologie. Dieser Leidenschaftsepos zersprengt nicht etwa nur, wie ihm lange zum Hauptvorwurf gemacht wurde, die chistliche Ehemoral, sondern mit großer Wucht auch die feudaladlige Ideologie der höfischen Ehr- und Minnedoktrin. Mit Gottfried von Straßburg, dem kühnsten und liberalsten Dichter seiner Zeit, beginnt der moderne Minne-Mythos, der mit seiner Verinnerlichung, seiner Sehnsucht nach permanenter Ekstase, nach Absolutheit und Auflösung erst durch den Tod über die große WagnerAdaption ungebrochen bis in die Gegenwart reicht. „Tristan und Isolde“ hat eine unsterbliche Modellvorstellung von der Liebe als zentralem Lebenssinn und der Liebe als Passion geschaffen. Gottfrieds Voraussage von der „wirkenden Kraft“ seiner Dichtung hat sich erfüllt. Schon lange vor dem moralischen Verdammungsurteil Eichendorffs und der enthusiastischen Aufnahme und musikalisch kongenialen Adaption Wagners hatte sich Heinrich Heine mit folge den Worten zu Gottfrieds Dichtung bekannt: „Ja, ich muß gestehen, Gottfried von Straßburg, der Verfasser dieses schönsten Gedichts des Mittelalters, ist vielleicht auch dessen größter Dichter, und er überragt noch alle Herrlichkeit des Wolfram v Eschilbach, den wir im ‚Parzival’ und in den Fragmenten des ,Titurel’ so sehr bewundern. Es ist vielleicht jetzt erlaubt, den Meister Gottfried unbedingt zu rühmen und zu preisen. Zu seiner Zeit hat man sein Buch gewiß für gottlos und ähnliche Dichtungen [...] für gefährlich gehalten.“[37]