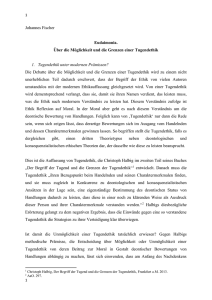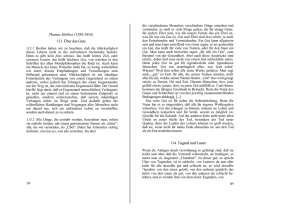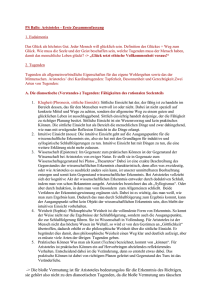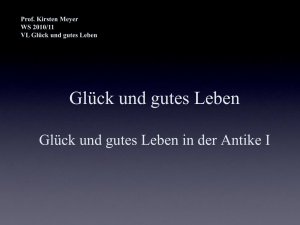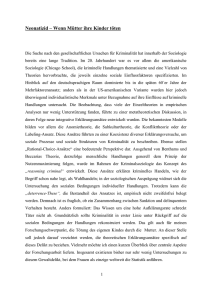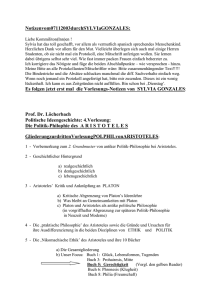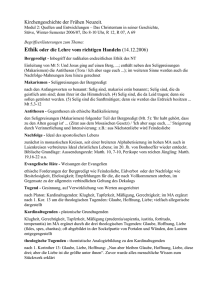Tugendethik1 - Johannes Fischer
Werbung
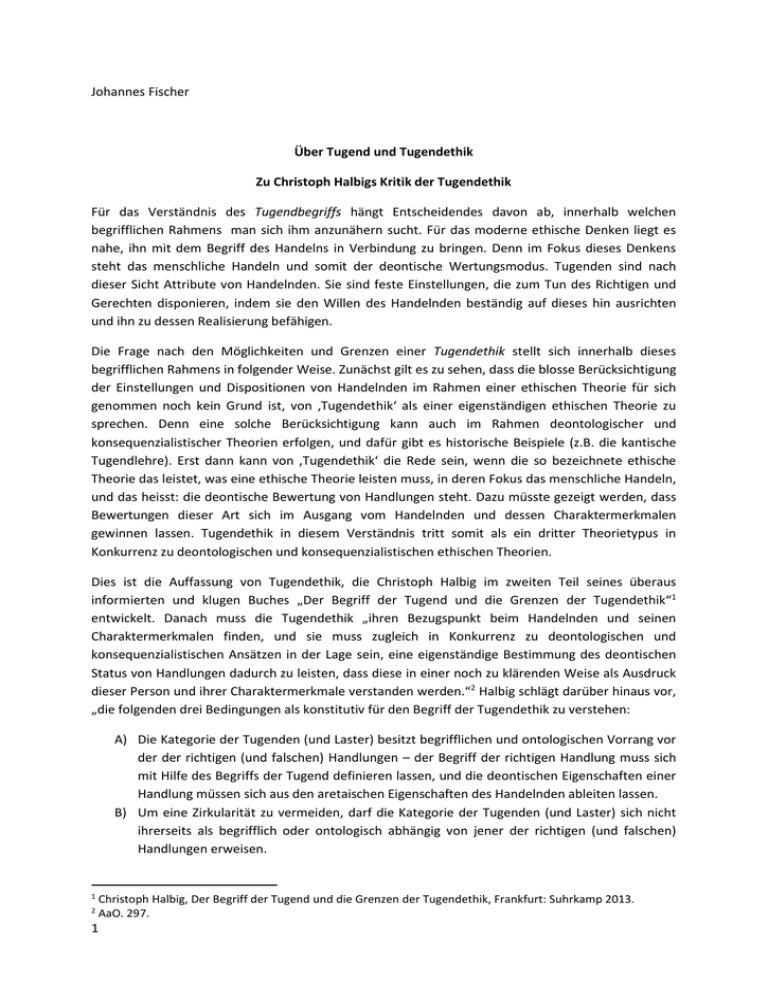
Johannes Fischer Über Tugend und Tugendethik Zu Christoph Halbigs Kritik der Tugendethik Für das Verständnis des Tugendbegriffs hängt Entscheidendes davon ab, innerhalb welchen begrifflichen Rahmens man sich ihm anzunähern sucht. Für das moderne ethische Denken liegt es nahe, ihn mit dem Begriff des Handelns in Verbindung zu bringen. Denn im Fokus dieses Denkens steht das menschliche Handeln und somit der deontische Wertungsmodus. Tugenden sind nach dieser Sicht Attribute von Handelnden. Sie sind feste Einstellungen, die zum Tun des Richtigen und Gerechten disponieren, indem sie den Willen des Handelnden beständig auf dieses hin ausrichten und ihn zu dessen Realisierung befähigen. Die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen einer Tugendethik stellt sich innerhalb dieses begrifflichen Rahmens in folgender Weise. Zunächst gilt es zu sehen, dass die blosse Berücksichtigung der Einstellungen und Dispositionen von Handelnden im Rahmen einer ethischen Theorie für sich genommen noch kein Grund ist, von ‚Tugendethik‘ als einer eigenständigen ethischen Theorie zu sprechen. Denn eine solche Berücksichtigung kann auch im Rahmen deontologischer und konsequenzialistischer Theorien erfolgen, und dafür gibt es historische Beispiele (z.B. die kantische Tugendlehre). Erst dann kann von ‚Tugendethik‘ die Rede sein, wenn die so bezeichnete ethische Theorie das leistet, was eine ethische Theorie leisten muss, in deren Fokus das menschliche Handeln, und das heisst: die deontische Bewertung von Handlungen steht. Dazu müsste gezeigt werden, dass Bewertungen dieser Art sich im Ausgang vom Handelnden und dessen Charaktermerkmalen gewinnen lassen. Tugendethik in diesem Verständnis tritt somit als ein dritter Theorietypus in Konkurrenz zu deontologischen und konsequenzialistischen ethischen Theorien. Dies ist die Auffassung von Tugendethik, die Christoph Halbig im zweiten Teil seines überaus informierten und klugen Buches „Der Begriff der Tugend und die Grenzen der Tugendethik“1 entwickelt. Danach muss die Tugendethik „ihren Bezugspunkt beim Handelnden und seinen Charaktermerkmalen finden, und sie muss zugleich in Konkurrenz zu deontologischen und konsequenzialistischen Ansätzen in der Lage sein, eine eigenständige Bestimmung des deontischen Status von Handlungen dadurch zu leisten, dass diese in einer noch zu klärenden Weise als Ausdruck dieser Person und ihrer Charaktermerkmale verstanden werden.“2 Halbig schlägt darüber hinaus vor, „die folgenden drei Bedingungen als konstitutiv für den Begriff der Tugendethik zu verstehen: A) Die Kategorie der Tugenden (und Laster) besitzt begrifflichen und ontologischen Vorrang vor der der richtigen (und falschen) Handlungen – der Begriff der richtigen Handlung muss sich mit Hilfe des Begriffs der Tugend definieren lassen, und die deontischen Eigenschaften einer Handlung müssen sich aus den aretaischen Eigenschaften des Handelnden ableiten lassen. B) Um eine Zirkularität zu vermeiden, darf die Kategorie der Tugenden (und Laster) sich nicht ihrerseits als begrifflich oder ontologisch abhängig von jener der richtigen (und falschen) Handlungen erweisen. 1 2 Christoph Halbig, Der Begriff der Tugend und die Grenzen der Tugendethik, Frankfurt: Suhrkamp 2013. AaO. 297. 1 C) Die Kategorie der Tugenden (und Laster) erweist sich als i) fundamental und nicht weiter erläuterungsfähig oder ii) als erläuterungsfähig mit Blick auf andere normative Kategorien, ohne dabei jedoch die in A und B genannten Bedingungen zu verletzen.“3 Auf die Probleme und Einwände, mit denen sich eine so definierte Tugendethik konfrontiert sieht, soll hier nicht näher eingegangen werden. Sie werden von Christoph Halbig mit grosser analytischer Präzision und Klarheit erörtert, mit dem Ergebnis, dass die Einwände die Verteidigungsstrategien überwiegen. Im Kern betreffen sie die Frage, ob sich deontische Wertungen von Handlungen überhaupt aus aretaischen Bestimmungen bezüglich des Charakters des Handelnden ableiten lassen. So lassen sich leicht Beispiele beibringen, bei denen wir die Einstellung des Handelnden als tugendhaft – z.B. als grosszügig, mitfühlend usw. –, sein Handeln aber als falsch bewerten. Und umgekehrt können wir eine Handlung als richtig, die Einstellung des Handelnden aber als lasterhaft – z.B. als selbstsüchtig, berechnend – bewerten. Im Folgenden soll es um eine andere Frage gehen, nämlich ob es überhaupt angemessen ist, den Begriff der Tugend innerhalb eines begrifflichen Rahmens zu verorten, der durch den Begriff der Handlung dominiert ist. Tugenden und Laster sind Gegenstand evaluativer Wertungen. Müsste nicht dasjenige, worin sie nach aussen in Erscheinung treten, etwas sein, das ebenfalls evaluativ statt, wie Handlungen, deontisch zu bewerten ist? Das würde freilich bedeuten, dass es neben Handlungen eine zweite Äusserungsgestalt der Moral gibt, die Gegenstand evaluativer moralischer Bewertungen ist. Um diese Äusserungsgestalt in den Blick zu bekommen, muss geklärt werden, worauf genau sich evaluative moralische Wertungen beziehen. Geht es nach der Standardauffassung, dann sind dies Motive, Dispositionen oder Charakterzüge von Personen.4 Diese Zuordnung evaluativer Wertungen ist die Folge einer Moralauffassung, die einseitig am Begriff des Handelns orientiert ist. Als Gegenstand evaluativer Wertungen bleibt dann nämlich nur dasjenige übrig, was zu Handlungen motiviert oder disponiert. Vordergründig hat die Standardauffassung zweifellos eine grosse Plausibilität. Wenn zwei Personen in zwei gleichen Situationen genau gleich handeln, aber aus unterschiedlichen Motiven, die eine z.B. aus Mitgefühl, die andere aus Berechnung und Habgier, dann treffen wir in Bezug auf ihre Handlungen unterschiedliche evaluative Wertungen, und zwar, wie es scheint, weil wir ihre Motive unterschiedlich bewerten. Also scheint sich die evaluative moralische Bewertung ursprünglich auf Handlungsmotive und von dorther abgeleitet auf die daraus resultierenden Handlungen zu beziehen. Bei genauem Zusehen jedoch stellt sich der Sachverhalt anders dar. Wenn wir etwas, z.B. Mitleid, als ein Motiv thematisieren, dann thematisieren wir es mit Bezug auf eine Handlung, für die es Motiv ist. Abgesehen davon ist Mitleid ein Gefühlszustand, aber kein Motiv. Daher lässt sich ein Motiv nicht separat von der Handlung evaluativ bewerten, für die es Motiv ist. Angenommen, jemand wird gefragt, warum er einem anderen geholfen hat, und er antwortet: „Ich hatte Mitleid mit ihm.“ Diese Äusserung nennt uns das Motiv, dies allerdings nur, wenn sie als Antwort auf die Frage nach dem Warum seines Handelns begriffen wird. Abgesehen davon handelt es sich um die Schilderung eines Gefühlszustands. Wenn wir daher das, was uns diese Antwort zu verstehen gibt, evaluativ als gut bewerten, dann ist dasjenige, was wir bewerten, nicht, dass er Mitleid mit ihm hatte, sondern 3 AaO. 298. Vgl. z.B. William K. Frankena, Analytische Ethik, 27; 77. Dieter Birnbacher, Analytische Einführung in die Ethik, Berlin 2003, 279ff. Friedo Ricken, Allgemeine Ethik, Stuttgart 42003, 88f. 4 2 dasjenige, was diese Äusserung als Antwort auf die gestellte Frage beinhaltet, nämlich dass er dem anderen aus Mitleid geholfen hat. Wir bewerten also nicht zuerst separat von der Handlung ein Motiv und von dorther abgeleitet die Handlung, sondern wir bewerten sein Handeln aus diesem Motiv, d.h. sein Verhalten. Um dies am Paradebeispiel der christlichen Ethik, nämlich der Samaritererzählung (Luk 10, 30ff) zu verdeutlichen: Was wir darin als moralisch gut bewerten, ist nicht das Mitgefühl des Samariters (dieser könnte Mitgefühl empfinden ohne zu helfen) und nicht sein Handeln (es könnte aus Berechnung und Spekulieren auf Belohnung erfolgen), sondern sein Handeln aus Mitgefühl, d.h. sein barmherziges Verhalten. Während die Rede von Handlungen eine Trennung macht zwischen der Handlung und ihrem Motiv (weshalb der Ausdruck ‚barmherziges Handeln‘ sich irgendwie schief anhört), ist bei der Rede von barmherzigem Verhalten die Barmherzigkeit essentieller Bestandteil des Verhaltens. Das also ist das Ergebnis dieser Überlegung: Um dasjenige zu kennzeichnen, worin die Moral sich äussert, reicht der Begriff des Handelns nicht aus. Wir benötigen vielmehr zwei Begriffe, den des Handelns und den des Verhaltens, und zwar Letzteren, um den Gegenstand evaluativer moralischer Wertungen zu kennzeichnen. Der Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten korrespondiert eine entsprechende Unterscheidung zwischen Motiven und Dispositionen. Die Rede von Motiven bezieht sich auf Handlungen. Wenn jemand auf die Frage, warum er etwas Bestimmtes getan hat, zur Antwort gibt, dass er eifersüchtig war, dann nennt er damit sein Motiv. Sein Handeln aus diesem Motiv lässt sich als ‚eifersüchtiges Verhalten’ beschreiben. Die Erklärung für dieses Verhalten besteht nun nicht wiederum in einem Motiv, sondern in seiner Eifersucht als einer Verhaltensdisposition. Ersichtlich kommt der Unterscheidung zwischen Motiven und Dispositionen gerade im Blick auf die Rede von Tugenden entscheidende Bedeutung zu. Tugenden wie Grosszügigkeit oder Tapferkeit sind nicht Motive für Handlungen, sondern Dispositionen oder Einstellungen in Bezug auf ein entsprechendes Verhalten. Es ist ein solches Verhalten, nicht ein Handeln, in dem sich dasjenige äussert, was durch aretaische Bestimmungen wie grosszügig oder mitfühlend artikuliert wird. Die Unterscheidung zwischen Handeln und Verhalten ist nicht zuletzt von Bedeutung für das Verständnis der Rolle von Emotionen für die Moral. Wird die Moral lediglich mit dem Begriff des Handelns in Verbindung gebracht, dann scheinen Emotionen irgendwie im Inneren des Handelnden als des Ursprungs der Handlung lokalisiert zu sein und von dorther als Motive sein Handeln zu beeinflussen. Demgegenüber treten in emotional bestimmtem Verhalten wie freundlichem, liebevollem oder mitfühlendem Verhalten Emotionen nach aussen in Erscheinung und wirken sich atmosphärisch auf andere aus.5 So kann Zorn als Brüllen, Schleudern von Gegenständen usw. einen Raum füllen. Dieser Sachverhalt ist zweifellos von fundamentaler Bedeutung für das menschliche Zusammenleben, und er ist auch für das Verständnis von Tugenden von erheblicher Bedeutung. Auch eine Tugend wie die Grosszügigkeit schafft über das Verhalten, in dem sie sich äussert, eine Atmosphäre im Bereich des Zwischenmenschlichen, welche die Emotionen anderer beeinflusst – ein Sachverhalt, der völlig ausserhalb des Blickfelds bleibt, wenn Tugenden lediglich mit dem Begriff des Handelns in Verbindung gebracht werden. Nun wirft das Gesagte natürlich sofort die Anschlussfrage auf, wie man sich das Verhältnis von Handlungen einerseits und Verhalten andererseits denken soll. Geht es hier um eine Alternative 5 Hermann Schmitz, Gefühle als Atmosphären und das affektive Betroffensein von ihnen, in: Hinrich Fink-Eitel/ Georg Lohmann (Hg.), Zur Philosophie der Gefühle, Frankfurt/M. 1993, 33-56. 3 derart, dass wir einerseits handeln und andererseits uns auch noch verhalten können? Diese Frage führt in handlungstheoretische Überlegungen, die hier wenigstens in Umrissen skizziert werden sollen. Will man verstehen, was eine Handlung ist, dann ist die grundlegendste Frage, die hier zu stellen ist, die Frage, wie uns Handlungen gegeben sind. Dazu muss man sich Folgendes vergegenwärtigen: Ob ein Verhalten, das wir an einem anderen Menschen beobachten, eine Handlung oder zum Beispiel nur eine unwillkürliche Körperbewegung ist, das lässt sich mit letzter Bestimmtheit nur klären, indem wir den Betreffenden fragen. Das bedeutet, dass uns Handlungen in der Verständigung über sie gegeben sind. Hierin liegt die entscheidende Differenz zwischen Handlungen und blossen Ereignissen wie etwa Naturereignissen, bei denen es eine solche intersubjektive Verständigungsmöglichkeit nicht gibt. Die konstitutive Bedeutung der Verständigung für das Phänomen des Handelns manifestiert sich vor allem in einem Sachverhalt, der für die Ethik von entscheidender Bedeutung ist, nämlich dass es für Handlungen Gründe und Motive gibt. Gründe und Motive sind nichts anderes als Antworten auf Warum-Fragen. Wir können den Grund einer Handlung nicht anders in Erfahrung bringen als dadurch, dass wir den Betreffenden nach deren Warum fragen, und der Grund ist dasjenige, was uns seine Antwort zu verstehen gibt. In der Tatsache, dass Handlungen Gründe und Motive haben, spiegelt sich die Frage-Antwort-Struktur unseres Verstehens am Leitfaden der Warum-Frage wider. Aus alledem wird deutlich, dass es sich bei dem, was wir als Handlungen thematisieren, um Verständigungskonstrukte handelt. Das meint: Handlungen sind nicht einfach empirische Tatsachen in der Welt, die unabhängig von unserer Verständigung über sie gegeben sind. Sie sind vielmehr etwas, das erst in der Verständigung über sie konstituiert wird. In der Verständigung über Handlungen und deren Gründe und Motive wird eine Struktur über unser Verhalten gelegt, die dieses im Augenblick seines Vollzugs nicht hat. Augenfällig ist dies an spontanem Verhalten. Wer auf der Strasse einem Bekannten spontan zuwinkt, der tut dies nicht intentional ‚aus einem Grund’ im Sinne einer Antwort auf eine vorausgehende Warum-Frage. Denn in diesem Fall wäre das Winken nicht spontan. Aber er kann, wenn man ihn nach dem Warum fragt, einen Grund dafür nennen: „Das ist ein guter Bekannter von mir.“ Nicht zuletzt ist die Handlungsfreiheit an die Perspektive der Verständigung über Handlungen geknüpft. Kant zufolge besteht diese Freiheit in dem Vermögen, eine Reihe von Begebenheiten von selbst anfangen zu können. Frei handelt mithin, wer der Urheber seines Handelns und seiner Folgen ist. Als Urheber seines Handelns aber betrachten wir den, der sein Handeln hinreichend aus Gründen verständlich machen kann, so dass nicht – wie bei unverständlichem Verhalten z.B. aufgrund psychischer Störungen – hinter ihn zurück nach verhaltensbestimmenden Ursachen gefragt werden muss. Handlungsfreiheit manifestiert sich somit in den plausiblen Gründen von Handlungen. In aller Verständigung mit einem anderen über die Gründe seines Handelns ist solche Freiheit unterstellt, und zwar allein dadurch, dass wir uns mit ihm verständigen und ihn nach Gründen fragen, statt uns – wie bei psychischen Störungen – über ihn zu verständigen und sein Verhalten aus Ursachen zu erklären. Es ist dieser Sachverhalt, dass Handlungen Verständigungskonstrukte sind, in welchem die Antwort auf die Frage zu finden ist, wie das Verhältnis zwischen (deontisch bewertetem) Handeln und (evaluativ bewertetem) Verhalten zu denken ist: Was wir in der Verständigung als ein Handeln aus Gründen und Motiven thematisieren, das tritt jenseits der Verständigungsperspektive als ein Verhalten in Erscheinung. Es geht also nicht um eine Alternative derart, dass wir einerseits handeln und uns andererseits auch noch verhalten können. Allem, was wir in der Verständigung als ein 4 Handeln thematisieren, liegt vielmehr ein Verhalten zugrunde, das freilich in solcher Verständigung ausserhalb des Blickfelds und unthematisch bleibt, insofern die Aufmerksamkeit hier ganz auf das Handeln, d.h. auf den Bereich des Deontischen, gerichtet ist. Der Unterschied zwischen Handeln und Verhalten schlägt sich nicht zuletzt in einem charakteristischen Unterschied zwischen deontischen und evaluativen Wertungen nieder. In der Verständigung über Handlungen gemäss der Frage-Antwort-Struktur des Verstehens am Leitfaden der Warum-Frage wird eine Trennung vollzogen zwischen der Handlung und ihrem Grund, als welcher die betreffende Situation thematisch wird. Dies hat für die deontische Wertung zur Folge, dass diese Handlungen relativ zu Situationen bewertet: so zu handeln ist in einer solchen Situation richtig (und in einer anderen falsch). Beim Verhalten hingegen, weil dieses der Verständigungsperspektive mit ihrer Frage-Antwort-Struktur voraus liegt, gibt es eine solche Trennung nicht. Vielmehr haben wir hier immer schon ein Verhalten-in-einer-gegebenen-Situation vor Augen, und dieses ist es, was wir evaluativ bewerten: Sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut. Das moralisch Gute kommt als ein ‚emotional bestimmtes Verhalten in einer gegebenen Situation’ in dem Gesamtzusammenhang zur Anschauung, der in der Verständigung über Handlungen zertrennt wird in die Handlung, ihren Grund in Gestalt der betreffenden Situation sowie ihr Motiv in Gestalt der beteiligten Emotion. Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Verhaltensebene ein fundamentalerer Status für die Moral zukommt als der Ebene des Handelns. Aus dem Urteil, dass eine Handlung relativ zu der gegebenen Situation moralisch richtig ist, lässt sich nicht das Urteil ableiten, dass das korrespondierende Verhalten moralisch gut ist. Denn die Handlung könnte aus unmoralischen Motiven erfolgt sein. Aus dem Urteil hingegen, dass ein Verhalten moralisch gut ist, lässt sich das Urteil ableiten, dass das korrespondierende Handeln moralisch richtig ist. Denn wenn die Bewertung ‚moralisch gut‘ sich immer schon auf ein Verhalten-in-einer-Situation bezieht – ‚sich so in einer solchen Situation zu verhalten ist gut‘ –, dann gehört die Situationsadäquatheit zu den Bedingungen des Gutseins eines Verhaltens. Ersichtlich bewerten wir ein Verhalten nicht als moralisch gut, wenn das korrespondierende Handeln moralisch falsch ist. Lässt sich aus diesem fundamentaleren Status der evaluativ bewerteten Verhaltensebene ein Argument für die Tugendethik ableiten? Wie oben ausgeführt wurde, weist Christoph Halbig einer Tugendethik, die diesen Namen verdient, die Aufgabe zu, „eine eigenständige Bestimmung des deontischen Status von Handlungen dadurch zu leisten, dass diese … als Ausdruck dieser Person und ihrer Charaktermerkmale verstanden werden“. Dazu muss gemäss seinem präzisierenden Vorschlag „die Kategorie der Tugenden (und Laster) … begrifflichen und ontologischen Vorrang vor der der richtigen (und falschen) Handlungen“ besitzen. Folgt man den vorstehenden Überlegungen, dann führt diese Auffassung von Tugendethik in die Irre, und zwar weil es dem Tugendbegriff inadäquat ist, wenn er im Begriffsfeld des Handelns verortet wird. Tugenden manifestieren sich in einem entsprechenden Verhalten. Aber Halbigs Vorschlag lässt sich dahingehend abändern, dass darin das Wort ‚Handeln‘ durch das Wort ‚Verhalten‘ und der Ausdruck ‚deontisch‘ durch den Ausdruck ‚evaluativ‘ ersetzt wird. Aufgabe einer Tugendethik wäre es dann, eine eigenständige Bestimmung des evaluativen Status von Verhalten dadurch zu leisten, dass dieses als Ausdruck dieser Person und ihrer Charaktermerkmale verstanden wird. Die Kategorie der Tugenden und Laster müsste dazu begrifflichen und ontologischen Vorrang vor der des guten und schlechten Verhaltens besitzen. 5 Ich glaube nicht, dass sich eine solche Konzeption von Tugendethik ernstlich vertreten lässt. Ihr zufolge würde das Gutsein eines Verhaltens aus dem Gutsein der sich-verhaltenden Person und ihrer Charaktermerkmale resultieren. Die entscheidende Frage ist hier, in welchem begrifflichen und ontologischen Verhältnis die Kategorie der Tugend im Sinne einer festen und beständigen Einstellung einer Person zur Kategorie des aretaischen Verhaltens steht. Ersichtlich ist der Begriff der Tugend der Grosszügigkeit über den Begriff des grosszügigen Verhaltens gebildet. Wenn wir jemandem erklären wollen, worin die Tugend der Grosszügigkeit besteht, dann tun wir dies über Beispiele für grosszügiges Verhalten. Und was die Frage des ontologischen Vorrangs betrifft, so ist die Tugend der Grosszügigkeit nur da gegeben, wo sich jemand grosszügig verhält. Umgekehrt aber kann sich jemand aktual grosszügig verhalten, ohne die Tugend der Grosszügigkeit im Sinne einer festen und beständigen Einstellung zu besitzen. Schliesslich besitzt die Kategorie des aretaischen Verhaltens auch einen epistemischen Vorrang vor der der Tugend. Wir erkennen die Grosszügigkeit einer Person an ihrem grosszügigen Verhalten, nicht umgekehrt. Denn wie sollten wir ihre Grosszügigkeit zuerst und unabhängig von ihrem Verhalten erkennen können? Wenn es nun aber so ist, dass die Kategorie des Verhaltens begrifflichen, ontologischen und epistemischen Vorrang vor der Kategorie der Tugend besitzt, dann kann das Gutsein solchen Verhaltens nicht aus der Tugend abgeleitet sein. Vielmehr bezieht sich dann die Bewertung ‚gut‘ ursprünglich und unmittelbar auf dieses Verhalten, und das Gutsein der Tugend ist aus dem Gutsein des betreffenden aretaischen Verhaltens abgeleitet. So werden wir im Falle dessen, der sich aktual grosszügig verhält, ohne die Tugend der Grosszügigkeit zu besitzen, nicht zögern, sein Verhalten – falls es zudem die Bedingung der Situationsadäquatheit erfüllt – als gut zu bewerten. Auf ein anderes Problem, das sich ganz ähnlich da stellt, wo man die deontische Bewertung von Handlungen aus der Tugend abzuleiten sucht, sei hier nur verwiesen. Die Tugend der Grosszügigkeit bewerten wir uneingeschränkt als gut. Grosszügiges Verhalten hingegen ist nicht immer gut. Denn das Gutsein eines Verhaltens steht nach dem Gesagten unter der Bedingung der Situationsadäquatheit. Grosszügiges Verhalten aber kann einer Situation inadäquat sein, wie z.B. da, wo es einen Menschen in Abhängigkeit hält und daran hindert, eine selbstverantwortliche Person zu werden. Würde das Gutsein eines Verhaltens aus der Tugend resultieren, die sich in ihm manifestiert, dann müssten wir auch ein solches situationsinadäquates Verhalten als gut bewerten. Tatsächlich bewerten wir es zwar nicht als moralisch schlecht, aber doch (deontisch) als moralisch falsch, und hierin manifestiert sich die Situationsrelativität der Bewertung, wie sie auch für Handlungen charakteristisch ist. Ein Tugendethiker könnte vielleicht, um dieses Problem auf seine Weise zu lösen, versucht sein, die Bedingung der Situationsadäquatheit in den Begriff der Tugend hineinzunehmen: Der wahrhaft Grosszügige ist nur da grosszügig, wo dies der Situation gemäss ist und er insbesondere anderen mit seiner Grosszügigkeit nicht schadet. Freilich scheint dies mit einer erheblichen Befrachtung des Tugendbegriffs erkauft zu sein. Lautet die Schlussfolgerung aus alledem, dass das Konzept einer Tugendethik als gescheitert angesehen werden muss? Christoph Halbig fordert m.E. zu Recht, dass eine Tugendethik, die diesen Namen verdient, die Bedeutung der Tugenden für die Moral in einer Weise einsichtig machen muss, die nicht auf andere Begriffe wie z.B. den Begriff des menschlichen Gedeihens zurückgreift. Wer die Bedeutung von Tugenden über diesen Begriff erläutert, der vertritt in Wahrheit nicht eine tugendethische, sondern eine konsequenzialistische Position. Halbig spricht diesbezüglich von 6 Charakterkonsequenzialismus.6 Tugenden sind dann wichtig, weil sie gute Konsequenzen haben, sei es für das Leben des einzelnen oder für die menschliche Gemeinschaft. Doch lässt sich die Bedeutung von Tugenden für die Moral ohne Rekurs auf derartige – dann moralisch fundamentalere – Kategorien einsichtig machen? Man muss m.E. zu Aristoteles zurückgehen, um eine Antwort auf diese Frage zu finden. Sein Denken bewegt sich in einem völlig anderen begrifflichen Rahmen als das moderne ethische Denken. Leitend ist eine teleologische Wirklichkeitsauffassung, die an der Worumwillen-Frage, d.h. an der Frage nach dem Telos einer Sache oder Tätigkeit orientiert ist, im Unterschied zur modernen Wirklichkeitsauffassung, die – von den Naturwissenschaften bis hin zum Verständnis des menschlichen Handelns – durch die Warum-Frage dominiert ist. Dabei ist das jeweilige Telos der betreffenden Sache oder Tätigkeit inhärent, so dem Samenkorn das Telos der entwickelten Pflanze oder dem Sattlerhandwerk das Telos des fertigen Sattels. Hieraus ist die Fragestellung der aristotelischen Ethik abgeleitet: Ist auch dem menschlichen Leben von Natur ein Telos eingeschrieben, auf das hin es ausgerichtet ist, und wenn ja, worin besteht es. Das Wort, mit dem Aristoteles dieses Telos bezeichnet, heisst Eudaimonia. Zumeist wird es mit ‚Glück‘ oder ‚Wohlergehen‘ übersetzt. Es ist diese Übersetzung, die – zumal wenn mit ihr das moderne Glücksverständnis assoziiert wird – eine Interpretation der aristotelischen Auffassung der Tugenden im Sinne des besagten Charakterkonsequenzialismus nahe legt. Die Bedeutung der Tugenden liegt dann darin, dass sie das Glück bzw. Wohlergehen sowohl des einzelnen als auch des Haushalts, der Oikonomia, als auch der Polis fördern. Ob diese Übersetzung zutreffend ist, wird noch zu fragen sein. Zuvor soll in Erinnerung gerufen werden, wie Aristoteles bei der Entwicklung seiner ethischen Konzeption vorgeht und wie er zum Begriff der Tugenden gelangt. Nachdem die Eudaimonia als das letzte und oberste Ziel des menschlichen Strebens benannt ist, schliesst sich nicht etwa die Frage an, worin die Eudaimonia besteht oder wie sie erreicht werden kann, um auf diesem Wege zur Tugend zu gelangen. Bei einem solchen Vorgehen würde die Bedeutung der Tugenden aus dem ethisch fundamentaleren Begriff der Eudaimonia abgeleitet. Vielmehr kehrt Aristoteles zu der Ausgangsfrage nach dem obersten dem Menschen bestimmten Telos zurück, um von dorther den Weg zu den Tugenden zu bahnen. Einen ersten gedanklichen Zwischenschritt bildet die Unterscheidung zwischen Poiesis, d.h. einer Tätigkeit, die ihr Ziel ausserhalb ihrer selbst hat, und Praxis, d.h. einer Tätigkeit, die ihr Ziel in sich selbst hat. Das oberste dem Menschen bestimmte Telos kann nicht Resultat oder Produkt einer Poiesis sein; denn wäre es dies, dann könnte weitergefragt werden nach dem Worumwillen dieses Produkts, und es würde sich nicht um ein oberstes Telos handeln. Also muss es sich beim obersten dem Menschen bestimmten Telos um ein solches handeln, das einer Praxis inhärent ist. (Vergegenwärtigt man sich, dass Aristoteles dieses Telos Eudaimonia nennt, dann zeigt sich bereits hier ein entscheidender Unterschied zum Glücksverständnis der Moderne, wie es etwa im Utilitarismus begegnet, dem zufolge Glück durch Handeln bewirkt werden kann.) Die weitere Bestimmung dieses Telos erfolgt über den Gedanken, dass es sich um ein Telos handeln soll, dass von Natur dem Menschen als Menschen bestimmt ist. Also muss es mit dem zu tun haben, was den Menschen vor allen anderen Entitäten auszeichnet, und das ist die Vernunft. Das oberste Telos des Menschen muss folglich in einer Praxis bestehen, die durch die Vernunft bestimmt ist. Dies nun führt zu der Anschlussfrage, in welcher Weise die Vernunft die menschliche Lebenspraxis bestimmen und 6 Halbig, aaO. 303. 7 prägen kann. Die Antwort hierauf ist: über die – dianoetischen und ethischen – Tugenden. Folglich ist das oberste dem Menschen bestimmte Telos ein Leben gemäss den Tugenden. Gemäss dieser Herleitung liegt also die Bedeutung der Tugenden nicht darin, dass sie den Menschen glücklich machen oder das allgemeine Wohl befördern, sondern darin, dass sich in ihnen die mit seiner Natur gegebene Bestimmung des Menschen verwirklicht. Was hat das dann aber mit Eudaimonia zu tun? Im Grunde gibt Aristoteles zwei Antworten auf die Frage nach dem obersten dem Menschen bestimmten Telos. Die eine lautet: Eudaimonia. Die andere lautet: vernunftgemässe Lebensführung, die sich in den Tugenden verwirklicht. Beides zusammengenommen ergibt: Wo die Vernunft in Gestalt der Tugenden herrscht, da ist Eudaimonia. Die Eudaimonia besteht hiernach nicht etwa in den Konsequenzen, die eine vernunftgemässe Lebensführung zeitigt, wie Glück oder Wohlergehen. Sie ist vielmehr mit der Herrschaft der Vernunft selbst gegeben. Genau hier liegt die Schwierigkeit der Interpretation: Inwiefern soll diese Herrschaft in Gestalt der Tugenden gleichbedeutend mit Eudaimonia sein, wenn dies nicht aus irgendwelchen Folgewirkungen wie Glück oder Zufriedenheit hergeleitet werden kann, die diese Herrschaft hat? Was meint der Ausdruck ‚Eudaimonia‘? Die Antwort dürfte wohl darin zu suchen sein, dass für Aristoteles und seine antiken Leser bei dem Wort ‚Eudaimonia‘ noch dessen Ursprungsbedeutung mitgeklungen hat: einen guten Dämon haben. Wo die Vernunft herrscht, da steht das menschliche Leben und Zusammenleben gewissermassen unter einem guten Dämon. Das Gemeinsame der beiden Antworten auf die Frage nach dem obersten dem Menschen bestimmten Ziel liegt dann darin, dass es sich beidemal um etwas handelt, das bestimmenden Einfluss auf das menschliche Leben hat, die Vernunft vermittels der Tugenden einerseits und die Eudaimonia in dem soeben erläuterten Sinne andererseits. Weil beide Antworten derselben Frage gelten, wird beides miteinander identifiziert, und der aufklärerische Impetus der aristotelischen Ethik zeigt sich in dieser Gleichsetzung: Eudaimonia ist da, wo die Vernunft bestimmenden Einfluss auf das menschliche Leben hat. Wird die Eudaimonia in dieser Weise begriffen, dann hat dies eine wichtige Konsequenz. Sie ist dann nicht ein Zustand, in dem sich ein Mensch oder eine menschliche Gemeinschaft befindet, der gegeben oder nicht gegeben sein kann, so wie dies das Glück im modernen Verständnis ist. Sie ist vielmehr etwas, das wie eine numinose Wirklichkeit anwesend oder abwesend sein, sich mitteilen oder sich entziehen und verbergen kann, im Leben eines einzelnen Menschen wie im Leben eines Gemeinwesens. Der Zusammenhang zwischen der Eudaimonia und der Herrschaft der Vernunft in Gestalt der Tugenden besteht dann darin, dass Letztere die Gegenwart der Eudaimonia verbürgt (wobei allerdings Aristoteles einschränkend hinzufügt, dass die Eudaimonia auch von günstigen äusseren Lebensumständen abhängig ist). Einen Hinweis darauf, dass diese Interpretation der Eudaimonia im Sinne einer quasi-numinosen Realität nicht abwegig ist, gibt eine Stelle in der Nikomachischen Ethik, an der Aristoteles selbst einen Bezug zur mythischen Wirklichkeitsauffassung herstellt, freilich um postwendend den Gedanken, dass sich die Eudaimonia den Göttern verdankt, aus dem Gebiet der Ethik zu verbannen: „Daraus erwächst nun auch die Frage, ob man die Eudaimonia erlangen kann durch Lernen oder Gewöhnen oder sonstwie durch Übung oder ob die Eudaimonia uns zuteil wird durch eine Gabe der Gottheit oder etwa gar durch Zufall. Wenn es nun überhaupt ein Geschenk der Götter an die Menschen gibt, so kann folgerichtig auch die Eudaimonia eine Gabe der Gottheit sein und zwar umso eher, als sie unter den menschlichen Gütern das wertvollste ist. Die Antwort darauf gehört allerdings mehr in eine andere Untersuchung. Doch ist soviel klar: selbst wenn uns die Eudaimonia nicht von den Göttern 8 gesandt wird, sondern durch ethisches Handeln und in gewisser Weise durch Lernen und Üben zuteil wird, so gehört sie doch zu den göttlichsten Gütern.“ Dass Aristoteles überhaupt diesen Bezug herstellt, weist darauf hin, dass ihm die mythische Konnotation des Ausdrucks ‚Eudaimonia‘ bewusst gewesen ist. Aristoteles weist an dieser Stelle die Meinung, dass die Eudaimonia eine Gabe der Götter oder der Gottheit ist, nicht ausdrücklich zurück. Aber er stellt klar, dass in einer ethischen Untersuchung zu diesem Thema die Götter aus dem Spiel bleiben müssen. Denn in einer solchen Untersuchung geht es um den Beitrag, den der Mensch selbst durch Übung und Gewöhnung, d.h. durch die Aneignung von Tugenden, leisten kann. Oben wurde gesagt, dass die Eudaimonia nicht in den Konsequenzen besteht, die eine vernunftgemässe Lebensführung zeitigt, wie Glück oder Wohlergehen, sondern dass sie mit der Herrschaft der Vernunft selbst gegeben ist. Das bleibt richtig, aber es bedarf nach den Ausführungen über den Anwesenheitscharakter der Eudaimonia einer Präzisierung. Wenn man von den Konsequenzen einer vernunftgemässen Lebensführung spricht, dann vollzieht man eine Trennung zwischen Ursache und Wirkung, zwischen der Lebensführung einerseits und dem, was sie bewirkt, andererseits. Anwesenheit steht in einer anderen Beziehung zu dem, was sie bewirkt, und zwar insofern sie dieses mit sich selbst kontaminiert, d.h. zu etwas macht, worin sie selbst ist, begegnet, sich manifestiert.7 So sehr daran festzuhalten ist, dass die Eudaimonia nicht in den Konsequenzen besteht, die eine vernunftgemässe Lebensführung zeitigt, so sehr gilt doch nun auch, dass die Gegenwart der Eudaimonia in eben diesen Konsequenzen – dem Wohlergehen des einzelnen wie dem des Gemeinwesens – gegenwärtig ist und erfahren wird. Hieraus erklärt es sich, dass der Bedeutungsgehalt des Ausdrucks ‚Eudaimonia‘ diese Konsequenzen mitumfasst, was – zumal für das moderne Bewusstsein – die Übersetzung mit ‚Glück‘ oder ‚Wohlergehen‘ nahe legt, woraus dann freilich das Missverständnis resultieren kann, dass die Eudaimonia in dem besteht, worin sie doch lediglich anwesend ist, ohne darin aufzugehen. Um zusammenzufassen: Folgt man der hier vorgeschlagenen Interpretation, dann sind Tugenden nicht Mittel zum Erreichen der Eudaimonia. Vielmehr sind sie Garanten der Gegenwart der Eudaimonia. Wo immer die Tugend das menschliche Wollen und Trachten lenkt, da herrscht Eudaimonia, sei es im Leben des einzelnen oder im Haushalt, der Oikonomia, oder in der Polis. Es ist nach dieser Sicht gerade nicht das Glück oder das Wohlergehen, worin die Eudaimonia besteht. Vielmehr sind Glück und Wohlergehen Manifestation der Gegenwart der Eudaimonia. Das blosse Streben nach Glück und Wohlergehen als letztem Ziel, wie es in der Moderne durch den Utilitarismus postuliert wird, verfehlt nach dieser Sicht gerade das dem Menschen bestimmte Telos. Und ebenso tut dies eine Auffassung von Tugenden, die diesen lediglich einen instrumentellen Wert im Blick auf das Erreichen von Gütern wie Glück und Wohlergehen zuerkennt. Die Tugend hat ihre Bedeutung in sich selbst. In ihr liegt die mit seiner Natur gegebene Bestimmung des Menschen, deren Realisierung zugleich die Gegenwart der Eudaimonia im Leben des einzelnen wie der Gemeinschaft verbürgt. Von diesem Ausgangspunkt aus erschliesst sich für die aristotelische Ethik das gesamte Feld der menschlichen Lebenspraxis. Wie dem menschlichen Leben insgesamt, so ist auch dem menschlichen Handeln und Verhalten von Natur das Telos der Eudaimonia bestimmt, und es realisiert dieses Telos, indem es den Tugenden gemäss ist. Deren oberste ist die Tugend der Gerechtigkeit, der Aristoteles alle anderen Tugenden zu- und unterordnen kann, insofern diese mit der Gerechtigkeit deren 7 Kurt Hübner verdeutlicht dieses Phänomen anhand einer Fülle von Beispielen für die Präsenz der mythischen Götter. Vgl. ders., die Wahrheit des Mythos, München: C.H.Beck, 1985. 9 entscheidendes Merkmal teilen, nämlich – zumindest immer auch – pros heteron, d.h. auf den anderen gerichtet zu sein, da sie zur Eudaimonia der Gemeinschaft beitragen. Im Rahmen dieses Verständnisses der Tugenden würde Aristoteles wohl tatsächlich die Auffassung vertreten, dass der wahrhaft Grosszügige sich nicht so verhalten kann, dass er anderen mit seiner Grosszügigkeit schadet; denn sein Verhalten wäre dann nicht wirklich pros heteron gerichtet. Es dürfte mit den vorstehenden Ausführungen deutlich geworden sein, dass zwischen der aristotelischen Tugendethik und dem modernen ethischen Denken Welten liegen. Das betrifft insbesondere das an der Warum-Frage orientierte Begründungsdenken – „Warum tugendhaft sein?“; „Warum überhaupt moralisch sein?“ –, das für die moderne Ethik charakteristisch ist. Der aristotelischen Ethik ist ein solches Denken völlig fremd, weil sie nicht an der Warum-Frage orientiert ist. Wichtiger noch dürfte etwas anderes sein, will man die Differenz zwischen aristotelischem Denken und dem Denken der Moderne markieren. Wenn die vorstehende Interpretation zutreffend ist, dann manifestiert sich Eudaimonia im Modus der Präsenz. Auf die Polis bezogen erweist sie sich als präsent in einem durch die Tugenden (und die Gesetze) geordneten friedlichen und verträglichen Miteinander der Bürger. Wir würden diesen Präsenzcharakter umgangssprachlich vielleicht so ausdrücken, dass wir von einem ‚guten Geist‘ oder einer ‚guten Atmosphäre‘ sprechen, die in einem Gemeinwesen herrscht, und dieser atmosphärisch ausstrahlende, auf die Gefühle anderer einwirkende, z.B. Bewunderung hervorrufende Charakter der Tugend ist bei Aristoteles mit Händen zu greifen. Die Eudaimonia ist abwesend, wo immer ein Gemeinwesen durch die ungezügelten Leidenschaften seiner Bürger wie Habsucht, Neid oder Machtstreben zerrüttet wird und zerfällt. Was das antike Bewusstsein solchermassen als Präsenz erlebt, das wird im modernen Denken subjektiviert. Das zeigt sich am Glücksverständnis der Moderne, für das Glück eine subjektive Gefühlszuständlichkeit ist. Dieses Verständnis liegt dem Glücksutilitarismus zugrunde. Setzt man die aristotelische Eudaimonia fälschlicherweise mit diesem Glücksverständnis gleich, dann läuft dies, wie gesagt, zwangsläufig auf eine Interpretation der aristotelischen Tugendlehre im Sinne des Charakterkonsequenzialismus hinaus. Tugenden sind dann wichtig, weil sie dazu beitragen, Menschen subjektiv glücklich zu machen, sei es die Tugendhaften selbst oder ihre Mitmenschen. Die ganze am modernen Glücksverständnis orientierte Debatte darüber, ob und inwiefern Tugenden glücklich machen,8 hat mit der aristotelischen Tugendlehre nichts zu tun. Man kann sich den Unterschied zwischen der aristotelischen Eudaimonia einerseits und Glück im modernen Sinne andererseits an dem Verhältnis verdeutlichen, in dem beides zum ‚guten Leben‘ steht. Für das moderne Verständnis ist ein gutes Leben ein solches, in welchem möglichst viel Glück und möglichst wenig Leid erfahren wird. Für das aristotelische Verständnis verwirklicht sich demgegenüber umgekehrt die Eudaimonia in einem guten Leben gemäss den Tugenden (wobei Aristoteles der Meinung war, dass die Eudaimonia sich erst im Ganzen eines Lebens zeigt). Das Wort ‚gut‘ im Ausdruck ‚gutes Leben‘ hat jeweils unterschiedliche Bedeutung, im modernen Verständnis eine aussermoralische, insofern sie sich hier auf Glück und Leid bezieht, im aristotelischen Verständnis hingegen eine moralische bzw. ethische, insofern es um ein Leben gemäss den Tugenden geht. Was folgt aus alledem? Man könnte sagen: Die Wirklichkeit des antiken Menschen ist eine andere als die Wirklichkeit des Menschen der Moderne. Daher hat die aristotelische Tugendlehre uns Heutigen nichts mehr zu sagen. Man könnte aber auch sagen: Die Wirklichkeit des Menschen der Moderne ist zumindest insoweit nicht anders als die des antiken Menschen, als auch der Mensch der Moderne 8 Vgl. Halbig aaO. 242ff. 10 ähnliche Erfahrungen von Präsenz macht: in der Erfahrung eines gedeihlichen menschlichen Miteinanders; in der atmosphärischen Ausstrahlung emotional bestimmten Verhaltens wie grosszügigen, freundlichen, liebevollen oder mitfühlenden Verhaltens; in Gestalt des Geistes einer Begegnung oder einer Freundschaft (die für Aristoteles so zentral war); aber auch in Gestalt der Präsenzerfahrung einer schweren Erkrankung9. Doch sobald er darüber nachzudenken beginnt, kommt dem Menschen der Moderne diese Präsenz abhanden, bzw. sie verwandelt sich ihm in subjektive Gefühlszustände, oder in Handlungen, d.h. Verständigungskonstrukte (anstelle von Verhaltenspräsenz mit ihrer atmosphärischen Ausstrahlung; diese schrumpft zu Handlungsmotiven, Handlungsdispositionen und handlungsrelevanten Charakterzügen von Personen zusammen), oder, wie im Beispiel der Erkrankung, in somatische oder psychische Zustände. Im modernen Denken vollzieht sich eine Vergegenständlichung der Wirklichkeit, die deren Präsenz in die Latenz abdrängt. Dies wirkt sich nach dem Gesagten nicht zuletzt auf das Verständnis der Tugend aus. Auch sie verliert ihren Präsenzcharakter und wird zu einer Eigenschaft von Handelnden, und da Ethik nach moderner Auffassung die Aufgabe hat, deontische Bewertungen von Handlungen zu begründen, scheint nach dieser Sicht die Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit und nach den Grenzen einer Tugendethik einzig und allein davon abzuhängen, ob überhaupt und inwieweit sich deontische Bewertungen von Handlungen aus aretaischen Bestimmungen bezüglich des Charakters des Handelnden ableiten lassen. 9 Johannes Fischer, Krankheit und Spiritualität, in: Schweizerische Ärztezeitung, 2012;93 (45): 1672-5. 11