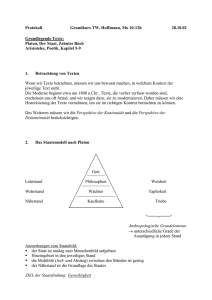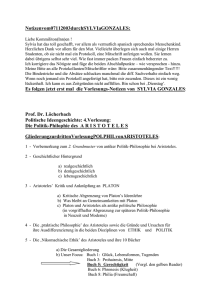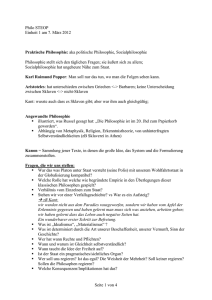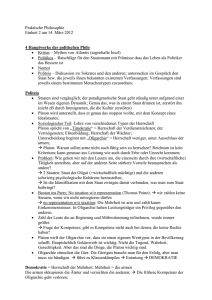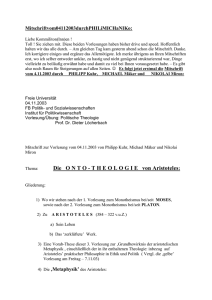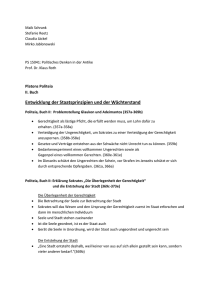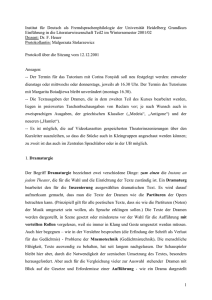Darstellung, Anordnung und implizite Schlussfolgerung. Über das
Werbung
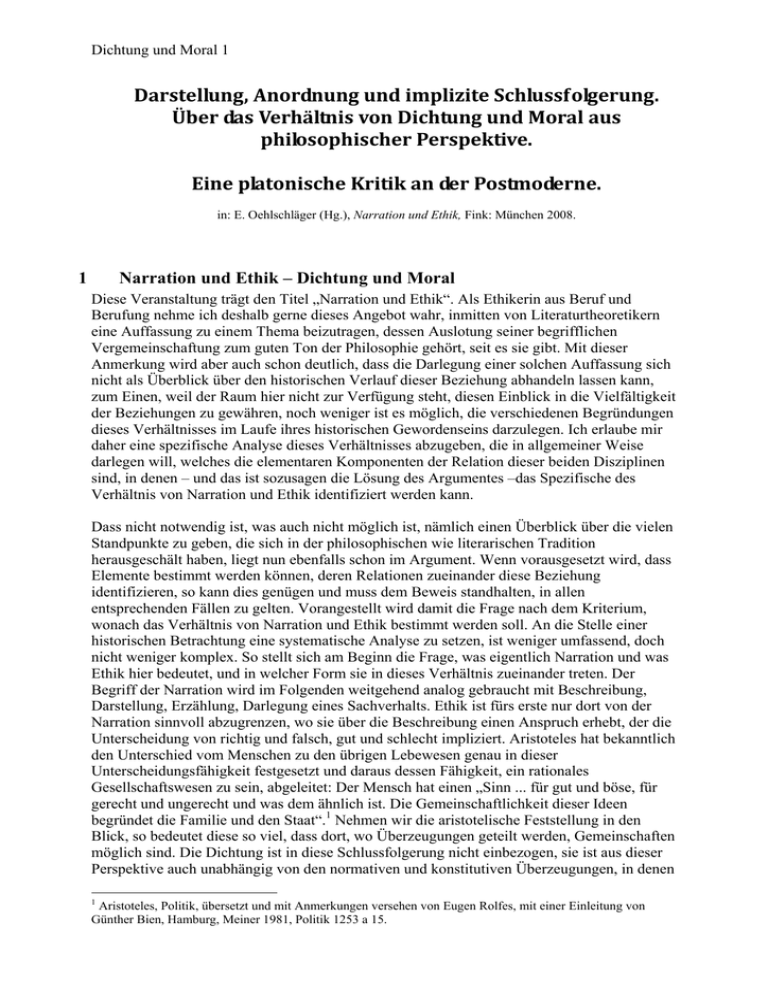
Dichtung und Moral 1 Darstellung, Anordnung und implizite Schlussfolgerung. Über das Verhältnis von Dichtung und Moral aus philosophischer Perspektive. Eine platonische Kritik an der Postmoderne. in: E. Oehlschläger (Hg.), Narration und Ethik, Fink: München 2008. 1 Narration und Ethik – Dichtung und Moral Diese Veranstaltung trägt den Titel „Narration und Ethik“. Als Ethikerin aus Beruf und Berufung nehme ich deshalb gerne dieses Angebot wahr, inmitten von Literaturtheoretikern eine Auffassung zu einem Thema beizutragen, dessen Auslotung seiner begrifflichen Vergemeinschaftung zum guten Ton der Philosophie gehört, seit es sie gibt. Mit dieser Anmerkung wird aber auch schon deutlich, dass die Darlegung einer solchen Auffassung sich nicht als Überblick über den historischen Verlauf dieser Beziehung abhandeln lassen kann, zum Einen, weil der Raum hier nicht zur Verfügung steht, diesen Einblick in die Vielfältigkeit der Beziehungen zu gewähren, noch weniger ist es möglich, die verschiedenen Begründungen dieses Verhältnisses im Laufe ihres historischen Gewordenseins darzulegen. Ich erlaube mir daher eine spezifische Analyse dieses Verhältnisses abzugeben, die in allgemeiner Weise darlegen will, welches die elementaren Komponenten der Relation dieser beiden Disziplinen sind, in denen – und das ist sozusagen die Lösung des Argumentes –das Spezifische des Verhältnis von Narration und Ethik identifiziert werden kann. Dass nicht notwendig ist, was auch nicht möglich ist, nämlich einen Überblick über die vielen Standpunkte zu geben, die sich in der philosophischen wie literarischen Tradition herausgeschält haben, liegt nun ebenfalls schon im Argument. Wenn vorausgesetzt wird, dass Elemente bestimmt werden können, deren Relationen zueinander diese Beziehung identifizieren, so kann dies genügen und muss dem Beweis standhalten, in allen entsprechenden Fällen zu gelten. Vorangestellt wird damit die Frage nach dem Kriterium, wonach das Verhältnis von Narration und Ethik bestimmt werden soll. An die Stelle einer historischen Betrachtung eine systematische Analyse zu setzen, ist weniger umfassend, doch nicht weniger komplex. So stellt sich am Beginn die Frage, was eigentlich Narration und was Ethik hier bedeutet, und in welcher Form sie in dieses Verhältnis zueinander treten. Der Begriff der Narration wird im Folgenden weitgehend analog gebraucht mit Beschreibung, Darstellung, Erzählung, Darlegung eines Sachverhalts. Ethik ist fürs erste nur dort von der Narration sinnvoll abzugrenzen, wo sie über die Beschreibung einen Anspruch erhebt, der die Unterscheidung von richtig und falsch, gut und schlecht impliziert. Aristoteles hat bekanntlich den Unterschied vom Menschen zu den übrigen Lebewesen genau in dieser Unterscheidungsfähigkeit festgesetzt und daraus dessen Fähigkeit, ein rationales Gesellschaftswesen zu sein, abgeleitet: Der Mensch hat einen „Sinn ... für gut und böse, für gerecht und ungerecht und was dem ähnlich ist. Die Gemeinschaftlichkeit dieser Ideen begründet die Familie und den Staat“.1 Nehmen wir die aristotelische Feststellung in den Blick, so bedeutet diese so viel, dass dort, wo Überzeugungen geteilt werden, Gemeinschaften möglich sind. Die Dichtung ist in diese Schlussfolgerung nicht einbezogen, sie ist aus dieser Perspektive auch unabhängig von den normativen und konstitutiven Überzeugungen, in denen 1 Aristoteles, Politik, übersetzt und mit Anmerkungen versehen von Eugen Rolfes, mit einer Einleitung von Günther Bien, Hamburg, Meiner 1981, Politik 1253 a 15. Dichtung und Moral 2 eine Familie oder ein Staat sich realisieren. In dieser Interpretation können wir den deskriptiven Zug eines narrativen Textes von einem ethischen Anspruch klar unterscheiden. Die geschichtliche Erfahrung zeigt uns übrigens ein kaum auflösbares Ineinander von Dichtern und Moralisten, Philosophen und Literaten. Platon begann seine Laufbahn als Dichter. In den antiken Tragödien des Aischylos und Sophokles findet sich moralgeschwängerte Erzählung, deren Wirkung zumindesten die philosophische Begriffsanalyse hinter sich lässt. Schiller und Hölderlin sind uns vertraute Dichterdenker, moralisierende Romanciers eines Formats von Leo Tolstoi2 und objektivierende Narrationstechniker wie Gustave Flaubert setzen Maßstäbe objektiven Betrachtungswillens. Moralisten eines Schlages wie Montaigne und Lichtenberg, Autorinnen wie Mary Astell und Margret Cavendish, Olympe de Gouges stehen zwischen Moralanalyse und Literatur. Nicht zu vergessen philosophierende Literat Nietzsche, sie alle reflektieren zeitgenössische Moralauffassungen und provozieren mitunter die philosophische Welt. Es bleibt also zu fragen, was die philosophische Reflektion über Narration und Ethik eruieren will, wenn sie weder die Vielfalt der historischen Analysen dieser und jener Disziplin wiederholen noch multiplizieren will. So soll es hier darum gehen, eine philosophische Position zu erörtern, in der die Relation von Ethik und Narration systematisch auf den Punkt gebracht wird um damit einen Beitrag zu leisten, der den Unterschied ihrer Bezugnahme verdeutlicht und damit Gemeinsames wie Trennendes offenlegt. 2 Philosophischer Anspruch und dichterischer Appell : Ethik als Grundlage der qualitativen Beurteilung von Handlungen Wie an dem Zitat von Aristoteles exemplifiziert, wird Ethik hier als die Wissenschaft von der Beurteilung menschlicher Handlungen definiert. Ethik versteht sich als die beurteilende Instanz aller handlungsabhängigen Entscheidungen. Kurz gesagt und anschaulicher formuliert: Jene Handlungen, in denen wir uns für frei halten und die Lebensweisen, die wir wählen oder ablehnen, die unserem Wunsch entsprechen, dort ist, soweit überhaupt eine Beurteilung relevant wird, die Ethik die Wissenschaft, die Kriterien einer solchen Beurteilung zur Verfügung stellt. Sie definiert mit diesen Kriterien zugleich den Geltungsraum der Kriterien, d.h. den Definitionsraum sozialer Gemeinschaften, die sich innerhalb dieser Kriterien bewegen. Nicht zuletzt ist Ethik eine Begründungswissenschaft und in dieser Hinsicht wirkt sie auf einem Gebiet, dessen Grenze kaum von der Narration überschritten wird. Die Ethik fragt nach der Begründung dieser Berurteilungskriterien und damit auch nach der Gerechtfertigtheit der Grundlagen von Gesellschaftsformen. Wenn wir also nach dem Verhältnis von Narration und Ethik fragen, so richtet sich diese Frage nach der Wohlbegründetheit menschlicher Handlungen in diversen Handlungsmustern, Erzählformen, und Darstellungsweisen. In seinem Buch „On Deconstruction“ hat Jonathan Culler deshalb zurecht auf Folgendes hingewiesen: „To treat philosphy as a species of writing would create difficulties“.3 Bei aller Nähe, die sich scheinbar aus der Gemeinschaftlichkeit zweier schreibender Disziplinen anbietet, versteht sich die Philosophie, so definiert Culler zurecht, nicht in erster Linie als schreibende Disziplin, wenngleich gerade die Philosophie des 20. Jahrhunderts mit ihrer Wende zur Sprache diesem Anschein erneut Nahrung gegeben hat. Das ursprüngliche philosophische Anliegen ist es, Kritierien der Geltung herauszuarbeiten und zwar nicht nur für den Bereich der Handlungen, wo es einsichtig zu sein scheint, dass dafür keine 2 Vgl. hierzu Marc Slonim, Four Western Writers on Tolstoi, in: The Russian Review 19 Nr. 2 (1960), S. 187204, hier S. 187. 3 Jonathan Culler, On Deconstruction. Theory and Criticism after Structuralism, Routledge & Kegan Paul, London, Melbourne and Henley, 1983, S. 90. Dichtung und Moral 3 Handlungskriterien vorgegeben sind, soweit Handlungen „in unserer Macht“ stehen; es gilt auch für den Bereich der Epistemologie, also den Bereich der Erkenntnis der Wirklichkeit. Es trifft in beiden Fällen keineswegs zu, was Richard Rorty in der Nachfolge von Quine postulierte, dass die Philosophie in die Wissenschaften aufgegangen sei;4 heute brauchen die Wissenschaften mehr als je die Philosophie als Instanz der Reflexion und Bewertung der in ihnen zugrunde gelegten Kriterien. Und nicht anders als von den Wissenschaften wird die Philosphie, resp. die Ethik von der Dichtung angerufen, als jene Disziplin, in der die Beurteilung von Handlungen ihre zuständige Domäne darstellt. Die Philosophie mag sich also als Wissenschaft der Beurteilungskunst begreifen. Jacques Derrida beklagt, dass damit das Schreiben in philosophischen Schriften abgewertet werde. Schreiben ist, wie Derrida in seiner „Grammatologie“ am Beispiel Rousseaus und dessen autobiographischen Schriften erläutert, eine Ergänzung zum Sprechen und zum Leben. Im Schreiben könne das Intermediäre sich darstellen; es ist, was zählt, weil sich das Wahre stets hinter dem Appel des zu Ergänzenden verberge.5 Die Ubiquität des zu Ergänzenden lasse die Welt als eindeutige Bezugsgröße abhanden kommen. Dass es diese Eindeutigkeit des bloßen Konstatieren eines Sachverhalts nicht gibt, ist nun aber nicht neu: Es ist das große Thema, an dem Platon sein Philosophieren begonnen hat und die Notwendigkeit der philosophischen Begründung festmacht. Um diesem Anfang gerecht zu werden und das in Platons Philosophie formulierte Anliegen im Hinblick auf das Verhältnis von Ethik und Narration zu vergegenwärtigen, lassen Sie mich mit Platons Reflexionen zum Verhältnis von Philosophie und Dichtung beginnen, wie er sie in seiner Politeia darlegt, die den Anlass dafür geben, dieses Verhältnis seit mehr als zweitausend Jahren kontrovers zu reflektieren. 3 Das platonische Urteil Eine elementare Einsicht des platonischen Dialoges über die Staatskunst, die „Politeia“, liegt genau darin, zu begreifen, dass unsere Wahrnehmung auf empirische Gegebenheiten eingeschränkt ist und dass wir notwendig alles Empirische nur beschränkt erfassen können: was notwendig und in der Natur der Sache liegt: Alles ist relativ, zum Standpunkt des Betrachters, zu den Möglichkeiten der Verwendung etc. Nichts kann vollständig erfasst werden, aus Gründen, die in der Zeit und in der Größe und Vielfältigkeit und Beweglichkeit der erscheinenden Dinge liegen. In den frühen Dialogen, die als „sokratische“ aber auch als „aporetische“ Dialoge bekannt sind, zeigt sich Platon, man könnte sagen, ganz als Moderner. Diese Modernität könnte man daran festmachen, dass Platon dort keine Lösung für die Ordnung der Vielfältigkeiten anbietet. Das Philosophische dieser Dialoge beschränkt sich prinzipiell auf die Fragestruktur. Durch sie bringt Platon die Relationalität aller Gegebenheiten und Erscheinungen radikal zum Ausdruck; alles, was wir daraus „schließen“ können, ist, dass es aus dieser Offenheit kein Entrinnen gibt, „gefangen im Offenen“, könnte eine postmoderne paradoxienfreundliche Formulierung des Höhlengleichnisses lauten. Diese frühen Dialoge zeichnen sich durch das aus, was heute als das Elend der Moderne postuliert wird, die Tatsache, dass es keine verbindliche Norm mehr geben kann, dass es keine verbindliche Moral gibt, keine Richtschnur die uns den Weg zur angemessenen Handlung weist, kein „Objektives“ und keinen Gott mehr, Befehl man gehorchen dürfte. Platons aporetische Frühdialoge diskutieren durchaus „intermediär“ und nicht dogmatisch; der immer fragende Sokrates ist gerade der, der er ist und zu dem er geworden ist. Er ist der Protagonist der philosophischen Fragestellung, auch deshalb der weise Nichtwissende. Aristoteles nennt Sokrates in seiner Metaphysik den Begründer der Philosophie. Sokrates habe das Wissen vom Himmel auf die Erde geholt. So steht es beim Dichter Aristophanes. In den „Wolken“, die 4 Vgl. hierzu z.B. den Text von R. Rorty, „Is Philosophy Relevant to Applied Ethics?“, Business Ethics Quarterly 16/ 3 (2006) S. 369-380. 5 Vgl. hierzu: Un appel de supplément, in: Jacques Derrida, De la grammatologie, Paris, Minuit 1967, S. 228. Dichtung und Moral 4 einen nicht unerheblichen Anteil an dem Asebieprozess nehmen, in dessen Folge und Verurteilung Sokrates schließlich den Schierlingsbecher trinken wird, ist Sokrates einer, der weder den Wissenschaften noch den Göttern Wissen zuspricht. Er bezweifelt scheinbar alles; aber genau das ist ein ungerechter Vorwurf: Sokrates übernimmt nicht, was andere für wahr halten. Er will Wahrheit, kann sie aber in den Erscheinungsformen nicht finden. Das ist es, worauf er hinweist.6 Sokrates leugnet die Dominanz des Wissens und ringt um Erklärung, seinen Spott verdienen jene, die das schwächere Argument zum stärkeren machen und das Stärkere zum Schwächeren, ohne von der Sache etwas zu verstehen. Was aber heißt es, etwas von der Sache zu verstehen? Dieser Frage ist die Politeia gewidmet und im Zusammenhang mit der Beantwortung dieser Frage soll die Dichtung aus dem Staat gewiesen werden. 4 Die Idee des Guten und der Ausweis der Dichter aus dem Staat In der Einleitung treffen wir den Dichter Simonides.7 An bezeichnender Stelle wird er sogar mit Homer in eins gesetzt. Beide machen den Fehler der Selbstreferentialität ihrer Argumentation, das wird von Sokrates durch seine Fragen aufgewiesen. Was aber behaupten wird von ihnen behauptet? Sie meinen, ein Urteil, über das, was Gut oder Schlecht sei, sei zu gewinnen, wenn das Gute als das Gerechte und das Schlechte als das Ungerechte aufgefasst werde. Die Bestimmung des Guten wird gebunden an eine Aussage über die Förderlichkeit von Handlungen, über gerechte Handlungen; das Gute könne deshalb auch das genannt werden, was „jedem als das Seine“ zukomme. Diese Auffassung hält nach Platon aber keiner philosophischen Nachfrage stand.8 Im Rahmen der Erzählung der Politeia wird gezeigt, wie eine Begründung des Guten geleistet werden kann, ohne den Fehler zu begehen, diese Gute entweder „dingfest“ zu machen und Bestimmungen zu unterwerfen, die selbst wieder relativ sind, noch kann das Gute als etwas Relatives aufgefasst werden. Gesucht wird mit dem Prinzip des Guten vielmehr genau das Argument, von dem aus die Vielfalt der Relationen begründet werden kann und das es zugleich erlaubt, diese Vielfalt auf das Gute hin kritisch zu reflektieren. Die Schwierigkeit, dieses Wissen zu erlangen, wird in verschiedenen Gleichnissen dargestellt, dem Sonnen-, Linien- und Höhlengleichnis. Das Sonnengleichnis erörtert die Notwendigkeit der Annahme einer solchen Voraussetzung des rechten Urteils. Behauptet wird, dass es ohne diese Voraussetzung gänzlich unmöglich wäre, auch nur das Relative und Ungeordnete zu bestimmen. Selbst das Ungeordnete als Ungeordnetes zu bestimmen, bedarf einer Voraussetzung. Ohne diese Voraussetzung zu denken, das sagt das Sonnengleichnis, wäre alles, was wir als relativ und wechselhaft, unbeständig und unbestimmbar bezeichnen, nicht einmal das, sondern vollständig beliebig, in keiner Weise erkenn- oder identifizierbar. Mit anderen Worten, auch das Ungeordnete setzt eine Ordnung voraus, um das Ungeordnete als solches zu bestimmen. Diese Voraussetzung muss zugestimmt werden, obwohl sie nicht empirisch nachvollziehbar ist, sie ist so notwendig wie die Sonne, die die Welt erleuchtet, damit überhaupt etwas zur Erscheinung kommt, auch wenn sie selbst unseren Blicken verborgen ist. Hier wird bereits eine Schlussfolgerung angelegt, die Platon im X. Buch seiner Politeia ziehen wird und auf Dichtung und Künste anwendet. Sie 6 Aristophanes‘ Wolken stellen die Wirkung des Sokrates zu seiner Zeit dar; die Komödie wurde 423 v.Chr. aufgeführt, trug aber keinen Sieg davon. Die Komödie wird auch in der Anklage gegen Sokrates erwähnt, vgl. Platon, Die Apologie des Sokrates. Dennoch lässt sich die These, deshalb habe Platon den Dichtern gezürnt, schwerlich halten. Im Symposion des Platon, der Schrift, in der die Ideenlehre und der Aufstieg zum Guten vorgestellt wird, findet sich der Dichter Aristophanes wieder ein und erzählt einen Mythos Symposion, vgl. Platon, Symposion / Das Gastmahl 189 a ff. Vgl. auch Aristophanes, Die Wolken, übersetzt von L. Seeger, Leipzig, Insel 1978. 7 Der Chordichter Simonides (557-467) wird von Platon auch angeführt in Platon, Protagoras. Dort geht es um die Frage der Lehrbarkeit der Tugend. 8 Platon, Politeia / Der Staat. Text von Emile Chambry, dt. Übersetzung von Friedrich Schleiermacher, Darstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, hier 335 a ff. Dichtung und Moral 5 lautet, wer sich dieser Voraussetzung nicht bewusst ist, häuft Relatives und Zufälliges aufeinander, multipliziert den Schein der Erscheinungen und tut Belangloses. Provozierend könnte zunächst gefragt werden, was gegen solch belangloses Tun einzuwenden sei. Diese Frage beantwortet Platon im Liniengleichnis, wozu und weshalb genau dieser Weg zu gehen sei, weshalb Erkenntnis notwendig aus etwas Drittem zu begründen sei.9 Nun geht es um den „Aufstieg“, der nicht zuletzt in der postmodernen und dekonstruktivistisch orientierten Literaturkritik als hierarchisierende und erfahrungsnegierende Abstraktion interpretiert wird.10 Dieser Aufstieg zur Einsicht in das Gute prägte ohne Zweifel in erstrangiger Dominanz die Entwicklung des eurozentristischen Intellektualismus; es mag dahingestellt sein, ob Platon auch für seine Rezeptionsgeschichte verantwortlich zu machen ist.11 Die Gegenwartskritik an der platonischen Lehre ist ihrerseits aber auch nicht völlig neu und bislang ungehört, sondern steht in der Tradition der Metaphysikkritik jener, die in verschiedenen Formen die Reflexion metaphysischer Voraussetzungen als Entsinnlichung und Negation der Wirklichkeit postulieren, wie dies teilweise bereits in Aristoteles angelegt ist; hier aber aus der Metaphysikkritik Heideggers erfolgt, worauf sich Derrida und andere beziehen. Platon stellt im Liniengleichnis den Aufstieg zum Guten als eine Schulung des Wissens vor, die jene zu durchlaufen haben, die sich der Erkenntnis des Guten widmen. 12 Diese Methode besteht in Folgendem. Wie ein Moderner beginnt Platon beim „Common Sense“, beim Alltagsverständnis. Ausgehend von dem, was uns umgibt, suchen wir nach den Ursachen dessen, was wir erfahren. Unsere Erfahrung ist geprägt von wechselnden Bildern, Unvollständigkeiten, Veränderlichkeiten. Platon nennt sie Schatten- und Spiegelbildern. Sie werden auf die Ursache der ihnen innewohnenden Relativität und Relationalität überprüft, mit der sie sich uns zeigen. So erfahren wir den Grund der wechselnden Erscheinungsweisen und die Natur der wahren Dinge zeigt sich uns damit. Wer den Ursachen der natürlichen Dinge auf den Grund gehen will, und den Ursachen der hergestellten Dinge, der wird den Bereich des Sichtbaren überschreiten, so Platon und in den Bereich des Denkbaren eintreten. Denn auch in der Vielfalt der Natur gilt es wiederum, jene Einheit zu erkunden, aus der die Vielfältigkeit verständlich wird. Diese Einsichten verhalten sich wiederum zu den Erkenntnissen der Wissenschaften wie die Welt der Spiegelungen zu den wirklichen Gegenständen. Wer wissen will, geht auf diesem Weg immer weiter fort; da dieser Weg beschwerlich ist, gelangen nur wenige zu den höchsten Einsichten. Doch es muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass dieser Weg nicht den Männern vorbehalten ist; auch hier folgte die Geschichte keineswegs den Einsichten des weisen Platon. Dieser Aufstieg wird von einer Frau gelehrt, Diotima und die Politeia diskutiert und verteidigt die gleiche Teilhabe am Philosophenkönigtum für die Frauen.13 Wie Platon im Höhlengleichnis zeigt, ist nicht jeder 9 Platon, Politeia op. cit. 507 d/e: Wenn auch in den Augen Gesicht ist und, wer sie hat, versucht, es zu gebrauchen, und wenn auch Farbe für sie da ist (an ihnen, den sichtbaren Dingen R.H.) ist, so weißt du wohl, wenn nicht ein drittes Wesen hinzukommt, welches eigens hierzu da ist seiner Natur nach, daß dann das Gesicht doch nichts sehen wird und die Farben unsichtbar bleiben werden. 10 Diesen „Aufstieg“ zum Guten als notwendiger Voraussetzung für die Einsicht in das Gute erläutert Platon auch in der „Diotima-Rede“ aus dem Symposion, siehe hierzu auch Anmerkung 6. Platon, Symposion. Übersetzt und herausgegeben von Thomas Paulsen und Rudolf Rehn, Stuttgart, Reclam 2006, hier 201 d ff. Vgl. hierzu die Interpretation von Luce Irigaray die sich kritisch mit diesem Text und der platonischen Ideenlehre auseinandersetzt: Luce Irigaray: „Socerer Love: A Reading of Plato’s Symposion, Diotima’s Speech“, in N. Tuana (Hrsg.): Feminist Interpretations of Plato. University Park: Pennsylvania State University Press (1994), S. 181-96. 11 Der Philosoph Whitehead charakterisierte die ganze Philosophiegeschichte als Anmerkungen zu Platon. 12 Platon, Politeia, op. cit. 509 c ff. 13 Platon, Politeia, op. cit. 451 c; vgl. auch Ruth Hagengruber, „Über die Vervollständigung des Wissens. Philosophinnen in der Wissenschaft“ in: G.Völger (Hg.), Sie und Er. Frauenmacht und Männerherrschaft im Kulturvergleich, Rautenstrauch-Joest-Museum: Köln, 1998, Bd. I, S. 105-109. Dichtung und Moral 6 bereit, der diesen Weg gegangen ist, auch wieder zurück zu gehen und dieses Wissen den anderen mit zuteilen, denn es ist zu schön, im Bereich des wahren Wissens zu verweilen.14 Die Bildungstheorie, die Platon in seiner „Politeia“ paradigmatisch vorstellt kann bedauerlicherweise keine institutionell ungebrochene Geschichte im Abendland aufweisen. Die Tradition der platonischen Akademie wird nach neunhundert Jahren im christlichen Abendland gebrochen. Die platonische Akademie wird vom christlichen Kaiser Justinian in der Mitte des 6. Jahrhunderts geschlossen. Erst knapp tausend Jahre später feiert sie als platonische Akademie im sinnenfreudigen Florenz des 15. Jahrhunderts ihre Wiederauferstehung und wird für die Emanzipation der an Wahrheit und Wissenschaft hungrigen Menschen zum Symbol einer neuen Epoche, das erneut Jahrhunderte philosophischer und wissenschaftlicher Bildung inspiriert.15 Wer will, kann die Parallelen weiter ziehen und in der erneuten Kritik an der Suche nach dem guten Grund unserer Handlungen ein neues Mittelalter heraufziehen sehen, das seine Absage an Vernunft und Wissenschaft wieder einmal durch die Funeralisierung Platons und der Vernunft ankündigt. 5 Die Entmündigung der Philosophie durch den Alltag 1984 trug Arthur Danto einen vielbeachteten Vortrag im Rahmen des World Congress of Aesthetics vor, der seither oft publiziert, übersetzt und zitiert wurde und unter dem Titel „Die philosophische Entmündigung der Kunst“ erschien.16 Danto hat mit diesem und darauf folgenden Beiträgen eine These vorgelegt, die Folgendes besagte: Die Dominanz der Philosophie müsse überwunden werden; sie bestehe in dem Anspruch, sich in den Rang einer Urteilsfinderin zu setzen und den übrigen Wissenschaften im Rahmen ausgeklügelter wissenschaftsordnender Verfahren ihren Platz zuzuweisen, diese nach Hierarchien und Rangordnungen festzulegen. Der Kunst käme in diesem Schema keine andere Aufgabe zu, als die Verklärung des Gewöhnlichen zu leisten. Danto zeichnet das platonische Bildungsschema nach und kritisiert es. Er agiert dabei nach einem dialektischen Muster des von Danto an vielen Stellen zitierten Philosophen G. W. F. Hegel, worin der „Knecht zum Herrn“ wird. Danto benutzt dieses Schema, um auch das Verhältnis Kunst und Philosophie umzukehren. Die Geschichte der Philosophie und ihre Konstruktion eines wissenschaftlichen Aufstiegs sei nicht als ein „listiger Kampf gegen die Kunst“.17 Es handelt sich um einen „platonischenn Angriff“, die Geschichte der Philosophie sei als eine massive gemeinschaftliche Anstrengung zu betrachten, eine bestimmte Aktivität zu neutralisieren, der Verstand wolle sich vollständig das Gefühl erschließen.18 Die Darstellung der Kunst als einer, die von Natur aus nichts bewirke, stehe nun aber nicht im Gegensatz zu dem Glauben, dass die Kunst gefährlich sei. Vielmehr reagiere die Philosophie auf die an der Kunst verspürte Angst, deshalb betrachte man sie metaphysisch und tue so, als hätte man von ihr nichts zu befürchten.“19 Der Philosoph sei durch den Mangel an Berührung mit Wirklichkeit gebrandmarkt, die Dichtung sei ein Angriff auf den Intellekt im Namen des Gefühls; während Sokrates einer sei, dem es an Wissen fehle, wird Danto zufolge der von Platon als ein Dummer vorgeführte Ion bei Danto zu einem Helden, gerade weil er seine Fähigkeit nicht der Vernunft verdankt, sondern 14 Platon, Politeia, op cit. 514 a ff. 15 Vgl. L. Pisano, L.: „Die kontroverse Rezeption der platonischen Texte über die Liebe vor Ficino“, in S. Ebbersmeyer (Hrsg.): Sinnlichkeit und Vernunft. München: W. Fink Verlag (2002), S. 55-71. Ficino, M.: „Amor socraticus als Lebensform“, in S. Ebbersmeyer (Hrsg.): Sinnlichkeit und Vernunft. München: W. Fink Verlag (2002), S. 72-94. 16 Arthur Danto, Die philosophische Entmündigung der Kunst, München, Wilhelm Fink 1993. 17 Danto, Die philosophische Entmündigung der Kunst, op. cit. siehe Klappentext. 18 Ebenda, S. 28 f. 19 Ebenda, S. 26. Dichtung und Moral 7 „dunkleren und verworrenen Kräften“.20 Platon, so Danto, spreche mit doppelter Zunge. Platons Testament der Entmündigung der Kunst wird von Danto umgekehrt. Nun ist es die Philosophie, die ohne die Kunst nichts ist. Platons Strategie bestehe darin, eine Ontologie zu schaften, die gegen die Kunst immun sein müsse. Wenn über Kunst gesprochen werde, dann rational. Dies sei mit dem Zweck verbunden, die Wirklichkeit in Begriffe zu bändigen, um sich der „schrecklichen Schönheit des Irrationalen“ zu entledigen. An dieser Strategie, die Philosophie gegen die Kunst zu behaupten, beteiligten sich nahezu alle Philosophen. Dantos Frontalangriff gegen die gesamte Philosophiegeschichte wendet sich auch gegen Kant. Kants genialer Begriff der „Interesselosigkeit“ als Definition einer Haltung gegenüber dem Kunstwerk, in der sich das Schöne mit dem Vernünftigen zusammenzuführen lässt und damit würdig der platonischen Nachfolge erweist, wird von Danto als Ausweis dafür gewertet, dass es nach Kant „beim Kunstwerk ... nichts zu gewinnen oder zu verlieren“ gäbe. Während eine kantexegetische Interpretation in diesem Begriff die Allgemeingültigkeit des ästhetischen Urteils aufgewiesen und in eine Einheit mit der reinen Vernunfterkenntnis gerückt sieht, womit sich zugleich die Aufgabe der Philosphie in gewisser Weise erfüllt hat, den Menschen in seiner Wahrnehmung zu schulen, der Kontingenz des Alltäglichen zu entreißen und ihm die Kenntnis des Schönen und Immerwährenden abzutrotzen, wird diese Einsicht von Danto erheblich banalisiert, um diese Bedeutung zu schmälern. So, wenn Danto anmerkt, Kants Begriff für diese Leistung, die „Zweckmäßigkeit ohne bestimmten Zweck“ einzusehen, zeige, dass Kant behaupten wolle, das Kunstwerk wirke nichts, denn alles müsse zu etwas nütze sein. 21 Mit dieser doch als halsbrecherisch zu nennenden Uminterpretation erheblicher Teile der Philosophiegeschichte, die doch in weiten Bereichen und von ihren Anfängen an, von Platon bis Kant, darum ringt, das Schöne mit dem Wahren und Guten zu versöhnen, wird der Kunst sowenig Dienst geleistet wie der Philosophie. Danto diskutiert freilich die Bestimmung der Kunst aus ihrem Dilemma, „zu nichts nutze zu sein“.22 Dass konzeptuelle Kunst Gegenstände der „Lebenswelt“ darstellte, lässt sich zwar auch nach Danto unter anderem mit dem Dictum des Hegelschen Programms der Selbsterkenntnis des Bewusstseins aus seiner Entfremdung definieren, wonach der der Geist sich in seinem Anderen erkennt. Nicht nur darin scheint Danto den Ideen der Denker zu folgen, bevor er sie umkehrt, wie Hegeln den „Knecht zum Herrn“ macht. Wie Danto selbst schreibt, ist seine Auffassung nicht neu, vielmehr geht sie einher mit Einsichten der analytischen Philosophen.23 Lange vor Danto und den Postmodernen stellt sich die Ethik des 20. Jahrhunderts selbst zur Debatte; der moralische Realismus wird in Frage gestellt. Wenngleich viele einzelne Argumentationen genannt werden können, die dem Ereignis vorhergehen, so wird doch in der Philosophiegeschichte hierfür Bezug auf das sogenannte „open-question-argument“ von George E. Moore genommen. 24 Er hatte sich in seinen Principia Ethica wieder einmal daran gemacht, die Frage nach einer möglichen Gemeinschaft des Guten und Schönen zu eruieren. Kann das moralisch Gute an irgend etwas festgemacht werden, worüber wir etwas aussagen können? Moore beantwortete diese Frage mit nein; dies hatte Folgen, vor allem auch Folgen für die Kunst. Da moralische Erfahrung nicht identisch und nicht reduzierbar ist auf natürliche Eigenschaften verbleiben als Schlussfolgerungen zwei weitere Optionen. Die eine kann die Erfahrung der moralischen Empfindung dann auf Intuition zurückführen. Die andere leugnet, dass es überhaupt eine objektive moralische Größe geben kann; die analytische Philosophie führt 20 Ebenda, S. 28. Ebenda, S. 31. 22 Danto bezieht sich auf den Text von W. H. Auden: „Irland hat seinen Wahnsinn und sein Wetter noch / Denn Dichung bewirkt nichts“, Ebenda, S. 23. Das Thema der Wirkungslosigkeit und Gefährlichkeit der Kunst wird mehrfach aufgenommen. 23 Danto nennt an dieser Stelle Wittgenstein und Carnap, Ayer und Reichenbach, Tarski und Russell, Ebenda, Vorwort S. 15. 24 Vgl. hierzu Geoffrey Sayre-McCord, Moral Realism“, in: David Copp (Hg.) Metaethics and Normative Ethics, S. 39-62. 21 Dichtung und Moral 8 weitgehend diesen zweiten Standpunkt aus und argumentiert für die Auffassung, moralische Urteile seien nur deskriptive Urteile. Nonkognitivistischen Vorschlägen ist gemeinsam, dass moralische Äußerungen, bzw. Solläußerungen als Sprechakt analysiert werden, ein Akt, der nicht begründungs- oder wahrheitsfähig ist.25 Moralische Urteile sind also nichts anderes als Urteile über Eigenschaften, die wir den Menschen zuschreiben, die diese Urteile fällen. Darüber hinaus gibt es keine Grundlage für die Rechtfertigung moralischer Urteile. Sie sind beliebig. Der wertende Charakter ist den Emotionen des Sprechers oder Hörers geschuldet; eine moralische Bedeutung ist dabei nicht mehr vorausgesetzt und auch nicht vorauszusetzen. Die Ethik des frühen 20. Jahrhunderts geht Hand in Hand mit einer Entwicklung, in der die Kunst die Darstellung übernimmt, mit der sie zeigt, aber kein Urteil mehr anstrengt, das über ihren Bereich hinausgeht. 6 Postmoderne Sinnentleerung „Was für einen Sinn (kann RH) eine Ortsbestimmung der Gegenwart heute haben, wenn der Sinn selbst suspendiert ist“? fragt Dietmar Kamper in seinem Aufsatz, „Wege aus der Moderne“.26 Es gibt keinen Sinn von Kunst und keinen Sinn von Moral; das Ende der Geschichte wird zur Posthistoire. Dietmar Kampers letzter Apell ist, das Spielfeld zu verlassen, ohne es zu unterlassen, damit doch noch einen Sinn zu vermitteln: Dies sei die wahre Herausforderung, wozu vergleichsweise die „Fortsetzung der Kämpfe an den alten Fronten der Kritik“ einfacher sei. Die Einsicht sei nun an der Zeit, „das Schreckliche einer Thanatokratie der Vernunft“ zu denken, weil menschliche Erkenntnis keine andere Wahl habe, als die Wahl, das, was sie vernichte, noch zu erfassen. Das „Inkommensurable“ müsse ertragen, begriffen werden, „dass in der Konfrontation mit den Mächten der Vernichtung ein Selbstgemachtes“ erscheine. 27 Mit gewaltsamer Sprache und nahezu brutaler Begrifflichkeit will man sich hier der Wissenschaft entledigen. Ein vergleichbares Anliegen findet sich in der Vernunftkritik Jean Francois Lyotard, allerdings weniger martialisch: „Die Postmoderne ist keine neue Epoche, sondern das Redigieren einiger Charakterzüge, die die Moderne für sich in Anspruch genommen hat, vor allem aber ihrer Anmaßung, ihre Legitimation auf das Projekt zu gründen, die ganze Menschheit durch die Wissenschaft und Technik zu emanzipieren.“28 Dietmar Kamper kämpft den Kampf gegen die Vernunft, von der er doch weiß, dass sie ihn in all seinen Argumenten immer schon eingeholt hat: „Der Monotheismus der Vernunft und der Poytheismus der Einbildungskraft, romantische Formeln für den einen Mythos und die vielen Mythen, … überstehen alle Kritik, sind aber beide – insofern sie die Welt verschließen – letztlich unannehmbar. (…) Die Mimesis des Schreckens, die Meditation des Todes der Menschheit, die Ästhetik des Posthistoire erweisen miteinander die Notwendigkeit, die Macht der linear bemessenen Zeit zu brechen …“.29 7 Die Ausweisung der Kunst nach Platon Platon hat bekanntlich die Dichter und die Kunst aus dem idealen Staat verwiesen, weil er dort schon angelegt sag, was sich zweieinhalb tausend Jahre später als Rache gegen ihn und 25 Vgl. hierzu Michael Quante, Einführung in die allgemeine Ethik, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, S. 41. 26 Dietmar Kamper, „Nach der Moderne. Umrisse einer Ästhetik des Posthistoire“ in: Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Hg. Von Wolfgang Welsch, VCH 1988, S. 163-174, hier S. 163. 27 Ebenda, S.168. 28 J. F. Lyotard „Die Moderne redigieren“ in: Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der PostmoderneDiskussion. Hg. Von Wolfgang Welsch, VCH 1988, S.205-214, hier 213. 29 Dietmar Kamper, „Nach der Moderne. Umrisse einer Ästhetik des Posthistoire“ op. cit. S. 173. Dichtung und Moral 9 seinen Versuch, der Vernunft in dieser Welt ein Recht zu verschaffen, wenden sollte. Die bloße Spiegelung der Wirklichkeit wird zu einem brutalen Gefasel der Zerstörung und Selbstzerstörung, wenn nicht ein Weg beschritten wird, diese Vielfältigkeit auf ein Prinzip zurück zu binden, um ihr einen „guten Grund“ zu geben. Aus platonischer Perspektive ist das Anliegen der postmodernen Theoretiker nicht neu. Darin findet sich, was Platon als blinden und vernunftfeindlichen Mythos zu überwinden hoffte. Die platonische Suche nach dem Guten beginnt, um sich des Schmerzes zu entledigen, der mit der Spiegelung des Sinnlosen einhergeht. Was ist schlecht daran, sich erhalten zu wollen? Was spricht dafür, unterzugehen?30 Was fügt also die Theorie der Denker, die die Dekonstruktion der Geschichte betreiben, den Einsichten hinzu, von denen Platon seinen Anfang genommen hat? Der Dichter, der„Ruhm haben will bei der Menge“, sorgt für die Intensivierung der Täuschungen, für gereizte und wechselreiche Gemütsstimmung, finden wir schon bei Platon bestätigt, weil es ihn gar nicht interessieren kann und darf , wie es sich mit der Sache verhält. Anders verhält es sich mit dem guten Dichter. „Denn notwendig müsse der gute Dichter, wenn er, worüber er dichtet, gut dichten solle, als ein Kundiger dichten“.31 Würde die Dichtung in irgendeiner Weise zum Ziel haben, etwas auszusagen, was über Dichtung hinausginge, wäre der Anspruch ein anderen, und der Dichter würde dann nicht den dichterischen Anspruch, sondern den Anspruch eines „Kundigen“ einnehmen. Das Dichterische steht im Gegensatz zum Anspruch auf Gestaltung von Welt, so radikal formuliert dies Platon. Und weil Platon es ferner für ausgemacht hält, dass jeglicher Anspruch an Welt nur der sein kann, diese Welt des Elends und der Täuschungen zum Besseren zu führen, genau darum ist der Dichter das Gegenteil von einem, der moralisch handelt, so der platonische Schluss. Die Dichter aber verstehen nichts von den Dingen, über die sie reden; „Dieses also, wie sich zeigt, ist uns ziemlich klar geworden, daß der Nachbildner nichts der Rede Wertes versteht von dem, was er nachbildet“.32 . Die Reproduktion des vermeintlich Tatsächlichen, als Reproduktion der Welt der Täuschungen ist nach Platon auf das Verderben der Jugend gerichtet. Wie aber soll das Wahre anderes dargestellt werden als in der Erzählung? Welche Rolle nehmen die platonischen Mythen ein? Hat nicht Platon in großartiger Weise sein dichterisches Handwerk ausgeübt, indem er die konkreten lebensweltlichen Situationen des damaligen Athen darstellt. Wie ist es zu verstehen, dass er, der Dichter dieser sokratischen Dialoge nicht in seinen Dialogen Sprecher ist? Verfährt Platon in der Darlegung seiner Ethik nicht gerade wie ein Dichter? Was heißt es, wenn er sagt, ein guter Dichter ist ein Kundiger? 8 Ordnung und implizite Schlussfolgerung Schon Aristoteles sah sich genötigt, dem harschen Urteil seines Lehrers Platon entgegen zu treten. Zwar ist auch nach der Auffassung des Aristoteles Dichtung Mimesis, keineswegs aber ergibt sich für ihn deshalb der Schluss daraus, dass das Schlechte nicht dargestellt werden dürfe, wie dies in den berühmten Thesen der Politeia postuliert wird. Aristoteles ist der Rezeptions-Theoretiker und Ethiker. Er argumentiert in seiner Poetik, die Darstellung sei ebenso gemischt zwischen dem Guten und Schlechten, dem Richtigen und Falschen, wie dies in der Wirklichkeit zutreffe. Aristoteles ist ein Methodiker. Weiß der Dichter Platon, wie er die formalen Mittel einzusetzen hat, um seine These zu Gehör zu bringen, so weiß der Analytiker Aristoteles, welches diese formalen Mittel sind. Er schreibt nicht mehr Dichtung, 30 Platon, Politeia, op. cit. 602 c. Platon, Politeia, op. cit. 598 e. 32 Platon, Politeia, op. cit. 602 b: Ταυτα μεν δα, οω γε φαινεται, επιεικωσ ημιν διωμολογηται, τον τε μιμητικον μψδεν ε ιδεϖαι αξιον λογ ου περι ων μιμειται ... 31 Dichtung und Moral 10 sondern legt die formalen Mittel des Dichters vor, wonach Furcht und Mitleid erzeugt werden; Aristoteles zeigt, dass diese Spiegelung der Wirklichkeit nicht zu einer „Potenzierung“ des „falschen Wissens“ führt und nicht die falsche Welt verdoppelt. Damit dies aber gelingt, gilt es die Kunst zu beherrschen. Der Dichter sollte über die Mittel verfügen, die Anordnung des Geschehnisses so zu vollbringen, dass ein kathartisches Moment eintritt, dass das Elende und Falsche uns vors Auge tritt und wir dadurch eine Läuterung erfahren, die unser Leben bereichert. Insofern geht es auch Aristoteles um das Gute, doch haben die Dichter daran möglichen Anteil. Aristoteles präsentiert einen aktiven für die gesellschaftliche Moral bedeutsamen Mimetiker. Doch auch er setzt das Gute voraus: Was immer die Menschen erkennen, worin immer sie sich läutern, was immer vor ihnen als Schein und Lug entlarvt wird, ist nur das allein, was ihnen selbst als Wert erscheint. Nicht die inhaltlichen Varianten menschlicher Handlungen sind Gegenstand der Erkenntnis, sondern die Analyse der Optionen von Handlungen ihrer eigenen Wirklichkeit und Möglichkeit. Aristoteles fragt und zeichnet methodisch nach, unter welchen Bedingungen Handlungsvarianten angespornt und evoziert werden. Auf uns heute übertragen bedeutet dies, dass jeder sein eigenes Urteil über Madame du Bovary fällt, ob sie nun als herausragende Liebende oder als Betrügende erscheint; ob wir mit Rodion Raskolnikow leiden oder ihn verachten. Die Frage nach der Vollständigkeit der Darstellung, der Repräsentation der umfassenden Perspektiven, die Platon durch einen idealen Objektivismus einzuholen suchte, wird nach Aristoteles so gefasst: Es gibt keine vollständige Darstellung und damit nicht die Darstellung des Richtigen. Der Dichter vermag aber aufgrund der Konstellationen und Relationen, aufgrund seiner Anordnung des Geschehens die moralischen Implikationen und dessen, was gut und schlecht ist, hervortreten zu lassen. Dichtung selbst verfolgt moralische Zwecke, die sich aber nur Betrachter realisieren, der die Darstellung zur Einheit bringt. Erst durch diese Einheit, die der Rezipient aufgrund der ihm eigenen Deutung der Darstellung unterstellt, ergibt sich ein moralischer Sinn. Dichtung soll nicht erbauen und uns nicht den Sieg des Gerechten und den Untergang des Bösewichts vorführen. In Kapitel 13 seiner Poetik führt Aristoteles ausdrücklich aus, dass „die Tragödie nicht zeigen soll wie der Schurke ins Unglück gerät.“33 Dichtung, die so agiert, ist „gut gemeint“, erreicht aber nicht die spezifische Wirkung. Irrtum und Fehler, die am Beispiel exemplifiziert werden, erreichen das Ziel, den Zuschauer durch Mitleid und Furcht zu reinigen. Der Dichter muss auch kein Kundiger sein. Nach Aristoteles ist es „egal“, ob der Dichter weiß, „daß die Hirschkuh keine Hörner hat“. Wirft man ihm vor, „, dass der Dichter die Wirklichkeit verfehlt“ so sei auch dies einerlei, denn es geht Aristoteles darum: „Um zu beurteilen ob diese oder jene Rede oder Handlung richtig oder nicht richtig ist, muss man nicht nur auf die Handlung und Rede selber blicken und prüfen, ob sie edel oder gemein ist, sondern auch auf den Handelnden und Redenden, und an wen es geht und wann und für wen und wozu...“. 34Aristoteles interessiert sich für die Einheit des Vielfältigen, ebenso wie Platon. Die Herstellung dieser Einheit wird aber nicht geleistet durch einen intellektuellen Bezug, sondern durch die Einheit, in die der Rezipient die Darstellung durch seine Deutung bringt. Das entscheidende Kriterium für die Dichtung ist daher nach Aristoteles, diese Möglichkeit der Einheit zu gewährleisten, Dichtung verfehle ihren Zweck, wenn sie Unmögliches dichte. Es ließe sich nun einwenden, dass auch Aristoteles an dieser Stelle einem kritikwürdigen Objektivitätszwang anheimfalle. Sei nicht gerade die Erfindung des Unmöglichen, die Bedingung der Moderne. Ist diese Forderung nach der Möglichkeit des Dargestellten eine Forderung, die doch das Alte und Überkommene befürwortet und die Bewegung leugnet, die sich als Übergang, wenn auch nicht als Aufstieg durchsetzen will? Was bedeutet die Einschränkung der relationalen Anordnung in einer Einheit für die dichterische Wahrheit und 33 Olof Gigon, „Einleitung“, in: Aristoteles, Poetik, herausgegeben von Olof Gigon, Stuttgart, Reclam 1961, hier S. 11. 34 Aristoteles, Poetik, übersetzt und herausgegeben von Olof Gigon, Stuttgart, Reclam 1961, S. 65. Dichtung und Moral 11 welche moralische Kategorie geht mit dieser Forderung einher?35 Es gibt keine dem Kunstwerk implizite Moral, jedenfalls nicht in dem Sinne, dass uns dort etwas vorgeführt wird, was objektiv, d.h. von uns unabhängig und ohne unsere Reflexion für uns moralisch sein kann. Ethische Relevanz entsteht nur in dieser Rezeption, der Wendung des Blickes von etwas auf uns. Denn nur in der Rezeption wird die inhaltliche Darstellung auf die Kriterien der Auswahl und der Anordnung bezogen. Nur im Hinblick auf diese Anordnung kann entschieden werden, was Aristoteles emphatisch als die Forderung nach der „Einheit der Handlung“ bezeichnet und insofern die Handlungssemantik für den Rezipienten konsistent ist. Wie aber kommt es, dass über die Rezeption einer Darstellung eine solche „Konsistenzprüfung“ erfolgen kann? Ist nicht die Vielfältigkeit der Darstellung stets viel größer als die Möglichkeit des Rezipienten, sie zu „überprüfen“? Hier liegt die moralische Komponente jeglicher Kunsterfahrung. In der Literatur Platons und Aristoteles’ ist es offenbar, dass Kunst im engen Zusammenhang mit der Bewertung unserer Wirklichkeit steht. Das Dilemma ist die Unermesslichkeit ihrer Vielfältigkeit und die Rückbindung auf eine Einheit. Der Vielfältigkeit ausgeliefert zu sein, bedeutet Bedrohung und Untergang. Wo wir diese Vielfalt auf uns reflektieren, sie in eine Einheit bringen, ist unsere Vernunft konstruierend und kreativ am Werk. Der Prozess des Synthetisierens des Vielfältigen zu dieser Einheit ist ein kreativer Prozess. Die Selektion auf diese Einheit hin ist zugleich ein Reduktionsprozess, in der aus einer als unendlich gegebenen Vielfalt zusammengefügt und eine Einheit erstellt wird, deren Sinn allein darin liegt, dass wir uns im Dargestellten spiegeln und wieder erkennen können, weil wir ihre Grundlage geschaffen haben. Kreativität und Gutsein lassen sich also gar nicht trennen. 35 Vgl. Gianni Vattimo, „Nihilismus und Postmoderne in der Philosophie“ in: Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion“ op. cit. S. 233-246, hier 233.