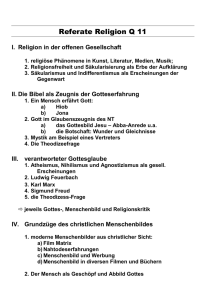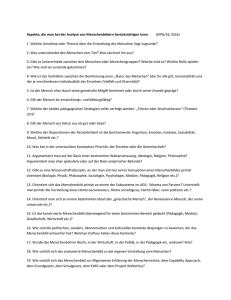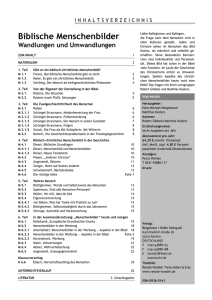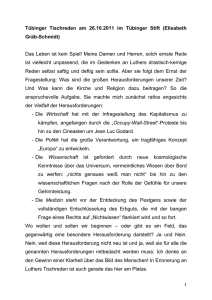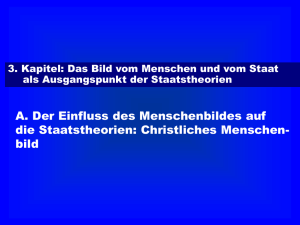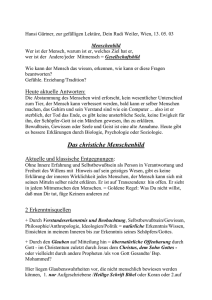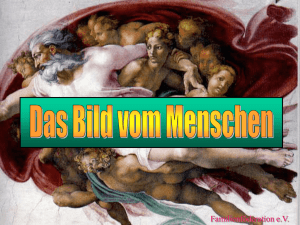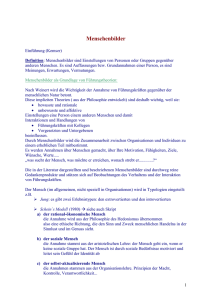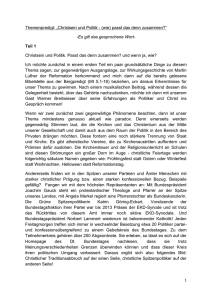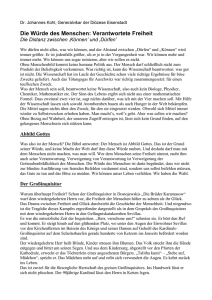Die Würde des endlichen Menschen
Werbung
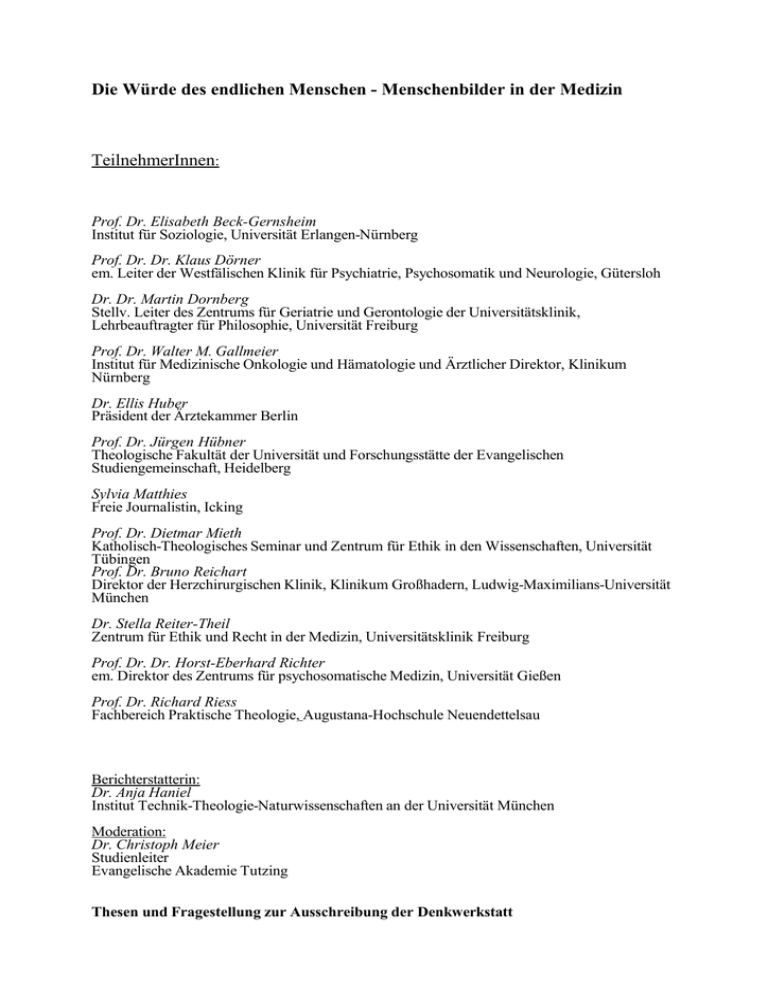
Die Würde des endlichen Menschen - Menschenbilder in der Medizin TeilnehmerInnen: Prof. Dr. Elisabeth Beck-Gernsheim Institut für Soziologie, Universität Erlangen-Nürnberg Prof. Dr. Dr. Klaus Dörner em. Leiter der Westfälischen Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Neurologie, Gütersloh Dr. Dr. Martin Dornberg Stellv. Leiter des Zentrums für Geriatrie und Gerontologie der Universitätsklinik, Lehrbeauftragter für Philosophie, Universität Freiburg Prof. Dr. Walter M. Gallmeier Institut für Medizinische Onkologie und Hämatologie und Ärztlicher Direktor, Klinikum Nürnberg Dr. Ellis Huber Präsident der Ärztekammer Berlin Prof. Dr. Jürgen Hübner Theologische Fakultät der Universität und Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, Heidelberg Sylvia Matthies Freie Journalistin, Icking Prof. Dr. Dietmar Mieth Katholisch-Theologisches Seminar und Zentrum für Ethik in den Wissenschaften, Universität Tübingen Prof. Dr. Bruno Reichart Direktor der Herzchirurgischen Klinik, Klinikum Großhadern, Ludwig-Maximilians-Universität München Dr. Stella Reiter-Theil Zentrum für Ethik und Recht in der Medizin, Universitätsklinik Freiburg Prof. Dr. Dr. Horst-Eberhard Richter em. Direktor des Zentrums für psychosomatische Medizin, Universität Gießen Prof. Dr. Richard Riess Fachbereich Praktische Theologie, Augustana-Hochschule Neuendettelsau Berichterstatterin: Dr. Anja Haniel Institut Technik-Theologie-Naturwissenschaften an der Universität München Moderation: Dr. Christoph Meier Studienleiter Evangelische Akademie Tutzing Thesen und Fragestellung zur Ausschreibung der Denkwerkstatt ‘Die Würde des endlichen Menschen – Menschenbilder in der Medizin’ „Zeitenwende - Horizonte öffnen“, so lautet das Oberthema zu den Werkstattgesprächen dieses Tages. Es setzt voraus, daß die aktuelle Gegenwart eine Umbruchzeit ist, in der alte Horizonte verschwimmen oder sich verschließen und deshalb neue geöffnet werden müssen. Eine Schlüsselfrage, die sich dabei stellt, ist die nach dem Menschenbild: Wie sieht und versteht der Mensch sich selbst in seiner Welt und welche Verhaltens- bzw. Handlungskonsequenzen zieht er daraus? Besonders virulent wird die Frage nach dem Menschenbild im Bereich der Medizin. Deshalb sollen „Menschenbilder in der Medizin“ exemplarisch diskutiert werden. Der Plural in dieser Themenformulierung setzt voraus, daß es ein allgemein gültiges Menschenbild, auf das sich zumindest eine Mehrheit der Beteiligten und Betroffenen gemeinsam beziehen kann, heute nicht mehr gibt. Daß man sich aber auf ein solches (oder wenigstens auf Kernelemente eines solchen) verständigen muß, wenn die Medizin weiterhin und auf Dauer menschlich bleiben soll, ist eine der Ausgangsthesen für das Werkstattgespräch. Im Oberthema „Die Würde des endlichen Menschen“ ist eine weitere These angedeutet: Die Begrenztheit und schließlich die Endlichkeit des Menschen ist nicht in jeder Hinsicht ein Übel, das mit allen Mitteln bekämpft werden muß, sondern sie gehört konstitutiv – und damit in gewissem Sinne auch positiv – zur menschlichen Existenz, ja ist genuiner Bestandteil der Menschenwürde. Wie haltbar und tragfähig diese Thesen sind und welche Verhaltens- und Handlungskonsequenzen, speziell im Bereich der Medizin, sich daraus ergeben, soll im Werkstattgespräch zunächst diskutiert werden. Weitere Punkte werden sich im weiteren Verlauf ergeben. Christoph Meier Anja Haniel Die Würde des endlichen Menschen - Menschenbilder in der Medizin Die Diskussionen um High-Tech-Medizin, Sterbehilfe, Kostendämpfung im Gesundheits-wesen oder genetische Eingriffe münden nicht selten in die Frage nach dem Menschenbild, das ärztlichem Handeln zugrunde liegt. In unserer christlich geprägten Kultur herrscht das auf der Gottebenbildlichkeit und damit einer ganz spezifischen, jedem Menschen zugesprochenen Würde beruhende Menschenbild vor. Nach diesem christlichen Menschenbild gehören Leid und Endlichkeit zur Natur des Menschen. Doch werden oft Bedenken geäußert, die darauf abzielen, daß das Tun der Medizin und der biomedizinischen Forschung mit diesem Menschenbild nicht mehr vereinbar seien. Die Medizin vermittele bzw. verstärke heute oft eine „säkularisierte Unsterblichkeitsvorstellung“, die ein Streben nach einem leidfreien Leben und einer leidfreien Gesellschaft begünstige. Demgegenüber gilt es, „die Würde des endlichen Menschen“ zu bewahren, wie es der Berliner Bischof Wolfgang Huber bei einer Tagung der Evangelischen Akademie Tutzing einmal formulierte. Die Themenstellung für das Werkstattgespräch war von daher angeregt. Das christliche Menschenbild und damit die Würde des Menschen seien unteilbar, so der Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter in seinem Eingangsstatement zum Werkstattgespräch. Damit sei auch eine Unteilbarkeit der Hilfeverpflichtung gegenüber anderen verbunden. Die hochtechnisierte Medizin erfordert aber einen ständig wachsenden Kostenaufwand und kommt deshalb nur einer Minderheit, nämlich der reichen Bevölkerung der Industrieländer, zugute. Die Unteilbarkeit der Menschenwürde werde damit praktisch aufgehoben, denn zunehmende Kosten für die sogenannte High-Tech-Medizin führten auch dazu, daß weniger finanzielle Mittel für die Entwicklungshilfe und damit die medizinische Versorgung der Dritten Welt zur Verfügung stünden. Schon seit mehreren Jahren sei dort ein Wiederaufflackern an sich leicht beherrschbarer Epidemien zu verzeichnen. Genetische Eingriffsmöglichkeiten, die vorgeburtliche Diagnostik oder auch zukünftig denkbare Interventionen zur „Verbesserung“ des Erbguts, seien Symptome einer Gesellschaft, die nach Leidfreiheit strebe. Sie entferne sich dabei immer weiter vom christlichen Menschenbild - und dies nicht nur, weil gottgegebenes Leben bis in seinen bisher unverfügbaren Kern hinein manipuliert werde, sondern auch, weil sich diese Eingriffe wiederum nur eine Minderheit werde leisten können. „Verbirgt sich hinter diesem elitären Allmachtsdenken nur ein größenwahnsinniger Übermut, oder ist es doch eher die manische Abwehr einer Angst, die mit dem Verlust der Geborgenheitsgewißheit in einer von Gott verlassenen Welt zusammenhängt? Ist es der verzweifelte Drang, sich ein Maß an Macht zu verschaffen, das ein Leiden ohne Hoffnung auf Trost und Erlösung ersparen soll? Sollte endgültig das Wissen verloren gehen, daß das Schicksal des einzelnen mit dem der Mitmenschen in allen Teilen der Welt unlösbar zusammenhängt und daß der Mensch zur Natur und diese nicht ihm gehört?“, so fragte Richter eingangs der Diskussion. Aus der Erfahrung klinischer Praxis wurde dagegen eingewandt, daß nicht Allmachtstreben der Medizin für die Entwicklung in der Intensiv- und Apparate-Medizin sowie gentechnische Eingriffe verantwortlich seien. Es sei vielmehr die „unendliche Last des Nicht-Heilen-Könnens“, die der Arzt täglich zu tragen habe, und der starke Wunsch zu helfen, die dazu führten, daß ein unendlicher Forschungsdrang entstehe. Es sei für den Arzt auch schwer denkbar, vor einem leidenden Patienten ein Menschenbild zu vertreten, das den Menschen als einen im Angesichte Gottes Leidenden beschreibe. In der Bevölkerung sei ein Menschenbild weit verbreitet, das zwar von der Endlichkeit der anderen, nicht aber von der eigenen ausgehe. Der Last des „Nicht-Heilen-Könnens“ auf seiten des Arztes steht das Leid der Patienten und Angehörigen gegenüber. Beide Perspektiven hängen zusammen und dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Den Patienten geht es nicht um „ewiges Leben“, sondern vor allem darum, „nicht jetzt und nicht so“ zu sterben. Im Blick darauf hat die Medizin der Gesellschaft gegenüber einen Auftrag, den sie erfüllen muß. Schwarz-Weiß-Malerei mit einer fordernden Gesellschaft auf der einen Seite und einer Medizin mit Allmachtsphantasien auf der anderen Seite wird der Problematik nicht gerecht, sondern führt zu einer unfruchtbaren Polarisierung. Auf weitgehende Zustimmung stieß die Anregung, Entscheidungen jeweils möglichst nah am konkreten Fall, unter Einbeziehung der Betroffenen, zu treffen. Für alle (Ärzte, Patienten und Angehörige) sei es hierbei hilfreich, sich klar zu machen, daß die medizinischen Ziele „Heilen Bessern - Lindern“ im Sinne ihrer tatsächlichen Erreichbarkeit besser in der umgekehrten Reihenfolge formuliert werden müßten: Lindern sei fast immer, Bessern selten und Heilen fast nie möglich. Diese realistischere Formulierung der Ziele schütze den Arzt vor unrealistischen Erwartungen der Patienten und Angehörigen und verhelfe ihm auch selbst zu einer differenzierteren Sichtweise seines Tuns. Einhellig war die Meinung, die Medizin sei eine „Beziehungswissenschaft“. Als solche sei sie keine Disziplin, in der allein naturwissenschaftliche Kenntnisse anzuwenden seien. Maßgeblich sei vielmehr die Beziehung zwischen Arzt und Patienten, für die aber in der täglichen Praxis häufig zu wenig Zeit bleibe. Menschliche Parameter seien jedoch für eine therapeutische Entscheidung wesentlich. Im Idealfall sollte der Arzt nur gemeinsam mit einem über das Nutzen/Risiko-Verhältnis einer Behandlung voll aufgeklärten Patienten entscheiden. Dabei sei eine ganzheitliche Sichtweise wichtig. Der Patient dürfe nicht auf sein physisches Problem reduziert werden, sondern seine psychische Befindlichkeit müsse mit berücksichtigt werden. Gerade in der Intensivmedizin ergeben sich aber für den Arzt Probleme, da der Patient oftmals nicht mehr in der Lage ist, sich an der Entscheidung zu beteiligen. Der Arzt steht dann häufig vor dem Dilemma, daß es sein Auftrag ist, Leben zu erhalten und dementsprechend Maßnahmen einzuleiten, die möglicherweise Leben verlängern, aber nicht Leiden vermindern. Damit widersprechen sie unter Umständen dem Wunsch des Patienten. Wenn dieser Wunsch des Patienten („mutmaßlicher Wille“!) auch im Gespräch mit Angehörigen nicht klar zu eruieren ist, sei es eine Frage an das Gewissen und die Erfahrung des Arztes, wie er entscheide. Letztlich seien solche Entscheidungen eine Frage des Menschenbildes, das der Arzt habe. Doch gebe es im Medizinstudium derzeit keinen oder viel zu wenig Raum für die Auseinandersetzung mit Fragen des Menschenbildes und der Ethik im allgemeinen. Dietmar Mieth, Leiter des Zentrums für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen, unternahm den Versuch, verschiedene Menschenbilder nach Kategorien zu ordnen. Dabei unterschied er zwischen integrativen, symbolisierenden, differenzierenden und ethischreligiösen Menschenbildern. Integrative Menschenbilder betonen ein Gemeinsames im Wesenskern des Menschen. Dies kann objektivistisch gedacht sein, z.B. im Sinne eines teleologisch verstandenen Naturrechts oder auch im Sinne der biologischen Natur. Hierher gehört u.a. das naturwissenschaftliche Menschenbild, das den Menschen anhand objektivierbarer Parameter zu beschreiben versucht. Viele Fragen des menschlichen Lebens seien jedoch nicht objektivierbar; so scheitere die Naturwissenschaft bereits daran, genau zu definieren, wann menschliches Leben beginne, ob mit der Verschmelzung der Keimzellen oder erst mit der Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut. Ein zweites integratives Menschenbild baut auf der formalen Würde des Menschen im Kant’schen Sinne auf. Auch hier sind jedoch ethische Fragen keineswegs eindeutig geklärt, da in vielen Situationen umstritten ist, auf wen diese Würde anzuwenden ist, und da manchmal auch Würde gegen Würde steht. So betonten z.B. die anwesenden Ärzte, daß in ihrer täglichen Arbeit mitunter ihr eigenes Selbstbestimmungsrecht und ihre Würde mit den Erwartungen der Patienten und Angehörigen und deren Vorstellungen von Würde nicht in Einklang zu bringen seien. Symbolisierende Menschenbilder bauen laut Mieths Schema auf der Verhaltenssteuerung des Menschen durch Bilder auf. So sind Entscheidungen und Handlungen des Arztes beispielsweise einerseits von seinem Selbstbild abhängig, aber auch das Bild vom anderen entscheidet über das ihm gegenüber gezeigte Verhalten. Wird der Embryo im Reagenz-glas etwa als himbeerartiger Zellhaufen betrachtet, wird mit ihm anders verfahren, als wenn man darüber staunt, daß das gesamte menschliche Potential bereits bei ihm vorhanden ist. Differenzierende Menschenbilder stellen auf die Differenz zwischen den Men-schen ab, z.B. auf die der Geschlechter, auf interkulturelle Unterschiede usw. Ethisch-religiöse Menschenbilder schließlich legen nach Mieths Zuordnung Wert auf die moralische und religiöse Identität heute. Im Unterschied zu teleologisch verstandenen Identitätskonzepten ist dabei der Gedanke wichtig, daß sich Identität in Beziehung konstituiert. So wird z.B. bei einer Geburt nicht nur das Kind neu geboren, sondern auch die Mutter, nämlich in ihrer Eigenschaft als Mutter. Von diesem Menschenbild führt ein direkter Weg zum Konzept einer Beziehungsmedizin, das sich als ein „roter Faden“ durch die gesamte Diskussion des Werkstattgesprächs zog. Dieser Überblick über mögliche Kategorien von Menschenbildern wurde intensiv diskutiert. Dabei herrschte allerdings die Meinung vor, daß die theoretische Beschäftigung mit unterschiedlichen Menschenbildern nur schwer in konkrete Entscheidungen in der täglichen Praxis umzusetzen sei. Auch seien Menschenbilder in der Regel eher „mosaikhaft“. Damit aber führt die allgemeinere Frage nach gemeinsamen „anthropologischen Grundwerten“, die eine „menschlichere Medizin“ ermöglichen, vielleicht weiter als die nach einem konkreten gemeinsamen Menschenbild. Die Medizinethik, die sich ja mit Fragen einer menschlicheren Medizin beschäftigt, sei hierzulande noch nicht ausreichend institutionalisiert, so wurde festgestellt. Es seien jedoch Bestrebungen zu verzeichnen, Medizinethik als Lehrfach in das Medizinstudium zu integrieren. Hierbei gehe es weniger darum, ein allgemein gültiges, in der Praxis anwendbares Menschenbild zu formulieren. Lernziele müßten vielmehr eine Sensibilisierung für die Probleme, eine Orientierung über Werte und Normen in ihrer Pluralität, das Relativieren der eigenen Meinung, die Fähigkeit zu argumentieren, ein bewußteres Vorbereiten von Entscheidungen und Handlungen sowie Dialogbereitschaft sein. Wichtig sei auch die Erkenntnis, daß der persönliche Lebenszusammenhang über Werte und Normen entscheide, denn diese seien nicht objektiv vorgegeben. Die im Gesundheitswesen Tätigen bringen ihre persönliche Grundhaltung zu Leben, Leiden und Sterben in die Beschreibung eines ethischen Problems meist unbewußt mit ein. Es ist deshalb notwendig, sich dieser Grundhaltung bewußt zu werden. Dies ist gerade dann unverzichtbar, wenn in komplizierten Problemsituationen einzelne menschliche Belange und Werte miteinander konkurrieren und eine Entscheidung möglicherweise nur für das geringere Übel getroffen werden kann. Konkret verdeutlicht wurde eine solche Problemsituation am Beispiel eines jungen Patienten mit chronischer Leukämie, der bei herkömmlicher Therapie eine mittlere Lebenserwartung von fünf bis acht Jahren habe. Hier stehe man oft vor der Entscheidung, ob man eine Knochenmarktransplantation wagen solle, die eine 20prozentige Mortalitätsrate, aber auch eine 50prozentige Heilungschance böte, wobei allerdings Spätfolgen nicht auszuschließen seien. Die Entscheidung für eine solche Therapie verstoße folglich mit recht großer Wahrscheinlichkeit gegen das ärztliche Gebot des Nicht-Schadens. In der konkreten Praxis spiele bei solch weitreichenden Therapieentscheidungen die Erfahrung des Arztes in bezug auf die Prognose des jeweiligen Patienten faktisch oft eine größere Rolle als ethische Grundsätze. Dagegen stand die These, daß gerade für solch schwierige Einzelentscheidungen andere als nur ärztliche Instrumente nötig seien, die durch eine gezielte Einbeziehung von Medizinethik vermittelt werden könnten. So tauchten oft gerade in der Intensivmedizin scheinbar unlösbare Probleme auf, bei denen Prinzipien wie Patientenautonomie und die Verpflichtung des Arztes, Leben zu sichern, kollidieren. Häufig könnten solche Probleme jedoch „umformuliert“ und damit lösbar gemacht werden. Insbesondere auch bei sich offenbar widersprechenden Ansprüchen der Angehörigen und des Arztes könne eine Beratung durch neutrale Dritte oft zu einer Problemlösung führen. Die Funktion des Beraters bei der Umformulierung des Problems mache aber die ethische Ausbildung der Ärzte mit den bereits genannten Lerninhalten nicht überflüssig, da in der Akut-Medizin Entscheidungen meist sehr rasch getroffen werden müssen. Externe Beratung in ethischen Entscheidungen könne jedoch bei längerfristigen Behandlungen außerordentlich hilfreich sein, da sie neue Perspektiven zur Problemlösung beitragen könne. In Deutschland gebe es aufgrund der geringen Institutionalisierung der Medizinethik jedoch noch zu wenige Stellen, die entsprechende Kompetenz hätten. Die ethische Reflexion sollte kontinuierlich in die tägliche Arbeit einbezogen werden. Als positives Beispiel wurde die Art und Weise genannt, in der die Bundesärztekammer ihren Richtlinienentwurf zur ärztlichen Sterbebegleitung und den Grenzen zumutbarer Behandlung zunächst einmal in der Öffentlichkeit zur Diskussion stellt. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Formulierung solcher Handlungsrichtlinien sei wünschenswert, da Medizin als Beziehungswissenschaft nur dialogisch funktioniere, also mit dem Verständnis und dem Einverständnis der Patienten. Am Ende des Werkstattgesprächs herrschte Übereinstimmung darüber, daß die Auseinandersetzung mit ethischen Aspekten des ärztlichen Tuns und dem dahinterstehenden Menschenbild in unserer heutigen Zeit wohl notwendiger denn je sei. Gegen Tendenzen zur Reduktion auf eine rein naturwissenschaftliche Sicht des Menschen müsse die Medizin eine Beziehungswissenschaft bleiben (oder wieder werden), die ihr Augenmerk verstärkt auf den „Umgang des Menschen mit dem Menschen“ richtet. Wichtig sei dabei auch die Untersuchung der psychologischen Grundlagen moralischen Handelns. Beispielsweise sei aus den Erfahrungen der NS-Medizin deutlich geworden, daß es Bedingungen gebe, unter denen das Verhältnis von Wissen und Gewissen nicht zu funktionieren scheine. Folglich sei es auch notwendig, Bedingungen im Medizinbetrieb, die unethisches Verhalten fördern, abzubauen. Vor allem aber gelte es, eine primär an der zwischenmenschlichen Beziehung orientierte Grundhaltung zu bewahren oder wieder zu gewinnen.