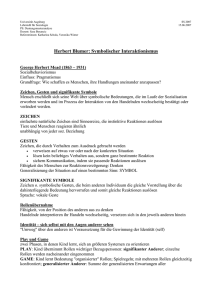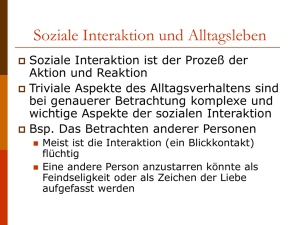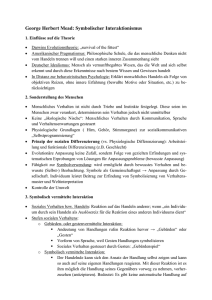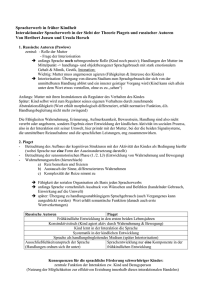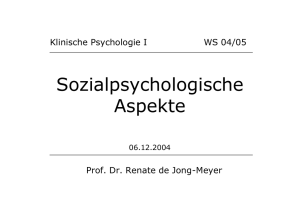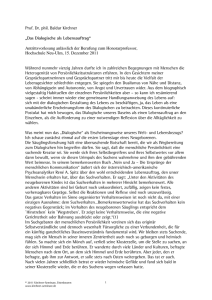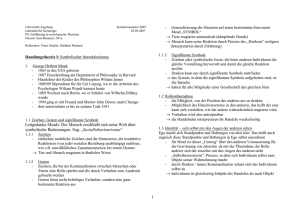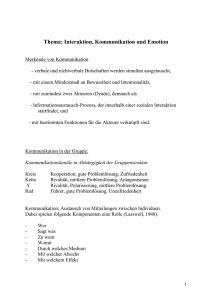2.5 Identität und Alterität - I dentität als soziale Konstruktion - A
Werbung
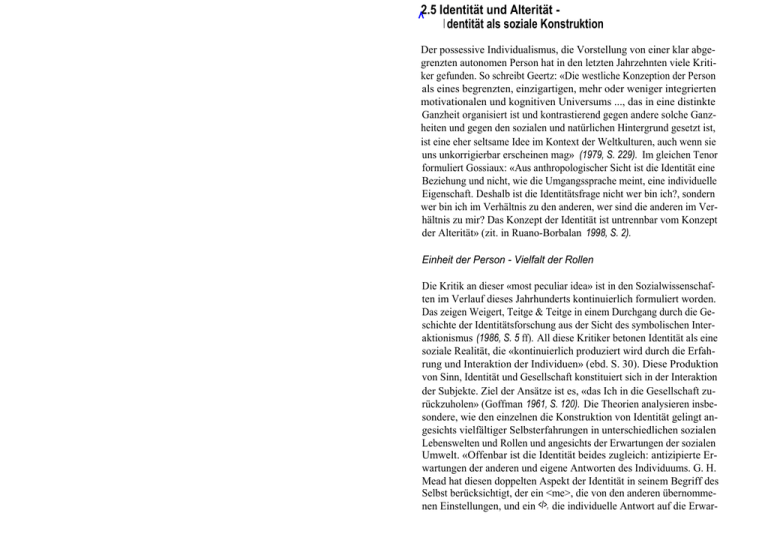
2.5 Identität und Alterität I dentität als soziale Konstruktion Der possessive Individualismus, die Vorstellung von einer klar abgegrenzten autonomen Person hat in den letzten Jahrzehnten viele Kritiker gefunden. So schreibt Geertz: «Die westliche Konzeption der Person als eines begrenzten, einzigartigen, mehr oder weniger integrierten motivationalen und kognitiven Universums ..., das in eine distinkte Ganzheit organisiert ist und kontrastierend gegen andere solche Ganzheiten und gegen den sozialen und natürlichen Hintergrund gesetzt ist, ist eine eher seltsame Idee im Kontext der Weltkulturen, auch wenn sie uns unkorrigierbar erscheinen mag» (1979, S. 229). Im gleichen Tenor formuliert Gossiaux: «Aus anthropologischer Sicht ist die Identität eine Beziehung und nicht, wie die Umgangssprache meint, eine individuelle Eigenschaft. Deshalb ist die Identitätsfrage nicht wer bin ich?, sondern wer bin ich im Verhältnis zu den anderen, wer sind die anderen im Verhältnis zu mir? Das Konzept der Identität ist untrennbar vom Konzept der Alterität» (zit. in Ruano-Borbalan 1998, S. 2). Einheit der Person - Vielfalt der Rollen Die Kritik an dieser «most peculiar idea» ist in den Sozialwissenschaften im Verlauf dieses Jahrhunderts kontinuierlich formuliert worden. Das zeigen Weigert, Teitge & Teitge in einem Durchgang durch die Geschichte der Identitätsforschung aus der Sicht des symbolischen Interaktionismus (1986, S. 5 ff). All diese Kritiker betonen Identität als eine soziale Realität, die «kontinuierlich produziert wird durch die Erfahrung und Interaktion der Individuen» (ebd. S. 30). Diese Produktion von Sinn, Identität und Gesellschaft konstituiert sich in der Interaktion der Subjekte. Ziel der Ansätze ist es, «das Ich in die Gesellschaft zurückzuholen» (Goffman 1961, S. 120). Die Theorien analysieren insbesondere, wie den einzelnen die Konstruktion von Identität gelingt angesichts vielfältiger Selbsterfahrungen in unterschiedlichen sozialen Lebenswelten und Rollen und angesichts der Erwartungen der sozialen Umwelt. «Offenbar ist die Identität beides zugleich: antizipierte Erwartungen der anderen und eigene Antworten des Individuums. G. H. Mead hat diesen doppelten Aspekt der Identität in seinem Begriff des Selbst berücksichtigt, der ein <me>, die von den anderen übernommenen Einstellungen, und ein <I>, die individuelle Antwort auf die Erwar- einer Vielzahl von Lebenswelten, die Frage der Sicherung von Kontinuität angesichts disparater Selbsterfahrungen, Mangel an subjektiven und gesellschaftlichen Sinnkonstruktionen. Zu all diesen Stichwörtern finden sich fruchtbare Überlegungen in den genannten Ansätzen. Die «dialogische Wende»: Diskurs - Macht - Anerkennung Die These einer untrennbaren Verbindung von Identität und Alterität ist zusammen mit der Betonung der diskursiven Konstruktion dieses Verhältnisses Charakteristikum des «dialogical turn», der dialogischen Wende in der Identitätsforschung. Sampson (1993) benennt als Grundlagen dieser Wende die schon erwähnten sozialkonstruktivistischen Ansätze. Hinzu kommen Überlegungen aus der Sprachphilosophie Wittgensteins und Bakhtins. Der zweite theoretische Strang für diese Wende sind Beiträge aus der feministischen Forschung (z. B. Harding 1986; Code 1991). Was lehrt uns die «dialogische Wende» über uns selbst? «Zuallerererst lernen wir, daß wir fundamental und unausweichlich dialogische, konversationale Wesen sind, deren Leben in und durch Konversationen geschaffen werden und in und durch Konversationen beibehalten oder verändert werden. ... Wir lernen, daß die Qualitäten unserer Persönlichkeit und Identität gleicherweise konversational konstituiert und durch die Dialoge mit verschiedenen anderen aufrechterhalten werden» (Sampson 1993, S. 109). Am wichtigsten allerdings ist für Sampson die Absage an das westliche Projekt des singulären Selbst: «Der andere ist ein lebendiger Mitschöpfer unseres Bewußtseins, unseres Selbst und unserer Gesellschaft» (ebd.). Diese zentrale Stellung des anderen darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß solche Beziehungen machtbestimmt sind. Sampson führt dazu den Begriff des «servicable other» ein, des dienstbaren anderen, der konstruiert wird zur Stabilisierung der eigenen Identität. «Während des größten Teils der ... Geschichte des Westens ... waren die primären Konstrukteure männlich, weiß, gebildet und Angehörige der herrschenden sozialen Klassen, während die Objekte ihrer Konstruktion als all das definiert wurden, was die herrschende Gruppe nicht ist» (1993, S. 4). Dieser Ansatz hilft Sampson, die feministische Forschung und die Rassismusforschung in sein Konzept zu integrieren. «Der Effekt dieser Konstruktionen, wenn nicht ihr bewußter Entwurf, war es, den anderen jeder genuinen Position in der Welt zu berauben und dadurch den herrschenden Gruppen zu erlauben, freier darin zu verfahren, An- erkennung für sie selbst zu erreichen und die Aufrechterhaltung ihrer Privilegien zu sichern» (a. a. O., S. 4). Die Frage der sozialen Anerkennung nimmt denn auch einen zentralen Stellenwert in dieser Diskussion ein. «Die Entdeckung der eigenen Identität heißt nicht, daß ich als isoliertes Wesen sie entschlüssele, sondern gemeint ist, daß ich sie durch den teils offen geführten, teils verinnerlichten Dialog mit anderen aushandele. Aus diesem Grund verleiht die Entwicklung eines Ideals der innerlich erzeugten Identität der Anerkennung neue und maßgebliche Bedeutung» (Taylor 1995, S. 57). Dies ist um so mehr der Fall, als «die einstmals selbstverständlichen Anerkennungsformen ihre Selbstverständlichkeit eingebüßt haben» (Anselm 1997, S. 137). Denn die Anerkennung, die durch Zugehörigkeiten erwächst, ist nicht mehr so einfach zu bekommen. In einer individualisierten Welt werden Kollektive brüchiger, und ihre Möglichkeit, einen sicheren Hafen sozialer Zugehörigkeit und daraus erwachsender Anerkennung zu bieten, schrumpft beständig. Identität, so die ins Positive gewendete These, ist ein Konstruktionsprozeß geworden, der sich in der dialogischen Erfahrung in sozialen Netzwerken vollzieht. In ihnen wird um die soziale Anerkennung gerungen. Hier ist die Bezugsebene für den kontinuierlichen Abgleich von Selbst- und Fremdwahrnehmung, der eine Identitätsbasis ist. Identität erwächst nicht mehr aus einer gemeinsamen Welt-Sicht vieler, einem ideologischen, moralischen Normenpaket, sondern aus der dialogischen Welt-Erfahrung der einzelnen in ihren Lebenswelten, und die kann nur konkret sein. «Individualität hängt von sozialer Konformität ab; der Kampf um Individualität verlangt, daß soziale Bindungen bestärkt und soziale Abhängigkeit vertieft werden. Die subjektive Welt, die die Identität der individuellen Persönlichkeit konstituiert, kann nur mittels intersubjektiven Austausches aufrechterhalten werden. In einem solchen Austausch muß der eine Partner imstande sein, <die Welt des anderen mitzutragen> ...» (Baumau 1995a, 244f). Solche idealen Anerkennungsverhältnisse werden mit der Individualisierung rarer. Einen möglichen Ausweg - so Bauman - bietet die Übernahme von auf dem Markt angebotenen Identitäten. Dann muß «soziale Anerkennung ... nicht auf dem Verhandlungswege erzielt werden - sie ist sozusagen von Anfang an in das auf dem Markt gehandelte Produkt <eingebaut>» (a. a. O., S. 250). Wenn wir der Überlegung zustimmen, daß Identität sich in der dialogischen Selbsterfahrung in verschiedenen Lebenswelten bildet, scheint es sinnvoll, mit einem Begriff der Teilidentitäten zu operieren. Denn die lebensweltlichen Erfahrungsbereiche stehen nicht nur für eine soziale Rolle, sondern auch für je spezifische Selbsterfahrungsbereiche. Als lebensweltübergreifende Identität können wir von einer Metaidentität sprechen. Sie ist das, was der erwähnten literarischen Figur des Harry Nash zu fehlen scheint. Die Frage danach, was denn eine distinkte Lebenswelt konstituiert, läßt sich vorläufig in Anlehnung an klassische Identitätsmodelle, die letztlich bei den erwähnten Handlungsaufgaben ansetzen, beantworten (vgl. Marcia 1993). Da geht es in der Regel um Herkunft, also die familiären Beziehungen, um Intimität, das heißt die Entwicklung von neuen engen Beziehungen, um Freundschaftsnetzwerke und um Arbeit als einem Realitätsbereich, der in unseren Gesellschaften eine äußerst große Bedeutung hat. Der Fokus auf die verschiedenen sozialen Lebenswelten des Individuums führt zu weiteren Fragen an eine Identitätstheorie. Die machtbestimmte Konstitution von Anerkennungsverhältnissen in diesen Lebenswelten rückt die sozialen und individuellen Ressourcen der Selbstbehauptung der einzelnen ins Blickfeld. Denn von ihnen muß es wesentlich abhängen, ob die Aufgabe der Identitätskonstruktion gelingen kann. Schon allein die Situationen in den Herkunftsfamilien müssen höchst unterschiedlich sein; das Identitätserbe der einzelnen wird also eine große Variationsbreite haben. Hinzu kommen individuelle Unterschiede, die unter gleicher sozialer Ressourcenlage die einzelnen mit höchst unterschiedlichem Erfolg die Aufgabe der Identitätskonstruktion bewältigen lassen. Eine weitere Frage ist die nach der Identitätsrelevanz von Alltagshandeln (Behringer 1998). Wenn alles Klein-Klein von lebensweltlichen Erfahrungen unter dem Postulat der Identitätsrelevanz steht, wird Identität zur «Weltformel». Alles Tun, Denken und Fühlen des einzelnen kann als relevanter Kommentar zur bekannten «Wer bin ich?»-Frage verstanden werden. Wir haben, um den Abschied vom Trompetenwort zu dokumentieren, den Begriff der alltäglichen Identitätsarbeit geprägt. Zudem reservieren wir für die Fülle von «kleinen» ich-bezogenen Wahrnehmungen über den Tag hinweg den Begriff der situativen Selbstthematisierungen, das heißt alltägliche, spontane und kurzfristige Selbstreflexionen, die kognitiv, emotional, sozial oder produktorientiert sein können. 2.6 Identität als diskursive Konstruktion die Arbeit an der eigenen Geschichte Die «dialogische Wende» verweist auf die Bedeutung von Kommunikation und damit von Sprache für die Sinnkonstruktion der Individuen: «... was auffällt, wenn wir uns ansehen, was Menschen zusammen tun, ist die Sprache als Kommunikation in Aktion. Weil wir uns so darauf konzentriert haben, tief in der Psyche des Individuums nach den Antworten auf all unsere Fragen über die Natur des Menschen zu suchen, übersehen wir in der Regel, was sich direkt vor uns befindet, einen dominierenden Aspekt unseres Lebens mit anderen: Konversationen. Es ist jetzt an der Zeit, Konversationen ernst zu nehmen» (Sampson 1993, S., 97). Einen Schritt weiter geht der Ansatz einer «narrativen Identität» mit seiner Annahme, daß die dialogische Form der Selbstkonstruktion primär im Modus der Narration, der Erzählung stattfindet. Das Konzept einer formbaren, sozial vermittelten, narrativen Identität hebt sich - wie der dialogische Ansatz im allgemeinen ab von anderen, traditionelleren Darstellungen der persönlichen Identität. Sie hatten «... persönliche Identität als etwas betrachtet, was der Erreichung eines bestimmten Bewußtseinszustandes verwandt ist. Das reife Individuum ist danach eines, welches ein stabiles Selbstgefühl oder eine feste Identität <gefunden>, <kristallisiert> oder <realisiert> hat. Im allgemeinen wird dieser Zustand als höchst positiv bewertet, und ist er einmal erreicht, können Varianz oder Inkonsistenz in jemandes Verhalten minimiert werden» (Gergen & Gergen 1988, S. 36). Im Gegensatz zu einer solchen tief empfundenen Identität steht das Konzept einer über Sprache und ihre Erzählstrukturen vermittelten Identität. Solche Überlegungen basieren auf Konzepten der narrativen Psychologie, wie sie in den letzten 20 Jahren entwickelt worden sind (Sarbin 1986; 1997; Bruner 1997b; Brockmeier & Mattes 1999). Die narrative Psychologie postuliert, daß wir uns nicht nur in der alltäglichen Interaktion in Geschichten und Erzählungen darstellen, sondern daß wir unser ganzes Leben und unsere Beziehung zur Welt als Narrationen gestalten (Mancuso 1986). «Wir träumen narrativ, tagträumen narrativ, erinnern, antizipieren, hoffen, verzweifeln, glauben, zweifeln, planen, revidieren, kritisieren, konstruieren, klatschen, hassen und lieben in narrativer Form» (Harry 1968, S. 5). Narrationen sind in soziales Handeln eingebettet. Sie machen Ereignisse sozial sichtbar und dienen dazu, vergangene Ereignisse mit der Gegenwart zu verbin- den und die Erwartung zukünftiger Ereignisse zu begründen. Die narrative Psychologie geht davon aus, «daß die Erzählung das primäre strukturierende Schema ist, durch das Personen ihr Verhältnis zu sich selbst, zu anderen und zur physischen Umwelt organisieren und als sinnhaft auslegen» (Polkinghorne 1998, S. 15). Die Ansätze einer narrativen Identität betonen die Offenheit und Unabgeschlossenheit des Sich-Erzähuuns. Das macht sie attraktiv für die Analyse der Identitätsarbeit von Subjekten, die - so unsere These als ständiger Umbauprozeß verstanden werden muß (vgl. Mey 1999). Kohärenz und Kontinuität müssen von den einzelnen immer wieder von neuem erkämpft werden. «Manche, so scheint es, haben dabei mehr Erfolg als andere. Niemand ist völlig erfolgreich. Wir versuchen es weiter. Was wir tun, ist, uns und anderen wieder und wieder die Geschichte davon zu erzählen, was uns beschäftigt und wer wir sind» (Carr 1986, S. 97). Narrative Identität kann definiert werden als «die Einheit des Lebens einer Person, so wie diese Person sie in den Geschichten erfährt und artikuliert, mit denen sie ihre Erfahrung ausdrückt» (Widdershoven 1993, S. 7; vgl. auch Ricoeur 1991; Kerby 1991; Meuter 1995). Erzählte Geschichten sind «in inhaltlich-qualitativer wie auch in formal-struktureller Sicht wichtige Konstituenten der Identität von Subjekten, insofern als sich diese in den narrativ vergegenwärtigten Zeitzusammenhängen <situieren>» (Straub 1998a, S.128). Die Art und Weise, in der das Individuum identitätsrelevante Ereignisse auf der Zeitachse aufeinander bezieht, kann (nach Gergen & Gergen 1988) als Selbsterzählung bezeichnet werden. Damit versucht das Individuum, kohärente Verbindungen zwischen einzelnen Lebensereignissen herzustellen (Kohli 1981). Diese werden dadurch verstehbar, daß sie in einer Sequenz oder einem Entfaltungsprozeß lokalisiert werden. Selbsterzählungen oder -narrationen bleiben nicht stabil, sondern bilden und verändern sich in sozialen Aushandlungsprozessen. Man kann sie als ein linguistisches Werkzeug betrachten, das von Individuen in Beziehungen konstruiert und verwendet wird, um verschiedene Handlungen zu stützen, voranzutreiben oder zu behindern. Sie sind symbolische Systeme, die für Rechtfertigung, Kritik und/ oder die Produktion von Kohärenz verwendet werden. tungen der anderen enthält» (Krappmann 1969, S. 39). Die begriffliche Scheidung hat ihre Tragfähigkeit bewiesen und findet sich auch in aktuellen Modellen (vgl. Haußer 1997). Soziale Zuschreibungen sind eine Realität menschlichen Lebens. Sie können willkommen sein, weil sie Verhaltenssicherheit bieten: Dafür, was ein «normaler» Vater, Ehemann, Chef oder Mitarbeiter zu tun hat, gibt es Rollenmodelle. Die Zuschreibungen können aber auch zu Problemen führen, wenn das Subjekt spürt, daß «es selbst» noch mehr oder auch ganz anders ist, als seine Rollen ihm vorgeben. Dadurch entsteht ja gerade das Identitätsproblem. Krappmann bringt das aus dieser Spannung resultierende Grunddilemma der Identitätsarbeit auf den Punkt: «Wie vermag sich der einzelne als besonderes, von anderen zu unterscheidendes Individuum, mit einer einmaligen Biographie und ihm eigentümlichen Bedürfnissen darzustellen, wenn er sich den angesonnenen Erwartungen, die ihn von vornherein typisierend festzulegen suchen, nicht ungestraft entziehen kann?» (1969, S. 8). Das Subjekt muß schließlich beides tun, es muß sich sozial integrieren und interaktionsfähig, aber auch «es selbst» sein und nicht nur das «Abziehbild» der relevanten Rollenmodelle. Man könnte meinen, daß die soziale Anerkennung durch Dritte um so größer ist, je weniger der einzelne einen «subjektiven Rest» hat, je weniger er von der Summe der Rollenzuschreibungen abweicht. Jemand, der in dieser Beziehung schlecht balanciert ist und - fast - nur aus «me» besteht, also keine Individualität, keine individuelle Stellungnahme und Variation zu den vorgefundenen gesellschaftlichen Rollen liefert, müßte der nicht mehr Anerkennung bekommen? Kurt Vonnegut hat in seiner Kurzgeschichte «Who am I this time?» in der Figur des Harry Nash, der nur in den Stücken des örtlichen Theatervereins auflebt, so einen Fall beschrieben. Aber aus einer solchen Position erwächst gerade keine Anerkennung. Identität geht nicht auf in den einzelnen Rollen, sondern entwickelt sich in Spannung zu ihnen. «Mit der Identitätskategorie sollen daher auch die Möglichkeiten des Individuums erfaßt werden, Autonomie gegenüber sozialen Zwängen zu bewahren» (Krappmann 1969, S. 12). Denn es ist im Gegenteil so, «daß dem Individuum desto mehr Möglichkeiten zur sozialen Interaktion offenstehen, je besser es ihm gelingt, die Besonderheit seiner Identität an der interpretativen Integration gerade divergenter Erwartungen und widersprüchlicher Handlungsbeteiligungen in den Systemen sozialer Interaktion zu erläutern» (ebd. S. 10). Das andere Extrem in dieser Polarität wären Menschen, die nur aus I» bestehen, ihr «me» nicht akzeptieren und ihre derart entstandene Interaktionsschwäche als Zeichen besonderer Stärke, Autonomie und Originalität ausgeben. Ihre soziale Interaktion ist wie bei den Überangepaßten problembelastet, nur aus dem gegensätzlichen Grund: «Mehr Individualität braucht mehr Liebe zur Unterstützung. Da sich freilich mit dem Wachstum der persönlichen Autonomie und Idiosynkrasie die Wahrscheinlichkeit der sozialen Anerkennung mindert, ist die Befriedigung um so weniger wahrscheinlich, je größer der Bedarf danach ist» (Baumau 1995a, S. 246). Der interaktionistische Zugang zur Identitätsdiskussion hat in den letzten fahren ein bemerkenswertes Echo in der Entwicklungspsychologie und -soziologie gefunden. Dies zeigt sich etwa in einem interaktionellen Entwicklungsmodell des Säuglings im Gefolge neuerer Ergebnisse der Säuglingsforschung (Stern 1992). Danach verfügt der Säugling «über angeborene Muster sozialer Reaktionsbereitschaft. Dadurch sind Mutter und Kind von Anfang an auf soziale Interaktionen vorbereitet» (Bobleber 1997, S. 95). Andere Modelle der frühkindlichen Entwicklungen rekurrieren auf den Meadschen Begriff der sozialen Interaktion. In der angelsächsischen Diskussion ist darüber hinaus die - späte - Rezeption des Entwicklungsmodells von Wygotski (1971) zu beobachten, der eine Entwicklung des Kindes vom «Sozialen zum Individuellen» - und nicht andersherum - postulierte (vgl. Stevens 1996). Aus der Sicht einer Identitätsforschung, die an der alltäglichen Konstruktion von Identität interessiert ist, bietet der interaktionistische Ansatz ein breites Repertoire an Strukturbegriffen zur Analyse von Interaktionssituationen wie auch zum Zusammenhang von Interaktion und Identität. Kohärenz und Kontinuität sind auch aus dieser Sicht Kernfragen der Identität. Entsprechend elaboriert sind die vorgelegten Konzepte, sei es als ein Zusammenspiel von «multiplen Identitäten» (Weigert, Teitge & Teitge 1986) oder als Ansatz der «balancierenden Identität» auf der Basis einer kommunikativ vermittelten «phantom normalcy» und «phantom uniqueness» (Krappmann 1969). Ein weiterer Vorzug dieser Theoriengruppe ist die unbedingte Betonung der subjektiven und sozialen Sinnkonstruktion, des «meaning making», wie Bruner (1997b) es nennt. Mit dem Fokus auf diese alltägliche Konstruktionsarbeit sind viele Aspekte der Individualisierungsdiskussion begrifflich eingefangen, ohne daß sie in deren Dramatik gekleidet würden: Kohärenz, Anerkennung, Zerrissenheit der Selbsterfahrung in