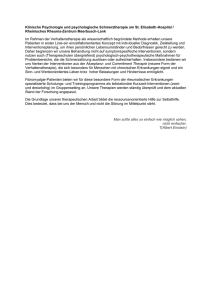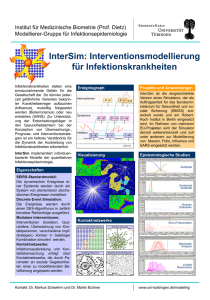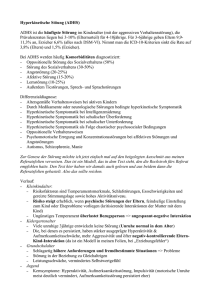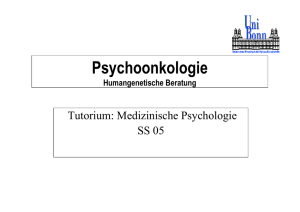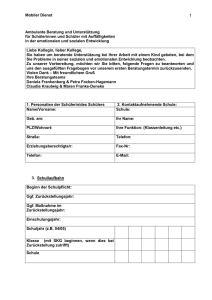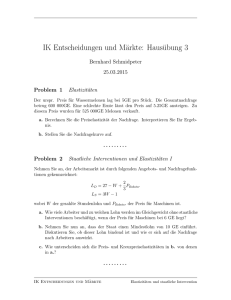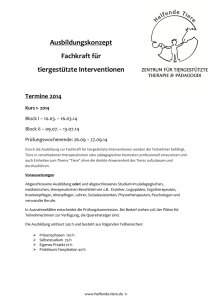Neuroethik— œ zur Beziehung zwischen
Werbung

Philosophie und/als Wissenschaft Proceedings der GAP.5, Bielefeld 22.–26.09.2003 „Neuroethik“ – zur Beziehung zwischen Neurowissenschaft und Ethik Heike Schmidt-Felzmann In jüngerer Zeit ist häufiger davon die Rede, dass eine „Neuroethik“ entwickelt werden sollte, um eine Reflexion derjenigen ethischer Fragestellungen zu leisten, die sich aus dem Fortschritt der Neurowissenschaften ergeben. Innerhalb der letzten zwei Jahre hat die Diskussion in diesem Bereich, sowohl von neurowissenschaftlicher als auch von ethischer Seite, signifikante Fortschritte gemacht. Da der Vortrag, auf dem dieser Aufsatz basiert, als Ziel eine überblickshafte Klärung der verschiedenen Aufgaben einer „Neuroethik“ hatte, werden neuere Diskussionen nur in dem Ausmaß berücksichtigt werden können, als sie zur Darstellung dieser Fragestellung beitragen. Ich unterscheide drei verschiedene Aufgaben, bei denen Neurowissenschaft und philosophische Ethik in jeweils unterschiedlichem Verhältnis zueinander stehen. Zum einen ist Forschung und klinische Praxis auf der Basis neurowissenschaftlicher Erkenntnisse in ihrer Durchführung ethischen Anforderungen unterworfen; darüber hinaus sind diese Interventionsmöglichkeiten selbst und die möglichen Veränderungen, die mit ihrer breiteren Anwendung in der Gesellschaft verbunden sind, ethisch zu beurteilen; und schließlich stellt sich auch die Frage nach den Konsequenzen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse für die Bestimmung Moralphilosophie. Angesichts der rasanten Fortschritte im Bereich der Neurowissenschaft ist in jüngerer Zeit zunehmend der Ruf nach einer „Neuroethik“ wachgeworden, die die neurowissenschaftlichen Ergebnisse ethisch reflektieren solle. Seit der Konferenz „Neuroethics: Mapping the Field“ (Marcus 2002), auf der führende Neurowissenschaftler und Bioethiker im Mai 2002 in San Francisco zusammenkamen, um eine erste Positionsbestimmung vorzunehmen, hat sich das Feld sowohl von der Seite neurowissenschaftlicher Forschung als auch der ethischen Reflexion rasant entwickelt. Churchland und Casebeer 2003, 169 sprchen von „mushrooming literature“ im Bereich der neurowissenschaftlichen Erfassung moralischer Phänomene, vor allem im Rahmen des Forschungsprogramms der sogenannten „social cognitive neuroscience“. Aber auch die ethische Diskussion neurowissenschaftlicher Verfahren und Handlungsmöglichkeiten sowie der Ergebnisse der „social cognitive neuroscience“ hat zunehmende Aufmerksamkeit erhalten. Mittlerweile sind in wichtigen neurowissenschaftlichen Zeitschriften wiederholt Artikel erschienen, die zumindest in Teilen philosophische Aspekte ethischer Fragen der Neurowissenschaft diskutieren. Der Begriff „Neuroethik“, so wie er derzeit gebraucht wird, vereint eine Anzahl recht heterogener philosophischer Fragestellungen. In den Diskussionen werden eine Vielzahl wichtiger Fragestellungen berücksichtigt, meistens allerdings ohne eine systematische Einordnung vorzunehmen.1 Ich werde im folgenden drei verschiedene Fragestellungen unterscheiden, die zu diskutierten Aufgabe einer „Neuroethik“ sein sollte, nämlich kli1 Roskies 2002 sei hier als Ausnahme erwähnt. nisch-ethische, normativ-ethische2 und moraltheoretische Fragestellungen. Ich möchte argumentieren, dass es sich dabei um philosophische Fragestellungen handelt, die nicht gänzlich neuartig sind, sondern sich prinzipiell in den Rahmen schon bestehender Diskussionsfelder einpassen lassen. Trotzdem bietet die Berücksichtigung neurowissenschaftlicher Fortschritte innovatives Potential. Zum einen müssen bestehende klinischethische Reflexionsmodelle auf neuartige Methoden und Interventionen zugeschnitten werden, was Spezifizierungen und Akzentuierungen erfordert. Darüber hinaus bietet die Neurowissenschaft sehr spezifische Formen der Erweiterung von Spielräumen individuellen und gesellschaftlichen Handelns, deren ethische Vertretbarkeit zu diskutieren ist. Und schließlich muss die Frage der Vereinbarkeit von moraltheoretischen Annahmen mit neurowissenschaftlichen Theorien und Erkenntnissen geklärt werden, wozu eine Reflexion auf die Relevanz empirischer Ergebnisse für die Moraltheorie erforderlich ist. Wie ich argumentieren möchte, müssen angesichts der neuartigen Zugangsmöglichkeiten zu neuronalem Geschehen die bisherigen Antworten auf die Frage nach dem Verhältnis zwischen empirischen Daten und Moralphilosophie überprüft werden. 1. „Neuroethik“ in der klinischen Anwendung Neurowissenschaftliche Forschung hat zur Entwicklung neuer Methoden und Interventionen beigetragen, die das klinische Handlungsspektrum deutlich erweitern. Verbesserungen und Neuentwicklungen im Bereich der bildgebenden Verfahren haben zur Folge, dass strukturelle und funktionale Eigenschaften des Gehirns mittlerweile relativ risikoarm und präzise erfasst werden können. Hinzu kommt auch zunehmendes Wissen über die Eigenschaften von neuronalen Strukturen, das sich etwa in der Entwicklung neuartiger psychopharmakologischer und operativer Behandlungsverfahren niederschlägt, wie beispielsweise der Entwicklung von sehr spezifisch wirkenden Antidepressiva, der Durchführung von Zell-Transplantationen in bestimmten Hirnstrukturen bei der ParkinsonKrankheit oder die Verwendung von Implantaten, die neuronale Strukturen ersetzen oder funktionale Störungen beheben oder ausgleichen sollen, z.B. Pacemaker bei Parkinson oder Retina-Implantate. Und nicht zuletzt werden sogenannte „Brain-ComputerInterfaces“ (BCI) entwickelt, mit deren Hilfe Gehirnsignale von Personen mit einem Computer so erfasst werden sollen, dass kommunikationsunfähigen Patienten mit intaktem Großhirn, beispielsweise ALS-Patienten oder anderen „Locked-in“-Patienten, dadurch die Kommunikation mit der Außenwelt oder die Steuerung von Artefakten ermöglicht wird. Derartige Diagnosemethoden und Interventionen stellen ihre Anwender in der klinischen Praxis vor ethische Herausforderungen. Kann die klinische Ethik das konzeptuelle 2 Selbstverständlich sind auch klinisch-ethische Fragestellungen in umschriebenem Sinne normativethisch, und wie weit metaethische Fragestellungen tatsächlich von normativ-ethischen Fragestellungen zu trennen sind, ist ebenfalls fraglich. Vorgeschlagene Alternativen wie „sozial-ethisch“ oder „ethische Implikationen“ scheinen aber gegenüber der gewählten Bezeichnung keine Verbesserung zu bringen. 637 Rüstzeug bereitstellen, das nötig ist, um die ethisch akzeptable Anwendung dieser Methoden und Interventionen zu gewährleisten? Wichtige Aspekte des Einsatzes dieser neuen Verfahren können in der Tat im Rahmen der etablierten klinisch-ethischen Reflexionsmodelle erfasst werden: Bildgebende Verfahren können beispielsweise als eine Methode unter anderen verstanden werden, mittels derer Informationen über Personen erfasst werden. Die Erhebung und der Umgang mit solchen Informationen muss denselben Anforderungen gerecht werden wie dies für andere Patientendaten auch gilt. Neben Verpflichtungen der Vertraulichkeit umfasst dies die Anforderung informierter Einwilligung, was beispielsweise Aufklärung über den Zweck der Erhebung, die Art der erhobenen Informationen, das Risiko des Vorgehens und die voraussichtliche Verwendung der Informationen beinhaltet. Insofern als aus erhobenen Daten Hinweise auf latente Störungen ersichtlich werden können, gelten Erwägungen, die im Kontext der Genetik diskutiert worden sind. Hierzu gehört beispielsweise die Verpflichtung, dem Patienten vor der Datenerhebung offenzulegen, welche praktischen und persönlichen Konsequenzen die Verfügbarkeit dieser Daten haben kann, sowie klare und ausreichend restriktive Bestimmungen, die festlegen, unter welchen Bedingungen eine derartige Datenerhebung erlaubt ist, und so einen möglichst weitgehenden Schutz der Betroffenen gewährleisten. Klinische Entscheidungen in diesem Kontext bedürfen zudem der Abklärung der Kompetenz des Patienten, was insbesondere im Falle gravierender neuronaler Schädigungen oder Dysfunktionen relevant wird, die oft mit signifikanten Einschränkungen der Kompetenz einhergehen.3 Eine weitere wichtige Fragestellung, die ebenfalls im Rahmen der klinischen Ethik ausführlich diskutiert worden ist, betrifft die ethischen Anforderungen an die Durchführung riskanter Eingriffe und experimenteller Verfahren. Neurowissenschaftlich basierte Methoden und Interventionen sind oft noch in experimentellem Stadium, ihr Risiko sowie das Ausmaß möglicher Schädigungen ist schwer abschätzbar; entsprechend ist der Abwägung zwischen erwartbarem Nutzen und Risiko besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Neurowissenschaftlich fundierte Verfahren haben allerdings eine Besonderheit, gegenüber anderen klinischen Fällen: Sie sind vor allem dadurch charakterisiert, dass mit dem Bezug auf das Gehirn die Grundlage derjenigen Eigenschaften betroffen ist, die wesentliche Determinanten des individuellen Person-Seins darstellen. Im Vergleich zu denjenigen klinischen Interventionen, bei denen die Bestimmung von Autonomie, Schädigung und Nutzen für den Patienten vor dem Hintergrund konstanter weitgehend personaler Eigenschaften vorgenommen wird, werden durch die Relevanz von Fragen der personalen Identität die ethischen Erwägungen komplexer. Der klinische Umgang mit Störungen sowie Verfahren, die die Persönlichkeit des Patienten betreffen und sie verändern könnten, ist allerdings nicht erst das Resultat neuartiger neurowissenschaftlicher Verfahren, sondern ist schon in der klassischen Psychiatrie und herkömmlichen Neurochirurgie erforderlich. Angesichts der Diskussionslage in diesem Bereich könnte aber die Diskussion der neurowissenschaftlich basierten Interventionen von Wert für eine 3 Vgl. auch Moreno 2003, 152, Farah 2002, 1127. 638 generell verbesserte Integration von Fragen personaler Identität und klinischer Ethik sein.4 Es scheint also, dass wichtige ethische Probleme der klinischen Anwendung neurowissenschaftlich fundierter Verfahren sich im Rahmen bisheriger Diskussionen der klinischen Ethik erfassen lassen, wenn sie auch, über die üblichen Reflexionen zu Autonomie sowie zur Schadens- und Nutzensabwägung hinaus, in besonderem Maße die Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Persönlichkeit und Personalität der Betroffenen erfordern. „Neuroethik“ in diesem Sinne bezeichnet also ein Anwendungsfeld der klinischen Ethik, dessen Besonderheiten nicht so ausgeprägt sind, dass sie grundsätzlich den Rahmen bisheriger klinischer Ethik sprengen würden. 2. „Neuroethik“ und der menschliche Umgang mit Neurotechnologien Die Anwendungsmöglichkeiten neurowissenschaftlich fundierter Methoden und Interventionen werfen nicht alleine Fragen im Hinblick auf ihre ethisch verantwortliche Anwendung in klinischen Zusammenhängen auf, sondern betreffen auch die ethische Bewertung dieser neuen Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten selbst, sowohl im Hinblick auf die ethische Beurteilung von Einzelfällen als auch von gesellschaftlichen Konsequenzen, die sich aus ihrer breiten Anwendung ergeben könnten. Ein zentrales ethisches Problem in diesem Zusammenhang könnte man als „big brother“-Problem bezeichnen. Neurowissenschaftlich fundierte Methoden können Einblick in Informationen gewähren, die nach gängigem Verständnis zur Intimsphäre der Person gehören und deren öffentliche Zugänglichkeit und Verfügbarkeit einen empfindlichen Einfluss auf das Leben dieser Personen haben könnten. Hierbei geht es zum einen um Konsequenzen des Zugangs zu Indizien manifester oder latenter Erkrankungen oder erhöhten Krankheitsrisikos. Insofern als es mit diesen Methoden erfassbare Frühindikatoren für Krankheiten wie etwa Schizophrenie, Depression oder Alzheimer geben könnte, ähneln sich die Möglichkeiten der Neurowissenschaft und der Genetik, und damit auch die ethischen Fragen des Umgangs mit solchen Informationen. Gerade im Hinblick auf diejenigen Störungen, die nach derzeitigem Wissen nicht ausreichend genetisch determiniert sind, wie etwa die meisten psychischen Störungen, könnte der Blick auf das Gehirn allerdings bessere Voraussagen erlauben als die Analyse genetischer Anlagen.5 Noch brisanter ist in diesem Fall die Möglichkeit des Zugang zu aktuellen psychischen Zuständen. Dies betrifft zwar einen eingeschränkten Bereich von Reaktionen – von „Gedankenlesen“ kann nicht die Rede sein – doch ist es beispielsweise möglich 4 5 Bisher findet sich eine solche gemeinsame Berücksichtigung vor allen Dingen in Hinblick auf ethische Anforderungen bei psychiatrischen Patientenverfügungen. Die Möglichkeit einer zuverlässigen individuellen Diagnose anhand bildgebender Verfahren ist aber, anders als im Bereich der Genetik, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gegeben. Aussagekräftige Unterschiede haben sich bisher vor allen Dingen in Gruppenuntersuchungen ergeben; allerdings gibt es in Hinblick auf einige Bereiche Beobachtungen, dass schon jetzt in Einzelfällen trennscharfe Unterscheidungen vorgenommen werden können. 639 festzustellen, ob Menschen bestimmte Informationen neu oder bekannt sind oder wie intensiv emotionale Reaktionen unter bestimmten Bedingungen oder zu bestimmten Reizen sind. Ebenso sind Indikatoren für das Bestehen genereller Charaktermerkmale und Handlungstendenzen benannt worden. Solche Informationen könnten nicht zuletzt auch in forensischen Kontexten, etwa zur Beurteilung der Gefährlichkeit von Personen, verwendet werden.6 Ohne derartige Methoden wäre der Zugang zu solchen Informationen nur über introspektive Aussagen der Person oder das indirekte Erschließen anhand ihres früheren oder gegenwärtigen Verhaltens möglich. Das hieße, dass Personen noch ein gewisses Maß an Kontrolle darüber bliebe, welche Informationen öffentlich werden.7 Dieses Maß an Kontrolle scheint für einige der neueren Methoden nicht mehr gegeben zu sein, so dass der Zugang zu diesen Informationen auch gegen den Willen der betroffenen Person möglich wäre.8 Die ethische Beurteilung dieser Verfahren kann im Kontext schon bestehender Reflexionen zum Schutz vertraulicher Informationen und zur Reichweite legitimer staatlicher Interventionen geschehen. In Bezug auf die hier genannten Interventionen wäre zu klären, wer das Recht hat, solche Informationen zu erheben und vor allem welche Rechte dem Individuum in Bezug auf ihre Verfügbarkeit und ihren Gebrauch zukommen sollen (Farah 2002, 1125). Insofern als Interesse an derartigen Informationen beispielsweise bei Gerichten, Arbeitgebern oder Krankenkassen bestehen kann, können sich signifikante praktische Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen ergeben. Gerade die Verfügbarkeit derartiger Daten in den Händen staatlicher Gewalt und deren soziale Konsequenzen sind in diesem Zusammenhang zu reflektieren. Angesichts des Interesses beispielsweise an der breiten Verfügbarkeit biometrischer Daten im Rahmen der Terrorismusbekämpfung scheint ein staatlicher Anspruch auf Verfügbarkeit auch derartiger Informationen eine realistische und in ethischer Hinsicht zu bedenkende Möglichkeit. Ein zweiter wichtiger ethischer Fragenkomplex könnte als „brave new world“Problem bezeichnet werden und betrifft die Konsequenzen der breiten Anwendung bestimmter neurowissenschaftlich basierter Interventionen. Insbesondere Möglichkeiten der psychischen Optimierung („enhancement“) sind in diesem Zusammenhang relevant, d.h. die Nutzung von Interventionen zur Veränderung psychischer Eigenschaften unabhängig vom Bestehen eindeutiger klinischer Störungsbilder. Beispielsweise ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass zunehmend auch in Abwesenheit klinischer Störungen Ritalin zu Zwecken der Leistungssteigerung oder Prozac und andere Antidepressiva zur Verbesserung des Befindens und der Selbstsicherheit eingesetzt werden; ähnliche 6 7 8 So scheint es derzeit nicht unrealistisch, dass neuronale Korrelate von pädophilen Tendenzen, Gewaltbereitschaft, Rassismus oder auch der Rückfallgefahr bei Sucht ausreichend zuverlässig identifiziert werden könnten. Selbst die sogenannten Lügendetektoren sind aufgrund ihrer Erfassung bloß unspezifischer physiologischer Reaktionen noch in gewissem Maß durch die Person kontrollierbar. Ähnliches gilt auch für den Unterschied zwischen Psychotherapien oder Trainings, denen gegenüber die Person Widerstand zeigen kann, und den nicht willentlich beeinflussbaren Effekten zuverlässig verabreichter Medikation andererseits, wie etwa Farah 2002, 1126f. hervorhebt. Moreno 2003, 151 greift vergleichbare Fragestellungen im Kontext von Fragen personaler Identität auf. 640 Konsequenzen werden für den Fall breiterer Verfügbarkeit des Schlaf reduzierenden Mittels Provigil angenommen oder der in Entwicklung befindlichen gedächtnisfördernden Mittel.9 Eine derartigen Nutzung kann in verschiedenen Hinsichten als problematisch betrachtet werden, die wiederum denjenigen ähneln, die oft im Kontext der Diskussion genetischer Interventionen genannt werden. So ist einerseits das Nivellierungsargument zu nennen, d.h. dadurch dass die natürlichen Unterschiede zwischen Menschen reduziert werden, könnten abweichende Eigenschaften zunehmend stigmatisiert werden. In diesem Zusammenhang wird oft auch das Argument der Verschiebung der Norm genannt: Diejenigen, deren Fähigkeiten heute noch durchschnittlich sind, würden in Abwesenheit optimierender Interventionen plötzlich als unterdurchschnittlich gelten, mit entsprechenden sozialen Konsequenzen. Wie Kritiker bemerken, ist es wahrscheinlich, dass in Leistungsgesellschaften der soziale Druck zu einer breiten Verwendung verfügbarer Optimierungsmethoden führen wird. Die Möglichkeit von „Zwangsoptimierungen“ und die damit verbundene Frage der Legitimität von Interventionen, die personale Identität betreffen, sind ein weiteres Problem, das etwa von Moreno 2003, 151 reflektiert wird. Gleichzeitig ist auch die Vergrößerung sozialer Unterschiede erwartbar, wenn „optimierende“ Interventionen nur denjenigen offenstehen, die dafür bezahlen können (Farah 2002, 1125). Problematisch ist hierbei, dass diese Interventionen nicht nur die Ungleichheit der sozialen Situation vergrößern, sondern die Fähigkeiten selbst betreffen, deren natürliche Unterschiede soziale Mobilität ermöglichen. Auf grundsätzlicherer Ebene wird auch der intrinsische Wert einer derartigen Optimierung diskutiert: Schwächen, Verwundbarkeiten, Leiden und die Unterschiedlichkeit von Menschen gehören wesentlich zur menschlichen Existenz, wie wir sie kennen, und es kann befragt werden, ob deren Kontrolle nach derzeitigen Wertvorstellungen eine durchweg positive Veränderung der menschlichen Lebensform zur Folge hätte. Während viele der mit optimierenden Interventionen verbundenen ethischen Probleme sich so oder ähnlich auch im Kontext der genetischen Optimierung stellen,10 gibt es mindestens zwei wesentliche Unterschiede: Zum einen ist, anders als im Falle genetischer Optimierung, der Gebrauch dieser Möglichkeiten schon jetzt gesellschaftliche Realität, so dass ihre ethische Reflexion von erhöhter Dringlichkeit ist. Darüber hinaus handelt es sich um Interventionen, für deren Anwendung sich in den meisten Fällen die betroffene Person selbst entscheidet,11 so dass der Frage des Respekts von autonomen Entscheidungen erhöhte Relevanz zukommt. „Neuroethik“ steht also auch im Kontext dieser Fragestellungen in engem Bezug zu schon bestehenden Diskussionszusammenhängen, welchen die Auseinandersetzung mit grundlegenden Fragen darüber erforderlich machen, welche Form menschliches Leben haben sollte und welche Charakteristika für das menschliche Leben in einer Gesell9 10 11 Vgl. auch Farah 2002, 1123f. Vgl. auch Moreno 2003, 151. Dies ist im Falle der Verwendung von Ritalin bei Kindergarten- und Schulkindern allerdings nicht der Fall. 641 schaft wünschenswert sind. Angesichts der Möglichkeiten neurowissenschaftlich basierter Methoden und Interventionen stellen sich aber einige dieser Fragen auf neuartige Weise – oder mit größerer Dringlichkeit. 3. „Neuroethik“ und Moralphilosophie Anders als die oben genannten Fragen einer Neuroethik, deren Integration in bisherige bioethische Reflexionen im Prinzip unkontrovers erscheint, ist die Integration neuroethischer Fragestellungen in die Moraltheorie als ein deutlich umstritteneres Projekt anzusehen. Die zentrale Frage in diesem Zusammenhang ist, ob anhand neurowissenschaftlicher Ergebnisse moraltheoretische Fragen neu zu überdenken und eventuell zu revidieren sind – und „Neuroethik“ in diesem Sinne würde diese Frage zumindest in bestimmten Hinsichten zustimmend beantworten. Neurowissenschaftliche Forschung gewinnt zunehmend Zugang zu den neuronalen Korrelaten moralischen Wahrnehmens, Denkens und Handelns.12 Bisher widmet sich die Forschung vor allen Dingen der Identifizierung von neuronalen Strukturen, die am moralischen Denken und Handeln beteiligt sind und zieht daraus Schlussfolgerungen dahingehend, welche psychischen Funktionen moralisches Denken und Handeln bestimmen. Eine zentrale Frage dabei ist das Zusammenspiel von kognitiven und affektiven Faktoren. Forschung an neuronal geschädigten, sozial auffälligen sowie normalen Versuchspersonen deutet darauf hin, dass Strukturen, die der emotionalen Verarbeitung dienen, nicht alleine in der Umsetzung moralischen Handelns, sondern wesentlich auch an der kognitiven Verarbeitung moralisch relevanten Materials beteiligt sind, und deren Schädigung die Entwicklung und Realisierung moralischen Denkens und Handelns signifikant beeinträchtigt. Affektive Elemente scheinen hiernach Moralität sowohl in kognitiver als auch praktischer Hinsicht zu ermöglichen anstatt einen bloßen motivationalen Zusatz darzustellen oder sie gar zu beeinträchtigen. Untersuchungen, die auf die Abhängigkeit erfolgreicher moralischer Praxis von bestimmten neuronalen Gegebenheiten hinweisen, werden vor allen Dingen im Hinblick auf ihre Relevanz für moralische Verantwortlichkeit diskutiert (Farah 2002, 1127). Neurowissenschaftliche Ergebnisse können beispielsweise unser Verständnis dessen verändern, was es heißt, dass jemand „anders hätte handeln können“. Beispielsweise gibt es zunehmend Hinweise darauf, dass die Fähigkeit, moralische Normen zu erwerben und zu befolgen von der Funktionalität bestimmter neuronaler Strukturen abhängig ist, und diese möglicherweise kaum durch Lernerfahrungen zu modifizieren sind. Sind solche Ergebnisse relevant für die Kriterien, die wir anlegen, um jemanden moralisch für sein Verhalten zur Verantwortung zu ziehen? Walter 2003 argumentiert, dass diese Ergebnisse dazu führen könnten, dass bisher angelegte Kriterien für Verantwortlichkeit in einem neuen Licht erscheinen könnten.13 Neurowissenschaftliche Daten bieten hier mehr als die bisher üblichen, generell formulierten Argumente zur kausalen Determina12 13 Für Überblicksreferate vgl. Greene, Haidt 2002, Moll 2003, Casebeer, Churchland 2003. Für weitere Reflexionen zu diesem Thema, vgl. auch Farah 2002, 1128, Moreno 2003, 149f. 642 tion, insofern als jetzt kausale Ursachen, die der Realisierung moralischen Verhaltens entgegenstehen, deutlich spezifischer und direkter identifiziert werden können als bisher möglich. Die mögliche Relevanz neurowissenschaftlicher Ergebnisse stellt sich allerdings nicht bloß in Hinblick auf die spezifische Frage von Verantwortlichkeit, sondern auch im Hinblick auf allgemeinere meta-ethische Fragestellungen. In der Philosophie des Geistes ist die Tendenz zu bemerken, zunehmend neurowissenschaftliche Ergebnisse in philosophische Theorien einzubeziehen, nicht allein zu illustrativen Zwecken, sondern als relevanter Bezugspunkt bei der Bestimmung der Adäquatheit der philosophischen Position. Der Ruf nach einer „Neuroethik“ könnte nicht zuletzt gespeist sein durch die Vorstellung, der Bereich der Moralphilosophie sollte auf ähnliche Weise mit der Neurowissenschaft verbunden werden wie in der Philosophie des Geistes. Allerdings wird oft von moralphilosophischer Seite angenommen, dass die Philosophie des Geistes und die Moralphilosophie sich wesentlich dadurch unterscheiden, dass letztere sich nicht mit deskriptiven, sondern normativen Urteilen befasst. Ist also der Versuch, Verbindungen zwischen Neurowissenschaft und Moralphilosophie zu ziehen aufgrund der Normativität des Gegenstandsbereichs zum Scheitern verurteilt? Dies ist nicht notwendigerweise der Fall, da das Verhältnis zwischen beiden auf unterschiedliche Weisen konzeptualisiert werden kann. Man kann zunächst zwei Extrempositionen in Bezug auf Moralität unterscheiden, einerseits einen starker Normativismus, andererseits einen starker Naturalismus.14 Der starke Normativismus beansprucht, dass die Geltung moralischer Normen unabhängig von den Möglichkeiten ihrer empirischen Implementierung zu bestimmen ist. Das heißt, ob Menschen in der Lage sind, diesen normativen Ansprüchen gerecht zu werden, ist ohne Einfluss darauf, ob die Normen gelten. Der starke Naturalismus beansprucht hingegen, dass moralische Normen sich vollständig aus empirischen Gegebenheiten ableiten lässt. Beide Positionen haben bekannte Probleme: Ganz grob gesagt, hat der starke Normativismus den Preis, dass normative Vorstellungen von tatsächlicher moralischer Praxis losgelöst werden, während der starke Naturalismus außer Acht zu lassen scheint, dass Moralität sich üblicherweise mit Idealen des Handelns befasst, die das natürlich Vorfindliche transzendieren. Alternativ dazu lassen sich gemäßigtere Positionen unterscheiden. Ein gemäßigter Normativismus gesteht zu, dass die Möglichkeiten empirischer Implementierung begrenzen, welche normativen Forderungen für Menschen gelten können. Das heißt, auch wenn die Normen ihre Geltung nicht aus der Empirie beziehen, so können trotzdem nur solche Normen als gültig bestimmt werden, welche den tatsächlich gegebenen Fähigkeiten von Menschen entsprechen. Ein gemäßigter Naturalismus beansprucht hingegen, dass empirische Daten in die Bestimmung von Normen selbst einfließen, ohne dass da14 Um der Komplexität metaethischer Fragestellungen gerecht zu werden, wären an dieser Stelle weitere Differenzierungen – im Hinblick etwa auf moralische Gründe, moralische Urteile und moralisches Handeln – erforderlich, die allerdings in diesem Rahmen nicht geleistet werden können. Für den Zweck dieser Diskussion soll dieser grobe Aufriss ausreichen. 643 bei allerdings eine vollständige Reduktion ihres Gehalts auf empirisch Vorfindliches anzunehmen ist. Das heißt, empirische Daten geben wichtige Hinweise darauf, welche Elemente in diesen Normen zu berücksichtigen wären, ohne allerdings damit die genaue Ausformung der Normen selbst vorzugeben. Implizit in einigen neurowissenschaftlichen und moralpsychologischen Diskussionen scheint etwa die Annahme zu sein, dass das konstruktive Potential dieser Forschung darin bestehen könnte, eine Revision moralischer Konzeptionen auf der Basis der wissenschaftlich identifizierten funktionalen Elemente moralischer Praxis anzustreben, ohne dabei aber spezifische inhaltliche Normen vorzugeben, wie es etwa die klassische evolutionäre Ethik angestrebt hatte. Im Falle der Annahme beider gemäßigter Positionen ist der Einbezug neurowissenschaftlicher Forschung für die Moralphilosophie insofern relevant, als sie Anhaltspunkte über diejenigen Funktionen gibt, die in moralischem Denken und Handeln involviert sind. Diese Forschung hilft, das moralische Subjekt als ein empirisches zu konzeptualisieren und den ihm de facto zur Verfügung stehenden Denk- und Handlungs-Spielraum genauer zu bestimmen. Der besondere Vorteil der Neurowissenschaft gegenüber anderen empirischen Disziplinen, wie etwa der Moralpsychologie, ist die Möglichkeit, einen direkteren und möglicherweise differenzierteren Zugang zu psychischen Funktionen zu erhalten als dies etwa durch Verhaltensbeobachtungen oder introspektive Aussagen möglich ist. Bildgebende Verfahren zeigen, was genau das Gehirn bei der Erfüllung bestimmter Aufgaben tut, und diese Daten können in Verbindung gesetzt werden damit, wie andere Arten von Aufgaben gelöst werden, worin sie sich ähneln oder unterscheiden. Hierdurch besteht die Chance, auch interne Bedingungen der praktischen Realisierung von Moralität zu identifizieren und Erwartungen an das moralische Subjekt entsprechend zu modifizieren. Im Rahmen einer gemäßigten naturalistischen Position könnte die Berücksichtigung empirischer Daten noch weitergehende Konsequenzen haben. So könnten etwa neuronale Charakteristika zur Differenzierung und Klassifizierung von Elementen moralischer Praxis herangezogen werden. Beispielsweise könnten neuronale Charakteristika zur Bestimmung der zentralen Elemente sowie der Reichweite und des Kernbereichs von Moralität herangezogen werden und mit bisherigen philosophischen Annahmen abgeglichen werden, in einem Prozess den Casebeer und Churchland 2003, 171 als „co-evolution“ beschreiben. Sie könnten dazu genutzt werden, verschiedene Klassen moralischer Situationen oder Urteile zu unterscheiden und normative Ähnlichkeiten oder Unterschiede in Zusammenhang zu derart bestimmten empirischen Unterschieden zu setzen.15 Eine solche Position könnte immer noch als gemäßigt bezeichnet werden, solange sie vor allen Dingen funktionale Gesichtspunkte der neuronalen Realisierung moralischer Praxis berücksichtigt, die mit einer Anzahl unterschiedlicher moralischer Inhalte vereinbar sein könnten. 15 Casebeer und Churchland 2003, 189 scheinen beispielsweise auf einer solchen Basis zu vertreten, dass der Unterschied zwischen prudentiellen und moralischen Urteilen weniger groß ist, als moraltheoretisch oft angenommen. 644 Nur wenige Autoren im Bereich der „Neuroethik“ haben sich bisher explizit und ausführlicher zu metaethischen Fragestellungen in diesem Bereich geäußert. Casebeer 2003, Casebeer, Churchland 2003 und Greene 2002, 2003 gehören zu den wenigen Ausnahmen, unterscheiden sich aber signifikant in den Konsequenzen, die sie aus den empirischen Ergebnissen ziehen. Während Casebeer und Churchland einen (anscheinend weitgehend) gemäßigten Naturalismus vertreten und in neurowissenschaftlichen Untersuchungen eine Unterstützung für aristotelische Positionen sehen, vertritt Greene einen gemäßigten Normativismus.16 Auch wenn signifikante Unterschiede zwischen beiden Positionen bestehen, bleibt mindestens offen, ob eine eindeutige Grenze zwischen einer Position, die neurowissenschaftliche Forschung nur zur Begrenzung anderweitig gewonnener moralischer Normen einsetzt, und einer Position, die diese auch zur positiven Bestimmung von Moralität verwendet, gezogen werden kann. Sollten klare neuronale Differenzen zwischen Fällen identifizierbar sein, die zunächst in normativer Hinsicht gleich beurteilt würden, könnten diese Unterschiede unter Umständen auch bei einem gemäßigten Normativisten in die erneuten Überprüfung der vorgängigen moralischen Analyse eingehen. Welches nun tatsächlich die Rolle neurowissenschaftlicher Ergebnisse für die Moralphilosophie sein wird, wird in den nächsten Jahren sicherlich differenzierter und intensiver als bisher diskutiert werden können.17 Literatur Casebeer, W. (2003): „Moral cognition and its neural constituents“, in: Nature Reviews Neuroscience 4, 841–847. Casebeer, W., P.S. Churchland (2003): „The Neural Mechanisms of Moral Cognition: A Multiple-Aspect Approach to Moral Judgment and Decision-Making“, in: Biology and Philosophy 18(11), 169–194. Farah, M. (2002): „Emerging ethical issues in neuroscience“, in: Nature Neuroscience 5(11), 1123–1129. Greene, J. (2002): The Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Truth About Morality and What to Do About It. Ph.D. Thesis, Princeton University. — (2003): „From neural ‘is’ to moral ‘ought’: what are the moral implications of neuroscientific moral psychology?“, in: Nature Reviews Neuroscience 4, 847– 850. Greene, J., J. Haidt (2002): „How (and Where) Does Moral Judgment Work?“, in: Trends in Cognitive Sciences 6, 517–523. 16 17 Dieser ist allerdings mit der Annahme moralischen Fiktionalismus’ gekoppelt, wodurch zwar die Normativität moralischer Praxis anerkannt wird, ihr aber im Sinne einer „error theory“ die Geltung in dem Sinne, der innerhalb der Praxis beansprucht wird, abgesprochen wird. Eine ausführlichere Diskussion der damit verbundenen Probleme findet sich in Greene 2002. Leser, die Interesse an Literatur zu hier erwähnten, aber nicht zitierten neurowissenschaftlichen Forschungsergebnissen haben, können sich für bibliographische Angaben gerne an mich wenden unter [email protected]. 645 Greene, J., et al. (2001): „An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment“, in: Science 293, 2105–2108. Marcus, S. (Hg.) (2002): Neuroethics: Mapping the field: Conference Proceedings. New York: The Dana Press. Moll, J. et al. (2003): „Morals and the human brain: a working model“, in: NeuroReport 14(3), 299–305. Moreno, J. (2003): „Neuroethics: an agenda for neuroscience and society“, in: Nature Reviews Neuroscience 4, 149–153. Roskies, A. (2002): „Neuroethics for the New Millennium“, in: Neuron 35, 21–23. Walter, H. (2003): „Neurophilosophical perspectives on conservative compatibilism“, in: C. Kanzian, J. Quiterrer, E. Rungaldier (Hg.): Persons. An Interdisciplinary Approach Proceedings of the 25th International Wittgenstein Symposium. Wien: hbt-öbv. 646