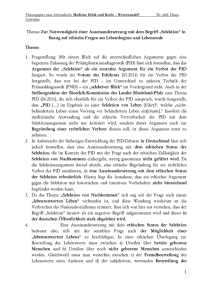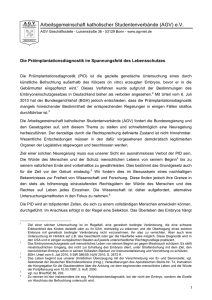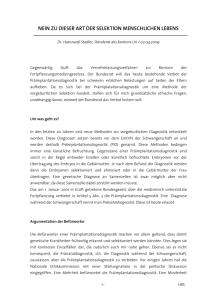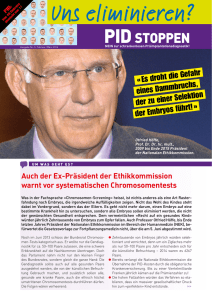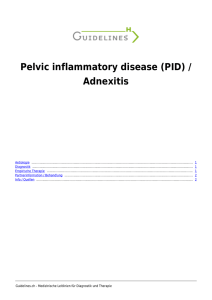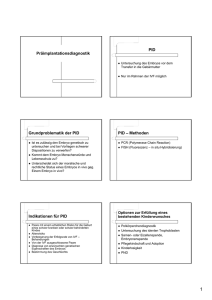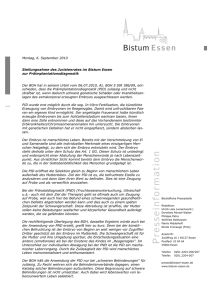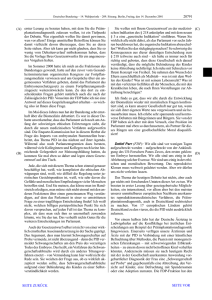Mitteilungen 97 (September 2002): Selektion und Solidarität
Werbung
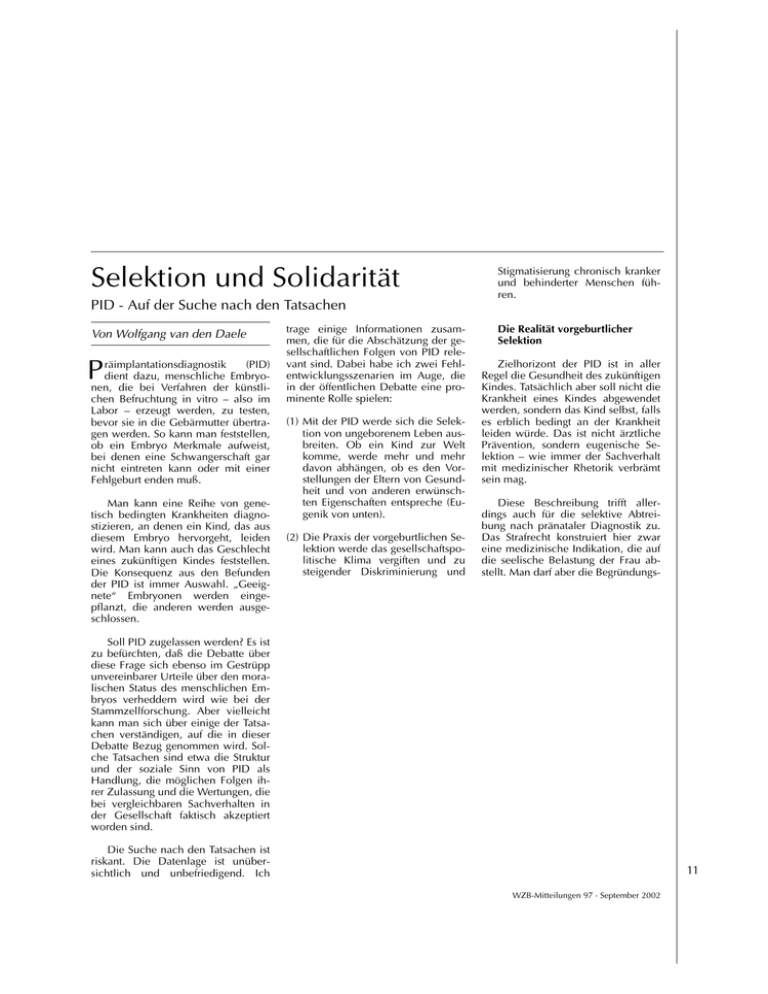
Selektion und Solidarität PID - Auf der Suche nach den Tatsachen Von Wolfgang van den Daele P räimplantationsdiagnostik (PID) dient dazu, menschliche Embryonen, die bei Verfahren der künstlichen Befruchtung in vitro – also im Labor – erzeugt werden, zu testen, bevor sie in die Gebärmutter übertragen werden. So kann man feststellen, ob ein Embryo Merkmale aufweist, bei denen eine Schwangerschaft gar nicht eintreten kann oder mit einer Fehlgeburt enden muß. Man kann eine Reihe von genetisch bedingten Krankheiten diagnostizieren, an denen ein Kind, das aus diesem Embryo hervorgeht, leiden wird. Man kann auch das Geschlecht eines zukünftigen Kindes feststellen. Die Konsequenz aus den Befunden der PID ist immer Auswahl. „Geeignete“ Embryonen werden eingepflanzt, die anderen werden ausgeschlossen. trage einige Informationen zusammen, die für die Abschätzung der gesellschaftlichen Folgen von PID relevant sind. Dabei habe ich zwei Fehlentwicklungsszenarien im Auge, die in der öffentlichen Debatte eine prominente Rolle spielen: (1) Mit der PID werde sich die Selektion von ungeborenem Leben ausbreiten. Ob ein Kind zur Welt komme, werde mehr und mehr davon abhängen, ob es den Vorstellungen der Eltern von Gesundheit und von anderen erwünschten Eigenschaften entspreche (Eugenik von unten). (2) Die Praxis der vorgeburtlichen Selektion werde das gesellschaftspolitische Klima vergiften und zu steigender Diskriminierung und Stigmatisierung chronisch kranker und behinderter Menschen führen. Die Realität vorgeburtlicher Selektion Zielhorizont der PID ist in aller Regel die Gesundheit des zukünftigen Kindes. Tatsächlich aber soll nicht die Krankheit eines Kindes abgewendet werden, sondern das Kind selbst, falls es erblich bedingt an der Krankheit leiden würde. Das ist nicht ärztliche Prävention, sondern eugenische Selektion – wie immer der Sachverhalt mit medizinischer Rhetorik verbrämt sein mag. Diese Beschreibung trifft allerdings auch für die selektive Abtreibung nach pränataler Diagnostik zu. Das Strafrecht konstruiert hier zwar eine medizinische Indikation, die auf die seelische Belastung der Frau abstellt. Man darf aber die Begründungs- Soll PID zugelassen werden? Es ist zu befürchten, daß die Debatte über diese Frage sich ebenso im Gestrüpp unvereinbarer Urteile über den moralischen Status des menschlichen Embryos verheddern wird wie bei der Stammzellforschung. Aber vielleicht kann man sich über einige der Tatsachen verständigen, auf die in dieser Debatte Bezug genommen wird. Solche Tatsachen sind etwa die Struktur und der soziale Sinn von PID als Handlung, die möglichen Folgen ihrer Zulassung und die Wertungen, die bei vergleichbaren Sachverhalten in der Gesellschaft faktisch akzeptiert worden sind. Die Suche nach den Tatsachen ist riskant. Die Datenlage ist unübersichtlich und unbefriedigend. Ich 11 WZB-Mitteilungen 97 · September 2002 Technik – Arbeit – Umwelt figuren des Rechts nicht mit den Realitäten des sozialen Handelns verwechseln. Frauen, die selektive Abtreibung wählen, heilen nicht ihre seelische Krankheit, sie entscheiden sich gegen das Zusammenleben mit einem kranken oder behinderten Kind. Der Schatten vorgeburtlicher Selektion liegt daher keineswegs nur über den Behandlungszyklen der medizinisch unterstützten Fortpflanzung, inzwischen etwa 60.000 Zyklen/Jahr in Deutschland, sondern über allen Schwangerschaften, fast 800.000 im Jahr. Der Schatten wächst. Die Angst davor, ein behindertes Kind zu bekommen, ist für fast alle Frauen ein unabweisbares Motiv für vorgeburtliche Selektion. In über 90 Prozent der Fälle, in denen pränatal Down-Syndrom (Trisomie 21) diagnostiziert wird, wird die Schwangerschaft abgebrochen. Dieser Motivlage entspricht eine latente Nachfrage nach mehr Diagnostik. Und der Nachfrage entspricht ein rapide wachsendes Angebot. 12 gerem Krankheitswert diagnostiziert werden – beim Klinefelter Syndrom etwa, einer Störung der Geschlechtschromosomen, die zu Unfruchtbarkeit führt, je nach Qualität der Beratung auf Werte zwischen 35 Prozent und 72 Prozent. 60.000; gegenwärtig liegt sie deutlich über 70.000. Ob man umgekehrt den finanziellen Hebel ansetzen könnte, um die Nachfrage einzudämmen, ist allerdings die Frage. Jedenfalls wird man das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen können. Auf der anderen Seite ist es unwahrscheinlich, daß Frauen sich Optionen der Diagnostik für Befunde aus der Hand nehmen lassen, die sie selbst als gravierend empfinden und bei denen sie eine Abtreibung wählen würden. So wurde in den 1980er Jahren die sogenannte psychische Indikation für die pränatale Diagnostik von jüngeren (in der Regel besser ausgebildeten) Frauen durchgesetzt, bei denen kein altersbedingt erhöhtes Risiko bestand, daß das Kind eine Chromosomenstörung haben könnte. Der große und wachsende Bereich der akzeptierten Indikationen für eine selektive Abtreibung – also die Diagnostik für schwere, nicht behandelbare Krankheiten oder Behinderungen des zukünftigen Kindes – wird weiter von den Kassen finanziert werden müssen. Und die Mehrkosten für Tests, die man dann noch „einsparen“ könnte, werden bei fortschreitender Automatisierung der Diagnostik immer weniger ins Gewicht fallen. Die Frauen hatten Angst und wollten einfach sicher gehen. Anfang der 90er wurden knapp 15 Prozent der invasiven Untersuchungen nach dieser Indikation durchgeführt. Gegen solchen Nachfragedruck dürften auch einschränkende Indikationenkataloge wenig ausrichten. Die Genomforschung hat inzwischen für 2.000 genetisch bedingte Erkrankungen die entsprechenden Gene bzw. assoziierten Marker identifiziert, mit denen diese Erkrankungen pränatal (und vor der Implantation) diagnostiziert werden können. Durch Automatisierung (Genchips) wird die Diagnostik schnell und billig werden. Ein zusätzlicher Schub ist zu erwarten, wenn embryonale Zellen ohne invasiven Eingriff gewonnen werden können, etwa aus dem mütterlichen Blutserum. Die Nachfrage nach pränataler Diagnostik ist durch Beratung nur in Grenzen zu beeinflussen. Zwar verzichten nach einer Untersuchung von Irmgard Nippert (Universität Münster) etwa die Hälfte der Frauen, die wegen diffuser Angst vor einem behinderten Kind die Beratung aufsuchen, schließlich auf die Diagnostik. Sobald es jedoch konkrete Hinweise auf ein erhöhtes Risiko gibt, nehmen fast alle die Diagnostik in Anspruch – bei auffälligem Ultraschallbefund zu 100 Prozent. Man erliegt jedoch einer Horrorvision, wenn man prophezeit, in Zukunft würden Eltern vorgeburtliche Selektion maximieren und niemals mehr auch nur das geringste Risiko für das Kind akzeptieren. Das entspricht weder der normalen Interessenlage noch den normalen Wertungen prospektiver Eltern. Diese wünschen sich ein Kind – und gehen dafür im Fall der medizinisch unterstützten Fortpflanzung einen langen, mühseligen Weg. Die Beratung kann die Illusion ausräumen (falls irgend jemand sie hegt), daß vorgeburtliche Diagnostik absolute Sicherheit biete, ein gesundes Kind zu bekommen. Aber sie kann Eltern nicht davon abhalten, die relative Sicherheit zu suchen, die ihnen diese Diagnostik immerhin bietet. Bei maximaler vorgeburtlicher Selektion wären aber die Chancen, überhaupt noch ein Kind zu bekommen, vermutlich nicht mehr sehr hoch. Tatsächlich differenzieren die Eltern. Die Abtreibungsrate sinkt, wenn pränatal Merkmale von gerinWZB-Mitteilungen 97 · September 2002 Die Nachfrage nach pränataler Diagnostik steigt, wenn die Krankenkassen die Kosten übernehmen. Als in den 90er Jahren nicht-invasive Untersuchungen finanziert wurden, die auf mögliche Schädigungen beim ungeborenen Kind hinweisen (Ultraschall und Tripletest), stieg die Zahl der invasiven vorgeburtlichen DiagnoseEingriffe innerhalb von fünf Jahren um 50 Prozent – von 40.000 auf Vorgeburtliche Diagnostik wird Routine in der Schwangerschaftsvorsorge werden, und vorgeburtliche Selektion wird sich als gesellschaftliche Praxis etablieren. Das wird die Einstellung zur Schwangerschaft und zum ungeborenen Leben verändern. 90 Prozent der von Irmgard Nippert befragten Frauen, die wegen einer familiären Vorbelastung pränatale Diagnostik durchführen lassen, berichten, daß sie das Gefühl haben, Abstand zu ihrer Schwangerschaft halten zu müssen. Bei einer PID dürfte diese Distanz noch deutlicher sein. „Zeugung auf Probe“ ist eine realistische Beschreibung. Ob der wertende Unterton, der in dieser Beschreibung mitschwingt, berechtigt ist, steht hier nicht zur Diskussion. Allerdings ist eine Standardindikation für PID, daß Eltern ein Risiko ausschließen wollen, für das es konkrete Hinweise gibt, etwa weil Familienangehörige betroffen sind oder sie schon ein krankes Kind haben. Diese Eltern werden, falls sie sich durch ein Verbot der PID nicht von ihrem Kinderwunsch abbringen lassen, eine Schwangerschaft herbeiführen, bei der sie nach allen Daten, die wir haben, fest entschlossen sind, vorgeburtliche Diagnostik in Anspruch zu nehmen und gegebenenfalls abtreiben zu lassen. Das PID-Verbot verschiebt also für diesen Fall das Problem nur von der „Zeugung auf Probe“ zur „Schwangerschaft auf Probe“. Die Zulassung von PID gilt als Dammbruch. Ist die Selektion von menschlichen Embryonen der Anfang einer Kette von selektiven Strategien, an deren Ende das Lebensrecht be- Normbildung und Umwelt hinderter Menschen zur Disposition stehen wird? Kritiker der PID sehen das Menetekel der Naziverbrechen an der Wand. Die Daten sprechen eine andere Sprache. Vorgeburtliche Selektion und das Lebensrecht behinderter Menschen Zunächst zeigt eine einfache Modellrechnung, daß PID kaum das Problem sein kann. Setzt man die Häufigkeit von (mono-)genetisch bedingten Erkrankungen und Chromosomenanomalien bei 15 Fällen auf 1.000 Neugeborene (1,5 %) an, würde flächendeckende PID, die alle diese Syndrome erfaßt, heute rechnerisch in 900 Fällen im Jahr (1,5 % von 60.000 Behandlungen) zur Selektion des untersuchten Embryos führen. Eine ebenso ausgelegte pränatale Diagnostik würde dagegen theoretisch bei 12.000 Schwangerschaften (1,5 % von 800.000 Geburten) einen Befund ergeben, der möglicherweise die Abtreibung rechtfertigt. Das selektive Potential der PID fällt neben dem der Pränataldiagnostik nicht ins Gewicht. Alle Dammbruchargumente zur PID arbeiten mit der Prämisse, daß der gesellschaftliche Umgang mit ungeborenem Leben symbolisch ausstrahlt und prägend für den Umgang mit geborenem Leben wird. Nichts spricht für diese Prämisse. Die Freigabe der Abtreibung im Rahmen der Fristenlösung hat die Tötung ungeborenen Lebens massenhaft zu einer legalen Praxis gemacht, mit schätzungsweise 200.000 Fällen im Jahr in Deutschland und mehr als einer Million in Europa. Die rechtliche und soziale Wertung geborener Kinder hat das in keiner Weise berührt. Die Geburt ist eine moralische Wasserscheide. Nicht nur nach dem Gesetz, sondern auch im Bewußtsein des Alltags gilt: Wer geboren ist, hat uneingeschränkt Anspruch auf Achtung seiner Würde und Schutz seines Lebens. Allerdings gibt es die Grauzone der schwerbehinderten Neugeborenen. Hier stehen nach einigen Umfragen große Teile der Bevölkerung einem „Sterbenlassen“ der betroffenen Kinder positiv bis indifferent gegenüber. Solche Wertungen haben eine lange Geschichte in vielen Gesellschaften. Sie sind weder ein Erbe der Wolfgang van den Daele, geboren 1939 in Königsberg/Pr., studierte Rechtswissenschaft und Philosophie. Wissenschaftler am Starnberger Max-PlanckInstitut in den 70er Jahren; Hochschullehrer an der Universität Bielefeld, Forschungsschwerpunkt Wissenschaftsforschung 1982 bis 1989. Seitdem Direktor der Abteilung „Normbildung und Umwelt“ des WZB. 1985 Mitglied der Enquête-Kommission „Chancen und Risiken der Gentechnologie“ des Deutschen Bundestags; 1995 Mitglied des Beirats für ethische Fragen im Gesundheitswesen beim Bundesgesundheitsministerium; 2001 Ernennung zum Mitglied des Nationalen Ethikrats durch den Bundeskanzler. Foto: David Ausserhofer Nazizeit noch eine Auswirkung der Abtreibungspraxis oder der Pränataldiagnostik. Sie sind auch nicht der Treibsatz für allgemeine Behindertenfeindlichkeit. Man kann nicht von der Einstellung gegenüber neugeborenem Leben auf die Einstellung gegenüber lebenden Personen im allgemeinen schließen. Während sich bis zu 75 Prozent zustimmend bzw. neutral zur Euthanasie unmittelbar nach der Geburt äußern, befürwortet so gut wie niemand eine Euthanasie zu einem späteren Zeitpunkt. Diese Einstellungskombination findet sich auch in traditionalen Gesellschaften, die bei schwerbehinderten Neugeborenen Infantizid praktizieren, aber zugleich die unter ihnen lebenden Behinderten hoch akzeptieren. Aber ist es nicht kennzeichnend für die Mentalität unserer Gesellschaft, wenn den Eltern behinderter Kinder von ihrer Umgebung entgegengehalten wird, daß man doch heutzutage so ein Kind nicht mehr zur Welt bringen müsse? Kennzeichnender als solche Taktlosigkeiten sind die institutionellen Trends. In allen Industrieländern werden seit Jahrzehnten die Rechte behinderter Menschen kontinuierlich ausgebaut und mit steigendem Aufwand gefördert. Hinzu kommt ein bemerkenswerter Wandel der sozialpolitischen Zielsetzung. Nicht mehr der Schutz und die Versorgung behinderter Menschen steht im Zentrum, sondern deren Autonomie und „Ermächtigung“. Behinderte sollen in die Lage versetzt werden, ein unabhängiges Leben „so normal wie möglich“ zu führen. Aktuell wird dies gerade beim Recht auf Sexualität verhandelt. Daß dieses Institutionengerüst einstürzt, ist unwahrscheinlich. Daß es WZB-Mitteilungen 97 · September 2002 13 einstürzt, weil Pränataldiagnostik und PID zugelassen werden, ist noch unwahrscheinlicher. Keine noch so perfekte vorgeburtliche Selektion kann an der Realität behinderten Lebens in der Gesellschaft Nennenswertes ändern. Von den in Deutschland gegenwärtig registrierten über 1,6 Millionen Fällen schwerer Behinderung dürften weniger als zehn Prozent genetisch bedingt sein, und von denen ist nur ein Teil vorgeburtlich diagnostizierbar. Angesichts dieser Zahlenverhältnisse fällt es schwer, Ängste oder Phantasien ernst zu nehmen, daß die vorgeburtliche Selektion die Behindertenpolitik aus dem Gleis werfen könnte. Die Gesellschaft wird nicht einer Million behinderter Menschen die Solidarität aufkündigen, wenn sie in einigen tausend Fällen Eltern gestattet, behinderte Föten abzutreiben bzw. Embryonen zu selektieren. Womit man offenbar weiter rechnen muß, ist die Ambivalenz, die Mischung von Empathie und Ablehnung, mit der viele Menschen auf Behinderte – vor allem auf Geistigbehinderte – reagieren. Aber diese Ambivalenz schließt steigende Solidarität keineswegs aus. Die wenigen Zeitreihen, die wir haben, zeigen, daß Vorschläge, die darauf hinauslaufen, Geistigbehinderte aus der Gesellschaft auszuschließen und sie billig und möglichst unsichtbar zu „verwahren“, immer weniger Resonanz finden. Der Anteil derjenigen, die für Kinder mit Down-Syndrom einfache Anstaltsunterbringung ohne besonderen Aufwand befürworten, ist zwischen 1969 und 2000 von neun auf Null Prozent gefallen (1983: 2%). Gleichzeitig stieg der Anteil der Befürworter besonderer individueller Fördermaßnahmen von 59 auf 90 Prozent (1983: 73 %). 1969 hielten es nur 18 Prozent für richtig, die betroffenen Kinder im Elternhaus zu betreuen, 2000 waren es 90 Prozent (1983: 43 %). Integration der Behinderten 14 Diese Entwicklung ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil parallel dazu die vorgeburtliche Selektion von Föten mit Down-Syndrom ständig zugenommen hat und überwiegend als richtig akzeptiert worden ist. Die Parallelität belegt, daß Selektion vor der Geburt und Diskriminierung nach der Geburt unabhängige Phänomene sind und das eine nicht auf das andere abfärbt. WZB-Mitteilungen 97 · September 2002 Die zunehmende politische und rechtliche Integration der Behinderten in die Gesellschaft scheint sich auch in einer erhöhten Bereitschaft der Bevölkerung niederzuschlagen, mit Behinderten zusammenzuleben. Nach neueren Umfragen haben über 90 Prozent nichts gegen eine Nachbarschaft mit Geistigbehinderten und über 80 Prozent nichts gegen die gemeinsame Anwesenheit im Urlaubshotel einzuwenden. Im Lichte dieser Befunde können einige fragwürdige Gerichtsurteile der jüngsten Vergangenheit schwerlich als Ausdruck wachsender Behindertenfeindlichkeit interpretiert werden. So wurde etwa einem Reisenden Schadensersatz zugesprochen, weil sich in dem gebuchten Ferienhotel unangekündigt auch eine Gruppe Geistigbehinderter aufhielt. In einem anderen Fall wurde der Aufenthalt Geistigbehinderter auf der Terrasse zeitlich begrenzt, weil die Nachbarn sich gestört fühlten. Diese Urteile reagieren auf Interessenkonflikte, die zunächst einmal eines zeigen: Die Behinderten sind wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wenn man den Umfragedaten glauben darf, würden die meisten Menschen bei den fraglichen Konflikten stärker als die Gerichte zugunsten der Behinderten entscheiden – realistischerweise wird man hinzufügen müssen: Solange sie als Beobachter des Konflikts urteilen und nicht als Betroffene. Man kann existentielle Ängste nicht mit Daten widerlegen. Aber man kann zeigen, daß nach den verfügbaren Daten kein Anlaß besteht, als Folge der Zulassung von PID die Gefährdung der Rechte behinderter Menschen an die Wand zu malen. Nach allem, was man sagen kann, ist es wahrscheinlich, daß vorgeburtliche Selektion sich als Praxis durchsetzt, aber gleichwohl die Solidarität mit behinderten Menschen kontinuierlich ausgebaut wird. n