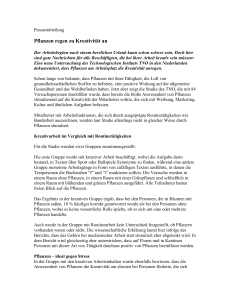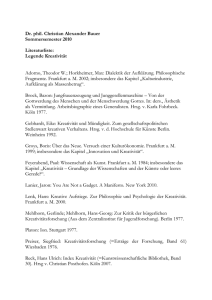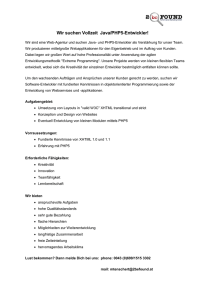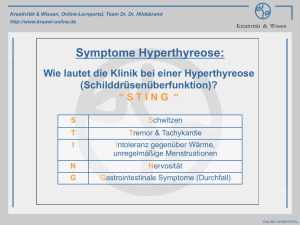Kreativitätstechniken
Werbung
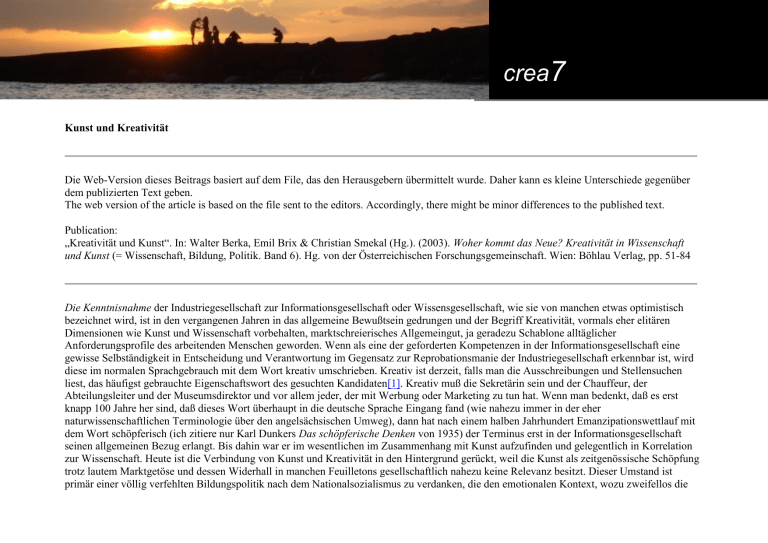
crea7 Kunst und Kreativität Die Web-Version dieses Beitrags basiert auf dem File, das den Herausgebern übermittelt wurde. Daher kann es kleine Unterschiede gegenüber dem publizierten Text geben. The web version of the article is based on the file sent to the editors. Accordingly, there might be minor differences to the published text. Publication: „Kreativität und Kunst“. In: Walter Berka, Emil Brix & Christian Smekal (Hg.). (2003). Woher kommt das Neue? Kreativität in Wissenschaft und Kunst (= Wissenschaft, Bildung, Politik. Band 6). Hg. von der Österreichischen Forschungsgemeinschaft. Wien: Böhlau Verlag, pp. 51-84 Die Kenntnisnahme der Industriegesellschaft zur Informationsgesellschaft oder Wissensgesellschaft, wie sie von manchen etwas optimistisch bezeichnet wird, ist in den vergangenen Jahren in das allgemeine Bewußtsein gedrungen und der Begriff Kreativität, vormals eher elitären Dimensionen wie Kunst und Wissenschaft vorbehalten, marktschreierisches Allgemeingut, ja geradezu Schablone alltäglicher Anforderungsprofile des arbeitenden Menschen geworden. Wenn als eine der geforderten Kompetenzen in der Informationsgesellschaft eine gewisse Selbständigkeit in Entscheidung und Verantwortung im Gegensatz zur Reprobationsmanie der Industriegesellschaft erkennbar ist, wird diese im normalen Sprachgebrauch mit dem Wort kreativ umschrieben. Kreativ ist derzeit, falls man die Ausschreibungen und Stellensuchen liest, das häufigst gebrauchte Eigenschaftswort des gesuchten Kandidaten[1]. Kreativ muß die Sekretärin sein und der Chauffeur, der Abteilungsleiter und der Museumsdirektor und vor allem jeder, der mit Werbung oder Marketing zu tun hat. Wenn man bedenkt, daß es erst knapp 100 Jahre her sind, daß dieses Wort überhaupt in die deutsche Sprache Eingang fand (wie nahezu immer in der eher naturwissenschaftlichen Terminologie über den angelsächsischen Umweg), dann hat nach einem halben Jahrhundert Emanzipationswettlauf mit dem Wort schöpferisch (ich zitiere nur Karl Dunkers Das schöpferische Denken von 1935) der Terminus erst in der Informationsgesellschaft seinen allgemeinen Bezug erlangt. Bis dahin war er im wesentlichen im Zusammenhang mit Kunst aufzufinden und gelegentlich in Korrelation zur Wissenschaft. Heute ist die Verbindung von Kunst und Kreativität in den Hintergrund gerückt, weil die Kunst als zeitgenössische Schöpfung trotz lautem Marktgetöse und dessen Widerhall in manchen Feuilletons gesellschaftlich nahezu keine Relevanz besitzt. Dieser Umstand ist primär einer völlig verfehlten Bildungspolitik nach dem Nationalsozialismus zu verdanken, die den emotionalen Kontext, wozu zweifellos die crea7 sinnliche Kreativität als Kunstvoraussetzung zählt, mehr oder weniger ausschloß und auf Kognition einerseits und geistlose Reproduktion andererseits setzte. Die Zeitangabe „nach dem Nationalsozialismus“ ist bewußt gewählt, bedürfte aber in ihrer ausführlichen Untersuchung eines eigenen Referates[2]. Andererseits haben auch gesellschaftspolitische Umstände (1968), die Dominanz der Sozialdemokratie, und vor allem die Verbreitung der elektronischen Medien Unsicherheiten ausgelöst, die nach wie vor in ihrer Benennung tabuisiert sind, andererseits aber auch jetzt nicht ausgebreitet werden können. Wesentlich ist auch, daß die Pluralität der Kunstszenen mit ihren Konkurrenzen und Dominanzbestrebungen, die allesamt zur Substanz der Künstlersozialisationen zählen, Kreativität als gemeinsamen Ansatz kaum erkennen lassen, wenn man sie oberflächlich betrachtet, und eines eigenen Tiefenstudiums in Themenstellung und Methodenwahl bedürfte, die die Gesellschaft grosso modo kaum zu leisten bereit ist. Die Kunstwissenschaften beschäftigen sich aus guten Gründen in der Regel nicht mit der unmittelbaren Gegenwart, respektive dringen sie, wenn sie es tun, in Tiefen vor, die die Kreativitätsschichten längst hinter sich gelassen haben. Das Phänomen einer gewissen sich gesellschaftlich stark verbreitenden Schizophrenie, die ich in vielen Zusammenhängen konstatiere, macht auch vor der Kunst nicht halt. Obwohl privat nahezu jeder urteilt, gleichgültig ob Publikum oder Experte, weigern sich nahezu alle, betreffende Objektivierungsversuche, die ich als Einschätzungsmodelle verstehe, zur Kenntnis zu nehmen. Es beginnt bei der Definition des Wortes Kunst, die entweder prinzipiell verweigert wird (siehe das gerade veröffentlichte Kulturprogramm der Grünen)[3], die andererseits in das dämliche Allgemeinwort von „Kunst ist Kunst ist Kunst“[4] ausrinnt oder ausschließlich nach persönlichem Geschmack, wie immer der zustande gekommen sein mag, resultiert. Die Künstlerschaft selbst, ein individualisiertes Konkurrenzsystem, das in seiner Durchsetzung der Interessen sich zumeist divergenter Seilschaften bedient, hat in der Regel kein Interesse an einem rational überprüfbaren Nachvollzug des Erarbeiteten, stellt diesen zumindest weit hinter die öffentliche Repräsentanz, die zwischen medialem Vorkommen und Darstellungs-, Ausstellungs- oder Aufführungswut pendelt. Der veröffentlichten Meinung, inzwischen längst den strengen Genre-Grenzen zwischen Feuilleton, Chronik oder Lokalem entzogen, kann, obwohl hilflos gerne zitiert, kaum eine ernstzunehmende Beurteilungskompetenz zugesprochen werden. Zufall, Marketing, persönliche Beziehungen, Blattlinie, Seilschaften und Netzwerke, ganz selten nur mehr ideologische Vorbehalte, reportieren nach Beliebigkeit, wobei der Eventeffekt, der im wesentlichen aus Einmaligkeit mit multiplizierter Zuschaueranzahl besteht, absoluten Vorrang einnehmen dürfte. Selbst die Kreativitätsforschung, die sich ja inzwischen zu einer respektablen Unterdisziplin der Psychologie entwickelt haben dürfte[5], weicht der Befassung mit der Kunst eher aus, wofür mehrere Gründe ausschlaggebend sein könnten. Da sind einerseits die zweifellos extrem geringen Stichprobengrößen mit starken Verweigerungstendenzen auf seiten der Künstler, respektive der Hochbegabungen, andererseits methodische Unsicherheiten, die, wenn überhaupt, dann am ehesten im Kontext der Musik zumindest ansatzweise minimiert werden konnten[6]. Dies hängt crea7 zweifellos mit dem System des Zeitablaufs und einer eigenen spezifischen Sprachlichkeit von Musik zusammen, die den Probanden und sein reales Umgehen mit dem Gegenstand auch der Untersuchungsmethode preisgeben. Eigenverbalisierung und visuelle Betrachtung sind diesbezüglich schwer steuerbar und unterliegen soweit der Souveränität des untersuchten Objekts, daß die Steuerung als extrem schwankend in ihrer Untersuchungsgenauigkeit angesehen werden muß. Auch wenn derzeit das Wort Kreativität eine Art Hausse im Sprachgebrauch erlebt und auf alle möglichen Gebiete ausgedehnt wird, ist offensichtlich, warum die meisten Menschen des Industriezeitalters den Begriff eher nur im Zusammenhang mit der Kunst alltagssprachlich verwenden. Die Kunst als sinnlich wahrnehmbarer Ausdruck emotionaler Intelligenz, also als in der Regel ding- oder symbolhafte Umsetzung des „kognitiven, emotionalen und sozialen Vermögens“ des Künstlers[7] unterscheidet sich von der Normalität dinglicher Gestaltung durch eine unverkennbare Qualitätsdifferenz, deren in der Regel vom Bürger wahrgenommene aber nicht artikulierbare Parameter unter dem Sammelbegriff Kreativität zusammengefaßt werden. Dieses Phänomen, an dem bis zum Ende des 20. Jahrhunderts niemand vorbeigehen konnte, weil die Außenwelt des Menschen zumindest in der europäischen Tradition künstlerisch verdinglicht gestaltet war (wofür jeder Tourismusführer als Beleg unmittelbar einsteht)[8], dieses Phänomen war primär unübersehbar und (schon eher vereinzelt) auch unüberhörbar. Die Demonstration einer Hochleistung künstlerischer Provenienz zog sich, wenn man so will, von den Pyramiden bis zur Hitlerschen Reichskanzlei und dem Centre Pompidou und wurde von allen historischen Staatssystemen zur Demonstration der Macht, der Größe, der Autorität, aber auch der Ideologie respektive der spezifischen Geistigkeit herangezogen. Dieses Repräsentanzmodell von Identität durchzog aber auch alle gesellschaftlichen Gruppierungen, die ihre Gemeinschaftlichkeit bis hin zur Wohnstätte baulich manifestierten, wobei die Imitation der sozial höheren Struktur ebenso nachwirkte, wie die Besonderheit der Contradictio (siehe Konzeptkunst, Revolutionsarchitektur respektive Ökologiebau) in Erscheinung trat. Der Grad der Aufmerksamkeit innerhalb der gesellschaftlichen Struktur wurde genau durch jenes Maß an Kreativität bestimmt, der die Gestaltung entweder von der Schiene der Tradition oder der gewachsenen Umgebung abhob. Die kreative Differenz in der Verdinglichung der Identität hing aber nicht nur von Kapital, Macht, Ausbeutung des Volkes und später der Massen, wie so oft auch in der kunsthistorischen Literatur[9] verkürzt argumentiert wird, ab, sondern primär von der Auffindung eines Kreativitätspotentials der Gestaltenden, gleichgültig ob auf ein Kollektiv oder einen aus der Anonymität heraustretenden Künstler als Träger dieses Kreativitätspotentials bezogen. Daß unser historischer Blick bei der Betrachtung zeitlich immer weiter entfernterer Epochen unschärfer wird in der Einschätzung des qualitativen Vermögens und dann letztendlich jede Tonscherbe oder jeder gewöhnliche Messinghelm zur Kunst erklärt wird (ein Phänomen, das wieder eine eigene Betrachtung nötig machte)[10], ändert nichts daran, daß selbstverständlich zu jeder Zeit die Differenz von Besonderheit zum Allgemeinen bewußt war und, überspitzt gesprochen, auch die Unterschiedlichkeit vom Alltäglichen zum Besonderen via Kreativität definiert wurde. crea7 Gewiß waren in historischen Zeiten die Übereinstimmungen zwischen Auftraggeber und gestaltendem Künstler enger in Bezug auf die Vorstellung dessen, was entstehen sollte, weil eine Art gemeinsamer Standard des Wissens existierte und, wenn nicht, durch kluge Beratung herbeigeschafft wurde. Ein Problem unserer Gegenwart und vor allem der öffentlichen Institutionen besteht darin, daß sie in ihrer Auftragsvergabe in der Regel nicht auf diese Kenntnisparallele zurückgreifen können, was entweder wie im Kontext von „Kunst im öffentlichen Raum“ dem Künstler völlige Freiheit einräumt, was möglicherweise zu Akzeptanzproblemen beim Publikums führt, oder bei Durchsetzung der Wünsche des Auftraggebers mediokere Ergebnisse liefert (Modell Versicherungsbauten), die nach einer kurzen Phase der Aufmerksamkeit durch das Neue wieder in der Anonymität des Allgemeinen verschwinden. Selbst der ästhetisch Ungebildete, dessen periphere Kenntnisse er sich fast ausschließlich im passiven Lernen erworben hat, reagiert auf diese kreative Differenz. Zuerst oft mit Ablehnung, weil er sein vertrautes Wahrnehmungssystem durch Neues irritiert wähnt, dann oft durch Verweigerung, was vor allem für den Museumsbesuch zutrifft, wogegen neuerdings ausgeklügelte Marketingstrategien anlaufen, ebenso oft aber durch Nichtbeachtung, was als Regel insbesondere für die von ihm bewohnte Ortschaft vermerkbar ist. Andererseits arbeitet gerade die Tourismusbranche der Städtereisen mit der Attraktivität des kreativen Unterschieds und führt gezielt die Touristen zu jenen Ikonen historischer oder zeitgenössischer Kreativität, die repräsentativ und charakteristisch, jedenfalls aber attraktiv sich vom allgemeinen Zustand abheben. Hier werden, schaut man genau hin, zwar auch manchmal die Klischees bedient, aber zunehmend, infolge der Marktkonkurrenz und der Differenzierungen stellen Haltepunkte der Stadtrundfahrten heute eine meist gelungene Auswahl des kreativen Potentials vor, und noch dazu, was gar nicht selbstverständlich ist, emanzipiert zwischen historischer und zeitgenössischer Substanz. Ist im Kontext der Architektur der Zusammenhang zwischen Kreativität und Baukunst relativ einfach nachzuvollziehen, verlangen ähnliche Untersuchungen bezüglich bildender Kunst, Musik und Wort genauere Betrachtungsweisen. Waren bis in die 1950er Jahre, Kunstmuseen relativ gesicherte Orte der Demonstration kreativen Potentials in Sachen Bildgestaltung, Graphik und Skulptur, ja sogar noch im Bereich Design, so erzeugte die zunehmende Musealisierung (auch ein Phänomen das nähere Betrachtungsweise verdiente)[11] die Ausfransung der Randgebiete. Die vor allem in den 1960er Jahren lautstark verkündeten Kunsterweiterungsdefinitionen brachten neue Unsicherheiten. Die zwar historisch und politisch verständliche, aber nichtsdestoweniger hochproblematische Erweiterung des Kunstbegriffes bis zur völligen Vermischung mit der Kultur (nebenbei bemerkt ein Phänomen, unter dem wir auch in der unmittelbaren Gegenwart noch zu leiden haben) wurde alltagssprachlich zumindest in Zentraleuropa durchgesetzt. Hier trafen sich das historische Erbe der „deutschen“ Identitätssuche, die als Nationalitätenbestimmung im Gegensatz zur angelsächsischen Modalität Kultur und an ihrer Spitze die Kunst als „Hauptkriterium eines Stammes oder Volkes“ (wie Herder sagte)[12] ansah, ein Modell, das Richard Wagner nahezu zur Religion erhob und über Nietzsche der Nationalsozialismus ebenso gerne für sich in Anspruch nahm, wie eine Abkehr davon auch nach 1945 vorerst nicht in Sicht war. Andererseits hatte sich der Sozialismus spätestens ab der Mitte der 1920er Jahre von seiner selbstverständlichen Kopulation mit der Avantgarde[13] verabschiedet und die Kunst als vermutetes oder crea7 unterstelltes Element der Eliten zur Kultur verbreitert, was in der Zusammensetzung mit Alltag seine Ausdehnung über alle Grenzen hinweg nahezu leuchtspurenhaft verfolgen läßt. Statt nach wie vor der vernünftigen Differenzierung der qualitativen Hierarchien der Kreativitätstheorie statt zu geben, die ein Grundpotential an für jeden Menschen verbindlicher Kreativität bis ca. einem Drittel der Rangskala zuläßt und statt Joseph Beuys’ richtigem Ansatz[14], daß in jedem Menschen künstlerische Fähigkeiten stecken, zu folgen, wurde die hierarchische Dimensionierung abgelöst zugunsten einer beliebigen Gleichwertigkeit, die alsbald auch – ich vermute aus eher politischen Gründen als intelligenten Erwägungen – die Kunstdefinitionen und ihre Promotoren selbst erfaßte. Der heutige Szenenslogan „Kunst ist, was Aufmerksamkeit erzeugt“[15], ist geradezu die Bankrotterklärung eines Differenzierungsmodells und gibt beides, Kunst und Kreativität, der Beliebigkeit einer irgendwie motivierten und passiv erlebten Wahrnehmung preis. Marketing und Medienmanipulation traten hinzu und Szenen, Institutionen und ihre Apologeten taten ein übriges, die Verwirrung in Sachen Kunst weiterzutreiben. Selbstverständlich konnten Toleranz und Bejahung der Pluralität keine entsprechend signifikanten Korrekturen anbieten, so daß, wie mir scheint, derzeit die Beschreibung von Kunst als Differenzierungsmerkmal verschiedener Kreativitätshöhen verschwunden ist und stattdessen völliger Beliebigkeit anheimzufallen scheint. Gleichsam ein Bindfaden als Rettungsseil könnte in der chartähnlichen Aneinanderreihung von bedeutenden Künstlernamen erscheinen, die als Logoi ihres eigenen Stils (ein Begriff von Peter Weibel)[16], hochkreatives Potential signalisieren und deswegen auch geradezu in altmodischer Weise als Repräsentanten des Zusammenhangs von Kreativität und Kunst nach wie vor angesehen werden. Daß auch hierbei Marketing, Verbreitungstechnik, Szenen, Durchsetzungsvermögen, Medienmanipulation und die in einer Materialgesellschaft vorhandenen Mechanismen bestimmte Irritationen hervorrufen können, die die Sicherheit der Zuschreibung wieder in Frage stellt, bleibt offen. Allerdings böte sich, so meine ich, eine brauchbare Alternative für die Differenzierung von Kultur und Kunst an, die im wesentlichen auf das alte Differenzierungsmodell von Kreativität und Kunst Bezug nimmt und sich als Tradition des 18. Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart ableiten läßt. Die Erkenntnisse des 18. Jahrhunderts, also der Zeit der Aufklärung, die nach wie vor prägend für unsere Gegenwart angesehen werden können, weswegen auch eine Reihe von philosophischen und theoretischen Überlegungen um diesen Gegenstand kreisen, haben relativ genau und weitgefaßt eine Reihe von Parametern, die in ihrer Summe für Kreativität zuständig sind, beschrieben, die sich durchaus als nachhaltig herausstellen, auch wenn sie in der modernen englischen Wissensterminologie neu benannt wurden. Friedrich von Schillers Ästhetische Briefe[17] könnten nahezu als Kompendium dieser Kreativitätsthematik verstanden werden, wobei schon damals vernünftigerweise weder die auch heute noch untrennbaren Faktoren Genetik und Sozialisation auseinandergenommen wurden, noch die Individualität des kreativen Potentials, bezogen auf den einzelnen Menschen, infrage gestellt wurde. Auch heute wird vor allem gemäß den Erfahrungen der Gehirnforschung nach wie vor auf diese Individualität gesetzt, wenn auch eine Reihe höchst renommierter Forscher sich mehr für die rationale Theorie „to explain the creative process“[18] als Kosten-Nutzeneffekt interessieren (Rubens, Sternberg, Lubart etc.)[19] oder andererseits die Systemperspektive des Ungarn Csikszentmihaly[20] gilt, der die Kunst in Relation zu Gesellschaft, Kultur und Personen vernetzt. Meine individuelle Präferenz resultiert crea7 aus dem nach wie vor ungeklärten Phänomen der künstlerischen Einzelleistung; dann dem Transportcharakter dieser individuellen Leistung, die sich immer wieder auch nur an ein Individuum richtet, weswegen folgerichtig letztlich auch nur ein individuelles Kunstverstehen existieren kann; dieses ist allerdings kommunizierbar und wird dort auf Zustimmung treffen, wo entweder die gleichen rationalen Grundlagen oder sehr ähnliche emotionale Befindlichkeiten vorliegen, gleichsam das Übereinstimmen von Psychoclusters gegeben ist. Sie treten in der Gesellschaft des 20. Jahrhunderts und auch der heutigen wegen der Pluralitätsperspektive in jeder Richtung eher zufälliger auf als in anderen Jahrhunderten, wo sie in der gleichzeitigen Einheitlichkeit der ästhetischen Kategorien zwischen Sender und Empfänger eher breit diagnostizierbar waren. Zur Individualität drängt auch die Argumentationsschwierigkeit des wissenschaftlichen Nachweises der Korrelation von Gesellschaft, Kultur und Person mit der Kunst, die, an einer Reihe von Fallstudien überprüft, unendliche mühsame wissenschaftliche Arbeit erfordert und letztlich nur relativ grobe Detailergebnisse erbringt. Im besten Fall lassen sich aus der Addition dieser Detailerfahrungen bestimmte begründete Vermutungen anstellen, die allerdings, wie beispielsweise die Mozart- und Wagnerliteratur erweist, trotz relativ ähnlichen Faktenwissens von hoher Brüchigkeit gekennzeichnet sind. Eine wissenschaftlich haltbare Korrelation von Kunst und Kreativität verlangt nach Axiomen beider Begriffe, die meinetwegen als Arbeitshypothesen durchgehen mögen, aber in einer Art Abbildverfahren dann auch entsprechend wahrgenommen werden müssen, wenn die Korrelate nachvollzogen werden sollen. Für die Kunst, zumindest unseres europazentrierten Kulturkreises biete ich als These an: „Kunst ist die Höchstentwicklung des kreativen Potentials des Menschen in der Versinnlichung seines intellektuellen, emotionalen und sozialen Vermögens“. Dieser Aspekt der Versinnlichung schließt natürlich auch die Darstellung abstrakter Phänomene mit ein im Sinne der oft geäußerten Argumentation von Naturwissenschaftern, begonnen mit Albert Einstein, „Die Formel sei schön“. Der Terminus Höchstentwicklung differiert eindeutig zur normalen kreativen Entwicklung des Menschen vom Kinddasein zum Erwachsenenalter, was, wie oben bemerkt, in der Qualitätshierarchie ca. mit einem Drittel abgedeckt ist, und reflektiert die Berufsmentalität des Künstlers in den verbleibenden drei Einschätzungsfeldern bis hin zum Genie. Diese Rangskala ist ab dann, wenn man so will, künstlerisches Selbstverständnis, wenn auch oft anders bezeichnet, nichtsdestoweniger inhaltlich ident. Die einzelnen Faktoren der Kreativität, also ihre Bestandteile, sind naturgemäß bis in die Unendlichkeit ausdifferenzierbar, lassen sich aber, geführt von Friedrich von Schillers vorgenommener Reduktion auf knapp 25 Zentraleigenschaften[21], heute auf sieben Zentralparameter reduzieren: Fluktualität: Flüssigkeit / Uhrwerk / ablaufen / Bewegung crea7 Flexibilität: Wandel / Schnitt / Rhythmus Originalität: Freiheit / Immunität / Nicht Allgemeine / Neue Sensitivität: Berührung / Empfindung Komplexitätspräferenz: Liberalität / Volle / Dichtungskraft / Unübersichtliche Elaborationsfähigkeit: Würde / Energie / Kenntnis Ambiguitätstoleranz: Selbständigkeit / Gleichgewichtigkeit / Toleranz / Ertragen In den nachfolgenden Graphiken wird der Rangskala von Begabungsstärke (als y-Achse) eine hypothetische x-Achse gegenübergestellt, die allerdings keine Rangskala darstellt, weswegen nötig ist, ein räumliches Schaubild zu entwerfen. Es ist zwar eindeutig, daß die einzelnen Parameter verschiedene Rangskalengrößen in ihrer individuellen Bedeutung erlangen können, aber bislang völlig offen, ob diese Parameter zueinander in irgendeiner Art von Zusammenhang stehen. Zumindest findet sich bislang dafür kein empirischer Beweis. Die vorgenommene Anlage dieser Kategorien an einer großen Reihe von Künstlern aller Genres aus Geschichte und Gegenwart überzeugt dahingehend, daß damit grosso modo und holistisch ein relatives Auslangen zu finden ist. Künstler, die in allen Kategorien Höchstleistungen vollbringen, sind jene, die wir gewöhnlich als Genies bezeichnen, also Persönlichkeiten vom Range Shakespeares, Goethes, Rembrandts, Mozarts oder Picassos. An den einzelnen Parametern überprüft, erfüllen sie optimale Kreativitätsansprüche bis hin zur emergentiven Phase, also jener Dimension, die realiter die Welt des Geistes veränderte und deren Produkte mehr oder weniger quer durch alle Jahrhunderte als zeitlose Ikonen verstanden werden. Der überregional bekannte Künstler, um eine soziologisch messbare Dimension eines anderen höherrangigen Künstlers zu verdeutlichen, erreicht Qualitätsstufen die zweifellos im oberen Drittel der Gesamtmöglichkeiten angesiedelt sind, kann aber und wird sogar im Querschnitt die einzelnen Parameter durchaus verschiedenartig abdecken. Es sei erlaubt, dies an einzelnen Beispielen und Künstlern aus topographischer Nähe, i. e. mit Aufenthaltsort Österreich, aber von verschiedenen Genres herkommend, zu verdeutlichen. crea7 crea7 crea7 crea7 crea7 crea7 Fluktualität Fluency beispielsweise, die „Flüssigkeit“ jener Ideen, bei Schiller schon als Flüssigkeit bezeichnet, aber auch als „fortlaufende Bewegung“ oder „ablaufendes Uhrwerk“, ist ein Zentralkriterium für die Bedeutung Elfriede Jelineks. Dies bedeutet, daß sie vorrangig ein bestimmtes zentrales Thema ins Auge fasste und ihr literarisches Leben lang an sich bei diesem Thema bleibt, aber Varianten entwickelt, die individuell und strukturell diese Thematik umkreisen. Es wären bei ihr, gleichgültig ob in Prosa oder Theaterstücken, der Aspekt kleinbürgerlicher Mentalität mit ihrer Zwängen und Frustrationen, eine Sexualstruktur, die repressiv ist, der immanente Faschismus, den jeder in sich trägt, und jene Frauenfeindlichkeit, die geradezu schon im Unterbewußtsein verankert ist. Das Beharren auf dieser oft gegen das Österreichische an sich gerichteten Thematik hat der Autorin viele Gegner eingetragen, andererseits aber gerade mit der Frauenfrage auch jenen Weltruhm, der diese manische Attitüde auszeichnet. crea7 Eine ganz andere Art von Fluktualität ist jenes Phänomen, das der österreichische Musikkritiker Harald Kauffmann in den 1960er Jahren als ein typisch österreichisches bezeichnet hat, jenes der Parataxe[22]. Er sieht dies als permanente Aneinanderreihung von Gedanken, die zu einem thematischen Überbau passen. Grundtypus dieses Phänomens wäre beispielsweise der Wiener Walzer, der im wesentlichen in einem Rahmenkorsett von symphonischer Introduktion und Coda kurze Melodienmodelle aneinander reiht, die als gleichwertig zu verstehen sind, auch wegen ihres akustischen Zuschnitts quasi als Signale wirken und damit, wenn man so will, auch ein gesellschaftliches Spiegelbild erzeugen, nur dieses Mal nicht primär kritischer Provenienz, sondern als affirmative Situationsschilderung. Fluency wird hier nicht als Beibehalten des gleichen Themas, sondern als Beibehalten des gleichen Formprinzips in der Hülle eines vorhandenen Gesellschaftssystems verstanden. Im bildnerischen Kontext würde sich der österreichische Künstler Adolf Frohner (*1934)[23], mit dessen Arbeit ich mich auch publikationsmäßig intensiv beschäftigt habe, zur Beweisführung anbieten. Er hat sich in den letzten vierzig Jahren sogar unter Einbeziehung des aktionistischen Beginns, der allgemein verschwiegen wird, ausschließlich mit dem Bild des Menschlichen, vor allem dargestellt am weiblichen Körper, beschäftigt. Weiblicher Körper ist für ihn Subjekt und Objekt gleichzeitig, ein Modell für Lebensspendung, Urkraft, pralle Repräsentanz von Freude und Rot, als Mythos und Leidensträgerin und wirksames Visavis zum Tod, als Akt, alle Stadien der altersbedingten variablen Unverhülltheit durchlaufend, aber nie die Würde verlierend, ebenso wie als geschundenes Wesen, benutzt und gebraucht von Werbung und Männerphantasien, als Objekt von Projektion inbegriffen. Frohner hat 40 Jahre lang ein Kompendium der Frauendisposition in Sein und Anschauung hergestellt und gleichzeitig eine Symbolsprache der losgelösten Geschlechtlichkeit, geradezu zur Dreidimensionalität verdinglicht, entwickelt. Der Theologe Friedhelm Mennekes nannte dies treffend: „der Logos gebunden ans Fleisch“[24]. Ein Nicht-Theologe würde glauben: „das Fleisch bleibt konstant und der Logos wechselt“. Zeitaktuell argumentiert, ist es ebenso ein Zeichen von hoher Fluktualität, wenn die französische Aktionskünstlerin Orlan versucht, durch fortwährende Schönheitsoperationen über lange Zeit sich ein neues Gesicht zu erschaffen, was allerdings nicht auf den üblichen fragwürdigen Schönheitskriterien basiert, sondern eher auf einer Sammlung ikonographisch bedeutender Bilder. Sie wollte die Nase der Diana von Fontainebleau, die Stirn der Mona Lisa, das Kinn der Botticellischen Venus, von Gustave Moreaus Europa den Mund und die Augen nach Psyche von Jean-Leon Gérômes. Fazit: Orlan sollte ein Pygmalion werden. Ihr Körper ist ein Kunstwerk. Der Operationstisch wird zu ihrem Künstleratelier, wie der französische Kritiker Bernard Lafargue attestierte[25]. Flexibilität crea7 Ein anderer Parameter ist die Flexibilität, von Schiller als „Wandelschnitt“ oder „Rhythmus“ bezeichnet, also die Fähigkeit, zwischen verschiedenen Themata ohne große Schwierigkeiten wechseln zu können, wobei eine Besonderheit dieser Begabung darin besteht, gleichzeitig an durchaus verschiedenen Werken zu arbeiten. Trifft dies für Maler schon aufgrund der Trockenzeiten ihrer Produkte nahezu immer als wichtige Voraussetzung zu, so weiß man es auch von Architekten, die gleichzeitig verschiedene Objekte planen und bauen und selbstverständlich gilt dies auch für den Auftragsmusiker historischer Provenienz, der schon aus Gründen schneller Vertragserfüllung immer gleichzeitig an mehreren Werken arbeiten mußte. Ein Parademodell außerhalb dieser Auftragslage war Anton Bruckner, von heute aus gesehen der wichtigste Symphoniker des 19. Jahrhunderts, der, ob neurotisch oder nicht, sich selbst die Pflicht der Flexibilität auferlegte - obwohl seine Symphonien wenige und immer gleiche thematische Grundmuster aufweisen, was in der Regel der Hörer nicht wahrnimmt, so daß er sein kompositorisches Leben lang, das allerdings erst mit seinem vierzigsten Lebensjahr einsetzte, immer gleichzeitig über mehreren Werken saß. Er schrieb immer an einem neuen Entwurf und verbesserte immer gleichzeitig früher Geschriebenes (ohne jetzt die Gründe dafür erörtern zu wollen), was zu jener Unübersichtlichkeit der Fassungen und damit auch der Gesamtausgaben führte, die an seinem musikalischen Beitrag in der Praxis problematisiert werden. Eine Besonderheit muß darin bestanden haben, daß er immer das Neue, Entwickelte, mit bereits Altem, also Entwickelt–Geschaffenem konkurrenzieren mußte, gleichsam Novität und eigene Tradition in einem gleichzeitigen Bewußtsein zu korrelieren hatte, zweifellos ein Phänomen mit hohem Streßfaktor, der ihn ja auch relativ früh (mit knapp über siebzig Jahren) am Riesenbau der 9. Symphonie scheitern ließ[26]. Ein nicht erläuterungsbedürftiger „Flexibilist“ war zweifellos Leonardo da Vinci, der nicht nur innerhalb der Kunst die Genres zwischen Musik, Dichtung und Malerei ununterbrochen wechselte, sondern dies auch bezüglich der Wissenschaft, sowohl jener der Grundlagen als auch der angewandten, der Ingenieurkunst etc. tat. Er war, wenn man so will, relativ gleichrangig Maler, Architekt und Plastiker, Ingenieur, Intellektueller, Anatom, Botaniker und Geologie, Hydrologe und Aerologe, Optiker und Mechaniker und imstande, an den Phänomenen nicht nur parallel, sondern auch durchaus tagesgleichzeitig zu arbeiten. Eine andere Art von Flexibilität ist bei Thomas Bernhard aufzufinden, dessen zahlreiche Schriften sich ausschließlich um den Typus des Außenseiters, des Exzentrischen, Verrückten, also um den Nahhabitus des Künstlers selbst drehen. Man würde diesen Typus auch gerne als Intellektuellen bezeichnen, wenn der Begriff alltagssprachlich nicht zu sehr kognitiv besetzt wäre und damit die für den Künstler so notwendige emotionale Intelligenz vernachlässigt würde. Künstler, rein soziologisch betrachtet, sind in Bernhards Werk zweifellos der Maler Strauch (Amras 1964), der Architekt Roithammer (Korrektur 1975), die Dichterin Maria (Auslöschung 1986), die Pianisten Wertheimer, der Klaviervirtuose Gould und der namenlose Protokollant (Der Untergeher 1983) sowie der Komponist Auersberg (Holzfällen. Eine Erregung 1984) und jene crea7 ohnehin mit realen Namen ausgestatteten Protagonisten von Bernhards Theaterstücken. Aber sind nicht auch Murau (Auslöschung. Ein Zerfall 1986) und Reger (Alte Meister 1985) künstlerische Repräsentanten? Beide entstammen der Visavis-Seite des Künstlers, der Rezeptionsschicht, sind aber Experten auf ihrem Gebiet: der eine Spezialist für Fotografie, der andere ein guter Tintoretto-Kenner. Alle Figuren sind Kopfarbeiter die aufgrund ihres Künstlerseins den Verlust aller sozialen menschlichen Bindungen auf sich nehmen müssen, jedenfalls aber Herausragende aus dem Milieu des Dumpfen und Schwachsinnigen. Strauch zerstört sich infolge seiner außerordentlichen Wahrnehmungsfähigkeit, Murau nennt sich selbst „Altersnarr“ und wird von seinem Schüler als „Vormittagsphantast“, als „maßloser Übertreiber“, als „grotesker Negativist“, als „Geschöpf der Künstlichkeit“ bezeichnet. Roithammer, Architekt von naturwissenschaftlichen Graden, ist sich selbst unerträglich, ja selbst Konrad (Das Kalkwerk 1970), der (typischerweise) seine Frau am Heiligen Abend ermordet, ist ein Querulant. Die Dichterin Maria schreibt „die größten Gedichte der deutschen Sprache“ und hält sich selbst für verrückt. Und auch die beiden Männer in Gehen (Frankfurt 1971), der Chemiker Oehler und der „Untergeher“ Karrer treiben sich in solche Höhen, daß sie nahezu wahnsinnig werden: „Verrücktheit ist etwas in unglaublichster Höhe sich Vollziehendes, aber gleichzeitig mit einem Schlage Wertloses“. Auch Reger ist ein Sonderling, der seine Kindheit als „Hölle“ empfindet, die Sonne haßt, mit Österreich (wie nebenbei bemerkt nahezu alle Bernhardschen Helden) in einer Art permanentem Kriegszustand lebt, und noch dazu einer, der, selbst hochkreativ im Denken und Empfinden, den Künstler desavouiert, ihn zumindest mit aller Künstlichkeit der Kunst in Zweifel zieht. Auch dieser Reger wird plötzlich zur Kunstfigur, weil er Maler, Musiker und Schriftsteller in einem ist, nicht nur Rezipient, sondern auch Täter, also nicht nur Leser, sondern auch Schreiber, künstlerischer Generalist, würden wir sagen[27]. Originalität Jener Parameter, der zumindest in der konventionellen Kunstauffassung des 19. Jahrhunderts als ein für die künstlerische Kreativität zentraler angesehen wurde, ist die Originalität. Damit war aber, nicht wie Laien so oft meinen, daran gedacht, daß jeder Künstler Originäres im Wortsinn der Erst- und Einmaligkeit schaffen müßte, sondern Originalität bedeutete auch im 19. Jahrhundert Originäres im Kontext zur zeitgenössischen Szene oder zur unmittelbar wahrgenommenen Rezeption. Originalität im Kreativitätsschema bedeutet primär Neuheit für den Künstler selbst, also Beschreiten neuer Wege und Durchsetzung der einmal als richtig erkannten Vorstellungen, gleichgültig, ob dies Tabus verletzt oder nicht, ob dies Beifall findet oder nicht, ob dies akzeptiert wird oder nicht, ob dies verfolgt wird oder nicht, ob dies gerade für ihn günstig ist oder nicht. Gerade die Tabufrage ist zweifellos jene Dimension der künstlerischen Kreativität, die die meisten sozialen Konflikte in der Kunstgeschichte ausgelöst hat. Heute werden gewöhnlich nur die Konflikte mit Machtträgern wie Kirche oder Adel betont und beschrieben, wobei die Verletzung crea7 sexueller Tabus bis hin zur vermeintlichen Pornographie als häufigstes Schema genannt wird. Kunsthistorisch gesehen gab es aber ebenso sicher Auseinandersetzungen mit anderen gesellschaftlichen Gruppierungen, mit Ständen, Berufssparten, Geschlechtern und Symbolträgern aller Art. Dies hängt damit zusammen, daß Tabus nicht nur in Relation zur Macht und deren Erhalt eingesetzt werden, sondern auch als weltanschauliche, schichteneigene oder spartensystemisierte aufgebaut werden können. In unserer gesellschaftlichen Realität beispielsweise hat sich eine relativ liberale Haltung gegenüber Sexualität allgemein durchgesetzt, andererseits aber haben sich neue Tabus entwickelt: Tierschutz, Genttechnologie, in Österreich die Atomfrage, Kindersexualität im Westen, Sterben und alle Auswüchse von „political correctness“, die nahezu beliebig und täglich neu gängige Sprachmetaphern mit Tabuzonen belegt. Die Nichtrücksichtnahme auf Tabus erstreckt sich folgerichtig denn auch auf die Gesetzgebung, was beispielsweise in Österreich Otto Mühl mit sieben Jahren Gefängnis bezahlen mußte. Von der Originalitätsdimension her gesehen, sind auch gesetzlich geschützte Tabus irrelevant. Dem Künstler bleibt nichts anderes übrig als seine Arbeit in Erkenntnis der Thematik und seiner eigenen Leistungsfähigkeit auszuführen und möglicherweise dafür bürgerlichen oder gesellschaftlichen Sanktionen ausgeliefert zu sein. Daß Künstler und darunter auch so berühmte wie Michelangelo, Schiele, Bruckner oder Verdi gelegentlich Revisionen auf äußeren Druck in ihren Werken vornahmen, ändert nichts an dem Phänomen an sich, sondern zeigt nur, daß sie die Veröffentlichung oder Aufführung ihrer Werke der einmal konstatierten Originalität vorzogen. Klassische Beispiele im 20. Jahrhundert für diese nahezu die Kunstwelt verändernde Originalität sind leicht zu benennen. Der Komponist Arnold Schönberg hat mit seiner Erfindung der Zwölftonlehre tatsächlich eine neue musikalische Ausdrucksweise entwickelt, die als künstlich erdachtes System weite Teile der musikalischen Komposition des Jahrhunderts beherrschte. In der Verfolgung der Idee, die Linearität und die Vertikalität der Musik zu verschränken, schuf er nahezu auf Ingenieurbasis Musikkonzepte, die vorher in dieser Form nicht auffindbar waren. Die Zwölftonlehre war also nicht so sehr der Wunsch nach einem neuen musikalischen Stil, sondern die Artikulation eines Kunstwollens, das die Dominanz des Handwerks als ästhetische Wahrhaftigkeit sichern wollte. Schönberg baute auf der Logik musikalischer Grundgesetze auf, die er vorab gründlich an prominenten Werken der Musikgeschichte studiert hatte und entwickelte damit ein Lehrsystem, das sich am musikalischen Material allein und nicht an seiner Interpretation oder der Überstülpung von Stimmungen über dieses Material orientierte. Das Ergebnis war zwangsläufig autokratisch, formal streng und deswegen auch einerseits von künstlerischen Adepten gesucht, andererseits von Gegnern des Systems wütend bekämpft. Erst in jüngster Zeit sind wieder Schönberg-Interpretationen bekannt geworden, die zeigen, daß sogar der Wienerische Sprachduktus trotz der Konstruktionsweise nicht verlorenging und damit tatsächlich eine Neusprachlichkeit von Musik erreicht wurde, die man ohne weiteres dem Wechsel vom Mittel- zum Neuhochdeutschen gleichstellen könnte[28]. crea7 Eine ebenso große und inzwischen durchaus von allen Schichten akzeptierte Prägung durch Originalität malerischer Sichtweise schuf Pablo Picasso, mit dessen Demoiselle d‘Avignon 1908 als Beginn des analytischen Kubismus gewöhnlich auch der Beginn der bildnerischen Moderne angesetzt wird, der aber auch in einer Reihe von anderen Stilfindungen nahezu das Gesamtschaffen des 20. Jahrhunderts präformierte. Gerade Picasso ist ein Beleg für die Tatsache, daß ihm die Originalitätsdefinition im Hinblick auf die Erstmaligkeit der Geschichte völlig gleichgültig war: Seine Studienphase ab dem 14. Lebensjahr internalisierte den Malstil Velasquez’, sein Expressionismus der blauen und der rosa Periode schloß in malerischer Unverwechselbarkeit an seine Vorgänger an, sein Exotismus stand unmittelbar mit Cézannes Bilddenken für den Kubismus Pate, Doppelgesichtigkeit in Analyse und Synthetik dauerten bis zu einem neuen wichtigen Klassizismus einerseits und einer Materialvielfalt andererseits, die von der konventionellen Bleistiftzeichnung bis zur Transparenzerfahrung auf der Glasplatte zwecks Filmabnahme reichte. Ja selbst das kleinplastische Werk, das erst 1977 mit einer Gesamtschau in Düsseldorf bekannt wurde, zeigt unmißverständlich die Vorwegnahme nahezu aller Objektauffassungen des 20. Jahrhunderts, wobei sich, wie sonst auch, rezeptionsrelevante Originalität und Findung – so Picassos eigene Formulierung – trafen[29]. Eine ganz andere originelle Strukturierung stellt der österreichische Dichter Peter Turrini, geboren 1944, vor. Seit seiner Rozznjogd von 1971 offeriert er in seiner Arbeitsweise, gleichgültig ob für das Theater, den Fernsehschirm oder neuerdings auch für die Oper (Der Riese vom Steinfeld, komponiert von Friedrich Cerha 2002) Zeitaktualität in Alltagskleidung und ausschließlich im sozial dramatischen Zusammenhang. Er verwendet wie weiland Johann Nestroy nicht nur die Sprache des einfachen Volkes, sondern auch die Medienrealität, insbesonders jene der trivialen Medien Film und Fernsehen, übernimmt Klischees zu ihrer Decouvrierung und singt nach wie vor das Lied vom einfach geschändeten Individuum, das aber nicht wie im Expressionismus als unschuldige Kreatur, sondern als mitschuldig Gefangener dem in der Regel letalen Schicksal nicht entkommt. Turrinis dramatischer Aufbau, an Modellen der Vergangenheit geübt, macht sinnvoll klar, daß auch im Zeitalter der Collage, der nahezu durchgängigen Fragmentierung, es sinn- und einsichtsvoll ist, ganzheitlich zu denken und zu schreiben, den traditionellen Werkcharakter beizubehalten und trotzdem die Dimension aktueller Modernität zu streifen. Dieses Originalitätsmodell, das trotz sich verändernder, politischer und ökonomischer Lage stur bei der Schicksalssubstanz des Individuums als Repräsentant einer der ausgebeuteten Schichten bleibt, erhält in der künstlerischen Bearbeitung unerwartete Nobilitierung, die dem unreflektierten Massenverbrauch entgegensteht und in der nivellierten Totale quasi auf Zoom-Ebene das Einzelschicksal zum Modell des Lebens erhebt[30]. Daß diese Originalität auch in den neuesten elektronischen Medienkünsten Zukunft hat, beweist der ungarische Animations- und Computerspezialist Támas Waliczky. In seinem aufwendigsten Projekt The Garden. (1991-1993). Ein Amateurfilm des 21. Jahrhunderts versuchte sich Waliczky nicht an der Zeit, sondern auch an der Vorstellung vom Raum: „Das ungewöhnliche an The Garden ist die veränderte Perspektive, denn das spielende Kind (aus altem Superachtmaterial zusammengeschnitten) wird zum Zentrum der Welt, eine solipsistische crea7 Einheit, in der sich alles krümmt und im wahrsten Sinn des Wortes um die eigene Person dreht. Waliczky hat dazu das Wassertropfenperspektivsystem entwickelt, bei dem jeder Gegenstand vom Standpunkt des Kindes her bemessen wird, das heißt, geht das Kind auf Etwas in seiner Umgebung zu, wird dieses Etwas größer und alles hinter dem Kind wird kleiner. Die Perspektivlinien gleichen einer wissenschaftlichen Abbildung aus dem Bereich der Strömungslehre. Das Kind scheint die Wirklichkeit anzuziehen. Dabei entstehen ungewöhnliche und kaum vorauszusehende Verzerrungen und Verschiebungen der sichtbaren Umwelt. Die ganze Welt ist kugelförmig und hat das kleine Kind als Mittelpunkt. Alles hängt von seinen Bewegungen ab. Die gezeigte Welt ist seine eigene Welt“. So beschreibt Anna Szepesi diese Arbeit[31]. Sensitivität Ein wichtiger Parameter ist auch Sensitivität, nicht zu verwechseln mit Sensibilität, weil das Adjektiv sensitiv auf eine Aktivposition hinweist, die vom Individuum als Sinnesaktivierung auch geleistet werden muß. Die Sensitivität ist für die Kunst der Hort des Seismographischen. Sie ist die Fähigkeit gesellschaftliche Veränderungen, Trends, Modeströmungen, die in der Luft liegen, wahrzunehmen, darauf zu reagieren und sie – meistens bevor sie eintreten – entsprechend auszudrücken, respektive die Anfänge von sie betreffenden Dokumentationen zu leisten. Auch wenn die treffende Zuschreibung erst immer ex posteriore zu leisten ist, wobei die Gefahr der Überprojektion droht, sind in der Kunstgeschichte einzelne Geschehnisse so bedeutsam, daß sie als Logoi für Eigenschaften dienen können. Auch wenn viele Regisseure, Dirigenten und gar erst das Publikum an dem Phänomen vorbeigehen, ist ein Paradebeispiel dafür in Mozarts Finale des 1. Aktes seiner Oper Don Giovanni aufzufinden. Diese Oper 1787 geschrieben, also zwei Jahre vor der Französischen Revolution, für die sich Mozart nach seinen eigenen Worten wegen des hohen Blutvergießens nicht sehr interessierte, beinhaltet eine meist als rätselhaft verstandene musikalische Artikulation, die später zum Signalruf der Revolution wurde. In dem Finale treffen sich alle Gegenspieler bei einem Maskenfest, die von Mozart auch musikalisch gleichzeitig auf der Bühne durch die sie repräsentierenden Tänze plastisch dargestellt werden. Innerhalb dieser vertikalen und horizontalen Separation, die nur durch den Faktor Musik geeint ist, brechen plötzlich alle Beteiligten in den Ruf „libertà“ aus, wiederholen diesen insgesamt 17mal, was nicht nur unser heutiges Opernpublikum kaum wahrnimmt, sondern auch das damalige wahrscheinlich verwunderte. Dieses Libertà-Modell, noch dazu in der seit dem Barock bekannten all’armi-Quarte aufgehoben, also ein militärisches Angriffssignal, hat eindeutig Kampfrufcharakter und wird seitdem oft in der Vertonung mit dieser autoritativen Quarte dargestellt[32]. Picassos Guernica-Bild von 1937, gemalt anläßlich der Auslöschung des Ortes, ist nicht nur eindeutig auf Spanien bezogen mit den vielen erfahrenen Techniken der früheren Jahre, dem flachen bruchstückhaften Figuren des Kubismus, dem versetzten Augen-Ohren-Profilen und crea7 Gliedmaßen, den kraftvoll abstrakten Formen der primitiven afrikanischen Kunst und der Symbolik der Minotaurus-Serie ausgestattet, sondern auch ein bildhaftes Symbol für jenen anonymen modernen Krieg, der seit der Jugoslawien- und der Irakkrise erst mehr als ein halbes Jahrhundert später Routine zu werden scheint. Übrig bleiben, so lehrt das Gemälde, nur gequälte, zerstörte Folgeerscheinungen: das Leid, die Unsicherheit, die Opfer, unkenntlich von welcher Seite, während der auslösende Täter oder die Veranlassung der Täter samt deren wie immer gearteter Motivation in Unpersönlichkeit und Unbekanntheit verschwanden[33]. Ein ebenfalls erst ein halbes Jahrhundert später relevantes Phänomen, die Ökologie und Bedachtsamkeit auf die Natur, ist bereits im Werk des Wiener Schule-Komponisten Anton von Webern vorformuliert. Auch wenn man seine 31 Stücke des Gesamtwerks in drei Stunden abspielen könnte, weil Weberns längstes Werk 10’ 30 dauert, während sein kürzestes 19 Sekunden währt, ging es ihm bei der Abstreifung der Tonalität um eine höchstmögliche Verdichtungsphase, also nicht um Pointillismus als Modell für Darstellung, sondern um Farbe an sich, Ton an sich, Musik als Leben und nicht als Synonym für Leben. Die heute immer weiter um sich greifende Erkenntnis, daß Weberns Musik mit dem Modus des Organischen zu tun hat, eine These, die seine eigenen Aussprüche und seine gute Kenntnis von Goethes Pflanzenlehre unterstreichen, versucht im Analogon der Naturanschauung zu verfahren. Deswegen bezeichnete sie Pierre Boulez als „entrindet“ oder beschrieb der Komponist Wolfgang Rihm die „Durchseelung des Einzeltons“, weil die Töne ja nicht im Stillstand beseelt seien, sondern sie im Fluß lägen und fließend ein von Webern gern gebrauchtes Wort sei. Dieses Zu-sich-selbst-Kommen, das immer nur den musikalischen Ton und seine Eigensubstanz bis hin zu seinen Beziehungen bedeutet, also Sein oder Leben signalisiert, war verständlicherweise eine Kampfansage an Pathos, Versprachlichung und Expressivität als Angriffsnormen gegen dieses Leben, das des absoluten Schutz bedürfte[34]. Komplexitätspräferenz Komplexitätspräferenz ist ein Parameter, der nahezu von jedem Künstler angestrebt wird, also ein Modell, das in allen anderen Kreativdimensionen wie Wissenschaft, Sozialverhalten oder körperliche Intelligenz nur sporadisch entsprechend auftritt und eher auf Spezialisierung hin trainiert wird. Die Legitimation für das Auftreten von und in der Kunst besteht jederzeit und überall zweifellos darin, daß sie als offenes System eine Art Lebensparallele darstellt. Es ist kein Zufall, daß seit Tausenden von Jahren immer wieder die gleichen zentralen Menschheitsprobleme abgehandelt werden, meist existentieller Art, wo es um die Grundbefindlichkeiten des Menschen geht: seine Triebe, seine Interessen, seine emotionalen Befindlichkeiten, seine Tätigkeiten, seine sozialen Beziehungen, seine Wahrnehmungen und sein Hang zur Metaphysik. Liebe und Haß, Werden und Tod, die Gottesvorstellungen, Fauna und Flora, die Mythologie und die Sterne, die Geschlechterbeziehungen, die Tugenden und Laster des Menschen sind zentrale Fragestellungen, die immer wieder neu beantwortet werden. Daraus resultiert zweifellos auch die Zeitlosigkeit wichtiger Kunstwerke, weil sie trotz ihrer zeitlichen Entstehungsgebundenheit, die lange crea7 zurückliegen mag, Lösungsansätze anbieten können, die heute noch überlegenswert und durchaus reflexionsanleitend sind. Das griechische antike Theater beispielsweise analysierte die innerfamiliären Beziehungen derart, daß auch die moderne Psychologie (nicht zufällig operierte Freud mit Antiken- und Kunstfigurenbezeichnungen) keine wesentlichen Neuerungen anbieten kann. Das Römische Imperium demonstrierte Machtfragen, die christliche Kunst von Anfang an die Vermenschlichung der Gottesvorstellungen, die Renaissance die Wahrnehmungsfähigkeiten, abgelesen an der Natur und konstruiert in neuer Ingenieurtechnik. Die Aufklärung kümmerte sich um die Autonomie und die Wahlchancen des Menschen, das 19. Jahrhundert vor allem um die Emotionen, und das 20. Jahrhundert um alle jene Nebenschauplätze, die fallweise die Hauptfragen empfindlich beeinflussen, sie aber nur im Ausnahmefall stellen. Tatsächlich schafft es die Kunst in ihrer Dimension komplexe Systeme an sich nicht nur darzustellen, sondern auch erklären zu können, gleichzeitig die emotionalen und rationalen Intelligenzen im Menschen anzusprechen, ihn zumindest an seine eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten zu erinnern. Kennzeichnend für diese Komplexitätspräferenz sind alle Konjunktionen mit Welt, womit der größtmögliche Umfang dieser Komplexität angedeutet wird. War diese Welt manchmal nur der überschaubare topographische Raum, so ist es heute eine globale ja orbitale Dimension, deren Zusammenfassung auch in der Gegenwart angegangen wird. Das Panoramabild Schlacht bei Frankenhausen von Werner Tübke[35] beispielsweise, nicht nur riesig im Format und nicht nur riesig in der quantitativen Malerei kennzeichnet den Anspruch einer solchen Komplexitätspräferenz ebenso, wie Peter Weibels Installationen den orbitalen Raum betreffend[36]. Joseph Beuys (1921-1986) suchte diese Weltsicht in Gestaltqualitäten nachzuweisen und entwickelte in seinen Rauminstallationen, in den Multiplen und selbst in seiner sozialpolitisch orientierten Arbeit (Stadtverwaldung in Kassel) nahezu Demonstrationsobjekte verschiedener Kategorien dieser Komplexitätspräferenz, die sich ja tatsächlich auch in den Bezeichnungen niederschlugen. Beuys setzte sich selbst als Abgeordneter der Grünen dafür politisch in Szene, erlangte mit seiner Arbeit Weltruhm und gilt nach wie vor als einer der wichtigsten Künstler des 20. Jahrhunderts[37]. Eine ganz andere Methode der Darstellung von Komplexitätspräferenz pflegte Ludwig van Beethoven. In seinem Werk, deren Titel ohne Opuszahl jene mit einer solchen weit übersteigen, suchte er sowohl quantitativ alle Gattungs- und Botschaftsmöglichkeiten menschlicher Existenz auszuloten, als auch qualitativ in zentralen Arbeiten musikalische Weltbilder zu erzeugen, die in ihrer Inhaltlichkeit soweit verstanden wurden, daß sie teilweise sogar politischen Manifestationscharakter erhielten. Ist heute davon in der Regel nur die humanistisch brüderliche Variante populär, stellt sein Gesamtwerk eindeutig dar, daß diese Komplexität auch für andere Zielvorstellungen oder Ausdrucksmöglichkeiten eingesetzt werden kann. Immerhin hielt er sein Schlachtengemälde Wellingtons Sieg bei Vittoria für sein bestes Werk überhaupt, versuchte in einer Reihe von Agitationsmusiken politische Zeitaktualität und Utopie einzufangen, transformierte die Folklore verschiedener Länder zu crea7 Kunstmanifestationen, schuf der Gattenliebe ein Denkmal in Fidelio und suchte den Aspekt des Todes in nahezu 20 Werken von allen Seiten her zu beleuchten. Beethoven brachte nicht nur die menschliche Stimme (Missa solemnis) und das instrumentale Vermögen (Violinkonzert) an seine physischen Grenzen, sondern lotete auch die Trivialität aus und trieb die Dialektik an den Rand ihrer Selbstzerstörung. Seine Missa solemnis zeigt nicht nur komponierte Theologie in der Vermischung mit privatreligiöser Haltung, nicht nur die Prüfung des Selbst an der Kompositionsschule des Barock, nicht nur den Grenzgang der Aufführungsmöglichkeit oder die Erzählung allgemeinverbindlicher Bilder (weswegen auch selbst nichtreligiöse Menschen von der Dramatik sich packen lassen), sondern auch eine Weltbilddarstellung, die in ihrer Grundbefindlichkeit jener des aufgeklärten, republikanischen, intellektuellen Demokraten entspricht. Es wird nämlich jede angesprochene Dimension der Existenz auch quasi von innen her kommentiert, die ehemals ausschließlich theologische Stoßrichtung ins allgemein Humane erhoben. Die eigenhändige Überschrift über das Kyrie „Von Herzen, möge es wieder zu Herzen gehen“, zeigt, daß die emotionale Ansprache für mindestens so wichtig gehalten wird, wie die musikalische rationale Fertigkeit[38]. Es ist vermutlich kein Zufall, daß, wenn sich auch die beiden aus zutiefst menschlichen Gründen nicht so sehr verstanden haben dürften, Beethovens Zeitgenosse Johann Wolfgang von Goethe in gewisser Hinsicht ein Pendant zu dem musikalischen Vordenker darstellt. In die gleiche Zeit, die Spätaufklärung hineingeboren, hochgebildet, intelligent und clever, versuchte er in seinem dichterischen Werk ähnliches wie der Komponist, was ihm nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ glückte. Goethes Faust in beiden Teilen demonstrierte denn auch Weltbildsicht in absoluter Zeitlosigkeit, die Dimension des Intellektuellen in einer von sinnlicher Verführung und wie immer gearteter Korruption gefährdeten Welt. Es sind nicht nur die Prinzipien von Gut und Schlecht ausgeführt, sondern auch deren Überschneidungen und Verwischungen, und es wird Stellung bezogen zur physischen wie zur metaphysischen Dimension der Erde. Es ist kein Zufall, daß kaum ein anderes Werk derart zitatfähig wurde wie dieser Faust, weil nahezu für alle menschlichen Befindlichkeiten entsprechende Sprüche bereitstehen[39]. Diese Weltsicht, bezogen auf das soziale Gefüge der Zwischenmenschlichkeit und insbesondere die Leidensfähigkeit unter sozial motivierter Dominanz hat der österreichische Künstler Wolfgang Flatz zum Thema seiner Arbeiten gemacht. In vielen Aktionen hat er einem in der Regel nach Vollendung der Installation beschämten Publikum vorgeführt, wozu Menschen imstande sind: zu ertragen, daß eine Frau ohne verhinderte Interventionen stundenlang geohrfeigt wird, daß gegen Geld Dart-Pfeile auf Menschen schleuderbar sind, daß die Durchsetzung des Durchkommens – gezielt mit hängenden Boxsäcken – Mitmenschen beschädigt, daß der Abwurf eines zwar toten, aber nichtsdestoweniger realen Lebewesens wie einer Kuh aus 20 Meter Höhe die Neugier der Massen zu keilen imstande ist. Dieses Modell der sozialen Erfahrung, wie, crea7 nebenbei bemerkt, öfter in der Kunst an sich selbst vollführt (durchaus eine Parallele zum Aktionismus), zielt messerscharf trotz quantitativer Unschärfe auf die Gesellschaft unserer Zeit[40]. Elaborationsfähigkeit Ein anderer wichtiger Parameter der Kreativität ist zweifellos die Elaborationsfähigkeit[41]. Dieser von Paul Guilford in die Kreativitätsforschung eingeführte Begriff aus den 1950er Jahren ist eine Ausweitung der Formulierbarkeit oder Definierbarkeit, wie sie Immanuel Kant postulierte. Kant vertrat die These, daß der Mensch nur denken könne, was er aussprechen kann. Abgesehen davon, daß diese These nach wie vor glaubwürdig erscheint, erweiterte sie Guilford um nonverbale Möglichkeiten, womit angedeutet wird, daß es auch eine Art nonverbalen Denkens geben könne. Dies kommt verdächtig in die Nähe des „begriffslosen ästhetischen Verstehens“, ein Terminus, der gerade in der Kunstrezeption und auch in der Erkennung kleinster gemeinsamer Nenner durch Künstler selbst eine große Rolle spielt. Kant meinte natürlich nicht, daß die Verbalisierung wie sie in der Literatur geschieht, die höchste aller Künste sei, sondern er ging von der These aus, daß gleichgültig, in welchem Medium der Ausdruck erfolgte, das in Worten gefaßte Denken eine wesentliche Voraussetzung dafür darstellt. Es ist durchaus vorstellbar, daß Kant mit dieser These recht hat. Denn im Gegensatz zu den Verfechtern jedweder Autonomie, die davon ausgehen, daß Medium beschäftige sich ausschließlich mit sich selbst, womit jeder Hintergrund geleugnet würde, ist ebenso denkbar, daß hinter jeder vorgestellten Autonomie durchaus konkrete Ausgangspunkte liegen, die wir aber aufgrund der fehlenden begrifflichen Darstellungen nicht eruieren können. Dafür würde Haydns berühmter Brief an seinen Verleger ein Beleg sein: „Bevor ich eine Symphonie anfange, muß ich mir eine Geschichte ausdenken und dann geht sie schon weiter“[42]. Es liegt wahrscheinlich am Medium selbst, daß gerade in der Architektur diese Fähigkeit der Elaboration eine zentrale Rolle auch in der Einschätzung ihrer Bedeutung spielt. Beispielsweise haben sowohl Hans Hollein (geboren 1934), den Kritiker zur Postmoderne rechnen, als auch der ebenfalls an der Universität für angewandte Kunst in Wien lehrende Wolfgang Prix (Coop Himmelblau zusammen mit Helmut Swiczinsky) in ihren Arbeiten, wenn auch in durchaus verschiedenen, ja diametralen Richtungen dieses Modell anschaulich vorgeführt. Dabei geht es weniger um die Erfüllung des Bauauftrags, die Kubatur, die notwendigen Funktionen, sondern um die gestalterische Herausarbeitung der zugrundeliegenden Ideologie. Hans Holleins unverwechselbare Leistung ist die Einbettung jedes von ihm geschaffenen Bauwerks in die topographische oder mentale Dimension des Umraums. Deswegen sind ihm die verschiedenen funktionalen Ansätze nicht nur in der Einlösung ihrer Ansprüche perfekt gelungen, sondern auch die Positionierungen, die bei aller Neuheit auf die vertraute Umgebung Rücksicht nehmen, noch dazu in brisanten crea7 Kontexten. Das Museum in Mönchengladbach, schwierig in eine Hügellandschaft eingebettet, atmet exakt jenen Geist der niederrheinischen Schatzkästleinmentalität, die typisch für Ökonomie und Bewußtsein des dort lebenden Menschenschlages ist. Sein Museum, bis auf den letzten Quadratzentimeter genau auf seine Funktionen zugeschnitten, erhob die Stadt, die bislang nur durch eine berühmte Handball- und später eine weniger berühmte Fußballmannschaft überregional bekannt war, in den Rang einer wichtigen Sehenswürdigkeit, wobei die Inhalte des Museums wahrscheinlich weniger attraktive Anreize boten, als das Museum selbst. Andererseits schaffte Hollein es unter tatkräftiger und für diesen selbst riskanter Unterstützung des ehemaligen Wiener Bürgermeisters Helmut Zilk, einen Typus von Wiener Kaufhaus gegenüber dem Stephansdom zu plazieren, daß tatsächlich trotz aller Anfangsproteste heute zu den zentralen Sehenswürdigkeiten der Stadt zählt. Hollein suchte nämlich nicht nur die funktionalen Leistungen aus dem üblichen Massenangebot von Kaufhäusern à la Harrods herauszulesen, sondern mithilfe von Kleinstrukturen in der Konzeption der Wiener City ein adäquates, modernes Pendant gegenüberzustellen. Wieweit dieses Vorhaben gelang, ist allein daraus abzusehen, daß die benachbarte Ringstraßengalerie, wenn auch ganz anders gebaut und der Gründerzeitgröße entsprechend, zumindest in der Geschäftsstruktur exakt diese Kleinteiligkeit übernommen hat. Auch wenn heute durch die Dummheit der Inhaber die Innenstruktur des Hollein-Baues nahezu komplett zerstört wurde, was das Gesamtgebäude durchaus in Frage stellt, bleibt die Außendimension Argument genug, dieses Modell realiter auf seine genaue Definition zu überprüfen. Holleins Bemühen war es, trotz der funktionalen profanen Aufgabe (Konsumtempel) die spirituelle Dimension des Stephansdomes nicht anzutasten. Dies gelang ihm nicht nur mit der Glasfassade, die den Dom spiegelt, sondern vor allem auch mit jenem Baldachinzitat, das aus der Klerikalsphäre übernommen, anders übersetzt, den hoch aufragenden Bau auf die irdische profane Dimension, quasi deckelartig abgeschnitten, beschränkt. Durch eine höchst sensible Reaktion auf die Verschiedenheit der Blickwinkel und der angrenzenden Gassen in durchaus verschiedenen architektonischen Haltungen gelang es Hollein, das Haus auch aus den verschiedenen Seitenansichten verschieden antworten zu lassen, so daß im gesamten gesehen, die homogene Einfügung in den von ihm vorgesehenen Platz, der es aufgrund des Unverstandes der Stadt nie dazu schaffte, möglich wurde. Heute schon rächt sich der Verzicht auf einen wesentlichen Vorschlag, den Hollein zugleich mit dem Plan des Hauses einbrachte: nämlich durch eine Säulenkonstruktion diesen Platz tatsächlich zu begrenzen und nicht als Leerfläche mit Sogwirkung à la mehrspuriger Fußgängerautobahn zu belassen. Deswegen ist es auch kein Zufall, daß Demonstrationen jedweder Art sich vornehmlich für diesen undefinierten Raum vor dem Haashaus entscheiden, weil dort der Beliebigkeit des Menschenauflaufs und seiner verschiedenen Motivationen tatsächlich kein gestalterisches Wollen entgegensteht[43]. Wolfgang Prix, geboren 1946, also nahezu eine Architektengeneration jünger als Hollein, geht in seiner Elaborationsstärke von ganz anderen Prämissen aus. Er kümmert sich im wesentlichen nicht um den Umraum, weswegen er auch, wenn möglich, unikatäre Plätze für seine Arbeit beansprucht, oder zumindest den Irritationsfaktor seiner Architektur dramaturgisch einsetzt. Seine Dimension des Dekonstruktivismus ist eine crea7 gestalterische Zusammenfassung zeitgenössischen kulturellen Denkens, das die Funktionalität – ebenso perfekt wie Hollein – in das Kleid aktueller philosophischer Ideologie einbettet und dem Gefühlshaushalt des in Selbstbestimmung und Technologie verhafteten Menschen Ausdruck verleiht. Seine Arbeiten, sowohl das Museum in Groningen (Niederlande) als auch jüngst der Filmpalast in Dresden oder das Zeichen im Vierwaldstätersee belegen, daß zwischen autonomer Gestalt und laufender Funktion kein Widerspruch bestehen muß, sondern beides trotz der nicht sofort erkennbaren Ansätze unmittelbar miteinander zu tun hat. Prix Aussage ist die des Subjektivismus zeitgenössischer menschlicher Existenz, der sich zunehmend in Individualität und auch im wahrscheinlich unerfüllbaren Wunsch ausdrückt, sich eine spezifisch eigene Umwelt zu schaffen, die mit dem eigenen Gefühlshaushalt mehr zu tun haben sollte als mit der sozialen Bindung an die Umgebung. Diese Ausdrucksweise denkmalisiert das menschliche Bewußtsein am Beginn des Informationszeitalters als spezifischen zeitabhängigen Typus und friert dessen mentalen Zustand in die Bauform ein[44]. Eine ganz andere Dimension dieser Elaborationsfähigkeit entwickelte Franz Schubert (1797-1828) in seinen über 600 Liedern. Er machte eine kleine, überschaubare dichterische Form zum Kosmos aller Aussagen, wobei er niemals Vorlage und deren Inhalt verletzt, aber in seiner Vertonung derart bildhaft ausdeutet, daß es zu einer Integration von Text und Musik kommt, was den Dichtern dieser Texte wie beispielsweise Goethe gar nicht immer recht war. Schubert ging es nicht um die reale Abbildung im Sinn der Wiedergabe, sondern um die eigene Ausdeutung des Erfahrenen, wobei ihm die dichterische Vorlage den Anlaß bot, er sie aber - und deswegen nahm er auch solche verschiedener Qualitäten - in seinem Sinn transformierte. Daher konnte ihm gleichgültig sein, ob sie von Weltstars wie Goethe oder privaten Intimfreunden wie Mayerhofer stammten, weil er prinzipiell Texte als Zeugnisse politischer Wirklichkeit ernstnahm und seine eigene Wahrnehmung und Transformation an ihnen zu erproben trachtete. So kompliziert die musikalische Struktur sich auch in ihrem Innenleben darstellen mag (weswegen sich auch die Analysen nicht leicht tun), so sprechen die Kompositionen, gleichgültig ob gestern oder heute und gleichgültig in welchem Bildungszusammenhang, ja sogar in welchem Ambiente sie dargeboten werden, unmittelbar die Gefühle des Zuhörers an und verlangen von ihm, zumindest punktuell, in die Sichtweise des Komponisten einzutauchen. Wie diese Sichtweisen sich von jenen anderer Komponisten und vor allem auch von jenen seiner Zeitgenossen unterscheiden, ist erst dann spürbar, wenn man die verschiedenen Vorgangsweisen gegeneinanderstellt. Hat beispielsweise Goethes Lieblingskomponist Johann Friedrich Reichardt, der Liederstar von Berlin, in der Vertonung des Erlkönigs brav die Silben und damit die Syllabik des Textes unterstützt, so schafft Schubert daraus ein Minidrama mit großen Reichweiten. Da ist die Stimmung genau ausgeklügelt auf die inhaltliche Spannung. Da heißt Reiten: Fuß für Fuß, sprich Ton für Ton, triolenmäßig hintereinanderzusetzen, da heißt Nacht und Wind das gesamte Universum zu umschreiten, damit das sich in diesem Universum (also innerhalb der Oktave) ausfüllende Geschehen um Vater und Kind. Und da ist andererseits, völlig losgelöst von der Singstimme und mit ihr nur harmonisch zusammentreffend, die Kontinuität der Reitbewegung, des Hufschlages, der parallelen nervösen crea7 Spannung, des Herzrasens mit allen Signaturen der Kontinuität im Eingefangensein, in der Wiederholung des Stupors in der Reperkussion zu beschreiben. Reichardt besteht auf der Priorität des textlichen Baus, Schubert auf der Priorität des durch ihn transportierten Inhalts. Reichardt achtet den Dichter, Schubert benutzt ihn, auch wenn er Goethe heißt. Dieser Unterschied mag mit der protestantischen Worttreue zusammenhängen, der in Wien immer prioritär die Paraphrase des Theatralischen, also die Szene weit dem Wort vorgezogen, gegenüberstand[45]. Vielleicht wird einmal die Hochschätzung der Elaborationsfähigkeit als Stilkennzeichen der Musik des 20. Jahrhunderts grosso modo erkannt werden. Denn tatsächlich haben Komponisten vorher kaum mit dem realen Zeitbegriff so ernst gemacht, wie jene, die gleichgültig aus welcher Schule kommend, ihre Umsetzungen in die Extreme katapultierten. Dazu zählt John Cage mit seinem Schweigestück 4’ 33”, wo die Stille als Erfahrungswert sekundenmäßig gezählt wird, wobei offen bleibt, ob sie anfänglich oder schlußendlich gedacht ist. Dazu gehört La Monte Youngs Composition Nr. 7 von 1960, die das reine Quintenintervall h-fis auf Stunden ausdehnt und so den Zuhörer jeder Zeitvorstellung beraubt, ihm quasi Ewigkeitsmusik simuliert. Dasselbe hatte Erik Satie schon in den 20er Jahren in seiner Komposition Vexations vollzogen. Ein wenige Takte dauerndes Musikstück (vermutlich wegen seiner Merkfähigkeit) ist 840mal zu wiederholen und hat somit eine Aufführungsdauer von mindestens 20 Stunden. Verblüffende Diskrepanz: ein als ideale Zeitdauer geprägtes Thema – und Besseres kennen wir nicht als eine Merkzeit durch sieben Sekunden – verliert durch seine Wiederholung Anfangs- und Schlußcharakter, läßt also Zeit im großen stillstehen. György Ligetis Symphonie für 100 Metronome läuft in die gleiche Richtung. Das genaueste und deswegen auch angegriffenste Ordnungsgerät des musikalischen Ablaufs schlechthin, das Metronom, wird durch seine Vervielfältigung derart unscharf, daß eine Art konstanter Klangmusterteppich entsteht, somit Einschnitte nicht mehr erkennbar sind. Zu große Genauigkeit oder Genauigkeit auf lange Zeitspannen ausgedehnt, ergibt, erarbeitet man nur das Problem exakt, Ungenauigkeit[46]. Ambiguitätstoleranz Der siebente, aber ebenso wichtige Parameter der Kreativität ist die Ambiguitätstoleranz. Sie ist die Fähigkeit, in einer problematischen und unübersichtlichen Situation zu existieren und trotzdem unermüdlich an deren Bewältigung zu arbeiten. Der deutsche Psychologe Paul Matussek, der viele Arbeiten diesem Phänomen gewidmet hat, positioniert in der Beschreibung der Ambiguitätstoleranz auch die oftmals festgestellte soziale Unfähigkeit von besonders kreativen Menschen. Er führt diese Defizite in Mitmenschlichen darauf zurück, daß der Kreative durch die Interessen, Wünsche und Ansichten anderer, die mit seinen nicht übereinstimmen, irritiert würde und daraus erkläre sich ein Teil seiner Kontaktarmut, ja des gelegentlichen Desinteresses. Albert Einsteins Wort „ich liebe die Menschheit, aber nicht die Menschen“ ist eine crea7 Bestätigung dieser These. Möglicherweise aber könnte eine andere Dimension für dieses Desinteresse am sozialen Gegenüber verantwortlich sein: nämlich die bedingungslose Konzentration auf den eigenen Gegenstand, die im Gegensatz zum kontemplativen reflektorischen Denken meistens einen dynamischen Umgang erfordert und oft das Tun vor die Reflexion stellt. Die Ambiguitätstoleranz ist zweifellos eine jener Kriterien, die bei nahezu allen künstlerisch Kreativen in einem hohen Ausmaß vorhanden ist und vermutlich auch als einer der Urheber des Erfolges gilt, selbst wenn die Ausformungen durchaus verschieden sein können. Während Beethoven beispielsweise an der Formulierung eines Themas feilte und dabei Klaviere zertrümmerte und immer wieder neue Versionen erzwang, brach Schubert – sofern ihm nicht gelang eine Idee zu formulieren – sofort die Komposition ab und begann mit einer neuen. Daraus erklären sich auch die zahlreichen Torsi seiner Werke. Wie in allen Parametern ist Wolfgang Amadeus Mozart in dieser Eigenschaft einer der Spitzenrepräsentanten. Er schaffte zeit seines Lebens einen rein numerisch nahezu unerklärlichen Output, wobei ihm weder soziale Widrigkeiten noch persönliche Betroffenheiten, weder die Reisen noch seine Spielsucht und andere Laster, weder Demütigungen noch überschwingliche Lobpreisbezeugungen irritieren konnten. Das Jahr 1788, in dem Mozarts nach wie vor rätselhafte Verschuldung ansetzte, die ihn zweifellos pekuniär in Bedrängnis bringen mußte, steht dafür als unumstößlicher Zeuge. 1788 schrieb Wolfgang Amadeus Mozart seine drei großen Symphonien, KV 543, 550 und 551, die nach wie vor zu den am häufigsten aufgeführten Werken des Komponisten zählen. Dieses Jahr 1788, gewöhnlich in der Literatur ein Krisenjahr genannt, hätte ihn als Menschen mehrfach schmerzhaft treffen müssen. Das Kärtnertortheater wurde geschlossen, das sich immerhin auf die deutsche Singspielperiode konzentriert hatte, das vierte Kind Theresia stirbt am 19. Juni, und trotzdem: die Werkliste dieses Jahres zeigt nicht nur jene Symphonien, von denen zwei überhaupt nichts von irgendeiner Tragik verspüren lassen, sondern auch Kriegskompositionen, Klavierterzette, Märsche, jene berühmte C-Dur-Sonate für Anfänger (sic!) KV 545, die allen Klavierschülern als Sonata facile bekannt ist, eine Klavier-Violinsonate, Terzette, Canzonetten also übliche Gelegenheitskompositionen, die wie immer voll ihren Auftrag erfüllen sollten. Bei aller verbal geäußerten Verzweiflung, bei aller Umzugsproblematik (Mozart wechselte auch seine Wohnung), bei aller Vorbereitungsarbeit für die ersten Wiener Don Giovanni-Aufführungen – im Werk ist keine Rede von Trostlosigkeit und Verzweiflung, ja im Gegenteil: kraftvollste Aussage von hoher Ichstärke bis zu dahin unbekannter Schärfe der Dialektik, aber auch Reibung von Vorstellungen der Umsetzung, von erstarrter Form und lebendiger Musizierpraxis kurzum, zutiefst positiv gesetzte Bejahung, ja gütige Weisheit, nur mit der Stimmung aus der Sarastroebene der Zauberflöte vergleichbar[47]. Die Berühmtheit Michelangelo Merisis, genannt Caravaggio (1573-1610), fußt vermutlich ebenfalls auf dieser Höchstentwicklung von Ambiguitätstoleranz, die allerdings nur ein sehr kurzes Leben ausfüllte. Zeit seines Lebens mußte er Schicksalsschläge hinnehmen: 1593 wurde er durch einen Pferdetritt schwer verletzt, spätestens ab 1600 permanent wegen Körperverletzung kriminalisiert, was in einer Duelltötung 1606 kulminierte. Einerseits Malteserkreuzträger, nach zwei Jahren wieder unehrenhaft ausgestoßen, starb er 37jährig. Seine künstlerische Arbeit crea7 nimmt von den Schwernissen des Lebens nicht Notiz. Er stellt den künstlichen Dimensionen vorher das direkte Studium der Natur entgegen, macht plötzlich selbst aus Bibelgestalten und Mythologiefiguren, die längst zu Typologien erstarrt waren, Menschen aus Fleisch und Blut und zwingt historische Persönlichkeiten in zeitgenössische Kleidung. Das Licht wird bei ihm zu einer neuen Dimension der Dramatik und prägt somit eine Räumlichkeit, wie man sie vormals nicht kannte. Die gleichzeitige Minimalisierung der taktischen Einzelheiten gab diesen Bildern eine Unmittelbarkeit, die bis in die Unheimlichkeit reichte[48]. Dieses Modell hat auch im 20. Jahrhundert seine Attraktivität nicht verloren. Hatten schon die Wiener Aktionisten in den 1970er Jahren demonstriert, daß sie keine Scheu hatten, künstlerische Prozesse an ihren Körpern zu demonstrieren, setzte sich der zypriotische Künstler Stelarc nahezu unerträglichen Qualen aus. Wie er sagt, nicht unbedingt um die Zeit zu thematisieren, aber wenn das Ertragen der Qual die Zeitdauer begrenzte, war sie ein wesentlicher Faktor: bei seiner Skulptur im Inneren des Magens (Internal Stomack Sculpture) oder bei seinem berühmten Suspensions, wo er die Aufhängung des Körpers in bestimmten Situationen probierte. In Seaside hielt er es maximal 30 Minuten aus, dann wieder auch nur 1 Minute. In tree suspension hing er 15 Minuten in den Bäumen, in lateral suspension in der Tamura Gallery, Tokyo 1978, ließ er sich mit Nadel und Faden die Lippen und die Augenlider zunähen und harrte eine Woche in diesem Zustand aus, während die Performance in Mexico City (Event for penetration/extrapolation, Mexiko 1976) nur 1 Minute dauerte, weil er gegen eine Glasscheibe lief, die beim Aufprall zerbrach. Hauptziel dieser Unternehmungen war für ihn, den Menschen, dargestellt von ihm selbst, nach der Unterscheidung von Mensch und Cyborg zu fragen. Cyborg ist eine Mischung aus menschlichem und künstlichem Körper, wobei das Internet zu einer Art externem Nervensystem wird[49]. Fazit Das Besondere an der Kunst ist nun einmal die durchaus nachvollziehbare und wie ich meine auch rational überprüfbare Korrelation mit der Kreativität, wie sie beispielsweise in diese sieben zentralen Parametern auch differenziert benannt werden kann. Auch wenn diese Hauptkategorien bis in die Unendlichkeit ausdifferenzierbar sind, ändert dies nichts daran, daß die Kunst wegen ihres Sinnlichkeitsanspruches, den sie a priori hat, auch wenn sie der Rezipient aus Mangel an Sinnlichkeitsverstehen nicht immer gleich erkennt, eine Art Parallelsystem zur Lebenserfahrung des Einzelnen bietet. Sie hat in ihrer Formulierung durch Individualitäten oft Modellcharakter und steht damit signifikant als Repräsentant bestimmter menschlicher Verhaltensstrukturen, ohne sich allerdings an deren numerischem Querschnitt zu orientieren. Sie ist deswegen aufregend, weil sie ohne Scheu mit exakt dem den Menschen betreffendsten Argument der emotionalen Intelligenz operiert und imstande ist, entgegen ihm selbst diese genauer und unmißverständlicher herauszustellen. Sie ist radikal, weil sie oft mit Extremen der Darstellung arbeitet und selbst dem Durchschnittlichsten unter dem Publikum klarmacht, daß diese Extreme auch in seinem Innern vorhanden crea7 sein können, was notgedrungen eine Art Betroffensein oder eine Schuldeinstehhaltung evoziert. Die Kunst zeigt andererseits unmißverständlich, wie weit die kreativen Fähigkeiten, die jedem Einzelnen auch aufgrund seines grundlegenden Vermögens bekannt sind, ausufern können oder wie genau diese Zustände beschreibbar sind, daß sie auch verständlich sind. Dieses Kreativitätsmodell ist entgegen vielen anderen dem Rezipienten näher, weil nicht Alogisches auf ihn projiziert wird, nicht geschehene Wunder und Zahlen oder Gummimenschen, sondern Versuche, durchaus mit dem Anreiz, die Nachahmung zu wagen. Unabdingbar ist allerdings, und darin sehe ich die Grunddiskrepanz zur Kunstrezeption vor dem 20. Jahrhundert, weil die Menschen nicht in der gleichen Formalsprachlickeit existieren, sondern wahrhaftig ein Tohuwabohu verschiedener Kunstsprachlichkeit herrscht, daß Grundkenntnisse dieser Sprachlichkeiten, in der Regel optimal empfangen zwischen dem ersten und neunten Lebensjahr, gelegt sein müssen, um überhaupt eine gewisse Aufnahmebereitschaft sicherzustellen[50]. Der Kreativität in der Kunst sind nach wie vor keine Schranken gesetzt, wohl aber – so scheint es – aus aller verfehlten Bildungspolitik, dem Rezeptionsvermögen. Copyright © 2003-2005 Manfred Wagner