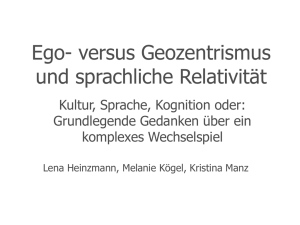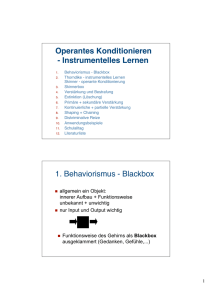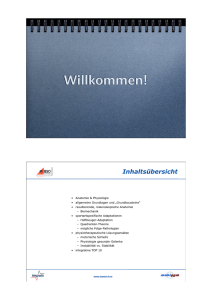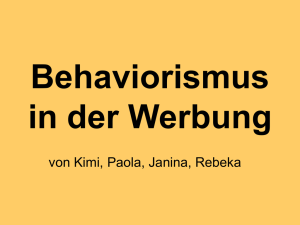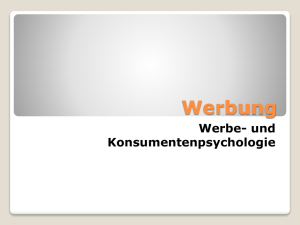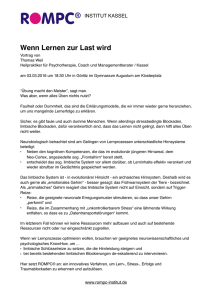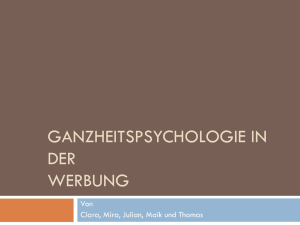ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE I
Werbung

ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE I Von: Josua Handerer Kontakt: [email protected] 1 1. Einführung in die Kognitionspsychologie 1.1. Gegenstand der kognitiven Psychologie Die allgemeine Psychologie befasst sich mit universellen und grundlegenden Funktionen menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns. Die kognitive Psychologie (= Allgemeine Psychologien I) befasst sich mit kognitiven Prozessen, die ihrerseits als Reiz- bzw. Informationsverarbeitung verstanden werden. Grundlegende Kognitionen sind z.B.: Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Sprache, Gedächtnis etc. Die traditionelle Sichtweise: Kognitionen (lat. „cognoscere“ = erkennen) dienen der Erkenntnis (Abbildung und Interpretation der Umwelt) Hoffmanns Sichtweise: Kognitionen dienen der Steuerung und Kontrolle von Verhalten; sie ermöglichen zweckmäßiges Handeln. Zweck unserer Kognitionen ist somit nicht die Abbildung bzw. Erkenntnis der Umwelt, sondern deren Veränderung! Daraus folgt, dass Kognitionen vom Verhalten her zu untersuchen sind. 1.2. Die biologischen bzw. evolutionären Wurzeln menschlichen Verhaltens Menschliche Verhaltensweisen haben sich im Lauf der Evolution herausgebildet; sie bringen spezifische adaptive Vorteile mit sich und ermöglichen dementsprechend eine bessere Anpassung an die Umwelt. Man geht davon aus, dass die Spezies Mensch (homo sapiens), die zur Familie der Menschenaffen gehört, vor ca. 6 bis 7 Millionen Jahren entstanden ist. Die nächsten Verwandten des Menschen sind die Schimpansen. Gegenüber anderen Arten zeichnet sich die Spezies Mensch v.a. durch folgende Merkmale aus: 1) Aufrechter Gang Effizientere Fortbewegung in der Ebene bzw. Steppe (verbraucht weniger Energie) Befreiung der vorderen Extremitäten (Arme und Hände) zur Manipulation von Gegenständen im eigenen Blickfeld (Benutzung von Werkzeug) 2) Soziale Kompetenz Genau wie wir lebten auch unsere Vorfahren in sozialen Gefügen (Rangordnungen, familiäre Bindungen etc.); Vgl. hierzu die diversen Affenbeobachtungen von GOODALL (Schimpansen können lügen, drohen etc.) Ein erfolgreiches Zusammenleben mit Artgenossen erfordert die Fähigkeit, deren Verhalten vorherzusagen bzw. zu antizipieren; nur dadurch werden Kooperation und Konkurrenz möglich! 3) Artikuliertes Sprechen Absenkung des Kehlkopfes => größerer Kehlkopfraum => präzisere Modulation der Atemluft => sprechen und atmen gleichzeitig + differenziertere Kommunikation Die Entstehung der (Symbol-) Sprache ist eine verhältnismäßig späte Entwicklung in der Evolution (siehe: Kap. 10). 2 4) Zuwachs und Differenzierung des Gehirns Betrifft v.a. den Neokortex, in dem höhere kognitive Funktionen (Planen, Problemlösen etc.) angesiedelt sind. Das menschliche Gehirn ist im Verhältnis zum Körpergewicht (Cephelesationsindize) am mächtigsten; außerdem enthält es im Verglich mit anderen Arten die meisten Neuronen! Der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich von der biologischen Evolution emanzipiert hat: 1) Gebrauch von Werkzeugen etc. => Anpassung der Umwelt an die eigenen Bedürfnisse 2) Kulturelle Evolution: Weitergabe erworbener Verhaltensweisen durch sprachliche Kommunikation 3) Genmanipulation 1.3. Das Problem des Bewusstseins Menschen haben ein Bewusstsein von sich selbst und der Umwelt; Tiere verfügen nur zum Teil und äußerst bedingt über ein solches Bewusstsein. Für Bewusstseinszustände bei Tieren sprechen: flexible Verhaltensanpassung an neue Situationen (auch bei Primaten finden sich höhere kognitive Leistungen wie z.B. Einsichtslernen; Vgl.: KÖHLER und der Affe „Sultan“) physiologische Bewusstseinskorrelate (Bewusstseinsphänomene beruhen auf neuronalen - v.a. cortikalen - Aktivierungen) Kommunikation zwischen Tieren Leib-Seele-Problematik: Bezüglich des Verhältnisses zwischen Körper und Geist (=Bewusstsein) lassen sich 3 philosophische Positionen unterscheiden: 1) Idealistischer Monismus (Solipsismus): Die Welt ist lediglich eine Erscheinung des Geistes; es gibt also keine materielle, sondern lediglich eine mentale Wirklichkeit. Problem: Die Behauptung, es gebe keine objektive Wirklichkeit, ist zwar nicht zu widerlegen, aber nur wenig plausibel! 2) Materialistischer Monismus: Es gibt nur die physikalisch determinierte Wirklichkeit; der Geist ist lediglich ein Epiphänomen physiologischer (materieller) Vorgänge. Problem: Leugnung eines freien Willens BENJAMIN LIBET (1985): Zum freien Willen Vpn sollten sich genau merken, wann sie sich dazu entscheiden, ihren rechten Zeigefinger zu krümmen. Parallel dazu wurden das motorische Bereitschaftspotenzial und die Muskelaktivität an dem betreffenden Finger (EMG) gemessen. Ergebnis: Das Bereitschaftspotenzial trat schon ca. 300 ms vor dem subjektiven „Willenserlebnis“ auf. Interpretation: Nicht der subjektiv empfundene Wille, sondern physiologische Prozesse (neuronale Bereitschaftspotenziale) sind die Ursache für unser Handeln! 3) Dualismus (Parallelismus): Materie und Geist existieren parallel zueinander und stellen jeweils eigenständige Wirklichkeitsbereiche dar. Problem: Wie hängen Geist und Materie zusammen; wie können sie interagieren? 3 Die Frage, welche Funktion das Bewusstsein für das Verhalten hat, kann nicht abschließend geklärt werden. Dissoziation von Bewusstsein und Verhalten: Die bewusste Wahrnehmung eines Reizes ist nicht notwendig, um angemessen auf diesen reagieren zu können (Vgl.: Kap. 4, 6, 7 und 8). Das Bewusstsein entsteht in der Evolution erst verhältnismäßig spät => Primat des Verhaltens 4 2. Elementare Strukturen des Verhaltens 2.1. Verhaltenskoordinationen 2.1.0. Schematischer Ablauf: Bedürfnis (Appetenz) Appetenzverhalten Schlüsselreize Verhaltensbereitschaft Endhandlung Effekte Sensorische Rückkopplung S-V-E-Tripel: Die evolutionäre Erfahrung umfasst Wissen darüber, in welchen Situationen (S) welche Verhaltensweisen (V) zu welchen Effekten (E) führen. 2.1.1. Bedürfnis: Bedürfnisse (z.B. nach Nahrung oder Paarung) bilden die primäre Voraussetzung für Verhalten. Schlüsselreize sind weder notwendig (s.u.: Leerlaufund Übersprungshandlungen) noch hinreichend (bei fehlenden Bedürfnissen), um ein bestimmtes Verhalten auszulösen. Dementsprechend kann Verhalten nicht als bloße Reiz-ReaktionsVerbindung (Behaviorismus) beschrieben werden. Fazit: Tiere (und Menschen) reagieren nicht auf Reizsituationen, sondern agieren, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Zu unterscheiden ist zwischen vorübergehenden (transienten) und ständigen Bedürfnissen bzw. Handlungsbereitschaften. Transiente Bedürfnisse: z.B. Hunger, Paarungsbereitschaft etc. Ständige Bereitschaften: z.B. Explorationsbedürfnis, Orientierungsreaktion (reflexartige Hinwendung zu plötzlich und unerwartet auftretenden Reizen) Bedürfnisse hängen von endogenen und exogenen Faktoren ab: Endogene Faktoren: Hormonspiegel, endogene Rhythmen (z.B. Spermavorrat oder zirkadianer Rhythmus) etc. Exogene Faktoren: Temperatur, Tageszeit, Jahreszeit etc. Bedürfnisse lösen eine entsprechende Handlungsbereitschaft aus. 2.1.2. Verhaltens- bzw. Handlungsbereitschaft: Handlungsbereitschaften können durch Bedürfnisse oder Reizung des zentralen Nervensystems ausgelöst werden. Im Gehirn gibt es spezifische Motivationszentren (z.B. Hungerzentrum), durch deren Reizung entsprechendes Verhalten ausgelöst werden kann. Gleichzeitig aktivierte Handlungsbereitschaften hemmen sich gegenseitig, wobei sich die jeweils stärkste Handlungsbereitschaft gegenüber den anderen durchsetzt. Z.B. ist die Fluchtbereitschaft bei brütenden Vögeln häufig stark vermindert. Bei Konflikten zwischen gleich starken Handlungsbereitschaften kommt es zu Übersprungshandlungen. Der Austernfischer z.B. fängt bei Gefahr scheinbar an zu „schlafen“. 5 2.1.3. Schlüsselreize und Appetenzverhalten: Damit eine Verhaltensweise, für die eine Bereitschaft besteht, tatsächlich ausgeführt wird, müssen entsprechende Schlüsselreize vorhanden sein. Schlüsselreize signalisieren, dass die entsprechende Verhaltenskoordination in der gegebenen Situation adäquat ist. Z.B.: Der rote Unterschnabelfleck bei Silbermöwen löst bei Jungtieren Bettelverhalten aus. Attrappenversuche zeigen, dass Schlüsselreize meist angeboren sind, durch Erfahrung aber modifiziert werden können (s.u.). Sind keine Schlüsselreize vorhanden, wird nach ihnen gesucht (Appetenzverhalten); die Suche nach Schlüsselreizen ist durch hohe Flexibilität gekennzeichnet. Sind Schlüsselreize vorhanden, wird das Verhalten in starrer und stereotyper Form ausgeführt (Angeborene Auslösemechanismen = AAM). Die Wirksamkeit der Schlüsselreize hängt von der Stärke des Bedürfnisses ab: Bei entsprechend hoher Appetenz kann das Verhalten auch durch ähnliche Reize – oder sogar ohne entsprechenden Schlüsselreiz (Leerlaufhandlung) ausgelöst werden. 2.1.4. Konsumatorische Endhandlung und sensorische Rückkopplung Führt die konsumatorische Endhandlung (z.B. Fressen oder Begattung) zum gewünschten Effekt wird das ursprüngliche Bedürfnis durch sensorische Rückkopplung abgebaut. Der Schmeißfliege wird z.B. durch Dehnungsrezeptoren angezeigt, dass sie genug getrunken hat. Trennt man diese Rezeptoren vom Gehirn ab, trinkt die Fliege solange bis sie platzt. Ergo: Nicht die Endhandlung selbst, sondern deren sensorischen Effekte beenden die Verhaltenskoordination. 2.2. Verhaltenskoordinationen sind teils angeboren, teils erworben Angeborene Verhaltenskoordinationen (Erbkoordinationen) liegen dann vor, wenn sie ohne entsprechende Lernerfahrungen voll funktionsfähig sind (Vgl.: sog. „KasparHauser-Versuche“). Z.B. können Entenküken schon bei ihrem ersten Kontakt mit Wasser schwimmen. Durch Lernerfahrungen werden vorgegebene Verhaltenskoordinationen modifiziert: 1) Differenzierung der verhaltensrelevanten Schlüsselreize durch klassisches Konditionieren: Tiere lernen, Erbkoordinationen an neuen Reizbedingungen auszurichten. 2) Erhöhung der Effektivität des Appetenzverhaltens durch operantes Konditionieren: Tiere lernen neue Verhaltensweisen, um Bedingungen zu finden bzw. herzustellen, die die Ausführung effektiver Endhandlungen ermöglichen. Artspezifische Lerndispositionen: Die Lernfähigkeit einer Art ist das Ergebnis evolutionärer Anpassung. Tiere lernen nur das gut, was sie in ihrer Lebenswelt brauchen (erhöhte Sensibilität gegenüber ökologisch bedeutsamen Infos). D.h., sie sind genetisch zu bestimmten Lernleistungen disponiert (prepared), zu anderen nicht! Ratten und Mäuse, die in Gangsystemen leben, sind z.B. dazu disponiert, Labyrinthe zu lernen. 6 3. Tierisches Lernen 3.0. Einleitung Im Folgenden wird unter „Lernen“ die Anpassung nicht-sprachbezogenen Verhaltens an Umweltgegebenheiten in Folge individueller Informationsverarbeitung verstanden (KLIX). Es geht also um assoziatives Lernen im Sinne der klassischen und operanten Konditionierung. Weitere Lernformen, die in späteren Kapiteln behandelt werden, sind das Modelllernen, das Einsichtslernen und der Wissenserwerb. Insofern Lernprozesse per definitionem auf Erfahrung beruhen, fallen Veränderungen, die auf Reifung oder vorübergehende organismische Zustände (Ermüdung, Drogen, Verletzung etc.) zurückzuführen sind, nicht unter den Lernbegriff. Lernen = Erwerb von Erfahrungen; Gedächtnis = Bewahrung von Erfahrungen Insofern jedes Verhalten (V) in einer bestimmten Situation (S) stattfindet und der Herbeiführung bestimmter Effekte (E) bzw. der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse dient, können die verhaltenssteuernden Strukturen als S-V-E-Tripel beschrieben werden: Sie enthalten „Wissen“ darüber, was (V) zur Befriedigung welcher Bedürfnisse (E) unter welchen Bedingungen (S) zu tun ist. Im Rahmen eines solchen Modells (S-V-E-Tripel) sind 2 Arten von Veränderungen bzw. Lernprozessen möglich (s.o.): 1) Einbeziehung neuer Reizbedingungen in die Verhaltenssteuerung (bedingte Reflexe durch klassisches Konditionieren) 2) Effektivierung des Appetenzverhaltens zur Suche bzw. Herstellung von Situationsbedingungen, die eine Bedürfnisbefriedigung erlauben (durch instrumentelles Bedingen bzw. operante Konditionierung) Anforderungen an eine Lerntheorie: 1) Angaben über die Strukturen zur Auswahl, Initiierung und Ausführung des Verhaltens 2) Angaben über mögliche Veränderungen in diesen Strukturen 3) Angaben darüber, durch welche Umweltinformationen (Erfahrungen/ Erlebnisse) das Verhalten bzw. die zugrunde liegenden Strukturen wie verändert werden. 4) Bereitstellung von Bewertungskriterien für die Verhaltensänderungen (Richtung des Lernens) 3.1. Der behavioristische Ansatz Der klassische Behaviorismus betrachtet den Organismus als „Black-Box“. Aus methodischen Gründen wird menschliches Verhalten und Lernen bewusst auf die beobachtbaren Variablen „Reiz“ und „Reaktion“ reduziert; auf introspektive Daten bzw. Spekulationen über innere Prozesse wird vollständig verzichtet. Daher die These: Jedes Verhalten ist durch die gegebenen Reizbedingungen determiniert (S-RPsychologie) Bekannte Vertreter sind: Pawlow, Watson, Thorndike, Skinner 7 3.1.1. Die klassische Konditionierung: Erweiterung der Auslösebedingungen Das klassische Konditionieren geht auf PAWLOW zurück. Berühmtestes Beispiel: der „Pawlowsche Hund“ Dadurch, dass die Futtervergabe wiederholt mit dem Erklingen eines bestimmten Tons einherging, „lernte“ der Hund, bereits beim Hören des Tons Speichel abzusondern. Beim klassischen Konditionieren wird also ein neuer bzw. „bedingter“ Reiz (CS), der ursprünglich lediglich zu einer Orientierungsreaktion (Aufmerksamkeit) führt, als Auslöser für eine biologisch vorgegebene Verhaltensweise (UCV =unbedingter Reflex) gelernt! Man spricht deshalb auch von Reiz-Reaktions- bzw. S-R-Lernen. Ein unbedingter Reiz (UCS; z.B. Nahrung) führt zu einer unbedingten Reaktion (UCV; z.B. Speichelsekretion). Im Rahmen der Konditionierung wird der unbedingte Reiz an einen neutralen Reiz (z.B. Licht oder Ton) gekoppelt. Wichtig ist dabei a) die zeitliche- und räumliche Nähe des bedingten und unbedingten Reizes (Kontiguität) sowie b) die Wiederholung dieser Reizkombination. Ist beides gegeben, wird nach der behavioristischen Theorie der neutrale Reiz mit dem unbedingten Verhalten (UCV) assoziiert (deshalb auch: assoziatives Lernen)! Dadurch entsteht eine neue Reiz-Reaktions-Beziehung: Der ursprünglich neutrale Reiz (z.B. Licht, Ton) wird zu einem bedingten Reiz (CS), der allein ausreicht, um die jew. Reaktion (nun eine bedingte Reaktion) hervorzurufen. Extinktion: Konditionierte Reaktionen können gelöscht werden, indem der bedingte Reiz mehrfach ohne den unbedingten dargeboten wird (Aufhebung der Kontiguität). Das Prinzip des Extinktion wird z.B. zur Angsttherapie eingesetzt. Beispiele: unbedingte Reflexe können autonom (z.B. Speicheln) oder willkürlich sein (z.B. Picken); verwendet werden meistens appetititive Reflexe (z.B.: Futter => Fressverhalten; Flüssigkeit => Trinkverhalten) oder aversive Reflexe (z.B.: Elektroschock oder Luftstrom => Blinkreflex / Fluchtverhalten etc.); die zu konditionierenden Reize sind Reize, die eine Orientierungsreaktion hervorrufen (meist Licht- oder Tonreize). Alternativerklärung (s.u.): Es wird nicht der bedingte Reiz mit der unbedingten Reaktion assoziiert (CS-UCV), sondern der bedingte Reiz mit dem unbedingten Reiz (CS-UCS); ersterer dient als Signal für letzteren, der bedingte Reiz führt also zur Erwartung des unbedingten Reizes; demnach ist nicht die Kontiguität (raum-zeitliche Nähe der Reize), sondern die Kontingenz entscheidend. 3.1.2. Die operante Konditionierung: Erweiterung des Verhaltensrepertoires Beim operanten bzw. instrumentellen Konditionieren wird ein neues Verhalten als Instrument zur Befriedigung von Bedürfnissen erworben. Das Grundprinzip operanten Verhaltens formuliert THORNDIKE in seinem Gesetz der Auswirkung („Law of effect“): Das Gesetz besagt, dass Verhaltensweisen, die angenehme Konsequenzen haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit wiederholt werden, während Verhaltensweisen mit negativen Folgen eher nicht wiederholt werden. Trotzdem geht der klassische Behaviorismus davon aus, dass Verhalten ausschließlich durch Reize ausgelöst wird. Nach traditioneller Auffassung ist der Effekt des Verhaltens auch beim operanten Konditionieren sekundär. Durch ihn wird nach THORNDIKE lediglich die Assoziation zwischen Situation bzw. Stimulus und Reaktion verstärkt. 8 SKINNER unterscheidet zwischen respondentem- und operantem Verhalten. Wie und warum operantes Verhalten ausgelöst wird, lässt Skinner offen; er beschränkt sich auf die Feststellung, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit von Verhalten von dessen Konsequenzen abhängt. B.F. SKINNER: Die „Skinner-Box“ Mit Hilfe dieses Prinzips konditionierte SKINNER z.B. Ratten und Tauben darauf, einen Mechanismus (Hebel, Knopf etc.) zu betätigen, um die Futterzufuhr (positive Verstärkung) zu regulieren- oder Stromschläge zu vermeiden (negative Verstärkung). THORNDIKE: Die „Vexier-Box“ Hungrige Katzen lernen durch Versuch und Irrtum, aus einem Käfig zu entkommen, um an Futter zu gelangen. Verstärkung: Verstärker sind nach SKINNER alle Konsequenzen, die die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens erhöhen. Zu unterscheiden ist dabei zwischen positiver und negativer Verstärkung. Positive Verstärkung: Darbietung eines angenehmen Reizes, Negative Verstärkung: Beseitigung eines unangenehmen (aversiven) Reizes Negative Verstärkung ist demnach nicht mit Bestrafung gleichzusetzen! Bestrafung: Bestrafung umfasst alle Konsequenzen, die zur Unterdrückung eines Verhaltens führen. Auch hier sind 2 Formen zu unterscheiden. Bestrafung I: Hinzufügung eines aversiven Reizes (negativer Verstärker) Bestrafung II: Beseitigung eines angenehmen Reizes (positiver Verstärker) Verstärkungspläne: Zu unterscheiden ist zwischen kontinuierlichen und intermittierenden, sowie fixen und variablen Verstärkungsplänen. 1. Bei kontinuierlicher Verstärkung wird ein Verhalten immer verstärkt. Beschleunigt den Verhaltensaufbau, daher zu Beginn einer Lernphase zu empfehlen. 2. Bei der intermittierenden bzw. gelegentlichen Verstärkung wird ein Verhalten nicht immer, sondern nur in bestimmten Abständen verstärkt. Führt zu hoher Löschungsresistenz; zu empfehlen, wenn das gewünschte Verhalten bereits aufgebaut ist („Fading-out“). 2.1. Quotenverstärkung: Verstärkung erfolgt nach Quoten, z.B. jede 10.Reaktion (fix) oder 20% der Reaktionen (variabel). 2.2. Intervallverstärkung: Verstärkung erfolgt in zeitlichen Abständen, z.B. alle 5 Minuten (fix) oder im Mittel alle 5 Minuten (variabel). Variable Verstärkungspläne => gleichmäßiges Verhalten Fixierte Verstärkungspläne => stark wechselnde Verhaltenshäufigkeiten 3.1.3. Diskriminationslernen: Situationsabhängige Verhaltensdifferenzierung Beim Diskriminationslernen wird ein bestimmtes Verhalten in Abhängigkeit von Merkmalen der Situation verstärkt bzw. nicht verstärkt (Kontrastmethode). Es handelt sich also um eine Form der operanten Konditionierung; bei der nicht nur die Verstärkungs-, sondern auch die Situationsbedingungen systematisch variiert werden. 9 Vier wichtige Befunde zum Diskriminationslernen bei Tieren: 1) Tiere sind zur Unterscheidung einfacher Merkmale in der Lage und zeigen situationsabhängiges Verhalten. HANSON (1959): Rotes vs. grünes Licht Leuchtet eine Reaktionstaste grün auf, werden Tauben für deren Betätigung mit Körnern belohnt; leuchtet sie dagegen rot auf, führt das Picken auf die Taste zu keiner Futterzufuhr. Ergebnis: Die „Pickrate“ passt sich der Beleuchtung der Taste (Wellenlänge des Lichts) an; leuchtet die Reaktionstaste grün, picken die Tauben oft darauf, leuchtet sie dagegen rot, betätigen sie sie kaum. 2) Tiere sind zur Unterscheidung von Merkmalsverknüpfungen in der Lage (Remember: Schlüsselreize sind meist komplex). Bietet man 2 verhaltensrelevante Reize dar, gibt es 2 Möglichkeiten, diese miteinander zu kombinieren: Von positivem patterning spricht man, wenn eine Bekräftigung nur dann erfolgt, wenn sowohl CS1 als auch CS2 auftreten (Konjunktion; „Compoundreize“); negatives patterning liegt vor, wenn eine Bekräftigung lediglich dann erfolgt, wenn entweder der eine (CS1) oder der andere Reiz (CS2) alleine auftritt (Disjunktion). WOODBURY (1943): positives und negatives patterning Woodbury konditionierte Hunde durch Futter-Bekräftigung darauf, eine Sperre mit der Schnauze zu lösen. Dabei bot er im Training hohe und tiefe Töne unter positivem und negativen patterning dar. Ergebnis: Die Hunde passten ihr Verhalten dem patterning an. 3) Tiere scheinen zur Bildung von Kategorien in der Lage zu sein, insofern sie ihr Verhalten nicht nur von eindeutigen Reizen, sondern auch von abstrakten Situationsmerkmalen abhängig machen. HERRNSTEIN, LOVELAND et al. (1976): abstrakte Situationsmerkmale Tauben werden darauf konditioniert, bei Dias mit Bäumen zu picken. Ergebnis: Die Tauben generalisieren ihr „Wissen“ auf neue Bilder (Bilder von anderen Bäumen)! Sie erkennen offenbar die Gemeinsamkeiten zw. den versch. Bäumen und bilden eine entsprechende Kategorie! 4) Tiere sind dazu in der Lage, situationsabhängig zwischen verschiedenen Verhaltensalternativen zu wählen. PORTER & NEURINGER (1984): Bach und Strawinski Bei Bach wird Taste A, bei Strawinski Taste B belohnt. Ergebnis: Obwohl jeweils verschiedene Musikausschnitte der beiden Komponisten verwendet werden, lernen die Tauben, bei Bach auf die eine- und bei Strawinski auf die andere Taste zu picken. Fazit: Die Ergebnisse zum Diskriminationslernen scheinen die Annahmen des klassischen Behaviorismus zu bestätigen: Bekräftigtes Verhalten wird jeweils an die Situation gebunden, in der es bekräftigt wurde. Verhaltensauslösend und –bestimmend scheinen also Merkmale der Situation (Reize) - und nicht die Ziele des Organismus (E) zu sein. Nach heutiger bzw. Hoffmannscher Auffassung ist es jedoch umgekehrt: Verhalten (insbesondere menschliches Verhalten) wird nicht durch Reize, sondern durch Ziele determiniert (s.u.)! 10 3.2. Kritik am Behaviorismus Die 3 Hauptkritikpunkte am Behaviorismus: 1) Es sprechen zahlreiche Befunde dafür, dass beim Konditionieren weniger CSCR- bzw. S-V-Assoziationen-, sondern vielmehr CS-UCS- bzw. V-EAssoziationen aufgebaut werden. Es scheint so zu sein, dass nicht die verwendeten Reize, sondern die Erwartung des UCS bzw. des Effektes das konditionierte Verhalten auslösen. 2) Nicht die Kontiguität (zeitliche und räumliche Nähe) der Reize, sondern die Kontingenz (Vorhersagbarkeit der Effekte) ist entscheidend. Lernen als die Ausbildung verhaltensleitender Erwartungen und nicht als Automatisierung von Reaktionen! 3) Latentes Lernen: Auch ohne Verstärkung finden Lernprozesse statt! 3.2.1. Werden beim Konditionieren S-R- oder V-E- Assoziationen aufgebaut? Der klassische Behaviorismus vertritt die These, dass die Effekte des eigenen Verhaltens dieses nur indirekt beeinflussen. Verhaltensauslösend ist primär die Situation bzw. die in ihr auftretenden Reize (s.o.). Kurz: Verhalten wird durch S-V- bzw. S-R-Beziehungen determiniert! A) Klassisches Konditionieren Klassisch konditioniertes Verhalten beruht primär auf einer durch den bedingten Reiz (CS) ausgelösten Erwartung des unbedingten Reizes (UCS) – und nicht wie vom klassischen Behaviorismus behauptet auf einer Assoziation des bedingten Reizes (CS) mit dem konditionierten Verhalten (CV)! 4 Argumente dafür, dass nicht die konditionierten Reize selbst, sondern die durch sie ausgelösten Erwartungen das Verhalten auslösen bzw. bedingen: 1) Der Devaluierungseffekt: Bei der Devaluierungstechnik wird der während der operanten oder klassischen Konditionierung verwendete Verstärker bzw. unbedingte Reiz (UCS) nachträglich entwertet; z.B. indem plötzlich schlechteres Futter verwendet wird. Wäre das konditionierte Verhalten (CV) primär von dem bedingten Reiz (CS) bzw. der Situation (S) abhängig und nicht von dem zu erwartenden Effekt, dürfte dessen Devaluierung das Verhalten kaum beeinflussen. Experimente zeigen jedoch, dass die Devaluierung des UCS bzw. Verstärkers (z.B. Futterkugeln) zu einer erheblichen Reduktion des konditionierten Verhaltens führt. Beachte: Trotz Devaluierung kommt es zu keiner vollständigen Unterdrückung des zuvor konditionierten Verhaltens. Interpretation: Entscheidend sind zwar die Effekterwartungen; parallel dazu bilden sich beim Konditionieren jedoch auch situationsgebundene Verhaltensgewohnheiten (S-V) heraus. HOLLAND & STRAUB (1979): Devaluierung des unbedingten Reizes 1. Phase: Ton-Futter-Konditionierung (auf Ton folgt Futter => Ratten bewegen sich beim Erklingen des Tons zur Futterbox); 2. Phase: In der Experimentalgruppe wird das Futter durch eine Übelkeit erzeugende Injektion devaluiert; 3. Phase: Darbietung des Tons ohne Futter => Lediglich in der Experimentalgruppe ist die Auftretensrate des konditionierten Verhaltens (hin zur Futterbox) reduziert. Interpretation: Konditioniert wurde nicht der Zusammenhang bei einem Ton zur Futterbox zu laufen (CS => CV), sondern die Erwartung: bei Ton gibt’s Futterkugeln (CS => UCS)! Durch die Devaluierung des Futters werden die Erwartung und damit das Verhalten modifiziert. Das Verhalten wird also nicht durch den Ton (CS), sondern die Erwartung des Futters (UCS) determiniert! 11 2) Sensory preconditioning (s.u.) 3) Klassische Konditionierung gelingt dann am besten, wenn der bedingte bzw. neutrale Reiz (CS) immer kurz vor dem unbedingten Reiz (UCS) dargeboten wird. Interpretation: der bedingte Reiz (CS) hat Signalwirkung; er dient der Ankündigung des unbedingten Reizes (UCS). Ergo: Entscheidend ist die Kontingenz (Vorhersagbarkeit des unbedingten Reizes!); wäre die Kontiguität (räumliche und zeitliche Nähe) ausschlaggebend, wäre es egal, ob der bedingte Reiz vor oder nach dem unbedingten Reiz dargeboten wird! 4) Konditionierung zweiter Ordnung Auch durch die mehrfache Kopplung mit einem bedingten Reiz (Ton) kann ein neutraler Reiz (Licht) konditioniert werden und die entsprechende Reaktion (z.B. Picken) auslösen. Und das, obwohl das Licht nie mit dem unbedingten Reiz (z.B. Körner) selbst gekoppelt wurde! B) Operantes Konditionieren Auch instrumentellem Verhalten liegen primär Verhaltens-Effekt-Erwartungen zugrunde; Stimulus-Response-Assoziationen sind dagegen sekundär. Argumente: 1) Tiere reagieren auf veränderte Verstärker mit Überraschung! TINKELPAUGH (1928): Banane => Salatblatt Nachdem eine Äffin gelernt hatte, in einem Futterbehälter eine Banane zu finden, wurde die Banane durch ein Salatblatt vertauscht! Die Äffin reagiert mit Überraschung und suchte die Banane. Ergo: Durch die Futterbox (S) wurde nicht (nur) das Öffnen dieser (V) getriggert, sondern auch eine Erwartung bezüglich des Effektes dieser Handlung (E). 2) Eine Veränderung bzw. Variation der Verstärker (E) führt zu einer Veränderung des Verhaltens (V)! Siehe oben: Devaluierungseffekt! ELLIOT (1928): Devaluierung Ratten lernen den Weg durch ein Labyrinth, um zu einer Futterbox zu gelangen. Die Kontrollgruppe erhält von Anfang an weniger gutes Futter als die Experimentalgruppe; ab dem 10. Durchgang erhält die Experimentalgruppe das gleiche (minderwertige) Futter wie die KG, woraufhin sich die Leistungen in der EG verschlechtern. Durch eine Veränderung der Erwartung verändert sich das Verhalten! COLWILL & RESCORLA (1985): Zwei verschiedene Verhaltensweisen (Drücken einer Taste vs. Zerren an einer Kette) werden jeweils mit verschiedenen Effekten (Zuckerlösung vs. Futterkugeln) bekräftigt. Nach der Lernphase wird einer der beiden Verstärker (z.B. die Futterkugeln) durch die Injektion milden Giftes entwertet. In der anschließenden Testphase (ohne Verstärker) wird die Verhaltensweise unterlassen (Zerren), deren Verstärker (Futterkugeln) zuvor entwertet wurde. 2 Schlussfolgerungen: 1) Die Versuchstiere haben offensichtlich eine verhaltensspezifische Erwartung bezüglich des Verstärkers bzw. Effektes ausgebildet. 2) Die Erwartung bzw. Repräsentation des Effektes hat Einfluss auf die Verhaltensauswahl! 12 C) Diskriminationslernen Diskriminationslernen entspricht nicht der Ausbildung von Reiz-ReaktionsAssoziationen, vielmehr handelt es sich dabei um die situative Modifikation von verhaltenssteuernden Effekterwartungen! Argumente für die Ausbildung von Verhaltens-Effekt-Erwartungen beim Diskriminationslernen: 1) Differential outcome effect Diskrimnationslernen wird durch die Verwendung unterschiedlicher Verstärker verbessert! Ergo: Nicht nur die jeweiligen Verhaltensweisen werden mit der Situation in Verbindung gebracht, sondern auch deren Effekte! TRAPOLD (1970): „differential outcome effect“ Bei Ton wird Taste 1 und bei Clickergeräusch Taste 2 bekräftigt. Ergebnis: Ratten lernen die reizabhängige Tastenwahl schneller, wenn die Tasten zu unterschiedlichen Bekräftigungen führen, z.B. Taste 1 zu Futterkugeln und Taste 2 zu Zuckerwasser! 2) Occasion setting Reize werden nicht als Signale für ein bestimmtes Verhalten, sondern für die Herstellbarkeit von bestimmten Effekten gelernt; sie fungieren als „occasion setter“. Das Verhalten wird somit nur indirekt durch die Situation bzw. bestimmte Reize getriggert, wichtiger ist die Antizipation der Effekte! Lediglich die Erwartung, welcher Effekt durch welches Verhalten ausgelöst werden kann, hängt unmittelbar von der Situation ab, nicht das Verhalten selbst! COLWILL & RESCORLA (1988): „occasion setting“ 1. Lernphase: Versuchstiere lernen, dass dasselbe Verhalten („nose poke“) in Abhängigkeit von der Situation zu unterschiedlichen Effekten führt: Bei Licht zu Futterkugeln; bei Lärm zu Zuckerlösung; Licht nose poke Futterkugeln Lärm nose poke Zuckerlösung In einer 2. Lernphase werden die Tiere darauf konditioniert, dass das Zerren an einer Kette zu Futterkugeln und das Drücken einer Taste zu Zuckerlösung führt – ohne dass dabei die Situationsbedingungen variiert werden (kein Lärm / kein Licht). Zerren Futterkugeln Taste Zuckerlösung In einer Testphase (ohne Bekräftigungen) zeigt sich, dass die Tiere bei Licht vermehrt an der Kette zerren, bei Lärm dagegen bevorzugt die Taste drücken. Licht Zerren Lärm Taste Interpretation (s.o.): der Reiz Licht generiert die Erwartung von Futterkugeln; bei Lärm dagegen erwarten die Tiere Zuckerlösung (1. Lernphase) => das Verhalten richtet sich nach dem erwarteten Effekt (2. Lernphase) und nicht nach der Situation (ansonsten müssten die Tiere sowohl bei Licht als auch bei Lärm „nose poke“ zeigen) 13 3) Nicht Verhalten wird situationsabhängig repräsentiert, sondern VerhaltensEffekt-Beziehungen: S(V-E) COLWILL & RESCORLA (1990): S-(V-E) Lernphase: bei Licht wird das Zerren an einer Kette mit Futterkugeln verstärkt-; das Drücken einer Taste mit Zuckerlösung; bei Lärm ist es umgekehrt. Licht Lärm Zerren Futterkugeln Taste Zuckerlösung Zerren Zuckerlösung Taste Futterkugeln In einer 2. Phase werden die Futterkugeln entwertet. In der Testphase (ohne Verstärkungen) können sich die Ratten zwischen den beiden Verhaltensalternativen (Zerren vs. Tasten) entscheiden, wobei entweder Licht oder Lärm dargeboten wird. Ergebnis: Bei Licht erwarten die Ratten offenbar, dass Zerren zu den entwerteten Futterkugeln führt: sie bevorzugen das Drücken der Taste; bei Lärm ist es umgekehrt. Interpretation: Diskriminationslernen beruht auf hierarchischen S-(VE)-Beziehungen. In einem 1. Schritt werden Verhaltens-EffektErwartungen (z.B. Taste-Futter) gebildet; in einem 2. Schritt werden diese V-E-Erwartungen als Einheiten an die Situationsbedingungen geknüpft. Fazit: Umgebungs- und verhaltensabhängige Erwartungen und nicht S-V-Beziehungen determinieren tierisches Verhalten! 3.2.2. Ist die Kontiguität oder die Kontingenz entscheidend für das Lernen? Nach behavioristischer Auffassung ist die Kontiguität (zeitliche und räumliche Nähe) von CS und UCS (klassisches Konditionieren) bzw. von S-V und Bekräftigung (operantes Konditionieren) entscheidend für das Lernen! Versteht man Lernen allerdings als die Ausbildung von verhaltensleitenden Erwartungen (s.o.) sollte die Kontingenz (Vorhersagbarkeit des UCS bzw. der Verstärkung) entscheidend sein! Die Kontiguität entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass bedingter und unbedingter Reiz gemeinsam auftreten: p (UCS&CS); die Kontingenz entspricht der Wahrscheinlichkeit, dass der unbedingte Reiz nur mit dem bedingtem Reiz und nicht ohne diesen auftritt: p (UCS/CS) – p (UCS/¬CS). Ton ¬ Ton Schock 5 0 5 ¬Schock 5 10 15 10 10 20 Ton ¬ Ton Schock 5 5 10 ¬Schock 5 5 10 10 10 20 Kontiguität: p (UCS&CS) = 5/20 = 0,25 p (UCS&CS) = 5/20 = 0,25 Kontingenz: p (UCS/CS) – p (UCS/¬CS) 5/10 – 0/10 = 0,5 p (UCS/CS) – p (UCS/¬CS) 5/10 - 5/10 = 0,0 14 Fazit: Bei konstanter Kontiguität hängt die Kontingenz von der Basisrate des UCS bzw. der Bekräftigung ab: Je geringer die Basisrate [p(UCS/¬CS)], desto höher die Kontingenz! Empirische Befunde, die für die Kontingenz sprechen: RESCORLA (1968): Kontingenz bei klassischer Konditionierung Rescorla untersuchte die Auftretensrate eines bedingten Reflexes (Vermeidungsreflex) in Abhängigkeit von der Kontingenz! Zu diesem Zweck wurde die Kontiguität konstant gehalten, die Kontingenz dagegen variiert: Ein Schock (UCS) wurde entweder nur mit oder auch ohne Ton (CS) dargeboten. Ergebnis: Je höher die Kontingenz bzw. die Differenz p (Schock, wenn Ton) – p (Schock, wenn kein Ton), desto stärker das Vermeidungsverhalten. Ergo: Die Kontingenz, d.h. die Vorhersagbarkeit des UCS aus dem CS, ist entscheidend für das klassische Konditionieren! HAMMOND (1980): Kontingenz bei operanter Konditionierung Durstige Ratten werden für das Drücken einer Taste mit Wasser belohnt. Erfolgt der Tastendruck, ist die Wahrscheinlichkeit für die Bekräftigung (und damit die Kontiguität) konstant: p (+/R) = 0,12. Die Wahrscheinlichkeit, eine Bekräftigung zu erhalten, wenn die Taste nicht gedrückt wurde, wird variiert: p (+/¬R) = 0,0; 0,8 oder 0, 12 Ergebnis: Bei p (+/¬R) = 0,0 - was einer Kontingenz von 0,12 entspricht ist die Reaktionsrate am höchsten; bei p (+/¬R) = 0,12, was einer Kontingenz von 0 entspricht – ist die Reaktionsrate am niedrigsten. Ergo: Die Kontingenz ist entscheidend für instrumentelles Verhalten! Beachte: In beiden Experimenten wurde mit geringer Kontiguität gearbeitet. Was bei hoher Kontiguität und niedriger Kontingenz passiert, ist eine offene Frage. Z.B.: Bei p (UCS/CS) = 1,0 und p (UCS/¬CS) = 0,8 ergibt sich eine Kontiguität von 1,0 und eine Kontingenz von 0,2! Das Rescorla-Wagner-Modell beschreibt die Abhängigkeit des Lernens von der Kontingenz mit folgender Formel: ΔVCSj = α β (λ – ΣVj) ΔVCSj = Veränderung der Konditionierungsstärke zwischen UCS und CS bzw. Lernzuwachs pro trial (entspricht der Reaktionsrate) α = Merkmale/Konditionierbarkeit des bedingten Reizes (z.B. Auffälligkeit) β = Merkmale des unbedingten Reizes (z.B. Intensität des UCS) λ = Maß für die Kontingenz; λ = 0, wenn UCS bzw. Bekräftigung nie auf CS bzw. V folgt & λ = λmax., wenn UCS bzw. Bekräftigung immer auf CS folgt. ΣVj = Summe der bereits konditionierten CS-UCS-Assoziationen, d.h. wie gut sagen die bereits gelernten Reize (z.B. Käfig etc.) den UCS bzw. die Bekräftigung vorher?! Entspricht den von dem zu konditionierenden Reiz (CSj) unabhängigen Erwartungen. Die Annahmen des Rescorla-Wagner-Modells: 1) Die Assoziations- bzw. Konditionierungsstärke (= Lernzuwachs) verändert sich inkrementell (stückweise) mit jeder Erfahrung bzw. jedem trial. 2) Es gibt eine maximale Assoziationsstärke (bedingt durch λmax. und die Merkmale des UCS). 3) Der inkrementelle Lernzuwachs (ΔVCSj) hängt proportional von der Differenz zwischen Lambda und SVj (λ – ΣVj) ab (Insofern erfordert Lernen „mentale Arbeit“). 15 Wenn Lambda > SVj Lernen findet statt (Verhaltensrate steigt) Wenn Lambda = SVj Lernen findet nicht statt Wenn Lambda < SVj Extinktion findet statt (Verhaltensrate sinkt) Die inhaltliche Kernaussage des R-W-Modells: “Organisms only learn if events violate their expectations!” Erwartungen werden also explizit als Voraussetzung für Lernprozesse anerkannt. Allerdings werden Erwartungen ausschließlich als reizdeterminiertes Phänomen angesehen; dem Modell nach entsprechen sie der Summe der Assoziationsstärken aller aktuell gegebenen Reize (ΣVj), zu denen die zu konditionierenden Reize (CVj) in Konkurrenz stehen. Das R-W-Modell ist ursprünglich zur Erklärung bedingter Reflexe (klassisches Konditionieren) entworfen worden, kann aber auch auf operantes Konditionieren angewendet werden. ΔV bezieht sich dann auf die Assoziationsstärke zwischen S und V oder zwischen V und E! Phänomene, die durch das Rescorla-Wagner-Modell erklärt werden können: Kontingenz: Die Abhängigkeit des Lernens von der Kontingenz wird dadurch erklärt, dass CS (z.B. Licht) und Kontext (z.B. Käfig) als verschiedene Reize betrachtet werden. Je höher die Basisrate des UCS (bzw. je geringer die Kontingenz zw. CS und UCS), desto stärker wird der Kontext mit dem UCS assoziiert und der Aufbau von Assoziationen zum CS gehemmt (schließlich ist die maximale Assoziationsstärke nach oben hin begrenzt)! Blockierung: KAMIN (1969): Blockierung Experimentalgruppe: 1. Lernphase: Ton (CS1) + Schock (UCS) Vermeidung; 2. Lernphase: Ton (CS1) + Licht (CS2) + Schock (UCS) Vermeidung; Testphase: Nur Licht (CS2) kein Vermeidungsverhalten Die Kontrollgruppe, die zuvor nicht auf den Zusammenhang Ton => Schock konditioniert wurde (keine Lernphase 1), reagiert in der Testphase auch auf den Lichtreiz mit Vermeidungsverhalten. Interpretation: In der Experimentalgruppe ist die Assoziationsstärke zw. Ton und Schock in der 2. Lernphase bereits so hoch, dass die Versuchstiere über den Schock nicht mehr überrascht sind. Ergo: Der zweite bedingte Reiz (Licht) wird nicht gelernt; er erscheint den Tieren irrelevant! Negative Konditionierung bzw. Extinktion: Die Assoziationsstärke wird abgebaut, wenn die Erwartung (ΣVj) größer als die Kontingenz der Bekräftigung/des UCS (Lambda) ist und insofern enttäuscht wird. Phänomene, die das Rescorla-Wagner-Modell nicht erklären kann: Negatives patterning: Bei negativen patterning (s.o.) ist die Kontingenz der Bekräftigung gleich 0. Um mit dem R-W-Modells zu erklären, warum Tiere (s.o.: WOODBURY) die Zusammenhänge trotzdem lernen, bedarf es einer Zusatzannahme: Einzelreize (Licht = CS1; Ton = CS2) und Compoundreize (Licht + Ton = CS3) müssen als unabhängige Reize gelernt werden! Problem: exponentielles Anwachsen der möglichen Compounds (2ⁿ). 16 Aufmerksamkeit: Die Rolle der Aufmerksamkeit (Vgl. Kap. 4 und 8) bleibt im R-W-Modell unberücksichtigt. Reize können noch so auffällig sein (α), wenn sie nicht beachtet werden, kann auch nichts über sie gelernt werden. Wenn Tiere z.B. vor der Konditionierung einen Reiz (CS) wiederholt dargeboten bekommen, erfolgt keine Orientierungsreaktion mehr auf diesen; die Tiere habituieren auf den Reiz (latent inhibition); Beachte: die Habituation auf Reize ist kontextspezifisch! Preparedness: Das Konzept der Preparedness entspricht in etwa dem der Lerndispositionen (TINBERGEN). Es besagt, dass Tiere bestimmte Reize schneller bzw. leichter miteinander assoziieren als andere (z.B. Geschmack mit Übelkeit; Lärm/Licht dagegen mit Schmerz von außen). In diesem Sinne lässt sich zwischen „ökologischen“ und „unökologischen“ Prädiktoren unterscheiden. Darüber hinaus sind Tiere für das Erlernen von bestimmten Effekten für bestimmte Verhaltensakte disponiert bzw. „prepared“ (z.B. Flucht => Schmerzvermeidung). GARCIA & KOELLING (1966): …beim klassischen Konditionieren Lernphase: Durstige Ratten bekommen bei gleichzeitigem Licht/ClickerReiz Süßwasser zum trinken. Der einen Versuchsgruppe wird danach Übelkeit induziert, der anderen ein Elektroschock appliziert. Testphase: Den Tieren wird entweder nicht-süßes Wasser bei gleichzeitigem Licht/Clicker-Geräusch oder nur Süßwasser angeboten. Gruppe A (Übelkeit) trinkt unbekümmert nicht-süßes Wasser bei gleichzeitigem Licht/Clicker-Reiz; meidet aber Süßwasser (Assoziation: Geschmack => Übelkeit). Gruppe B (Elektroschock) dagegen meidet das nicht-süße Wasser bei Licht/Clicker (Assoziation: Licht/Clicker => Elektroschock), trinkt aber unbekümmert das Süßwasser ohne Licht/Clicker. BOLLES (1973): …beim operanten Konditionieren Ratten in einem Laufrad erhalten nach einem Ton entweder einen Schock, wenn sie nicht sofort wenden – oder wenn sie sich nicht sofort aufrichten. Die Tiere lernen zwar zu wenden, um den Schock zu vermeiden, nicht aber, sich aufzurichten (letzteres ist widernatürlich/unökologisch) 3.2.3. Latentes Lernen: Aufbau von Erwartungen ohne Bekräftigung Dem Behaviorismus zufolge wird jeder Lernprozess durch (externe) Bekräftigung initiiert. Beim klassischen Konditionieren erfolgt die Bekräftigung entspricht vor dem Verhalten und entspricht dem unbedingten Reiz (UCS)! Beim operanten Konditionieren erfolgt die Bekräftigung (Belohnung oder Bestrafung) nach dem Verhalten und entspricht dessen Effekt (E)! Befunde zeigen jedoch, dass Tiere auch ohne unmittelbare externe Bekräftigung Zusammenhänge lernen (Latentes Lernen). RIZLEY & RESCORLA (1972): Latentes S-S-Lernen; sensory preconditioning 1. Lernphase (Kopplung zweier neutraler Reize): Licht + Ton => allg. Aktivität 2. Lernphase: Ton + E-Schock => Vermeidungsreaktion Testphase: Licht (=> Erwartung des Tons => Erwartung des E-Schocks) => Vermeidungsreaktion In der 1. Lernphase wurde offenbar ohne jede Bekräftigung eine Assoziation zwischen Licht und Ton aufgebaut. 17 SEWARD (1949): Latentes V-E-Lernen (T-Labyrinth) Ein Teil der Ratten (Versuchsgruppe) bekommt die Möglichkeit, ein einfaches T-Labyrinth mit zwei unterscheidbaren Endboxen (rot und grün) zu explorieren. Nach der Explorationsphase wird eine der Boxen durch Futter aufgewertet (valuiert); die meisten Ratten der Versuchsgruppe finden den Weg zur betreffenden Box auf Anhieb; die Ratten der Kontrollgruppe (keine Explorationsphase) müssen ihn erst lernen! Ergo: Bereits in der Explorationsphase hat Lernen stattgefunden (zur roten Box geht’s nach rechts; zur grünen nach links); obwohl in dieser Phase keine Verstärker eingesetzt wurden! TOLMAN & HONZIG (1930): Latentes V-E-Lernen Ratten werden in ein Labyrinth gesetzt. Eine Kontrollgruppe wird ab dem ersten Durchgang für das Erreichen einer Zielbox mit Futter belohnt. Die Experimentalgruppe erhält erst ab dem 11. Durchgang Futter für das Erreichen der Zielbox. Ergebnis: Trotzdem verbessert sich die Versuchsgruppe von Durchgang zu Durchgang und ist ab dem 12. Durchgang sogar besser (macht weniger Fehler) als die Kontrollgruppe, die von Anfang an verstärkt wurde! Erklärung für latentes Lernen: Das Eintreten eines antizipierten Effektes wirkt als innere Bekräftigung! Es gibt also ein Bedürfnis nach Vorhersagbarkeit. Dieses Antizipationsbedürfnis bringt einen Fortpflanzungs- und Überlebensvorteil mit sich: Es wird Wissen auf Vorrat gesammelt. Das auf diese Weise gesammelte Wissen kann zwar nicht unmittelbar zur Befriedigung von Lebensbedürfnissen genutzt werden, aber evtl. zu einem späteren Zeitpunkt. In diesem Fall ermöglicht es dann eine schnellere Verhaltensanpassung! These: Latent werden v.a. solche Zusammenhänge gelernt, für die die Tiere „prepared“ sind oder auf die sie aus anderen Gründen (Auffälligkeit, Intensität der Reize) ihre Aufmerksamkeit richten. 3.3. Zusammenfassung Konditionierungsprozesse werden durch äußere (Kontingenz, Auffälligkeit etc.) und innere Faktoren (Bedürfniszustand, mentale Arbeit, Aufmerksamkeit, preparedness) beeinflusst. Verhalten ist primär erwartungsgesteuert. Reize beeinflussen das Verhalten lediglich indirekt, insofern durch sie spezifische Erwartungen aktiviert werden. Klassische Konditionierung: Bedingte Reize aktivieren Erwartungen bezüglich bedürfnisrelevanter Situationen (CS-UCS) Operante Konditionierung: Bekräftigungen aktivieren Verhaltens-Effekt-Erwartungen (V-E) Diskriminationslernen: Situationsabhängige Modifikation von VerhaltensEffekt-Erwartungen S-(V-E) Situation/Stimulus Erwartung (CS=>UCS oder V=>E) Verhalten Lernen ist nicht passiv, sondern aktiv und selektiv. Die Bildung von Assoziationen zwischen Reizen (CS und UCS) bzw. Verhaltensakten und Effekten erfolgt nicht schematisch, sondern erfordert „mentale Arbeit“ bzw. Schlussfolgerungsprozesse: In Analogie zum Wissenschaftler sucht das Tier sucht nach Ursachen. Zu welchen Schlussfolgerungen das Tier tendiert, hängt u.a. von dessen Aufmerksamkeit ab und davon, zu welchen Assoziationen es disponiert ist (Preparedness). Tiere haben ein allgemeines Antizipationsbedürfnis! 18 4. Menschliches Lernen: 4.1. Menschliches Lernen in Analogie zum Lernen bei Tieren Elementare menschliche Lernprozesse können analog zu denen bei Tieren beschrieben werden. Auch wir bilden in ähnlicher Weise S-V-E-Tripel aus. 4.1.1. Bedingte Reflexe beim Menschen Reize werden mit Erwartungen verbunden, auf die man sein Verhalten einstellt (s.o.). Im Humanbereich spielen klassische Konditionierungsprozesse v.a. beim Lernen von emotionalen Reaktionen, Einstellungen und Verhaltensweisen eine Rolle (Anwendung in der Werbung etc.). WATSON (1920): Der kleine Albert WATSON konditionierte den 11 Monate alten Albert darauf, sich vor einer weißen Ratte (NS bzw. CS) zu fürchten, vor der dieser ursprünglich keine Angst hatte. Jedes Mal, wenn der Junge die Ratte (NS) sah, schlug Watson auf eine Eisenstange und koppelte dadurch die Ratte, anfangs neutral- oder sogar positiv besetzt, an ein angstbesetztes Geräusch (UCS). Schon nach wenigen (7) Kopplungen genügte der Anblick Ratte, um Albert zum Weinen (CV) zu bringen. LACHNIT (1993): Positives und negatives patterning Bestimmte Buchstaben (CS) werden einzeln (negatives patterning) oder in Kombination (positives patterning) an einen leichten elektrischen Schlag (UCS) gekoppelt. Nach mehreren Durchgängen reicht die Darbietung der betreffenden Einzel- bzw. Doppelbuchstaben, um die Hautleitfähigkeit (GSR = Galvanic Skin Response) zu erhöhen. 4.1.2. Instrumentelles Bedingen beim Menschen Instrumentelle Konditionierungsprozesse spielen im menschlichen Alltag (Erziehung, Strafrecht, Verhaltenstherapie etc.) eine wichtige Rolle. GREENSPON (1955): Pluralwörter Vpn sollen assoziativ Wörter produzieren. Pluralwörter werden dabei vom Vl durch ein zustimmendes „Hhmmhmm“ bekräftigt. Kontinuierlicher Anstieg der Produktion von Pluralwörtern, ohne das den Pbn die Verstärkungsregel bewusst wird. HEFFERLINE et al. (1959): Daumenstellung Pbn hören 1 h Musik, die durch gelegentliche Störgeräusche unterbrochen wird. Letztere können durch eine minimale Bewegung des Daumens ausgeschaltet werden. Weder die Experimentalgruppe, die überhaupt nichts über den Zusammenhang zwischen der eigenen Bewegung und dem Störgeräusch weiß, noch die Kontrollgruppe, die zumindest weiß, dass es irgendeinen Zusammenhang gibt, wird sich über die zugrunde liegende Kontingenz bewusst. Trotzdem lernen alle Pbn, das Störgeräusch zunehmend besser zu kontrollieren. 4.2. Kritik am Behaviorismus Bezüglich der Ergebnisse im Humanbereich stellen sich dieselben Fragen wie beim tierischen Lernen: 1) Findet beim S-R oder V-E-Lernen statt? 2) Ist die Kontiguität oder die Kontingenz entscheidend für den Lernzuwachs? 3) Wie ist implizites (latentes) Lernen zu erklären? 19 4.2.1. Primat der Bildung von V-E-Beziehungen Um entscheiden zu können, ob eher S-V oder V-E-Assoziationen gebildet werden, muss analog zu den entsprechenden Tierversuchen (s.o.) untersucht werden, ob unterschiedliche Effekte (z.B. durch Devaluation/Valuation) die Verhaltenswahl beeinflussen oder lediglich die Ausgangssituation entscheidend ist. STOCK & HOFFMANN (2001): V-E-Lernen blockiert S-V-Lernen! Es gibt jeweils 4 verschiedene „Startsituationen“(Symbole), „Ziele“ (Symbole) und Handlungsalternativen (Tasten). Für jeden trial wird ein neues Start- und Zielsymbol vorgegeben. Aufgabe ist es, die Taste zu drücken, die für das jeweils gegebene Start- und Zielsymbol korrekt ist. Variiert wird lediglich die Zahl der Effekte: In der ersten Bedingung wird lediglich die Rückmeldung gegeben, ob die gedrückte Taste korrekt war oder nicht. Es gibt also nur einen anzustrebenden Effekt (= positive Rückmeldung)! In der zweiten Bedingung führt das Drücken einer Taste zu einem weiteren Symbol; korrekt ist die Taste, wenn das erscheinende Symbol mit dem jeweiligen Zielsymbol übereinstimmt. Es gibt also 4 verschiedene Effekte! Die zugrunde liegende Kontingenz ist in beiden Bedingungen dieselbe: Welche Taste bekräftigt wird, hängt vom Startsymbol ab (jedem Startsymbol ist jeweils eine andere „richtige“ Taste zugeordnet). Ergo: Es liegt eine S-V-Beziehung vor! 1. Bedingung: Wenn bei jeder Aktion nur 2 Effekte möglich sind, lernen die Pbn schnell, unter welchen Bedingungen (S), welche Taste (V) zu einer positiven Rückmeldung (E) führt (=> Diskriminationslernen). 2. Bedingung: Bei vier Effekten lernen lediglich 3 von 15 Vpn den S-VZusammenhang; der Rest verzweifelt! Erklärung: Bei mehreren Effekten wird zuerst versucht, V-E-Beziehungen zu erkennen (Welche Taste führt jeweils zu welchem Effekt?); lediglich sie werden bei korrektem Tastendruck verstärkt. Dadurch wird die Bildung von S-V-Beziehungen blockiert! Das Ergebnis spricht für die Bildung hierarchischer S(V-E) Beziehungen (siehe: nächster Punkt). Situationsabhängiges Aktions-Effekt-Lernen [S-(V-E)]: Im Alltag reicht es nicht, nur Verhaltenseffekte zu lernen, darüber hinaus müssen diese kontextualisiert, d.h. mit der jeweiligen Situation in Verbindung gebracht werden. Das Simpsons-Paradox: Werden kontingenzrelevante Unterschiede zwischen Situationen/Objekten/Gruppen nicht beachtet, kommt es zu Fehlschlüssen: dass z.B. die Verbrechensrate bei Ausländern höher ist, liegt nicht an deren Nationalität, sondern an deren (im Schnitt) niedrigerem sozialen Status (Arbeitslosigkeit etc.). Ein Maß für die situationsabhängige Verhaltenswahl ist der Bedingungsabhängigkeitsindex (BAI). Dieser errechnet sich aus den relativen Häufigkeiten (h%), mit denen die gegebenen Verhaltensalternativen in den einzelnen Situationen gewählt wurden (zw. -100 und +100; bei 0: situationsunabhängige Verhaltenswahl): Bei 2 Aktionen (z.B. Tasten) und 2 Situationen (z.B. Startsymbolen: h% (Taste 1/Situationn1) + h% (Taste2/ Situation2) – h% (Taste 1/Situation2) – h% (Taste2/Situation 1) 2 20 HOFFMANN & SEBALD (2000): Glücksradexperiment I Der BAI bei 100%iger bedingungsabhängiger Kontingenz [S-(V-E)] Den Pbn stehen 4 Aktionen (Tasten) zur Auswahl; Variation der Startsituation (Käfer oder Schwein als Glückssymbol); Bekräftigung der Tasten abhängig vom Glückssymbol: Bei „Schwein“ ist immer Taste 1, nie Taste 2 richtig; bei „Käfer“ ist es umgekehrt; die Tasten 3 und 4 werden unabhängig vom Startsymbol in 20% der Fälle bekräftigt! Nach mehreren Durchgängen lernen alle Pbn, die Tasten in Abhängigkeit vom Symbol zu benutzen (der BAI nimmt den Wert 100 an). Der individuelle Verlauf zeigt: Zunächst werden die Tasten mit hoher unbedingter Bekräftigungsrate (Tasten 1 und 2 => 50%) bevorzugt gewählt (V-E-Lernen); das Glückssymbol wird erst später (ab Block 7) berücksichtigt (Diskriminationslernen). Ergo: Primär ist die Bildung von V-E-Einheiten, die erst sekundär kontextualisiert werden (siehe auch: Kap. 3)! 4.2.2. Kontiguität oder Kontingenz? Bedingungsunabhängige Kontingenzen: Einfaches V-E-Lernen kann auch mit dem „response-outcome“ Paradigma untersucht werden: Dabei sollen Vpn einschätzen, zu welchem Grad (0 bis 100) sie einen Effekt (z.B. Licht) durch ihr Handeln (Tastendruck) beeinflussen bzw. kontrollieren können (Kontingenz). WASSERMAN et al. (1993): „response-outcome“ Lernen Die Kontingenz zwischen Tastendruck (V) und dem Aufleuchten eines Lichtes (E) wird zwischen den Pbn variiert (25 Bedingungen), indem jeweils 5 verschiedene Wahrscheinlichkeiten p (E/V) und p (E/¬V) zugrunde gelegt werden. Aufgabe der Pbn ist es, die Kontingenz einzuschätzen (+100: Licht brennt nur nach Tastendruck; 0: kein Zusammenhang; -100: Licht brennt nie nach Tastendruck). Ergebnis: Bereits nach kurzer Zeit kovariieren die Einschätzungen der Pbn nahezu perfekt mit der tatsächlichen Kontingenz. Lediglich bei hoher Basisrate überschätzen die Pbn ihren eigenen Einfluss (Kontrollillusion)! Ergo: Hohe Sensibilität für kontingente V-E-Beziehungen! Bedingungsabhängige Kontingenzen und Verhalten: Wann werden bedingungsabhängige Kontingenzen verhaltenswirksam? HOFFMAN & SEBALD (2000): Glücksradexperiment II Der BAI bei variierender bedingungsabhängiger Kontingenz [S-(V-E)]! In der obigen Variante hing der Tastenerfolg zu 100% von den Bedingungen (dem Glückssymbol: Käfer vs. Schwein) ab: deterministische V-EKontingenzen. Im Folgenden werden die bedingungsabhängigen Kontingenzen variiert, d.h. die Wahrscheinlichkeiten, mit der eine bestimmte Taste (und keine andere!) bei einem bestimmten Glückssymbol zum Erfolg führt (100%, 80%, 60%); darüber hinaus werden die unbedingten Bekräftigungsraten variiert, d.h. die Wahrscheinlichkeiten, mit der eine Taste unabhängig vom Glückssymbol bekräftigt wird (50%, 40%, 30%). Je höher die unbedingte Bekräftigungsrate einer Taste, desto häufiger wird sie gewählt. Dabei schlagen sich schon kleine Unterschiede im Verhalten nieder: Eine nur 10% höhere Bekräftigungsrate führt zu einer signifikanten Bevorzugung der betreffenden Taste! Mit bedingungsabhängiger Kontingenz nimmt zwar auch die bedingungsabhängige Wahl der kritischen Tasten (BAI) zu; die Anpassung 21 des Verhaltens an die bedingungsabhängigen Kontingenzen ist aber nur bei 100%iger Kontingenz optimal (BAI = Kontingenz). Schon eine geringfügige Verringerung der bedingungsabhängigen Kontingenz führt zu wesentlich niedrigeren BAIs: Lediglich bei einer Kontingenz von 100/0 wird ein BAI von 100 erreicht; bei einer Kontingenz von 80/0 wird z.B. nur ein BAI von 60 erreicht. Fazit: Menschen sind sehr sensibel für erfolgsbezogene V-E-Kontingenzen: Bereits geringfügige Unterschiede beeinflussen die Verhaltenswahl. Um das Verhalten aber an kritischen Situationsbedingungen zu orientieren (BAI), bedarf es nahezu deterministischer bedingungsabhängiger Kontingenzen (100/0: in der einen Bedingung immer; in der anderen nie). Hinzu kommen die Beachtung der relevanten Situationsmerkmale und die aktive Suche nach Kontingenzen (s.u.)! Sobald verschiedene Bedingungen die V-E-Einheiten moderieren und die Kontingenzen nicht 100%ig sind, haben wir Schwierigkeiten, unser Verhalten systematisch anzupassen. 4.2.3. Situationen/Objekte/Reize als „occasion setter“ oder direkte S-V-Aktivierung? Das Problem (s.o.): Aktivieren Situationen das Verhalten direkt (S-V) oder indirekt über die Antizipation der in ihnen potenziell erreichbaren Effekte (erst S-E; dann VE)? 3 Fälle können unterschieden werden: 1) Situationen können Bedürfnisse wecken: In diesem Fall determiniert nicht die Situation, sondern die durch sie geweckten Ziele (antizipierten Effekte) das Verhalten (erst S-E; dann V-E bzw. E-V); Situation als „occasion setter“ (s.o.)! 2) Bei hoch trainierten Routinehandlungen oder situationsgebundenen Gewohnheiten (z.B. Autofahren: rote Ampel etc.) können Situationen das Verhalten auch direkt („automatisch“) aktivieren, aber nur, wenn eine grundsätzliche Verhaltensbereitschaft bereits vorhanden ist (Vgl.: Schlüsselreize). Bei entsprechend starker Automatisierung können in Bereitschaft stehende Verhaltensakte auch gegen den Willen getriggert werden. Der Simon-Effekt: Der Reizort führt zur automatischen Aktivierung der räumlich kompatiblen Reaktion; daher: langsamere Reaktionszeiten bei räumlich inkompatibler Darbietung (Reiz rechts – zu drückende Taste links). Der Stroop-Effekt: Das Benennen der Schriftfarbe von Farbwörter wird verzögert, wenn das Wort eine andere Farbe bezeichnet (z.B: Grün). Durch veränderte Intention kann der Effekt stark reduziert werden: z.B. wenn die Schriftfarbe nicht benannt-, sondern eine zugeordnete Taste gedrückt werden muss. 3) Noch größeren Einfluss hat die Situation in geschlossenen Handlungsroutinen („closed skills“) wie z.B. Zähneputzen. Dabei löst jedes Element der gewohnten Handlungskette löst die jeweils nachfolgende Handlung aus – ohne Beteiligung des Willens. Fazit: S-V-Beziehungen werden bedingungsabhängig differenziert und zu S-(V-E)Einheiten zusammengefügt; letztere sind im Sinne von Verhaltensregeln zu verstehen. Bei häufiger Wiederholung derselben S-V-E-Tripel kann die Situation das Verhalten aber auch direkt auslösen! 22 4.3. Implizites Lernen Latentes Lernen bei Tieren = Lernen ohne externe Bekräftigung Erklärung: Antizipationsbedürfnis (s.o.) Implizites (= latentes) Lernen beim Menschen = inzidentelles Lernen (ohne bewusste Intention und externe Bekräftigung) Erklärung: intrinsische Motivation => Verwandte Konzepte: Explorationsbedürfnis (BERLYNE), „effectance motivation“ (WHITE) etc. Beispiele für latentes Lernen bei Menschen: Säuglinge erhöhen ihre Aktivität, wenn diese zu kontingenten Effekten führt, auch wenn die Effekte selbst keine (direkten) Bekräftiger sind (z.B.: Kontingenz zwischen Saugstärke und Lichthelligkeit). ELSNER & HOMMEL (2001): reversal- und non-reversal transfer Lernphase: Auf ein Signal (Rechteck) hin soll so schnell wie möglich auf eine von 2 Tasten gedrückt werden (free choice). Der Effekt wird je nach gedrückter Taste kontingent von einem hohen- oder einem tiefen Ton begleitet. S linke Taste (R1) hoher Ton (E1) S rechte Taste (R2) tiefer Ton (E2) Testphase: Je nach Effektton (hoch vs. tief) soll so schnell wie möglich auf eine der beiden Tasten gedrückt werden (forced choice); variiert wird dabei die Ton-Tasten-Zuordnung: Non-Reversal Transfer Reversal Transfer Hoher Ton (E1) linke Taste (R1) Tiefer Ton (E2) rechte Taste (R2) Hoher Ton (E1) rechte Taste (R2) Tiefer Ton (E2) linke Taste (R1) Ergebnis: In der non-reversal Bedingung reagieren die Pbn schneller auf die als Reize dargebotenen Effekte als in der reversal Bedingung. Ergo: Die auffälligen, aber für die Aufgabenstellung irrelevanten V-EBeziehungen in der Lernphase wurden latent (ohne bewusste Absicht) gelernt! In der nachfolgenden non-reversal Bedingung (E-V-Lernen) wurde das auf diese Weise erworbene „Wissen“ angewandt. Die Annahmen zum impliziten Lernen gehen jedoch weiter: Es wird nicht nur davon ausgegangen, dass implizites Lernen ohne Absicht- (inzidentell), sondern darüber hinaus aufmerksamkeitsunabhängig und unbewusst erfolgt! Die 3 postulierten Merkmale impliziten (voraussetzungsfreien) Lernens: 1) inzidentell (unbeabsichtigt und ohne externe Bekräftigung) 2) aufmerksamkeitsunabhängig 3) unbewusst Zwei prototypische Untersuchungen zum impliziten Lernen LEWICKI (1986): Implizites Kovariationslernen Vpn bekommen vier 3×3-Quadranten dargeboten. Aufgabe ist es mittels einer von 4 Tasten die Matrix zu bezeichnen, die das Target (die Zahl 6) enthält. Ein subliminal (unterschwellig) dargebotener Code (z.B. A235A) kündigt den zu bezeichnenden Quadranten bzw. die zu drückende Taste vorher an (100%ige Kovariation zw. Code und Quadrant/Taste). In einer Bedingung bleibt die Zuordnung zwischen Code und Quadrant über alle 120 trials hinweg gleich; in der anderen Bedingung wechselt die Zuordnung nach 60 trials. In der Versuchsgruppe, in der die Zuordnung gleich bleibt, kommt es zu einer signifikanten Verbesserung der Reaktionszeiten; in der 23 anderen nicht. Keine der Vpn kann sagen, welcher Code welchen Quadranten angekündigt hat! Ergo: In der ersten Versuchsgruppe ist die Kovariation zwischen Code und Quadrant implizit gelernt worden! CLEEREMAN & MCCLELLAND (1991): Implizites sequentielles Lernen Vpn bekommen die Aufgabe, auf das Erscheinen eines Punktes an einer von 6 möglichen Positionen mit dem Drücken einer räumlich kompatiblen Taste zu reagieren (SRT-Experiment: Serielle Reaktionszeit-Aufgabe). Die Sequenz der Positionen ist nicht willkürlich, sondern wird durch eine, den Vpn nicht bekannte „finite state“- Grammatik bestimmt: Nur bestimmte Abfolgen und Kombinationen sind also (grammatikalisch) möglich. Obwohl die zugrunde liegenden Regeln sehr komplex und den Pbn nach eigenen Angaben nicht bewusst sind, nehmen die Reaktionszeiten auf grammatische Positionen schneller ab als auf agrammatische! Ergo: Die „finite state“-Grammatik oder zumindest Teile von ihr sind implizit gelernt worden (zur Kritik: s.u.)! 4.4. Kritik am Konzept des impliziten Lernens Im Zusammenhang mit implizitem Lernen ist zu fragen, was und wie gelernt wird. Die meisten Befunde zum impliziten Lernen (s.o.) erlauben keine Aussage darüber, was eigentlich genau gelernt wird! Wird z.B. beim Kovariationslernen (siehe: LEWICKI) die Kontingenz zwischen Cue und Targetlokation (S-S-Lernen) oder zwischen Cue und Augenbewegung bzw. Cue und Taste (S-V-Lernen) gelernt?! Wird beim sequentiellen Lernen (siehe: CLEEREMAN & MCCLELLAND) der Zusammenhang zwischen aufeinanderfolgenden Positionen (S-S-Lernen), aufeinanderfolgenden Tasten (R-R-Lernen) oder zwischen Tasten und nachfolgenden Positionen (V-E-Lernen) gelernt?! Die Annahme, implizites Lernen sei inzidentell, aufmerksamkeitsunabhängig und unbewusst, ist äußerst fraglich! 4.4.1. Ist es möglich inzidentell (unbeabsichtigt) zu lernen? Das inzidentelle Lernen von kontingenten V-E-Beziehungen ist möglich, auch wenn selbstinstruiertes Lernen nie ausgeschlossen werden kann! Eine bewusste Lernintention ist zumindest bei situationsunabhängigen V-EBeziehungen nicht notwendig! Das zeigt u.a. das oben besprochene Experiment von ELSNER & HOMMEL. Offen ist die Frage, ob sich explizites (gezieltes) und inzidentelles Lernen grundsätzlich – oder lediglich hinsichtlich der zugrunde liegenden Aufmerksamkeitsmechanismen unterscheiden. Am plausibelsten ist in diesem Zusammenhang die These, dass explizites Lernen auf der gezielten Beachtung bestimmter (antizipierter) Merkmale beruht, während die Aufmerksamkeit bei inzidentellem Lernen frei fluktuiert (unsystematischer Strategiewechsel). Wenig plausibel ist dagegen die These, dass beim inzidentellen Lernen alle bzw. keine Variablen und Kontingenzen beachtet werden! Für eine inzidentelle Anpassung an Situationsmerkmale [(S-(V-E)-Einheiten] gibt es keine Evidenz! In jedem Fall gilt, dass Situationsmerkmale beachtet werden müssen, um Einfluss auf das Verhalten zu gewinnen (s.u.: Aufmerksamkeit)! 24 4.4.2. Implizites Lernen ist definitiv nicht aufmerksamkeitsunabhängig! Aufmerksamkeitsunabhängiges Lernen kann ausgeschlossen werden! HOFFMANN & SEBALD (2000): Glücksradexperiment III Der BAI in Abhängigkeit von der Motivation (und der Aufmerksamkeit) Indem ein Punktesystem eingeführt wird, wird die Motivation der Vpn, auf das Glückssymbol zu achten, manipuliert. Je nach Bedingung werden für falsche Reaktionen („Nieten“) unterschiedlich viele Punkte abgezogen. Annahme: Je höher der Punktverlust, desto stärker die Motivation, relevante Situationsmerkmale (hier: das Glückssymbol) zu erkennen und zu nutzen. Tatsächlich steigt der BAI bei höherem Punkteverlust stärker an als bei geringerem Punkteverlust (s.o.: der BAI entspricht der Berücksichtigung des Glückssymbols bei der Verhaltenswahl). Ergo: 1) Damit die kritischen Situationsbedingungen (hier: das Glückssymbol) verhaltenswirksam werden, muss a) auf sie geachtet und b) aktiv nach ihnen gesucht werden! 2) Die Situation (hier: das Glückssymbol) wird keineswegs spontan beachtet! Vielmehr müssen Menschen dazu motiviert sein (z.B. durch wiederholte Frustration)! HOFFMANN & SEBALD (2000): Glücksradexperiment IV Der BAI in Abhängigkeit von der Plausibilität der Kontingenz bzw. dem kontingenzrelevanten Situationsmerkmal! Variiert wird das kontingenzrelevante Situationsmerkmal: Glückssymbol (Schwein vs. Käfer); Farbe der Karten (rot vs. schwarz); Lage der Glückskarte (links vom oder unter dem Ziel) Ergebnis: Je plausibler das Merkmal, desto höher der BAI! Lage der Karten > Symbol > Farbe Die Berücksichtigung von Situationsmerkmalen sowie das Lernen von V-EBeziehungen hängen mit Sicherheit auch von Lerndispositionen (Preparedness) ab! Wir sind dazu disponiert, funktionale (plausible) Zusammenhänge zu lernen! HOFFMANN & SEBALD (2005): Kartenrückseite Taste (Kovariationslernen) Aufgabe ist es, auf einen rechts oder links dargebotenen Target-Reiz hin auf eine rechte oder linke Taste zu drücken. Zentral werden Spielkarten dargeboten, wobei die Rückseiten der Karten (Fische vs. Palmen) die zu drückende Taste bzw. den Ort des Targetreizes zu 100% vorhersagen. Ergebnis: Lediglich die Vpn, denen der Zusammenhang bewusst wird, weil sie die Kartenrückseiten beachten, verbessern ihre Reaktionszeiten! Wird der Zusammengang zw. KRS und Taste plötzlich aufgehoben, verschlechtern sich ihre Reaktionszeiten wieder. Ergo: 1) Nur bei (bewusster) Beachtung der Cues findet Kovariationslernen statt! Auch bei subliminaler Darbietung der relevanten Cues (Vgl. LEWICKI) werden diese zumindest beachtet! 2) Auch nicht-diskriminative Situationsmerkmale, die erfolgreiches Verhalten lediglich kontingent begleiten, werden nicht „automatisch“ Auslöser dieses Verhaltens. Bei SRT-Aufgaben (serial reaction tasks) sind die kontingenzrelevanten Reizmerkmale gleichzeitig aufgabenrelevant (bei CLEEREMAN & MCCLELLAND: die Lokation des Punktes). Sie werden daher zwangsläufig beachtet! Um die Aufmerksamkeit von den kontingenzrelevanten Merkmalen abzulenken, gibt es 2 Techniken: 1) Doppelaufgabe (z.B. neben SRT Töne Zählen) 2) Reize mit 2 Merkmalen (z.B.: Lokation bestimmt Reaktion; Form bestimmt Sequenz) 25 JIMÈNEZ & MENDÈZ (1999): SRT und Aufmerksamkeit SRT-Aufgabe mit unterschiedlichen Zeichen („?“, „#“, „&“, „£“) an 4 Lokationen; reagiert (und geachtet) wird auf Lokation; Form des Reizes sagt nächste Lokation vorher (nach einer „infinie state“-Grammatik). Nur wenn die Vpn durch die Aufgabenstellung dazu angehalten sind, auf die Form zu achten (z.B. indem sie aufgefordert werden, die Zeichen zu zählen), schlägt sich die Kontingenz in besseren Reaktionszeiten nieder! Ergo: Implizites sequentielles Lernen ist aufmerksamkeitsabhängig! 4.4.3. Unbewusstes Lernen ist zumindest fraglich Eine bewusste Lernintention scheint – zumindest beim Lernen situationsunabhängiger V-E-Kontingenzen - nicht notwendig zu sein (siehe 4.4.1.: inzidentelles Lernen) Viele der genannten Befunde legen nahe, dass ein bewusstes Erkennen der gelernten Strukturen nicht notwendig ist, um verhaltenswirksam zu werden. Kurz: Das Lernresultat muss nicht bewusst werden! Als Kriterium für implizite und damit vermeidlich unbewusste Lernvorgänge dienen „indirekte“ Verhaltensdaten (Reaktionszeiten, Fehler). Explizite Lernergebnisse werden dagegen mittels „direkter“ Verhaltensdaten erfasst (Benennen der Strukturen, -Signalreize etc.). Die strikte Unterscheidung zw. direkten- und indirekten Verhaltensdaten ist allerdings zumindest kritisch zu hinterfragen: 1) Pbn berichten oft über fragmentarisches Wissen; d.h. ihnen sind zumindest Teile der Strukturen (z.B. der finite-state-Grammatik) bewusst. Wenn dieses fragmentarische Wissen die indirekten Daten (z.B. die Reduktion der RT) hinreichend aufklärt, darf nicht von 2 unterschiedlichen Lernformen ausgegangen werden! 2) Es kann sein, dass lediglich die Sensitivität der direkten und indirekten Messmethoden unterschiedlich ist, nicht aber die Daten selbst. Ein Befund, der diese Vermutung stützt, ist, dass direkte und indirekte Daten meist miteinander korrelieren: Je mehr explizites Wissen, desto mehr „implizites“ Lernen! 3) Direkte Messmethoden erfassen möglicherweise nicht das verhaltensdeterminierende Wissen! z.B. wenn die RT-Reduktion in SRT-Aufgaben v.a. auf R-RAssoziationen beruht, die Pbn aber nach den zugrunde liegenden S-SBeziehungen gefragt werden! 4) Auch wenn am Ende keine expliziten Angaben über relevante Strukturen gemacht werden können, kann es sein, dass diese zumindest während des Lernens kurzfristig erkannt, dann aber wieder vergessen oder nicht weiterverfolgt wurden! Zumindest die Bewusstheit des Lerngegenstandes scheint notwendig zu sein! HOFFMANN & SEBALD (2005): Kartenrückseite Taste (Kovariationslernen) Siehe oben: noch nicht einmal bewusst identifizierte Reize (die Kartenrückseiten) werden verhaltenswirksam, wenn sie nicht beachtet werden! 4.4.5. Fazit: Am plausibelsten ist die Annahme, dass implizites und explizites Lernen keine qualitativ verschiedenen Lernformen sind, sondern auf denselben grundlegenden Mechanismen beruhen und sich auf einem Kontinuum bewegen! 26 5. Die ABC-Theorie („Anticipative Behavioral Control“) 5.1. Der Aufbau verhaltenssteuernder S-V-E-Einheiten (Lernen) Die ABC-Theorie beschreibt Lernen als aktiven Aufbau von S-V-E-Beziehungen! Es wird davon ausgegangen, dass dieser Lernprozess in 2 Schritten erfolgt: 1) Aufbau von bidirektionalen V-E Repräsentationen (primärer Lernprozess) Willkürliches bzw. zielgerichtetes Verhalten setzt die Antizipation der Effekte voraus: Das angestrebte Ziel muss schon vor dem Handeln repräsentiert sein! Wird der antizipierte Effekt erreicht, kommt es zum Aufbau bidirektionaler V-E Beziehungen: Es wird a) die Beziehung zwischen Antizipation und Verhalten und b) die Beziehung zwischen Verhalten und tatsächlichem Effekt gespeichert. Eant V Ereal Auch nicht explizit gewollte (bzw. antizipierte) Effekte können im Sinne von V-E-Beziehungen gespeichert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass sie (z.B. wegen ihrer Auffälligkeit, Preparedness oder d. Antizipationsbedürfnis) beachtet werden! Nur beachtete Effekte werden repräsentiert! Von den beachteten Effekten werden die kontigenten abstrahiert! Wiederholtes Eintreten der gewollten oder „nur“ beachteten Effekte führt zur Stärkung der mental repräsentierten V-E-Beziehung! 2) Kontextualisierung der V-E-Repräsentationen: S-(V-E) V-E-Repräsentationen werden kontextualisiert, wenn… a) der antizipierte Effekt nicht erreicht wurde b) und bestimmte Situationsmerkmale das Verhalten kontingent begleiten oder den Erfolg modifizieren! Nur beachtete Situationsmerkmale werden integriert! Von den beachteten Merkmalen werden die das Verhalten konsistent begleitenden Merkmale abstrahiert! Durch das wiederholte Erleben einer bereits repräsentierten S-(V-E)Beziehung wird diese gestärkt! 5.2. Antizipative Verhaltenssteuerung Die ABC-Theorie beschreibt menschliches Verhalten analog zu Verhaltenskoordinationen bei Tieren (siehe: Kap. 2.1.). Es wird davon ausgegangen, dass willkürliches (zielgerichtetes) Verhalten durch die Antizipation der Effekte – gegebenenfalls auch der relevanten Situationsbedingungen – gesteuert wird (antizipative Verhaltenssteuerung). Suche Situationsmerkmale Effektantizipationen Verhaltensbereitschaft Ausführung Effekte ( evtl. Antizipation rel.Bedingungen ) 27 Effektantizipationen bzw. Intentionen können durch endogene Reize (z.B. Hunger), situative Faktoren (z.B. Restaurant) oder Instruktionen hervorgerufen werden. Effektantizipationen werden zu Intentionen, wenn der antizipierte Effekt „gewollt“ wird! Die Antizipation eines Effektes löst eine Verhaltensbereitschaft aus – sofern entsprechende V-E Einheiten repräsentiert sind. Darüber hinaus löst die Antizipation des Effektes gegebenenfalls die Antizipation der zur Erreichung notwendigen Situationsbedingungen aus (Startantizipation). Bei der Verhaltenssteuerung wird also der durch Erfahrung erworbene V-EZusammenhang umgedreht. Der antizipierte Effekt löst das Verhalten aus (siehe Kap.6: ideomotorisches Prinzip) Liegen die notwendigen Situationsmerkmale nicht vor, wird nach ihnen gesucht (Vgl. Kap. 2.1.: Appetenzverhalten); liegen sie vor (Vgl. Kap.2.1.: Schlüsselreize) wird das in Bereitschaft stehende Verhalten ausgeführt! Verhaltensbereitschaften werden also ausgeführt, wenn… 1) die aktivierten V-E-Repräsentationen entweder keine differenzierenden Bedingungen enthalten 2) oder die wahrgenommenen Situationsmerkmale den antizipierten entsprechen 3) keine konkurrierenden Ziele oder anderes Verhalten der Ausführung entgegenstehen und diese durch ein „fiat“ (es werde) initiiert wird! Abschließend werden die erzeugten Effekte mit den antizipierten verglichen. Bei Übereinstimmung: Erlöschen der Intention oder neue Intention / Stärkung der S-(V-E)-Repräsentation Bei Diskrepanz: Modifikation der S-(V-E)-Repräsentation 5.3. Kritische Vergleiche 5.3.1. Lernmechanismen bei Mensch und Tier Die Grundstrukturen des Lernens (Bildung von S-V-E-Tripel) haben sich im Lauf der Evolution herausgebildet und sind bei allen höher organisierten Lebewesen analog. Besonderheiten und Unterschiede: Der Mensch verfügt über das bei Weitem differenzierteste Verhaltensrepertoire und besitz die Fähigkeit, sich beliebige Ziele zu setzen! Tierisches Verhalten ist dagegen weniger vielfältig und auf die Befriedigung der elementaren Bedürfnisse (Nahrung, Fortpflanzung etc.) beschränkt. Aus der Vielzahl an möglichen Verhaltensweisen und Zielen folgt, dass der Mensch vermutlich über differenziertere Steuerungsmechanismen verfügt als Tiere (Planung, Sprache etc.)! 5.3.2. Behaviorismus vs. ABC-Theorie BehavioBehaviorismus Lebewesen als Black-box (keine Intention) Reiz löst Verhalten aus Verhaltensänderung als S-R-Lernen Lernen nur durch externe Verstärkung Keine Optimierung des Lernens ABC-Theorie Verhalten ist intentional (zielgerichtet) Reize modifizieren die Erwartung; letztere bestimmt das Verhalten bzw. aktiviert die Verhaltensbereitschaft Verhaltensänderung als Folge veränderter Effektantizipationen Lernen auch durch intrinsische Motivation Zunehmend bessere Antizipation 28 6. Verhaltensausführung 6.1. Allgemeines zum sensomotorischen System der Skelettmuskulatur Jede Verhaltensausführung beruht auf der Kontraktion von Muskeln. Zu unterscheiden ist zwischen dem Herzmuskel, der glatten Muskulatur (z.B. in den Wänden der Eingeweide) und der quergestreiften Skelettmuskulatur! Nur die Skelettmuskulatur (insgesamt gibt es ca. 600 Skelettmuskeln) kann willkürlich kontrahiert und damit zur Verhaltensausführung genutzt werden. Unterschieden werden kann zwischen isotonischer- und isometrischer Kontraktion: Isotonische Muskelkontraktion: Muskeltonus (Muskelspannung) bleibt gleich-; Muskellänge wird verkürzt! z.B. Beim Heben eines Steins Isometrische Muskelkontraktion: Muskellänge bleibt gleich; Muskeltonus (Muskelspannung) wird erhöht! Skelettmuskeln bestehen aus starken exrafusalen Fasern und schwachen intrafusalen Fasern (=Muskelspindeln). Die efferente Innervation (ZNS => Muskel): Motorik α-Motoneurone => α-Fasern => extrafusale Fasern γ-Motoneurone => γ-Fasern => Muskelspindeln Die afferente Innervation (Muskel => ZNS): Sensorik (Propriozeption) Muskelspindeln („messen“ vorwiegend Länge des Muskels) => Ia-Fasern (oder Typ II-Fasern) => Thalamus => sensomotorischer Kortex Golgi-Sehnenorgane („messen“ vorwiegend Spannung des Muskels) => IbFasern => sensomotorischer Kortex Sensorik und Motorik bzw. Afferenzen und Efferenzen sind permanent aufeinander bezogen und strukturell oft kaum voneinander zu trennen: 1. Primär efferente Strukturen im ZNS: 1.1. Der primäre motorische Kortex (Gyrus praecentralis): Reizungen im primären motorischen Kortex lösen kontralateral entsprechende Muskelkontraktionen aus, wobei der Ort der Reizung der Lage des Muskels somatotopisch zugeordnet ist (=> motorischer Homunkulus)! 1.2. Der prämotorische Kortex: An der Planung und Ausführung zielgerichteter Bewegungsabläufe beteiligt 1.3. Basalganglien: Beteiligt an der Zeit/Kraft-Regulation von Muskelkontraktionen 1.4. Cerebellum (Kleinhirn): Beteiligt an der Kontrolle schneller, automatisierter Bewegungen 2. Primär afferente Strukturen im ZNS: 2.1. Thalamus und sensomotorischer Kortex Propriozeptive Erregungen aus der Peripherie (v.a. von den Muskelspindeln sowie Gelenk- und Hautrezeptoren) gelangen über den Thalamus in den somatosensorischen Kortex (somatosensorischer Homunkulus) 29 Bedeutung der Propriozeption (Eigenwahrnehmung): Die motorischen Afferenzen (aus den Muskelspindeln, Gelenkrezeptoren etc.) liefern Informationen über: 1. Die Stellung der Glieder 2. Aktive und passive Bewegungen des Körpers und seiner Glieder 3. Richtung, Geschwindigkeit und Beschleunigung von Bewegungen 4. Die für eine Bewegung notwendige Kraft (Widerstand) Propriozeption informiert also nicht nur über den eigenen Körper, sondern auch über Umwelteinflüsse bzw. Eigenschaften von Objekten (Gewicht, Masse, Konsistenz etc.) 6.2. Das Regelungsprinzip 6.2.1. Das Prinzip allgemein Das Regelungsprinzip besagt, dass nicht das Handlungs- bzw. Bewegungsziel selbst, sondern dessen Differenz zum jeweiligen Ausgangzustand entscheidend für die Handlungssteuerung ist. Daher bedürfen Bewegungen der internen und externen Regelung. Ein Regler erhält eine Führungsgröße bzw. einen Soll-Zustand und vergleicht diesen mit der Regelgröße bzw. dem Ist-Zustand. Nur wenn die Differenz zwischen Führungs- und Regelgröße ungleich Null ist, aktiviert der Regler das Stellglied, das durch negative Rückkopplung auf die Regelgröße einwirkt, bis dessen Differenz zur Führungsgröße gleich Null ist. Konkret (am Beispiel der Temperaturregelung oder Regelung einer Handbewegung): Führungsgröße (Soll-Zustand): die gewünschte Zimmertemperatur Zielort der Hand Regler: Thermostat Muskelspindel Regelgröße (Ist-Zustand): aktuelle Zimmertemperatur Aktuelle Handposition bzw. Muskellänge Stellglied: Öl/Ventil α-Motoneuron 6.2.2. Der Dehnungsreflex Der Dehnungsreflex kann als sensomotorischer Regelkreis verstanden werden, der dafür sorgt, dass die Muskellänge gegenüber Störungen (passive Dehnung) konstant bleibt. Die passive Dehnung eines Muskels wird von der Muskelspindel als Abweichung des „Ist-Zustand“ vom „Soll-Zustand“ (=Ausgangslage) registriert. Über Ia-Fasern werden die α-Motoneurone dieses Muskels aktiviert, die antagonistischen Motoneuronen gehemmt: Auf diese Weise wird die passive Dehnung des Muskels durch dessen unmittelbare Kontraktion (Verkürzung) kompensiert. Ist-Zustand = Muskellänge (gemessen vom Spindelfühler)?! Soll-Zustand = entspricht der Muskelspindellänge?! 6.2.3. Die Gamma-Spindel-Schleife Die willkürliche Einstellung der Muskellänge und -kraft (isotonische und isometrische Kontraktion) erfolgt über die Gamma-Spindel-Schleife. Zentralnervöse Innervation der Gamma-Motoneuronen führt zur Kontraktion der Muskelspindel. Dadurch ist die Führungsgröße (Soll-Zustand) vorgegeben. Stimmt dieser nicht mit dem „Ist-Zustand“ (tatsächliche Muskellänge: extrafusale Fasern) überein, wird die Diskrepanz von der Muskelspindel (genauer: dem Spindelfühler) 30 registriert und der Dehnungsreflex wird ausgelöst: Aktivierung der α-Motoneurone => Kontraktion der extrafusalen Muskelfasern. Prinzip der Servosteuerung: Zentralnervös wird die Länge der Muskelspindeln vorgegeben (Führungsgröße), nach der die Länge der Muskeln durch den Reflexbogen zwangsläufig „geregelt“ wird. Da bei isometrischer Kontraktion die gereizten Golgi-Rezeptoren das α-Motoneuron (über Ib-Fasern) hemmen (ist halt so!), werden bei den meisten Bewegungen nicht nur die γ-, sondern auch die α-Motoneurone direkt (zentralnervös) innerviert: Man spricht in diesem Zusammenhang von einer α-γ-Kopplung! Muskelkontraktionen werden also nicht ausschließlich über die γ-Schleife hervorgerufen; es sollte daher besser von Servounterstützung gesprochen werden. Die α-γ-Kopplung verbindet 2 Regelkreise: Die Muskelspindeln messen mechanisch die Differenz zwischen der kortikal (γMotoneurone) vorgegebenen und der vom Spindelfühler gemessenen Muskellänge (extrafusale Fasern). In Abhängigkeit von dieser Differenz werden die α-Motoneurone aktiviert (negative Rückkopplung) - und dadurch Muskeldehnungen (=Störgrößen) autonom kompensiert. Die Impulse, die die α-Motoneuronen zum Muskel senden, ergeben sich aus der Differenz zwischen exzitatorischen (Ia und supraspinal) und inhibitorischen (Ib) Inputs. Insofern misst ein Motoneuron neuronal die Differenz zwischen kortikal vorgegebener und der von den Golgi-Rezeptoren gemessenen Muskelspannung. Die vorgegebene Spannung wird autonom gegen Erschlaffung verteidigt. Schließlich schlägt sich eine niedrigere Spannung (Golgirezeptoren) sofort in einer geringeren Hemmung der α-Motoneuronen nieder. Prinzip der Äquifinalität: Durch Vorgabe des Spannungsverhältnisses zwischen Beuger und Strecker kann der Sollzustand (z.B. eine best. Körperhaltung) unabhängig vom jeweiligen Ausgangzustand erreicht werden (analog zum Masse-Feder-Modell)! 6.2.4. Extero- und propriozeptive Regelung von Zielbewegungen: Die Ausführung von Zielbewegungen wird extern (exterozeptiv; v.a. visuell) und intern (propriozeptiv) geregelt. Das Fittsche Gesetz (speed-accuracy-trade-off) besagt, dass Schnelligkeit und Genauigkeit einer Bewegung in reziprokem Verhältnis zueinander stehen: Je schneller eine Bewegung, desto ungenauer und je genauer, desto langsamer ist sie. Gezielte Handbewegungen teilen sich typischerweise in 2 Phasen auf: 1) Schnelle (und eher grobe) Annäherung an das Ziel 2) Danach Abbremsung und Feinjustierung mittels einer oder mehrerer Teilbewegungen Experimente, in denen das visuelle Feedback (Exterozeption) während einer Zielbewegung manipuliert wurde, führten zum sog. 2-Phasen-Modell. WOODWORTH (1899): 2-Phasen-Modell Woodworth ließ Pbn Linien zwischen 2 Zielorten zeichnen; manipuliert wurden a) das visuelle Feedback (offene vs. geschlossene Augen) und b) die geforderte Geschwindigkeit (mittels Metronom). Als AV wurde die Genauigkeit der Bewegungen erfasst. Ergebnis: Bei schnellen Bewegungen (unter 450 ms) hat die Verfügbarkeit visueller Rückmeldung keinen Einfluss auf die Genauigkeit; je langsamer aber die Bewegungen werden, desto stärker der Einfluss des visuellen Feedbacks! 31 Interpretation (2-Phasen-Modell): Zielbewegungen bestehen aus einem open- und einem closed loop. 1) „Open loop“: „Zentral“ vorprogrammierte, rückmeldungsunabhängige Initialbewegung in die Nähe des Ziels 2) „Closed loop“: Rückmeldungsabhängige Zielannäherung und Feinjustierung unter visueller Kontrolle (online-Regelung) Es gibt allerdings Befunde, die dafür sprechen, dass visuelles Feedback schon während der Initialbewegung verarbeitet wird! SPIJKERS & SPELLERBERG (1995): Pbn sollen eine konstant schnelle Handbewegung zu einem Ziel ausführen. Mittels einer PLATO-Brille wird das visuelle Feedback entweder unmittelbar nach Bewegungsbeginn oder kurz vor Erreichen des Ziels für unterschiedlich lange Zeit ausgeblendet. Ergebnis: In Zielnähe hat die Ausblendung des visuellen Feedbacks zwar den stärksten Effekt (10% vor dem Ziel wirken sich stärker aus als 30% nach dem Start); aber auch durch Ausblendung zu Beginn der Bewegung wird deren Genauigkeit reduziert. PAULIGNAN et al. (1991): Verändert man die Position des Ziels mit Bewegungsbeginn, finden sich bereits nach 100 ms kontinuierliche (online) Anpassungen der Initialbewegung an das neue Ziel. => Auch, wenn die Veränderung nicht bewusst bemerkt wird und die sich bewegende Hand nicht gesehen werden kann! Fazit: Die Verwertung exterozeptiven feedbacks erfolgt teilweise diskret, wobei Teilbewegungen aktiviert werden, die rückmeldungsfrei ablaufen („open loop“), teilweise online (closed loop). Welchen Anteil die beiden Komponenten haben, hängt u.a. von der erforderlichen Geschwindigkeit und Genauigkeit der Bewegung ab. Eine strikte Trennung zwischen einer rückmeldungsunabhängigen ersten Phase (open loop) und einer rückmeldungsabhängigen zweiten Phase (closed loop) ist nicht möglich. Höchstens der allererste Teil der Initialbewegung (bis ca. 100 ms) ist primär open loop! Ansonsten: komplexe Verschränkung von open- und closed loop, sowie von internen und externen Regelungsprozessen! 6.2.5. Antizipative Regelung von Bewegungen Die Regelung von Bewegungen wird durch Antizipationsmechanismen effektiviert! Drei solcher Antizipationsmechanismen lassen sich unterscheiden: A) Antizipation von Veränderungen der Ziel- oder Führungsgrößen B) Antizipation des exterozeptiven Feedbacks (“exteroceptive feedforward”) C) Antizipation des propriozeptiven Feedbacks (“proprioceptive feedforward”) A) Zur Antizipation von distalen Führungsgrößen: Trackingversuche: Bei Trackingversuchen bekommen Pbn die Aufgabe; der Trajektorie (Bewegungsbahn) eines sich bewegenden Ziels zu folgen. Variiert wird dabei entweder die Führungsfunktion (Geschwindigkeit / Vorhersehbarkeit der Zielmarke etc.), das visuelle Feedback (Sichtbarkeit von Ziel und Folgepunkt etc.) oder die Übertragung der Bewegungen auf den Folgepunkt (Werkzeugtransformation) Ändert sich die Führungsgröße nach einem sich wiederholenden Muster (Vorhersagbarkeit), nehmen die Abweichungen davon ab. Ergo: Durch die Antizipation der vorgegebenen Bewegungsbahn können die eigenen Bewegungen vorausschauend (und damit genauer und schneller) angepasst werden. 32 B) Zur Antizipation von exterozeptivem (visuellem) Feedback: Exterozeptives feedforward dient vermutlich dazu, exterozeptives feedback zu ergänzen (im Sinne einer dynamischen Führungsgröße) und gegebenenfalls zu ersetzen (für den Fall, dass kein visuelles Feedback verfügbar ist). BARD et al.. (1999): Auch wenn peripheres (exterozeptives und propriozeptives) Feedback gänzlich fehlt, passen sich die Bewegungen unbemerkten Zielveränderungen an. Interne Regelung durch exterozeptives feedforward: Mit Bewegungsbeginn wird eine Repräsentation des zu erwartenden Landeortes der Hand generiert und mit dem gesehenen Zielort verglichen. Bei Nicht-Übereinstimmung des Ziels mit dem antizipierten Landeort der Hand wird vor oder während der Handbewegung eine Korrektur dieser eingeleitet. Zum Vergleich: Bei der externen Regelung (durch exterozeptives feedback) wird der gesehene Zielort mit dem gesehenen (und nicht mit dem antizipierten) Landeort der Hand verglichen. C) Zur Antizipation von propriozeptivem Feedback: Nicht nur das exterozeptive-, sondern auch das propriozeptive Feedback (sprich das Bewegungsgefühl) wird antizipiert und mit dem tatsächlich eintretenden Bewegungsgefühl verglichen. Bei Nichtübereinstimmung werden auf diese Weise schon während der Bewegungsausführung Fehler signalisiert und korrigiert (körperbezogene Bewegungskontrolle). Propriozeptives Feedforward erklärt z.B., warum das Misslingen geübter Bewegungen (z.B. Tennisaufschlag, Tippfehler) schon während der Bewegung (und vor dem Eintreten des Resultats) bemerkt wird. Zusammenfassung: Die sensomotorische Regelung von Bewegungen bzw. Bewegungsabläufen basiert auf 4 Prozessen: 1) Exterozeptives Feedback Führungsgröße ist der gesehene Zielort bzw. bei bewegten Zielen dessen Antizipation; Regelgröße ist die gesehene Position der Hand! 2) Propriozeptives Feedback Führungsgröße ist der gesehene Zielort bzw. bei bewegten Zielen dessen Antizipation; Regelgröße ist die gefühlte Position der Hand! 3) Exterozeptives Feedforward Führungsgröße ist der Zielort bzw. bei bewegten Zielen dessen Antizipation; Regelgröße ist der antizipierte Landeort der Hand! 4) Propriozeptive Feedforward Führungsgröße ist das antizipierte Bewegungsgefühl (propriozeptives feedforward); Regelgröße ist das tatsächlich eintretende Bewegungsgefühl (propriozeptives feedback) 6.2.6. Die Lernabhängige Adaptation von Regelprozessen Die Adaptation von Regelprozessen (z.B. an veränderte Bedingungen durch Verletzung, Muskelabbau etc.) basiert auf 3 Lernmechanismen: 1) Das Erlernen inverser Modelle 2) Das Erlernen von forward Modellen 3) Das Erlernen von Redundanzen in der Dynamik von Zielgrößen 4) Die lernabhängige Verbesserung in der Koordination von externer und interner Regelung 33 Inverse Modelle: Es muss – in Abhängigkeit von den Situationsbedingungen (eigene Verfassung etc.) – gelernt werden, welche efferenten Impulsmuster zu generieren sind, um von einem gegebenen Zustand aus das jeweils angestrebte Ziel zu erreichen. Forward Modelle: Auch die Antizipation des sensorischen Feedbacks muss sich an die variierenden Situationsbedingungen anpassen. Inverse- und Forward Modelle sind situationsabhängige V-E-Assoziationen: S-(VE)-Lernen! Redundanzen: Die Antizipation von Veränderungen der Führungsgröße setzt das Erlernen von Redundanzen voraus: S-S-Lernen Koordination von externer und interner Regelung: Übung unter visueller Kontrolle führt nicht zur Verringerung, sondern zur Verstärkung der Verwertung visueller Rückmeldung. PROTEAU (1987): Regelung und Übung Lernphase: Pbn üben dieselbe Zielbewegung bei visueller Kontrolle entweder 200- oder 2000mal. In der Testphase ohne visuellem feedback sind die Pbn mit 2000 trials schlechter als die mit 200! Die Umsetzung visueller (externer) Informationen in motorische Kommandos kann auf 2 verschiedene Weisen erfolgen. 1) Direkte Umsetzung von distalen Führungsgrößen (externen Zielen) in motorische Kommandos (Efferenzen). In diesem Fall würden Beziehungen zwischen den exterozeptiven Effekten und den motorischen Kommandos (bzw. efferenten Innervationen), die diese bewirkt haben, gelernt werden (E-V-Lernen) Eher unwahrscheinlich, da immer die Ausgangslage (initiale Körperhaltung) berücksichtigt werden muss und die zur Erreichung eines Ziels notwendigen Efferenzen daher sehr variabel sind; außerdem: FINK (s.u.) 2) Umsetzung von distalen Führungsgrößen in propriozeptive Führungsgrößen. FINK (1999): Exterozeptives feedback ≠ propriozeptives feedback Durch eine Spiegelwand wird das exterozeptive feedback so manipuliert, dass es dem propriozeptiven widerspricht (ansynchron): die Vpn haben eine Hand geöffnet-, eine geschlossen, sehen aber bedingt durch die Spiegelwand nur zwei geschlossene Hände. => erhöhte Durchblutung des dorsolateralen präfrontalen Kortex, wo extero- und propriozeptives feedback offenbar miteinander verglichen werden. 34 6.3. Das Programmierungsprinzip 6.3.1. Das Prinzip allgemein Computermetapher (Gehirn als informationsverarbeitendes System): Zielgerichtetes Verhalten wird von erworbenen Programmen (=Software) determiniert, die aufgerufen (in den Arbeitsspeicher kopiert) und entsprechend der aktuellen Bedingungen spezifiziert werden, bevor sie zur Ausführung kommen. Das Programmierungsprinzip besagt, dass Bewegungen durch „motorische Programme“ determiniert werden. Letztere zeichnen sich durch 2 Merkmale aus: 1) werden sie vor der Ausführung festgelegt 2) ermöglichen sie, dass die bestreffende Bewegung ohne peripheres (extero- und propriozeptives) feedback ausgeführt werden kann! 6.3.1. Werden Bewegung tatsächlich vorprogrammiert?! 6.3.1.1. Programmierung von einzelnen Zielbewegungen Die Vorinformationsmethode (precuing): In Wahlreaktionsexperimenten wird vor der Darbietung des imperativen Reizes jeweils ein Hinweisreiz dargeboten, der über bestimmte Eigenschaften (Parameter) der nachfolgend geforderten Reaktion vorinformiert. Annahme: Die Parameter, die bereits durch den Cue festgelegt werden, werden in der Zeit zwischen Cue und Reiz (SOA) vorprogrammiert. Die Verkürzung der RT durch Vorinformation eines bestimmten Parameters entspricht daher der Zeit, die für dessen Programmierung notwendig ist! Tatsächlich führt die Vorinformationsmethode zu kürzeren Reaktionszeiten, und zwar in Abhängigkeit von Anzahl und Art der vorinformierten Parameter! ROSENBAUM (1980): Precuing 8 mögliche Zielbewegungen mit 3 Parametern: Arm (rechts/links), Richtung (vorwärts/rückwärts) und Intensität (nahes -/weites Ziel). UV ist die Anzahl und Art der noch zu spezifizierenden Parameter; AV ist die RT. Je mehr Parameter bereits durch den Hinweisreiz spezifiziert sind, desto niedriger die RT! Die RT ist abhängig von dem noch zu spezifizierenden Parameter; nicht nur die Anzahl der Vorinformationen, sondern auch die Art der Vorinformation hat also einen Einfluss auf die RT! * Insofern liegen die kürzeren Reaktionszeiten nicht bloß an einer schnelleren Reizidentifikation (Hicksches Gesetz), sondern tatsächlich an der Vorprogrammierung der bereits spezifizierten Parameter! Vorprogrammiert werden keine konkreten Muskelinnervationen, sondern abstrakte Bewegungseigenschaften, die sich auf die physikalischen Grunddimensionen Raum, Zeit und Intensität beziehen. Raum: z.B. Zielorte (weit/nah), Bewegungsrichtung etc. Zeit: z.B. schnell/langsam; kurz/lang Intensität: z.B. starke/schwache Kontraktion Räumliche Merkmale: Zuerst vorprogrammiert werden Orte, an denen oder zu denen Bewegungen auszuführen sind. MILLER (1982): hierarchische Vorprogrammierung (Hand => Finger)?! 4 Tasten mit Zeige- und Mittelfinger beider Hände; kurze SOA; variiert wird Art der Vorinformation: Cue 1 (rechte/linke Hand); Cue 2 (Zeigefinger/Mittelfinger) „Neither“-Cue (rechter Mittelfinger, linker Zeigefinger/umgekehrt); kein Cue. Ergebnis: Nur wenn die Hand vorher spezifiziert wird (Cue 1), ergeben sich Vorbereitungseffekte (signifikante Reduktion der RT) 35 Millers (falsche) Interpretation: Hierarchische Vorprogrammierung (Handmotorik wird schneller vorprogrammiert als Finger) REEVE & PROCTOR (1984): Der Ort wird vorprogrammiert Selber Versuchsaufbau; einziger Unterschied: Zeigefinger drücken die mittleren Tasten überkreuz. Dadurch: Dissoziation von Ort und Hand. Ergebnis: Schnellerer Reaktionszeiten nicht beim „Hand“-Cue, sondern beim „neither“-Cue! Interpretation: Nicht die zu innervierende Muskelgruppe (Hand) wird zuerst vorprogrammiert, sondern der Ort des Effektes. Zu einer Verkürzung der RT kommt es deshalb nur, wenn die Orte der auszuführenden Bewegung jeweils paarweise rechts bzw. links nebeneinander liegen. Zeitliche Merkmale: Die Dauer einer Bewegung (kurzer vs. langer Tastendruck) kann unabhängig von den zu innervierenden Muskeln (Zeigefinger vs. Daumen) vorprogrammiert werden. KLAPP (1977): Dauer- vs. Finger-Cue Vpn sollen auf einen Reiz hin eine Taste entweder mit dem Zeigefinger oder dem Daumen kurz oder lang drücken. Einer der beiden Parameter (Finger / Dauer) wird durch einen Cue vorab spezifiziert! Ist ein langer Tastendruck gefordert: normalerweise höhere RT. Aber: Bei vorhergehendem Dauer-Cue: keine RT-Unterschiede. Ergo: Die Dauer einer Bewegung kann unabhängig von der zu innervierenden Muskelgruppe (Finger/Hand) vorprogrammiert werden! Analoge Experimente gibt es zur Intensität einer Bewegung bzw. Kontraktion, die unabhängig davon programmiert wird, ob der Beuger oder Strecker zu innervieren ist. Diskussion: Die Resultate des Vorinformationsparadigmas hängen stark von den experimentellen Bedingungen (Instruktion, Art der Cues, Dauer der SOA (=Zeit zw. Cue und imperativem Reiz) etc.) ab. Die Befunde verschiedener Experimente sind daher kaum miteinander zu vergleichen. Annahmen darüber, wie der Prozess der Programmierung genau abläuft, sind daher mit Vorsicht zu genießen! 6.3.1.2. Programmierung von Bewegungsfolgen A) Die Vorprogrammierung von konkreten Bewegungsfolgen Mit den Annahmen des Programmierungsansatzes konsistent sind der Sequenzlängeneffekt und der Vorinformationseffekt! Sequenzlängeneffekt: Latenzzeiten steigen mit der Länge der auszuführenden Sequenz an. Befunde: Das lässt sich zum Beispiel anhand von Tastensequenzen oder Sprechakten zeigen: Je mehr Tasten hintereinander gedrückt- bzw. je mehr Silben (auf einen imperativen Reiz hin) gesprochen werden müssen, desto länger die Latenzzeit. Interpretation: Der Initiierung einer Bewegungssequenz geht die Vorprogrammierung aller Elemente (Tastenanschläge bzw. Silben) voraus: Daher: Je länger die Sequenz, desto länger der Programmierungsprozess! Vorinformationseffekt: Latenzzeiten (T1) für die Wahl zwischen 2 Sequenzen fallen umso kürzer aus, je mehr gemeinsame Anfangselemente sie haben! Befunde: Ist z.B. zw. den Tastenfolgen zrm und zrM zu wählen, ist die Reaktionszeit schneller, als wenn zw. den Tastenfolgen zrm und Zrm zu wählen ist. Die Inter-Response-Time für die folgenden Tastenanschläge (T2 und T3) erhöht sich für die Tasten, die erst durch das Reaktionssignal bestimmt werden – die also von der alternativen Tastensequenz abweichen (Vorprogrammierung bis zur ersten Unsicherheit). 36 Interpretation: Die Programmierung ist bei Bewegungsbeginn noch nicht abgeschlossen. V.a. bei längeren Sequenzen verlaufen deren Ausführung und die Vorprogrammierung nachfolgender Teilsequenzen parallel! B) Die Vorprogrammierung abstrakter Eigenschaften von Bewegungsfolgen Wie bei einfachen Zielbewegungen (s.o.) werden auch bei Bewegungsfolgen zuerst abstrakte Eigenschaften vorprogrammiert. Zu unterscheiden ist zwischen der Vorprogrammierung… 1) invarianter Zeitstrukturen bei diskreten Bewegungsfolgen (z.B. beim Tippen) 2) invarianter Raum-Zeit-Strukturen bei kontinuierlichen Bewegungsfolgen (z.B. bei Schreiben) 3) invarianter Raumstrukturen bei diskreten Bewegungsfolgen 4) von Wiederholungsmustern bei diskreten Bewegungsfolgen zu 1) Bei diskreten Bewegungsfolgen bleibt die Zeitstruktur (das Verhältnis der Inter-Response-Zeiten) unabhängig von den zu innervierenden Muskeln und der absoluten Ausführungsgeschwindigkeit invariant! Ergo: die Zeitdynamik wird durch ein feststehendes hierarchisches Programm bedingt, das in Form eines Baumdiagramms dargestellt werden kann: Die Inter-Response-Zeiten ergeben sich aus der Anzahl der zu durchlaufenden „Knoten“ (Programmschritte)! Das Programm selbst ergibt sich aus der Struktur der Sequenz! ROSENBAUM et al. (1983): Vpn sollen versch. Tastenfolgen mit Zeige- und Mittelfingern beider Hände üben. Die den Tastenfolgen zugrunde liegende Struktur ist dabei immer dieselbe: 12-12-34-34! Variiert wird die Zuordnung der Finger zu den Ziffern (z.B. ZzZzMmMm, ZMZM,zmzm etc.)! Ergebnis: Es ergibt sich immer das gleiche Profil der Inter-Response-Zeiten! Interpretation: siehe oben! Zu 2) Vorprogrammierung von (invarianten) Raum-Zeit-Strukturen bei kontinuierlichen Bewegungsfolgen! TERZUOLO & VIVIANI (1980): Die zeitlich-räumlichen Verhältnisse zwischen den einzelnen Bewegungen beim Schreiben von Buchstaben (z.B.:„a“) bleibt weitgehend erhalten – unabhängig von der Gesamtzeit und den beanspruchten Muskeln (z.B.: sollte der Buchstabe entweder auf ein Stück Papier oder an die Tafel geschrieben werden; weitere Variante: mit den Füßen oder dem Stift zwischen den Zähnen) Zu 3) Vorprogrammierung von Raumstrukturen bei diskreten Bewegungsfolgen GRAFTON (1998): Transfer von räumlichen Strukturen Die räumliche Struktur einer SRT (serielle Reaktionszeitaufgabe) kann auf verschieden große Keyboards übertragen werden. Ergo: Die räumliche Struktur einer Bewegungsfolge (Zielortsequenz) wird unabhängig von den konkret zu innervierenden Muskeln vorprogrammiert! Zu 4) Vorprogrammierung von Wiederholungsmustern bei diskreten Bewegungsfolgen ZIEßLER, HOFFMANN et al. (1988): Wiederholungsmuster RT-Verkürzung bei Wahlreaktionsaufgaben zw. 2 Sequenzen, die entweder dieselben Anfangselemente (s.o.) oder dieselbe Struktur (Wiederholungsmuster) haben! 37 6.3.2. Sind zielgerichtete Bewegungen ohne peripheres feedback möglich? Motorische Programme sind per definitionem von peripherem feedback unabhängig. D.h., sie können auch ohne exterozeptives und propriozeptives feedback ablaufen (müssen aber nicht!). Dass zielgerichtete Bewegungen auch ohne exterozeptives feedback möglich sind, entspricht unserer Alltagserfahrung: wir können uns zur Not auch im Dunkeln bewegen, mit geschlossenen Augen Streicheln etc. Argumente dafür, dass zielgerichtete Bewegungen auch ohne propriozeptives feedback möglich sind: Bei hoch trainierten und schnellen Bewegungsfolgen (z.B. Tippen, Klavierspielen) kann mangels Zeit kein feedback verwertet werden: Dementsprechend werden sie vermutlich „open loop“ realisiert! Experimente mit deafferentierten Patienten (s.o.: BARD) oder Tieren zeigen, dass, selbst wenn exterozeptives und propriozeptives feedback ausgeschaltet sind, zielgerichtete Bewegungen möglich sind. TAUB, GOLDBERG & TAUB (1975): Deafferentierte Rhesusaffen 1) Deafferentierte Rhesusaffen lernen Zielbewegungen, auch wenn die visuelle Rückmeldung unterbunden wird und sie nur das Ziel, nicht aber ihre Hand sehen (natürlich ist die Genauigkeit geringer und der Lernaufwand größer)! Die Zielinformation kann offenbar direkt in motorische Programme bzw. efferente Kommandos umgesetzt werden, die dann „open loop“ (rückmeldungsunabhängig) ausgeführt werden. Gleichzeitig zeigen die Leistungseinbußen, dass Zielbewegungen gewöhnlich unter Verwertung proprio- und exterozeptiven feedbacks ausgeführt (und geregelt!) werden. 2) Bei nicht deafferentierten Tieren hat die Manipulation der visuellen Rückmeldung nur geringen Einfluss! Bei intakter Propriozeption kann mangelnde Exterozeption ausgeglichen werden: Interne Regelung mit propriozeptivem feedforward als Führungsgröße! 3) Die deafferentierten Tiere verwerten verfügbares visuelles feedback schlechter. Offenbar ist propriozeptives feedback wichtig für die Verwertung des visuellen feedbacks! 6.3.3. Fazit Das Programmierungs- und Regelungsprinzip stehen nicht im Gegensatz zueinander! Es handelt sich lediglich um unterschiedliche Perspektiven: Das Regelungsprinzip bezieht sich vorwiegend auf die Bewegungsausführung (Initial- und Korrekturbewegungen); das Programmierungsprinzip dagegen auf die Prozesse vor Bewegungsbeginn! Vermutlich ist es so, dass die Initiierung und Ausführung einer Bewegung z.T. „openloop“ programmiert-, z.T. „closed-loop“ geregelt wird. Bei der Programmierung werden zielbezogene Efferenzen aktiviert; bei der Regelung extero- und propriozeptive Afferenzen genutzt. Welchen Anteil die beiden Komponenten jeweils haben, hängt davon ab, ob und in welchem Ausmaß peripheres feedback zur Verfügung steht und wie genau und schnell die jeweilige Handlung auszuführen ist. 38 6.4. Theorien zur Handlungssteuerung 6.4.1. Die „Closed-Loop Theory“ von Adams (1971) Lernphase (als Erwerb zielbezogener bewegungsdeterminierender Repräsentationen): Bei jeder Ausführung einer Zielbewegung werden a) die initialen motorischen Impulse und b) die bei der Bewegungsausführung auftretenden sensorischen Rückmeldungen registriert. Wird das Ziel erreicht (KR= Knowledge of result), wird beides gespeichert: Auf diese Weise entstehen einerseits zielbezogene Repräsentationen der initialen motorischen Impulse (memory trace), andererseits zielbezogene Repräsentationen der propriound exterozeptiven sensorischen Rückmeldungen (perceptual trace)! Die memory trace entspricht einem inversen Modell (s.o.)! Die perceptual trace entspricht einem forward Modell (s.o.)! Bewegungsausführung: Bei geübten Zielbewegungen wird zunächst die memory trace reproduziert (recall): Dabei ist die memory trace als motorisches Programm zu denken, das der Auswahl und Initiierung der geforderten Bewegung dient. Mit Beginn der Bewegungsausführung wird die perceptual trace erinnert (recignition). Sie dient als Führungsgröße für die Regelung der korrekten Ausführung: Die perceptual trace wird online (kontinuierlich) mit dem peripheren feedback verglichen (closed loop). Zielvorgabe memory trace initiale Bewegungsimpulse [perceptual trace Bewegungsimpulse] = closed loop Kritik: Wie wird die Assoziation zwischen Ziel (+Situation) und memory trace aufgebaut? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten werden memory- und perceptual trace abstrahiert? 6.4.2. Die Schema-Theorie von Schmidt (1975) Lernphase (als Erwerb von Bewegungsschemata): Bei Bewegungen werden vorübergehend 4 Arten von Informationen gespeichert: 1) Ausgangsbedingungen („initial conditions“) z.B. Körperhaltung und -position; Zielentfernung etc. 2) Motorische Parameter („response specifications“) Welche efferenten Impulse erfordert die Bewegung? 3) Proprio- und exterozeptive Konsequenzen („sensory consequences“) Zu welchem afferenten feedback führt die Bewegung? Sprich: Wie fühlt sie sich an- wie sieht sie aus? Etc. 4) Ergebnis der Bewegung („movement outcome“ bzw. „knowledge of result“) Dauerhaft gespeichert werden jedoch lediglich bestimmte Relationen zwischen diesen Faktoren, genauer: das Recall- und das Recognition-Schema 1) Das Recall-Schema (entspricht einem inversen Modell): bezieht sich auf die Relation zw. den motorischen Parametern und der Art des Effektes 39 (movement outcome) – in Abhängigkeit von den Ausgangsbedingungen (initial conditions) 2) Das Recognition-Schema (entspricht einem forward Modell, das allerdings nicht von der Motorik, sondern vom Ziel und der Ausgangsituation determiniert wird): bezieht sich auf die Relation zw. sensorischem Feedback und der Art des Effektes – in Abhängigkeit von den Ausgangsbedingungen! Recall- und Recognition-Schema werden unabhängig voneinander gebildet. Jede erfolgreiche Bewegung erzeugt einen Datenpunkt mit 3 Koordinaten. Nach mehreren erfolgreichen Bewegungen existieren mehrere Datenpunkte, so dass durch lineare Interpolation eine Relation zwischen diesen gebildet werden kann. Lediglich diese Relation bzw. das durch sie definierte Schema wird bewahrt; die einzelnen Datenpunkte werden wieder gelöscht; sie denen lediglich dazu, die Relation zu spezifizieren bzw. zu justieren. Bewegungsausführung: Bei Initiierung und Ausführung einer „schematischen“ Bewegung (z.B. Korbwurf) aktivieren das Ziel (desired outcome) und die Ausgangsbedingungen via Recall-Schema die erfahrungsgemäß angemessenen motorischen Parameter. Gleichzeitig aktiviert das Recognition-Schema Erwartungen bezüglich der erfahrungsgemäß eintretenden sensorischen Konsequenzen. Die Bewegung kann entweder ausschließlich durch das Recall-Schema initiiert werden (open loop: z.B. bei sehr schnellen Bewegungen) oder parallel dazu mittels Recognition-Schema geregelt werden, indem produzierten sensorischen Konsequenzen kontinuierlich (online) mit den erwarteten verglichen werden (closed loop: wenn genügend Zeit vorhanden ist). Vorteile gegenüber der „Closed loop Theory“: Dass für jede Einzelbewegung eine eigene Repräsentation im Gedächtnis gespeichert wird (Closed loop Theory) ist wenig plausibel. Für die Bildung von generalisierten Schemata spricht… a) dass es einen Transfer von geübten auf noch nie angestrebte Ziele gibt (jemand, der einen Korbwurf aus 5 und 8m geübt hat, ist auch aus 6m besser) b) und dass dieser Transfer durch variables Training (wechselnde Ziele und Ausgangsbedingungen) verbessert werden kann! Kritik: Die Theorie macht zwar Aussagen darüber, wie Schemata durch Erfahrung modifiziert werden; nicht aber wie sie entstehen! Es bleibt offen, nach welchen Kriterien Recognition- und Recall-Schemata abstrahiert werden. Bildet man z.B. ein Schema aufgrund ähnlicher Ausgangsbedingungen oder ähnlicher Ziele, aufgrund ähnlicher motorischer Parameter oder ähnlicher sensorischer Konsequenzen? Wenn alle 4 für das Verhalten relevanten Dimensionen in der Berechnung der Schemata enthalten sein sollen, müssen enorm viele Parameter interpoliert werden; schließlich spielen bei komplexen Bewegungen meist mehrere Ausgangsbedingungen, Muskeln und sensorische Konsequenzen eine Rolle! Darüber hinaus ist nicht davon auszugehen, dass die Beziehungen zw. den einzelnen Parametern immer linear sind! Die Theorie geht davon aus, dass das Recall- und Recognition-Schema unabhängig voneinander sind. Diese Annahme ist jedoch äußerst fragwürdig, da vieles dafür spricht, dass motorische und sensorische Parameter sich wechselseitig bedingen und einander direkt beeinflussen (s.o.): z.B. Modellernen! 40 Vergleich zw. Schema-Theorie und ABC-Theorie (s.o.: Kap.5) Behavio Schema-Theorie Die Antizipation des Ziels aktiviert via Recall-Schema die entsprechenden motor responses und gleichzeitig via RecognitionSchema Erwartungen über sensorische Konsequenzen Recall (Motorik) und Recognition (Sensorik) sind unabhängig voneinander und bilden 2 Grundstrukturen Ausbildung von Schemata als diskontinuierlicher Prozess 4 Info-Arten werden parallel gespeichert Transfer als Interpolation ABC-Theorie Zuerst werden sensorische Konsequenzen antizipiert (Recognition-Schema) und erst dann entsprechende motorische Spezifikationen (Recall-Schema) durchgeführt Motorik und Sensorik sind stark gekoppelt (bilden bidirektionale V-E-Beziehungen) und bilden eine Grundstruktur: S-(V-E) Lernprozess ist kontinuierlich Erst V-E-Einheiten; dann S-(V-E) Transfer kein besonderer Mechanismus 6.4.3. Die behavioristische Theorie (Reflexkettentheorie) Jedes Verhalten / jede Bewegung wird durch Reize (und nicht etwa durch Ziele) determiniert. Gelernt wird nicht, in welcher Situation, durch welches Verhalten welcher Effekt erreicht wird, sondern auf welche Situation welches Verhalten folgt (SR-Lernen). Reflexkettentheorie: S1 => R1 => S2 => R2 => …=> Sn => Rn Kritik: siehe oben; außerdem kann das Modell die flexible Anpassung an wechselnde Bedingungen (Transfer) nicht erklären! MACFARLANE (1930): Schwimmende Ratten Ratten, die gelernt haben, durch ein Labyrinth zu einer Futterbox zu laufen, können denselben Weg auch schwimmen! Offenbar haben sie nicht eine Folge von Bewegungen, sondern eine Folge von zu erreichenden Zielen gelernt. 6.5. Die ideomotorische Hypothese (IMH) 6.5.1. Das ideomotorische Prinzip Die ideomotorische Hypothese geht davon aus, dass beim Lernen bidirektionale VE-Beziehungen aufgebaut werden (Vgl. Kap. 5: ABC-Theorie). Beim zielgerichteten Handeln wird der gelernte Zusammenhang zw. Verhalten und Effekt umgedreht: Die Antizipation des Effektes löst das Verhalten aus! Stimmt der antizipierte Effekt mit dem eintretenden überein, wird die V-EBeziehung verstärkt! Nach der ideomotorischen Hypothese entspricht der Effekt einer Handlung den proprio- und exterozeptiven Reafferenzen, das Verhalten den motorischen Efferenzen. Anders als die Closed loop- und die Schema-Theorie unterscheidet die ideomotorische Hypothese also nicht zwischen Zielen (outcome) und sensorischen Effekten (perceptual trace; recognition schema): Vielmehr ist das Ziel einer Handlung durch deren sensorischen Effekte repräsentiert. Daraus folgt, dass nach der IMH die Antizipation des sensorischen feedbacks nicht nur der Regelung einer Bewegung dient (feedforward), sondern auch deren Auswahl und Initiierung! Während ADAMS und SCHMIDT die memory- und perceptual trace bzw. das recall- und recognition schema jeweils als unabhängige Einheiten betrachten, sind Motorik und Sensorik nach der IMH untrennbar aufeinander bezogen! 41 6.5.2. Empirische Belege Zu zeigen ist, dass Antizipationen sensorischer Effekte nicht nur mit Handlungen einhergehen, sondern deren Initiierung vorausgehen! GREENWALD (1970): Geschriebene und gesprochene Wörter Akustisch oder visuell dargebotene Buchstaben sollen so schnell wie möglich gesprochen oder geschrieben werden. Kürzere RT, wenn die Reizmodalität der Modalität des erwarteten feedbacks entspricht! Ergo: Antizipation der sensorischen Effekte spielt schon vor der Handlungsinitiierung eine Rolle HOMMEL (1996): Reversal- vs- non-reversal Transfer (s.o.) In einer Lernphase erzeugen Reaktionen auf einen Reiz einen kontingenten Effekt (hoher Ton vs. niedriger Ton). In der Testphase geht der Effekt der Reaktion zusammen mit dem Reiz voraus. Kompatible vs. inkompatible ReizEffekt-Zuordnung. Ergebnis: Bei non-reversal Transfer schnellere RT! Interpretation: Reaktionen werden durch die Darbietung ihrer Effekte geprimt! Problem: Nach der IMH sollte nicht die Darbietung des Effektes, sondern dessen Antizipation das Verhalten vorbereiten; ansonsten: zirkuläre Reflexe! KUNDE, HOFFMANN et al. (1999): Auf 4 Farbreize ist jeweils eine von 4 Tasten zu drücken; 2 der Tasten erzeugen einen hohen-, die beiden anderen einen tiefen Ton (Effekt). Ein Cue informiert über den zu drückende Taste vor. Dabei ist der Cue entweder valide und sagt die Taste eindeutig vorher oder invalide, in dem Fall ist eine der 3 anderen Tasten zu drücken. Eine dieser 3 Tasten erzeugt dabei denselben Ton wie die vorangekündigte Taste (corresponding effect), die beiden anderen erzeugen jeweils den anderen Ton (non-corresponding effect). Ergebnis: In der 2. Versuchshälfte erzielen die Vpn in den Durchgängen mit invalidem Cue bei korrespondierendem Effekt kürzere Reaktionszeiten! Interpretation: Cue führt zur Vorbereitung bzw. Programmierung der Reaktion => diese Vorbereitung beinhaltet nicht nur die Antizipation des imperativen Reizes, sondern auch der proprio- und exterozeptiven Effekte (Ton) => durch die Antizipation des Tons wird immer auch die jeweils andere Aktion, die diesen Ton auch erzeugt, vorbereitet! Das Ergebnis tritt erst in der 2. Versuchshälfte auf, weil die Tasten-TonZuordnung erst gelernt werden muss! S-R-Kompatibilitätseffekt: Reize, die Eigenschaften der von ihnen geforderten Reaktionen haben, triggern diese Reaktionen automatisch (z.B. Simon-Effekt) => Bei Geltung der IMH sollte es auch V-E-Kompatibilitätseffekte geben! KUNDE (2001): V-E- Kompatibilitätseffekt Zwei Wahlreaktionen: Bei grün => schwacher Tastendruck; bei rot => starker Tastendruck. UV: Den Reaktionen folgen entweder kompatible oder inkompatible Effekte (lauter- vs. leiser Ton) Ergebnis: Obwohl der Effekt immer erst nach der (Re-)Aktion eintritt, ergeben sich bei kompatibler Aktions-Effekt-Zuordnung kürzere RTs. Ergo: Die Antizipation sensorischer Effekte (hier: Ton) beeinflusst die Verhaltenswahl und -initiierung! Zusatzeffekt: Effekte bzw. deren Antizipation beeinflussen auch die Verhaltensausführung! Konkret: Die antizipierte Intensität des zu erwartenden Effektes (Lautstärke des Tons) wirkt sich gegensinnig auf die Intensität der Aktionsausführung (Stärke des Tastendrucks) aus. 42 6.5.3. Defizite der ideomotorischen Hypothese 1. Die Beziehung zwischen distalen Zielen (z.B. das Licht anmachen) und motorischen Efferenzen (α- und γ-Aktivierungen) ist keineswegs eindeutig! Erstens, gibt es meistens verschiedene Möglichkeiten, ein distales Ziel zu erreichen. Zweitens, kann jede Bewegung unterschiedlichen Zielen dienen und drittens, sind zur Erreichung eines distalen Ziel zahllose Teilbewegungen notwendig! Eindeutige Aktions-Effekt-Beziehungen bestehen also lediglich zwischen efferenten Aktivitätsmustern und propriozeptiven Reafferenzen! Distale (exterozeptiv definierte) Ziele müssen demnach erst in mehrere körperbezogene bzw. proximale (propriozeptiv definierte) Teilziele „übersetzt“ werden, bevor sie das Verhalten im Sinne der IMH determinieren können! 2. Nichtsdestotrotz bleibt offen, wie und warum propriozeptive Ziele letztlich umgesetzt werden. Auch vollständig vorbereitete Handlungen können willentlich „unterdrückt“ werden. Wie hat man sich die Mechanismen des „fiat“ und der „Hemmung“ vorzustellen? 3. Die IMH macht weder Aussagen über situationsabhängiges [S-(V-E)-] Lernen (Vgl. ABC-Theorie), noch über die Generalisierung bzw. den Transfer gelernter V-EBeziehungen (Schema-Theorie)! 6.5.4. Kritische Vergleiche Die ABC-Theorie nimmt die IMH auf und erweitert sie, insofern… …von zwei Lernprozessen ausgegangen (V-E-Lernen und S-(V-E)-Lernen) – …und Aufmerksamkeit als eine Grundvoraussetzung des Lernens angesehen wird! Im Gegensatz zur Closed loop und Schema-Theorie… 1) …unterscheidet die IMH nicht zwischen dem Resultat bzw. Ziel einer Aktion und deren sensorischen Effekten (s.o.)! 2) Nach Adams und Schmidt determinieren die Ziele und Situationsbedingungen die Verhaltensinitiierung (memory trace bzw. recall schema); die Antizipation der sensorischen Effekte (perceptual trace bzw. recognition schema) dient lediglich der Verhaltensregelung! Nach der IMH dient die Antizipation der sensorischen Effekte dagegen auch der Verhaltenswahl und -initiierung! 43 7. Wahrnehmung 7.0. Einleitung Der Mensch verfügt über 7 Sinnessyteme: das visuelle-, das akustische-, das haptische-, das kinästhetische- und ein weiteres vestibuläres System. Unterschieden werden muss zwischen distalen Reizen (außerhalb des Körpers: z.B. Licht- oder Schallwellen) und proximalen (körpereigenen) Reizen (z.B. retinales Bild). Unter Wahrnehmung versteht man allgemein die Abbildung des Physischen auf das Psychische: Distale Reize Proximale Reize neuronale Impulse (Repräsentationen) phänomenale Wahrnehmung 7.1. Was ist die Funktion der Wahrnehmung? 7.1.1. Wahrnehmung dient der korrekten Abbildung der Umwelt Die Abbildungshypothese besagt, dass die Wahrnehmung der korrekten (phänomenalen) Abbildung der distalen Welt dient. In diesem Sinn wird der Wahrnehmungsprozess als Informationsübertragung bzw. –verarbeitung beschrieben. Die Informationstheorie beschreibt den Prozess der Informationsübertragung folgendermaßen: Informationsquelle Nachricht =>Signal Informationsempfänger Empfangssignal => Nachricht Störungen Auf den Wahrnehmungsprozess übertragen: Die Umwelt als Informationsquelle, von der „Nachrichten“ bzw. distale Reize ausgehen. Der Organismus als Informationsempfänger, bei dem die ausgesendeten Nachrichten bzw. Signale als proximale Reize ankommen. Der kognitive Wahrnehmungsprozess besteht darin, die in den proximalen Reizen enthaltene Nachricht zu dekodieren und Störungen zu kompensieren. Ziel ist, dass jedem Zustand der äußeren Welt (Nachricht) ein spezifischer innerer Zustand (neuronale Repräsentation) zugeordnet wird. Ein Problem bei der Dekodierung ist, dass die proximalen Reize nicht immer äquivalent zu den distalen Reizen sind („Störungen“). Die Größe des retinalen Bildes (proximaler Reiz) hängt z.B. nicht nur von der Größe des Objektes (distaler Reiz), sondern auch von dessen Entfernung ab! Ergo: die in der Größe des retinalen Bildes enthaltene Information über die Größe des Objektes wird durch die Entfernung überlagert bzw. gestört. Es gibt zwei Antworten darauf, wie solche „Störungen“ kompensiert werden: 1) Wahrnehmung als Rekonstruktionsprozess (HELMHOLTZ) Es gibt verschiedene Hinweise auf die Struktur der äußeren Welt; in Bezug auf die Größe und Entfernung von Objekten z.B. die Größe des retinalen Bildes und die Augenstellung. Der Wahrnehmungsprozess besteht darin, die einzelnen Hinweise miteinander zu verrechnen („unbewusste Schlüsse“) und dadurch die Struktur der distalen Welt zu (indirekt) rekonstruieren! 44 2) Wahrnehmung von Invarianten (GIBSON) Die Gesamtheit der proximalen Reize bildet die Struktur der distalen Welt eindeutig ab! Störungen werden durch die Wahrnehmung von Invarianten („higher order invariants“) kompensiert (bei der Größenwahrnehmung z.B. die von einem Objekt verdeckte Grundfläche). Kritik an der Abbildungshypothese: 1) Das Resultat eines Prozesses ist nicht notwendigerweise auch dessen Ziel (siehe: Photosynthese)! 2) Die Abbildungshypothese geht davon aus, dass es nur eine Struktur der Welt gibt – und dass es diese (wahre) Struktur ist, die wahrgenommen wird! Ein- und derselbe Reiz kann aber auf verschiedene Weise wahrgenommen werden (siehe: Kippbilder etc.). Unsere Wahrnehmung ist also in hohem Maß subjektiv: Der Empfänger bestimmt welche der Strukturen, die die Welt darbietet, für ihn eine „Nachricht“ sind. 3) Nicht umsonst ist Wahrnehmung artspezifisch. Wahrgenommen werden immer nur die Eigenschaften der Umwelt, die verhaltensrelevant sind. Die evolutionäre Entwicklung der Sinnessysteme dient insofern nicht der Verbesserung-, sondern der Spezialisierung der Wahrnehmung! Fledermäuse sind z.B. darauf spezialisiert, Schallwellen wahrzunehmen, die für die Ortung von Hindernissen relevant sind. 7.1.2. Wahrnehmung dient der Verhaltenssteuerung Die Wahrnehmung dient der Verhaltenssteuerung, genauer: sie dient a) der Antizipation herstellbarer Effekte und der zur Herstellung notwendigen Ausgangsbedingungen und b) dem Vergleich dieser Antizipationen mit den tatsächlich eintretenden Effekten (Reizwirkungen). In diesem Sinne wird Wahrnehmung „gelernt“; sie konstituiert sich erst, indem man sich in irgendeiner Weise zur Umwelt verhält und dadurch auf Kovariationen zw. dem eigenen Handeln und dessen Effekten stößt. Die Struktur der Welt wird nur deshalb erkennbar, weil sie mit dem eigenen Verhalten kovariiert. Anders ausgedrückt: die sensorischen Afferenzen ergeben erst dann Sinn, wenn sie konsistent mit motorischen Efferenzen und/oder propriozeptiven Impulsen einhergehen. Immer wenn ein Säugling den Arm vor seine Augen hält, kommt es zu denselben neuronalen Erregungsmustern: Die mit der Armbewegung einhergehenden efferenten und/oder propriozeptiven Aktivierungen kovariieren mit den afferenten Impulsen des visuellen Systems. Die auf diese Weise entstandene bzw. selbst erzeugte Struktur kann beliebig oft reproduziert werden; sie wird gespeichert und dient von nun an der Verhaltenssteuerung. Die Struktur der distalen Welt wird also weder abgelesen (GIBSON), noch erschlossen (HELMHOLTZ), sondern selbst erzeugt und gelernt. Zwischen Verhalten und Wahrnehmung besteht ein reziproker Zusammenhang: Die Wahrnehmung bedingt das Verhalten und das Verhalten bedingt die Inhalte der Wahrnehmung! Unsere Wahrnehmung wird gleichermaßen durch äußere Reize und unsere verhaltenssteuernden Erwartungen determiniert. Ein solches Verständnis von Wahrnehmung steht keineswegs im Widerspruch zur Abbildungshypothese: Die kortikalen Erregungsmuster kovariieren schließlich nur deshalb miteinander, weil die Welt um uns herum geordnet ist. Insofern repräsentieren sie tatsächlich Eigenschaften der distalen Welt. 45 Im Gegensatz zur Abbildungshypothese wird allerdings behauptet, dass die Repräsentation der distalen Reize a) nur ein Nebenprodukt der Verhaltenssteuerung- und b) auf die verhaltensrelevante Eigenschaften dieser Reize beschränkt ist! Ziel des ZNS ist es nicht, die Umwelt möglichst adäquat abzubilden, sondern angenehme Zustände zu erreichen und unangenehme zu vermeiden; allein zu diesem Zweck werden Aktions-Effekt-Beziehungen gelernt! Welche Wahrnehmungen sind zur antizipativen Verhaltenssteuerung notwendig bzw. welche Eigenschaften der distalen Welt sind verhaltensrelevant? 1) Zusammengehöriges (Entitäten bzw. Objekte) muss aus dem Chaos der Reize extrahiert werden. 2) Entitäten bzw. Objekte müssen wenigstens insoweit zu unterschieden werden, als sie eine unterschiedliche „Behandlung“ erfordern. Siehe Kap.9: Begriffsbildung 3) Der egozentrische Ort der handlungsrelevanten Entitäten ist zu bestimmen. Zu 1) Woher weiß das Gehirn, welche distalen Reize bzw. afferenten Impulse zusammengehören und welche nicht? Wie erkennen wir Objekte? Heuristik 1: „Integriere, was sich gemeinsam bewegt bzw. verändert!“ Gestaltgesetz des gemeinsamen Schicksals Siehe: Kap. 7.2 Heuristik 2: „Integriere benachbarte gleichartige Aktivierungen!“ Schließlich gehen von Objektoberflächen in der Regel homogene Reizwirkungen aus. Siehe: Kap. 7.3 7.2. Bewegungswahrnehmung: Integration gleichartiger Bewegungen 7.2.1. Allgemeines: Die Bewegungswahrnehmung ist essentiell für das Überleben; sie ist eine Möglichkeit, Objekte aus der Vielfalt der Reizwirkungen herauszulösen und als Entitäten wahrzunehmen (siehe: Heuristik 1). Es gibt richtungsspezifische Bewegungsdetektoren, d.h. Neuronen, die nur dann aktiviert werden, wenn die räumlich verteilten Rezeptoren auf der Retina in einer bestimmten Reihenfolge (z.B. von rechts nach links) aktiviert werden. Feuern richtungsgleiche Neuronen verschiedener rezeptiver Felder synchron, werden diese synchronen Aktivierungen verbunden, so dass in der Wahrnehmung das, was auf den verschiedenen rezeptiven Feldern abgebildet ist und sich gleichsinnig bewegt, als zusammengehörend erscheint. Kurz: Synchrone Aktivierungen von richtungsgleichen Bewegungsdetektoren werden integriert! Bewegungsnacheffekte (z.B. der „Wasserfalleffekt“ oder die „Exner Spirale“): Fixiert man über eine längere Zeit einen Wasserfall und wendet sich dann plötzlich einem anderen (unbewegten) Gegenstand zu, macht dieser den Eindruck sich in die Gegenrichtung zu bewegen. Erklärung: Der Eindruck von Bewegung entsteht dann, wenn die Aktivitäten einander entgegengesetzter Bewegungsdetektoren ungleich sind. Nach anhaltender Reizung sinkt die Aktivität von Bewegungsneuronen unter die Spontanaktivität („neuronale Ermüdung“), wodurch es zu einem kurzfristigen Ungleichgewicht kommt. 46 7.2.2. Die Unterscheidung von Objektbewegung und Eigenbewegung Das Problem: Dieselben proximalen (retinalen) Bildbewegungen können durch Objektbewegungen oder eigene Bewegungen hervorgerufen sein. Objektbewegungen müssen also von Eigenbewegungen unterschieden werden können! Das Problem gilt nicht nur für die Bewegungswahrnehmung: Jede Aktion des Organismus führt zu einer Veränderung des sensorischen Inputs! Die Erklärungsversuche: GIBSON („higher order invariants“): Die retinale Reizung enthält alle notwendigen Informationen, um zwischen Eigen- oder Objektbewegung zu unterscheiden (s.o.). Bei Objektbewegungen verschiebt sich lediglich das Objektbild auf der Retina; bei Augenbewegungen verschiebt sich dagegen das gesamte Retinabild (dem entspricht, dass wir z.B. das langsame Anfahren eines Nachbarzuges als Eigenbewegung wahrnehmen). Problem: Obwohl die Verschiebung eines homogenen Hintergrunds auf der Retina nicht bemerkt werden kann, unterscheiden wir auch bei homogenem Hintergrund zw. Eigen- und Objektbewegung (z.B. wenn wir im blauen Himmel eine Wolke sehen). Ergo: Neben der retinalen Information nutzen wir offenbar auch extraretinale Informationen zur Interpretation von Bewegungen HELMHOLTZ („unbewusste Schlüsse“): Wir verwerten extraretinale Informationen (v.a. die Augenbewegung), setzen sie zur retinalen in Beziehung und rekonstruieren auf diese Weise die Objektbewegung! Wir werden auf 2 Arten über unsere Augenbewegung informiert: 1) Durch die motorischen Kommandos bzw. Efferenzen (Outflow Modell) 2) Durch die propriozeptiven Afferenzen der Augenmuskulatur (Inflow Modell) Beide Modelle kommen zu jeweils unterschiedlichen Vorhersagen. Als richtig erwiesen haben sich dabei die Vorhersagen des Outflow Modells: Bewegung wird nur dann wahrgenommen, wenn das efferente Kommando nicht mit den retinalen Konsequenzen übereinstimmt. Dementsprechend wird bei passiver Augenbewegung durchaus Bewegung wahrgenommen (Efferenz: nein / Propriozeption: ja / retinale Bewegung: ja)! Ein Nachbild wird bei passiver Augenbewegung dagegen nicht als bewegt wahrgenommen (Efferenz: nein / Propriozeption: ja / retinale Bewegung: nein)! Blickintentionen bei gelähmter Augenmuskulatur führt zur Wahrnehmung von Bewegung (Efferenz: ja / Propriozeption: nein / retinale Bewegung: nein)! Auch wenn die Augen einem bewegten Objekt folgen, wird dieses als bewegt wahrgenommen (Efferenz: ja / Propriozeption: ja / retinale Bewegung: nein)! Letzteres sagt allerdings auch das Inflow Modell vorher. 7.2.3. Das Reafferenzprinzip Vorab einige Begriffe: Efferenz: zentralnervöse Befehle an die Muskeln (absteigende Nervenimpulse) Afferenz: Rückmeldung aus der Peripherie an das ZNS (aufsteigende Nervenimpulse) Reafferenz: Rückmeldung der Peripherie, die durch efferente Kommandos verursacht wurde – und deshalb vorhersehbar ist (Efferenzkopie/feedforward) Exafferenz: Erwartungswidrige Rückmeldung aus der Peripherie (wenn: Efferenzkopie ≠ Reafferenz); ausgelöst durch sensorische Reizung Efferenzkopie: Erwartung bzw. Antizipation der (selbst ausgelösten) Reafferenz 47 Das Reafferenzprinzip beschreibt den physiologischen Mechanismus, der dem Outflow Modell zugrunde liegt. Es besagt, dass sich Efferenzkopie und Reafferenz gegenseitig genau aufheben. Die Reafferenz entspricht der durch die Augenbewegung ausgelösten Bildbewegung auf der Retina. Letztere wird durch die Efferenzkopie antizipiert. Stimmen die antizipierten (Efferenzkopie) Bildverlagerungen mit den eintretenden (Reafferenz) überein, wird keine Bewegung wahrgenommen; bleibt dagegen eine Differenz, wird diese als Bewegung (Exafferenz) wahrgenommen. Efferenz Augenbewegung Efferenzkopie Reafferenz & Exafferenz Wahrnehmung der Exafferenz Das Reafferenzprinzip entspricht dem Gedanken des feedforward (s.o.); allerdings dient das feedforward der Bewegungsregelung; die Efferenzkopie der Bewegungswahrnehmung. Problem der Inkommensurabilität: Die Efferenzkopien müssen irgendwie in die zu erwartenden Reafferenzen übersetzt werden. Ist diese Übersetzung angeboren oder wird sie im Sinne von V-E-Beziehungen gelernt (auf diese Efferenz folgt jene Reafferenz)? 7.2.4. Erweiterung des Reafferenzprinzips Es gibt eine lernabhängige Adaptation der Wahrnehmung an veränderte EfferenzReafferenz (V-E-) Beziehungen! Ergo: Der Zusammenhang zwischen Efferenz (Augenbewegung) und retinaler Reafferenz (Bildbewegung) wird gelernt; es handelt sich dabei um eine V-E-Beziehung. FESTINGER (1967): Prismenlinsen und „rubbery-effects“ Durch Prismen-Kontaktlinsen wird die visuelle Wahrnehmung der Pbn verzerrt. Eine gerade Linie, auf der sich Figuren befinden, wird gekrümmt gesehen; bei Augenbewegungen kommt es zu „rubbery effects“: die Figuren scheinen sich zu bewegen (antizipierte und eintretende Reafferenz stimmen nicht mehr überein). Ergebnis: Je länger die Pbn die Linie „scannen“, desto gerader nehmen sie sie wahr, die „rubbery effects“ verschwinden. Interpretation: Das Ergebnis entspricht den Annahmen des Reafferenzprinzips! Durch die Prismen werden die Efferenz-ReafferenzBeziehungen verändert. Um die Figuren entlang der scheinbar gekrümmten Linie (retinales Bild) zu fixieren, müssen sich die Augen gerade bewegen. Es kommt zu einer Diskrepanz zwischen den efferenten Kommandos und dem Sinneseindruck bzw. zw. den erwarteten- und den tatsächlichen eintretenden Reafferenzen; deshalb werden zunächst distale Bewegungen wahrgenommen (rubbery effects). Die Tatsache, dass sich das visuelle System mit der Zeit an die veränderten Verhältnisse zw. visuellem Input und motorischem Output anpasst, spricht dafür, dass…: 1) die Beziehungen zw. efferenten Kommandos und sensorischer Rückmeldung (Reafferenz) nicht angeboren sind, sondern im Sinne bidirektionaler V-E-Beziehungen gelernt werden. Ob sich dabei die antizipierten Reafferenzen (Eant) oder die motorischen Efferenzen (V) zuerst anpassen, kann durch das Experiment nicht geklärt werden! 48 2) Primat des Verhaltens: Die motorischen Kommandos bestimmen die Wahrnehmung (der Linie); die Adaptation der Augenbewegung an veränderte V-E-Beziehungen führt zur Adaptation der Wahrnehmung. Letzteres ist zwar plausibel, kann aber durch das Experiment nicht eindeutig geklärt werden. Es könnte genauso gut sein, dass sich erst die Wahrnehmung bzw. die antiziperte Reafferenz anpasst und dann das Verhalten (die Efferenz)! HAJOS & FEY (1982): Anpassung der Efferenzen! Pbn sollen zwei Punkte auf einem Bildschirm alternierend fixieren. Während der Willkürsakkaden (Augenbewegungen) werden die beiden Punkte systematisch verlagert, z.B. indem beide Punkte um jeweils 10 Grad nach rechts verschoben werden. Obwohl die Verschiebungen nicht bemerkt werden (Wahrnehmung), passen die Sakkaden sich ihnen an (Verhalten): Die Sakkade nach rechts wird verlängert (Overshoot), die Sakkade nach links verkürzt (undershoot)! Dabei werden undershoots (nach links) schneller gelernt als overshoots (nach rechts); die Adaptation ist also nicht das Resultat einer „Koordinatenverschiebung“ => die Efferenz passt sich an die antizipierte Reafferenz an, nicht umgekehrt! Entscheidend für die Wahrnehmung ist nicht die Efferenz, sondern die aufgrund von ihr erwartete bzw. mit ihr intendierte Reafferenz (=Efferenzkopie). Solange letztere mit der tatsächlich eintretenden Reafferenz übereinstimmt, wird keine Bewegung wahrgenommen (s.u.). HEIN & HELD zufolge stehen die Beziehungen zwischen Efferenzen und Reafferenzen keineswegs fest, sondern werden gelernt. Dementsprechend erweitern sie das Reafferenzprinzip um eine Lernkomponente, den sog. „Korrelationsspeicher“. In ihm ist festgehalten, welche Efferenz erfahrungsgemäß zu welcher Reafferenz führt. Der „Korrelationsspeicher“ enthält also die Efferenzkopien, die ihrerseits nicht den erzeugten, sondern den erwarteten bzw. intendierten Reafferenzen entsprechen! Daraus folgt: 1) Unsere Wahrnehmung wird nicht nur durch die efferenten und afferenten Impulse selbst-, sondern auch durch den erwarteten Zusammenhang zwischen diesen Impulsen bestimmt (Korrelationsspeicher)! 2) Letzterer muss im Sinne einer bidirektionalen V-E-Beziehung erst gelernt werden. Ein solcher Lernprozess setzt Verhalten voraus. Ergo: Ohne Verhalten kommt keine korrekte Wahrnehmung zustande! Das Korrelationsprinzip erklärt zwar, wie Efferenz-Reafferenz-Kovariationen gelernt werden (V=>Ereal), nicht aber, wie die gelernten Zusammenhänge auf die Efferenz zurückwirken (Eant =>V). Die ABC-Theorie: Da Sakkaden ballistische Bewegungen sind, können sie nicht online geregelt werden. Die Efferenzkopien (Eant) erfüllen daher eine andere Funktion als das feedforward. Sie dienen nicht der Regelung, sondern der Auswahl und Initiierung einer Bewegung (ideomotorisches Prinzip)! Der Unterschied zwischen dem Reafferenzprinzip und der ABC-Theorie besteht v.a. in der kausalen und zeitlichen Abfolge: Reafferenzprinzip: Efferenz => Efferenzkopie => Vergleich zw. Efferenzkopie und Reafferenz ABC-Theorie: Antizipation der Reafferenz => Efferenz => Vergleich zw. antizipierter und eingetretener Reafferenz (bei Diskrepanz: Bewegungswahrnehmung oder Anpassung des Verhaltens und der Wahrnehmung) 49 Fazit: Bewegungswahrnehmung ist nicht nur reizgetrieben (bottom up = induktiv), sondern durch handlungssteuernde Erwartungen mitbedingt (top down = deduktiv). Das bestätigt die These, dass Wahrnehmung nicht der Widerspiegelung, sondern der Verhaltenssteuerung dient! 7.2.5. Die Erkennung von Bewegungsmustern Die Wahrnehmung von Bewegung dient nicht nur der Herauslösung von Entitäten aus der Vielfalt der Reizwirkungen (s.o.), sondern gleichzeitig deren individueller Identifikation: Wir erkennen Objekte anhand der von ihnen erzeugten raumzeitlichen Bewegungsmuster! Die raumzeitliche Bewegungsrelation zwischen Leuchtpunkten - z.B. in der Mitte und am Rand eines Rades - lässt uns im Dunkeln das Rad erkennen, obwohl wir lediglich zwei sich bewegende Punkte sehen. Auf diese Weise erkennen auch einen sich bewegenden Menschen, wenn an den entsprechenden Stellen (an Schultern, Hüften, Ellbogen, Knien und Füßen) Leuchtpunkte angebracht sind. Die Bewegungswahrnehmung wird durch Reize (stimulus driven), Erwartungen (top down) und die aktuelle Handlungsintention (intentionality driven) bestimmt. Das Phi-Phänomen (WERTHEIMER): Alternierend dargebotene Reize (z.B. 2 nebeneinander liegende Streifen) erzeugen bei hinreichend kurzen Zeitintervallen den Eindruck von Bewegung (=Scheinbewegungen)! Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile! WOHLSCHLÄGER (2000): mehrdeutige Scheinbewegung Den Pbn werden alternierend jeweils 6 kreisförmig angeordnete Punkte um 30 Grad gedreht dargeboten. Dabei handelt es sich um eine mehrdeutige Scheinbewegung: die einen meinen, der Kreis dreht sich rechts rum, die anderen, links rum. Ergebnis: Sollen die Pbn parallel dazu einen Schalter drehen, passt sich die Wahrnehmung der Handlung an; das gilt sogar, wenn die Handlung erst nach Betrachtung der Scheinbewegung ausgeführt werden soll. Ergo: Die Wahrnehmung von mehrdeutigen Scheinbewegungen hängt von der Handlungsintention ab! 7.3. Integration gleichartiger Aktivierungen 7.3.0. Allgemeines Objekte werden nicht nur durch die Integration gleichsinniger Bewegungen herausgelöst und unterschieden, sondern auch durch die Integration gleichartiger Aktivierungen und die Verstärkung von Konturen (siehe: Heuristik 2). Objektoberflächen reflektieren unterschiedliche Anteile des Lichts (Farbqualität) in unterschiedlichem Umfang (Farbintensität); dadurch heben sie sich von ihrem jeweiligen Hintergrund und untereinander ab. Die Unterschiede in Qualität und Intensität des reflektierten Lichts führen nämlich zu einer diskontinuierlichen Reizung der Retina. Die Retina ist eine leicht gekrümmte Fläche, die etwa 120 Millionen Stäbchen und 6 Millionen Zapfen enthält. Die Stäbchen sind v.a. für die Intensitätswahrnehmung (hell-dunkel) zuständig; die Zapfen für die Wahrnehmung von qualitativen Unterschieden (Farben). In der Fovea: keine Stäbchen; viele Zapfen; im unmittelbaren Umfeld der Fovea: hohe Stäbchenkonzentration; zur Peripherie hin: zunehmend weniger Stäbchen und noch weniger Zapfen 50 7.3.1. Intensitätswahrnehmung und Kontrastverstärkung Laterale Hemmung: Durch verschiedene Lichtreize unterschiedlich stark aktivierte Neuronen hemmen sich gegenseitig. Dabei ist die Hemmung proportional abhängig von der Intensität der Erregung in den hemmenden Fasern und von deren Abstand. Dadurch werden Helligkeitskontraste an den Rändern verstärkt. Merke: Je heller ein Reiz, desto stärker feuern die durch ihn aktivierten Neuronen. Hermanngitter: An den Kreuzungspunkten werden dunkle „Flecken“ gesehen, weil jeweils die Mitte der Kreuzungen die meiste laterale Hemmung erhält. => An der Kreuzung, die man fixiert, kein „Fleck“, da in der Fovea keine intensitätssensitiven Stäbchen! Helligkeitsfeldkontrast: Die wahrgenommene Helligkeit einer Fläche hängt von der Umgebung ab. Ein graues Quadrat erscheint vor einem hellen Hintergrund dunkler als auf einem hellen, da vom hellen Hintergrund eine stärkere laterale Hemmung ausgeht! Laterale Aktivierung: ist ein ergänzender Mechanismus zur lateralen Hemmung, durch den Flächen von den Rändern aus homogenisiert werden, indem Aktivierungen von dort nach innen weitergeleitet werden. Craik-Täuschung: Gleich graue Felder, die sich lediglich dort, wo sie zusammenstoßen in ihrer Helligkeit unterscheiden, werden unterschiedlich grau wahrgenommen. 7.3.2. Farbwahrnehmung Objektoberflächen reflektieren bzw. absorbieren Licht unterschiedlicher Wellenlänge unterschiedlich stark (additive Farbmischung). Die Dreifarben-Theorie von YOUNG & HELMHOLTZ: Man braucht mindestens 3 Farben, um jeden beliebigen Farbeindruck mischen zu können. Tatsächlich gibt es 3 Zapfentypen, die auf kurz- (blau), mittel(grün) und langwelliges Licht (rot) jeweils unterschiedlich reagieren. Je nachdem, wie die Erregungen der unterschiedlichen Zapfentypen zueinander im Verhältnis stehen, ergeben sich unterschiedliche Farbeindrücke. Entscheidend ist das Verhältnis, nicht die Intensität der Erregungen! Obwohl sich tatsächlich drei Zapfentypen mit jeweils unterschiedlichen Sehfarbstoffen unterscheiden lassen, bringt die trichromatische Theorie Probleme mit sich: 1) Farbspezifische Nachbilder (rot erzeugt grünes-, gelb erzeugt blaues Nachbild) 2) Farbsimultankontraste (an roten Rändern entsteht eine grünliche-, an blauen Rändern eine gelbliche Kontur) 3) Rot-Grün-Blindheit (rotblinde Menschen sind immer auch grünblind) Die Gegenfarbentheorie von HERING: Nach HERING gibt es 3 Mechanismen, die jeweils auf spezifische Gegenfarben entweder mit dem Abbau (-) oder Aufbau (+) einer bestimmten chemischen Substanz reagieren: 1) Schwarz (-) Weiß (+) 2) Grün (-) Rot (+) 3) Blau (-) Gelb (+) Integration der beiden Ansätze: Den farbspezifischen Zapfensystemen sind Neuronen nachgeschaltet, die je nach Wellenlänge entweder gehemmt oder aktiviert werden. 51 Die Farbwahrnehmung ergibt sich also aus dem Aktivitäts-Verhältnis antagonistischer Neurone. Diese sog. Gegenfarbenzellen befinden sich im Kortex, dort v.a. im Corpus geniculatum laterale. Die zusätzliche (kortikale) Verschaltung der Farbmeldungen dient vermutlich der Kontrastverstärkung zwischen verschiedenen Lichtqualitäten bei gleicher Helligkeit! 7.3.3. Konstanzphänomene Das von beleuchteten Objekten ausgehende Licht wird nicht nur von ihren jeweiligen Oberflächen, sondern auch von der Beschaffenheit des sie beleuchtenden Lichts bestimmt. Die im proximalen Reiz enthaltene Information über Objektoberflächen wird also durch Informationen über die Leuchtquelle überlagert (gestört). Trotzdem gibt die Wahrnehmung primär Oberflächeninformationen wieder: Helligkeitskonstanz: Ein Stück Kohle in der Sonne erscheint uns schwarz, ein Stück Kreide im Keller weiß, obwohl letzteres im direkten Vergleich weniger Licht reflektiert! Farbkonstanz: Trotz rot getönter Sonnenbrille (oder z.B. monochromatischer Beleuchtung) nehmen wir Objekte schon nach kurzer Zeit wieder in ihren natürlichen Farben wahr. Die konstante (d.h. von den Lichtverhältnissen unabhängige) Wahrnehmung von Helligkeit und Farbe wird durch einen retinalen und einen kortikalen Mechanismus sichergestellt. Retinal: Stäbchen und Zapfen adaptieren an die vorherrschenden Lichtverhältnisse. Dabei gilt: Zapfen adaptieren schnell, aber schwach-, Stäbchen langsam-, aber stark (Kohlrausch-Knick). In der Dunkelheit erhöht sich die Sensitivität der Stäbchen/Zapfen; bei grellem Licht (Mittagssonne etc.) sinkt sie. Bei einer roten Sonnenbrille z.B. adaptieren selektiv die für langwelliges Licht (rot) sensiblen Zapfen. Kortikal: Durch die selektive Adaptation der Rezeptoren bleiben die neuronalen Aktivierungsverhältnisse gleich! 7.3.4. Der Einfluss von Erwartungen Die Wahrnehmung von Helligkeiten und Farben wird nicht nur durch die Eigenschaften der distalen bzw. proximalen Reize bestimmt (bottom up), sondern auch durch Erwartungen (top down)! Beim Kanisza-Dreieck handelt es sich um eine Scheinkontur. Die Konfiguration der Reize führt beim Betrachter zu der Erwartung, dass diese durch Abdeckung mit einem Dreieck entstanden ist. Die Erwartung wiederum führt zu einer Konturverstärkung an den erwarteten Objekträndern. Wertheimer-Täuschung: Obwohl beide Dreiecke gleich grau sind und das gleiche Umfeld haben, wird das Dreieck im Kreuz heller gesehen als das Dreieck am Kreuz. Innerhalb des Kreuzes erwartet man dieselbe OberflächenDunkelheit, im Umfeld des Kreuzes dieselbe Hintergrund-Helligkeit. Im Vergleich zu diesen Erwartungen erscheint das Dreieck im Kreuz heller, das Dreieck am Kreuz dunkler. Schachbretttäuschung nach Adelson: Betrachtet man ein Schachbrett, auf das ein Schatten fällt, nimmt man ein vermeidlich „weißes“ Feld im Schatten heller wahr, als ein schwarzes Feld außerhalb des Schattens. In Wirklichkeit sind jedoch beide Felder gleich dunkel! 52 Farbwahrnehmung: Den Pbn werden verschiedene Formen aus orange-roter Pappe vorgelegt (z.B. Herz, Kirsche, Apfel); auf einem Vergleichsfeld sollen sie den Rotanteil jeweils so einstellen, dass sie die gleiche Farbe sehen. Für Objekte, die normalerweise rot sind, wird ein höherer Rotanteil eingestellt. Die Farbwahrnehmung wird also an die zu erwartende Farbe angepasst! IVO KOHLER (1956): halbseitig in Gegenfarben eingefärbte Brillengläser; wenn die Pbn nach links schauen, sehen sie alles grün-, wenn sie nach rechts schauen, alles rot eingefärbt. Obwohl beim Blick nach rechts und links jeweils dieselben Rezeptoren betroffen sind, eine Adaptation der Zapfen also ausgeschlossen werden kann, sehen die Pbn ihre Umwelt nach einiger Zeit wieder in den Normalfarben. Diese „doppelgleisige“ Adaptation hängt vermutlich mit den Augenbewegungen zusammen: Je nach Richtung der Augenbewegung erwartet man eine spezifische Verfärbung (antizipierte Reafferenz), stimmt die eintretende mit der erwarteten Verfärbung überein, wird keine Verfärbung wahrgenommen. Fazit: Der subjektive Eindruck bzw. die Wahrnehmung wird letztlich durch den Vergleich zwischen erwarteten und eintretenden Reizwirkungen bestimmt. Die Art der Erwartungen hängt von der gegebenen Reizkonfiguration (z.B. Formeigenschaften) oder den Handlungen des Wahrnehmenden (z.B. Augenbewegung) ab! 7.4. Bestimmung von Lokationen und Entfernungen 7.4.1. Die Lokation fixierter Objekte Da sich nur in der Fovea hinreichend viele Photorezeptoren bzw. Zapfen befinden (Auge = miserable Kamera), müssen wir Objekte fixieren, um sie scharf zu sehen: Das retinale (proximale) Bild des fixierten Objektes muss in beiden Augen auf die Fovea fallen. Fixation geschieht durch Konvergenz der Blicklinien und die Akkomodation der Linsen (Einstellung der Brechkraft). Konvergenz: Die Augen sind dann konvergent ausgerichtet, wenn sich die beiden Blicklinien (durch den Drehpunkt und die Fovea) im Fixationspunkt schneiden. Konvergenz und Akkomodation ermöglichen jedoch nicht nur eine optimale Reizverarbeitung, sondern liefern darüber hinaus Informationen über die egozentrische Lage des fixierten Objektes (=okulomotorische Tiefencues)! Konvergenz: Die Augenstellung und der Vergenzwinkel (Drehung der Augen nach innen) geben Auskunft über Richtung und Entfernung des fixierten Objekts in Relation zum eigenen Körper bzw. Kopf. Je größer der Vergenzwinkel, desto näher das fixierte Objekt! Akkomodation: Die eingestellte Brechkraft der Linsen liefert zusätzliche Infos über die Entfernung! 53 7.4.2. Die Lokation nicht fixierter Objekte A) Richtungswahrnehmung Die distalen Objekte werden auf der Retina kopfstehend und seitenverkehrt abgebildet. Ein Objekt, das sich links vom fixierten Objekt befindet, wird rechts der Fovea abgebildet. Um es zu fixieren, müssen wir unsere Augen nach links bewegen. Dort wird es auch wahrgenommen. Ergo: Nicht die Lage auf der Retina bestimmt unsere Wahrnehmung, sondern die zur Fixation notwendigen Augenbewegungen. Die relative Lage nicht fixierter Objekte zum fixierten Objekt entspricht dabei der relativen Lage ihrer proximalen Abbildungen zur Fovea! B) Entfernungswahrnehmung In Bezug auf retinale Tiefenkriterien kann zwischen monokularen und binokularen Tiefencues unterschieden werden. 1. Binokulare Tiefencues: Disparität Objekte, die auf dem empirischen Horopter liegen, die also in etwa gleichweit vom Betrachter entfernt sind wie das fixierte Objekt, werden auf korrespondierenden Netzhautstellen abgebildet: D.h. ihr proximales Abbild hat in beiden Augen die gleichen Koordinaten bzw. die gleiche Lage zur Fovea. Dementsprechend müssen die Blicklinien korrespondieren, um nacheinander gleich weit entfernte Objekte zu fixieren. Ein Objekt, das in derselben Entfernung rechts vom Fixationspunkt liegt, wird in beiden Augen rechts von der Fovea abgebildet. Um es zu fixieren müssen sich beide Augen in dieselbe Richtung bewegen. Objekte, die vor oder hinter dem Horopter liegen, die also entweder näher oder weiter entfernt sind als das fixierte Objekt, werden auf querdisparat verschobenen Netzhautstellen abgebildet. Dabei gilt: Je größer die Querdisperation, desto weiter entfernt sind die Objekte vom Horopter bzw. dem Fixationspunkt. Von Objekten hinter dem Fixationspunkt entstehen ungekreuzte Doppelbilder: im rechten Auge wird das Objekt rechts vom Fixationspunkt, im linken Auge links vom Fixationspunkt gesehen. Um diese Doppelbilder zu integrieren, ist eine heteronyme Attraktion erforderlich: das Bild vom rechten Auge muss nach links-, das Bild vom linken Auge muss nach rechts verschoben werden. Um das Objekt zu fixieren, müssen die Blicklinien divergieren (auseinander gehen). Für Objekte vor dem Fixationspunkt ist es umgekehrt: ungekreuzte Doppelbilder => homonyme Attraktion; konvergierende Blicklinien zur Fixation. Empirische Befunde: Wenn Vpn durch ein Stereoskop zwei identische querdisparat verschobene Figuren vor homogenem Hintergrund dargeboten bekommen, nehmen sie diese je nach Art der Querdisparation (ungekreuzte vs. gekreuzte Doppelbilder) vor bzw. hinter dem Hintergrund wahr. Das gilt auch für Zufallsmuster („magic eye“); der durch Querdisparation erzeugte Tiefeneindruck ist also unabhängig von Konturen! Die der binokularen Tiefenwahrnehmung zugrunde liegende Heuristik lautet offenbar: Integriere Reizanordnungen, die die gleiche Querdisparation aufweisen! 54 2. Monokulare bzw. empirische Tiefencues Verdeckung: das verdeckende Objekt wird vor dem verdeckten gesehen Relative Höhe zum Horizont: Unter dem Horizont gilt: je höher im Bild, desto weiter weg; über dem Horizont ist es dagegen umgekehrt. Licht-Schatten-Verteilung Atmosphärische Perspektive: durch Luftverschmutzung werden entfernte Objekte weniger scharf abgebildet (anders bei Fön) Perspektivische Verkürzung: Parallele Linien konvergieren zu einem Fluchtpunkt Größe: Bei sonst gleichen Bedingungen wird das kleinere von 2 Objekten weiter entfernt gesehen. Bewegungs- bzw. Ortsparallaxe: Wird bei Eigenbewegung ein Objekt fixiert, scheinen sich vor dem Objekt liegende Objekte entgegengesetzt und hinter dem Fixationspunkt liegende Objekte mit einem mit zu bewegen. Bei Eigenbewegung ohne Fixation scheinen sich entfernte Objekte langsamer in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen als nahe. Fazit: Die monokularen Tiefencues zeigen, dass auch die Wahrnehmung von Entfernungen durch empirische Erwartungen beeinflusst wird. 7.4.3. Größenkonstanz Die proximale Bildgröße hängt nicht nur von der Größe des abgebildeten Objekts, sondern auch von dessen Entfernung (Störgröße) ab! Trotzdem sehen wir ein und dasselbe Objekt in unterschiedlicher Entfernung in konstanter Größe. Die Größenkonstanz kann mithilfe der „Herstellungsmethode“ empirisch geprüft werden. Dabei wird Pbn in einer bestimmten Entfernung ein Quadrat (S) gezeigt; in halber Entfernung wird ein weiteres Quadrat (V) projiziert, dessen Kantenlänge vom Pbn so einzustellen ist, dass seine wahrgenommene Größe der des entfernteren Quadrates entspricht. Wird V = S eingestellt, ist die Größenkonstanz optimal; wird V = S* eingestellt, besteht Gleichheit der Wahrnehmung bei Gleichheit der retinalen Abbilder (GK = 0) Ausgehend von diesen Variablen kann die Größenkonstanz mit folgender Gleichung berechnet werden: GK = (V-S*/S-S*) × 100 GK = 100, wenn V = S GK = 0, wenn V = S* Ergebnisse: Bei binokularem Sehen: GK = ca. 100; bei monokularem Sehen nimmt GK stark ab; fallen empirische Tiefenkriterien weg, beträgt sie 0! Interpretation: Die phänomenale bzw. wahrgenommene Größe wird unter Verwertung von Entfernungsinformationen bestimmt (daher auch die geometrisch-optischen Größentäuschungen: s.u.)! Das Emmert’sche Gesetz: Bei gleicher Größe des Netzhautbildes, „vergrößert“ unsere Wahrnehmung ein Objekt, wenn es weiter weg zu sein scheint, und verkleinert es, wenn es näher zu sein scheint. Beispiel: Die wahrgenommene Größe von Nachbildern hängt davon ab, wie weit die Fläche entfernt ist, auf die wir sie projizieren! Die Mond-Täuschung: Am Horizont erscheint uns der Himmel weiter entfernt als im Zenit; dementsprechend erscheint uns der Mond am Horizont größer als im Zenit. Verstärkt wird dieser Effekt vermutlich noch dadurch, dass nur, wenn der Mond am Horizont steht, Vergleichsobjekte zur Verfügung stehen (ein Segelschiff etc.) Weitere geometrisch-optische Größentäuschungen: die Ponzo-Täuschung; die MüllerLyer-Täuschung etc. 55 7.5. Handlungssteuerung und visuelle Wahrnehmung 7.5.1. Versuche mit Prismenbrillen Die Bestimmung der egozentrischen Lage von Objekten ist v.a. für die Handlungssteuerung (Manipulation von Objekten) essentiell. Mittels Prismenbrillen (HELMHOLTZ / KOHLER) kann die visuelle Wahrnehmung, genauer: die Beziehung zwischen distalen und proximalen Orten, systematisch manipuliert werden (möglich ist z.B. eine vollständige rechts/links- oder oben/untenSpiegelung). Auf diese Weise ist es möglich, den Zusammenhang zwischen phänomenaler Wahrnehmung und Verhalten zu untersuchen: Inwiefern wird die Wahrnehmung durch das Verhalten bzw. das Verhalten durch die Wahrnehmung beeinflusst? Effekte einer rechts/links-Umkehrbrille: Augen- und Handmuskulatur liefern widersprüchliche Informationen über die egozentrische Lage der Objekte Wahrnehmung und V-E-Beziehungen ohne Brille: Distales Objekt: rechts vom Fixationspunkt Proximales Abbild: links von der Fovea Zur Fixation erforderliche Augenbewegung: rechts Wahrnehmung (bedingt durch die Augen- und Kopfstellung): rechts Erforderliche Handbewegung: rechts Wahrnehmung und V-E-Beziehungen mit Umkehr-Brille: Distales Objekt: rechts vom Fixationspunkt Proximales Abbild: rechts von der Fovea Erforderliche Augenbewegung: links Wahrnehmung (bedingt durch die Augen- und Kopfstellung): links Erforderliche Handbewegung: rechts (wobei eine Bewegung nach links wahrgenommen wird) Nach der Abbildungshypothese (s.o.) sollte sich zuerst die phänomenale Wahrnehmung an die veränderten Abbildungsverhältnisse adaptieren. Genauer: Die prismenspezifischen Beziehungen zwischen den proximalen Abbildern (+Augen- und Kopfstellung) und den phänomenalen Wahrnehmungen sollten neu gelernt werden (Ziel: korrekte Wahrnehmung). Nach der Handlungshypothese (s.o.) sollte sich primär das Verhalten bzw. dessen Steuerung an die veränderten Abbildungsverhältnisse adaptieren. Genauer: Die prismenspezifischen Beziehungen zwischen den Bewegungen des Körpers und den dadurch erzeugten retinalen Effekten sollten neu gelernt werden (Ziel: Korrekte Verhaltenssteuerung). Ergänzung: neu gelernt werden müssen nur die Hand- und Körperbewegungen; nicht die Augenbewegungen, für die sich durch Prismenbrillen (anders als bei Kontaktlinsen) nichts ändert. Ergebnisse: 1) Eine Adaptation findet nur bei eigener, aktiver Bewegung statt! Je öfter man die durch die Brille veränderten Verhaltenskonsequenzen aktiv herbeiführt, desto schneller gewöhnt man sich an die neuen V-EBeziehungen. Man lernt, die neuen visuellen Konsequenzen zu antizipieren und umgekehrt, sein Verhalten nach diesen Effekten auszurichten (ABCTheorie). 2) Motorische Adaptation findet schon nach wenigen Tagen bis Wochen vollständig statt. 3) Adaptation der Wahrnehmung (des Sehens) erfolgt nur langsam und für einzelne Objekte. Der phänomenale Gesamteindruck bleibt bis zuletzt fremd. 56 Schlussfolgerungen: 1) Primat des Verhaltens: Die primäre Funktion der Wahrnehmung besteht in der Verhaltenssteuerung und nicht in der korrekten Abbildung der distalen Verhältnisse! Unsere Wahrnehmung dient dazu, die Effekte unseres Verhaltens zuverlässig widerzuspiegeln - die korrekte Abbildung der Umwelt ist sekundär. 2) Die Verhaltensanpassung ist selektiv und auf die von der Veränderung betroffenen Bewegungsorgane beschränkt. In den besagten Experimenten müssen nur die Körperbewegungen, nicht die Augenbewegungen neu gelernt werden! 3) Das phänomenale Sehen ist sekundär (siehe: 1)! Deshalb erfolgt die Adaptation des Sehens bzw. der Wahrnehmung nur langsam und nicht ganzheitlich, sondern lediglich objektbezogen; eine vollständige Umkodierung zw. den proximalen Orten und deren phänomenaler Wahrnehmung ist nicht notwendig! 4) Das phänomenale Sehen ist primär durch Erfahrung, d.h. durch das, was man zu sehen gewohnt ist, determiniert. Eine ihrer Funktionen besteht in der Wiedererkennung! Wenn ein phänomenaler Eindruck der gewohnten Wahrnehmung zu sehr widerspricht, wird er dieser angepasst (z.B. wird eine brennende Kerze trotz oben/unten-Umkehrbrille schnell richtig herum gesehen). Interessanter Einzelbefund: Lediglich eine Umgebung, die man nur mit Brille kennt, erscheint nicht ungewohnt, da die neue Wahrnehmung hier nicht mit der gewohnten verglichen werden kann. Die Adaptation der Wahrnehmung erfolgt unabhängig vom Verhalten. 7.6. Die Dissoziation zw. phänomenaler Wahrnehmung und Verhalten UNGERLEIDER & MISHKIN (1982) unterscheiden ausgehend von Tierversuchen zwischen einem dorsalen Pfad, der ihnen zufolge für die Verarbeitung von Orts- und Bewegungsinfos zuständig ist („Wo-Pfad“) und einem ventralen Pfad, auf dem Informationen über Farbe, Form und Größe verarbeitet und zur Objekterkennung genutzt werden („Was-Pfad“). Wird bei Affen der Scheitel- bzw. Parietallappen (dorsaler Pfad) außer Funktion gesetzt, können sie zwar noch Objekte unterscheiden, aber nicht mehr deren Orte; wird der Temporal- bzw. Schläfenlappen außer Funktion gesetzt (ventraler Pfad) ist es umgekehrt. Dorsaler Pfad („Wo-Pfad“) => Parietallappen (Orts- und Bewegungsinfos) Ventraler Pfad („Was-Pfad“) => Temporallappen (Form- und Farbinfos) 57 MILNER & GOODALE (1995) differenzieren dorsale und ventrale Prozesse weniger danach, welche Informationen verarbeitet werden, sondern wie und zu welchem Zweck sie verarbeitet werden. Anstatt zwischen räumlicher Wahrnehmung und Objekterkennung zu unterscheiden, unterscheiden sie zw. Wahrnehmung und Verhalten. MILNER & GOODALE (1995): Läsionsstudie mit der Patientin D.F. Aufgrund einer Läsion im ventralen Bereich konnte D.F. keine Formen unterscheiden (Form-Agnosie) bzw. Objekte identifizieren. Trotzdem passte sie ihr Verhalten den Formen verschiedener Objekte an; z.B. konnte sie Karten auf Anhieb in unterschiedlich ausgerichtete Schlitze stecken, obwohl sie deren Ausrichtung und Form nicht bewusst erkannte! Phänomenale Wahrnehmung und Verhaltenssteuerung sind mehr oder minder unabhängige Prozesse, die unterschiedlichen kortikalen Arealen zugeordnet sind. Dorsale Prozesse dienen der Steuerung zielgerichteten Verhaltens (Initiierung und Regelung), ventrale Prozesse dagegen der bewussten Objekterkennung bzw. -wiedererkennung! 58 8. Aufmerksamkeit 8.0. Einleitung Immer nur ein Teil aller gegebenen Reizwirkungen wird phänomenal wahrgenommen! Die Aufmerksamkeitsforschung fragt: Wodurch wird bestimmt, worauf wir achten? Worin unterscheidet sich die Verarbeitung beachteter und nicht beachteter Reize? Welche Konsequenzen hat die unterschiedliche Verarbeitung beachteter und nicht beachteter Reize? 8.1. Aufmerksamkeitsprozesse aus Sicht der Abbildungshypothese 8.1.0. Allgemeines Die selektive Wahrnehmung wird als Defizit betrachtet. Ursache des „Problems“ ist unsere begrenzte Verarbeitungskapazität. Durch Aufmerksamkeitsprozesse wird das Defizit kompensiert. Aufmerksamkeit als Kompensationsmechanismus! Folgende experimentelle Paradigmen stehen zur Untersuchung von Aufmerksamkeitsprozessen zur Verfügung: Visuelle Aufmerksamkeit: spatial-cueing-Paradigma Auditive Aufmerksamkeit: dichotisches Hören und shadowing Dual-task-Paradigma (=> Ressourcenmodelle) Folgende Aufmerksamkeitsmodelle lassen sich unterscheiden: Filtermodelle: sequentielle Reizverarbeitung Frühe Selektion (BROADBENT) Späte Selektion (DEUTSCH & DEUTSCH) Ressourcenmodelle: parallele Reizverarbeitung unspezifische Ressourcen (KAHNEMAN) multiple Ressourcen 8.1.1. Filtermodelle Filtermodelle gehen von einer sequentiellen Reiz- bzw. Informationsverarbeitung aus. Erst werden elementare (physikalische) Reizeigenschaften wie Ort, Farbe und Größe repräsentiert - dann die konzeptuelle Bedeutung der Reize. Die Frage, die sich stellt, ist, an welcher Stelle dieses „Informationskanals“ die Selektion stattfindet. In Bezug auf die Art der Selektion gehen Filtermodelle vom Alles-oder-nichtsPrinzip aus: Die Verarbeitung vor dem Filter ist aufmerksamkeitsunabhängig; die Verarbeitung nach dem Filter aufmerksamkeitsabhängig, wobei Reize bzw. Reizeigenschaften, die herausgefiltert wurden, nicht mehr zur Verfügung stehen. A) Frühe Selektion (Broadbent) BROADBENT geht von einer frühen Selektion aus. Ihm zufolge werden Reize ausschließlich aufgrund physikalischer Eigenschaften herausgefiltert. Letztere werden also aufmerksamkeitsunabhängig identifiziert. S1 S2 S3 Sensorische Merkmale Bedeutungen, Kategorien etc. Reaktionen Verhalten 59 Empirische Befunde, die für eine frühe Selektion sprechen: CHERRY (1953): Dichotisches Hören und „shadowing“ (Party-Phänomen) Beim dichotischen Hören wird dem rechten Ohr (über Kopfhörer) etwas anderes dargeboten als dem linken. Die Pbn werden aufgefordert, jeweils einen der beiden Texte mitzusprechen („shadowing“), um auf diese Weise ihre Aufmerksamkeit zu lenken. Die Pbn bemerken nicht, wenn die verschattete Botschaft plötzlich in einer anderen Sprache (Englisch => Deutsch) gesprochen-, rückwärts abgespielt oder 35 Mal dasselbe Wort wiederholt wird (Ergo: Es findet keine semantische Verarbeitung statt). Bemerkt wird dagegen, wenn sich im nicht beachteten Ohr die Tonfrequenz ändert oder ein Wechsel von einer Frauen- zu einer Männerstimme stattfindet (Ergo: Lediglich die sensorische Verarbeitung ist aufmerksamkeitsunabhängig). WRIGHT (1968): Spatial-cueing-Paradigma Pbn wird kurzzeitig eine Matrix mit verschiedenfarbigen Zeichen (Ziffern und Buchstaben) dargeboten. Sind sie aufgefordert, nur die roten Zeichen (sensorisches Merkmal: Farbe) wiederzugeben, gelingt das besser, als wenn selektiv die Ziffern (semantisches Merkmal) erinnert werden sollen. B) Späte Selektion (Deutsch & Deutsch) In vielen Fällen wird auch die Bedeutung nicht beachteter Reize kodiert (breakthrough). Daraus schließen DEUTSCH & DEUTSCH, dass alle Reize „auf höchster Ebene“ verarbeitet werden. Aufmerksamkeitsirrelevante Reize werden ihnen zufolge erst nach ihrer semantischen Identifikation herausgefiltert. S1 S2 S3 Sensorische Merkmale Bedeutungen, Kategorien etc. Reaktionen Verhalten Empirische Befunde, die gegen eine frühe und für eine späte Selektion sprechen: MORAY (1959): z.B. wird der eigene Name bemerkt, auch wenn dieser in der nicht zu beachtenden Nachricht enthalten ist. CORTEEN & WOOD (1972): Städtenamen & „Galvanic skin response“ (GSR) Mittels E-Schocks werden Pbn darauf konditioniert auf bestimmte Städtenamen mit dem galvanischen Hautreflex zu reagieren. Anschließend werden dem nicht zu beachtenden Ohr diese- und neue Städtenamen sowie neutrale Substantive dargeboten. Die Pbn reagieren auf sämtliche Städtenamen (auch auf die neuen) mit dem galvanischen Hautreflex. Ergo: die Bedeutung der dargebotenen Wörter scheint kodiert zu werden. BRADSHAW (1974): Parafoveal dargebotene und nicht zu beachtende Wörter („Baum“, „Geld“) beeinflussen die Identifikation von foveal dargebotenen Targetwörtern (=> „Bank“) 60 FAZIT Weder das späte, noch das frühe Selektionsmodell sind letztlich überzeugend! Kritik an der späten Selektion: Gegen eine 100%ige Verarbeitung aller Reize (späte Selektion) spricht u.a., dass Reize anhand einfacher physikalischer Merkmale (rote vs. weiße Zeichen) besser selektiert werden können als anhand semantischer Kriterien (Ziffern vs. Buchstaben). Was die Breakthrough-Effekte betrifft, kann es immer sein, dass die Pbn die nicht zu beachtenden Reize (entgegen der Instruktion) doch kurz beachtet haben! Kritik an der frühen Selektion: EGETH (1977): Es gibt keine aufmerksamkeitsunabhängige Reizverarbeitung Die Pbn bekommen verschiedene Displays mit mehreren Kreisen dargeboten. Sie sollen entscheiden, ob alle Kreise gleich oder ein Kreis anders (größer oder andersfarbig) ist! Werden die heterogenen Farb- oder Größendisplays geblockt dargeboten, reagieren die Pbn schneller als bei zufälliger Mischung. Die Konzentration der Aufmerksamkeit auf ein elementares Merkmal (Größe oder Farbe) erleichtert offenbar die Kodierung dieses Merkmals. Das widerspricht dem Filtermodell, dem zufolge die Verarbeitung physikalischer Merkmale aufmerksamkeitsunabhängig ablaufen sollte! Die Annahme einer sequentiellen Informationsverarbeitung ist kaum haltbar. Insbesondere Befunde zum Lösen von Doppelaufgaben (Dual-task-Parradigma) sprechen für eine parallele Informationsverarbeitung. 8.1.2. Ressourcenmodelle Ressourcenmodelle gehen von einer parallelen Reizbzw. Informationsverarbeitung aus. Welche Reize bzw. Reizeigenschaften verarbeitet werden, hängt von der zur Verfügung stehenden Kapazität ab. Der Aufmerksamkeitsmechanismus wird nicht als Filter, sondern als flexible Verteilung (Allokation) von Ressourcen verstanden. A) Modell der flexiblen Ressourcen-Allokation (Kahneman) Nach KAHNEMAN verfügen wird über einen begrenzten Pool kognitiver Ressourcen. Diese Ressourcen sind ihm zufolge unspezifisch und können flexibel für verschiedene Verarbeitungsprozesse eingesetzt werden. Die Menge der verfügbaren Ressourcen hängt vom momentanen Erregungszustand, insbes. der Müdigkeit und willentlichen Anspannung einer Person ab. Die „Verteilungspolitik“ hängt von den momentanen Intentionen, den überdauernden Dispositionen (Vorlieben) und den Reizeigenschaften ab. Unterschieden wird nach diesem Modell nicht zw. verschiedenen Ressourcen (s.u.), sondern zwischen daten- und ressourcen-limitierten Prozessen. Daten-limitierte Prozesse: sind automatisierte (ressourcenunabhängige) Prozesse (z.B. Autofahren, Schreiben etc.) Widerspruch: Unterdrückung automatisierter Prozesse erfordert Ressourcen! Ressourcen-limitierte Prozesse: sind ressourcenabhängige Prozesse/ Handlungen (z.B. schwierige Kopfrechenaufgaben) Die relative Ressourcenabhängigkeit einer Aufgabe im Vergleich zu einer anderen ergibt sich aus der Interferenz zw. den beiden Aufgaben (Dual-taskParadigma). Letztere wird in Form sog. POC-Kurven dargestellt. 61 B) Modell multipler Ressourcen (Navon & Gopher) Experimente, bei denen 2 Aufgaben parallel ausgeführt werden müssen (Dual-taskPardigma), zeigen, dass die Interferenzen zw. Aufgaben nicht nur von deren Schwierigkeit, sondern auch von deren Inhalt abhängig sind. SEGAL & FUSELLA (1970): Inhaltsspezifische Interferenzen Primäre Aufgabe: Vorstellung eines Bildes oder eines Geräusches Sekundäre Aufgabe: Visuelle oder akustische Signale entdecken Ergebnis: Die Bild-Vorstellung interferiert stärker mit der visuellen-, die Geräusch-Vorstellung stärker mit der akustischen Erkennungsaufgabe. Aus solchen inhaltsspezifischen Interferenzen schließen NAVON & GOPHER auf inhaltsspezifische (visuelle, motorische etc.) Ressourcen! Interferenzen entstehen, wenn 2 gleichzeitig auszuführende Handlungen dieselben Ressourcen beanspruchen. Kritik: Die Annahme inhaltsspezifischer Ressourcen beruht auf einem Zirkelschluss und hat deshalb keinen Erklärungswert. Theoretisch können beliebig viele Ressourcen angenommen werden. 8.1.3. Filter- und Ressourcen-Modelle Vorteile der Ressourcen-Modelle gegenüber Filtermodellen: 1) Die Widersprüche zw. früher- und später Selektion können dadurch erklärt werden, dass die vom „breakthrough“ betroffenen Reize (z.B. der eigene Name) entweder automatisch verarbeitet werden oder ihre Verarbeitung nur wenige Ressourcen verbraucht. 2) Die sensorische Verarbeitung läuft entweder automatisch ab oder verbraucht nur sehr wenige Ressourcen. Deshalb ist sie gegenüber der semantischen Verarbeitung meistens im Vorteil. 3) Durch Übung einer Aufgabe wird bewirkt, dass diese weniger Ressourcen verbraucht (Trainingseffekt) Generelle Kritik: Filter- und Ressourcen-Modelle setzen eine „Instanz“ voraus, die den Filter aktiviert bzw. die Ressourcen verteilt (Homunkulus-Problem) – ohne zu spezifizieren, nach welchen Kriterien dabei vorgegangen wird. Wie wird entschieden, welche Reize in welcher Situation relevant sind und welche nicht?! Diese Frage lässt sich nur plausibel klären, wenn man die Aufmerksamkeitssteuerung als Bestandteil der Verhaltenssteuerung betrachtet und nicht unabhängig von dieser. 8.2. Aufmerksamkeit aus Sicht der Handlungsperspektive 8.2.0. Allgemeines Aus der Handlungsperspektive ist Aufmerksamkeit ein notwendiger Bestandteil der Verhaltenssteuerung. Um Zielkonflikte zu vermeiden, müssen handlungsrelevante Informationen hervorgehoben, handlungsirrelevante Informationen dagegen ausgeblendet werden. Insofern ist Aufmerksamkeit kein Kompensationsmechanismus, sondern Voraussetzung für effektives Handeln: Reiz-Selektion ermöglicht die Umsetzung von Handlungszielen („selection for action“). Die Frage, die sich aus der Handlungsperspektive stellt, ist, woher das ZNS weiß, welche Informationen handlungsrelevant sind und welche nicht. Der ABC-Theorie zufolge entspricht der Aufmerksamkeitsmechanismus der Antizipation sensorischer Effekte. Antizipierte Reizwirkungen werden, wenn sie tatsächlich eintreten, schneller, sicherer und genauer verarbeitet! Die Selektion erfolgt also nicht während der Reizverarbeitung (Filter- und Ressourcenmodelle), sondern bereits davor! 62 Verwandte Konzepte (Verhaltensbereitschaft „Wahrnehmungsbereitschaft“): LEWIN: Intentionen oder „Quasibedürfnisse“ bestimmen den Aufforderungscharakter von Situationen (will man z.B. einen Brief einwerfen, haben Briefkästen vorübergehend hohen Aufforderungscharakter) HECKHAUSEN: In der volitionalen Bewusstseinslage Verengung des Aufmerksamkeitsfokus auf zielrelevante Infos („realisierungsorientierte Informationsverarbeitung“) 8.2.1. Empirische Befunde A) Die bevorzugte Wirkung handlungsrelevanter Reize Der Prime-Kongruenz-Effekt: Handlungsrelevante Reize werden selbst dann verhaltenswirksam, wenn sie unterschwellig dargeboten und nicht bewusst wahrgenommen werden. NEUMANN & KLOTZ (1994/99): Der Prime-Kongruenz-Effekt Ein Quadrat und eine Raute werden nebeneinander dargeboten; Aufgabe ist es, auf die Lage der Raute mit kongruentem Tastendruck (rechts/links) zu reagieren. Zuvor werden Primes dargeboten, die entweder neutral, inkongruent oder kongruent zum imperativen Reiz sind. Obwohl die Primes wegen des Metakontrastes nicht bewusst wahrgenommen werden können, kommt es bei kongruenten Primes zu kürzeren RTs. Drei mögliche Erklärungen: 1) Kongruenter Prime erleichtert die Wahrnehmung des Targets (perzeptives Priming) 2) Die Primes triggern unmittelbar die ihnen entsprechenden Reaktionen. Dafür sprechen a) die hohen Fehlerzahlen nach inkongruenten Primes und b) die psychophysiologischen Daten (Primes lösen kongruente Bereitschaftspotenziale aus) 3) ABC-Theorie: Die Übereinstimmung bzw. Ähnlichkeit des Primes mit der Antizipation reicht aus, die in Bereitschaft stehende Handlung zu aktivieren. Um diese These zu prüfen, muss gezeigt werden, dass die Wirkung von Primes von der Intention bzw. den Antizipationen der Pbn abhängt (s.u.). NEUMANN & KLOTZ (1994): Primes in Abhängigkeit von der Intention Selber Versuchsaufbau, allerdings wird nach jedem Durchgang durch einen Cue das S-R-Mapping neu vereinbart und dadurch die Intention der Pbn manipuliert; unabhängig vom S-R-Mapping zeigen sich Kongruenz-Effekte, die umso stärker sind, je länger das Cue-Stimulus-Intervall (CSI). Dieselben Primes triggern also je nach S-R-Mapping unterschiedliches Verhalten. Ihre Wirkung hängt demnach von der jeweiligen Intention bzw. den damit einhergehenden Antizipationen ab. Dass die Kongruenzeffekte bei kürzeren Cue-Stimulus-Intervallen (CSI) geringer ausfallen, ist ein Hinweis darauf, dass der Aufbau von handlungssteuernden Antizipationen Zeit braucht. DAMIAN (2001): Den Pbn werden wiederholt Namen von großen- und kleinen Objekten dargeboten. Auf große Objekte soll mit rechtem-, auf kleine mit linkem Tastendruck reagiert werden. Werden als Primes die Targetwörter dargeboten, zeigen sich Kongruenzeffekte; werden andere Wörter als Primes dargeboten, nicht. Ergo: Subliminal dargebotene Primes haben nur dann einen Einfluss auf das Verhalten, wenn sie zu den Reizen gehören, die die Pbn erwarten. 63 Auch Primes, die den erwarteten Targetreizen lediglich ähnlich sind oder derselben Kategorie angehören, können verhaltenswirksam werden. Offenbar werden die Antizipationen flexibel an die Situation angepasst; sie sind so spezifisch wie möglich. Werden nur wenige spezifische Reize als Targets verwendet (wie z.B. bei DAMIAN), werden nur diese wenigen Reize antizipiert; werden dagegen viele nicht vorhersehbare Beispiele von Kategorien verwendet, wird eine abstrakte Repräsentation der Kategorien antizipiert. In dem Fall müssen die Primes nicht mit den Targetreizen identisch sein, um verhaltenswirksam zu werden. KUNDE, KIESEL & HOFFMANN (1993): > 5 vs. < 5 Pbn sollen auf Ziffern < 5 und > 5 jeweils mit einem entsprechenden Tastendruck reagieren. Werden als Targets die Ziffern 1, 4 / 6 und 9 verwendet, produzieren auch die nicht zum Targetset gehörenden Primes 2 und 8 Kongruenzeffekte; bei den Targets 3,4,6 und 7 dagegen nicht. Offenbar werden in Abhängigkeit von den verwendeten Targets verschiedene Teilmengen antizipiert: im ersten Fall die Teilmengen „1 bis 4“ und „6 bis 9“; im zweiten Fall „3 bis 4“ und „6 bis 7“. Fazit: Reize werden nur hinsichtlich ihrer Relevanz für aktuell in Bereitschaft stehendes Verhalten kodiert. Der Mechanismus, durch den der Zusammenhang zwischen Verhalten und Reizen vermittelt wird, ist die Antizipation. Als relevant werden die Reize bzw. Reizeigenschaften „angesehen“, die den antizipierten Reizwirkungen entsprechen (Selektion durch Adaption). Auf diese Weise können sogar nicht bewusst wahrgenommene Reize verhaltenswirksam werden. Einzige Voraussetzung ist, dass sie in irgendeiner Form antizipiert wurden. B) Die Unwirksamkeit verhaltensirrelevanter Reize („inattentional blindness“) Um die Unwirksamkeit verhaltensirrelevanter Reize nachzuweisen, wird die Aufmerksamkeit der Pbn nicht durch Instruktion (wie beim dichotischen Hören), sondern durch eine konkrete Aufgabe fokussiert. Inattentional Blindness: MACK & ROCK (1998): Inattentional Blindness für statische Reize Die Pbn sollen entscheiden, ob die vertikale- oder horizontale Linie eines nur kurz dargebotenen Kreuzes länger ist. Nach einigen Trials wird in der Nähe des Kreuzes ein weiterer (nicht erwarteter) Reiz gezeigt. 20% der Pbn nehmen diesen „kritischen“ Reiz nicht bewusst wahr bzw. können sich nicht daran erinnern, ihn gesehen zu haben. Wird das Kreuz parafoveal (an verschiedenen Stellen) dargeboten, der kritische Reiz dagegen foveal, nehmen ihn noch mehr Pbn (über 60%!) nicht wahr. Daraus folgt, dass die Selektivität der Wahrnehmung kein retinales, sondern ein kortikales Phänomen ist. Obwohl (oder gerade weil) der kritische Reiz foveal dargeboten wird, wird er von den meisten nicht wahrgenommen, da nun weder seine Form, noch seine Lage den Antizipationen entspricht! NEISSER & BECKLEN (1975): Inattentional Blindness für dynamische Reize Den Pbn werden zwei verschiedene Filmszenen übereinander geblendet dargeboten („dichotisches Sehen“); nur eine der beiden Szenen ist zu beachten. Die unbeachtete Filmszene wird, obwohl sie am gleichen Ort dargeboten wird, nicht bewusst wahrgenommen. Auch dieser Befund zeigt: Die Selektivität der Wahrnehmung ist kein retinales, sondern ein kortikales Phänomen; sie wird bestimmt durch die jeweils zu verfolgenden Handlungen! 64 Change blindness: Werden bei „Flicker-Bildern“, die in bestimmten Abständen für wenige ms ausgeblendet werden, oder in Filmszenen während eines „Cuts“ Veränderungen vorgenommen, bleiben diese oft unerkannt. Dasselbe gilt für sehr langsam vorgenommene oder verdeckte Veränderungen! Der Begriff „change blindness“ ist allerdings irreführend. Eigentlich sind wir für Veränderungen nicht „blind“, sondern sogar sehr sensibel. In den besagten Untersuchungen werden die Veränderungen nur deshalb nicht bemerkt, weil sie maskiert sind. Die Pbn sehen nicht die Veränderungen an sich, sondern sind auf einen Vergleich zwischen dem neuen und dem vorangegangenen Bild angewiesen; dabei können sie aber immer nur die Bildteile miteinander vergleichen, die sie bewusst wahrgenommen haben. Die Befunde zur „Change blindness“ zeigen also nicht, dass wir dazu tendieren, Veränderungen zu übersehen, sondern, dass wir immer nur einen kleinen Ausschnitt der Welt bewusst wahrnehmen. Da wir wissen, dass wir nach Belieben jeden Ausschnitt fokussieren können, haben wir den Eindruck, jeder Zeit über ein vollständiges Bild unserer Umwelt zu verfügen. Dabei handelt es sich jedoch um eine Illusion (bedingt durch die Antizipation der selbst auslösbaren Reizwirkungen). Über verhaltensirrelevante und daher unbeachtete Reize bzw. Reizeigenschaften wird nichts gelernt und sie werden nicht erinnert. WOLFE et al. (2000) Pbn sollen so schnell wie möglich entscheiden, ob sich eine zentral dargeboteneunter mehreren peripher dargebotenen Figuren befindet. In 5 aufeinander folgenden Durchgängen wird dabei lediglich die Zielfigur verändert, nicht aber die peripheren Figuren. Obwohl die Vpn also 5 Mal hintereinander dasselbe Display durchsuchen, verbessert sich die Effektivität der Suche (RTs) nicht. Die peripheren Figuren werden lediglich dahingehend beachtet, ob sie mit der zu suchenden Figur übereinstimmen oder nicht; weitergehende Merkmale werden nicht gespeichert. C) Das Fazit aus den empirischen Befunden: Die Beachtung bzw. Antizipation eines Reizes ist notwendig und hinreichend für seine Verhaltenswirksamkeit – und notwendig, aber nicht hinreichend für seine bewusste (erinnerbare) Wahrnehmung! Eine aufmerksamkeitsunabhängige Verarbeitung von Reizen (Filtermodelle) gibt es nicht! Nicht beachtete bzw. antizipierte Reize werden weder bewusst, noch verhaltenswirksam - sofern sie nicht von selbst auf sich aufmerksam machen (s.u.) Antizipierte und deshalb beachtete Reize werden dagegen unmittelbar und unabhängig vom Bewusstsein verhaltenswirksam (evtl. über den dorsalen Pfad). Für die Bewusstwerdung eines Reizes bzw. dessen Speicherung im Gedächtnis sind zusätzliche von der Verhaltenssteuerung unabhängige Prozesse notwendig (evtl. ventrale Verarbeitung). Versteht man Lernen als die Veränderung falscher Antizipationen, gilt: „Organisms only learn if events violate their expectations!“ Versteht man die Ausbildung des Gedächtnisses als Festigung richtiger Antizipationen, gilt: Organismen speichern primär, was ihre Erwartungen bestätigt. 65 8.2.2. Zwei Ergänzungsmechanismen Würden ausschließlich verhaltensrelevante Reize beachtet werden, brächte das erhebliche Nachteile mit sich: Erstens, blieben unerwartete Gefahren unerkannt. Zweitens, wäre man blind für neue, unter Umständen attraktivere Handlungsziele. Um diese Nachteile zu kompensieren, gibt es a) den Orientierungsreflex und b) die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit auch handlungsunabhängig zu lenken! A) Der Orientierungsreflex Der Orientierungsreflex kann definiert werden als reflektorische Ausrichtung der Sinne auf plötzliche Veränderungen, einhergehend mit einer allgemeinen Aktivierungserhöhung und motorischer Anspannung. Kurz: der Orientierungsreflex ist eine durch bestimmte Reizeigenschaften ausgelöste reflektorische Aufmerksamkeitszuwendung. Der Orientierungsreflex wird also durch Reize (und nicht etwa durch Antizipationen) ausgelöst; man spricht deshalb auch von einer zwangsläufigen Ausrichtung der Aufmerksamkeit (attentional capture). Der Orientierungsreflex wird u.a. durch folgende Reizeigenschaften ausgelöst: Bewegung Plötzliche Änderung der Farbe, Form, Größe, Lautstärke etc. Auffälligkeit („Singletons“ sind Reize, die sich von allen umgebenden Reizen eindeutig unterscheiden) Dass der Orientierungsreflex auch gegen den Willen / die Intention einer Person ausgelöst wird, scheint dafür zu sprechen, dass Aufmerksamkeit ein ausschließlich reizgetriggertes Phänomen ist (S-R-Modell). SHIFFRIN & SCHNEIDER: Pop-out-Effekt Werden zuvor „automatisierte“ Targets (die nach mehreren trials automatisch ins Auge springen) anschließend als Distraktoren verwendet, stören sie die Suche nach neuen Targets erheblich. siehe: 8.1.2.: Einerseits sollen automatisierte Prozesse ressourcenunabhängig ablaufen, andererseits verbraucht die Unterdrückung automatisierter Prozesse Ressourcen. Eindeutig ein Widerspruch! In diesem Kontext zeigt das Experiment, dass die Aufmerksamkeit auch gegen den Willen auf Reize „gezogen“ werden kann! Trotzdem ist davon auszugehen, dass die Aufmerksamkeitslenkung sowohl von Reizeigenschaften als auch von verhaltenssteuernden Antizipationen abhängt. Nicht umsonst passt sich der Orientierungsreflex flexibel an verschiedene Situationen und Handlungsabsichten an: bei verhaltensirrelevanten Reizen nimmt der Orientierungsreflex ab (Habituation); bei verhaltensrelevanten Reizen nimmt er zu (Modulation des Orientierungsreflexes durch Handlungsabsichten) Habituation: Reize, die sich wiederholt als verhaltensirrelevant erwiesen haben, lösen keinen Orientierungsreflex mehr aus (z.B. Geräusche beim Zelten). Habituation ist reiz- und kontextspezifisch - und außerdem ein eher passiver Vorgang: die bewusste Nichtbeachtung von störenden Reizen (z.B. Lärm) führt meist zum Gegenteil! „Contingent involuntary orienting“: 66 B) Handlungsunabhängige Aufmerksamkeit Die bloße Vorstellung von Reizen führt zu deren bevorzugter Verarbeitung, auch wenn die vorgestellten Reize aktuell nicht verhaltensrelevant sind! Unsere Aufmerksamkeit wird also nicht nur durch verhaltenssteuernde Antizipationen, sondern durch beliebige Vorstellungen (willentlich) gelenkt. PASHLER (1998): Der „attentional blink effect“ Die Pbn sollen sich einen Gegenstand (z.B. einen Fisch) möglichst lebhaft vorstellen. Anschließend wird ihnen eine schnelle Abfolge von Bildern dargeboten, wobei es ihre Aufgabe (Handlungsabsicht) ist, auf das Erscheinen einer Zahl zu achten. Letztere wird umso schlechter identifiziert, je unmittelbarer sie nach dem zuvor vorgestellten Gegenstand (Fisch) dargeboten wird. Ergo: Unabhängig von dessen Handlungsrelevanz steuert die Vorstellung eines Gegenstandes die Aufmerksamkeit. 8.3. Mechanismen der Aufmerksamkeitslenkung Die Theorie der antizipativen Verhaltenssteuerung geht davon aus, dass die Aufmerksamkeitslenkung darin besteht, antizipierte Reize bzw. Reizeigenschaften bevorzugt zu verarbeiten (s.o.). Dabei lassen sich 3 Aufmerksamkeitsmechanismen bzw. Antizipationsformen unterscheiden. Wir antizipieren a) den Ort des sensorischen Inputs b) den Zeitpunkt seines Eintretens und c) die Qualität bzw. Art des sensorischen Inputs. Wir richten unsere Aufmerksamkeit also nicht nur auf spezifische Reize, sondern auf Orte, Zeiten und Reizqualitäten! A) (Verdeckte) Aufmerksamkeit auf einen Ort Die visuelle Aufmerksamkeit wird zwar primär, aber nicht ausschließlich durch Fixation hergestellt: Sie kann auch auf nicht fixierte Orte bzw. Objekte gerichtet werden. Die visuelle Aufmerksamkeit ist also kein retinales, sondern ein kortikales Phänomen (s.o.: inattentional blindness)! Es gibt in der Forschung 2 Arten, die fixationsunabhängige bzw. verdeckte Ausrichtung der visuellen Aufmerksamkeit zu erklären: 1) Die Spotlight-Metapher 2) Die Premotor-Hypothese Zu 1) Die Spotlight-Metapher Die Spotlight-Metapher geht davon aus, dass der Raum mental repräsentiert ist. Die Aufmerksamkeit ist der Metapher zufolge mit einer Taschenlampe zu vergleichen. Sie kann unabhängig von der Fixation auf verschiedene Orte innerhalb des mental repräsentierten Raums gerichtet werden. POSNER et al. (1978): „Spatial Cueing“ Die Pbn sollen einen zentralen Punkt fixieren und auf ein entweder rechts oder links erscheinendes Signal mit entsprechendem Tastendruck reagieren. Ein Cue informiert die Pbn über den wahrscheinlichen Auftrittsort des Signals vor. Valide Cues kündigen den Auftrittsort in 80% der Fälle korrekt an (benifits), invalide Cues lediglich in 20 % der Fälle (costs). Ergebnis: Nach korrekter Target-Ankündigung reagieren die Pbn schneller und fehlerfreier! Ergo: Offenbar können die Pbn ihre Aufmerksamkeit unabhängig vom Fixationspunkt auf den angekündigten Ort richten und dadurch schneller reagieren, wenn das Target auch am angekündigten Ort auftritt! 67 Weitere Forschungsergebnisse zur Spotlight-Metapher: Der Spot ist unteilbar: er kann nicht auf 2 oder mehrere Orte gleichzeitig gerichtet werden. Der Spot hat keine scharf umrissenen Grenzen: seine erleichternde Wirkung (benefits) nimmt mit dem Abstand vom Spot-Fokus ab. Der Spot kann in Abhängigkeit von der Größe des erwarteten Reizes unterschiedlich stark fokussiert werden: D.h. man kann seine Aufmerksamkeit auf spezifische Orte im Raum oder globale Bereiche richten. Die Weite des Spots ist also willkürlich einstellbar. Wechsel von lokaler zu globaler Aufmerksamkeitseinstellung gelingt schneller als umgekehrt! Ungeklärt sind die Fragen, ob sich der Spot kontinuierlich oder diskret im Raum bewegt und ob man sich die mentale Repräsentation des Raumes dreioder zweidimensional vorzustellen hat. – Vermutlich kann der Spot nur auf konkrete Objekte in der Entfernung gerichtet werden. Die Spotlight-Metapher ist kompatibel zu den Ressourcen-Modellen. Die Einstellung des Spots entspricht der Konzentration von Ressourcen auf einen bestimmten Ort! Zu 2) Die Premotor-Hypothese Im Gegensatz zur Spotlight-Metapher geht die Premotor-Hypothese davon aus, dass die verdeckte Aufmerksamkeit an die Steuerung der Blickbewegung gekoppelt ist. Die Hypothese besagt,… 1) dass jeder willkürliche Blickwechsel mit einer Verlagerung der Aufmerksamkeit zum Zielort der Sakkade eingeleitet wird - und 2) jede Aufmerksamkeitsausrichtung auf einen Ort mit einer entsprechenden Blickintention verbunden ist. Demnach ist die Ausrichtung der Aufmerksamkeit zwar unabhängig vom aktuellen Fixationspunkt, nicht aber vom intendierten Fixationspunkt. Empirische Evidenz: DEUBEL & SCHNEIDER (1996): 1) Aufmerksamkeit => Blickwechsel Die Pbn werden zu einer Augenbewegung an einen bestimmten Ort instruiert. Die Bewegung ist jedoch erst auf ein Signal hin auszuführen. Unmittelbar nach dem Go-Signal und noch bevor die Sakkade eingeleitet wird, werden für wenige ms 2 Distraktoren und eines von 2 Targets (E oder „Spiegel E“) eingeblendet. Aufgabe der Pbn ist es, nach dem Blickwechsel zu entscheiden, ob ein E oder „Spiegel E“ dargeboten wurde. Wird das Target am Zielort der Sakkade eingeblendet, wird es schneller erkannt; je weiter entfernt vom Fixationsziel das Target eingeblendet wird, desto seltener wird es erkannt. Dieser Effekt bleibt sogar dann bestehen, wenn das Target immer an derselben Position dargeboten wird und die Pbn explizit dazu aufgefordert werden, ihre Aufmerksamkeit auf diese Position zu richten. Offenbar sind Blickintention und Aufmerksamkeit tatsächlich nicht voneinander zu trennen! Selbst wenn man es will, kann man seine Aufmerksamkeit nicht auf einen anderen Ort als den richten, der als nächstes zu fixieren ist. THEEUWES (1999): 2) Blickintention => Aufmerksamkeit Ein Distraktor-Onset, der Aufmerksamkeit auf sich zieht, führt dazu, dass intendierte Blickbewegungen zu Targets unterbrochen werden. 68 Die Premotor-Hypothese ist im Einklang mit den empirischen Befunden zur SpotlightMetapher (s.o.): Der „Spot“ entspricht der intendierten Blickbewegung bzw. dem antizipierten Fixationspunkt. Der Spot ist unteilbar Man kann nicht zu 2 Orten gleichzeitig blicken wollen! Globale und lokale Ausrichtung des Spots Man kann einen bestimmten Ort oder in eine bestimmte Gegend blicken wollen 2D- oder 3D-Raum Ausrichtung des Blicks auf eine best. Entfernung erfordert ein fixes Objekt, an dem Konvergenz und Akkomodation ausgerichtet werden können Noch einmal der Kerngedanke: Die Zuwendung der verdeckten Aufmerksamkeit zu einem Ort entspricht der Vorbereitung seiner Fixation. Die Premotor-Hypothese ist absolut kompatibel zur ABC-Theorie: Die an die Blickintention gekoppelte Aufmerksamkeit entspricht der Antizipation der sensorischen Konsequenzen. Die Antizipation des zu fovealisierenden Bildausschnittes (Effekt) triggert zum einen die zur Fixation notwendige Augenbewegung (Verhalten), zum anderen bewirkt sie die Hervorhebung der von dort kommenden Reizwirkungen (Aufmerksamkeit). In diesem Sinn ist die verdeckte Aufmerksamkeit ein Nebenprodukt der antizipativen Verhaltenssteuerung! B) Aufmerksamkeit auf einen Zeitpunkt Zeitpunkte und Orte sind ausschließlich relational bestimmbar (Referenz – Relat): Zur Bestimmung von Orten stehen egozentrische- und allozentrische Referenzen zur Verfügung (rechts von mir – hinter dem Stuhl). Zeitpunkte können nur durch die Dauer relativ zu einem externen Ereignis bestimmt werden (5 Minuten nach der Tagesschau etc.) Drei Fälle der relativen Zeitpunktbestimmung sind zu unterscheiden: 1) Dauer von 0 = Gleichzeitigkeit: z.B. Tastendruck beim Erscheinen eines Reizes Zeitpunkt wird durch die Antizipation des zu erwartenden Reizes repräsentiert 2) Dauer zwischen 2 Ereignissen: Tastendruck bei Erscheinen eines vorher angekündigten Targetreizes (Cue => Targetreiz/Reaktion) Antizipation des zu erwartenden Reizes + Antizipation der Dauer zwischen Cue und Targetreiz. 3) Dauer allein: Tastendruck immer eine Sekunde nach kritischem Reiz Bestimmung des Zeitpunktes durch Antizipation der Dauer Befunde, die dafür sprechen, dass unser ZNS die Dauer von Ereignissen und zwischen Ereignissen automatisch (inzidentell) registriert und speichert. COULL et al. (2000): „Time Cuing“ Auf einen Reiz soll so schnell wie möglich mit einem Tastendruck reagiert werden. Anhand von Cues wird die Zeit bis zum Eintreten des Reizes angekündigt. In validen trials, in denen die Zeit zw. Cue und Reiz (SOA) korrekt vorhergesagt wird: schnellere RTs. Offenbar kann die Dauer zw. Cue und Reiz repräsentiert- und dadurch der Zeitpunkt der Reaktion antizipiert werden! ALBINET & FEZZANI (2001): Das inzidentelle Lernen von Zeitsequenzen Ein Objekt soll nach dem Austritt aus einem Tunnel mit einem „Projektil“ abgeschossen werden. Um das Objekt zu treffen muss a) die Dauer, die das Projektil bis zum Objekt braucht, und b) die Verweildauer des Objektes im Tunnel antizipiert werden. Letztere wird zyklisch variiert. D.h.: Die 69 Verweildauer im Tunnel ist zwar unterschiedlich, die Abfolge der Verweildauern bleibt dagegen über mehrere Blocks gleich. Ergebnis: Bleibt die Abfolge der Verweildauern gleich, wird das Ziel immer knapper verfehlt. Sobald die Abfolge der Verweildauern verändert wird: signifikante Leistungsverschlechterung! Ergo: Die Pbn lernen offenbar die Abfolge der Verweildauern und können so den optimalen Zeitpunkt ihrer Reaktion zunehmend besser antizipieren! Beispiel für das inzidentelle und unbewusste Lernen von Zeitsequenzen. C) Aufmerksamkeit auf Reizqualitäten 1) Das experimentelle Paradigma (visuelle Suche) Um die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf spezifische Reizeigenschaften zu untersuchen, lässt man Pbn unter einer variablen Menge von Distraktoren ein Target suchen. Als Maß für die Effizienz der Aufmerksamkeitslenkung gelten dabei die RT und Fehlerzahl in Abhängigkeit von der Anzahl der Distraktoren (display size). Die Suche ist umso effektiver, je unabhängiger die Ergebnisse von der display size sind. „Singleton search“ und „conjunction search“: Singleton search Unterscheidet sich das Target in nur einem Merkmal (z.B. Farbe oder Form) von den Distraktoren, findet man den sog. „Pop-out-Effekt“. Das Target springt unabhängig von der Größe des Suchdisplays ins Auge. Die RTs steigen mit der Anzahl der Distraktoren nicht an. „AbsentReaktionen“ (Target nicht enthalten) dauern etwas länger. Conjunction search Sind 2 oder mehr Merkmale zu berücksichtigen (z.B. Farbe und Form), um das Target von den Distraktoren zu unterscheiden, findet sich kein „Pop-outEffekt“. Die RTs sind umso höher, je größer das Suchdisplay. In „Absent-trials“ ist der Anstieg der RTs ca. doppelt so stark wie in „Present-trials“. 2) Die Merkmalsintegrationstheorie (MIT) von Treisman TREISMAN geht von 2 Arten der Informationsverarbeitung aus: 1) Elementare Merkmale wie Farbe, Form oder Bewegung werden ihm zufolge parallel und aufmerksamkeitsunabhängig verarbeitet. 2) Die Integration von elementaren Merkmalen, z.B. von Farbe und Form, erfordert dagegen räumliche Aufmerksamkeit und erfolgt seriell. Befunde, die für die MIT sprechen: Pop-out-Effekt Einzelne Merkmale des Targets und der Distraktoren können parallel verarbeitet werden. Dementsprechend wird das Vorliegen bzw. Nicht-Vorliegen eines elementaren Merkmals (Singleton search) aufmerksamkeitsunabhängig registriert (parallele Suche und pop-out). Ist die Integration von Merkmalen verlangt, muss dagegen jeder Reiz einzeln beachtet werden. Die räumliche Aufmerksamkeit (Spot) muss nacheinander von Ort zu Ort „wandern“ (serielle Suche). Illusory Conjunctions Nach kurzfristiger Darbietung heterogener Suchdisplays erinnern sich die Pbn oft an Merkmalskombinationen, die gar nicht dargeboten wurden. Einzeln waren die Merkmale (z.B. rot und Quadrat) zwar vertreten, aber nicht in der von den Pbn bezeichneten Kombination! 70 Befunde, die gegen die MIT sprechen: Auch die Verarbeitung elementarer Merkmale erfordert Aufmerksamkeit! EGETH (1977): Es gibt keine aufmerksamkeitsunabhängige Reizverarbeitung Die Pbn bekommen verschiedene Displays mit mehreren Kreisen dargeboten. Sie sollen entscheiden, ob alle Kreise gleich oder ein Kreis anders (größer oder andersfarbig) ist! Werden die heterogenen Farb- oder Größendisplays geblockt dargeboten, reagieren die Pbn schneller als bei zufälliger Mischung. Die Konzentration der Aufmerksamkeit auf ein elementares Merkmal (Größe oder Farbe) erleichtert offenbar die Kodierung dieses Merkmals. Das widerspricht der MIT, derzufolge die Verarbeitung einzelner, elementarer Merkmale aufmerksamkeitsunabhängig ablaufen sollte! Auch komplexe Objekte „poppen“ ;) Z.B. fällt uns eine vertraute Person am Bahnsteig sofort auf, obwohl sie sich in keinem elementaren Merkmal von den anderen unterscheidet. HOFFMANN et al. (1985): pop-out bei (vertrauten) konjunktiven Targets Lässt man Pbn unter anderen Objektzeichnungen nach einem „Auto“ suchen, sind die Entdeckungszeiten unabhängig von der Zahl der Distraktoren (pop-out). Lässt man sie dagegen in denselben Displays nach einem „Fahrzeug“ suchen, nehmen die Entdeckungszeiten mit Anzahl der Distraktoren zu. Wie schnell man etw. findet, hängt offenbar nicht nur von der visuellen Auffälligkeit des gesuchten Objektes ab, sondern auch von der Genauigkeit der Zielvorstellung (=> objektspezifischer Aufmerksamkeitsmechanismus). Revision der Merkmalsintegrationstheorie (MIT) durch TREISMAN: Annahme von 4 Aufmerksamkeitsmechanismen: 1) Aufmerksamkeitsausrichtung auf einen Ort 2) Aufmerksamkeitsausrichtung auf ein Merkmal (z.B. rot) 3) Aufmerksamkeitsausrichtung auf ein Objekt (z.B. Auto) 4) Selektion von Objekten für eine Handlung 3) Die ABC-Theorie Die visuelle Suche wird durch Antizipationen geleitet. Die Reizidentifikation ist dabei umso effektiver…, je distinkter der Reiz antizipiert werden kann (s.o.: „Auto“ vs. „Fahrzeug“) Die Distinktheit des antizipierten Reizes bzw. -Aktivitätsmusters hängt nicht von dessen Komplexität ab, sondern von der Häufigkeit, mit der der betreffende Reiz zu antizipieren ist. und je eher der Reiz auch bei parafovealer Abbildung wahrgenommen und mit dem antizipierten verglichen werden kann. hängt von der visuellen Auffälligkeit des gesuchten Reizes ab. In einem Satz: Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf Reizqualitäten entspricht der Antizipation ihrer sensorischen Wirkungen. Unterschied zur MIT: Es gibt keinen qualitativen Unterschied zw. der Suche nach elementaren Merkmalen und Merkmalskonjunktionen! Auch die Wahrnehmung elementarer Merkmale beruht nicht auf einzelnen Rezeptormeldungen, sondern auf neuronalen Aktivitätsmustern. Entscheidend für die schnelle Erkennung bzw. Wiedererkennung eines solchen Musters ist nicht dessen Komplexität, sondern die Distinktheit, d.h. wie oft das Muster bereits antizipiert und realisiert worden ist (s.o.). 71 8.4. Der Einfluss raum-zeitlicher Redundanzen auf Reizerwartungen 8.4.0. Einleitung Die Ausrichtung der Aufmerksamkeit auf Orte, Zeiten und Reizqualitäten beruht auf voneinander unabhängigen Antizipationen: Die Aufmerksamkeitsausrichtung auf Orte beruht auf deren antizipativen Fixation. Die Aufmerksamkeitsausrichtung auf Zeitpunkte beruht auf der Antizipation der Dauer. Die Aufmerksamkeitsausrichtung auf Reizeigenschaften beruht auf der Antizipation ihrer sensorischen Wirkungen. Dementsprechend erfolgen die einzelnen Antizipationen unabhängig voneinander: Bei der Beachtung eines Ortes bzw. einer Zeit werden alle Reize an dem antizipierten Ort/ der antizipierten Zeit beachtet. Bei der Beachtung von Reizmerkmalen werden nur (!), allerdings unabhängig von Ort und Zeit, hervorgehoben. ROCK & GUTTMAN (1981): Merkmalsbeachtung ≠ Ortsbeachtung Pbn bekommen für eine Sekunde zwei unterschiedliche Formen, eine grüne und eine rote, am selben Ort gezeigt. Beachtet werden sollen immer nur die roten Formen. In einem Wiedererkennungstest werden auch nur sie wiedererkannt. Ergo: die Beachtung eines bestimmten Merkmals (hier: rot) ist ein anderer Mechanismus als die Beachtung eines bestimmten Ortes oder Zeitpunktes. Merkmale/Objekte/Szenen etc. sind allerdings nicht zufällig in Raum und Zeit verteilt, sondern topographisch und zeitlich geordnet. Deshalb sind die einzelnen Erwartungen häufig miteinander verknüpft: Die Aufmerksamkeit adaptiert an topographische und räumliche Invarianten! 8.4.1. Die Adaptation von Erwartungen an topographische Invarianten Die Aufmerksamkeit adaptiert an topographische Invarianten und wird von ihnen mitbestimmt. HOFFMANN & KLEIN (1988): Der Kongruenzeffekt Objekte werden in kongruenten Kontexten, vorausgesetzt sie sind dort an ihrem gewohnten Ort, schneller gefunden als in inkongruenten Kontexten: Z.B. wird ein Zahnputzbecher in einem Badezimmer auf der Spülbeckenablage schneller gefunden als auf einer Baustelle! Am längsten müssen die Pbn suchen, wenn sich das gesuchte Objekt zwar in einem kogruenten Kontext, dort aber an einem ungewohnten Ort befindet (z.B. neben der Toilette). Kovariationen zwischen Reizen und deren Lokation werden inzidentell gelernt. MUSEN (1996): Die Bildung von Target-Ort-Assoziationen Pbn bekommen verschiedene Zeichen und Buchstaben dargeboten und sollen sie so schnell wie möglich benennen. Werden die einzelnen Zeichen und Buchstaben wiederholt an denselben Orten dargeboten, erfolgt die Reaktion schneller. CHUN & JIANG (1998): „Contextual Cuing“ In bereits „bekannten“ Suchdisplays entdecken die Pbn einen Targetreiz (ein T unter lauter Ls) schneller als in neuen Displays. – Und das obwohl die „bekannten“ Displays von den Pbn nicht bewusst wiedererkannt werden. Fazit: Durch das inzidentelle Lernen topographischer Invarianten bilden sich lokationsspezifische Objekterwartungen und objektspezifische Lokationserwartungen, durch die die Augenbewegungen gesteuert werden. Lokationsspezifische Objekterwartungen können immer nur im (allozentrischen) Bezug zu anderen Orten bzw. Objekten ausgebildet werden; sie sind insofern immer kontextabhängig. 72 Ergo: Der Aufbau topographischer Erwartungen entspricht dem Aufbau von SV-E-Tripel: Unter welchen Bedingungen können mit welchen Augenbewegungen welche (fovealen) Reizwirkungen erzeugt werden?! 73 9. Begriffsbildung 9.1. Einleitung Entitäten bzw. Objekte sind wenigstens insoweit zu unterscheiden, als sie eine unterschiedliche „Behandlung“ erfordern. Wir müssen also dazu in der Lage sein, handlungsrelevante Merkmale zu abstrahieren! Das Entscheidende an einem Messer beispielsweise ist nicht die Farbe des Griffs, sondern das Vorhandensein einer Schneide! Darüber hinaus müssen die abstrahierten Merkmale auffällig und schnell zu entdecken sein. Die Merkmale, anhand derer wir Begriffe bilden, müssen also 2 Kriterien erfüllen: 1) Sie müssen handlungsrelevant sein! 2) Sie müssen schnell und sicher zu lokalisieren sein! Die Repräsentation solcher Merkmale bzw. die Suche nach ihnen geschieht durch Antizipation. Die durch unterschiedliche Rezeptormeldungen hervorgerufenen Aktivitätsmuster (bottom up) werden durch deren Antizipation (top down) hervorgehoben. Im Lauf der Phylo- und Ontogenese kommt es zu einer Anpassung der bottom-upVerarbeitung an die top-down-Antizipationen. Dadurch wird die Effektivität der Verhaltenssteuerung langfristig und dauerhaft erhöht. Phylogenese: Durch genetische Selektion setzen sich die neuronalen Verschaltungen durch, die den Lebensbedingungen bzw. den Intentionen und Antizipationen der betreffenden Art am besten entsprechen. Ontogenese: Durch Lernerfahrungen kommt es im Lauf der Ontogenese zu weiteren spezifischen Veränderungen der neuronalen Verschaltungen. Die kurzfristige, flexible Anpassung an wechselnde Verhaltensanforderungen geschieht durch die Anpassung der Antizipationen. Werden bestimmte Antizipationen besonders häufig genutzt, können sie langfristig zu einer Veränderung der neuronalen Verschaltungen führen (s.o.). 9.2. Klassische Erklärungsversuche 9.2.0. Begriffe werden erworben! Platon (Realismus): Die Begriffe bzw. Ideen sind angeboren und unveränderlich; die Dinge lediglich deren unvollkommene Widerspiegelung. Aristoteles (Nominalismus): Die Dinge sind das Wirkliche; Begriffe lediglich Namen (Zusammenfassungen von Dingen) Empirische Psychologie: Alle traditionellen Theorien zur Begriffsbildung haben 2 Ansichten gemeinsam: 1) Begriffe sind erworben! 2) Begriffsbildung ist die Zusammenfassung von Objekten zu Klassen aufgrund gemeinsamer Merkmale! 74 9.2.1. Der behavioristische Ansatz: S-r-s-R Die Begriffsbildung entspricht der Bildung von Assoziationen zwischen Objekten und kategorialen Reaktionen! Kurz: Begriffe werden als S-R-Assoziationen verstanden! Modifikation: Da durch Konditionierung nicht nur lineare, sondern auch nicht-lineare Verknüpfungen gelernt werden (s.o.: negatives patterning = disjunktive Verknüpfung), wurde das Modell um interne Prozesse erweitert. Diese internen Prozesse bzw. Reaktionen vermitteln der Theorie nach zw. Stimulus und Response und ermöglichen es so, nicht nur ganze Objekte mit einer kategorialen Reaktion, sondern einzelne Merkmale separat zu assoziieren (S-r-s-R). Externer Reiz (S: Rotes Dreieck) interne Reaktion (r: beachte die Farbe) interner Reiz (s: rot) externe Reaktion (R: Kategorie A) 9.2.2. Der (traditionelle) kognitive Ansatz: Begriffsbildungsalgorithmen Begriffe sind anhand ihrer definierenden Merkmale und deren formal-logischer Verknüpfung repräsentiert. Dementsprechend müssen bei der Begriffsbildung a) die relevanten Merkmale und b) deren korrekte Verknüpfung bzw. die Begriffsstruktur gelernt werden. Folgende Begriffsstrukturen bzw. Verknüpfungen lassen sich unterscheiden: 1) Konjunktion: „…und…“ 2) Disjunktion: „…oder…“ 3) Ausschließende Disjunktion: „entweder … oder…“ 4) Implikation (konditionale Verknüpfung): „Wenn…dann…“ 5) Äquivalenz (bikonditional): „Nur wenn…dann… und umgekehrt“ Es wird davon ausgegangen, dass die relevanten Merkmale und die Struktur von Begriffen durch das Aufstellen von Hypothesen und deren systematische Prüfung erschlossen werden. Die Prüfung der Hypothesen geschieht auf Basis von festen Algorithmen und heuristischen Regeln bzw. Strategien: Beispiel für eine heuristische Regel: Wenn mit einem Merkmal bereits hinreichend viele Objekte korrekt klassifiziert wurden, dann aber ein Objekt, das dieses Merkmal nicht trägt, doch zum gesuchten Begriff gehört, dann wird das Merkmal beibehalten und disjunktiv mit einem weiteren Merkmal des vorliegenden Objektes verknüpft. Je nach zugrunde liegender Struktur, werden Begriffe unterschiedlich schnell gelernt; am meisten Aufwand erfordert das Lernen bikonditionaler Verknüpfungen. Kritik: ROSCH (Prototypentheorie) weist auf folgende Mängel des algorithmischen Informationsverarbeitungsansatzes hin: 1) Begriffe werden nicht anhand ihrer definierenden, sondern anhand von typischen Merkmalen repräsentiert. Dementsprechend gibt es typische und weniger typische Vertreter eines Begriffs – und Merkmale mit hoher und niedriger „Hinweisgültigkeit“. WITTGENSTEIN: „Familienähnlichkeit“ 2) Begriffsbildung ist nicht die Zusammenfassung von Objekten aufgrund gemeinsamer Merkmale, da sich theoretisch unendlich viele Gemeinsamkeiten finden lassen. Nicht Begriffe werden aufgrund gemeinsamer Merkmale gebildet, vielmehr sind die Merkmale, die wir unterscheiden, das Resultat der Begriffe, die wir bilden. 3) Paradoxon: Gemeinsame Merkmale zu abstrahieren, setzt voraus, dass die Menge der Objekte, die das Merkmal gemeinsam haben, bereits gegeben ist. 75 9.2.3. Begriffsbildung in konnektionistischen Netzwerken Die Theorie der konnektionistischen Netzwerke baut auf dem behavioristischen Ansatz auf. Ein einfaches konnektionistisches Netzwerk beruht auf Eingangs- (S) und Ausgangsknoten (R). Erstere entsprechen den Merkmalen; letztere den Begriffen. Die Verknüpfungen zw. Merkmalen und Begriffen sowie deren Gewichtung basiert auf Lernerfahrungen. Die lernabhängige Gewichtung (manche Merkmale sind wichtiger/typischer als andere) basiert auf der Delta-Regel, die dem Rescorla-Wagner-Modell (Kap.: 3.2.2.) entspricht. Ein Problem an konnektionistischen Netzwerken ist, dass anhand von ihnen nur lineare (z.B. „und“) Verknüpfungen repräsentiert werden können. Daher (analog zum behavioristischen Ansatz): Multi-Layer-Netzwerke; letztere enthalten zw. Merkmals- und Begriffsknoten eine weitere Schicht von Knoten. Das Hauptproblem bleibt jedoch bestehen: Anhand von Netzwerken können zwar Merkmale zu einer vorgegebenen Kategorie gelernt werden, aber keine neuen Kategorien gelernt werden! 9.3. Begriffsbildung aus Sicht der antizipativen Verhaltenssteuerung 9.3.0. Allgemeines Aus Sicht der antizipativen Verhaltenssteuerung sind Begriffe Resultat und Voraussetzung effektiven Verhaltens. Sie werden nicht auf Basis gemeinsamer Merkmale, sondern aufgrund funktionaler Äquivalenz gebildet. Als funktional äquivalent erlebt werden dabei Objekte bzw. Situationen (Reizwirkungen), die ausgetauscht werden können, ohne den Erfolg des jeweiligen Verhaltens zu gefährden. Begriffe = Äquivalenzklassen bzw. Antizipationen äquivalenter Reizwirkungen Abstrahiert werden nicht gemeinsame Merkmale und deren Verknüpfung, sondern handlungsrelevante bzw. handlungsspezifische Reizwirkungen. Voraussetzung ist, dass die betreffenden Reizwirkungen a) beachtet werden und b) das jeweilige Verhalten kontingent oder zumindest oft genug begleiten, um als Invarianten erkannt zu werden. Die auf diese Weise gebildeten Begriffe entsprechen den zur Verhaltenssteuerung notwendigen Antizipationen. Demnach kann die Begriffsbildung auch als zwangsläufige (inzidentelle) Anpassung der Antizipationen an die erfahrenen Reizwirkungen beschrieben werden. 9.3.1. Die Abstraktion handlungsrelevanter Invarianten Beispiele für die zwangsläufige (inzidentelle) Ausbildung von Äquivalenzklassen: RENSCH (1968): Die Schimpansin Julia Die Schimpannsin lernt, einen Deckel mit Hilfe eines „Schraubenziehers“ (Stück Eisen mit Steckkante) zu öffnen. Im Folgenden werden ihr verschiedene Werkzeuge angeboten. Ein Teil dieser Werkzeuge ist dem bereits bekannten Stück Eisen ähnlich, enthält aber keine Steckkante; die anderen Werkzeuge sind dem Stück Eisen zwar unähnlich, enthalten aber Steckkante. Die Schimpansin wählt unabhängig von der äußeren Ähnlichkeit zum bereits bekannten Werkzeug einen Gegenstand mit Steckkante! Sie wählt also nicht aufgrund gemeinsamer Merkmale, sondern aufgrund funktionaler Äquivalenz! 76 BROWN (1989): Analoges Experiment mit Kindern! Kinder lernen mit einem rot-weiß gestreiften Stock mit Haken ein Spielzeug zu sich zu ziehen; stehen ihnen anschließend verschiedene Stöcke zur Verfügung, wählen sie keinen ähnlichen (rot-weiß gestreift), sondern einen geeigneten Stock aus (Haken), um das Spielzeug heranzuziehen. Beispiel für die Abstraktion nicht direkt verhaltensrelevanter, aber invarianter Merkmale: LÜER et al. (1989): Das Lösen von Anagrammen Lernphase: Pbn sollen Anagramme lösen, wobei 2 Regeln in Abhängigkeit vom Anfangsbuchstaben des Anagramms besonders häufig zum Erfolg führten; Bei „A“ => Regel 1; bei „O“ => Regel 2 Transferphase: Die Anagramme, bei denen der Zusammenhang zw. Anfangsbuchstabe und Regel gleich bleibt, werden schneller gelöst als Anagramme mit umgekehrter Zuordnung. Die Pbn haben das invariante Merkmal „Anfangsbuchstabe“ unbewusst abstrahiert und an die jeweils passende Regel geknüpft! Latente Bildung von (funktionalen) Kategorien durch Handlung! HOFFMANN & ZIEßLER (1986): funktionale Kategorien 8 verschiedene Figuren werden zu funktionellen Kategorien zusammengefasst, indem entweder mit dem rechten bzw. linken Fuß oder mit der rechten bzw. linken Hand auf sie reagiert werden soll. Es gibt also zwei funktionelle Oberkategorien (Hand vs. Fuß) mit jeweils 2 funktionellen Unterkategorien. Dabei ist die Zuordnung der Figuren zu diesen Kategorien so gewählt, dass diese der anschaulichen Kategorisierung der Figuren widerspricht. Im Anschluss an diese Lernphase sollen die Pbn die Figuren nach ihrer Klassenzugehörigkeit benennen. Dabei entspricht die geforderte Klassifikation entweder der funktionellen Kategorisierung aus der vorherigen Lernphase oder nicht. Sind die geforderten Benennungen zu den zuvor geforderten Reaktionen kompatibel, werden sie schneller gelernt! Eine bisher nicht untersuchte (aber lohnende) Frage: Inwieweit werden invariante Eigenschaften nicht intendierter Effekte abstrahiert?! 9.3.2. Die Abstraktion globaler Invarianten Die abstrahierten Invarianten sollten nicht nur handlungsrelevant, sondern darüber hinaus schnell und leicht zu lokalisieren sein (s.o.)! Targets stechen hervor („poppen“), wenn ihre antizipierten Merkmale a) distinkt sind, sie sich also leicht von Distraktoren unterscheiden lassen, und b) die antizipierten Merkmale auch bei parafovealer Darbietung wahrgenommen werden können. „Global superiority“: Unser visuelles System bevorzugt die Verarbeitung globaler Reizeigenschaften. NAVON (1977): „global superiority“ Den Pbn werden globale Buchstaben dargeboten, die sich aus lokalen Buchstaben zusammensetzen. Die Identifikation der lokalen Buchstaben wird durch Inkongruenz zum globalen Buchstaben verlangsamt; die Identifikation der globalen Buchstaben ist dagegen a) generell schneller und b) unabhängig von den lokalen Buchstaben. 77 Globale Merkmale bzw. Invarianten werden bevorzugt abstrahiert. DUNCAN & HUMPHREYS (1989): „Homogenity Coding“ Aufgabe der Pbn ist es, ein T unter kreisförmig angeordneten Ls zu entdecken. Normalerweise sollten die Entdeckungszeiten mit der Anzahl der Distraktoren (Ls) ansteigen. Das Umgekehrte ist jedoch der Fall. Hinzu kommt, dass die Reaktionszeiten bei no-target-trials (völlige Homogenität) kürzer als bei targettrials sind. Erklärung: Je höher die Anzahl der Distraktoren, desto stärker die Homogenität des Kreises. An letzterer orientieren sich die Pbn. Anstatt nach dem T zu suchen, entscheiden sie nach dem globalen Merkmal der Homogenität! Globale Merkmale dienen als Referenzen zur Lokation von Details. Sprich: Lokale Merkmale werden relativ zum Globalen bestimmt. Wir suchen beispielsweise nicht direkt nach dem Nummernschild (lokales Merkmal), sondern erst nach dem Auto (globale Form) und dann nach dem Nummernschild. 9.4. Perzeptives Lernen: Wahrnehmungsexpertise 9.4.1. Was ist perzeptives Lernen? Perzeptives Lernen meint die ontogenetische Anpassung der Reizverarbeitung an häufig geforderte Verhaltensdifferenzierungen. Kurz: Perzeptives Lernen führt zu einer Veränderung der Wahrnehmung. Dabei ändern sich sowohl die Antizipationen von Reizen (top-down) als auch deren neuronale Verarbeitung (bottom-up). Neuronale Plastizität: Viele neuronale Verschaltungen bilden sich erst im Lauf der Ontogenese. Die neurophysiologischen Grundlagen der Wahrnehmung stehen also keineswegs fest, sondern entwickeln sich in Abhängigkeit von den individuellen Lernerfahrungen. 9.4.2. Die Anpassung der Wahrnehmung an häufig auftretende Reize Reize bzw. Reizkonfigurationen, auf die häufig reagiert werden muss (z.B. bestimmte Gesichter), bilden unitäre neuronale Repräsentationen (Unitization). Die vielfältigen Aktivierungen, die von dem betroffenen Reiz ausgehen, werden zu einer neuronalen Einheit bzw. einem spezifischen Aktivierungsmuster zusammengefasst. PALMERI (1997): Punktmuster Die Pbn bekommen verschiedene Punktmuster dargeboten und sollen so schnell wie möglich die Anzahl der Punkte bestimmen. Nach mehreren Trainingseinheiten, in denen immer wieder dieselben Muster dargeboten werden, sind die RTs unabhängig von der Anzahl der Punkte. Letztere werden offensichtlich nicht mehr einzeln verarbeitet bzw. gezählt; stattdessen haben sich offenbar die Muster jeweils als Ganzes eingeprägt. Sie bilden neuronale Einheiten, die die Reaktion unmittelbar auslösen! Nicht nur einzelne Reize bzw. Reizkonfigurationen, sondern auch individuell verschiedene Reize, die als funktional äquivalent erlebt und deshalb zu Klassen zusammengefasst werden, bilden neuronale Einheiten bzw. unitäre Repräsentationen! Siehe Kap. 8.3.3.: Auch komplexe Reizkonfigurationen stechen bei hinreichender Vertrautheit hervor bzw. „poppen“! 78 HOFFMANN & GROSSER (1985): Das Lernen artifizieller Kategorien Pbn bekamen verschiedene, artifizielle Objekte mit 4 klassifizierungsrelevanten Merkmalen (globale Form, Dachform, Fensterform, Fundamentform) dargeboten. Nach welchen Kriterien die verschiedenen Objekte zu Klassen zusammenzufassen waren, wurde vom Vl vorgegeben und variiert. In mehreren Trainingseinheiten lernten die Pbn die jeweils vorgegebenen Kategorien korrekt zu unterscheiden und entsprechend zu benennen. Visuelle Suche: Anschließend sollten die Pbn die neu gelernten „Begriffe“ unter mehreren Distraktoren finden (Conjunction search). Sie fanden sie unabhängig von der Größe des Suchdisplays (pop-out-Effekt) Ergo: Für alle Kategorien bildeten sich durch entsprechendes Training unitäre neuronale Repräsentationen. Am schnellsten bildeten sich unitäre Repräsentationen für Klassen, deren Elemente gemeinsame globale Merkmale besaßen. Ob die Klassen durch Einzelmerkmale (z.B. rundes Dach) oder Konjunktionen (z.B. hoch + rundes Dach) gekennzeichnet waren, spielte keine Rolle! Gemeinsame Merkmale sind keine notwendige Voraussetzung für die Bildung von unitär repräsentierten Äquivalenzklassen. Letztere können auch ausschließlich über eine gemeinsame Aktion definiert werden. Kurz: Auch völlig unterschiedliche Reize werden unitär repräsentiert, sofern sie nur dasselbe Verhalten erfordern. SHIFFRIN & SCHNEIDER (1977): Die Buchstaben G, M, L, A als eine Kategorie Sollen Vpn bis zu 3000 Mal nach denselben Buchstaben (G, M, L und A) suchen, stellt sich irgendwann der pop-out-Effekt ein. Obwohl die Buchstaben keine gemeinsamen Merkmale aufweisen, die sie von den anderen Buchstaben eindeutig unterscheiden, bildet sich offenbare eine unitäre Repräsentation für sie. Das visuelle System schafft sich selbst die Merkmale, die benötigt werden, um als äquivalent erlebte Reizkonfigurationen zu unterscheiden! Wenn man im Handeln häufig zwischen ähnlichen Objekten unterscheiden muss, werden die Unterschiede zw. diesen Objekten verstärkt ( Wahrnehmungsexpertise: differenziertere Äquivalenzklassen). Z.B. haben Europäer Schwierigkeiten, Asiaten voneinander zu unterscheiden – und umgekehrt; Ornithologen sind besonders sensibel für Unterschiede von Vogelarten etc. etc. Die Wahrnehmungsexpertise ist kontextspezifisch! CHASE & SIMON (1973): Schachexperten reproduzieren Figurenkonstellationen nur dann besser als Laien, wenn es sich um echte Spielstellungen handelt. 79 10. Sprache als Handlung 10.1. Spekulationen über die phylogenetische Entwicklung von Sprache Physiologische Voraussetzungen: Absenkung des Kehlkopfes; Ausbildung entsprechender kortikaler Strukturen Sprechakt erzeugt 1) akustische Effekte und 2) soziale Effekte (Kommunikation/Beeinflussung) Sobald durch Laute soziale Effekte angestrebt werden (Warnruf etc.), kann Sprache als eigenständiger Verhaltensbereich gelten. Wichtige Weiterentwicklung: Sprache zur Beeinflussung zielgerichteten Verhaltens („Flieht in die Höhle!“) bzw. zur Aktivierung handlungsleitender Repräsentationen! BÜHLER’S Organonmodell der Sprache: Umwelt Symbol Sender Empfänger Sprache Ausdruck Appell 10.2. Die Ontogenese der Sprache Damit Sprache bzw. Kommunikation im Sinne einer Aktivierung handlungsleitender Repräsentationen gelingen kann, müssen 3 Voraussetzungen erfüllt sein: 1) Es müssen von vornherein bei beiden Kommunikationspartnern vergleichbare Repräsentationen vorliegen. 2) Die sprachlichen Äußerungen müssen mit den gemeinsamen Repräsentationen assoziiert werden (gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus) 3) Es muss gelernt werden, dass Sprache zur Aktivierung der mit ihnen assoziierten Repräsentationen eingesetzt werden kann. BRUNER: Mutter-Kind-Interaktion ist zu Beginn des Spracherwerbs in „Formaten“ organisiert (das „Was-Spiel“; das „Wo-Spiel“ etc.), durch deren stereotypen Ablauf sichergestellt wird, dass beim Kind zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Repräsentationen vorliegen (mentale Synchronisation). Außerhalb solcher „Formate“ ist die Zuordnung zw. Wort und Bedeutung selten eindeutig (Induktionsproblem). 80 MARKMAN nimmt an, dass das Induktionsproblem gelöst wird, indem bei der Zuordnung von Bedeutungen sog. „constraints“ verwendet werden. „Constraints“ sind Vorannahmen, an denen sich die Kinder beim Lernen von Wörtern orientieren; sie reduzieren bzw. beschränken die Anzahl der möglichen Bedeutungen eines Wortes! Folgende „Constraints“ (ab 18. Monat) sind zu unterscheiden: 1) Die Ganzheitsannahme Hört ein Kind in einer Benennungssituation neue Wörter, geht es davon aus, dass sich diese neuen Wörter auf ganze Objekte und nicht auf Objektteile oder Eigenschaften beziehen… 2) Die Taxonomieannahme …und dass die neuen Wörter „Dinge gleicher Art“, d.h. kategorial verbundene Objekte bezeichnen. 3) Die Disjunktionsannahme Die Disjunktionsannahme besagt, dass jedes Objekt nur eine einzige Bedeutung haben kann. Wenn ein Kind also schon eine Bezeichnung für ein Objekt kennt, geht es davon aus, dass neue Wörter sich auf etwas anderes (Objektteile oder Eigenschaften) beziehen. 10.3. Der Zweck von Sprache Der Spracherwerb dient nicht nur der Bezeichnung bereits bekannter Begriffe, sondern der Bildung neuer! Mittels Sprache werden Handlungserfahrungen einzelner sozialisiert. Schließlich haben wir mit den meisten Dingen, die wir sprachlich unterscheiden, nichts zu tun! Die zu dieser Unterscheidung notwendigen Erfahrungen haben andere für uns gemacht! Vor diesem Hintergrund kann zwischen handlungsbezogenen Begriffen und „Nennkategorien“ unterschieden werden. Erstere basieren v.a. auf funktionellen Merkmalen und persönlicher Erfahrung. Letztere basieren (aufgrund mangelnder Erfahrung) primär auf anschaulichen Merkmalen! Sprache dient a) dazu, bei anderen bestimmte Repräsentationen zu aktivieren und b) die eigenen Repräsentationen zu kontrollieren (Wir denken überwiegend sprachlich). 81 11. Objekterkennung 11.1. Wie sind Objekte bzw. Begriffe repräsentiert? 11.1.1. Einleitung Im objektbezogenen und sprachlichen Handeln werden bestimmte Reizwirkungen als äquivalent erlebt. Sie werden zu Invarianten bzw. Begriffen zusammengefasst und bilden unitäre Repräsentationen. Auf diese Weise ordnet die Wahrnehmung das Chaos verschiedener Reizwirkungen. Die Repräsentation eines Objektes entspricht dessen Antizipation; stimmen die eintretenden Reizwirkungen mit den erwarteten überein, werden sie identifiziert. Ein Objekt zu erkennen heißt insofern es wieder zuerkennen. 11.1.2. Abstraktionen und innere Struktur Begriffliche Äquivalenzklassen (Objektrepräsentationen) enthalten oft sehr unterschiedliche Exemplare und führen dementsprechend zu verschiedenen Reizwirkungen. Z.B. können „Stühle“ sehr unterschiedlich aussehen (Schaukelstuhl, Klappstuhl etc.). - Trotzdem werden sie erkannt. Offensichtlich abstrahieren Objektrepräsentationen von den Erscheinungsformen der einzelnen Exemplare! Dieselben Objekte erzeugen aus verschiedenen Perspektiven unterschiedliche Reizwirkungen. Trotzdem werden Objekte unabhängig von ihrer egozentrischen Lage erkannt. Objektrepräsentationen abstrahieren von den unterschiedlichen Perspektiven (Form- und Orientierungskonstanz)! Oft reichen nur einzelne Teile eines Objektes, um es zu identifizieren. Objektrepräsentationen haben eine interne Struktur; sie enthalten Informationen über die relative Lage der einzelnen Teile innerhalb des Ganzen. 11.1.3. Die Rolle von Erwartungen Je spezifischer die Erwartungen, desto schneller die Objektidentifikation. Objekte in kongruenten Szenen werden schneller entdeckt als Objekte in inkongruenten Szenen (s.o.): Die Topographie der Reize bietet den Referenzrahmen für die Suche nach Details („Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“). 11.2. Objektidentifikation bei unspezifischen Erwartungen 11.2.1. Die bevorzugte Identifikation von Basisbegriffen (Priorität in Taxonomien) Begriffe sind taxonomisch geordnet: Je nach Allgemeinheitsgrad, lässt sich zwischen übergeordneten, basalen und untergeordneten Begriffen unterscheiden. Fast jedes Objekt kann dementsprechend auf unterschiedlichen Ebenen identifiziert werden. Tier – Vogel – Geier; Pflanze – Blume – Veilchen; Nahrung – Frucht – Banane Objekte werden bevorzugt – und am schnellsten auf dem Niveau der Basisbegriffe eingeordnet und identifiziert (Priorität in Taxonomien). Darüber hinaus gibt es Hinweise, dass Kinder zuerst Basisbegriffe lernen. 82 Wodurch sind „Basisbegriffe“ gekennzeichnet? – Der Versuch einer Definition: 1) HOFFMANN: Basisbegriffe sind „die jeweils abstraktesten Begriffe innerhalb einer Taxonomie, die noch sensorisch repräsentiert werden“, die also noch gemeinsame anschauliche Merkmale aufweisen. Bei letzteren handelt es sich meistens um globale Merkmale (wie z.B. die äußere Form). Gemeinsame globale Merkmale sind allerdings weder notwendig noch hinreichend. Entscheidend ist die funktionale Äquivalenz! Experten zeichnen sich gerade dadurch aus, dass sie sich bei der Begriffsbildung weniger von globalen Merkmalen leiten lassen. Das Basisniveau ist für sie auf einer weniger abstrakten Ebene angesiedelt. Dementsprechend identifizieren z.B. Ornithologen eine Meise eher als Meise und nicht als Vogel. 2) Basisbegriffe sind die Begriffe innerhalb einer Taxonomie, deren Elemente am häufigsten als funktional äquivalent erlebt werden – und deren Elemente - zumindest meistens - gemeinsame globale Merkmale aufweisen. 11.2.2. Die bevorzugte Identifikation des Ganzen (Priorität in Partonomien) Begriffe sind nicht nur taxonomisch-, sondern auch partonomisch geordnet (z.B.: Mensch-Arm-Hand-Finger). Was jeweils Ganzes und was Teil ist, hängt vom Betrachtungsabstand ab. Unabhängig von der Perspektive jedoch gilt, dass das (vertraute) Ganze jeweils vor den einzelnen Teilen identifiziert wird (s.o.: „global superiority“). Das Ganze wird also nicht aus den nacheinander fixierten Details zusammengesetzt, sondern dient vielmehr als Referenzrahmen für die Suche nach Details. 11.2.3. Die bevorzugte Identifikation von Objekten in kanonischer Perspektive Objekte werden zwar prinzipiell aus allen Perspektiven erkannt, aus der kanonischen Perspektive jedoch am schnellsten: Die Zeit bis zur Identifikation steigt mit dem Winkelabstand von der vertrauten Perspektive linear an. Ergo: Objekte sind in ihrer vertrautesten Ansicht repräsentiert; werden sie in einer davon abweichenden Perspektive dargeboten, müssen sie erst „mental rotiert“ werden. Die Perspektivenabhängigkeit der Objektidentifikation hängt jedoch a) von der Vertrautheit des jeweiligen Objektes ab und b) davon, ob die Objektidentifikation von einzelnen Teilen und deren Lage abhängig ist (bei einem „b“ kommt es z.B. darauf an, dass der Bauch rechts und nicht links ist; bei einem „x“ ist die topographische Anordnung der Teile dagegen beliebig). Der „face inversion effect“: Die Identifikation von Gesichtern ist besonders erschwert, wenn sie auf dem Kopf stehen. Ursache: Die Erkennung von Gesichtern erfordert die Auswertung von Details (Nase, Mund etc.); wird ein Gesicht aus der kanonischen Perspektive dargeboten, stehen dazu hocheffektive Mechanismen zur Verfügung (Wahrnehmungsexpertise), bei ungewohnten Perspektiven nicht! Orientierungsabhängigkeit findet sich immer dann, wenn Details zu prüfen sind; sie nimmt ab, wenn die geforderte Identifikation aufgrund globaler Merkmale gelingt. 83 11.3. Modelle zur Objektidentifikation 11.3.1. Das Modell von Hoffmann Grundannahme: Die von einem Objekt (z.B. „Meise“) ausgehenden Reizwirkungen werden kontinuierlich für eine immer genauere Bestimmung der begrifflichen Identität genutzt. Ablauf: Am schnellsten gelingt die Zuordnung zu einer Basiskategorie („Vogel“); steht genügend Zeit zur Verfügung, dient die Basiskategorie als Bezugsrahmen für die Überprüfung von Details, so dass das Objekt evtl. auf einer untergeordneten Ebene identifiziert werden kann (Subklassifikation: „Meise“). Ist die Zuordnung zu einem Oberbegriff gefordert (Superklassifikation: „Tier“), muss abstraktes Wissen aktiviert werden. Superklassifikation („Tier“) Meise Globale Merkmale Basisidentifikation („Vogel“) Details Kategoriales Wissen Subklassifikation („Meise“) Dem Modell nach müssten Basisbegriffe am schnellsten- und untergeordnete Begriffe am langsamsten erkannt werden. Die Zuordnung zu einer übergeordneten Klasse setzt die Basisidentifikation voraus. HOFFMANN (1982): Subspezifikationen Hoffmann untersuchte verschiedene Klassifikationen in Abhängigkeit von der Darbietungsdauer. In einem ersten Schritt sollten die Pbn entscheiden, ob kurz dargebotene Objekte einem vorgegebenen Ober- oder Basisbegriff (z.B. „Tier“ oder „Blume“) zuzuordnen sind; danach wurden sie nach einer weiteren Spezifikation gefragt (Basisidentifikation oder Subklassifikation). Gelang den Pbn die Zuordnung zu einem Oberbegriff, konnte in fast allen Fällen auch der Basisbegriff genannt werden! Eine Subklassifikation gelang dagegen nur, wenn genügend Zeit für die Prüfung von Details zur Verfügung stand. ZIMMER & BIEGELMANN (1990): Gemeinsame globale Merkmale (Artifizielle) Basisbegriffe (geometrische Figuren) werden nur dann schneller identifiziert, wenn sie ein globales Merkmal gemeinsam haben! HOFFMANN & ZIEßLER (1985): Ist auf Begriffe, die derselben Basiskategorie angehören, jeweils mit derselben Hand zu reagieren (same-hand-mapping), sind die RTs kürzer als bei differenthand-mapping. Für Begriffe derselben Oberkategorie gilt dieser Effekt nicht. 11.3.2. Das Modell von Kosslyn et al. Im visuellen Puffer werden die visuellen Daten bzw. Reizwirkungen kurzfristig zur Verfügung gehalten, wobei Infos zum Ort der Reize und zu ihrer Qualität getrennt verarbeitet werden. Die oberflächliche Verarbeitung der Lokationen und der Merkmale erlaubt die Basisidentifikation („Vogel“). Durch letztere wird Wissen darüber aktiviert, welche Details an welchen Orten zu erwarten sind. Durch die Fokussierung der Aufmerksamkeit auf die entsprechenden Lokationen werden die Erwartungen überprüft und evtl. eine Spezifikation vorgenommen. Erkennen globaler Merkmale; nach KOSSLYN et al. auf der Integration von räumlichen- und merkmalsbezogenen Informationen. 84 11.3.3. „Recognition by components“ (Biederman) BIEDERMAN beschreibt die Objektidentifikation als sequentielle Zusammenfügung abstrakter Grundelemente. Daher: „recognition by components“! 1) Extraktion von Kanten: In einem ersten Schritt werden aufgrund von Diskontinuitäten in der Reizverteilung Kanten extrahiert, so dass man eine Art Strichzeichnung des Objektes erhält. 2) In einem zweiten Schritt werden die „nonaccidental features“ der Kanten bestimmt. Dabei handelt es sich um Kanteneigenschaften (z.B. gerade, gebogen, parallel, konvergierend etc.), die unabhängig von der jeweiligen Perspektive auf die zugrunde liegenden Körper schließen lassen. Gleichzeitig wird die Gesamtkonfiguration anhand von „Transversalitäten“ bzw. „Konkavitäten“ (in die Figur weisende Ecken) in Teilkörper zerlegt. 3) Im nächsten Schritt wird für jedes Teil bestimmt, um welche Art von Körper bzw. „Geon“ (geometric ion) es sich handelt. Dabei wird davon ausgegangen, dass es 36 solcher Grundkörper bzw. „Geone“ gibt (z.B.: Würfel, Zylinder etc.), die jeweils durch die „nonaccidental features“ ihrer Kanten definiert sind. 4) Abschließend wird die Anordnung der „Geone“ bestimmt und mit den im Gedächtnis gespeicherten Objektmodellen verglichen. Die Zuordnung erfolgt zum ähnlichsten Modell! Zur Unterstützung seines Modells zeigt BIEDERMAN, dass die Identifikation von Objekten v.a. von dem Vorhandensein der „nonaccidental features“ und der Unversehrtheit der Geonenstruktur abhängt. Kritik: Kaum zu beweisen und wenig plausibel! Wieso ausgerechnet 36 Geone etc. etc.?! Steht im Widerspruch zum Ansatz: „Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile“ 85 12. Gedächtnis und Wissen 12.0. Einleitung: Definition: Gedächtnis umfasst alle (Nach-)Wirkungen in der Vergangenheit gemachter Erfahrungen auf das gegenwärtige Verhalten. Lernen: Verhaltensänderung Gedächtnis: Bewahrung erlernten Verhaltens über die Zeit Die im Gedächtnis gespeicherten Informationen sind gleichermaßen Folge und Voraussetzung von Lernprozessen. Könnte Vergangenes nicht mit Gegenwärtigem in Beziehung gesetzt werden, wären keine Aussagen über die Zukunft – und damit kein V-E-Lernen und keine antizipative Verhaltenssteuerung möglich! Es ergeben sich zwei Behaltensnotwendigkeiten: 1) Kurzfristige Bewahrung von aufeinander folgenden Reizwirkungen – um Zusammenhänge herstellen zu können (UKZG, KZG). 2) Dauerhafte Bewahrung der verhaltenssteuernden Strukturen (LZG) Neuronale Plasitzität, d.h. die erfahrungsabhängige Veränderbarkeit kortikaler Strukturen, ist eine unbedingte Voraussetzung für die Gedächtnisbildung! 1) Veränderungen der Übertragung an bestehenden Synapsen Long Term Potentiation (LTP): langfristige Erhöhung der neuronalen Antwort nach hochfrequenter afferenter Reizung (Sensitivierung) Long Term Depression: längerfristige Reduktion der neuronalen Antwort nach niedrigfrequenter afferenter Reizung (Desensitivierung) 2) Veränderungen der Morphologie, Anatomie und chemischen Prozesse Tierexperimente zeigen: Eine reichhaltige Lernumgebung bewirkt eine stärkere neuronale Vernetzung in den geforderten Arealen; d.h. im Einzelnen: eine höhere Aktivität des Enzyms AChE (Acetylcholinesterase) => entsorgt synaptischen Transmitter und macht dadurch die Synapse für erneute Stimulation frei ein höheres Hirngewicht eine höhere Anzahl von Synapsen und Vergrößerung der synaptischen Kontakte eine stärkere Dendritenverzweigung und mehr „dendrite spines“ Erinnerungen sind neuronale Aktivierungsmuster, die vermutlich sowohl durch ihre Dynamik, als auch durch die beteiligten Neurone spezifiziert sind. Erinnerungen an Eindrücke verschiedener Sinnesmodalitäten sind wahrscheinlich in unterschiedlichen Neuronenpopulationen repräsentiert (lokalisierte Repräsentation). Dagegen wird die Spezifik der Erinnerung vermutlich durch die Dynamik der Aktivierungen in gleichen Neuronenpopulationen repräsentiert (verteilte Repräsentation). Ergo: Das Gedächtnis ist nicht mit einer Festplatte oder Bibliothek zu vergleichen; treffender ist der Vergleich mit einem Kaleidoskop, bei dem die gleichen Bausteine immer wieder verschiedene Muster ergeben. Das Mehrspeichermodell von ATKINSON & SHIFFRIN geht von 3 funktionell verschiedenen Gedächtnistypen bzw. Stadien der Informationsverarbeitung aus. 1) Das Ultrakurzzeitgedächtnis mit seinen verschiedenen Sinnesmodalitäten 2) Das Kurzzeitgedächtnis mit den darin ablaufenden Konsolidierungsprozessen 3) Das Langzeitgedächtnis mit seinen Strukturen und versch. Inhalten 86 12.1. Das Ultrakurzzeitgedächtnis (auch: sensorisches Register) Das UKZG entspricht der Wirkung von Reizen über die Dauer ihrer Präsenz hinaus. Die neuronale Antwort der Rezeptoren dauert länger als die Reize auf die Rezeptoren einwirken; dadurch bleiben für kurze Zeit alle Reize präsent. Das UKZG kann je nach Reizmodalität in verschiedene „Gedächtnisse“ unterteilt werden. Das visuelle oder ikonische UKZG dient der kurzfristigen „Speicherung“ visueller Informationen (0,5 Sekunden). SPERLING (1959): „Partial report“ –Methode Vpn bekommen für 50 ms eine aus 6 Buchstaben bestehende Matrix dargeboten. Methode des vollständigen Berichtens: Sollen die Vpn die gesamte Matrix wiedergeben, können sie nur 3-4 Buchstaben (50%) reproduzieren. Methode des teilweise Berichtens: Wird den Vpn dagegen durch einen Marker angezeigt, welchen der Buchstaben sie wiedergeben sollen, zeigt sich folgendes Ergebnis: Unmittelbar nach der Darbietung der Matrix können die Vpn jeden der Buchstaben wiedergeben; nach einer Verzögerung von 500 ms nur noch 50%. Ergo: Im visuellen UKZG wird - zumindest kurz (ca. 500ms) - die gesamte Information (Matrix) „gespeichert“! Das akustische oder echoische UKZG dient der kurzfristigen „Speicherung“ akustischer Informationen (2-4 Sekunden)! DARWIN et al. (1972): „Partial-report“-Methode Den Pbn wurden aus 3 an verschiedenen Orten befindlichen Lautsprechern jeweils 3 Items dargeboten. Nach einer Verzögerung von 0, 1, 2 oder 4 Sekunden wurde durch einen visuellen Marker angezeigt, welche 3 Items (aus welchem Lautsprecher) zu reproduzieren waren. Auch hier: „partial report“ besser als „whole report“; allerdings verfallen die Gedächtnisspuren akustischer Items offenbar langsamer als die Spuren visueller Items; „Speicherdauer“: 2 – 4 Sekunden. Da zurückliegende akustische Informationen im Gegensatz zu visuellen Infos nicht wiederbeschafft werden können (etwa durch einen „Blick zurück“), ist es sinnvoll, dass die Nachwirkung akustischer Reize etwas länger anhält! 12.2. Das Kurzzeit- bzw. Arbeitsgedächtnis 12.2.1. Konsolidierungsprozesse Dafür, dass nach einer Lernphase Konsolidierungsprozesse stattfinden, die der dauerhaften Speicherung des Gelernten dienen, sprechen 2 Befunde: Erstens, kann die Speicherung durch Traumata unterbunden werden; zweitens, kann sie durch entsprechende Substanzen angeregt werden. Retrograde Amnesie nach Traumata Nach einem abgeschlossenen Lernprozess wird ein Trauma gesetzt (z.B. durch Elektroschocks, Drogen etc.) und anschließend getestet, inwieweit das zuvor gelernte Verhalten noch umgesetzt werden kann. Ergebnis: Je kürzer die Konsolidierungsphase (Zeit zw. Lernende und Trauma), desto stärker die Amnesie. Je fortgeschrittener die Konsolidierungsphase, desto geringer die Wirkung des Traumas. Alternativerklärung: Das gelernte Verhalten wird mit dem Trauma assoziiert und deshalb nicht mehr ausgeführt; gespeichert worden ist es durchaus! 87 Umgekehrt kann die Speicherung des Gelernten durch stimulierende Drogen in der Konsolidierungsphase (nach dem Lernprozess) angeregt werden (=> Leistungsverbesserung)! 12.2.2. Ebbinghaus & Co EBBINGHAUS lernte sinnlose Silben auswendig und prüfte in unterschiedlichen Abständen, wie viele Wiederholungen er jeweils benötigte, um die Liste wieder vollständig zu können. Als Maß für die Gedächtnisleistung verwendete er also die Lernersparnis in Abhängigkeit von der Behaltensdauer! E = [(L1-L2)/L1] × 100 E= Ersparnis; L = Lernaufwand Auf diese Weise erstellte EBBINGHAUS seine berühmt gewordenen Gedächtniskurven, die als Beginn der experimentellen Gedächtnisforschung gelten. Die neuere Gedächtnisforschung arbeitet überwiegend mit „Recall“ (freie Reproduktion) und „Recognition“ (Wiedererkennung); insofern beschränkt sie sich auf das episodische Gedächtnis für verbalisierbare Inhalte. Nach HOFFMANN ist es jedoch sinnvoller, die Bewahrung verhaltenssteuernder Strukturen zu untersuchen! 12.2.3. Das Kurzzeitgedächtnis als Flaschenhals Das Mehrspeicher-Modell von ATKINSON & SHIFFRIN geht von einer sequentiellen Informationsverarbeitung aus. Das Kurzzeitgedächtnis wird dabei als weitgehend passiver Speicher beschrieben, in dem eine begrenzte Anzahl von Infos vorübergehend bewahrt wird, bevor diese Infos ins LZG übertragen werden können. Gleichzeitig müssen Infos aus dem LZG ins KZG übernommen werden, um verhaltenswirksam zu werden. Input UKZG KZG LZG Verhalten Behaltensdauer und Kapazität des KZG sind begrenzt; die Kapazität entspricht der sog. Gedächtnisspanne (Anzahl der in korrekter Reihenfolge reproduzierten Items) und umfasst ca. 7 plus/minus 2 Items. Einzelne Items (z.B. Buchstaben oder Zahlen) können jedoch zu größeren Informationseinheiten, sog. „chunks“ (z.B. Wörter etc.) zusammengefasst werden! Dadurch kann die verarbeitbare Menge an Infos erhöht werden! PETERSON & PETERSON (1961): Rückwärtszählen Sollen Pbn nach Darbietung dreier Items in Dreierschritten rückwärts zählen, sinkt die Behaltensleistung nach wenigen Sekunden drastisch ab. => Rückwärtszählen verhindert die Konsolidierung! Kritik am Flaschenhalsmodell: Um Reize zu identifizieren und „chunks“ zu bilden, müssen die Reize schon vor dem KZG mit den Inhalten des LZG in Beziehung gesetzt werden. Ergo: Keine rein sequentielle Informationsverarbeitung! Je unähnlicher bzw. distinkter das zu behaltende Material, desto besser die Leistung des KZG. Ergo: KZG ist kein passiver Speicher! Trotz Auslastung des KZG (ständiges Wiederholen einer „digit list“), können gleichzeitig dargebotene Sätze korrekt verifiziert werden (BADDELEY). Trotz Auslastung des KZG wird die Infoverarbeitung also nicht blockiert. Ergo: KZG ist kein Flaschenhals! 88 12.2.4. Arbeitsgedächtnis statt Kurzzeitgedächtnis A) Modell von Baddeley: Konsolidierung durch Wiederholung und Vorstellung BADDELEY zufolge sind die eingeschränkten Leistungen des KZG nicht auf mangelnde Kapazität zurückzuführen, sondern darauf, dass nur eine begrenzte Anzahl von Konsolidierungsprozessen zur selben Zeit ausgeführt werden kann. Ihm nach ist das Kurzzeitgedächtnis kein einfacher Zwischenspeicher, sondern ein modular aufgebautes Arbeitsgedächtnis, das aus einer zentralen Exekutive und zwei modalitätsspezifischen Dienstleistungssystemen besteht: Die zentrale Exekutive ist modalitätsunspezifisch und dient v.a. der Aufmerksamkeitslenkung und Kontrolle. Die artikulatorische oder phonologische Schleife („phonological loop“) ist für die Verarbeitung und Bereithaltung verbaler Informationen zuständig: Konsolidierung durch (verbale) Wiederholung! Bildhafte Infos werden im „visuell-räumlichen Notizblock“ („visuo-spatial – sketchpad“) verarbeitet: Konsolidierung durch anschauliche Vorstellung! Empirische Evidenz für die phonologische Schleife: Der Wortlängeneffekt: Die Behaltensleistung ist eine Funktion der Wortlänge. Es können in etwa so viele Wörter unmittelbar reproduziert werden, wie innerhalb von 2 Sekunden wiederholt werden können! Die begrenzten Leistungen des KZG sind nicht auf mangelnde Kapazität, sondern auf eine begrenzte Konsolidierung zurückzuführen! Die altersabhängige Steigerung der Gedächtnisspanne ist durch die zunehmende Artikulationsgeschwindigkeit bedingt Artikulatorische Suppression: Sollen Pbn während einer verbalen Gedächtnisaufgabe sinnlose Silben artikulieren, verschlechtert sich die Behaltensleistung! Mehr Zeit pro Item führt zu besseren Behaltensleistungen (mehr Zeit für Konsolidierung bzw. Wiederholung) Phonologisch ähnliche Items (z.B. B, C, D, G) werden schlechter behalten, da sie schwerer zu unterscheiden sind (s.o.). Empirische Evidenz für den visuell-räumlichen Notizblock: Sich die zu merkenden Dinge anschaulich vorzustellen ist eine effektive Gedächtnisstrategie. KIRKPATRICK (1894): Bilder von Objekten werden – v.a. auf lange Sicht – besser behalten als Bezeichnungen. BOWER (1972): Werden Pbn instruiert, Wortpaare (z.B. Hai und Zigarre) zu anschaulichen Bildern zu integrieren (z.B.: Zigarre rauchender Hai) erzielen sie bessere Behaltensleistungen. Empirische Evidenz für die Unterscheidung zwischen verschiedenen Konsolidierungssystemen bieten „systemspezifische Interferenzen“ bei der Bewältigung von Doppelaufgaben: Doppeldissoziation: Das Lernen einer Wortliste (verbales Wiederholen im phonological loop) wird durch die akustische Darbietung irrelevanter Wörter stärker gestört als durch das Einblenden irrelevanter Bilder; beim bildhaften Einprägen (visuo-spatial sketchpad) ist es umgekehrt. Das Einprägen von Phrasen wird je nach Instruktion (Pbn sollen die bezeichnete Handlung entweder ausführen oder sie sich bildahft vorstellen) entweder von motorischen Störungen oder von visuellen Störungen stärker beeinträchtigt. 89 Kritik (analog zur Kritik am Ressourcenmodell): Jede neu entdeckte Interferenz führt zur Annahme eines neuen Dienstleistungssystems. Z.B. konnte durch ein Experiment gezeigt werden, dass der visuo-spatial sketchpad in ein räumliches und ein visuelles System zu unterteilen ist. Insofern beschreibt das Modell eher als zu erklären! B) Konsolidierung durch Handeln (der „Tu-Effekt“) Die Speicherung von Informationen wird nicht nur durch deren bildhafte Veranschaulichung verbessert, sondern auch durch entsprechende Handlungen bzw. deren Planung. ENGELKAMP (1980): Der „Tu-Effekt“ (in self-performed tasks) ENGELKAMP konnte zeigen, dass das Behalten von Verb-Objekt-Phrasen (z.B.: „Computer einschalten“) durch die - symbolische oder tatsächliche Ausführung der bezeichneten Handlung verbessert wird. In weiteren Experimenten zeigte ENGELKAMP, dass bereits das Planen einer Handlung zu einer Verbesserung der Behaltensleistung führt. Daraus schließt er, dass der „Tu-Effekt“ sich aus einer Planungs- und einer Ausführungskomponente zusammensetzt. C) Konsolidierung durch unterschiedliche Verarbeitungsschritte „Level of Processing“- Hypothese: Statt von verschiedenen Gedächtnistypen auszugehen, gehen CRAIK & LOCKHART von verschiedenen Verarbeitungsebenen aus. Je „tiefer“ die Verarbeitung einer Information, desto umfassender wird diese gespeichert und später erinnert, so die Theorie. CRAIK & TULVIG (1975): Verarbeitungstiefe Pbn bekamen verschiedene Wörter dargeboten. Nach jedem Wort sollten sie entweder entscheiden, ob das betreffende Wort in Groß- oder Kleinbuchstaben geschrieben war (sensorische Verarbeitung), ob es sich auf ein vorgegebenes Wort reimt (phonetische Verarbeitung) oder ob es in einen vorgegebenen Satz passt (semantische Verarbeitung). Es zeigte sich zweierlei: Erstens, war die Behaltensleistung (RecognitionTest) umso größer, je „tiefer“ die Verarbeitung. Zweitens, war die Verarbeitungstiefe unabhängig von der Verarbeitungszeit! „Transfer Appropriate Processing“: MORRIS, BRANSFORD et al. widerlegten die Grundannahme von CRAIK & LOCKHART. Es ist keineswegs so, dass eine „tiefere“ Verarbeitung generell zu einer besseren Behaltensleistung führt. Vielmehr werden auf den verschiedenen Verarbeitungsebenen unterschiedliche Merkmale bevorzugt gespeichert. Der Unterschied ist also weniger quantitativer-, als vielmehr qualitativer Art: Verarbeitungsspezifität statt Verarbeitungstiefe! MORRIS, BRANSFORD et al. (1977): Testet man die Behaltensleistung nicht mit einem Recognition-, sondern einem Reim-Test, ergibt sich für die „flachere“ Verarbeitung ein Vorteil! D) Konsolidierung durch emotionale Erregung (flashbulb memory) Emotional hervorgehobene Ereignisse werden besser gespeichert. – Eine Folge der emotionalen Erregung oder des „von Restorff Effekts“?! Der „von Restorff Effekt“ besagt, dass hervorgehobene bzw. andersartige Items in einer ansonsten homogenen Liste besonders gut gelernt werden. 90 12.2.5. Fazit zum Arbeitsgedächtnis Das „working memory“-Konzept betont die „mentale Arbeit“, die für die Speicherung von Informationen notwendig ist. Nicht die Reize an sich determinieren die Gedächtnisbildung, sondern deren Verarbeitung bzw. Konsolidierung. Was letztlich gespeichert wird, die sog. „Gedächtnisspur“, die davon abhängt, auf welche Reizeigenschaften sich die Verarbeitung konzentriert. Werden in der Testsituation genau die Merkmale abgefragt, die zuvor bevorzugt verarbeitet wurden, ist die Erinnerungsleistung am besten („transfer appropriate processing“). Verschiedene Konsolidierungsprozesse bzw. Formen mentaler Arbeit: Organisation (Chunking, hierarchische Strukturierung etc.) Elaboration (Eselsbrücken, Verknüpfung mit Vorwissen etc.) Wiederholung Anschauliche Vorstellung (Loci-Methode etc.) Motorische Verankerung (Tu-Effekt) 12.3. Das Langzeitgedächtnis 12.3.1. Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Inhalten im LZG Ein Inhalt ist im LZG gespeichert, wenn die ihn repräsentierenden Aktivationsmuster prinzipiell reproduzierbar sind. Oft sind Inhalte zwar gespeichert (available), aber aktuell nicht zugänglich (accessible). „Feeling of Knowing“ (FOK): Sachverhalte, die man glaubt zu wissen, werden in der Regel wiedererkannt oder durch Erinnerungshilfen (z.B. Anfangsbuchstaben) reproduzierbar. „Tip of Tongue“ (TOT): Das gesuchte Wort liegt einem auf der Zunge, kann aber nicht ausgesprochen werden. FOK und TOT deuten darauf hin, dass Erinnerungen nichts Ganzheitliches sind, sondern in unabhängigen Teilen repräsentiert sind; deshalb können oft nur Teile des gesuchten Aktivitätsmusters reproduziert werden. Erinnerungshilfen („retrieval cues“): 1) Recognition statt Recall: Items werden leichter wiedererkannt als reproduziert! 2) Kategorisierung der Items MANDLER (1967): Je mehr Kategorien, desto besser MANDLER ließ 52 Items frei kategorisieren. Je mehr Kategorien die Pbn dabei bildeten (2 bis 7), desto besser konnten sie die Items später reproduzieren. TULVIG et al. (1966): Kategorienhinweise als retrieval cues Wurden den Pbn die Kategorien der zuvor gelernten Wörter genannt, konnten sie diese besser reproduzieren! 3) Situativer Kontext als Hinweis BADDELEY (1975): Lernen und Erinnern über und unter Wasser An Land gelernte Wortlisten werden besser an Land-, unter Wasser gelernte Wortlisten besser unter Wasser reproduziert! 4) Der „innere“ Kontext („mood congruent recall“?!) Fazit: Sachverhalte, die in einem räumlich-zeitlichen- oder sachlichen Zusammenhang zum zu erinnernden Sachverhalt stehen oder diesem in anderer Weise ähnlich sind, erleichtern die Erinnerung an diesen. Erklärung: Muster, die schon zusammen aktiv waren, haben die Tendenz, sich erneut gegenseitig hervorzurufen! 91 12.3.2.Verschiedene Inhalte des LZG Das LZG lässt sich in ein explizites- und implizites Gedächtnis unterteilen: Das explizite Gedächtnis umfasst bewusst verfügbare Wissensinhalte, die verbalisiert werden können und deshalb auch als deklaratives Wissen bezeichnet werden („Was-Wissen“). Dazu gehört das Sprach-, Sach- und Weltwissen einer Person (semantisches Gedächtnis) ebenso wie das Wissen um persönlich erfahrene Episoden (episodisches Gedächtnis). Die im impliziten Gedächtnis gespeicherten Inhalte sind unbewusst und werden als nicht-deklaratives Wissen bezeichnet („Wie-Wissen“). Dazu gehört zum einen das prozedurale Wissen einer Person. Damit sind psychomotorische und kognitive Fertigkeiten wie Skifahren oder Rechnen gemeint; also Handlungsabläufe und Fertigkeiten, die aufgrund hinreichender Übung automatisiert ablaufen. Ebenfalls unbewusst und damit dem impliziten Gedächtnis zuzuordnen ist das perzeptuelle Gedächtnis einer Person, das die schnellere Erkennung „geprimter“ Reize ermöglicht. Beim „priming“ („vorwärmen“ bzw. vorbereiten) wird die Wahrscheinlichkeit, einen Reiz wiederzuerkennen dadurch erhöht, dass zuvor ein assoziativ damit verknüpfter Gedächtnisinhalt aktiviert wird. Diese „assoziative Aktivierung“ kann bewusst oder unbewusst (subliminal) erfolgen. Explizites Gedächtnis (deklarativ) Episodisches Gedächtnis Semantisches Gedächtnis Implizites Gedächtnis (nicht-deklarativ) Prozedurales Gedächtnis Perzeptuelles Gedächtnis Beim episodischen und prozeduralen Gedächtnis handelt es sich um verschiedene Gedächtnissysteme, da die Konsolidierung und Reproduktion der verschiedenen Inhalte unabhängig voneinander beeinflusst werden können! Das zeigen zum einen Läsionsstudien mit Amnesie-Patienten, zum anderen Experimente mit indirekten (impliziten) Gedächtnistests. Dissoziation zwischen episodischem Erinnern und prozeduralem Lernen bei Amnesiepatienten. Der Patient H.M.: Prozedurales Lernen ohne Erinnerung Aufgrund einer Epilepsie wurden H.M. u.a. große Teile des Hippocampus und der Amygdala entfernt. Folge: anterograde Amnesie (kein episodisches Gedächtnis) Obwohl sich H.M. an keine der Lernepisoden erinnern konnte, lernte er in diesen u.a., Wörter in Spiegelschrift zu lesen oder Figuren nachzuzeichnen. H.M. bildet Gedächtnisspuren aus, die zwar verhaltenswirksam sind, aber nicht bewusst erinnert werden können (Prozedurales G. ≠ Episodisches G.) Ähnliche Befunde gibt es auch zu anderen Patienten. Z.B.: Signifikante Verbesserung in seriellen Reaktionszeitaufgaben (SRT), obwohl die ständige Wiederholung derselben Sequenz nicht bewusst bemerkt wird. 92 Auch bei Gesunden lassen sich Dissoziationen zwischen explizitem Erinnern und implizitem Lernen nachweisen. Dabei verzichtet man auf eine explizite Erinnerungsinstruktion. Beispielsweise lässt man die Pbn in der „Lernphase“ Wortlisten bearbeiten (Kategorien benennen, Vokale zählen etc.) – ohne dabei einen Gedächtnistest anzukündigen. In der 2. Phase lässt man die Pbn implizite Gedächtnistests bearbeiten: z.B. Wortstämme vervollständigen, Bildfragmente benennen, Wörter assoziieren etc. Ein Teil der geforderten Antworten entspricht dabei den in der ersten Phase bearbeiteten Items. Werden diese häufiger und/oder schneller genannt als „inkongruente“ (d.h.: in der Lernphase nicht vorgekommene) Antworten, gilt dieser Priming-Effekt als Indiz für implizite Gedächtnisspuren. Explizites und implizites Lernen beruhen auf unterschiedlichen Verarbeitungs- bzw. Konsolidierungsprozessen. GRAF & MANDLER (1984): Semantische- vs. sensorische Verarbeitung In der „Lernphase“ sind die dargebotenen Wörter entweder zu kategorisieren (semantische Verarbeitung) oder hinsichtlich ihrer Schriftart zu beurteilen (sensorische Verarbeitung). In der „Testphase“ werden die Pbn entweder dazu aufgefordert, die vorgegebenen Wortstämme anhand der zuvor dargebotenenoder anhand beliebiger Wörter zu ergänzen (expliziter- vs. impliziter Gedächtnistest). Die semantische Verarbeitung führt beim expliziten Gedächtnistest zu besseren Leistungen; die sensorische Verarbeitung beim impliziten Gedächtnistest! Die bisher besprochenen Befunde können verschieden interpretiert werden: 1) Das episodische und das prozedurale Gedächtnis sind verschiedene, voneinander unabhängige Systeme innerhalb des LZG; die Ausbildung episodischer Gedächtnisspuren beruht dementsprechend auf anderen Prozessen als die Veränderung verhaltenssteuernder Strukturen! 2) Die gefundenen Dissoziationen beruhen nicht auf unterschiedlichen Gedächtnisspuren, sondern auf unterschiedlichen Zugängen. Bei anterograden Amnesien z.B. werden die Gedächtnisspuren durchaus noch gebildet, sie sind dem Bewusstsein lediglich nicht mehr zugänglich. 12.3.3. Semantisches LZG Das semantische, abstrakte Wissen wird oft als eigenständiger Gedächtnisinhalt beschrieben. Es ist im Gegensatz zum episodischen und prozeduralen Wissen kontextunabhängig und amodal repräsentiert, so die These. Ein Beispiel für dieses Konzept ist das multimodale Gedächtnismodell von ENGELKAMP, demzufolge sich die Verarbeitung von Infos zwischen den Polen sensorisch – motorisch und verbal – nonverbal bewegt. Ausgehend davon werden 3 Gedächtnissysteme postuliert: ein nonverbales sensumotorisches System (prozedurales Gedächtnis) ein verbales sensumotorisches System (episodisches Gedächtnis) und ein konzeptuelles System (semantisches Gedächtnis) Argumente für ein abstraktes, amodales „semantisches Gedächtnis“: Viele Informationen sind kontextunabhängig gespeichert: wir kennen zwar die Fakten, wissen aber nicht, wo, wann und wie wir sie gelernt haben. Experimentelle Evidenz (BRANSFORD et al.): Werden Pbn in einer Lern- und Testphase jeweils verschiedene Sätze selben Inhalts dargeboten, werden diese fälschlicherweise wiedererkannt! 93 HOFFMANN geht dagegen davon aus, dass das semantische Wissen - unter Einschluss des sprachlichen Wissens - ein Teil des prozeduralen Gedächtnisses ist! Wie jedes Wissen basiert auch das semantische Wissen auf konkreten Handlungserfahrungen (S-V-E-Lernen); schließlich ist auch Sprache (und damit sprachliches Lernen) Handeln! Beim Sprechen lernen wir Klangbilder zu erzeugen; beim Lesen Schriftbilder zu benennen und beim Schreiben, Schriftbilder zu generieren. Der Unterschied zwischen semantischem und episodischem Wissen besteht lediglich darin, dass bei ersterem von den zufällig wechselnden Kontexten abstrahiert wird, wobei die Repräsentation semantischen Wissens trotzdem nicht amodal ist! Ein Apfel ist zwar nicht kontextspezifisch, aber trotzdem als visuellanschauliche Vorstellung repräsentiert! 12.4. Wissensstrukturen im LZG 12.4.1. Handlungsstrukturen Der Aufbau von Wissen ergibt sich aus der Abstraktion von Handlungserfahrungen. Handlungen sollten demnach im Zentrum der im Gedächtnis gespeicherten Wissensstrukturen stehen. KLIX spricht in diesem Zusammenhang von „Geschehenstypen“. Im Zentrum stehen jeweils Handlungen bzw. Verben; die übrigen Sachverhalte (Akteur, Objekt, Ort, Rezipient etc.) sind den Handlungen zugeordnet. Empirische Befunde: HOFFMANN (1980): Reproduktion von Wortlisten nach Geschehenstypen Pbn bekommen 6 Mal dieselbe Wortliste in verschiedener Reihenfolge dargeboten. Die Wortliste enthält 4 verschiedene Geschehenstypen, zu denen jeweils ein Akteur, eine Handlung, ein Objekt und ein Instrument gehören (z.B.: Hausfrau – Putzen – Fenster – Lappen). Nach jeder Darbietung werden die Pbn gebeten, die Wortliste frei zu reproduzieren. Mittels einer hierarchischen Clusteranalyse wird ausgewertet, wie oft welche Begriffe nacheinander reproduziert wurden. Ergebnis: Die zu einem Geschehenstyp gehörenden Begriffe werden am häufigsten zusammenhängend reproduziert. Der Effekt verschwindet jedoch, wenn die Handlungsbegriffe durch passende Ortbegriffe (z.B. statt „putzen“ „Wohnung“) ersetzt werden. Ergo: Es scheinen tatsächlich die Handlungen zu sein, durch die die zu ihnen passenden Begriffe (Akteur etc.) untereinander verbunden sind. Handlungsschemata werden auch dazu genutzt, nicht explizit mitgeteilte oder fehlende Informationen im Gedächtnis zu ergänzen. Hören Pbn z.B. eine Geschichte, in der ein Indianer verwundet wird, erinnern sich später viele an einen Pfeil, obwohl davon in der Geschichte gar keine Rede war („reconstructive memory“). 12.4.2. Taxonomische Strukturen Unser Wissen über Objekte, Akteure, Rezipienten etc. ist hierarchisch geordnet. Logisch, da je nach Handlungskontext unterschiedliche Begriffe äquivalent sind. Hat man Durst, kommt es nicht darauf an, was man trinkt; bei einem guten Essen schon! Begriffliches Wissen enthält sowohl anschauliche Merkmale, anhand derer man die Elemente einer Kategorie erkennen kann, als auch abstrakte, über Sprache vermittelte Merkmale. 94 Nach COLLINS & QUILLIAN (1969) ist unser Wissen in semantischen Netzwerken organisiert. Ein Begriff ist diesem Ansatz zufolge durch seine Verknüpfung mit anderen Begriffen und seine spezifischen Attribute repräsentiert. Die Speicherung der Attribute erfolgt der Theorie zufolge nach dem Prinzip der „kognitiven Ökonomie“. Attribute werden immer nur auf der höchstmöglichen Hierarchieebene abgespeichert. Direkt zugeordnet sind den verschiedenen Begriffen also immer nur deren spezifischen Merkmale bzw. die Merkmale, die sie von den nebengeordneten Begriffen unterscheiden! Die Aktivierung eines Knotens bzw. Begriffes führt dabei der Theorie zufolge automatisch zur Aktivierung weiterer, im Umkreis befindlicher Knoten („spreading of activation“) (=> Daher auch die Priming-Effekte). Die Annahmen des semantischen Netzwerkmodells lassen sich mit Reaktionszeitexperimenten gezielt prüfen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Bestätigung einer Aussage umso länger dauert, je mehr Knoten zu ihrer Verifikation durchlaufen werden müssen. Die Aussage, dass Vögel fliegen können, kann z.B. schneller bestätigt werden als die Aussage: Kanarienvögel können fliegen. Erklärung: Das Attribut „Flugfähigkeit“ ist nur auf der Ebene „Vogel“ abgespeichert. Kritik: Es gibt auch Befunde, die dem semantischen Netzwerkmodell widersprechen. 1) ROSCH: Es gibt typische und weniger typische Elemente innerhalb einer Kategorie (Typikalität); daher kommt es, dass z.B. eine „Ente“ eher der Kategorie „Tier“ als der Kategorie „Vogel“ zugeordnet wird. 2) Die Beziehungen zwischen den versch. Begriffen bzw. Kategorien sind nicht immer transitiv: Ein Skalpell ist z.B. ein Messer und ein Messer ist ein Küchengerät; aber ein Skalpell ist kein Küchengerät! Alternativmodell von SMITH et al.: Die taxonomischen (kategorialen) Beziehungen zwischen den einzelnen Begriffen sind nicht explizit repräsentiert. Stattdessen werden begriffliche Zuordnungen jedes Mal neu geprüft, indem die jeweils gespeicherten Merkmale mental miteinander verglichen werden. Soll beispielsweise die Aussage verifiziert werden, dass Enten Vögel sind, werden zunächst die jeweils gespeicherten charakterisierenden Merkmale miteinander verglichen. Werden dabei noch nicht genug Übereinstimmungen gefunden (mittlere Übereinstimmung), werden die definierenden Merkmale von „Vogel“ aktiviert und geprüft, ob sie auch für „Ente“ zutreffen. Fazit: Vermutlich treffen beide Modelle zu. Individuell häufig erlebte/besprochene kategoriale Beziehungen sind vermutlich direkt gespeichert, während seltene, ungewöhnliche Beziehungen erst abgeleitet werden müssen. 12.4.4. Topographisches Wissen: frames Topgraphisches Wissen hat Einfluss auf die Gedächtnisleistung, insofern letztere davon abhängt, wieweit das zu speichernde Material zu den bereits gespeicherten Schemata passt. Topographisches Wissen ist das Wissen darüber, wie die Teile von vertrauten Ganzheiten typischerweise angeordnet sind. Vertraute Ganzheiten bzw. Szenen, die das Einordnen und Speichern von Einzelheiten erleichtern, werden „frames“ genannt. 95 Empirische Befunde: MANDLER et al.: Die Bedeutung von frames Den Pbn werden Bilder mit verschiedenen Objekten dargeboten. Letztere sind entweder ungeordnet oder Teil einer typischen Szene (z.B. Straßenszene). In einem Wiedererkennungstest werden dieselben und ähnliche Bilder noch einmal dargeboten. Ergebnis: Nach 4 Monaten können sich die Pbn an Art und Anordnung der Objekte nur dann erinnern, wenn diese in organisierten Bildern dargeboten worden waren. CHASE & SIMON (1973): Schachexperten Schachexperten erinnern sich nur dann signifikant besser an die Positionen von Schachfiguren, wenn es sich dabei um regelgerechte Stellungen handelt. 12.4.5. Sequentielles Wissen: Skripts Die Gedächtnisleistung wird nicht nur durch die räumliche Topographie, sondern auch durch den zeitlichen Ablauf von Ereignissen beeinflusst. Häufig wiederkehrende Ereignisse und Handlungsabläufe wie z.B. ein Restaurantbesuch sind in Form sog. Skripts (schematisierte „Drehbücher“) gespeichert. Empirische Befunde: BREWER & TENPENNY (1996) konnten zeigen, dass v.a. schema-konsistente und schema-inkonsistente (auffällige) Elemente eines Restaurantbesuchs behalten werden; schema-irrelevante Infos dagegen schnell vergessen werden. Erinnerungen werden oft durch schematypische Details ergänzt („reconstructive memory“). 12.4.6. Schemata allgemein Schemata werden meist als übergeordnete Wissensstrukturen definiert, die dazu dienen, die Umwelt und unser Wissen darüber (taxonomisch, topographisch, sequentiell etc.) zu organisieren. frames = topographische Schemata; skripts = sequentielle Schemata; etc. Nach HOFFMANN sollte man sich Schemata jedoch nicht als feste Strukturen (im Sinne statischer Gedächtniseintragungen) denken. Ihm zufolge entsteht alles, was wir erinnern, erst im Moment des Erinnerns selbst. Häufig erfahrene Aktivierungsmuster haben dabei die Tendenz, sich zu wiederholen. Ein Schema ist demnach lediglich die Tendenz zur Wiederholung bestimmter Aktivierungsmuster: Folgen auf Aktivierung A häufig die Aktivierungen B und C; führt A automatisch zur Antizipation von B und C. 96 97