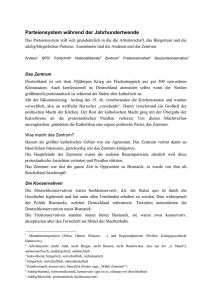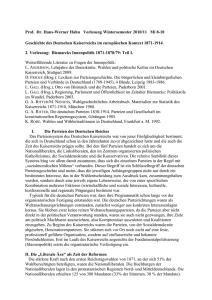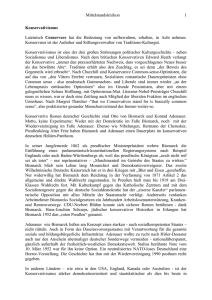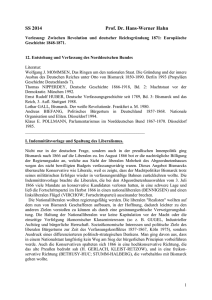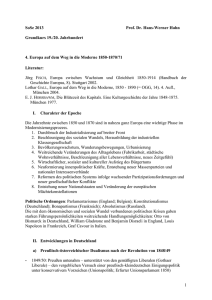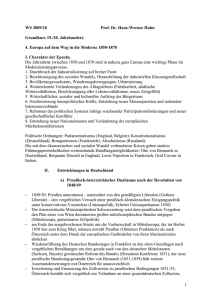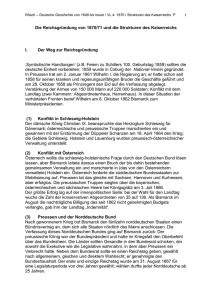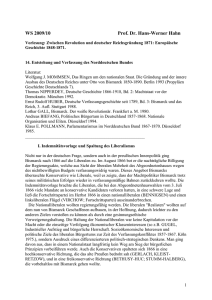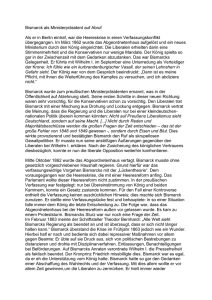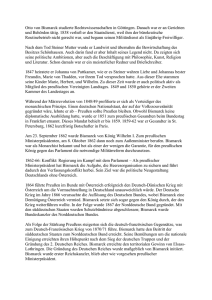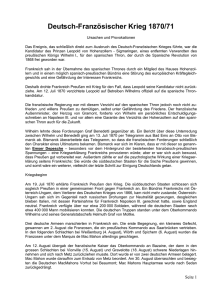VorlesungSS14-skript13
Werbung

SS 2014 Prof. Dr. Hans-Werner Hahn Vorlesung: Zwischen Revolution und deutscher Reichsgründung 1871: Europäische Geschichte 1848-1871. 13. Deutsche Integrationspolitik und französische Reaktionen I. Der Norddeutsche Bund und die süddeutschen Staaten: Alle vier süddeutschen Staaten - die Königreiche Bayern und Württemberg sowie die Großherzogtümer Baden und Hessen-Darmstadt - hatten im Krieg von 1866 auf der Seite Österreichs gestanden, obwohl seit der Zollvereinsgründung von 1834 enge wirtschaftliche Bindungen an Preußen bestanden und obwohl es auch in diesen Staaten durchaus eine teileise beachtliche kleindeutsch-liberale Parteirichtung gab (vor allem in Baden und HessenDarmstadt). Der Hauptgrund für die Haltung der Monarchen in den süddeutschen Staaten lag in ihrer Furcht vor einer preußischen Hegemonie und in der Sorge vor Einbußen staatlicher Eigenständigkeit (Eine Ausnahme bildete hier das Großherzogtum Baden). Süddeutsche Deutschland-Politik nach dem Krieg von 1866: Baden mit seiner liberalen Regierung und dem auch aus verwandtschaftlichen Gründen propreußischen Großherzog Friedrich I. entwickelte sich nach 1866 sehr schnell wieder zum Parteigänger Preußens und setzte auf eine rasche Integration des Südens in den Norddeutschen Bund. Das Großherzogtum Hessen(-Darmstadt) betrieb unter Großherzog Ludwig III. und seinem Ministers DALWIGK nach wie vor eine antipreußische Politik. Dieser Kurs stieß aber auf heftige Kritik im eigenen Lande. Auch außenpolitisch besaß Hessen-Darmstadt kaum Handlungsspielraum, weil fast die Hälfte des Staatsgebietes nördlich des Mains lag und damit zum Norddeutschen Bund gehörte. BAYERN und WÜRTTEMBERG betrieben unter den Regierungschefs HohenloheSchillingsfürst und Varnbüler eine Politik, die die Eigenständigkeit bewahren wollte, aber auch den neuen Realitäten Rechnung zu tragen suchte (wirtschaftliche Abhängigkeit vom Norden, kleindeutsche Partei im eigenen Land, sicherheitspolitische Bedürfnisse). Ausgehend von Bayern gab es 1866/67 Diskussionen über einen eigenen SÜDBUND. Dieser Bund, der in lockerer Form mit dem Norden verbunden sein sollte, scheiterte aber am bayerischen Hegemonieanspruch, anderen inneren süddeutschen Zwistigkeiten und der Obstruktionspolitik, die Bismarck über Baden betrieb. Eine sofortige Integration der süddeutschen Staaten musste am Widerspruch Frankreichs und Österreichs, aber auch an der Abwehr der partikularen Kräfte im Süden scheitern. Bismarck war hier realistisch. Aber er wollte schon 1866/67 Voraussetzungen für einen späteren Anschluss schaffen und vor allem alles vermeiden, was wie der Südbund diese Integration erschwerte. In dieser Haltung wurde Bismarck von den Nationalliberalen kräftig unterstützt. Auch sie betonten die Notwendigkeit eines Anschlusses des Südens. Aus Sicht der Liberalen musste die Vollendung des Nationalstaates vorangebracht werden. Zudem versprachen sie sich von der Integration des Südens ein stärkeres Gewicht in der deutschen Politik. Bismarck wollte die Integration, weil auch aus seiner Sicht die Nationalstaatsgründung noch unvollendet war, der nationale Gedanke für eine konservative Strategie aber nur dann zu benutzen war, wenn man ganz auf ihn einging. Bis 1866 war das Spiel mit der Nationalidee für Bismarck weitgehend taktischer Natur gewesen. Jetzt begann er damit, die nationale Idee als Integrationsklammer für eine konservative, standes-, klassenund konfessionsübergreifende Politik einzusetzen, weil alte monarchische und konfessionelle Bindungen allein nicht mehr auszureichen schienen (Funktionswandel des Nationalismus). 1 Literatur zu den integrationspolitischen Fragen: - Th. NIPPERDEY, Deutsche Geschichte 1866-1918, 1. Bd., Arbeitswelt und Bürgergeist, München 1990 (mit guten Ausführungen zu den Religionsfragen) 2. Bd.: Machtstaat vor der Demokratie, München 1992. - R. WILHELM, Das Verhältnis der süddeutschen Staaten zum Norddeutschen Bund 18671870. Husum 1978. - H. BÖHME, Deutschlands Weg zur Großmacht. Studien zum Verhältnis von Wirtschaft und Staat 1848-1881, 3. Aufl. Köln 1974. Integrationsversuche und Integrationsblockaden: Bismarck bereitete die aus seiner Sicht erforderliche Integration Süddeutschlands Wege nach 1866 zunächst vor allem auf zwei Wegen vor: a) Militärpolitische Vorbereitung: Sofort nach dem Krieg von 1866 zwang Bismarck die besiegten süddeutschen Staaten zum Abschluss so genannter Schutz- und Trutzbündnisse mit Preußen. Diese zunächst geheim gehaltenen Verträge sahen eine gegenseitige militärische Unterstützung bei jeder Verletzung der Integrität des jeweiligen Staatsgebietes vor, unterstellten die süddeutschen Truppen im Verteidigungsfall dem preußischen König und waren weder befristet noch kündbar. Damit war der Süden auf militärpolitischem Gebiet eng an Preußen angekoppelt. Zugleich schuf Bismarck bessere Voraussetzungen für einen Krieg mit der Macht, die der Integration des Südens am feindlichsten gegenüberstand, also Frankreich. Sehr früh wurden bereits gemeinsame Aufmarschpläne gegen Frankreich entwickelt. Bezeichnenderweise machte Bismarck die Bündnisverträge mit dem Süden 1867 angesichts der Luxemburg-Krise (Drohung gegen Frankreich) öffentlich bekannt. Ist Bismarck damit nicht von Anfang an auf die militärische Lösung der deutschen Frage zugesteuert? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach. Bismarck hat die militärische Lösung nicht ausgeschlossen, hat aber zunächst einmal auch andere Wege zur Integration des Südens versucht. Im übrigen hätte auch eine liberale norddeutsche Regierung vermutlich zu keiner friedlicheren Politik geführt, da die deutschen Liberalen sich noch klarer zu einem "gerechten" Einigungskrieg gegen Frankreich bekannten als Bismarck, der in seinen Entscheidungen stärker als die Liberalen die Architektur des gesamten europäischen Staatensystems vor Augen hatte. Die schwierige gesamteuropäische Situation hat Bismarck nach 1866 bekanntlich auch veranlasst, zunächst einmal auf einen evolutionären Anschlusskurs zur Vollendung der deutschen Einheit zu setzen. b) Deutsche Integrationspolitik mit Hilfe des Zollvereins: Durch den Krieg von 1866 waren die bisherigen Zollvereinsverträge erloschen. Nördlich des Mains wurde durch die neue Verfassung ein einheitlicher Wirtschaftsraum geschaffen. Der bisherige staatenbündisch strukturierte Zollverein wurde hier also überflüssig. Gegenüber den vier süddeutschen Staaten wurden die alten Zollvereinsverträge nach dem Friedensschluss von Preußen zunächst nur provisorisch wieder in Kraft gesetzt. Da der Süden wirtschaftlich in hohem Maße auf den Norden angewiesen war und nicht auf die zollpolitische Anbindung verzichten konnte, hatte Bismarck ein weiteres wichtiges Druckmittel in der Hand. Die süddeutschen Staaten mussten am 8. Juli 1867 neue Zollvereinsverträge unterzeichnen, die den bisherigen Zollverein von einem Zoll-Staatenbund in einen Zoll-Bundesstaat umwandelten. Der neue Zollverein erhielt eine dem Norddeutschen Bund entsprechende Verfassung (allerdings nur bezogen auf die Zollgesetzgebung). Die Einzelstaaten verloren ihr bisheriges Vetorecht, mussten sich also nun auch juristisch der preußischen Hegemonie unterordnen und Mehrheitsentscheidungen akzeptieren. Hinzu kam ein Zollparlament, das 2 sich aus den Abgeordneten des Norddeutschen Reichstages und 85 nach dem allgemeinen Wahlrecht gewählten Abgeordneten des Südens zusammensetzte. Bayern opponierte bis zuletzt gegen das Zollparlament, das Bismarck und die Nationalliberalen bewusst als Einigungsmotor installieren wollten. Die Zollparlamentswahlen im Februar 1868 brachten dann aber für Bismarck und die Liberalen ein enttäuschendes Ergebnis. Die große Mehrheit des Südens votierte in einer Protestwahl gegen eine drohende "Verpreußung" für Kandidaten, die die Funktionen des Zollparlamentes auf die rein handelspolitischen Aufgaben beschränken wollten (bayerische und württembergische "Partikularisten"/Patrioten, politischer Katholizismus, großdeutsche Demokraten). Damit waren die Chancen auf einen evolutionären, von den wirtschaftlichen Sachzwängen forcierten Integrationskurs gegenüber dem deutschen Süden deutlich gesunken. Nach dem für Bismarck und die Nationalliberalen negativen Ausgang der Zollparlamentswahlen konnten die eine rasche Integration hemmenden Faktoren auch in den ersten Sitzungsperioden des Zollparlaments nicht überwunden werden. Der Antrag der nationalliberalen Abgeordneten Metz, Bamberger (Hessen-Darmstadt) und Bluntschli (Baden), mit Hilfe des Zollvereins "eine vollständige Einigung des ganzen deutschen Vaterlandes in friedlicher und gedeihlicher Weise" herbeizuführen, wurde vom Zollparlament mit 186 gegen 150 Stimmen abgelehnt. Die süddeutschen Gegner einer preußisch geführten deutschen Einigungspolitik wurden in dieser Frage von den preußischen Altkonservativen unterstützt. Das Zollparlament leistete im wirtschaftlichen Bereich gute Arbeit, trug zum Ausbau des deutschen Wirtschaftsraumes bei und förderte damit langfristig auch das politische Zusammenwachsen. Dennoch verhinderten es die Mehrheitsverhältnisse, dass dieses Parlament wie anfangs erhofft zum echten Motor eines politischen Einigungsprozesses werden konnte. Antipreußische Stimmung im deutschen Süden: Bismarck und die Liberalen mussten nicht nur ihre integrationspolitischen Hoffnungen auf das Zollparlament zumindest vorerst zurückstellen. Sie mussten zugleich hinnehmen, dass die antipreußischen Kräfte in den beiden wichtigsten süddeutschen Staaten über die Zollparlamentswahlen hinaus weiter an politischem Gewicht gewannen. Im Königreich Württemberg errangen die Demokraten und die Großdeutschen bei den nach allgemeinem gleichem Wahlrecht abgehaltenen Landtagswahlen des Jahres 1869 einen klaren Sieg. Sie setzten die Regierung VARNBÜLER unter Druck. Die heftige Kritik an der zu preußenfreundlichen Militärpolitik führte 1870 zu einer schweren Regierungskrise. Die württembergischen Demokraten (Moritz Mohl) wollten zwar einen deutschen Nationalstaat, aber keinen unter preußischen Vorzeichen, sondern eine Einheit nach einem demokratischföderativen Modell (SCHWEIZ). Die kleindeutsch-liberale "Deutsche Partei" unter Julius HÖLDER blieb in Württemberg in der Minderheit. Auch im Königreich Bayern mündeten die innenpolitischen Konflikte aufgrund der Deutschlandpolitik in eine schwere Regierungskrise. Im Mai 1869 errang die katholischkonservativen bayerische Patriotenpartei (Dr. Joseph Edmund JÖRG) die Mehrheit im Landtag. Die Auflösung und Neuwahl des Landtages im Herbst 1869 brachten einen noch klareren Erfolg für die Patriotenpartei. Die bayerischen Landtagswahlen waren Protestwahlen des Landes, aber auch des städtischen Kleinbürgertums gegen eine zu nachgiebige Politik gegenüber Preußen (Militär- u. Einigungspolitik), gegen den auch in Bayern forcierten wirtschaftsliberalen Kurs und nicht zuletzt auch gegen die kulturelle Hegemonie des liberalen Bürgertums. Hinzu kamen die innerkatholischen Konflikte. Während Ministerpräsident Fürst HOHENLOHE-Schillingsfürst, König Ludwig II. und das katholische Bildungsbürgertum (Ignaz DÖLLINGER) den konservativen Kurs von Papst PIUS IX. ablehnten (1854 Dogma der unbefleckten Empfängnis, 1864 Syllabus Errorum, 1869/70 1. Vatikanisches Konzil und Unfehlbarkeitsdogma), blieb die Basis des bayerischen Katholizismus auf dem 3 „ultramontanen“ Kurs. Infolge der inneren Konflikte trat Hohenlohe-Schillingsfürst Anfang 1870 vom Amt des Ministerpräsidenten zurück, Nachfolger wurde der konservativere Graf BRAY. Die Krisen in Bayern und Württemberg zeigten, wie schwierig die innenpolitische Strategie zur Vollendung der deutschen Einheit zwischen 1868 und 1870 geworden war. Gerade die nationalliberalen Kräfte taten sich nun zunehmend schwer mit dem Aufkommen neuer politischer Massenbewegungen, die sich auf vorindustrielle, modernisierungsskeptische Kräfte und Mentalitäten stützten. Dies zeigte sich im Großherzogtum Baden, wo die Liberalen die Regierung stellten und Zweifel aufkamen, ob sie mit ihren wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Konzepten den neuen Aufgaben und dem zunehmenden Mitgestaltungswillen der Gesellschaft gewachsen waren. Die soziale Basis des Liberalismus begann Ende der sechziger Jahre hier bereits zu bröckeln. Die Träger der parlamentarischen Ideen hatten Probleme bei ihrer Umsetzung in die Praxis. These GALL: Das liberale Regierungsexperiment in Baden ist weitgehend gescheitert. (Lothar GALL, Der Liberalismus als regierende Partei. Das Großherzogtum Baden zwischen Restauration und Reichsgründung. Wiesbaden 1968). II. Vorgeschichte des deutsch-französischen Krieges. Literatur: - E. KOLB (Hrsg.), Europa und die Reichsgründung. Preußen-Deutschland in der Sicht der großen europäischen Mächte 1860-1880. München 1980 - E. KOLB, Der Kriegsausbruch 1870. Politische Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise. Göttingen 1970. - Ders., (Hrsg.), Europa vor dem Krieg von 1870. München 1987. - D. WETZEL, Duell der Giganten. Bismarck, Napoleon III. und die Ursachen des deutschfranzösischen Krieges 1870-1871, Paderborn 2005. Eingeengte Handlungsspielräume und der Umweg über die Außenpolitik: Liberaler Aufbruch und Fortschrittsoptimismus erhielten durch die gescheiterten Hoffnungen auf ein rasches Zusammenwachsen von Nord und Süd und die innenpolitischen Krisen im Süden zwischen 1866/67 und 1870 einen Dämpfer. Dies machte die Dinge auch für Bismarck nicht einfacher, denn je länger sich die Fortschritte in der deutschen Frage hinzogen, desto schwieriger wurde der von Bismarck begonnene Balanceakt zwischen den alten und den neuen gesellschaftlichen Kräften. Stand er deshalb bei der Kriegsentscheidung von 1870 unter Zugzwang? Nipperdey verneint dies, Gall und Engelberg sehen die Dinge etwas anders. Sie verweisen darauf, dass im Süden die antipreußische Stimmung wuchs und die kleindeutschen Liberalen Bismarck zunehmend zu einer Flucht nach vorn drängten (Anfang 1870 Antrag Laskers auf Anschluss Badens an den Norddeutschen Bund) und damit den Einigungsprozess selbst stärker bestimmen wollten. Hinzu kam, dass 1871 die bisherige Militärbudget-Bewilligung auslief. Anfang 1870 startete Bismarck mit dem Kaiserplan einen Versuchsballon. Wilhelm I. sollte zum Kaiser des Norddeutschen Bundes ausgerufen werden, um die Deutschlandpolitik in Bewegung zu bringen. Frankreich erhob sofort Einspruch. Auch Bayern lehnte ab. Bismarck war nun vollends überzeugt, dass man die Dinge nur über neue außenpolitische Krisensituationen verändern konnte. Er hat die Krisensituation jedoch nicht selbst künstlich herbeigeführt, sondern auf eine günstige Gelegenheit gewartet. 4 Machtpolitische Offensiven Deutschlands und Frankreichs: Der Kriegsausbruch von 1870 war nicht allein Bismarcks Werk. Er war nicht die Folge eines genialen Planes, sondern eher das Aufeinandertreffen zweier machtpolitischer Offensiven, die jeweils viel mit der innenpolitischen Situation zu tun hatten. Bismarck wurde getrieben durch den Stillstand der nationalen Integrationspolitik. Die französischen Entscheidungsträger wurden durch die instabile innenpolitische Lage und die seit 1866 in der französischen Öffentlichkeit stark angewachsene antipreußische Stimmung zu einer Politik getrieben, die sich einer Integration der süddeutschen Staaten in den Norddeutschen Bund entschieden widersetzte. Politische Lage in Frankreich Literatur - Heinz-Gerhard HAUPT u. a., Kleine Geschichte Frankreichs, Stuttgart 1994. - Francois CARON, Frankreich im Zeitalter des Imperialismus 1851-1918 (Geschichte Frankreichs , hrsg. v. J. Favier, Bd. 5), Stuttgart 1990. Vorsichtige Systemöffnung in den frühen sechziger Jahren: Die französische Innenpolitik der sechziger Jahre war von einem allmählichen Anwachsen einer breit gefächerten Opposition bestimmt, auf die Napoleon III. nicht mit einem Ausbau seiner diktatorialen Exekutivgewalt und der Verschärfung der Repression reagierte, sondern mit eigenen Reformansätzen zur Öffnung des bonapartistischen Herrschaftssystems. Die ersten wichtigen Reformschritte erfolgten im November 1860. Ihr Ziel war es, den Dialog zwischen dem Kaiser und den gewählten Repräsentanten des Landes durch eine Erweiterung der parlamentarischen Rechte (Debatten über die Thronrede, 1861 Ausbau des Budgetrechts) zu verbessern. Dem echten parlamentarischen Prinzip (volle Ministerverantwortlichkeit gegenüber dem Parlament) wollte Napoleon III. aber noch keine Entfaltungsmöglichkeiten geben. Treibende Kraft der Reformen war Napoleons Halbbruder MORNY. Nach ersten Ansätzen der Liberalisierung kam es um 1863/64 wieder zum Stillstand des Reformprozesses, weil die Abgeordneten von dem neuen Recht nach Ansicht Napoleons zu regen Gebrauch machten und weil die Lockerung des Systems der öffentlichen Kritik eher zusätzlichen Auftrieb gab. Die Macht des Kaisers schien auf den ersten Blick aber noch gefestigt zu sein. Die Zahl oppositioneller Abgeordneter war nicht groß. Zudem zerfiel die Opposition in ganz unterschiedliche Richtungen. - Rechte Opposition: Legitimisten (Graf von Chambord) und Katholiken, die sich nicht zuletzt wegen der Italienpolitik vom Kaiser gelöst hatten. - Liberale Opposition: 1863 Gründung einer "Union libérale". Wichtigster Kopf dieser Richtung war der linke Orleanist, Staatsmann und Historiker Adolphe Thiers, der 1863 als oppositioneller Abgeordneter in Paris gewählt wurde und 1864 ein umfassendes Programm entwickelte, das politische Freiheiten und die Parlamentarisierung forderte. - Neben diesem Oppositionsliberalismus bildete sich nach 1863 noch eine andere Spielart von Liberalismus heraus, der sogenannte "tiers parti". Diese dritte Partei, die vom eigentlichen Liberalismus zunächst strikt getrennt marschierte, entstand innerhalb des bonapartistischen Regierungslagers. Zunächst regierungstreue Abgeordnete formierten sich hier um die Mitte der sechziger Jahre zu einer systemimmanenten Opposition, die ihre Loyalität zu Napoleon III. nicht aufkündigte, gleichzeitig aber eine Fortsetzung der 1860 begonnenen Reformen verlangte, die auf eine Parlamentarisierung des Regimes hinausliefen. - Republikanische Opposition: Innerhalb des republikanischen Lagers gewannen die radikaleren Kräfte (Léon Gambetta) in den sechziger Jahren immer stärker an Gewicht. Diese "Unversöhnlichen" lehnten die Reform des bestehenden Systems ab und forderten die Rückkehr zur demokratischen Republik. 5 - Auch in der Arbeiterbewegung gab es neue Entwicklungen in den sechziger Jahren. Einerseits unternahm Napoleon III. nochmals neue Versuche zur Integration der Arbeiter (1864 Koalitionsrecht). Andererseits wuchsen innerhalb der Arbeiterschaft die Ansprüche auf angemessene politische Mitbestimmung. Dies führte große Teile auf die Seite der republikanischen Opposition. Frankreich erlebte ein Ansteigen der Streikbewegungen. Reaktionen Napoleons III. Innerhalb der engeren bonapartistischen Führungsclique herrschte keine Einheit, was den künftigen politischen Kurs betraf. Napoleon III. stoppte den Reformkurs und versuchte zunächst einmal, seine Stellung durch Angebote an die Arbeiter und durch neue außenpolitische Erfolge zu festigen. Beides schlug aber fehl. In der Außenpolitik brachte die Italienpolitik Napoleon III. mehr Schwierigkeiten (französische Katholiken) als durchschlagende Erfolge. Das 1861 begonnene Engagement in Mexiko, wo ein Kaiserreich unter französischem Protektorat errichtet werden sollte (unter dem Habsburger Erzherzog Maximilian 1864-67), scheiterte. Frankreich zog auf Druck der USA seine Truppen wieder zurück und überließ Maximilian seinem Schicksal. Der mexikanische Präsident Benito Juarez ließ den gefangen genommenen Kaiser 1867 standrechtlich erschießen. In der europäischen Politik erlitt Napoleon III. durch die Entfremdung gegenüber Rußland (Polenaufstand 1863), vor allem aber durch die deutsche Entscheidung von 1866 weitere Schlappen. Die Hoffnungen auf eine Schiedsrichterrolle mit territorialen Konzessionen im preußischösterreichischen Konflikt (Pfalz, Rheinhessen, Saar) erfüllten sich nicht. 1867 gab es eine weitere Demütigung in der Luxemburg-Krise. Kritik der öffentlichen Meinung und weitere Systemöffnung: Die französische Öffentlichkeit, allen voran die Opposition, forderte nach dem unbefriedigendem Ausgang der deutschen Dinge seit 1866 Rache für SADOWA/Königgrätz. 1867 war Napoleon III. durch außenpolitische Misserfolge, eine Wirtschaftskrise, wachsende Staatsverschuldung und innere Unruhen schwer angeschlagen. 1868 gab er dem öffentlichen Druck durch eine neue, liberalere Pressegesetzgebung nach. Ansätze zu einer umfassenden Militärreform kamen wegen der Opposition aus verschiedenen Teilen der Gesellschaft nicht voran. Auch Teile der Bauern gingen nun auf Distanz. Der entscheidende Anstoß zu umfassenden Reformen des politischen Systems kam dann mit den Wahlen von 1869, die sich von der Vorbereitung, vom Verlauf und vom Ergebnis von den vorangegangenen Wahlen deutlich unterschieden. Von 10,4 Millionen Wahlberechtigten stimmten 4,4 Millionen - also nur noch 42,5% - für die Regierungskandidaten. Aber auch darunter waren viele, die eine grundlegende Reform des Herrschaftssystems befürworteten. Die Opposition kam auf 3,4 Millionen Stimmen, also auf etwa 33% der Wahlberechtigten (1,3 Millionen neue Wähler !). Der Anteil der Nichtwähler war weiter auf 22% gesunken. Das Wahlergebnis brachte in der Kammer eine Mehrheit aus liberal gesinnten Reformern (Liberale und regierungsloyale Reformer), die bereit waren, gegen entsprechende Konzessionen in Richtung Parlamentarismus das System Napoleons III. zu unterstützen. Napoleon III. hat sich dieser neuen Situation dann auch nicht verschlossen und neue Reformen eingeleitet. 6 Das Empire libéral: Am 8. September 1869 erhielt das Corps législatif aufgrund eines Senatsbeschlusses weit reichende Vollmachten (Recht der Gesetzesinitiative, volles Budgetrecht sowie eine noch vage Andeutung, dass die Entwicklung in Richtung parlamentarischer Ministerverantwortlichkeit gehen könne). Am 2. Januar 1870 bildete der bisherige Oppositionspolitiker Emile Ollivier (1825-1913) ein von der Kammermehrheit getragenes Kabinett. Im April 1870 wurde eine Verfassungsrevision abgeschlossen, die die rechtlichen Voraussetzungen des "Empire libéral" schuf. Napoleon III. verlor an Macht, behielt aber das Recht, sich in wichtigen Fragen selbst an das Volk zu wenden. Am 8. Mai 1870 ordnete er ein Plebiszit über "seine" liberalen Reformen an, dessen klarer Ausgang (7,3 Millionen JaStimmen, 1,5 Mill. Nein-Stimmen) von ihm erneut als Bestätigung interpretiert wurde. In den folgenden Wochen bis zum Ausbruch des deutsch-französischen Krieges (19. Juli 1870) konnte das "Empire libéral" keine großen Wirkungen mehr entfalten, zumal es an einem engen Zusammenwirken von Kaiser und parlamentarischer Regierung fehlte. Napoleon III. hat wenig getan, um Ollivier zu stützen. Die Kriegsniederlage von 1870 ließ das System wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Am 4. September 1870 wurde in Paris die Republik ausgerufen. Einerseits war die Systemänderung kaum von Anfang an intendiert. Entscheidende Konzessionen durch Napoleon kamen erst, als er in die Krise geraten war. Andererseits war das Empire libéral aber vielleicht doch mehr als ein rein taktisches Manöver, der Wandel des Systems ging auf realistische Einsichten Napoleons III. zurück, dass man in eine moderne Gesellschaft nicht auf Dauer mit alten Methoden weiterregieren konnte. Folgen der innerfranzösischen Situation für die Beziehungen zu Deutschland Der innenpolitisch geschwächte Napoleon III. durfte sich nach den außenpolitischen Schlappen der Jahre 1866/67 keine weitere machtpolitische Schwäche erlauben. Das gleiche galt für die Anfang 1870 installierte Regierung Ollivier, die über keine starke Basis verfügte. Die Furcht, dass Frankreichs Stellung in Europa und vor allem auch Frankreichs Ehre durch eine Fortsetzung des Bismarckschen Einigungskurses beeinträchtigt werden könnte, war auf fast allen Seiten des politischen Spektrums sehr groß. Die französische Seite vertrat die Ansicht, dass die Integration des deutschen Südens das europäische Gleichgewicht zerstöre. Diese Argumentation war im Übrigen auch aus britischer Sicht wenig glaubwürdig, weil zuvor ja gerade die französische Außenpolitik auf die Überwindung der Wiener Ordnung von 1815 gedrängt hatte. Neben entschiedenen Gegnern des deutschen Einigungsprozesses standen in Frankreich allerdings auch gemäßigte Stimmen, die eine Einigungspolitik unter Berücksichtigung französischer Sicherheitsbelange akzeptieren wollten. Die in der Forschung vertretene These, die Franzosen hätten bei einer deutschen Einigungspolitik unter liberalen Vorzeichen möglicherweise nicht zu den Waffen gegriffen, ist nach Ansicht neuerer Arbeiten aber wenig überzeugend. 7