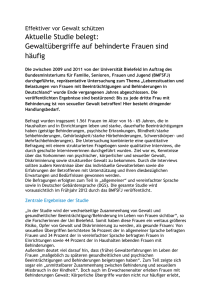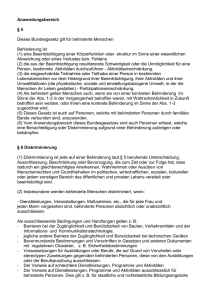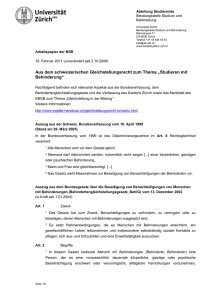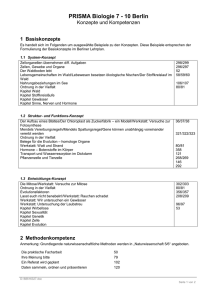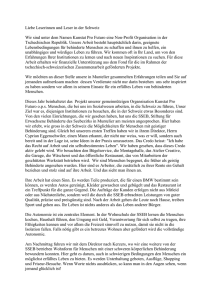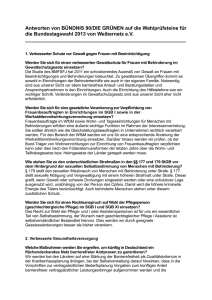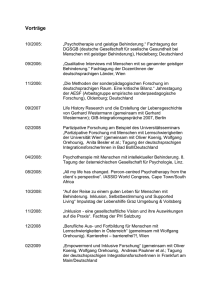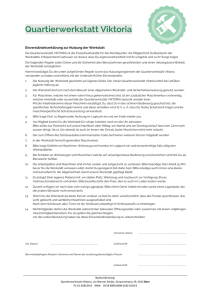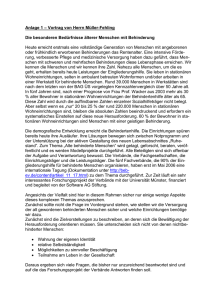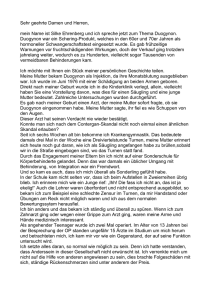Personal der Integrationsfachdienste muss gut
Werbung

Nach der Schule – was dann? Der Übergang von der Werkstufe in den beruflichen Bereich Walter Straßmeier Systeme tendieren dazu, sich relativ autonom zu entwickeln, sich gegenüber anderen Systemen abzugrenzen, Störungen (Perturbationen) nach Möglichkeit zu vermeiden. An der Nahtstelle zwischen Schule und beruflicher Ausbildung bzw. Eingliederung in die Arbeitswelt treffen sich verschiedenste Systeme, die sich sehr eigenständig entwickelt haben. Aus der Notwendigkeit heraus, den Menschen mit Behinderungen adäquate Hilfestellungen zur Integration in einen neuen Lebensabschnitt zu geben, müssen sie sich aber abstimmen. Im Schulbereich ist die Welt noch weitgehend in Ordnung: Durch die staatliche Schulaufsicht sind der Schulbesuch abgesichert, die Finanzierung geregelt, die Inhalte durch Lehrpläne vorgeschrieben, Stundentafeln und Lehrerstundenberechnungen bis ins kleinste Detail ausgefeilt. Verbeamtetes, unkündbares Personal sorgt für Stabilität, manchmal auch für Stagnation. Zwar haben die KMK-Empfehlungen von 1994 bezüglich des Förderortes bei festgestelltem sonderpädagogischem Förderbedarf mehrere Optionen eröffnet, die Kulturhoheit der Länder regelt aber den Spielraum nach eigenem politischem Konzept. Doch nach der Schule? Hier beginnt die große Unübersichtlichkeit. Verschiedenste Interessen treffen hier aufeinander: Die der abgebenden Einrichtungen, die der Betriebe, der Werkstätten für Behinderte, der Kostenträger, der Eltern und schließlich auch gelegentlich der betroffenen jungen Leute. Kaum überschaubare Möglichkeiten werden konzeptionell angeboten: Eingangs- und Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen, Förderlehrgänge, Berufsvorbereitungsjahre, betriebliche Ausbildung speziell für Menschen mit Behinderungen und andere. Wie sieht es bei Menschen mit geistiger Behinderung dabei aus, welche Möglichkeiten könnten weiter diskutiert werden, welche Entwicklungen zeichnen sich ab? Situation allgemein 1 Die Arbeitswelt hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verändert. Bei der Produktion eines Autos hat sich das Verhältnis Materialkosten gegenüber Arbeitskosten von 1920 bis 1990 von 40 zu 60 auf 15 zu 85 verschoben, wobei beim Arbeitsanteil lediglich noch 20 % Produktionsanteil sind, 80 % auf Wissensarbeit entfällt. Beim Computer liegt der Materialanteil bei einem Prozent, bei unqualifizierter Arbeit bei 5 % und 94 % ist Wissensarbeit (DUISMANN, 2001, 3). In unserer Gesellschaft ist es keinesfalls mehr selbstverständlich, Arbeit zu haben; schon gar nicht „humane Arbeit“. „Die technischökonomischen Veränderungen haben zu einem dramatischen Abbau an Arbeitsplätzen geführt, die geringere kognitive und handwerklich-artistische Qualifikationen voraussetzen. Der Konkurrenzkampf auf dem Markt der verbliebenen Arbeitsplätze ist hart und das Mitmachen in der Qualifikationsspirale neu entstandener Berufe und Arbeitstätigkeiten nicht allen Menschen möglich“ (4) So ist es nicht erstaunlich, wenn gerade Menschen mit schwerer Behinderung mehr von Arbeitslosigkeit bedroht sind als andere Gruppen. Die Arbeitslosenquote liegt bei Schwerstbehinderten bei 18 %, die Hälfte davon verfügt über keine abgeschlossene Berufsausbildung. Erste These: Veränderungen in den Berufsfeldern und der Arbeitsmarkt erschweren die berufliche Eingliederung von Menschen mit Behinderungen Diese Feststellung wird von allen, die Erfahrungen in diesem Bereich haben, bestätigt werden können. Was aber ist zu tun? Was kann die Schule beitragen, um ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen zwischen individueller Bildung, Erziehung und Therapie und einem auf eventuell später mögliche Arbeitsfelder ausgerichteten Funktionstraining? Ist das bisherige System der Werkstufe nach wie vor geeignet, die jungen Menschen vorzubereiten auf ein Leben als Erwachsener in Arbeits-, Wohn-, Öffentlichkeits- und Privatsphäre? Wie wird der Übergang gestaltet? Was kann die Schule beitragen? Zuerst sei wieder ein Blick auf Umfrageergebnisse geworfen. Bei einer bundesweiten Erhebung des Bundesverbandes evangelischer Behindertenhilfe (BEB) von 1998 und einer Rücklaufquote von 54 % (=174 Einrichtungen) kamen zum Teil sehr erstaunliche Ergebnisse heraus: 2 In durchschnittlich 30 % der Schulen erfolgt der Übergang von einer Stufe zur nächsten nicht unabhängig von der Leistung. Der Wechsel in die letzte Schulstufe (Werkstufe) ist etwa in Einrichtungen der LEBENSHILFE zu 58 % von der Leistung der Schüler abhängig, begründet durch „Innere Struktur der Klassen“ oder „Pädagogische Gründe“. Vorgaben für den Unterricht in der Werkstufe (etwa Lehrpläne) werden zum Beispiel in Hamburg, Bremen und im Saarland überhaupt nicht verwendet, in sechs Bundesländern jedoch weitgehend. Praktika werden in fast allen Einrichtungen angeboten, es nehmen jedoch nur ca. zwei Drittel der Schüler daran teil. Als Gründe für Nicht-Teilnahme werden hauptsächlich genannt: Zu großer Personalaufwand, zu wenig Praktikumsplätze. Auf die Frage, wann die Einrichtungen erfahren, ob eine Schülerin oder ein Schüler in die Werkstatt für behinderte Menschen aufgenommen wird, antworteten 50 % der LEBENSHILFE-Einrichtungen aber auch 33 % der evangelischen und 16 % der katholischen Einrichtungen mit „überhaupt nicht“. Es lässt sich feststellen: Der Übergang von der Oberstufe in die Werkstufe ist meist wenig deutlich akzentuiert. Die Lehrer kennen die Schüler schon sehr lange und gehen mit ihnen um wie seit jeher. Der Unterricht wird zwar durch mehr Fachunterricht (Werken und Hauswirtschaft) etwas verändert, Praktika kommen dazu, der schulische Charakter wird aber weiterhin stark tradiert. Es ist zu fragen, ob die Werkstufe eher ein bloßes „Anhängsel“ der Schule zur individuellen Lebensbewältigung mit einer „im Wesentlichen auf eine Fortführung schulischen Lernens ausgerichtete „Zusatz-Schulzeit“ ist. (WIMMER, 2000, 179). Noch dazu tendieren die Pädagogen dazu, die Schüler möglichst lang im Schonraum der Schule behalten zu wollen. Das ist zumindest in Frage zu stellen. Die Schule hat noch immer Defizite, die Schüler angemessen auf die Arbeitswelt vorzubereiten. „Arbeiten lernt man dort, wo gearbeitet wird“, stellt WIMMER (179) fest. Außerdem sollte die Schule nicht glauben, dass sie die Arbeitswelt simulieren kann. Welcher Lehrer hat sie auch selbst erfahren, hat z. B. eine handwerkliche Ausbildung und Arbeitsjahre in einem Betrieb? Viele kommen von der Schulbank auf die Universität und dann wieder in die Schule. Die Kompatibilität zwischen schulischen Angeboten und betrieblichen Anforderungen muss dabei leiden. Prof. HAVEMANN stellte auf der Lebenshilfetagung Ende 1999 fest, dass „die Werkstufe der Sonderschulen mit der Aufgabe der Vorbereitung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, u. a. durch die Vermittlung von Grundfertigkeiten, die 3 Unterweisung in grundlegende Arbeitstechniken, das Kennenlernen unterschiedlicher Arbeitsmaterialien und das Erlernen eines sachgemäßen Umganges mit Arbeitsgeräten, überfordert ist“ (1999, 16) Dazu ist der Bildungsplan zu eng auf den Übergang der Schüler in die Werkstatt für behinderte Menschen (der neue Terminus im Sozialgesetzbuch IX statt „Werkstatt für Behinderte“) ausgerichtet, hier müssen Ergänzungen vorgenommen werden. Einen bedeutenden Stellenwert sollen Angebote des Freizeit- und Wohnbereichs einnehmen. Diese Angebote ermöglichen den jungen Leuten, Erfahrungen in Zusammenhang mit Jugendkultur und erwachsenengerechten Aktivitäten zu sammeln. Wir sollten Möglichkeiten des Wohntrainings, der Nutzung von Freizeitangeboten, der Erfahrungen mit gleich alten nicht behinderten Jugendlichen und der Anforderungen öffentlichen Lebens durch Handeln in diesen Feldern verstärkt einbeziehen. Zweite These: Der Übergang von der Schule zum Beruf und der neuen Rolle als Erwachsener muss flexibler verlaufen Was kann die Werkstufe bezüglich dieser Aufgaben tun? Ich schließe mich WIMMER (2000, 180) an, wenn er fordert: Entwicklung eines individuellen Förderplanes zu Beginn der Werkstufenzeit, der laufend revidiert wird: Aufhebung des Klassenprinzips zu Gunsten eines differenzierten Kurssystems: Flexible zeitliche Strukturierung, etwa durch Einführung von „Zeitkonten“. Warum ist der Unterricht lediglich auf die Zeit von 8 Uhr bis 15.30 Uhr begrenzt? Warum sollten nicht abends oder am Wochenende schulische Veranstaltungen stattfinden? Vertieftere Zusammenarbeit mit „Anbietern“ im Lebensbereich Arbeit und Beruf (Werkstatt, freier Arbeitsmarkt, Arbeitsamt, Anbieter von Qualifizierungsmaßnahmen): Räumliche Trennung von Schule und Werkstufe, um den Werkstufenschülern und Schülerinnen (und den Lehrern und Lehrerinnen) „deutlich zu machen, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt (und nicht die Schulzeit weitergeht)“. Selbstverständnis der Werkstufe als „Informationszentrum“ für Eltern und Jugendliche. Wenn die Werkstufe unter anderem auf die Berufs- und Arbeitswelt vorbereiten soll, muss dieser Übergang mehr verzahnt werden. 4 Dritte. These: Die berufliche Qualifizierung scheitert noch zu oft an mangelnder Kooperationsbereitschaft der beteiligten Institutionen und Professionellen Weiterführend könnte das „Außenklassenmodell“ überlegt werden, bei dem Werkstufenklassen an bestehende Berufsschulen angegliedert werden könnten (WIMMER, 2000). Die praktische Ausbildung müsste näher an den nachfolgenden Betrieben angesiedelt werden: Werkstatt, Förderstätte, alternativer Arbeitsmarkt. Ein Praxistag pro Woche in möglichen Arbeitsfeldern wird teilweise schon praktiziert. Probleme mit der beruflichen Grund- und Ausbildung Die berufliche Grundbildung für lernschwache Schüler geschieht etwa in Bayern in sog. Praxisklassen, die durch eine spezifische schulische Förderung mit hohen berufsbezogenen Praxisanteilen in einer professionellen Werkstatt z. B. der Berufsschule oder eines außerschulischen Partners der Wirtschaft gekennzeichnet sind und die jungen Leute zu einer positiven Lern- und Arbeitshaltung führen soll. Mit Beginn dieses Schuljahres wird ein Modellprojekt durchgeführt, bei dem jungen Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in den Berufsbildungswerken Augsburg, Hof, Kirchseeon, Rummelsberg und Nürnberg die Möglichkeit geboten wird, Räumlichkeiten und Fachpersonal zu nutzen sowie Beratung zu erfahren, damit „sie eine Chance finden und nützen können, im Rahmen von betrieblichen Praktika zunehmend realitätsnahe Selbsteinschätzung über künftige berufliche Möglichkeiten zu gewinnen“ (SCHOR, 2001, 17). Das geschieht auf Anregung und durch finanzielle Unterstützung der Arbeitsverwaltung. Eine engere Verzahnung von schulischer und betrieblicher Ausbildung wird auch in den Berufsschulen angedacht. Dem Ministerium in Bayern liegt ein Konzept einer Arbeitsgruppe vor, das die Verkürzung der Schulzeit durch Einführung eines Ganztagsunterrichts im 8. Schuljahr mit starken praxisbezogenen Inhalten vorsieht (erstes Jahr der beruflichen Ausbildung) und die duale Ausbildung dadurch auf zwei Jahre begrenzt wird. In Osterholz-Scharmbeck (nahe Bremen) gehen die Schüler der Werkstufenklassen in die dortige Berufsschule. Eine Klasse nimmt geschlossen am Unterricht in Metalltechnik teil, eine Arbeitgemeinschaft aus zwei bis drei Klassen bildet sich für Bautechnik, zwei Schüler besuchen das Berufsgrundbildungsjahr Holz und ähnliches. Das besondere ist nicht nur der 5 Ort des Unterrichts, sondern es unterrichten im Team Sonder- und Berufsschullehrer gemeinsam. Die Beispiele ließen sich fortführen. Gemeinsam ist diesen Bestrebungen, die Verbindung von Schulunterricht und praktischer beruflicher Grund- und Ausbildung enger zu gestalten. Für die Werkstufe könnte das bedeuten: Im ersten Werkstufenjahr neben dem herkömmlichen Schulunterricht – allerdings mit verstärkt projektartigen und erwachsenenpädagogischen Verfahren – ein längeres Betriebspraktikum Im zweiten Jahr eine verstärkte Praxisorientierung durch mindestens einen Praxistag (in Tagesförderstätte, Werkstatt für behinderte Menschen oder einem Betrieb) und möglichst eine Anbindung an die Berufsschule, aber auch Wohntrainings und Orientierung in der Öffentlichkeit sowie praktische Durchführung von Freizeitprojekten Das dritte Werkstufenjahr könnte im Rahmen der Werkstatt für behinderte Menschen, Tagesförderstätte oder als erstes Jahr Ausbildung in einem F2/F3 Lehrgang stattfinden (siehe FRÜHAUF 1997, 66; LEBENSHILFE 1998, 53). Betriebsprojekte (Betriebe im Betrieb) könnten vermehrt durchgeführt werden, wobei etwa Serviceleistungen regelmäßig angeboten werden (Cafeteria, Druckerei). Die Schüler lernen dabei Verantwortung zu übernehmen, müssen mit fremden Personen umgehen lernen, erwerben handwerkliche Fertigkeiten und entwickeln u. U. ein realistischeres Selbstbild (v. DANIELS 2001, 9): Das Konzept der „Probierwerkstatt“ mit diagnostischen Erhebungen und praktischen Erfahrungen wäre ebenfalls hier zu nennen (SCHARFF 2000). Vom Institut für Sonderpädagogik München haben wir 1999 eine Umfrage über Betriebspraktika im Rahmen der beruflichen Grundbildung in der Werkstufe durchgeführt. Es beteiligten sich 25 von 30 Schulen Oberbayerns. Durchschnittlich hatten die Schüler zwei Praktika in den drei Werkstufenjahren, meist eine Woche und überwiegend in der Werkstatt für behinderte Menschen. Die Idee, zwei zweiwöchige Praktika durchzuführen, eines in der Werkstatt und eines auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wurde nirgends verwirklicht. Einzelnen Schülern wird dies jedoch ermöglicht, und zwar in den folgenden Branchen: Reinigung/Abfallentsorgung, Landwirtschaft, Sozialpflege/Hauswirtschaft, Gartenbau/Landschaftspflege, Büro/Verwaltung und (ausschließlich in der Werkstatt) Metall/Holz. 6 Die Kooperationsbereitschaft der Schulen mit den Betrieben war gering. Schwierigkeiten traten dabei vor allem auf durch schwieriges Arbeitsverhalten, nicht genügend Einsatzmöglichkeiten, Ablenkbarkeit, Verhaltensauffälligkeiten und mangelndes Verständnis der Arbeitskollegen (PFEIFER 1999). Was kann die Werkstatt für behinderte Menschen beitragen? Der Weg von der Schule in das Berufs- und Arbeitsleben verläuft bei Menschen mit geistiger Behinderung überwiegend auf einer breiten Einbahnstraße: 96 % der Schüler der Werkstufe kommen in die Werkstatt für behinderte Menschen, die übrigen vier Prozent verteilen sich auf Förderstätten und den alternativen Arbeitsmarkt. In den Werkstätten für Behinderte schließt sich an den Eingangsbereich der Berufsbildungsbereich an, der schließlich in den Arbeitsprozess führt. Die Werkstatt für behinderte Menschen hat aber auch den Auftrag, deren Leistungsfähigkeit zu entwickeln, zu erhöhen oder wiederzugewinnen und dabei auch deren Persönlichkeit weiterzuentwickeln. (§54 SchwbG). Neben der Ausbildung wird dabei auch die Weiterbildung angesprochen. Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich sind gut abgesichert, nicht jedoch die Weiterbildung im Arbeitsbereich. „Hier legt die Werkstättenverordnung lediglich fest, dass entsprechend zu verfahren ist. Im weiteren enthält sie keine verbindlichen Aussagen zu Art, Dauer und Inhalten. Das Angebot umfasst primär Freizeitaktivitäten, wohingegen Maßnahmen mit allgemein bildenden oder berufsbezogenen Aspekten (zum Beispiel Erste Hilfe Kurse, Umgang mit Geld, Kulturtechniken) eher eine untergeordnete Rolle spielen und nur punktuell angeboten werden“ (SCHÜLLER 2001, 292). Nach Verlautbarung der Bundesanstalt für Arbeit von 1999 gaben 80 % der Werkstätten an, eingliederungsfördernde Maßnahmen durchführen zu wollen, jede fünfte Werkstatt sah sich aber bisher nicht in der Lage, entsprechende Vorhaben zu realisieren (1999, 295). Welche Möglichkeiten bestehen, Menschen mit geistiger Behinderung eine berufliche Bildung zukommen zu lassen, die sie in ihrem Selbstkonzept stärkt, ihnen zu einem „ihrer Leistung angemessenen Entgelt“ zu verhelfen? Die LEBENSHILFE stellt ein Konzept vor, das meines Erachtens viele Differenzierungsmaßnahmen zulässt. 7 „Eine aus einem Ausbildungsberuf abgeleitete, in ihrer Komplexität reduzierte, anerkannte Ausbildung auf Berufsfeldbreite.“ Eine Ausbildung nach § 48 BBiG bzw. § 42 HwO (Metallfachwerker) ist noch zu komplex für viele Menschen mit geistiger Behinderung. Um ihnen diese Bereiche zu erschließen, sollte die Ausbildung weiter differenziert und individualisiert werden. Als Beispiel soll diese Stufung aus dem Bereich Metall ausgeführt werden, hier wäre es der Metallbearbeiter. „Eine anerkannte (Aus-)Bildung in einem Teilbereich (Modul). Menschen mit geistiger Behinderung, die die gesamte Breite eines Berufsfeldes nicht abdecken können, können in einem solchen Teilbereich gelegentlich hochwertige Arbeit leisten. Es erscheint sinnvoll, „dieses bisher ungeleitete und zufällige „Spezialistentum“, das häufig in der WfB zu beobachten ist, in einer Ausbildung zu fassen und zu optimieren.“ Ein solches Modul aus dem Beispiel könnte „Fügen“ sein, die Berufsbezeichnung Metallverarbeiter (Fügen). Die anerkannte (Aus-)Bildung in einem Baustein eines Ausbildungsberufs, hier im Beispiel Lötfüger. (nach FRÜHAUF 1997, 70-71). Abbildung 1 Vierte These: Die Werkstatt für Behinderte (WfB) war allgemein für Menschen mit geistiger Behinderung konzipiert. Für Menschen mit schweren Mehrfachbehinderungen und Jugendliche aus den Förderschulen sind erst in Ansätzen passende Angebote vorzufinden Die oben aufgezeigten Möglichkeiten sind vor allem für Schüler der Übergangsform zur Lernbehinderung. Etwa acht Prozent der Menschen mit geistiger Behinderung haben jedoch einen besonders hohen Pflege- und Betreuungsbedarf und werden nach geltendem Recht nicht in der Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen aufgenommen. Für sie wurden „Förder- und Betreuungsgruppen“ gebildet oder sie werden in Förderstätten betreut. Es ist aber auch ein Anstieg von psychisch behinderten Menschen zu verzeichnen, die mangels Alternativen um Aufnahme in die Werkstatt für behinderte Menschen nachsuchen. Etwa zwölf Prozent zählt man zu diesem Personenkreis (SCHÜLLER 2001). Außerdem drängen vereinzelt ehemalige Schüler der Schule zur individuellen Lernförderung (Förderschule) in die Werkstatt, wenn sie trotz beruflicher Grund-Qualifizierung keinen angemessenen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bekommen haben. 8 Für Menschen mit schwersten und mehrfachen Behinderungen wurden Förderstätten als eigene Einrichtungen oder „unter dem Dach der Werkstatt“ geschaffen. Hier werden angemessene Angebote ermöglicht, die nicht unter dem Diktat der Wirtschaftlichkeit stehen. Sie bieten diesen Menschen Arbeit als „produktive, geplante Auseinandersetzung mit der Umwelt“ (LELGEMANN 1996), sie bieten Tagesstrukturierung und die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnung. Kritisch zu bewerten ist allerdings die Tatsache, dass keine Finanzierung durch die Bundesanstalt für Arbeit erfolgt. Die Finanzierung von Maschinen ist erschwert, fachlich qualifiziertes Personal ist nur schwer anzustellen. Die Entgeltzahlung auf dem Niveau der Werkstatt (die sowieso niedrig ist) ist nicht möglich und es findet keine sozialversicherungsrechtliche Absicherung der Mitarbeiter statt. Darüber hinaus ist die Verknüpfung mit der Unterbringung in Wohn-Pflegeheimen problematisch. Inhaltlich muss noch viel weiterentwickelt werden, um die Konzepte zu verbessern. Vielfach liegen überhaupt keine eigenen Rahmenrichtlinien vor. Die Orientierungshilfe der Diakonie zur „Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen in Werkstätten für Behinderte“ zum Beispiel unterscheiden sich überhaupt nicht von Förderansätzen in der Schule (VERBAND EVANGELISCHER EINRICHTUNGEN 1996). Wird man damit erwachsenen Menschen gerecht? Werden die Bedürfnisse, biographischen Erfahrungen, offengebliebenen Möglichkeiten damit ausreichend berücksichtigt? Ein Konzept für körperlich schwerst behinderte Menschen legte LELGEMANN (1996) vor und beschreibt detailliert Arbeitshilfen und Arbeitsplätze für diese Menschen. Der Diagnostik kommt dabei eine sehr bedeutsame Rolle zu. (siehe SCHARFF 2000): Veränderungen durch das SBG IX Das Sozialgesetzbuch (SGB) IX, das am 1. 7. 2001 in Kraft getreten ist, fasst viele Verordnungen und Einzelregelungen (etwa das Schwerbehindertengesetz und teilweise das BSHG) zusammen und bringt einige Neuerungen: Die Einführung von Integrationsfachdiensten und Integrationsprojekten als Regelleistungen im Schwerbehindertenrecht. Den Rechtsanspruch auf Arbeitsassistenz sowie auf Hilfe im Kontakt mit den Behörden. Die Verankerung „persönlicher Budgets“. Den Wegfall des Unterhaltsrückgriffs auf Eltern volljähriger behinderter Kinder (ZELFEL 2001, 4) 9 Die Aufwertung des Arbeitstrainingsbereichs durch die Bezeichnung „Berufsbildungsbereich“ Fünfte These: Die neue Sozialgesetzgebung will den Gesetzesdschungel vereinfachen, schafft aber auch neue Problemfelder Es gibt aber auch noch Problembereiche, die im praktischen Vollzug zu klären wären. An der Nachrangigkeit der Sozialhilfe wurde festgehalten, die „Auffangfunktion“ wurde jedoch teilweise durch andere Regelungen unterminiert. Neu hinzugekommen ist das Arbeitsförderungsgeld, das den Behinderten zur Lohnerhöhung zukommen soll, wo die Auszahlungsmodalitäten aber noch geklärt werden müssen. Teilweise sind die Texte nicht einfacher zu lesen sondern bringen neue Unklarheiten. Trotzdem ist es anzuerkennen, dass gesetzliche Rechtsansprüche formuliert wurden und auch explizit die Jugendlichen mit Lernbehinderungen im SGB III genannt werden. Damit ist ihre Förderung auch in diesem Gesetzeswerk abgesichert, zumindest vom Text her. Welchen Stellenwert haben die Integrationsfachdienste? Es ist erfreulich, dass die Integrationsfachdienste, die ja zum Teil schon jahrelang arbeiten, gesetzlich verankert wurden. Sie können zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben beteiligt werden, indem sie nach § 110 die schwerbehinderten Menschen beraten, unterstützen und auf geeignete Arbeitsplätze vermitteln, die Arbeitgeber informieren, beraten und ihnen Hilfe leisten, die Fähigkeiten der zugewiesenen schwerbehinderten Menschen bewerten und einschätzen und dabei ein individuelles Fähigkeits-, Leistungs- und Interessenprofil ... erarbeiten, geeignete Arbeitsplätze auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erschließen, die schwerbehinderten Menschen auf die vorgesehenen Arbeitsplätze vorbereiten, die schwerbehinderten Menschen, solange erforderlich, am Arbeitsplatz oder beim Training der berufspraktischen Fähigkeiten am konkreten Arbeitsplatz begleiten, mit Zustimmung des schwerbehinderten Menschen die Mitarbeiter im Betrieb oder in der Dienststelle über Art und Auswirkungen der Behinderung und über entsprechende Verhaltensregeln informieren und beraten, eine Nachbetreuung, Krisenintervention oder psychosoziale Betreuung durchführen und 10 als Ansprechpartner für Arbeitgeber zur Verfügung stehen. Ein sehr erfreulicher Katalog, der viele Möglichkeiten zur Unterstützung von Menschen mit schweren Behinderungen bietet. Es wäre zu überlegen, ob die Integrationsfachdienste nicht stärker eigenständig sein sollten und weniger als Auftragnehmer der Bundsanstalt für Arbeit, der Rehabilitationsträger und der Integrationsämter bei der Durchführung der Maßnahmen zur Teilhabe der schwerbehinderten Menschen am Arbeitsleben fungieren. Auch ist zu fragen, ob grundsätzlich nur ein Integrationsfachdienst pro Arbeitsamtsbezirk sinnvoll ist. Die noch zu entwickelnden Vereinbarungen über Standards, Finanzierung, Struktur der Dienste u. ä. sollte sicherstellen, „dass Integrationsfachdienste für alle Personen der Zielgruppe frei zugänglich und ein freiwilliges Angebot sind“, dass Menschen mit schweren Behinderungen und einem höheren Unterstützungsbedarf „auch faktisch unterstützt werden können und nicht praktisch herausfallen, dass unbürokratische und an qualitativen fachlichen Standards orientierte Leistungsvereinbarungen und Kooperationsbeziehungen mit den Leistungsträgern geschaffen werden dass es ein gut ausgebautes System der berufsbegleitenden Qualifizierung für IntegrationsberaterInnen in diesem Bereich gibt, dass eine kostenträgerübergreifende Sockelfinanzierung mit der Möglichkeit von zusätzlichen bedarfs- und erfolgsabhängigen Leistungsentgelten sichergestellt wird und dass regional sinnvolle Strukturen gefunden werden“ (DOOSE, 2000, 5) Sechste These: Menschen mit geistiger Behinderung brauchen Assistenz bei der Eingliederung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Aber nicht alle Menschen mit Behinderungen brauchen ein derart enormes Maß an geschützter Lebens- und Arbeitsbegleitung. Hier müssen die Konzepte erweitert werden 1985/86 wurde in der Vereinigten Staaten das System der „Supported Employment“ eingeführt, seither bei uns als unterstützte Beschäftigung bezeichnet. Zahlreiche Werkstätten in den USA haben ihr Angebot umgestellt und offerieren auch Arbeitsassistenz (58% der Anbieter), 16 % sind dabei, nur noch ambulante Dienste anzubieten und die Einrichtung aufzulösen. Seit Ende der Achtziger gibt es die Form der unterstützten Arbeit auch in der 11 Bundesrepublik. 1997 gab es bei uns ca. 120 Integrationsfachdienste (DOOSE, 2000), im November 2000 berichtet DIE ZEIT von ca. 180, Tendenz steigend. In einer Untersuchung von 130 Arbeitsplätzen durch DOOSE (1997) ergibt sich für die von Integrationsfachdiensten unterstützten Arbeitsplätze (N = 80): Die in die Untersuchung einbezogenen Beschäftigten haben zu über 80 % eine Lern- oder geistige Behinderung. Für zwei Drittel der unterstützten Beschäftigten ist dies das erste reguläre Arbeitsverhältnis. Die Hälfte der Arbeitnehmer wird mindestens einmal wöchentlich direkt vom Fachdienst unterstützt. Die Arbeitsplätze verteilen sich auf Dienstleistungsgewerbe (72 % der Frauen), vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe (39 %) und im Gesundheits- und Sozialbereich (28 %), bei den Männern Handwerk und Handel mit 28 %, Land- und Forstwirtschaft und das produzierende Gewerbe mit 17 % (1997, 2001). Die unterstützten Arbeitsplätze werden überwiegend in kleineren Betrieben gefunden. 72 % der Betriebe haben weniger als 50 Beschäftigte, 46 % sogar weniger als 15. Barrieren für die berufliche Integration sind die wirtschaftliche Situation mit hoher Arbeitslosigkeit, mangelndes Interesse von Arbeitgebern, geringe Qualifikation der Bewerber mit Behinderungen, inflexibles Förderungsrecht (verschiedene Töpfe, so dass der Kostenträger wechselt) und keine Unterstützung durch Werkstätten für Behinderte, die leistungsfähigere Mitarbeiter ungern gehen lassen. Die Qualifikation der ca. 150 000 Menschen mit geistiger Behinderung, die im „Sonderarbeitsmarkt WfB arbeiten, erweist sich in vielen Fällen für die Fachdienste als unzureichend und teilweise kontraproduktiv für die Anforderungen das allgemeinen Arbeitsmarktes“ (DOOSE 2001). In einer vom Landschaftsverband Rheinland in Auftrag gegebenen Studie berichten SCHARTMANN u. a. , dass folgende Variablen für den Übergang in eine Erwerbstätigkeit oder eine Eingliederungsmaßnahme von Bedeutung sind: Der Dienst, von dem die Klienten betreut wurden, die Art der Behinderung, der Schulabschluss und die berufliche Qualifikation ((SCHARTMANN 2000, 74). Bei den kleinen Betrieben macht der Anteil der Menschen mit geistiger Behinderung 14 % des Personals aus, bei den mittleren 3 – 4 % und bei den großen 0,5 % (105) 12 NEUBERGER formuliert, dass in Organisationen Beziehungen instrumentalisiert werden, sie seien „nicht Selbstzweck, sondern Mittel und sollen dazu dienen, Aufgaben zu erfüllen, Leistungen zu erbringen, Erfolg zu erzielen. Mitarbeiter werden als einzelne eingestellt, damit sie Aufgaben erfüllen und nicht, um ihnen bei ihrer Selbstverwirklichung zu helfen oder ihnen bereichernde soziale Erfahrungen zu ermöglichen“ (zit. nach SCHARTMANN 1999). Was erwarten eigentlich Arbeitgeber von den Menschen mit Behinderung, die sie einstellen? Warum stellen Sie überhaupt behinderte Mitarbeiter ein? Zwei Beweggründe, behinderte Menschen anzustellen, geben TROST und SCHÜLLER an: ein Gefühl der sozialen Verpflichtung und betriebswirtschaftliche Gründe (zit. nach SCHARTMANN 1999). Die zweite Begründung ist interessant: Weil die einzelnen Personen Fähigkeiten mitbringen, die dem Betrieb nutzen können: Weil die Höhe der finanziellen Unterstützung so gestaltet ist, dass für die Arbeitgeber kein oder ein überschaubares finanzielles Risiko entsteht: Weil manche Arbeitgeber hoffen, dass sie jemanden ‚Dankbares’ zur Erledigung der ‚Drecksarbeit’ gefunden haben, weil der Personenkreis aufgrund seiner Abhängigkeit sich leichter einfügen lasse (MEUTH, zit. nach SCHARTMANN 1999): Von 94 % der Betriebe wurde die passgenaue Besetzung des Arbeitsplatzes als Kriterium für die Einstellung genannt: 92 % meinen, der Schwerbehinderte erhält eine gute Einarbeitung (Training) am Arbeitsplatz. Die Einstellungspraxis hängt mit dem Grad der Behinderung zusammen. Während 30 % der Arbeitgeber Menschen mit leichten geistigen Behinderungen Chancen geben, sind es bei schwerer Behinderten nur fünf Prozent. Wenn Erfahrungen vorliegen, werden weitere Arbeitsverträge abgeschlossen, da die Mehrzahl der Betriebe überwiegend zufrieden ist und nur 16 % überwiegend negative Erfahrungen mit der Beschäftigung von Menschen mit geistiger Behinderung machten (LVR 1998, 41). Unter Anwendung des Verfahrens MELBA wurden durch das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Arbeitsplatzanforderungen an Menschen mit geistigen Behinderungen formuliert. Von den Arbeitgebern werden erwartet: “Antrieb: Der Behinderte muss in der Lage sein, ein Mindestmaß an physischer und psychischer Energie bereitzustellen und zielgerecht einzusetzen 13 Auffassung: Er muss in der Lage sein, zumindest einfache Instruktionen in ihrer Bedeutung zu verstehen und einfache Zusammenhänge erkennen Ausdauer: Er muss fähig sein, sich einer Aufgabe ausdauernd zuzuwenden Konzentration: Er muss seine Aufmerksamkeit willkürlich auf seine Tätigkeit richten können Kritische Kontrolle: Er muss das Ergebnis seiner Tätigkeit im Ansatz realistisch einschätzen können Kritisierbarkeit: Er muss fähig sein, seine erbrachte Arbeitsleistung kritisieren zu lassen Pünktlichkeit: Er muss zeitliche Absprachen einhalten können Sorgfalt: Schließlich muss er bei der Erledigung von Aufgaben im Ansatz korrekt, gewissenhaft und umsichtig vorgehen können (LWL 1994, zit. nach SCHARTMANN 1999) Mögliche Konsequenzen für Weiterentwicklungen Die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten muss intensiviert werden. Es geht nicht an, dass die Schule zu wenig weiß, was später in der Werkstatt für behinderte Menschen oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwartet wird und tatsächlich abläuft, umgekehrt der Arbeitsmarkt von der Werkstufe etwas erwartet, was nicht geleistet werden kann oder unter pädagogischen Gesichtspunkten nicht als sinnvoll angesehen wird. Die Praktika müssen stärker in die berufliche Grundbildung einbezogen werden .Bei der Entwicklung von Förderplänen in der Werkstufe sollte es um die Vermittlung eines „Echtheitscharakters“ gehen, bei dem die realen Erfordernisse des allgemeinen bzw. SonderArbeitsmarktes „möglichst real widerspiegelt werden“. Um das Erreichen der Förderziele zu überprüfen, sind diese Praktika „nicht nur für die zu fördernden behinderten Menschen, sondern auch für das ‚pädagogische Personal’ in den abgebenden Institutionen“ vorzusehen (SCHARTMANN 1999). Verschiedene Modelle der beruflichen Bildung müssen miteinander kombiniert werden können. Die gängige Praxis ist, dass stark auf das sog. ‚Schulmodell’ gesetzt wird, bei dem der Staat weitgehend die berufliche Grund- und Ausbildung regelt. Das ist gut so, vor allem in den Regelungen der Berufsbildungswerke, Förderlehrgängen u. ä. Dazu kommen müssen aber auch Ansätze eines sog. ‚Marktmodells’, wobei die Ausbildung stark in die Betriebe verlagert wird. ‚Training on the Job’ ist ein Modell, das den Grundsatz 14 ‚Erst qualifizieren, dann platzieren’ umkehrt, mindestens aber ergänzen soll. Dazu sind auch die Ausführungen von Böhm zum „Lernort Betrieb“ anzuführen (BÖHM 2000.) Das ‚duale Ausbildungsmodell’, das in verschiedensten Varianten existiert, sollte in die Überlegungen mit einbezogen werden (siehe STOCKMANN 1998) Ein Konzept, das zwischen überbetrieblicher Ausbildung und einer Ausbildung nach den Prinzipien ‚unterstützte Beschäftigung’ liegt, schlägt SCHÜLLER vor. Es sollen tradierte Konzepte (allgemeinbildender/ berufsfachlicher Unterricht) durch Elemente unterstützter Beschäftigung ergänzt werden (Betriebspraktika mit Arbeitsassistenz). Nach einer ‚Orientierungsphase’ schließt sich die ‚Qualifizierungsphase’ an, „bei der betriebliche Erprobungen (im vorgesehenen Berufsfeld) mit überbetrieblichen Lerneinheiten (Blockunterricht oder ein wöchentlicher Schulungstag) abwechseln“ (SCHÜLLER 2001, 299). Einen evtl. Abschluss bildet die ‚Vermittlungsphase’. Aufgabe von Werkstufe und Integrationsfachdiensten ist eine qualifizierte Fähigkeitsdiagnostik. Diese Diagnostik sollte, soweit möglich, mit dem Menschen mit Behinderung zusammen erfolgen, um eigene Einschätzung, Vorlieben und Abneigungen zu eruieren. Das sollte mit den aufnehmenden Betrieben (Werkstatt für behinderte Menschen, allgemeiner Arbeitsmarkt) abgeglichen werden. Es genügt nicht, lediglich auf den Eingangsbereich der Werkstatt ein solches Verfahren zu verschieben, da damit Alternativen sehr eingeschränkt werden. Der Wechsel von der Werkstatt für Behinderte auf alternative Felder ist häufig erschwert, wie viele Untersuchungen belegen. Die Werkstätten für behinderte Menschen leisten gute Arbeit und müssen dafür auch Unterstützung erhalten. Es müssen aber auch differenzierte Beschäftigungsmöglichkeiten und Angebote der begleitenden Dienste einbezogen werden. Das darf nicht nur im Rahmen der verschiedenen Abteilungen innerhalb der Werkstatt geschehen, sondern die sog. Außenarbeitsplätze könnten erweitert werden: Landwirtschaft, Gartenpflege, Tierpflege im Wildpark, Hotel- und Gaststättenbetriebe, Wäscherei und viele mehr. Der ‚Schonraum’ der Werkstatt für behinderte Menschen bietet vielen Menschen mit Behinderungen soziale Kontakte, Stabilität in den Arbeitsabläufen, fachkundige Anleitung und einen sicheren Arbeitsplatz. Was er nur unzureichend bietet, ist eine angemessene Entlohnung. Hier müssen Korrekturen vorgenommen werden. Bei Beschäftigten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt sieht die finanzielle Situation erheblich besser aus. Allerdings traten nach Auskunft der Beratungsstelle der Lebenshilfe München auch gehäuft psychische 15 Probleme auf, da sie dort z. T. überfordert waren, nicht angemessen betreut wurden, unter starkem Leistungsdruck standen oder durch Unverständnis der Kollegen oder Arbeitgeber litten. Außenarbeitsplätze, eine Variante der gemeinnützigen Arbeitnehmerüberlassung, Selbsthilfefirmen, geschützte Betriebsabteilungen sind nur einige Möglichkeiten, die ausgebaut werden können. Hier ist auch eine wichtige Aufgabe von Arbeitsassistenten, im Rahmen der Integrationsfachdienste geeignete Hilfen für die Behinderten und die Arbeitgeber bereitzustellen. Personal der Integrationsfachdienste muss gut geschult werde. Das Kennzeichen einer professionellen Integrationsarbeit ist „eine starke Kundenorientierung durch einen flexiblen, individuellen und betriebsnahen Ansatz“ (BRANDENBURGER ERKLÄRUNG) Als ernstzunehmender Verhandlungspartner mit den Betrieben müssen die Fachberater lernen, ‚mit dem Kopf der Betriebe zu denken’ (SCHARTMANN, 2000, 173). Die Angebote sollen individuelle Berufsplanung und Erstellung eines Fähigkeitsprofils umfassen, individuelle Arbeitsplatzsuche unterstützen, die Beratung von Arbeitsgebern, Kollegen und behinderten Arbeitnehmern anbieten, Arbeitsplatzanalysen durchführen, Job Coaching und Qualifizierung im Betrieb sowie langfristige Unterstützung ermöglichen (BRANDENBURGER ERKLÄRUNG) Neue Ausbildungsberufe für Menschen mit Lernschwierigkeiten müssen entwickelt werden. „Nur eine institutionalisierte, geregelte Berufsausbildung für geistig behinderte junge Erwachsene kann die Rahmenbedingungen für eine Synthese der beiden wesentlichen Ausbildungspole schaffen: fachliche Ausbildung je nach Eignung und Neigung sowie Erwerb von ‚Schlüsselqualifikationen’, die im sozialen Gefüge des Erwerbslebens unabdingbar sind“ (LEBENSHILFE 1998, 17) Gestufte Ausbildungspläne für neue Berufszweige (Modulsystem) etwa zum Helfer im Gartenbau, Helfer im Haus- und Pflegedienst und ähnliche liegen bereits vor. Hier können weitere Entwicklungen Raum greifen. Abschließend darf ich festhalten, dass das Betätigungsfeld beruflicher Grund- und Ausbildung von Menschen mit geistiger Behinderung zwischen den verschiedenen Systemen stark in Bewegung ist, dass sich viele Möglichkeiten eröffnen und die Arbeit an einer Qualifizierung nachschulischer Förder- und Beschäftigungsangebote äußerst spannend ist. 16 Literatur: BARLSEN, J., HOHMEIER, J. (Hrsg.): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderung. Unterstützte Beschäftigung im System der beruflichen Rehabilitation. Düsseldorf 2001 BÖHM, A.: Integrierte Ausbildung für Behinderte. In: Behindertenpädagogik in Bayern 2/2000, 126 – 129 BRANDENBURGER ERKLÄRUNG zur beruflichen Integration behinderter Menschen in Deutschland. In: Impulse Nr. 13, Nov. 1999 BUNDESANSTALT FÜR ARBEIT: Berufliche Bildung und Förderung in der Werkstatt für Behinderte (WfB). Nürnberg 1999 BUNDESVERBAND EVANGELISCHER BEHINDERTENHILFE (BEB): Fragebogen zum Übergang von Schülerinnen und Schülern mit einer geistigen Behinderung von der Schule in das Berufsleben. Unveröffentl. Skript 1998 DOOSE, S.: Unterstützte Beschäftigung. Eine Untersuchung von Integrationsfachdiensten und unterstützten Arbeitsplätzen in Deutschland. Hamburg 1997 DOOSE, S.: Unterstützte Beschäftigung in Deutschland – ein Überblick. 1999 (http://bidok.uibk.ac.at/impulse/imp989ueberblick2.html) DOOSE, S.: Aktuelle Informationen zur Novellierung des Schwerbehindertengesetzes. In: Impulse Nr. 15, April 2000 (http://bidok.uibk.ac.at/texte/imp15-00-novellierung.html) DOOSE, S.: Unterstützte Beschäftigung – Ein neuer Weg der Integration im Arbeitsleben im internationalen Vergleich. 2001 (http://bidok.uibk.ac.at/texte/integ2000-Unterst_html) DUISMANN, G., H.: Neue Arbeitswelt – neue Arbeitslehre? In: Lernen konkret 1/2001, 2 – 5 FRÜHAUF, T.: Berufsbezogene und anerkannte Ausbildung für Menschen mit geistiger Behinderung. In: FRÜHAUF, T., GRAMPP, G., SCHMITZ, G.: Berufliche Bildung in Werkstätten für Behinderte. Frankfurt 1997, 63 - 73 HAVEMANN, M.: Veränderungen heutiger Lebenswelten für Kinder und Jugendliche – Worauf muss die Schule vorbereiten? Referat bei der Fachtagung der Bundesvereinigung Lebenshilfe. Marburg 1999 HEINTZE, D.: Ein Beruf fürs Leben. Geistig Behinderte sollen einen Platz im ersten Arbeitsmarkt finden. Doch es gibt zu wenig qualifizierte Integrationsberater. In: DIE ZEIT Nr. 47 vom 16. No. 2000 HORIZON-ARBEITSGRUPPE: Unterstützte Beschäftigung. Handbuch zur Arbeitsweise von Integrationsfachdiensten für Menschen mit geistiger Behinderung. Hamburg 1995 LANDSCHAFTSVERBAND RHEINLAND (LVR) (Hrsg.): Übergänge von der Sonderschule/ WfB in das Erwerbsleben, Zwischenbericht, Köln 1998 LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE (LWL) (Hrsg.): Kriterien zur Verbesserung der Entscheidungssicherheit bei der Eingliederung Behinderter in Werkstätten für Behinderte oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Münster 1994 LEBENSHILFE BUNDESVEREINIGUNG (Hrsg.): Wege zu allgemeinen Arbeitsmarkt. Marburg 1996 LEBENSHILFE BUNDESVEREINIGUNG (Hrsg.): Ein Beruf für mich. Berufliche Ausbildung für Menschen mit geistiger Behinderung. Marburg 1998 LELGEMANN, R.: Arbeit ist möglich. Arbeitshilfen und Arbeitsplätze für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen Düsseldorf 1996 PFEIFER, S.: Betriebspraktika im Rahmen der beruflichen Grundbildung in der Werkstufe der Schule zur individuellen Lebensbewältigung. Zulassungsarbeit Universität München 1999 17 SCHARFF, M., SCHARFF, G.: Berufliche Orientierung und Entscheidungsvorbreitung für Förderschülerinnen/Förderschüler an der Schwelle zur vorberuflichen/beruflichen Ausbildung. In: : Behindertenpädagogik in Bayern 2/2000, 123 – 126 SCHARTMANN, D.: Berufliche Integration geistig behinderter Menschen – die Sicht der Betriebe. In: Gemeinsam leben – Zeitschrift für integrative Erziehung Nr. 2, 1999 SCHARTMANN, D., SCHRÖDER, H., STEINWEDE, J.: Übergänge von der Sonderschule/ WfB in das Erwerbsleben, Ergebnisbericht, Köln 2000 SCHOR, B.: Eine Partnerschaft – zukunftsorientiert und erfolgreich: Arbeitsverwaltung und Förderschulen in Bayern kooperieren. In: Lernen fördern 3/2001, 16 – 17 SCHÜLLER, S.: Die Auswirkungen des Konzeptes der ‚Unterstützten Beschäftigung’ auf das System der beruflichen Rehabilitation am Beispiel der Werkstätten für Behinderte. In: BARLSEN, J., HOHMEIER, J (Hrsg.): Neue berufliche Chancen für Menschen mit Behinderung. Düsseldorf 2001, 287 - 310 STOCKMANN, R., KOHLMANN, U.: Transferierbarkeit des Dualen Systems. Berlin 1998 VERBAND EVANGELISCHER EINRICHTUNGEN für Menschen mit geistiger und seelischer Behinderung (VEEMB) (Hrsg.): Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen in Werkstätten für Behinderte. Reutlingen 1996 WIMMER, M.: Die Werkstufe der Schule zur individuellen Lebensbewältigung – eine Zwischenbilanz. In: Behindertenpädagogik in Bayern 3/2000, 179 – 181 ZELFEL, R. C.: Ein großer Schritt nach vorn: Das neue Sozialgesetzbuch (SGB) IX ab 1. 7. 2001 in Kraft. In: Lernen fördern 2001, 4 – 5 Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Walter Straßmeier Institut für Sonderpädagogik der Ludwig-Maximilians-Universität München Leopoldstraße 13 80802 München 18