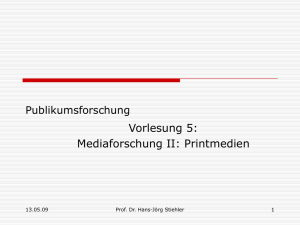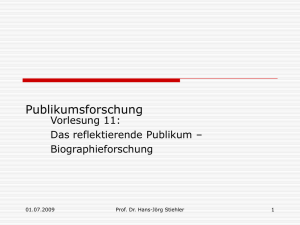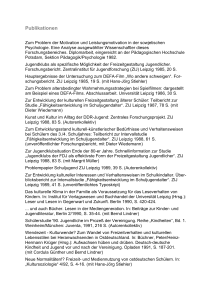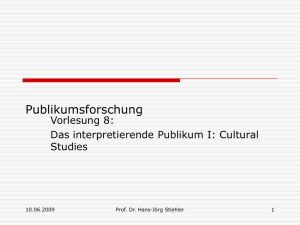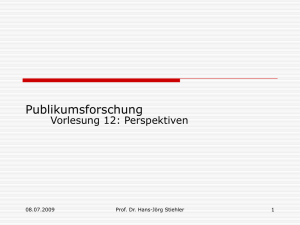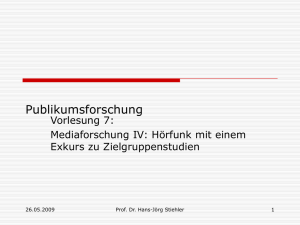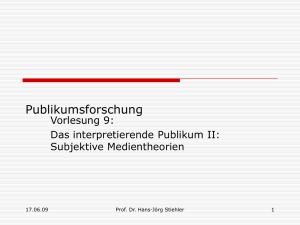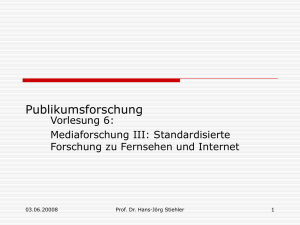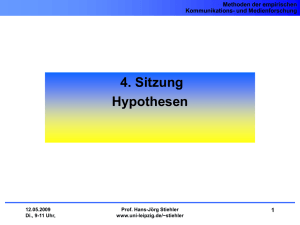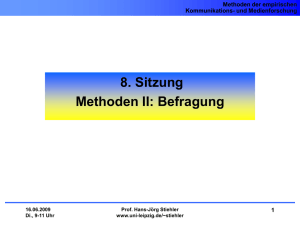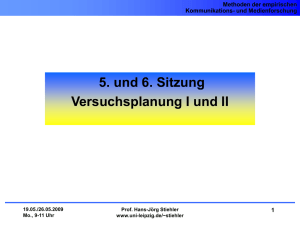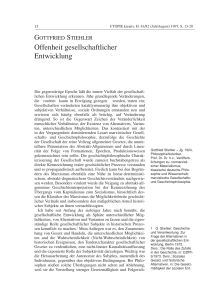Publikumsforschung
Werbung

Publikumsforschung Vorlesung 10: Das redende Publikum 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 1 Gliederung Vorlesung 10 1. Grundgedanken 2. Methoden 3. Beispielstudien 1. Medien in der Alltagskommunikation 2. Tischgespräche 3. Der sprechende Zuschauer 4. Gerüchteforschung 4. Zusammenfassung 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 2 1. Grundgedanken: Reden in der Medienwelt Ausgangspunkte: MK und IPK als Grundtypen von Kommunikation a) Art: vermittelt vs. unvermittelt b) Reichweite: global vs. lokal c) feed back: Fehlen vs. Vorhandensein d) Sprachen: multi- vs. monosprachlich IPK in Medienwelt: direkter und indirekter Bezug neuer Platz von IPK in einer Medienwelt neue Technologien: Hybridformen von MK und IPK 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 3 1. Grundgedanken: Ansätze mit Bezug auf interpersonale Kommunikation direkter Bezug Zwei-Stufen-Fluss der Kommunikation Diffussionsforschung soziale Netzwerke indirekter Bezug: Wissenskluft Einstellungsänderungen Schweigespirale 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 4 1. Grundgedanken: Prozesse Metakommunikation: Kommunikation über Kommunikation Prozesse (siehe Beispiel 3) präkommunikativ rezeptionsbegleitend postkommunikativ 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 5 1. Grundgedanken: Funktionen interpersonale K. für Medienkommunikation Weiterleitung/Ersatz Kommentierung/Bewertung Erlernen und Demonstration von Medienkompetenz Medien für interpersonale Kommunikation Gesprächsstoff/-gegenstände Brennpunkt sozialer Aktivitäten Stützen individueller Positionen (virtuelle Bezugsgruppe) 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 6 2. Methoden Methode der Wahl: teilnehmende Beobachtung Probleme Rolle im Feld Protokollierung Reaktivität Forschungsethik 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 7 3. Forschungsbeispiel 1: Massenmedien in der Alltagskommunikation Hans-Martin Kepplinger/Verena Martin: Die Funktionen der Massenmedien in der Alltagskommunikation. Publizistik 31/1986 Ausgangspunkt: Funktion von Alltagsgesprächen für Wirkung und Nutzung der Medienkommunikation Fragestellungen (u.a.): o Häufigkeit der Thematisierung von Medien Funktionen der Medien für Alltagskommunikation Methode: teilnehmende verdeckte Beobachtung 45 Gruppen mit 2-5 Mitgliedern vier verschiedene Plätze 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 8 3. Forschungsbeispiel 1: Alltagskommunikation 1. Häufigkeit nach verschiedenen Orten 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 9 3. Forschungsbeispiel 1: Alltagskommunikation 2. Gesprächsintensität und Medienbezug 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 10 3. Forschungsbeispiel 1: Alltagskommunikation 3. Funktionen: Anlass, Unterrichtung, Verteidigung 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 11 3. Forschungsbeispiel 2: Tischgespräche Angela Keppler: Tischgespräche. Über Formen kommunikativer Vergemeinschaftung am Beispiel der Konversation in Familien. Frankfurt a.M. 1994: Suhrkamp Ausgangspunkt: Studie zur Konversation in Familien: Rolle der Medien darin Fragestellung Wie versorgen die Medien mit Gesprächsstoff und wie vollzieht sich dessen Nutzung? Methode Tonbandaufzeichnungen (100 Stunden) 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 12 3. Forschungsbeispiel 2: Tischgespräche Medienreferenzen (in anderen Themen) Kurzverweise Belehrung Eigenständige Medienrekonstruktionen Re-Inszenierungen mehrstimmige Rekonstruktionen Medien der Aktualisierung gemeinsame Interpretationen 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 13 3. Forschungsbeispiel 3: Der redende Zuschauer Werner Holly, Ulrich Püschel, Jörg Bergmann: Der sprechende Zuschauer. Wie wir uns Fernsehen kommunikativ aneignen. Wiesbaden 2001: Westdeutscher Verlag Ausgangspunkt: Zusammenhang Alltags- und Fernsehkommunikation Fragestellung Wie verläuft fernsehbezogenes Sprechen? Methode Tonbandaufzeichnungen (180 Stunden) + Videomitschnitte 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 14 3. Forschungsbeispiel 3: Der redende Zuschauer 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 15 3. Forschungsbeispiel 3: Der redende Zuschauer 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 16 3. Forschungsbeispiel 4: Gerüchte Definitionsbestandteile: unsichere Information nach Quelle und Genauigkeit institutionell nicht abgesichert Mischformen und Übergänge zu Klatsch und „richtigen“ Informationen Entstehen: Situationen mit Informationsdefizit Bedrohung gesellschaftlicher Ordnung bzw. von allgemeinen Realitätsvorstellungen Versagen der Medien 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 17 3. Forschungsbeispiel 4: Gerüchte kollektiver Problemlösungsprozess nach Plausibilität Ersatz der Medien Rückgriff auf inadäquate Erkenntnis- und Kommunikationsformen Restrukturierung sozialer Beziehungen „von unten“ Prinzipien (nach Festinger) Prinzip der äusseren Kontrolle Prinzip der kognitiven Unstrukturiertheit Prinzip der integrativen Interpretation 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 18 4. Zusammenfassung interpersonale Kommunikation als Sphäre des aktiven Umgang mit den Medien (inkl. des Spiels mit den Medien kein gegenseitiger Ersatz, sondern Funktionswandel neue und veränderte Gesellungsformen 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 19 Übungsfragen 1. Wodurch unterscheiden sich Medien- und interpersonale Kommunikation? 2. Welche Funktionen erfüllt interpersonale Kommunikation? Illustrieren Sie diese Funktionen mit selbst gewählten Beispielen! 3. Beschreiben Sie eine empirische Studie aus dem Forschungsfeld (Methode, Herangehen, ausgewählte Beispiele)! 24.06.2009 Prof. Dr. Hans-Jörg Stiehler 20