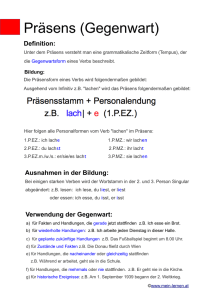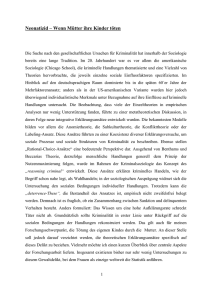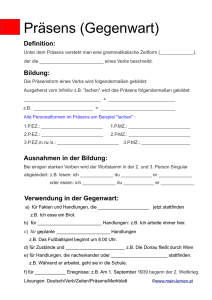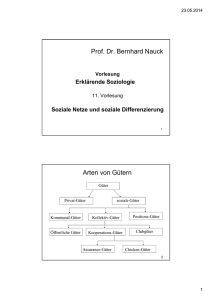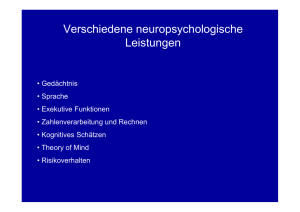Bedeuten und Verstehen
Werbung

Josef Häfele Bedeuten und Verstehen Das sprachliche Handeln und seine Grammatik Der Autor: Josef Häfele, geb. 1950, ist promovierter Sprachwissenschaftler mit dreißigjähriger Erfahrung im gymnasialen Unterricht. Publikationen u.a.: Fragekompetenz 1974; Der Aufbau der Sprachkompetenz. Studien zur Grammatik des sprachlichen Handelns 1979; Stundenblätter „Reflexion über Sprache“1984; Stundenblätter „Don Carlos“ 1986; Thomas Mann. Der Tod in Venedig. Grundlagen und Gedanken zum Verständnis erzählender Literatur 1992; Reflexion über Sprache. Bedeutung, Sprache, Den‐ ken. Arbeitsblätter Deutsch 1997. www.bedeutungstheorie.de Ungekürzte Originalausgabe, August 2015 © epubli GmbH, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin Druck: Sigloch Verlagservice, Am Buchberg 8, 74572 Blaufelden ISBN 978-3-7375-6384-0 Für Anna Vorwort Seit der Antike haben Philosophen über Sprache nachgedacht. Eine ihrer Annahmen war: Sprachliche Ausdrücke haben Bedeutung, sie bedeuten etwas. Dabei wurde seit Platons Kratylos vorausgesetzt, dass es etwas gäbe, das Ausdrücken als Bedeutung zugeordnet werden könnte, etwa Gegenstände, Vorstellungen, Ideen, Gedanken usw. Wittgenstein hat vor über einem halben Jahrhundert solche Theorien mit überzeu‐ genden Argumenten zurückgewiesen. Diese Theorien erklären Sprache nicht, schon die Prämissen ihrer Fragestellungen sind falsch. So etwas wie Bedeutungen, die sprachlichen Ausdrücken zur Erklärung zugeordnet werden könnten, gibt es gar nicht. Was wir mit sprachlichen Ausdrücken bedeuten, kann weder in Gegenständen noch in Vorstellungen von ihnen noch in anderen mentalen oder kognitiven Entitä‐ ten bestehen. Wittgenstein schlug deshalb vor, auf den irreführenden Terminus Be‐ deutung zu verzichten und stattdessen die tatsächliche Verwendung sprachlicher Ausdrücke, ihren Gebrauch, zu betrachten. Wittgensteins epochale Leistung war vor allem die Destruktion der traditionellen Semantik. Eine systematische Alternative lieferte er noch nicht. Immerhin formulierte er mehrere Vorschläge. Einerseits schlug er vor, den Gebrauch von Ausdrücken über die Bestimmung ihrer Wahrheitsbedingungen zu interpretieren. In einem zweiten Ansatz interpretierte er sprachliche Handlungen als Sprachspiele. Ein dritter Vor‐ schlag war, den Gebrauch sprachlicher Ausdrücke durch Bestimmung der mit ihnen angestrebten Zwecke zu beschreiben. Allerdings blieb der Zusammenhang dieser drei Ansätze weitgehend offen. Wie aber sieht eine systematische und kohärente Gebrauchstheorie aus? Diese Frage scheint mir bis heute noch nicht hinreichend beantwortet zu sein. Zwar liegt seit Langem eine Reihe gebrauchstheoretischer Ansätze vor, etwa die Sprechakttheorie oder die konversationelle Theorie von H. P. Grice. In ihnen werden wichtige Aspekte des Bedeutungshandelns thematisiert. Es fehlt aber eine handlungstheoretische Be‐ schreibung, die systematisch und umfassend erklärt, wie das, was traditionell Bedeu‐ tung heißt, im sprachlichen Handeln selbst konstituiert wird. Auch sehe ich noch immer keine überzeugende Erklärung grammatischer Regeln. Welche Funktionen haben sie in unserem sprachlichen Handeln? Es fehlt also eine integrale Theorie des sprachlichen Handelns, in der Syntax und Pragmatik ihren funktionalen Platz haben, und die erklärt, wie das, was Sinn oder Inhalt genannt wird, im sprachlichen Handeln selbst gegeben ist. Und ebenfalls fehlt auch die Erklärung, worin das Verstehen sprachlicher Handlungen besteht. Damit sind auch schon die Ziele dieser Arbeit vorgegeben. In diesem Buch geht es für mich darum, ihnen möglichst nahe zu kommen. 1. An Stelle der unhaltbaren semantischen Korrespondenztheorien werde ich im Sin‐ ne Wittgensteins eine handlungstheoretische Semantik formulieren, die zeigt: Was wir Bedeutung, Sinn oder Inhalt nennen, gibt es nur in den Handlungen selbst, mit denen wir etwas bedeuten. 2. In dieser Beschreibung wird auch die künstliche und unangemessene Trennung von Syntax, Semantik und Pragmatik überwunden werden. Die hier vorgestellte funktionale Grammatik beschreibt syntaktische Regeln als Regeln des sprachlichen Handelns und damit als integralen Teil der Semantik 3. Eine handlungstheoretische Semantik soll nicht nur das sprachliche Handeln an‐ gemessen beschreiben, sondern auch dessen Verstehen. Ich möchte darlegen, wie sprachliche Handlungen verstanden werden und welche Rolle pragmatische Er‐ schließungsarbeit dabei spielt. Mein zentrales Vorhaben ist also eine zumindest in groben Zügen linguistisch ausge‐ arbeitete Gebrauchstheorie. Mit ihr soll eine Antwort gegeben werden auf die Frage, wie wir bedeutsam sprachlich kommunizieren, und zwar ohne die unhaltbaren Prä‐ missen der Vorstellungstheorie und anderer traditioneller Semantiken. Konkret geht es um eine Neuformulierung und Weiterentwicklung der Sprechakttheorie, bei der Syntax und Pragmatik in die Beschreibung des sprachlichen Handelns integriert werden. Das Ergebnis ist eine Beschreibung des sprachlichen Bedeutungshandelns: Wir machen sprachliche Handlungen und wir machen sie so, dass zu verstehen ge‐ geben wird, dass wir sie machen. Das geht natürlich nicht ohne Regeln, auch wenn Regeln noch nicht reichen. Natürlich kann ich auf den folgenden Seiten keine vollständige handlungstheoreti‐ sche Beschreibung sprachlicher Kommunikation bieten. Ihrem Charakter nach han‐ delt es sich bei der folgenden Darstellung eher um eine Einführung. Trotzdem sollte deutlich werden, dass die Frage, wie wir bedeutsam sprachlich kommunizieren, durch eine handlungstheoretische Semantik vollständig beantwortet werden kann. Ich hoffe, dass der Leser bei der Lektüre seine kommunikative Praxis wiedererkennt. Heilbronn, 20. August 2015. Josef Häfele Inhalt Teil I: Grundlagen 1. Handlungstheorie Besonderheiten von Handlungsbeschreibungen 1 Verstehen von Handlungen 5 Arten von Handlungen 8 13 Von welcher Art sind sprachliche Handlungen? 2. Regeln und Wahrheit: Prädikatoren und Satzwörter Wortarten 17 Prädikationsregeln 20 Notwendige Unschärfen 24 Polysemie und Homonymie 25 Satzwörter 30 Fazit und Ausblick 45 Teil II: Sprachliche Bedeutungshandlungen 3. Die „unzähligen“ Verwendungen der Sprache – Was sind Sprechakte? 47 48 Sprechakte und Regeln: Illokutive Indikatoren 63 Sprechakte und konversationelles Erschließen 72 Bewirkungsziele bei Sprechakten 77 Absichten bedeuten 83 Intentionen und Regeln 86 Sprechakte sind keine Sprachspiele 4. Das Prädikationsspiel und die Grammatik des sprachlichen Handelns 89 Die kommunikative Funktion grammatischer Regeln 91 Prädizieren: Der einfache Satz 93 Referieren 103 109 Bedeutungshandlungen als „Tiefenstruktur“ von Sätzen 113 Attributive Prädikationshandlungen Konventionelle Unterbestimmtheit und Pragmatik 118 Adverbiale und das Reden über Sachverhalte 134 Fazit: Die Grammatik des sprachlichen Handelns 159 5. Die vielen Wege zum kommunikativen Misserfolg 163 6. Sprachliches Verstehen Teil III: Schlussfolgerungen 179 Interpretieren und Erschließen 185 Das Verstehen des Prädikationsspiels 189 7. Sprachliche Universalien 193 8. Fazit 207 9. Von der traditionellen Semantik zur Gebrauchstheorie 209 10. Anhänge: 1. Pragmatische Aspekte des Verstehens – Analyse eines journalistischen Textes 221 2. Rekursivität in einem Satz in Thomas Manns „Tod in Venedig“ – eine grammatische und handlungstheoretische Beschreibung Literatur 229 235 1 Teil I: Grundlagen 1. Handlungstheorie Besonderheiten von Handlungsbeschreibungen Was sind sprachliche Handlungen und wie werden sie gemacht? Und weil sprachli‐ che Handlungen auf Verstehen angelegt sind: Wie werden sprachliche Handlungen gemacht, so dass mit ihnen etwas zu verstehen gegeben werden kann? Und wie funktioniert schließlich das Verstehen? Will man das Spezifische der kommunikativen und insbesondere der sprachlichen Handlungen bestimmen, kommt man nicht umhin, sich vorab Auskunft darüber zu geben, was Handlungen überhaupt sind. Als Handlungen werden im Allgemeinen intentional gerichtete und gewollte Verhaltensweisen verstanden. In psychologi‐ schen Charakterisierungen werden sie in Abgrenzung zu verursachtem Verhalten oft als Willenshandlungen bezeichnet. „Willenshandlungen kommen dadurch in die Welt, dass die handelnde Person ein bestimmtes Ziel hat, das sie erreichen will, und dass sie glaubt, dieses Ziel mit Hilfe einer bestimmten Handlung erreichen zu kön‐ nen.“1 Solche Willenshandlungen werden intuitiv von der Vorstellung der Hand‐ lungsfreiheit begleitet. „Wir sind nämlich davon überzeugt, dass Personen die Urhe‐ ber ihrer Handlungen sind und sie in ihren Handlungsentscheidungen frei sind. (…) Wir gehen davon aus, dass wir in fast allen Lebenslagen auch immer anders handeln könnten als wir es tatsächlich tun – wenn wir nur wollten…“2 Unsere Handlungen sind also in doppelter Hinsicht absichtsvoll: Sie dienen der Erreichung von Zielen, und sie sind gewollt in dem Sinne, dass wir sie auch unterlassen oder anders han‐ deln könnten. Will man verstehen, was Handlungen sind, muss auch geklärt werden, wie wir über sie reden. Auf den ersten Blick scheinen Handlungen ja nichts Besonderes zu sein. Wie über anderes sprechen wir auch über sie mit klassifizierenden prädikativen Ausdrücken, die wir wahrheitsgemäß zu‐ oder absprechen. Wenn wir sagen, dass jemand schwimmt, rennt oder lacht, benutzen wir regelhaft verwendete Ausdrücke wie schwimmen, rennen oder lachen. Wir stellen fest, dass eine konkrete raumzeitliche Aktivität dem entspricht, was nach unserem Sprachgebrauch als Schwimmen, Ren‐ 1 Prinz 2004, 4ff. a.a.O. Wieso entgegen der Mehrheitsmeinung von Kognitions‐ und Neurowissenschaftlern die Frei‐ heitsintuitionen von handelnden Subjekten keine Selbsttäuschungen sind, erklärt aus neurobiologi‐ scher Sicht Prinz 2013. 2 2 nen oder Lachen zählt. Wir unterscheiden und kategorisieren also einzelne raumzeit‐ lich konkrete Handlungsvorkommnisse als Handlungen eines bestimmten Typs oder Musters. Insoweit gilt für Handlungen zuerst einmal nichts anderes als für alle anderen in un‐ serer prädikativen Einteilung der Welt gegebenen „Gegenstände“. Wenn wir z.B. über Pflanzen reden, reden wir von ihnen ebenfalls als Vorkommnissen eines be‐ stimmten Typs wie Fichten, Tomatenstauden oder Gras. Auf dieselbe Weise unter‐ scheiden wir einzelne Werkzeuge als Gegenstände des Typs Zange, Schraubenzieher oder Meterstab. Und solche prädikativen Kategorisierungen machen wir auch beim Reden über Menschen, wenn wir sie als Männer, Frauen, Kinder, Franzosen, Farbige, als Buddhisten oder Moslems bezeichnen. Voraussetzung für ein solches Reden über Dinge, Menschen oder Handlungen usw. ist die praktische Kenntnis von entspre‐ chenden, regelhaft gebrauchten prädikativen Ausdrücken. Wittgenstein hat bezüg‐ lich Farben festgestellt: „Wie erkenne ich, dass diese Farbe Rot ist? – Eine Antwort wäre: ‚Ich habe Deutsch gelernt.’“ Entsprechendes gilt auch für das Unterscheiden von Handlungen. Wie erkenne ich, dass jemand tanzt? Ich habe das Wort tanzen ge‐ lernt. Zwischen prädikativen Ausdrücken (bzw. Sätzen, in denen sie zugesprochen wer‐ den) kann es logische Zusammenhänge geben. Wer von einem Dackel redet, wird – wenn er dem üblichen Gebrauch dieses Ausdrucks folgt ‐ auch zugeben, dass dieser Dackel ein Hund, ein Tier und auch ein Lebewesen ist. Innerhalb der logischen Im‐ plikation Dackel Hund Tier Lebewesen werden die Prädikationsbedingungen der Ausdrücke von links nach rechts immer unspezifischer. Das Pfeilsymbol steht von links nach rechts gelesen für wenn – dann und gleichzeitig für daraus folgt, also in dem Sinn: Wenn etwas ein Dackel ist, dann ist es auch ein Hund. Aus der Wahrheit des Satzes Das ist ein Tier folgt die Wahrheit von Das ist ein Lebewesen. Auf den ersten Blick erscheinen auch Handlungen als ganz gewöhnliche „Gegen‐ stände“ der Welt, über die wir reden wie über Tiere, Pflanzen, Werkzeuge oder Men‐ schen. Auf ein und dasselbe Tier vom Typ Dackel treffen auch die Prädikatoren Hund, Tier und Lebewesen zu. Entsprechendes scheint es auch bei Handlungsbe‐ schreibungen zu geben. Denn auch auf eine einzige raumzeitliche Handlung können meist mehrere Beschreibungen gleichzeitig zutreffen: Ein Matrose P auf einem in Seenot geratenen Schiff holt Hilfe (e), indem er einen Notruf abgibt (d), indem er eine Leuchtrakete bestimmter Art abfeuert (c), indem er den Abzug der Pistole betätigt (b), indem er eine bestimmte Fingerbewegung ausführt (a). Die raumzeitliche Hand‐ 3 lung a kann nun auf verschiedene Weisen beschrieben werden, nicht nur als Hand‐ lung vom Muster a, sondern auch als Handlung vom Typ b, c, d oder e. Zwischen diesen verschiedenen gleichzeitig möglichen Handlungsbeschreibungen zeigt sich ein Zusammenhang: Finger bewegen Abzug betätigen Rakete abfeuern Notruf abgeben Hilfe holen a b c d e Das Pfeilsymbol zwischen den Handlungsmustern kann von rechts als Indem‐ Relation gelesen werden: P ruft Hilfe herbei (e), indem er einen Notruf abschickt (d), indem er eine Leuchtrakete abfeuert (c), indem er den Pistolenabzug betätigt (b), in‐ dem er seinen Finger bewegt (a). Besser erkennbar werden die Besonderheiten von Handlungsbeschreibungen aber in der Wenn‐dann‐Lesart von links nach rechts: Wenn P seinen Finger bewegt, dann ist das nur unter bestimmten Bedingungen das Betätigen des Pistolenabzugs, dieses ist nur unter Umständen das Abfeuern einer Leuchtrakete, dieses wiederum nur unter bestimmten Bedingungen das Herbeirufen von Hilfe. In dieser Wenn‐dann‐Lesart beschreiben die Handlungsmuster rechts die Ziele, mit denen die Handlungen links davon gemacht werden: Der Abzug wird mit der Ab‐ sicht betätigt, die Rakete abzufeuern, diese wird mit dem Ziel abgefeuert, einen Not‐ ruf abzugeben, der Notruf wird mit dem Ziel abgegeben, jemanden zur Hilfeleistung zu bewegen. Absichten sind also immer als Ziele von Handlungen beschreibbar. Das unterscheidet sie von Wünschen: Ich kann mir zwar wünschen, dass ich im Lotto gewinne, aber ich kann es nicht beabsichtigen. Die Wenn‐dann‐Lesart offenbart nun einen entscheidenden Unterschied zu logischen Implikationen. Der Zusammenhang klassifizierender Beschreibungen in der Wenn‐ dann‐Kette Dackel Hund Tier Lebewesen ist schon durch den Gebrauch (die Wahrheitsbedingungen) der Prädikatoren – also logisch ‐ gegeben. Wenn man feststellt, dass etwas ein Hund ist, würde jemand mit unserem Sprachgebrauch sich selbst widersprechen, wenn er bestreiten würde, dass es gleichzeitig auch ein Tier und ein Lebewesen ist. In solche Widersprüche muss man bei Handlungsbeschreibungen nicht geraten: Man kann durchaus feststellen, dass der Pistolenabzug gedrückt wurde, aber alles andere weiter rechts in der Beschreibungskette hängt von den jeweiligen faktischen Um‐ ständen ab. Es kann sein, dass durch das Betätigen des Abzuges nur ein klackendes Geräusch verursacht wird, dass ein Vogel verscheucht, ein Tier verletzt oder dass das Mobiliar beschädigt wird. Nur unter bestimmten situativen Bedingungen gibt man dadurch einen Notruf ab. Der Wenn‐dann‐Zusammenhang zwischen Handlungs‐ 4 mustern ist also nicht von logischer Art. Es gehört nicht zur Gebrauchsregel des Ausdrucks den Pistolenabzug betätigen, dass damit lebensrettende Notrufe erfolgen oder Menschen verletzt werden. Solche Folgezusammenhänge ergeben sich nur un‐ ter bestimmten Umständen. Wenn ich beim Schachspiel eine Figur von einem Feld auf ein anderes bewege (a), damit meinen Gegner matt setze (b), ihn dadurch besiege (c), dadurch eine Wette gewinne (d), dadurch erreiche, dass ich tausend Euro bekomme (e), mich dadurch von meinen finanziellen Nöten befreie (f), dann habe ich eine einzige raumzeitliche Handlung gemacht, auf die mehrere Beschreibungen oder Typisierungen zutreffen können. Man kann auch sagen, dass ich nach mehreren Mustern handle: a b c d e f. Auch hier kann die mit dem Pfeilsymbol dargestellte Relation doppelt gelesen wer‐ den: von links nach rechts als wenn ‐ dann, von rechts nach links als indem: Ich befreie mich von meinen finanziellen Nöten (f), indem ich mir tausend Euro beschaffe (e), indem ich eine Wette gewinne (d), indem ich beim Schachspiel siege (c), indem ich den Gegner matt setze (b), indem ich den richtigen Zug mache (a). Zwischen diesen verschiedenen Handlungsbeschreibungen bestehen keine logischen Beziehungen: Nicht per se, sondern nur in einer ganz bestimmten faktischen Spielkonstellation führt ein bestimmter Zug mit einer bestimmten Figur vom Feld x auf das Feld y zum Schachmatt, nur unter ganz bestimmten Umständen gewinnt man dadurch eine Wet‐ te, nicht immer bekommt man nach einer gewonnenen Wette tausend Euro, und nicht jeder wird dadurch von seinen finanziellen Nöten befreit. Unser Sprechen über Handlungen unterscheidet sich also erheblich davon, wie wir über andere Dinge der Welt reden. Zwar können auch auf Handlungen – ebenso wie auf alles andere Beschreibbare ‐ gleichzeitig mehrere prädikative Typisierungen zu‐ treffen. Aber während der Zusammenhang verschiedener klassifikatorischer Aus‐ drücke für beispielsweise Pflanzen oder Tiere durch die Gebrauchsregeln dieser Ausdrücke und damit logisch gegeben ist, gibt es zwischen den bei Handlungen gleichzeitig möglichen prädikativen Beschreibungen im Allgemeinen keine semanti‐ schen bzw. logischen Zusammenhänge. Somit ist es bei handlungstheoretischen Beschreibungen besonders interessant, die Arten der jeweiligen Bedingungen zu betrachten, unter denen in Wenn‐dann‐Ketten einzelne raumzeitliche Handlungen nach dem Muster A auch jeweils Handlungen nach den Mustern B und C usw. sein können. Und entsprechend den unterschiedli‐ chen Arten solcher Bedingungen lassen sich vermutlich auch unterschiedliche Arten von Handlungen bzw. Handlungsmustern unterscheiden. 5 Handlungsbeschreibungen in Wenn‐dann‐Ketten beginnen bei konkreten raumzeitli‐ chen Basishandlungen, also Handlungsmustern, die in der jeweiligen Beschreibungs‐ kette ganz links stehen. Was als Handlung eines bestimmten Typs gilt, ist durch un‐ sere prädikativen Einteilungen gegeben. Eine Handlung ist nach einem bestimmten Muster, wenn der entsprechende Handlungsprädikator (oder die entsprechende Be‐ schreibung) wahr davon behauptet werden kann. Und umgekehrt darf man anneh‐ men: Erst durch die prädikative Bestimmung wird ein raumzeitliches Tun als Reali‐ sierung eines bestimmten Handlungstyps unterscheidbar. Ein bestimmtes Tun ist seinem Typ nach ein Winken, wenn es die Wahrheitsbedingungen für winken erfüllt. Wie viele Handlungsmuster einem raumzeitlichen Handlungsvorkommnis zugeord‐ net werden, hängt vom Differenzierungsgrad der Beschreibung oder des Verstehens ab. So kann etwa eine Feststellung gleichzeitig eine Warnung und darüber hinaus später vielleicht sogar noch lebensrettend sein. Nicht immer ordnen wir einem raumzeitlichen Tun mehrere Muster zu. Wenn ich sehe bzw. erkenne, dass einer schwimmt, weiß ich in den meisten Fällen genug. In vielen Situationen des Lebens ist es gar nicht nötig, dass ich die einzelnen Teilhand‐ lungen seines Schwimmens erfasse oder einen weitergehenden Zweck seines Schwimmens kenne. Verstehen von Handlungen Manchmal erkennen wir, was jemand macht, aber wir verstehen nicht, wie er es macht oder wozu er es macht. Denkbar ist auch, dass wir überhaupt nicht erkennen, was jemand macht. So lassen sich raumzeitliche Basishandlungen denken, für die wir gar keine oder keine weitere prädikative Typisierung kennen, etwa für zeremonielle Handlungen in fremden Kulturen. Wir können vielleicht bestenfalls irgendwelche Bewegungen eines Schamanen erkennen, nicht aber, was er dadurch macht. In die‐ sem Fall werden wir sagen, dass wir nicht erkennen bzw. verstehen, was da „eigent‐ lich“ gemacht wird. Ein Mindestverständnis einer raumzeitlichen (Basis‐) Handlung hat nur, wer sie als Handlung eines bestimmten Typs oder Musters erfasst, z.B. dass jemand seine Hän‐ de abwechselnd in die Höhe hebt. Dieses Erfassen muss nicht unbedingt sprachlich fundiert sein. Angemessenes Verstehen gelingt aber erst, wenn die physische Hand‐ lung im Zusammenhang mit einem durch sie angestrebten Ziel interpretiert wird.3 Die Spiegelneuronen bei Makaken waren besonders aktiv, wenn die Tiere physische Handlungen beobachteten, die mit Zielen verbunden waren. Wurden dieselben Handlungen ohne solche Absichten lediglich vorgeführt, zeigten sich keine „mitfühlenden“ Reaktionen. Wahrnehmung und intentionale 3 6 Man versteht bestimmte raumzeitliche Handlungen, indem man erkennt, dass je‐ mand, indem er sie macht, beispielsweise tanzt, singt oder strickt. Das genügt meist schon. Wenn wir an die Beschreibungsmöglichkeiten von Handlungen in Wenn‐dann‐ bzw. Indem‐Ketten denken, liegt es nahe, dass das Verstehen von Handlungen tendenziell immer tiefer, weiter oder umfassender sein kann. Einen Hinweis gibt die Unter‐ scheidung verstehen, was jemand macht, wie er es macht, wozu er es macht. Wenn man von irgendeinem Handlungsmuster in einer möglichen Beschreibungskette ausgeht, zielt die Frage wie? auf die Muster links davon, also auf die Mittel, die Frage wozu? auf die Muster rechts davon, also auf die Ziele. Beschreibungen von Handlungen als Ketten von Handlungsmustern sind also Beschreibungen von Mittel‐Zweck‐ Relationen: Die Rakete wird abgefeuert, damit dadurch ein Notruf abgesetzt wird. Diese Handlung wiederum hat den Zweck, Hilfe herbeizurufen usw. Eine Kette von Handlungsbeschreibungen kann theoretisch immer weiter nach links, aber auch nach rechts fortgeführt werden. Man kann wissen wollen: Wie wird die Rakete abgefeu‐ ert? Wie wird der Finger am Abzug gekrümmt? Und man kann auch auf der anderen Seite theoretisch immer weiter fragen: Wozu soll Hilfe geholt werden? Wozu soll Le‐ ben gerettet werden? Aber so wenig man in der Praxis Gebärden und Handbewe‐ gungen ohne Limit immer genauer in ihre Einzelteile zerlegen kann und muss, um die Frage nach dem Wie zu beantworten, so wenig wird man die Frage nach dem Wozu „letztlich“ beantworten können und müssen. Häufig wird man auf abschlie‐ ßende Begründungen folgender Art kommen: Weil ich es will, weil es mich glücklich macht, weil ich ein Mensch bin. Wann hat man nun eine Handlung verstanden? Es kommt auf die jeweilige Interes‐ senlage an. Wahrscheinlich ist es oft unnötig, das genaue Wie zu verstehen. Man ver‐ steht, dass jemand strickt, auch wenn man es selbst nicht kann bzw. das Wie nicht beschreiben kann. Bei Bedarf kann man sich das Wie ja erklären oder ‐ wo Worte nicht reichen ‐ zeigen lassen. Dann versteht man vielleicht, wie Stricken geht. Auch der Geigenvirtuose wird die Technik seines Spiels nicht unbegrenzt immer genauer beschreiben können. Er wird wohl irgendwann mit den Erklärungen aufhören und das Wie allenfalls noch zeigen. Mit der Beschreibung des Wozu verhält es sich ana‐ log. Natürlich weiß der Handelnde oft mehr über seine Ziele als der Betrachter. Aber kennt er wirklich die ganze Kette? Kennt er seine letzten Ziele? Kann man davon ausgehen, dass wir als Handelnde unsere Motive immer selbst ganz überblicken? Gibt es jemand anderen, der das an unserer Stelle könnte? Interpretation von Handlungen sind neuronal offenbar eng miteinander verknüpft. Vgl. Iacoboni 2009, 45; Restak 2006, 57 ff. 7 Das Verstehen von Handlungen bezieht sich also meist nur auf einen Ausschnitt ei‐ ner möglichen Beschreibungskette. In der Praxis sind die Fragen nach den Zielen be‐ grenzt. Man wird nicht ‐ wie Kinder das manchmal tun ‐ immer weiter fragen: Wa‐ rum? Offensichtlich – und das schon aus praktischen Gründen ‐ geht es nicht immer weiter nach rechts in der möglichen Beschreibungskette. Manchmal reicht es, zu ver‐ stehen, dass jemand einen Pullover strickt. Manchmal ist es wichtig, zu wissen, wo‐ für er gestrickt wird. Erklärungen durch Hinweise auf noch grundsätzlichere oder gar letzte Zwecke kann man dagegen im alltäglichen Reden von Menschen über ihr Handeln nicht beobachten. Nur ein realitätsfernes rationalistisches Zerrbild vom Menschen unterstellt eine Letztbegründbarkeit von Handlungszielen. Die macht schon praktische Schwierig‐ keiten, weil es in der Handlungsbeschreibung faktisch nicht immer noch weiter nach rechts gehen kann – gleichsam ohne Ende. Allem Anschein nach gibt es Ziele, die wir einfach akzeptieren bzw. es gibt Handlungen, die wir nicht hinterfragen. Sie sind uns zum Teil wohl biologisch vorgegeben und stehen der bewussten Wahl zuerst einmal nicht völlig offen. Wir können im Restaurant zwar entscheiden, was wir bestellen, nicht aber, was uns schmeckt. Wir haben wahrscheinlich die Wahl der Mittel, aber nicht der letzten Ziele. Wir dürfen von menschlichen Grundbedürfnissen ausgehen, wie zum Beispiel dem nach sozialer Anerkennung und Wertschätzung. So wenig wir das ändern können, so wenig können oder müssen wir das begründen. Die Antwort würde ohnehin nur lauten: „Weil wir Menschen sind.“4 Verstehen einer Handlung – sowohl das des Betrachters als auch das des Handeln‐ den selbst ‐ ist also eher graduell. Es bezieht sich auf relevant erscheinende Aus‐ schnitte einer im Prinzip immer noch genauer differenzierbaren Beschreibungskette. Weder müssen wir immer alle Einzelheiten verstehen, wie etwas gemacht wird, noch müssen wir alle Ziele kennen, die mit einer Handlung verbunden sind. Verstehen dürfte in vielen Fällen wohl darin bestehen, eine Handlung als Handlung eines be‐ stimmten Typs zu erkennen (z.B. als Tanzen). Die damit verbundenen Mittel und weitere Ziele setzen wir als unproblematisch voraus oder erschließen sie. Im Allge‐ meinen ist klar, wozu jemand tanzt, warum er sein Leben retten oder seine Schulden loswerden will. Bei Bedarf lässt sich nachfragen. Aber alle Antworten haben ihre Grenzen. Für das Verstehen sprachlicher Handlungen dürfte das oben Gesagte im Prinzip ebenfalls gelten. Wir müssen nicht verstehen, wie wir mit unserem artikulatorischen Apparat Laute erzeugen. Und genauso müssen wir nicht die letzten kommunikati‐ Vgl. Brooks 2012, 337 ff., 417 ff. Nebenbei stellt sich die Frage, ob „Lebewesen“ ohne Organismus, al‐ so ohne organische Bedürfnisse, überhaupt Handlungszwecke verfolgen könnten. 4 8 ven Absichten durchschauen. Aber es wird sich zeigen, dass wir einen bestimmten Ausschnitt der sprachlichen Handlungsmusterkette verstehen müssen, sonst verste‐ hen wir gar nichts. Arten von Handlungen Bei der Klassifizierung von Handlungen sind verschiedene Bezeichnungen geläufig wie instrumentelles, soziales, sprachliches, strategisches, symbolisches oder kommunikatives Handeln. Oft werden diese Bezeichnungen unterschiedlich verwendet. Wie immer man auch unterscheidet ‐ eine Klassifikation von Handlungen gelingt nur dann widerspruchsfrei, wenn man zwischen konkretem raumzeitlichem Handeln auf der einen und Handlungstyp bzw. Handlungsmuster auf der anderen Seite un‐ terscheidet. Wenn man entscheiden will, von welcher Art ein konkretes Handeln ist, muss man unterscheiden, nach welchen Handlungsmustern dieses Handeln ist. Erst in einem zweiten Schritt kann man feststellen, von welcher Art diese Handlungsmus‐ ter sind, ob sie z.B. instrumentelle oder ein strategische Handlungstypen sind. Aber meist ist die Angelegenheit komplizierter. Wenn auf eine raumzeitliche Hand‐ lung in einer Beschreibungskette mehrere Handlungsmuster zutreffen, können diese verschiedenen Arten von Handlungsmustern angehören. Das heißt: Oft ist ein kon‐ kretes raumzeitliches Handeln im Zusammenhang mit den damit angestrebten Zie‐ len gar nicht als Handlung nur einer einzigen Art zu bestimmen. Nehmen wir das bereits eingeführte Beispiel: Ein Matrose auf einem in Seenot gera‐ tenen Schiff holt Hilfe (e), indem er einen Notruf abgibt (d), indem er eine bestimmte Leuchtrakete abfeuert (c), indem er den Abzug der Pistole betätigt (b), indem er eine bestimmte Fingerbewegung ausführt (a). Von welcher Art sind die Handlung des Matrosen in der Wenn‐dann‐Kette bzw. Indem – Kette a b c d e ? Bei der Beantwortung dieser Frage kommt man sofort in das Dilemma konkurrie‐ render Einordnungen, denn die Handlungsmuster a bis e sind von verschiedener Art: Das Abschießen der Leuchtrakete (c) ist ein instrumenteller Handlungstyp. Dass das Drücken des Pistolenabzugs (b) zum Abschuss der Rakete führt, liegt nämlich an bestimmten Voraussetzungen (z.B. dass die Pistole mit einer bestimmten Munition geladen ist) und an vorhersehbaren mechanischen bzw. physikalischen Gesetzmä‐ ßigkeiten, nach denen die Pistole funktioniert. Instrumentelles Handeln wie das Ab‐ schießen einer Leuchtrakete ergibt sich also als kausale Folge einer anderen Hand‐ lung. 9 Das Abgeben des SOS‐Signals (d) ist dagegen eine symbolische Handlung, denn (d) kommt nur zustande durch Gültigkeit einer Konvention, wonach das Absenden ei‐ nes bestimmten Leuchtsignals (c) als ein Notruf zählt. Eine symbolische Handlung ergibt sich nur für diejenigen, für die auf der Grundlage gemeinsamer Regeln eine bestimmte Aktion als eine bestimmte symbolische Handlung zählt. Der Hund, der das Leuchten am Himmel mit dem Blick verfolgt, gehört wohl nicht dazu. Das Absenden eines Notrufes (d) führt nur unter bestimmten Bedingungen dazu, dass dadurch Hilfe herbeigeholt wird (e). Genau genommen ist (e) eine Beschreibung von zeitversetzten Folgen des Handelns des Matrosen. Vorausgesetzt, das Notsignal wird empfangen und richtig verstanden, dann ist die Beschreibung „holt Hilfe“ erst nach dem anschließenden Handeln der Retter zutreffend. Bei einer solchen Ret‐ tungsaktion handelt es sich natürlich nicht um eine determinierte Konsequenz. Sie tritt nicht determiniert als kausale Folge, sondern durch das absichtsvolle Handeln der Retter ein. Das Absenden des Notrufes geschieht mit der Absicht, dass bestimmte soziale Folgen eintreten. Das Herbeiführen von Folgen lässt sich einem Subjekt als Handlung zuschreiben. Durch das Abgeben des SOS‐Signals (symbolische Hand‐ lung) wird Hilfe herbeigeholt (soziale Folge). Solche Handlungen lassen sich als stra‐ tegische Handlungsweisen bezeichnen. Im Unterschied zu instrumentellen kommen sie nicht als kausale, sondern als soziale Folgen zustande. Das Beispiel zeigt: Auf ein und dieselbe raumzeitliche Basishandlung können unter‐ schiedliche typisierende Beschreibungen zutreffen, je nachdem, ob die Bedingungen dafür erfüllt sind. Und diese Bedingungen können naturgesetzlicher (bei instrumen‐ tellen Handlungsmustern), sozialer (bei strategischen Handlungen) oder konventio‐ neller Art sein (bei symbolischen Handlungen). Dabei ist es nicht einmal so, dass ein bestimmtes Handlungsmuster immer von einer bestimmten Art sein muss, etwa immer instrumentell oder immer strategisch. Es kommt auf den konkreten Einzelfall an. Leben zu retten kann zum einen eine strate‐ gische Handlung sein, wenn etwa, wie in unserem Beispiel, durch einen Notruf Hel‐ fer zum lebensrettenden Eingreifen bewegt werden. Wenn dagegen ein Arzt durch das Setzen einer Spritze das Leben eines Erkrankten rettet, dann ist die Handlung des Lebensrettens normalerweise eine instrumentelle Handlung, deren Zustande‐ kommen auf der kausalen Wirkungsweise des verabreichten Medikaments beruht. Fürs Erste können wir ‐ jeweils nach den Bedingungen für ihr Zustandekommen ‐ folgende Arten von Handlungsmustern oder Handlungstypen unterscheiden: 10 Handlungsmuster instrumentelle soziale strategische symbolische Instrumentelles Handeln folgt empirischem Wissen über naturgesetzliche Ursache‐ Wirkungs‐Zusammenhänge. Es besteht darin, durch bestimmte Handlungen be‐ stimmte vorhersehbare Folgen zu verursachen. Dass ich mit bestimmten Handha‐ bungen einer Axt Holz spalten oder durch das Drehen eines Zündschlüssels den Mo‐ tor starten kann, ist durch physikalische Regelmäßigkeiten bedingt.5 Genau genom‐ men startet jemand gar nicht den Motor, sondern er verursacht durch sein Handeln, dass der Motor startet. Instrumentelle Handlungen werden also durch andere Hand‐ lungen als deren kausale Folgen herbeigeführt. Das Motoranlassen ist eine instru‐ mentelle Handlung, weil es durch physikalische Regelmäßigkeiten herbeigeführt werden kann. Soziale Handlungen dagegen beruhen nicht auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten. Strategische Handlungen kommen zustande, wenn bestimmte Konsequenzen im Handeln anderer Menschen erreicht werden. Wer am Strand absichtlich so lärmt, dass der Nachbar weggeht, hat den Nachbarn vertrieben, indem er Lärm machte. Das Vertreiben des Nachbarn ist also ein strategisches Handlungsmuster, weil es als beabsichtigte soziale Folge einer vorausgehenden Handlung zustande kommt. Typisch ist strategisches Handeln z.B. im Wirtschaftsleben. Wenn ein Unternehmen einen Marktkonkurrenten dazu bringt, sein Geschäft aufzugeben, indem er dieselben Waren dauerhaft billiger verkauft, so sind die Bedingungen für den Zusammenhang der Realisierung beider Muster weder naturgesetzlicher noch konventioneller Art. Solch strategisches Handeln beruht auf der Annahme, dass andere in ihrem eigenen Interesse rational und somit einigermaßen berechenbar handeln, z.B. dass sie finan‐ zielle Verluste vermeiden, Lärm aus dem Weg gehen oder einfach Gutes tun wollen. Die angestrebten Folgen sind also nicht kausal determiniert, sondern treten durch das erwartete oder erhoffte Handeln anderer ein, und das erst mit zeitlicher Verzöge‐ rung. Gerade bei instrumentellen Handlungen, etwa um eine bestimmte chemische Reaktion zu erzeugen, müssen manchmal mehrere Handlungen gemacht werden: Eine bestimmte Substanz muss mit einer anderen auf bestimmte Weise kombiniert werden, die Verbindung ist danach zu erhitzen usw. und erst dadurch wird der erwünschte Effekt erreicht. Genauso kann es sein, dass bestimmte Handlungen gleichzeitig gemacht werden müssen, um die gewünschte physikalische Folge zu erreichen. Hier müssten also die formalen Darstellungen entsprechend angepasst werden. 5 11 Kausale und nichtkausale Folgen können natürlich auch unbeabsichtigt ausgelöst werden. Man hat dann etwas getan, was man gar nicht beabsichtigte, z.B. das Haus in Brand gesetzt oder den Freund durch einen schlechten Rat ins Unglück gestürzt. Beides muss man sich als Handlung zuschreiben lassen, man kann es nicht einfach leugnen. Aber man hat diese Handlung nicht absichtsvoll gemacht, man verfolgte damit eine andere Absicht. Symbolische Handlungen finden wir im Alltag oft als kommunikative Handlungen mimischer oder gestischer Art. Das Augenzwinkern, das Grüßen durch Heben der Hand, das Herbeiwinken oder das Vogelzeigen sind Prototypen symbolischer Hand‐ lungen mit kommunikativer Funktion. Regeln sind hier konstitutive Regeln. Eine be‐ stimmte raumzeitliche Handlung zählt per Konvention als eine bestimmte symboli‐ sche Handlung. Händeklatschen gilt als Applaudieren, nicht dagegen Pfeifen oder Kopfschütteln. Deshalb gelingen solche symbolischen Handlungen nur, wenn sie auch entsprechend diesen Regeln verstanden werden. Wenn ich gegenüber meiner Katze auf den Mond zeige, blickt sie nur auf meinen Finger. Symbolische Handlungen ohne kommunikative Absichten finden wir auch in institu‐ tionellen Zeremonien. Sakrale Handlungen wie Taufen oder Segenspenden gleichen hierin Spielhandlungen. Auch dort konstituieren Regeln die in einem Spiel mögli‐ chen bzw. gültigen Handlungen. Eine bestimmte raumzeitliche Handlung zählt im Spiel als eine bestimmte symbolische Handlung wie etwa Spielhandlungen des Typs „ein Tor schießen“ oder des Musters „einen Feldverweis aussprechen“ oder eines be‐ stimmten Zuges im vielzitierten Schachspiel. Damit die Handlung gelingt, muss die Regel, nach der sie als solche gilt, von den Partnern geteilt werden. Entsprechend gilt bei solchen zeremoniellen oder institutionellen „Spielen“ ein bestimmtes Tun oder eine bestimmte Äußerung per Konvention gleichzeitig als Vollzug einer bestimmten (symbolischen) Handlung. Die symbolische Handlung wird immer gleichzeitig mit der entsprechenden Basishandlung gemacht. Die Verwarnung eines Fußballspielers durch den Schiedsrichter ist keine zeitverzögerte Folge des Zeigens der gelben Karte. Das unterscheidet symbolische Handlungen von strategischen und auch von instru‐ mentellen, wo immer ein Zeitversatz existiert, und sei er auch – wie bei manchen in‐ strumentellen ‐ im Millisekundenbereich. Zu den Regeln bei vielen symbolischen Handlungen gehört auch, dass solche Handlungen nur in bestimmten Situationen (eben „im Spiel“) möglich sind und dass sie meist nur durch bestimmte „spielberech‐ tigte“ Personen ausgeführt werden können. Wenn ein Schiedsrichter einem Fußgän‐ ger auf der Straße die rote Karte zeigt, zählt das nicht als Platzverweis. Der mit Rot bedachte Passant wird vielleicht mit der symbolischen Handlung des Vogelzeigens reagieren, die auch außerhalb des Spielfelds Gültigkeit hat. 12 Symbolische Handlungen können auch auf der Grundlage von Ad‐hoc‐Vereinba‐ rungen gemacht werden. Die Wirksamkeit solcher symbolischer Handlungen beruht meist auf einer Vereinbarung, dass sie eine bestimmte explizite sprachliche Aussage oder Ansage ersetzen soll, etwa: Wenn ich dich anrufe und das Telefon dreimal klin‐ geln lasse, heißt das: Ich bin nach der Autofahrt wohlbehalten am Ziel angekommen. Insofern sind solche symbolischen Handlungen kommunikative Handlungen, mit denen etwas zu verstehen gegeben werden soll. Sie gehören zum kommunikativen Alltag und lassen sich überall, wo sie nützlich erscheinen, generieren und nutzen. Symbolische Handlungen finden wir somit in mindestens drei verschiedenen Le‐ bensbereichen. Zum einen als Spielhandlungen (ein Tor schießen) oder als instituti‐ onelle bzw. zeremonielle Handlungen (die Absolution erteilen), zum anderen als kommunikative Handlungen (Grüßen durch Handheben, Warnen durch Pfeifen). In allen Fällen sind symbolische Handlungen darauf angelegt, verstanden zu werden. Sie gelingen nur, wenn die Regeln, auf denen sie beruhen, von allen Beteiligten aner‐ kannt und deshalb entsprechend verstanden werden. Symbolische Handlungen kommen gleichzeitig mit dem Verstehen der Beteiligten zustande. Die kommunika‐ tiven Varianten symbolischer Handlungen sind außerdem darauf angelegt, durch das Verstandenwerden beim Kommunikationspartner Wirkungen zu erreichen. Der Pfiff des Schmierestehers soll die Einbrecher nicht nur warnen, sondern ihr Verhalten beeinflussen: Sie sollen abhauen. Ohne dieses bei allen kommunikativen Handlun‐ gen wesentliche Bewirkungsziel wäre der Pfiff nicht relevant. Weil hier wie allgemein beim symbolischen Handeln durch gemeinsame Regeln ge‐ sichert ist, dass eine bestimmte Handlung als eine andere zählt, werden die Hand‐ lungsmuster notwendigerweise gleichzeitig realisiert. Es besteht kein zeitlicher Ver‐ satz zwischen der Realisierung der Handlungsmuster des Handhebens und des da‐ mit vollzogenen Grüßens. Darin besteht die Ausnahmestellung symbolischer Hand‐ lungsmuster. Im Unterschied dazu werden, wie gesagt, instrumentelle und strategi‐ sche Handlungen zeitlich immer nach den sie „erzeugenden“ Handlungen realisiert. Der Motor springt erst nach dem Drehen des Zündschlüssels an, und der Strandbe‐ sucher ist erst vertrieben, nachdem er sich außer Reichweite des nicht mehr tolerier‐ baren Lärms begeben hat. 13 Von welcher Art sind sprachliche Handlungen? Von welcher Art sind nun aber sprachliche Handlungen? Zuerst einmal gehören sie zweifellos zu den kommunikativen Handlungen, deren Kennzeichen es ist, dass mit ihnen etwas zu verstehen gegeben werden soll, um Wirkungen zu erreichen. Nicht alle kommunikativen Handlungen sind sprachliche Handlungen. Symbolische Handlungen gestischer oder mimischer Art dienen zwar ebenfalls dazu, etwas zu verstehen zu geben. Sie sind aber eben keine sprachlichen Handlungen. Diese sind dadurch gekennzeichnet, dass sie mit lautsprachlichen (oder schriftsprachlichen) Äußerungen gemacht werden. Sprachliche Handlungen sind also eine Teilmenge der kommunikativen Handlungen. Sind nun sprachliche Handlungen – alle oder bestimmte Arten von ihnen – von der Art der symbolischen Handlungen, die aufgrund von Regeln verstanden werden und erst dadurch Wirkungen erreichen können? Für diese Auffassung scheint die of‐ fensichtliche Vielzahl sprachlicher Regeln zu sprechen. Oder können sprachliche Handlungen oder bestimmte davon auch ohne Regeln verstanden werden und ihre angestrebten sozialen Wirkungen erreichen? Sprachphilosophen werden zuweilen, je nachdem, welcher Partei sie zuneigen, als Regelianer oder Intentionalisten bezeich‐ net. Da sprachliches Handeln wie kommunikatives Handeln allgemein, wenn es sei‐ ne Zwecke erreichen soll, immer darauf aus sein muss, verstanden zu werden, liegt eine Kombination beider Sichtweisen nahe. Denn es bringt erhebliche Vorteile, zur Verdeutlichung von Absichten wenigstens auf Verstehensvereinbarungen, also Re‐ geln, zurückgreifen zu können. Die Frage, von welcher Art die verschiedenen sprachlichen Handlungen sind, lässt sich nach den obigen handlungstheoretischen Überlegungen sicherlich nicht pau‐ schal beantworten, sondern nur in Bezug auf das Zustandekommen einzelner sprachlicher Handlungsmuster in Wenn – dann ‐ Ketten. Nur dann kann geklärt werden, von welcher Art welche sprachlichen Handlungsmuster sind. Eine für unsere Fragestellung hilfreiche Beschreibung sprachlichen Handelns bietet J. L. Austin in der 8. bis 10. Vorlesung seiner William James Lectures von 1955.6 Dort beschreibt er sprachliche Handlungen handlungstheoretisch konsequent durch rela‐ tiv komplexe Wenn – dann – Ketten. Nach Austin wird ein Sprechakt durch den Vollzug eines lokutionären Aktes ausgeführt; dieser besteht aus einem rhetischen Akt, welcher sich aus den beiden Teilakten der Bezugnahme und der Prädikation zu‐ sammensetzt. Beide wiederum werden durch Äußerung von Worten bzw. Sätzen, dem phatischen Akt, ausgeführt. Letzterer schließlich wird durch Äußern von Lau‐ ten, dem phonetischen Akt, vollzogen. Mit den auf diese Weise gemachten illokutio‐ 6 Austin 1972, S. 110 ff. 14 nären Akten können zusätzliche Wirkungen hervorgerufen werden. Die illokutionä‐ ren Akte sind dagegen selbst keine Folgen oder Konsequenzen der lokutionären Ak‐ te. Handlungen, die als Wirkungen von illokutionären Akten zustande kommen, nennt Austin „perlokutionäre Akte“. So ergibt sich nach Austin eine mehrfache indem‐Verbindung von Handlungsmus‐ tern: Man vollzieht einen perlokutionären Akt (PA) , indem man einen illokutionären Akt (IA) vollzieht, indem man einen lokutionären Akt (LA) vollzieht, indem man ei‐ nen rhetischen Akt (RA) vollzieht, indem man referiert und prädiziert (RPA), indem man einen phatischen Akt ausführt, indem man einen phonetischen Akt vollzieht. Diese Kette kann Austin zufolge nach der Seite der perlokutionären Akte noch erwei‐ tert werden. Somit ergibt sich folgende Wenn‐dann‐Relation: PhonA PhA RPA (RhA) LA IA PA. Das könnte man sich in der Terminologie Austins konkret ungefähr so vorstellen: Ich äußere die phonetische Lautfolge „derkursdertelekomaktieiststarkgestiegen“, somit formuliere ich die Wörter und deren grammatisch korrekte Kombination „Der Kurs der Telekom‐Aktie ist stark gestiegen“ (phatischer Akt), nehme dadurch auf den Kurs der Telekom ‐ Aktie Bezug und sage darüber etwas aus (Referenz und Prädika‐ tion), vollziehe also einen rhetischen (oder propositionalen) Akt, vollziehe damit un‐ vermeidlich einen illokutiven Akt (Behaupten, Empfehlen, Warnen usw.), bringe damit den Partner dazu, die Aktie zu verkaufen oder zu kaufen usw. (perlokutionä‐ rer Akt). Man muss die Kette der verschiedenen Handlungsmuster nicht genau so sehen wie Austin, aber eine derartige Aufschlüsselung des sprachlichen Handelns bietet die Möglichkeit für eine ausreichend differenzierte Analyse. Denn auf der Grundlage solcher Wenn‐dann‐Ketten kann geklärt werden, ob der Zusammenhang zwischen einzelnen Mustern durch Regeln oder durch anderes, wie etwa Annahmen oder Ab‐ sichten, zustande kommt. Somit kann für jedes Muster in der Kette geklärt werden, was die Bedingungen für seine Realisierung sind und von welcher Art es ist. Man kann die Menge aller sprachlichen Handlungen vorläufig bestimmen als Ge‐ samtheit aller Handlungen, die mittels lautlicher oder schriftsprachlicher Äußerun‐ gen gemacht werden. In den nachfolgenden Untersuchungen möchte ich die Wenn‐ dann‐Kette auf die durch Äußerungen gemachten Handlungen der Bezugnahme und Prädikation sowie die illokutiven und die perlokutiven Akte beschränken und die Bedingungen für deren Zustandekommen beschreiben. Dabei wird sich zeigen, ob und inwieweit Regeln verschiedener Arten für die einzelnen Glieder der Kette be‐ deutsam sind und inwieweit andere Faktoren eine Rolle spielen. 15 Wenn man sprachliche Handlungen als Ketten von Handlungsmustern beschreibt, können also für die einzelnen Muster einer Wenn‐dann‐Kette Bedingungen für ihr Zustandekommen geklärt werden, z.B. dafür, wodurch ein sog. propositionaler Akt auch eine Frage ist. Wenn beschrieben wird, dass eine Äußerung eine Frage ist, heißt das, dass die Bedingungen für das Zusprechen des Prädikators fragen oder Frage er‐ füllt sind. Dazu gehört u.a., dass der Sprechende etwas nicht weiß, aber will, dass der Partner ihm das sagt. Allerdings ist eine solche Betrachtungsweise monologisch und reicht für die Erklä‐ rung sprachlichen Handelns nicht aus. Sprachliche Handlungen wie Fragen, Ver‐ sprechen oder Feststellungen kann man offensichtlich nicht erfolgreich machen, ohne dass sie verstanden werden. Man sagt zwar manchmal: Ich habe ihn darum gebeten, aber er hat nicht zugehört oder Ich habe das gefragt, aber der thailändische Händler hat mich nicht verstanden. Damit sagt man, dass man „für sich selbst“ die Handlung zwar ge‐ macht habe, räumt aber ein, dass sie kommunikativ nicht gelungen ist. Da im obigen Beispiel der für eine gelingende Kommunikation nötige verstehende Gesprächs‐ partner nicht vorhanden ist, ist es angemessener zu sagen: Ich wollte etwas fragen bzw. ich wollte das berichten, bin aber nicht verstanden worden. Sprachliche Handlungen sind also der Intention nach immer kommunikative Hand‐ lungen. Wer kommuniziert, will verstanden werden, denn nur durch das hörerseiti‐ ge Verstehen können sie gelingen, wodurch weitergehende Zwecke erreichbar wer‐ den. Damit sprachliche Handlungen verstanden werden können, geht es bei ihnen nicht nur darum, sie lediglich für sich zu machen, sondern darum, zu verstehen zu geben, dass man sie macht bzw. dass man die für sie kennzeichnenden Absichten hat. Nur wenn H erkennt, dass S etwas wissen will, dass er also will, dass H ihm et‐ was mitteilt, wird H dies auch möglicherweise tun. Das Gelingen und der weiterge‐ hende Erfolg sprachlicher Handlungen hängen vom Verstandenwerden ab. Ein Sprechakt, der gemacht wird ohne Absicht, verstanden zu werden, ist von vorneher‐ ein keiner. Wie könnte man etwa einen Rat geben, wenn man nicht wollte, dass er verstanden wird. Dass ein Sprecher verstanden werden will, ist also für seinen Sprechakt konstitutiv. Und dass er tatsächlich verstanden wird, ist für dessen kom‐ munikatives Gelingen unabdingbar. Weil das Verstandenwerden für das Gelingen und den Erfolg sprachlicher Handlun‐ gen so wichtig ist, heißt das: S will nicht nur Bezug nehmen und prädizieren und dadurch einen Sprechakt machen, sondern er will gleichzeitig auch zu verstehen ge‐ ben, worauf er Bezug nimmt und was er darüber sagt und ganz besonders, mit wel‐ cher Absicht er das tut bzw. welchen Sprechakt er damit macht. Und nur dadurch, dass H diese Handlungen und Absichten erkennt, kann das kommunikative Unter‐ nehmen gelingen. Verstehen bzw. Verstandenwerden ist eine notwendige Voraus‐ 16 setzung erfolgreichen Kommunizierens. Erfolgreiches Kommunizieren heißt, durch das Verstandenwerden die Voraussetzungen zu schaffen, dass die angestrebten Fol‐ gewirkungen erreicht werden können. Wenn also im Folgenden die Leitfrage verfolgt wird, was sprachliches Handeln ist und wie wir es machen, geht es um Fragen wie diese: 1. Welche sprachlichen Handlungen lassen sich (in Wenn‐dann‐Ketten) unter‐ scheiden? 2. Welche davon sind symbolische, beruhen also auf Regeln? Welche sind strate‐ gische, kommen also durch nicht‐kausale Folgen zustande? Gibt es auch in‐ strumentelle sprachliche Handlungen? 3. Wie machen wir die symbolischen sprachlichen Handlungen, so dass sie als solche verstanden werden? 4. Ist sprachliches Handeln und dessen Verstehen auch möglich, wenn Regeln nicht oder nicht ausreichend vorhanden sind? Und wenn ja: wie? An solchen Fragestellungen wird bereits deutlich, wie weit eine solche Theorie des sprachlichen Handelns sich von den Annahmen mentalistischer Bedeutungstheorien entfernt hat. Etwas zu verstehen zu geben kann ja nicht heißen, etwas „im Kopf“ Be‐ findliches zu übermitteln. Es heißt vielmehr, sprachliche Handlungen zu machen und diese so zu machen, dass sie als solche verstanden werden können, sodass Wir‐ kungen erreicht werden können. Man kann auch sagen: Mit sprachlichen Handlun‐ gen bedeuten wir unseren Partnern etwas, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Frage ist nur, was wir da genau bedeuten und wie wir das machen. Um die Antwort geht es in den folgenden Kapiteln. 17 2. Regeln und Wahrheit: Prädikatoren und Satzwörter Für die Entwicklung einer Gebrauchstheorie hat Wittgenstein mehrere programmati‐ sche Vorschläge gemacht. Statt nach Bedeutungen zu suchen, solle man darauf ach‐ ten, wozu sprachliche Äußerungen instrumentell verwendet werden. Auch solle man die regelgeleiteten Spiele betrachten, die wir mit Sprache machen. Und wir sollten darauf achten, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn wir Ausdrücke mit Wahrheitsanspruch verwenden. Zwar blieb bei diesen Vorschlägen noch offen, wie sie miteinander zusammenhän‐ gen, aber naheliegend ist: Wir wollen mit sprachlichen Äußerungen Wirkungen er‐ reichen. Und zur Erreichung dieser Wirkungen machen wir ‐ wahrscheinlich symbo‐ lische – sprachliche Handlungen. Dabei verwenden wir wahrheitsfunktionale Aus‐ drücke. Betrachten wir also zuerst die verschiedenen Arten von Wörtern, die uns im Deut‐ schen für sprachliche Handlungen zur Verfügung stehen. Welche Ausdrücke aus dem Inventar unserer Wortarten verwenden wir nach Wahrheitsbedingungen? Und wie verwenden wir den Rest? Wortarten Stellen wir uns einen systematisch geordneten und sorgfältig eingeräumten Werk‐ zeugkasten vor, aus dem wir uns beim sprachlichen Handeln bedienen. Als die kleinsten sprachlichen Einheiten mit kommunikativer Funktion werden die Mor‐ pheme angesehen. Unterschieden werden hier Lexeme (also die Stämme der Wörter) und grammatische Morpheme. Diese sind entweder Endungsmorpheme (Flexive) oder Wortbildungsmorpheme, auch Affixe genannt. Solche Wortbildungsmorpheme sind die Präfixe vor dem Stamm (ent‐gehen), Suffixe (end‐lich) und Zirkumfixe vor und nach dem Stamm (ge‐komm‐en). Die Morphologie verschiedener Sprachen ist un‐ terschiedlich. Das Chinesische kennt z.B. keine Wortbildungsmorpheme. Gewöhnlich werden die Lexemarten in die zwei großen Klassen der Flektierbaren und der Unflektierbaren eingeteilt.7 Nach der traditionellen Wortartenlehre sind im Deutschen fünf Wortarten flektierbar: Substantive, Verben, Adjektive, Artikel und Pronomen. Nicht flektierbar sind die fünf weiteren Wortarten: Adverbien, Konjunk‐ tionen, Präpositionen, Numerale und Interjektionen. An dieser Einteilung wird aller‐ Diese Zweiteilung findet sich in den meisten Klassifikationen (vgl. z.B. Wahrig 1973 oder Flämig 1977). 7 18 dings manchmal die Vermischung semantischer, morphologischer und syntaktischer Kriterien kritisiert. Ermittelt man die Wortarten im Hinblick auf ihre syntaktische Distribution, ergeben sich leicht veränderte Einteilungen:8 Zum Bereich der flektierbaren Lexemarten gehören: 1. Verben, 2. Adjektive, 3. Nomen, 4. Pronomen: Personalpronomen: ich, du, sie … Reflexivpronomen: sich Interrogativpronomen: wer?, wo?, wie? … Indefinitpronomen: jemand, man, niemand … Relativpronomen: der, den, welchen … 4. Determinierer /Artikel: definite: der, die, das … indefinite: ein, eine, irgendein … demonstrative: dieser, jener … quantifizierende: alle, jeder, mancher … negierende: kein, keine … possessive: mein, dein, ihr … interrogative: welcher … Zum Bereich der unflektierbaren Lexeme gehören9: 5. Präpositionen: wegen, in, auf, unter, nach… 6. Adverbien: Satzadverbien: vielleicht, immerhin, wahrscheinlich, angeblich, bekanntlich, gewiss, zwei‐ fellos, sicherlich, hoffentlich, erstaunlicherweise, nicht, natürlich … Gradadverbien: kaum, ein bisschen, sehr, etwas, allzu, äußerst, weniger, viel, überaus … Prädikatsbezogene Adverbien: rückwärts, abseits, hin, her, immer, schon, noch, wieder, dreimal, eilends, umsonst… Bindeadverbien: nämlich, mithin, immerhin, dennoch, allerdings, freilich, hingegen … 7. Konjunktionen: aber, denn, doch, deshalb, und … 8. Subjunktionen: dass, ob, seit, als, während, nachdem, bevor, ehe, weil, da, obwohl, ob‐ gleich, wenngleich, falls, wenn, insofern, so dass, dass, damit …. vgl. Heringer 2009, 65 ff., ders. 2001, 181 ff. und 1989, 138 ff. Die Unflektierbaren werden häufig als Partikeln zusammengefasst. Dann werden auch Konjunktio‐ nen und Präpositionen als Partikeln gezählt. Ich werde hier aber dem engeren Partikelbegriff folgen. 8 9 19 9. Partikeln: Gliederungspartikeln: nämlich, also, aber, doch, auch … Gradpartikeln: ungemein, ausgesprochen, ziemlich, zutiefst, höchst, etwas … Fokuspartikeln: nur, bloß, allein, lediglich, einzig, auch, ebenfalls, ebenso, sogar, selbst, nicht einmal, wenigstens, besonders… Modalpartikeln (Abtönungspartikeln): aber, ja, auch, doch, wohl, eben, halt, ja, bloß, nur, etwa, denn, eigentlich, wohl, … Mit dieser Klassifikation haben wir den lexematischen Teil unserer sprachlichen In‐ strumente übersichtlich sortiert vor uns. Für eine Theorie des sprachlichen Handelns ist es natürlich von entscheidendem Interesse, für welche Handlungen und nach welchen Regeln diese Lexeme verwendet werden. Was also machen wir mit diesen Lexemen? Lassen sich, ausgehend von der obigen offenen Liste, grundsätzliche Verwendungsweisen im sprachlichen Handeln unter‐ scheiden? Die Zweiteilung der Lexeme in flektierbare und unflektierbare bietet dafür vielleicht einen groben Anhaltspunkt. Es ist aber nicht zu erwarten, dass die Unter‐ schiede der Verwendungen genau durch diese morphologische Grenze zu bestim‐ men sind. 20 Prädikatoren Niemand würde auf die Idee kommen, bei den Lauten einer Sprache nach sprachli‐ chen Handlungen zu fragen, die mit ihnen gemacht werden können. Die Antwort wäre schlicht: Die Verwendungen sind unspezifisch, wir verwenden diese Laute bei allen sprachlichen Handlungen. Spezifische Korrelationen zwischen der Verwen‐ dung einzelner Laute und Sprechakten lassen sich nicht feststellen. Auch der Groß‐ teil von Lexemen wird in Sprechakten aller Art verwendet. Die Verwendung von Wörtern wie Buch, rot oder lesen ist nicht an bestimmte Sprechakte gebunden. Be‐ trachtet man aber die Handlungen, die wir machen, wenn wir Sprechakte machen, drängt sich bei einigen Lexemklassen eine bestimmte instrumentelle Deutung nahe‐ zu auf. Wörter dieser Lexemarten verwenden wir zum Prädizieren. Man kann sie deshalb wortartenübergreifend als Prädikatoren bezeichnen. Solche Prädikatoren sind Ausdrücke, die mit Wahrheitsanspruch über Gegenstände der Bezugnahme ausgesagt werden können.10 Sie können auch zur kennzeichnenden Bezugnahme selbst verwendet werden. Prototypisch für Prädikatoren sind Nomen, Adjektive und Verben. In der traditionellen Semantik werden sie oft als Inhaltswörter bezeichnet – im Gegensatz zu sogenannten Funktionswörtern wie Konjunktionen, Partikeln usw. Prädikationsregeln Für Prädikatoren hat schon Wittgenstein im Tractatus Regeln ihres Gebrauchs in Be‐ zug auf die Bedingungen charakterisiert, unter denen sie mit Wahrheit zugesprochen werden: „Um aber sagen zu können, ein Punkt sei schwarz oder weiß, muss ich vor‐ erst wissen, wann man einen Punkt schwarz und wann man ihn weiß nennt.“11 Da‐ mit werden Gebrauchsregeln für prädizierbare Ausdrücke durch Angabe ihrer kon‐ ventionellen Wahrheitsbedingungen bestimmt. Diese Sicht wird auch in den späte‐ ren Untersuchungen beibehalten und an Beispielen paradigmatischen Lernens, bei‐ spielsweise von Farbadjektiven, illustriert. In diesem Zusammenhang wurden von Wittgenstein die grundsätzlichen Arten des Lernens von Prädikationsregeln ausführ‐ lich beschrieben: a) die paradigmatische Einführung, b) die hinweisende Definition und c) die Regelbeschreibung. 10 Mit Gegenstand sind nicht nur feste Körper gemeint, sondern z.B. auch Handlungen, Personen, Aus‐ drücke – kurz alles, worüber sich etwas prädizieren lässt. 11 Wittgenstein 1922, 4.063 21 a) Beim primären Spracherwerb ist paradigmatisches Lehren und Lernen typisch: Das paradigmatische Lernen setzt die Fähigkeit zur Erkennung von Analogien vo‐ raus. Die Prädikationsregel wird durch induktive Verallgemeinerung des allen Bei‐ spielen Gemeinsamen erlernt: „Das Gemeinsame sehen. Nimm an, ich zeige jemand verschiedene bunte Bilder, und sage: „Die Farbe, die du in allen siehst, heißt ʹOckerʹ.“ ‐Das ist eine Erklärung, die verstanden wird, indem der Andere aufsucht und sieht, was jenen Bildern gemeinsam ist. Er kann dann auf das Gemeinsame blicken, darauf zeigen. Vergleiche damit: Ich zeige ihm Figuren verschiedener Form, alle in der glei‐ chen Farbe gemalt und sage: „Was diese miteinander gemein haben, heißt ʹOckerʹ“. Und vergleiche damit: Ich zeige ihm Muster verschiedener Schattierungen von Blau und sage: „Die Farbe, die allen gemeinsam ist, nenne ich ʹBlauʹ.“12 Im Unterschied zu den meisten Adjektiven und Substantiven sind Verben überwie‐ gend mehrstellige Prädikatoren. Die Prädikationsregel einer bestimmten Verwen‐ dungsweise des Verbs schenken wird gelernt an Beispielen dreistelligen Zusprechens. Das Gemeinsame erkennen heißt hier, die Wahrheitsbedingungen zu lernen an Bei‐ spielen mit wechselnden Füllungen in den Ergänzungspositionen, wie in Ich schenke dir das Bild. Karl schenkt dir fünf Euro. Meiner Lehrerin schenkten wir einen Blumenstrauß. Aus wahren Beispielen des Zusprechens kann einerseits eine Regelhypothese für schenken gebildet, andererseits auch ein hypothetisches Wissen darüber erworben werden, was den Gegenständen in den verschiedenen Ergänzungsstellen jeweils ge‐ meinsam ist. In zwei von den drei Ergänzungspositionen kommen Bezeichnungen für Menschen vor, in der dritten meist Bezeichnungen für Dinge. b) Das Lehren und Lernen geschieht auch mit hinweisenden Definitionen. Das Leh‐ ren mittels hinweisender Definition besteht in einer Äußerung, die mit einer Hin‐ weisgeste verbunden ist, etwa in der Äußerung von Das ist ein Gallapfel. Hinweisende Definitionen liegen nahe, wenn jemand bereits eine Sprache spricht und nur noch erfahren soll, wie ein bestimmter „Gegenstand“ bezeichnet wird. Sie funktionieren aber nur, wenn der Lernende bereits weiß, welchem Weltausschnitt der Prädikator zugesprochen wird. Dann reicht eine einmalige hinweisende Definiti‐ on aus. Das heißt, es muss vom Lernenden nicht nur die Intention des Benennens verstanden, sondern auch bereits die Einteilung vorausgesetzt werden, in welcher das zu Benennende schon unterschieden ist. Dasselbe ist Voraussetzung beim Fragen 12 Wittgenstein 1953, 72 . 22 nach einer Benennung: „Man muss schon etwas wissen, um nach einer Benennung fragen zu können.“13 Ist dies nicht der Fall, ist also der zu benennende Gegenstand noch nicht als solcher unterschieden, ist es beim Lehren mit einer einmaligen Benen‐ nung noch nicht getan. Dann wird die paradigmatische Einführung benötigt, bei der anhand von Beispielen nicht nur die Prädikationsregel vermittelt, sondern auch der entsprechende Weltausschnitt bestimmt wird. c) Die dritte Variante des Lehrens ist die Regelbeschreibung. Sie besteht z.B. in der Angabe von Bedingungen, unter denen wir den Ausdruck zusprechen, oder in der Bereitstellung von Ausdrücken oder Umschreibungen, die für annähernd synonym oder äquivalent gehalten werden, so etwa in fremdsprachlichen Wörterbüchern. Für den frühkindlichen Spracherwerb ist ein solches Lehren oft ungeeignet, weil das Kind dazu schon die Erklärungen verstehen müsste. Zudem ist beim Lehrenden selbst eine explizite Regelkenntnis Voraussetzung, die normalerweise nicht ange‐ nommen werden kann. Wer kann schon aus dem Stand beschreiben, wann eine Handlung als Empfehlen bezeichnet werden kann, etwa im Unterschied zu einem Ratschlag. Den Gebrauch von Basisprädikaten wie etwa Farbadjektiven können wir überhaupt nicht durch Regelbeschreibung (auch nicht durch Angabe von Wellenlän‐ gen) erklären. Für die regelhafte Verwendung des Prädikators Buch lernen wir, wann etwas Buch genannt wird, also die Bedingungen, unter denen in unserer Sprachgemeinschaft Gegenständen der Ausdruck Buch zugesprochen werden kann. Wir lernen dabei gleichzeitig, was als Buch zählt. Erst auf der Grundlage solche gemeinsamer Prädika‐ tionsregeln können wir Aussagen mit Wahrheitsanspruch formulieren und überprü‐ fen. Wahrheit ist an Regeln gebunden, und umgekehrt werden Regeln über wahre Beispiele gelernt. Die Prädikationsregeln für Wörter wie rot, Wasser, lieben oder geben sind in allen Sprechakten konstant. Es ist egal, ob sie im Zusammenhang mit Bitten, Fragen, War‐ nen oder anderen Sprechakten verwendet werden. Die Prädikationsbedingungen 13 Wittgenstein 1953, 30. Vgl. auch Wittgensteins Kritik an der Auffassung von Augustinus, der pri‐ märe Spracherwerb gelinge ausschließlich über hinweisende Definitionen: „Und nun können wir, glaube ich, sagen: Augustinus beschreibe das Lernen der menschlichen Sprache so, als käme das Kind in ein fremdes Land und verstehe die Sprache des Landes nicht; das heißt: so als habe es bereits eine Sprache, nur nicht diese.ʺ (Wittgenstein 1953, 32) – Dem ist entgegenzuhalten, dass das Kind zwar noch keine Sprache hat, wohl aber biologisch begründete Unterscheidungen, so dass ein Teil der Aus‐ drücke für materielle Gegenstände relativ unproblematisch mit hinweisenden Definitionen gelehrt werden kann. Die sprachlichen Unterscheidungen folgen in solchen Bereichen den biologischen. 23 von rot oder Buch bleiben gleich, egal, ob ich feststelle Ich habe mein rotes Buch verloren oder frage Ist das Buch, dass du gefunden hast, rot?14 Auch wenn Nomen, Adjektive und Verben die „klassischen“ Prädikatoren sind, so werden doch auch andere Lexemarten prädikativ verwendet. Zwar kann man sie nicht wie jene klassifikatorisch zusprechen nach der Art: Das ist ein Buch, das ist rot, das blüht (das zählt als Blühen). Dennoch entscheiden auch Wörter wie nie oder immer ganz offensichtlich über die Wahrheit von Sätzen: Der Verein ist nie deutscher Meister gewesen. oder Gegen diese Mannschaft gewinnt er jedoch immer. Typisch für solche nicht klassifikatorisch verwendbare, gebundene Prädikatoren sind prädikatsbezogene Adverbien und Verwendungen bestimmter Präpositionen wie in: Er kam eilends. Sie übte zeitlebens. Er verlor oft. Gestern gewann er. Er war auf der Brücke (im Unterschied zu Er war unter der Brücke.) Er kam vor dem Glockenschlag. Bei der Diskussion um die Abgrenzung von Semantik und Pragmatik standen immer wieder Ausdrücke im Fokus, deren Gebrauch zwar auch, aber nicht allein über die Wahrheitsbedingungen bestimmt werden kann. Beispiele sind bestimmte Arten von Artikeln (dieser, jener, mein, dein, alle, jeder), Demonstrativa (hier, dort, da) und be‐ stimmte deiktische Adverbien (hin, her, hinunter, herunter, jetzt, später, heute, morgen, gestern, rechts, links). Solche indexikalischen oder deiktischen Ausdrücke sind nur in einem vorausgesetzten Kontext wahrheitsfunktional. Beim Gebrauch von herunter wird beispielsweise eine bestimmte Sprecherposition vorausgesetzt. Diese Lexeme werden konventionell verwendet, sind aber hinsichtlich ihrer Wahrheitsbedingun‐ gen konventionell unterbestimmt. Deshalb sind sie Standardbeispiele für die soge‐ nannte Pragmatik. Auch graduelle Adjektive wie groß, klein, reich, gut sind Beispiele für Prädikatoren, bei denen die Regelkenntnis für ein angemessenes Verstehen noch nicht hinreichend 14 Diese Konstanz der Prädikationsregel besteht natürlich immer nur für eine bestimmte Verwen‐ dungsweise, etwa für die Verwendungsweise von rot als Farbwort oder als metaphorische Bezeich‐ nung einer politischen Orientierung, vgl. unten die Bemerkungen zur Polysemie. 24 ist. Bei der prädikativen Verwendung solcher Wörter entsprechend ihren Wahrheits‐ bedingungen wird unausgesprochen immer ein Kontext vorausgesetzt: Karlchen ist groß (für einen Jungen seines Alters). Wir sind reich (im Vergleich zu …). Das ist gut (im Vergleich mit … und im Hinblick auf …). Solche graduellen Adjektive werden in der Praxis elliptisch verwendet. Ihre Ver‐ wendungen sind Beispiele komprimierten Sprechens, bei dem im Sinne einer öko‐ nomischen Kommunikation weggelassen wird, was die Partner vermutlich schon wissen oder erschließen können. Bei der Prädikation solcher Gradadjektive verlassen wir uns darauf, dass sie das Weggelassene aus ihrem Kontext‐ und Weltwissen her‐ aus ergänzen oder ersetzen. Die Tasche ist zu klein. heißt eben zu klein für den hier vorausgesetzten Zweck. Prädikationsregeln sind wie sprachliche Regeln allgemein Konventionen, denen wir mehr oder weniger unbewusst folgen. Die Regelkenntnisse gehören eher zum soge‐ nannten impliziten Wissen, das sich weniger in Kenntnissen als im Können zeigt. So ist es nicht ungewöhnlich, dass wir von uns angewandte Regeln nicht beschreiben können – bei sog. Basisprädikaten wie den Farbadjektiven ist das prinzipiell unmög‐ lich. Dass wir Regeln folgen, zeigt sich dann daran, dass wir sie an Beispielen ver‐ deutlichen können. Der entscheidende Beweis für die Existenz von Regeln ist nicht ihre Beschreibbarkeit z.B. durch andere sprachliche Ausdrücke, sondern die Tatsa‐ che, dass das Handeln nach einer Regel gelehrt, gelernt und angewandt werden kann. Notwendige Unschärfen Bekanntlich ist über die Anwendbarkeit eines Wortes oft keine sichere Entscheidung möglich, z.B. darüber, ob etwas noch rot oder schon orange zu nennen ist. Wer kann schon sagen, ab wann ein Weg zu einer Straße wird oder ein Hügel zu einem Berg. Wenn aber die Regeln für Ausdrücke, mit denen wir Unterscheidungen machen, so ungenau sind, stellt sich die Frage, was wir mit derart unscharfen Unterscheidungen anfangen können. „Aber ist ein verschwommener Begriff überhaupt ein Begriff?“ ‐ Ist eine unscharfe Photographie überhaupt ein Bild eines Menschen? (…) Ja, kann man ein unscharfes Bild immer mit Vorteil durch ein scharfes ersetzen? Ist das un‐ 25 scharfe nicht oft gerade das, was wir brauchen?“15 Warum die Regeln unscharf sein müssen, lässt sich schnell zeigen. Regeln haben wir für bestimmte Zwecke entwickelt, und wir können sie entspre‐ chend auch verändern. Wenn es sinnvoll erscheint, lässt sich die Unschärfe verrin‐ gern. Das geschieht ständig, etwa durch Fachsprachen. Andererseits ist die Zweck‐ mäßigkeit einer relativen Ungenauigkeit offensichtlich: Mit Prädikatoren teilen wir die Welt in Dinge gleicher Art ein. So, wie wir einerseits im Spracherwerb an ver‐ schiedenen Beispielen gelernt haben, wann wir etwas beispielsweise Haus nennen (indem wir das Gemeinsame der verschiedenen roten, gelben, großen, kleinen, ein‐ stöckigen, mehrstöckigen Häuser, der Häuser mit und ohne Garten, usw. erkannt und das jeweils Wechselnde als unwesentlich ausgeschieden haben), so teilen wir andererseits die Welt in Dinge gleicher Art ein, unterscheiden mit Hilfe der Prädika‐ toren in Häuser, Bäume, rote oder runde Dinge usw. Gleich ist dabei, was wir ent‐ sprechend unseren Prädikationsregeln als gleich gelten lassen. Grundsätzlich ist es der Vorteil der unscharfen Prädikation, die komplexe Vielfalt der potentiellen Ge‐ genstände der Welt überschaubar zu machen, indem wir sie reduzieren auf wieder‐ kehrende Typen und Muster. Eine theoretisch vorstellbare maximale Exaktheit unse‐ rer Prädikationsregeln würde die prädikativen Einteilungen der Welt in Gleicharti‐ ges unmöglich machen. Wie viele verschiedene Wörter bräuchten wir als Ersatz für den unscharf gebrauchten Prädikator Zypresse, wo doch jede Zypresse anders ist? Wir ständen im Extremfall einem Universum ungeordneter Einzeldinge gegenüber, für die wir eine Unzahl von Eigennamen kennen müssten, ohne jedoch die für uns so wichtige Gliederung zu erreichen. Die relative Offenheit unserer Prädikationsregeln gestattet uns dagegen eine gleichzeitig stabile und flexible Orientierung.16 Polysemie und Homonymie Zu der grundsätzlich nötigen Randunschärfe kommt noch das Phänomen der Mehr‐ deutigkeit. Das heißt, die Unschärfe gilt jeweils für verschiedene einzelne Verwen‐ dungsweisen eines Wortes. Ein kurzer Blick in Wörterbücher zeigt, dass Wörter mehrere oder viele Verwendungsweisen haben können. Häufig genannte Beispiele für Prädikatoren mit unterschiedlichen Verwendungsweisen – also mit jeweils ver‐ schiedenen Wahrheitsbedingungen ‐ sind Substantive wie Zug, Schlag oder Läufer. Besonders Adjektive zeigen enorm weite Verwendungsspektren. Für das Wort hart Wittgenstein 1953, 71 Zur Orientierungsfunktion „unscharfer“ prädikativer Einteilungen vgl. Kamlah, Lorenzen 1967, 45 ff. 15 16 26 etwa schwankt je nach Wörterbuch die Zahl angegebener Verwendungsweisen zwi‐ schen fünf und über zwanzig. Bei Verben korrespondieren die unterschiedlichen Prädikationsregeln zum Teil mit unterschiedlichen Valenzen, wobei auch ihre Wahr‐ heitsbedingungen jeweils andere sind. So kontrastiert beispielsweise das zweiwertige verlassen in Er verließ die Stätte des Unfriedens. mit dem dreiwertigen in Sie verließ sich auf ihn. Unterschiedliche Wahrheitsbedingungen haben manche Verbalausdrücke auch je nachdem, ob eine Ergänzung kasuell oder präpositional angeschlossen wird oder mit welcher Präposition es angeschlossen wird: Wir zählen alle Anwesenden. ‐ Wir zählen auf alle Anwesenden. Er wartet den Rasen. ‐ Er wartet auf Regen. Sie klagte über ihr Rheuma. ‐ Sie klagte gegen den behandelnden Arzt. Polysemie entsteht sprachgeschichtlich v.a. durch metonymischen oder metaphori‐ schen Gebrauch. Das betrifft nicht nur Verben (verstehen, begreifen), Substantive (An‐ schauung) oder Adjektive (scharf), sondern beispielsweise auch Präpositionen (unter, vor) und Konjunktionen (weil), aber auch sogenannte polyfunktionale Strukturwörter wie als, bis, damit, doch usw. Angesichts der heute im Rahmen korpusbasierter Untersuchungen empirisch fest‐ stellbaren Vielfalt konkreter Verwendungen liegt die Frage nahe, ob das bisher skiz‐ zierte Bild von Prädikationsregeln nicht naiv ist. Ist es angesichts der vielfältigen Verwendungen von Prädikatoren (aber auch von anderen Wörtern), die je nach Nachbarschaft in Sätzen unterschiedlich zu sein scheinen, überhaupt noch sinnvoll, von Regeln des Gebrauchs zu sprechen? Im Allgemeinen wird in der Behandlung des Themas heute so verfahren, dass man auf der Grundlage statistischer Kookkurrenzanalysen die Distribution, d. h. die Menge aller Kotexte, z.B. die eines untersuchten Adjektivs, statistisch auswertet.17 Auf dieser Grundlage können typische Kookkurrenzen und signifikante konventio‐ nalisierte Verwendungsweisen herausgefiltert und von Ad‐hoc‐Verwendungen un‐ terschieden werden. Die intuitive Unterscheidung verschiedener konventionalisierter z.B. Cyril Belica: Kookkurrenzdatenbank CCDB ‐ Eine korpuslinguistische Denk‐ und Experimentier‐ plattform, 2001 ff., Institut für Deutsche Sprache, Mannheim. Signifikante Nähe oder Häufigkeit eines Ausdrucks zu anderen erlaubt die Feststellung von Kookkurrenzen. Daraus lassen sich Vorkommen von besonderer, meist syntaktischer Nähe herausheben, nämlich Kollokationen. 17 27 Verwendungsweisen kann mit Hilfe verschiedener Untersuchungsmethoden18 gefes‐ tigt werden. Ein gern zitiertes Beispiel für unterschiedliche Verwendungsweisen ist das Adjektiv billig. Es wurde sprachgeschichtlich zuerst im Bereich der Rechtsprechung verwen‐ det, danach auch im Bereich des Handels. Heute können in der Alltagssprache drei regelhafte Verwendungsweisen festgestellt werden: niedrig im Preis, wertlos, geistlos, und in juristischer Fachsprache zusätzlich noch die ursprüngliche Verwendungswei‐ se im Sinn von angemessen. 19 Billig ist damit ein anschauliches Beispiel für einen po‐ lysemen Prädikator. Polysemie entsteht sprachgeschichtlich, wenn ein Ausdruck z.B. auf metonymische oder metaphorische Weise zusätzlich neu und anders verwendet wird. Metaphorische Verwendungsweisen dienten sprachgeschichtlich häufig dazu, über Analogien zu konkreten Gegenständen abstrahierende Ausdrücke aufzubauen. Es wurden in solchen Fällen nicht neue Wörter erfunden, sondern neue Verwen‐ dungsweisen bereits vorhandener. Ein Wort wie verstehen lässt noch seine metapho‐ rische Entstehung erkennen. Ähnlich wie das englische understand verweist es auf ei‐ ne konkrete Tätigkeit wie das Stehen vor etwas, um es gut wahrnehmen zu können. Zahllose solcher Metaphern sind in der heutigen Sprache schon „tot“ oder „abge‐ storben“, das heißt, ihr metaphorischer Charakter ist ihren Benutzern meist nicht bewusst. Gerade die Bezeichnungen für geistige Vorgänge wurden schon von Jean Paul als ein „Wörterbuch erblasster Metaphern“ bezeichnet. Aber nicht nur, wenn es um geistige Vorgänge geht, können Metaphern im Spiel sein. Es ist bekanntlich ziem‐ lich schwierig, Sätze ohne metaphorische Ausdrücke zu finden. Von Polysemie wird Homonymie unterschieden. Wenn ein Wort mehrere Verwen‐ dungsweisen hat, die nichts miteinander zu tun haben, handelt es sich eigentlich um zwei verschiedene Lexeme, deren Ausdruck zufällig identisch ist. Ein Beispiel ist das Wort Mast, mit dem einerseits das Anfüttern von Tieren, andererseits ein Pfahl oder Stamm gemeint sein kann. Keine der beiden Verwendungsweisen ist aus der anderen hervorgegangen. Ähnliches gilt für Kiefer, Ball oder Reif. So kann man theoretisch un‐ terscheiden: „Wenn ein Wort zwei systematisch unterschiedene Bedeutungen hat und die eine historisch von der anderen ableitbar ist, und wenn diese Bedeutungs‐ verwandtschaft im allgemeinen Sprachbewusstsein präsent ist, so spricht man von Polysemie. Wenn zwei verschiedene Wörter, die keine (erkennbare) gemeinsame sprachgeschichtliche Herkunft haben, gleich lauten, so liegt Homonymie vor.“20 18 Bons 2009, 27 ff. beschreibt als Methoden zur Ermittlung von Verwendungsweisen die Kollokati‐ onsanalyse, den Kipp‐Test, den Zeugma‐Test, die Analyse syntaktischer Aspekte sowie die Angabe von Paraphrasen, fremdsprachlichen Äquivalenten und Antonymen. 19 vgl. Fritz 2006, 133 f. 20 Keller/Kirschbaum 2003, 103. 28 Diese Unterscheidung ist klar – jedenfalls theoretisch. Bezogen auf die sprachliche Praxis des Einzelnen ist sie es nicht. Denn der Einzelne hat eben kein allgemeines Sprachbewusstsein, sondern immer nur sein individuelles. Und da kann es sein, dass jemand nur eine Verwendungsweise von billig kennt, ein anderer vier. Und beim Letzteren ist denkbar, dass er als Etymologe die Zusammenhänge zwischen den ver‐ schiedenen Verwendungsweisen genau kennt. Aber es kann ebenso sein, dass ihm diese sprachgeschichtlichen Zusammenhänge nicht bekannt sind. Dann sind für ihn die verschiedenen Verwendungsweisen von billig homonyme Ausdrücke; es muss ihm nicht einmal bewusst sein, dass er verschiedene Verwendungsweisen eines Wor‐ tes praktiziert. Ob es sich in einem konkreten Fall um einen polysemen oder einen homonymen Ausdruck handelt, ist zwar sprachgeschichtlich zu klären, sagt aber nichts über die konkrete Praxis von Sprecherhörern. Überhaupt sollte man beim ein‐ zelnen Sprachteilhaber Prädikationsregeln eher als ein mehr oder weniger entwickel‐ tes Bündel bzw. Spektrum möglicher regelhafter Verwendungsweisen betrachten. Die verschiedenen Sprachteilhaber verfügen nicht unbedingt über identische Regeln bzw. Regelbündel, weil sie eben nicht das gleiche Leben geführt haben und führen. Zum Thema Polysemie gibt es zwei theoretische Extremansichten: Nach der minima‐ listischen These kennt der Sprecher eine Verwendungsweise und kreiert daraus immer wieder metaphorisch oder metonymisch neue. Nach der maximalistischen Auffassung kennt der Sprecher nur verschiedene, gleichsam homonyme Verwen‐ dungsweisen. Der minimalistische Standpunkt, Sprecher würden aus einer „Grundbedeutung“ verschiedene Verwendungsweisen jedes Mal neu erfinden und Hörer würden sie konversationell aus einer Grundbedeutung ableiten, ist wenig plausibel. Wer etwa das Wort billig im Kontext mit den Preisen von Waren gelernt hat, kann die für ihn neue Verwendung in Das ist ein billige Ausrede vielleicht als konversationelle Implika‐ tur erschließen. Anschließend kann er möglicherweise eine solche für ihn zuerst ok‐ kasionelle Verwendung als eine neu hinzugekommene konventionalisierte Verwen‐ dungsweise „abspeichern“. Ob er sich danach bei der aktiven oder rezeptiven Ver‐ wendung von billig noch an den Ableitungszusammenhang erinnert oder nicht, ist unerheblich. Ohne ein etymologisches Hintergrundwissen sind die verschiedenen Verwendungsweisen einfach homonyme Ausdrücke. Nach der maximalistischen Auffassung werden verschiedene sprachgeschichtlich aus einander hervorgegangene Verwendungsweisen ‐ etwa von billig oder scharf ‐ als voneinander unabhängige Homonyme gelernt. Damit sind Sprecher bzw. Hörer von jeglichem Erschließungsaufwand entlastet. Allerdings trifft diese Auffassung eben nicht auf die häufigen Fälle konversationellen Erschließens und Lernens zu. Wenn wir mit einer unbekannten Verwendung eines Wortes konfrontiert sind, werden wir 29 kooperativ versuchen, sie als metaphorische, ironische usw. zu erschließen. Und viel‐ leicht benutzen wir das Wort anschließend selbst in der neuen Weise. In der sprachli‐ chen Praxis des Einzelnen sind Polysemie und Homonymie jedenfalls nicht so ge‐ trennt wie in der sprachgeschichtlichen Theorie. Kommen wir noch einmal zu der Frage, ob angesichts der beeindruckenden empiri‐ schen Befunde zur Polysemie die Annahme von Regeln überhaupt noch haltbar ist. Im Allgemeinen lassen sich innerhalb der Vielzahl von empirisch feststellbaren Ver‐ wendungen typische konventionelle Verwendungsweisen erkennen. Zwar sind diese an den Rändern jeweils notwendigerweise unscharf. Jede dieser Verwendungswei‐ sen bietet aber eine Grundlage, über die bekannten Mechanismen der Metonymisie‐ rung und Metaphorisierung neue Verwendungen zu erproben. Solche okkasionellen Verwendungen sind dann Ad‐hoc‐Varianten von konventionalisierten Verwen‐ dungsweisen. Sie erscheinen zwar in empirischen Distributionsanalysen als nicht re‐ gelhaft, setzen aber für ihre Erzeugung regelhafte Verwendungsweisen voraus und sind über diese entstanden und nur über diese erschließbar. Eine neue Verwendung eines Ausdrucks ist kommunikativ also nur aussichtsreich, wenn sie aus einer kon‐ ventionellen Verwendungsweise z.B. durch Metonymisierung und Metaphorisierung gewonnen wird und über diese Mechanismen auch erschließbar ist. Zudem sollte im kollokativen Kontext möglichst Regelhaftigkeit dominieren. Eine Gleichung bestehend nur aus Unbekannten könnten wir nicht lösen. Mit Sätzen, die nur aus nicht konventionell gebrauchten Ausdrücken bestehen, könnten wir nicht aussichtsreich kommunizieren. Auch wenn die empirische Distributionsanalyse für einen einzelnen Ausdruck nicht konventionalisierte Verwendungen zeigt, darf davon ausgegangen werden, dass jeweils zumindest die Mehrzahl der anderen Ausdrücke im Satz konventionell verwendet sein muss, damit eine konversationelle Erschlie‐ ßung möglich ist. Jedenfalls ist nicht plausibel und empirisch auch nicht nachgewie‐ sen, dass gleichzeitig alle Ausdrücke eines Satzes konversationell erschlossen werden könnten. Eine Neuschöpfung macht erst im Satzkontext regelhaft verwendeter Aus‐ drücke Sinn. Nur dann kann ich etwas damit meinen, nur dann kann sein Gebrauch erschlossen werden. Einen Satz nur mit Wörtern ohne regelhafte Verwendungswei‐ sen kann ich jedenfalls nicht sinnvoll meinen und auch nicht verstehen. Es sind also die Regeln, welche die Freiheit zu neuen Verwendungen und später möglicherweise neuen konventionalisierten Verwendungsweisen ermöglichen. 30 Satzwörter Unsere Frage lautet: Wozu verwenden wir Wörter? Welche sprachlichen Handlun‐ gen machen wir mit ihnen? Eine Verwendungsweise unserer Wörter ist offensichtlich primär: Mit prädizierbaren Lexemen machen wir Prädikationshandlungen, und wir tun dies im Dienste von Sprechakten. Zu den Prädikatoren gehören nicht nur die klassifikatorischen Haupt‐ wortarten, sondern auch verschiedene nicht flektierbare Lexemarten wie bestimmte prädikatsbezogene Adverbien (rückwärts, abseits), Gradadverbien (kaum, ein bisschen, sehr) oder bestimmte Verwendungsweisen von Präpositionen (auf, unter, neben, mit, ohne).21 Sie lassen sich zwar nicht zur Klassifikation von Dingen, Handlungen usw. verwenden, aber sie wirken sich auf den Wahrheitswert von Sätzen aus. Es ist ein Unterschied, ob jemand auf der Brücke oder unter der Brücke schläft, ob er vorwärts oder rückwärts läuft oder ob er intelligent, sehr intelligent oder kaum intelligent ge‐ nannt wird. Die Verwendungsregeln von Prädikatoren lassen sich durch Angabe ihrer Wahr‐ heitsbedingungen beschreiben. Diese Wahrheitsbedingungen bleiben konstant, un‐ abhängig von wechselnden Sprechakten. Beim Prädizieren mit deskriptiver Absicht bedeuten wir, dass wir Prädikationen über Gegenstände der Bezugnahme für wahr halten. Wir geben also zu verstehen, dass wir die Wahrheitsbedingungen, so wie wir sie gelernt haben, für erfüllt halten. Und wir wollen dies dem Partner bedeuten. Das ist die bekannte Standardanwendung des Behauptens. Prädikationshandlungen ma‐ chen wir aber auch mit anderen Bewirkungsabsichten. Wenn wir mit der Äußerung des Satzes Schließe das Buch! auffordern, wollen wir bewirken, dass der Partner auf eine bestimmte Weise handelt, so dass die Prädikation von schließen bzw. der Satz H schließt das Buch. wahr wird. Jedenfalls wird mit Prädikatoren im Dienste verschiedener Bewirkungs‐ absichten prädiziert. Und durch diese Prädikationshandlungen machen wir Sprech‐ akte. Von den nichtflektierbaren Lexemen wird zwar – wie oben gesagt ‐ ein Teil prädika‐ tiv verwendet, die große Mehrzahl kommt aber für eine prädikative Verwendung nicht infrage. Dazu zählen: 21 Nicht prädikativ verwendet werden Präpositionen zum Anschluss präpositionaler Ergänzungen wie in: Er hofft auf gutes Wetter. Er leidet unter der Hitze. Er sehnt sich nach Kühlung 31 1. Konjunktionen und Subjunktionen: aber, denn, doch deshalb; obwohl, weil, wenn, falls … 2. Bindeadverbien oder Konjunktionaladverbien: nämlich, mithin, immerhin, den‐ noch, allerdings, freilich, hingegen … 3. Satzadverbien: vielleicht, immerhin, wahrscheinlich, angeblich, bekanntlich, gewiss, zweifellos, sicherlich, hoffentlich, erstaunlicherweise, nicht, natürlich … 4. Partikeln: Gliederungspartikeln: nämlich, also, aber, doch, auch … Fokuspartikeln bzw. Gradpartikeln: (wie nur, bloß, allein, ausschließlich, selbst, le‐ diglich, auch, ebenso, sogar, selbst, nicht einmal, wenigstens, lediglich, gerade, eben … Modalpartikeln bzw. Abtönungspartikeln: wie aber, ja, auch, doch, wohl, eben, halt, ja, bloß, nur, etwa, denn, eigentlich, wohl … Viele solcher Lexeme sind als sehr mobile polyfunktionale Wanderer durch die Wortarten bekannt.22 Je nach Kontext können manche sowohl als Adverbien, Satzad‐ verbien oder als Modalpartikeln auftreten, andere auch noch als Konjunktion, Gradpartikeln (Fokuspartikeln) oder als Gliederungspartikeln. Somit lassen sich die‐ se Wörter durch die Zuweisung zu unterschiedlichen Wortarten als polyseme Aus‐ drücke interpretieren oder auch in Reihen von Homonymen zerlegen. Welche Bedeutungshandlungen machen wir mit diesen Wörtern? Haben die ver‐ schiedenen nicht prädizierbaren Lexeme eine oder mehrere gemeinsame, übergrei‐ fende Verwendungsweisen? Es ist im Nachhinein erstaunlich, dass viele der nicht prädizierbaren Lexeme lange Zeit als semantisch eher nicht bestimmbare, gewissermaßen bedeutungsleere Synsemantika oder Funktionswörter angesehen wurden. Manchmal wurden ihnen nicht näher ausgewiesene grammatische Aufgaben zugeschrieben. Anderswo wur‐ den sie gar dem grammatischen Wortschatz zugeschlagen, ohne dass klar wurde, was denn ein grammatischer Wortschatz sein könnte. Auch die Erläuterung, die Be‐ deutung von Funktionswörtern sei eher struktureller Art, half nicht recht weiter. Be‐ trachtete man konkrete Beispiele, blieben alle Fragen offen. Inwiefern soll die Fokus‐ partikel auch eine grammatische oder strukturelle Funktion haben? Und wieso sollte das Satzadverb natürlich bedeutungslos sein? Wenn wir es verwenden, werden wir wohl etwas damit bedeuten. 22 Somit muss man z.B. die einzelnen Partikelarten weniger als Wortarten, sondern eher als Funktio‐ nen sehen, in denen bestimmte Partikeln auftreten können. So lässt sich die Partikel doch in fünf ver‐ schiedenen Verwendungsweisen nachweisen, u.a. als Modalpartikel, als Konjunktion und als Bin‐ deadverb und Gliederungspartikel (Vgl. Thurmaier 1989, 110 ff.). 32 Unstrittig ist nur, dass diese Wörter keine sogenannte lexikalische Bedeutung haben, dass sie also nicht prädikativ verwendet werden und auch nichts zum Wahrheits‐ wert von Sätzen beitragen. Genauso trifft zu, dass diese Wörter weglassbar sind. Vollständig irreführend ist allerdings die Behauptung, dass bei Weglassung von Satzadverbien oder Partikeln kein Informationsverlust aufträte. Tatsächlich macht es einen Unterschied, ob Satzadverbien verwendet werden oder nicht. Man vergleiche nur Ich kann nicht kommen. mit Ich kann leider nicht kommen. Genauso macht es einen Unterschied, ob ich sage: Inge war da. oder ob ich sage: Wenigstens Inge war da. Entsprechendes gilt bei Konjunktionen: Wir sind gegangen. Es hat uns gefallen. Wir sind gegangen. Aber es hat uns gefallen. Wir sind gegangen. Denn es hat uns gefallen. Und natürlich ist es auch ein Unterschied, ob ich sage: Ich bin damit nicht einverstanden. oder Ich bin damit eigentlich nicht einverstanden. Ebenso wie Konjunktionen, Subjunktionen und Bindeadverbien sind auch Satzad‐ verbien und die verschiedenen Arten von Partikeln keineswegs inhaltsleere und irre‐ levante „Füllwörter“, sondern kommunikativ bedeutsame und in spezieller Weise ebenfalls wahrheitsbezogen verwendete Lexeme. Das Spezifische an ihnen scheint zu sein, dass sie alle erst bedeutsam verwendet werden können als Hinzufügungen zu schon vollständigen Sätzen. Zwar fehlt bei ihrer Weglassung keine Information im Bezugssatz, aber es fehlt genau das, was im Hinblick auf den im Bezugssatz formulierten Sachverhalt mit ihnen zusätzlich be‐ deutet wird. Damit lässt sich festhalten: Ein Teil der nicht flektierbaren Lexeme wird prädikativ verwendet. Von den übrigen nicht flektierbaren wird ein erheblicher Teil – nämlich die oben aufgeführten Wortarten ‐ dazu verwendet, etwas in Bezug auf das mit Sät‐ zen Gesagte zu bedeuten. Im Folgenden werde ich – um den funktionalen Unter‐ 33 schied zu kennzeichnen – diese nicht prädikativ verwendeten Lexeme als Satzwörter bezeichnen und in ihrem Gebrauch beschreiben. Eine spezifische Gruppe dieser Satzwörter sorgte in der philosophischen Diskussion für eine letztlich erhellende Kontroverse, nämlich Bindeadverbien wie somit, mithin, Konjunktionen wie deshalb und Subjunktionen wie weil. Unbestreitbar ändert man mit ihrer Verwendung nichts am Wahrheitswert der durch sie in einen Zusammen‐ hang gestellten Sätze. Das sieht man bei therefore und weil in He is an Englishman; he is, therefore, brave.23 Er ist ein intelligenter Mensch, weil er die FAZ liest. Die jeweiligen Sätze bleiben wahr oder falsch – unabhängig von der Verwendung solcher Satzwörter. Allerdings kann man mit ihnen selbst auch etwas Richtiges oder Falsches sagen. Vielleicht ist unser Engländer nicht tapfer, weil er Engländer ist, son‐ dern obwohl er es ist. Und der FAZ‐Leser wird ja nicht dadurch intelligent, dass er das genannte Blatt liest. Jedenfalls gibt man mit daher, folglich, somit, demzufolge, mithin, deswegen, weil oder deshalb etwas zusätzlich zu diesen Sätzen auf regelhafte Weise zu verstehen. Im All‐ gemeinen werden die mit Konjunktionen gemachten Bedeutungshandlungen lingu‐ istisch so beschrieben: „Das wesentliche funktionale Kennzeichen von Konjunktio‐ nen ist, dass sie Sätze oder einzelne Satzteile miteinander verbinden. Dabei macht die Konjunktion Angaben über die Art der Verknüpfung.“24 Das heißt also, dass wir mit Konjunktionen zu verstehen geben, welchen Zusammenhang wir zwischen zwei festgestellten Tatsachen für wahr halten. Bindeadverbien wie mithin, somit, deswegen, außerdem, jedoch, trotzdem, schließlich entsprechen funktional den Konjunktionen. Auch mit ihnen stellen wir Zusammenhänge zwischen Sachverhalten fest. Allerdings werden sie syntaktisch anders als Konjunktionen verwendet. Wer Bindeadverbien, Konjunktionen oder Subjunktionen verwendet, bedeutet, dass er einen bestimmten Zusammenhang zwischen Sachverhalten oder Tatsachen für wahr hält. So gibt man mit weil zu verstehen, dass man die im zugehörigen weil‐Satz ausgedrückte Tatsache als Grund für das im Hauptsatz Festgestellte ansieht. Und mit therefore (mithin, somit) wird im obigen Beispiel zum Ausdruck gebracht, dass man die Tapferkeit als Folge der Nationalitätszugehörigkeit ansieht. Man kann Bindead‐ verbien, Konjunktionen und Subjunktionen als komprimierte Versionen von Sätzen sehen: Mit denn und weil wird in Kurzform zum Ausdruck gebracht, dass man etwas als Grund für etwas anderes betrachtet. Und umgekehrt wird mit somit, folglich, also 23 24 Das ist das bekannte Beispiel in Grice, Logic and Conversation. Thurmaier 1989, 12 34 usw. bedeutet, dass man einen Sachverhalt als Folge des vorher genannten betrach‐ tet. Also bringen wir auch mit Bindeadverbien, Konjunktionen und Subjunktionen etwas mit Wahrheitsanspruch zum Ausdruck – wir bedeuten mit ihnen etwas. Grice hat für dieses Etwas in Anlehnung an den Terminus konversationelle Implikatur die Bezeich‐ nung konventionelle Implikatur vorgeschlagen. Demzufolge könnte man die mit der Verwendung solcher Ausdrücke gemachte Handlung als konventionelles Implikatie‐ ren bezeichnen.25 Allerdings führte der Ausdruck Implikatur in diesem Zusammen‐ hang zu Irritationen, wird doch im Allgemeinen als Implikatur das verstanden, was zwar gemeint, aber nicht explizit gesagt wird. Dagegen wird mit den hier zur Debat‐ te stehenden Wörtern das, was gemeint ist, explizit zum Ausdruck gebracht. Insofern ist die Bezeichnung konventionelle Implikatur selbstwidersprüchlich und ihr Nutzen zweifelhaft.26 Angesichts der Problemlage hat Grice später darauf hingewiesen, dass die Bezeichnung „konventionelle Implikatur“ nur als vorläufig zu betrachten sei und mit entsprechender Vorsicht verwendet werden sollte.27 Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, das mit Konjunktionen und Bin‐ deadverbien wie denn, aber, somit usw. Ausgedrückte als konventionelle Implikatur zu bezeichnen? Gehen wir von Grice’ eigenem Beispiel aus und lassen dabei ver‐ suchsweise therefore weg: Er ist Engländer. ‐ Er ist tapfer. Wenn sich der Zuhörer hier fragt, wie das gemeint sein könnte, wird er möglicher‐ weise als konversationelle Implikatur erschließen, dass der erste Satz als Begründung für die Wahrheit des zweiten gemeint sein könnte. Nun kann man aber dieses nicht Gesagte, aber Gemeinte, also die konversationelle Implikatur, auch explizit ausdrü‐ cken ‐ etwa so: Er ist tapfer, weil er Engländer ist. Er ist Engländer. Deshalb ist er tapfer. Er ist tapfer, denn er ist Engländer. Hier wird nun mit weil (deshalb, denn) der argumentative oder kausale Zusammen‐ hang mit einem regelhaft verwendeten Wort explizit festgestellt, also das, was vorher 25 Grice, Logik und Konversation. In: Meggle 1979, 247 f. – Immerhin wäre das konventionelle Impli‐ katieren eine sprachliche Handlung, im Gegensatz zum konversationellen Implikatieren. Meinen ist wohl kaum als sprachliche Handlung anzusehen, es ist nichts, was wir machen. 26 Vgl. Bach, The Myth of Conventional Implicature, 1994. Eine kurze Zusammenfassung der Debatte bietet Pfister 2008. 27 „… the nature of conventional implicature needs to be examined before any free use of it, for ex‐ planatory purposes, can be indulged in.ʺ (Further Notes on Logic and Conversation, in Grice 1989, 46). 35 als konversationelle Implikatur zu erschließen war. Es wird also etwas explizit aus‐ gedrückt, was man auch weglassen und als Implikatur erschließen lassen könnte. Diese Weglassbarkeit kann man teilweise auch bei anderen Bindeadverbien, Kon‐ junktionen oder Subjunktionen beobachten: Die Straße ist nass. Es hat geregnet. (Die Straße ist nass, weil es geregnet hat.) Er springt zwei Meter hoch. Er ist nur 1,70 Meter groß. (Er springt zwei Meter hoch, obwohl er nur 1,70 Meter groß ist.) Die Zuschauer warfen Knallkörper aufs Spielfeld. Der Schiedsrichter brach das Spiel ab. (Als/ nachdem/ während / weil/ die Zuschauer Knallkörper aufs Spielfeld warfen, brach der Schiedsrichter das Spiel ab. ‐ Die Zuschauer warfen Knallkörper aufs Spielfeld. Der Schieds‐ richter brach folglich/ daher/ deshalb das Spiel ab.) Man kann also manche Konjunktionen oder Bindeadverbien weglassen, sodass das mit ihnen Ausdrückbare konversationell erschlossen werden muss. Aber man kann es auch explizit ausdrücken. Problematisch ist aber, diese weglassbaren Ausdrücke als Ausdrücke für konventionelle Implikaturen zu interpretieren. Wenn nämlich alle weglassbaren und konversationell erschließbaren Wörter als Ausdrücke für konven‐ tionelle Implikaturen angesehen werden müssten, würde das zu einem inflatorischen Gebrauch dieses Terminus führen. Denn dann wären alle Ausdrücke, die in Sätzen weglassbar und konversationell erschließbar wären, Ausdrücke für konventionelle Implikaturen. Aber ihr Gebrauch wäre durch diese Etikettierung in keiner Weise er‐ klärt. Auch aus diesem Grund wird im Folgenden die Bezeichnung Implikatur aus‐ schließlich für konversationelle Implikaturen verwendet. Wenn man dagegen den Gebrauch von Wörtern beschreiben will, empfiehlt es sich, den Ausdruck „Implikatur“ zu streichen und sich auf den konventionellen Aspekt zu konzentrieren, also die wahrheitsfunktionalen Regeln des Gebrauchs. Und diese findet man, indem man bestimmt, was für wahr gehalten wird, wenn der Ausdruck verwendet wird. Im Übrigen sind mit Ausnahmen bestimmter Konjunktionen, Subjunktionen sowie einzelner Bindeadverbien die meisten Satzwörter gerade nicht weglassbar. Satzad‐ verbien wie sicherlich, natürlich, doch, sogar oder Partikeln wie auch muss man schon verwenden, um zum Ausdruck zu bringen, was man mit ihnen zum Ausdruck brin‐ gen kann. Jedenfalls lässt sich bei einem Satz wie Auch konventionelle Implikaturen sind wahrscheinlich strittig. nicht so ohne weiteres auf auch und wahrscheinlich verzichten. Wie sollte denn er‐ schlossen werden können, dass auch und natürlich in Konventionelle Implikaturen sind strittig. 36 mitgemeint sind? Man müsste dann ersatzweise schon etwas dazu sagen wie: Sie sind es nicht als einzige. (Sie sind nicht als einzige strittig.) Das ist mit ziemlicher Si‐ cherheit so. Damit wäre aber das, was mit auch und wahrscheinlich mit Wahrheitsanspruch zum Ausdruck gebracht wird, nur in expliziter Langform gesagt. Die Bezeichnung Satzwörter erweist sich also zumindest für Bindeadverbien und Konjunktionen als anschauliche funktionale Kennzeichnung. Zum einen beziehen wir uns mit ihnen auf das, was wir mit Sätzen, zu denen sie hinzutreten, sagen. Zum anderen verwenden wir sie als Kurzformen von satzförmigen Feststellungen mit Wahrheitsanspruch. So kann man sagen: Satzwörter sind Lexeme, mit denen wir in Kurzform etwas zusätzlich zu dem mit einem Satz Gesagten zum Ausdruck bringen – und zwar innerhalb dieses Satzes und mit Wahrheitsanspruch. Wir machen mit ihnen so etwas wie satzinterne Feststellungen zu dem mit dem Satz Gesagten.28 Was man mit einem Satzwort in aller Kürze feststellt, kann man anschließend nicht wi‐ derspruchsfrei in Langform bestreiten. Wer sagt: Nur Rainer war eingeladen. kann anschließend nicht – ohne sich selbst zu widersprechen sagen: Außerdem (waren) noch andere (eingeladen). Entsprechend erscheint Bachs Vorschlag auf den ersten Blick nicht unplausibel, sol‐ che Satzwörter als Ausdrücke für Sprechakte zweiter Ordnung zu interpretieren.29 Man macht mit ihnen innerhalb eines Satzes einen weiteren Sprechakt – wohl immer einen deskriptiven –, der sich auf den zugehörigen Satz bezieht. Nehmen wir als Bei‐ spiele die Konjunktion deshalb und das Satzadverb leider: Das Wetter war schlecht. Deshalb fiel das Gartenfest aus. Karl ist leider krank. Mit deshalb wird ausgedrückt, dass die in dem anschließenden Satz festgestellte Tat‐ sache die Folge der im vorausgehenden Satz festgestellten Tatsache ist. Mit leider wird festgestellt, wie der Sprecher zu der in diesem Satz ausgedrückten Tatsache steht. Wir machen also mit solchen Satzwörtern Feststellungen zum Sachverhalt des Bezugssatzes, und das innerhalb desselben Satzes – und zwar in Kurzform. Und demzufolge wären Satzwörter Formen komprimierten Sprechens, mit denen eben 28 Das gilt auch, wenn Satzwörter zu appellativ intendierten Sätzen hinzutreten. Bei Packe auch die Bü‐ cher ein! wird mit auch so etwas wie die Annahme zum Ausdruck gebracht, dass die Bücher nicht das einzige sind, was der Angesprochene einpacken soll. 29 Vgl. Bach 1994, 328: „The idea of second‐order speech acts is due to Grice (1989, pp. 122 and 362). I will endorse his idea but not his claim that second‐order speech acts produce conventional implica‐ tures. “ 37 Sprechakte zweiter Ordnung, genauer gesagt: Feststellungen zweiter Ordnung gemacht werden. Wenn wir uns die Konsequenzen einer solchen Annahme vor Augen führen, er‐ scheint sie aber als eher problematisch. Zuerst einmal müssten konsequenterweise die satzinternen Paraphrasen von Satzwörtern ebenfalls als Sprechakte zweiter Ord‐ nung interpretiert werden, wie sich am Beispiel von leider zeigen lässt. Karl ist leider erkrankt. Zu meinem Leidwesen ist Karl erkrankt. Dass Karl erkrankt ist, tut mir leid. Und warum sollten dann nicht auch satzexterne Paraphrasen Sprechakte zweiter Ordnung repräsentieren, wie etwa Karl ist krank. Das tut mir leid. Hinzu kommt das Problem, dass man auch Sprechakte dritter und vierter Ordnung annehmen müsste. Denn in den Paraphrasen von Satzwörtern könnten selbst wieder Satzwörter als Ausdrucksformen von Sprechakten zweiter Ordnung verwendet sein usw.: Karl ist erkrankt. Das tut mir natürlich leid. Hier wäre der zweite Satz eine Feststellung zweiter Ordnung, innerhalb derer durch natürlich eine Feststellung dritter Ordnung repräsentiert würde. In der nachfolgen‐ den Satzreihe gäbe es gar Sprechakte erster, zweiter, dritter und sogar vierter Ord‐ nung: Karl ist krank. Das bedauere ich. Das ist natürlich selbstverständlich. Hier würde Karl ist krank. einen Sprechakt erster Ordnung repräsentieren, Das bedauere ich. einen zweiter Ordnung, Das ist selbstverständlich einen dritter Ordnung und natürlich einen Sprechakt vierter Ordnung. Vielleicht müssten auch bestimmte Sätze, die Subjekt‐ oder Objektsätze enthalten, als Sprechakte zweiter usw. Ordnung angesehen werden: Dass X, habe ich vergessen. Dass X, habe ich leider vergessen. 38 Schließlich müsste man sich fragen, warum nur satzinterne Aussagen über Sachver‐ halte Feststellungen zweiter Ordnung sein sollen. Kämen nicht auch Attribute in Frage? Schließlich sind sie satzinterne Feststellungen über Referenten eines Satzes, sie sind also Feststellungen innerhalb einer Feststellung. Angesicht solcher Schwierigkeiten erscheint die Annahme, dass es Sprechakte höhe‐ rer Ordnung geben könnte, problematisch. Sie verdeckt eher, was in grammatischen Theorien ein Allgemeinplatz ist: Die Struktur von Sätzen bzw. von Sprechakten ist rekursiv. Eine Feststellung kann beispielsweise selbst Teil einer Feststellung sein. At‐ tribute und adverbiale Bestimmungen in ihren Lang‐ und Kurzformen sind Beispiele solcher rekursiven Prädikationshandlungen.30 Alles, was innerhalb von Sätzen gesagt werden kann, kann auch in Satzreihen gesagt werden. Ist etwas als Sprechakt einer höheren Ordnung anzusehen, nur weil es nicht satzextern, sondern innerhalb eines Satzes gesagt wird? Und wird es wieder zu einem Sprechakt erster Ordnung, wenn es außerhalb gesagt wird? Ich lasse die Frage offen, verzichte aber auf den Terminus „Sprechakt zweiter Ordnung.“ Die bisher betrachteten Bindeadverbien, Konjunktionen und Subjunktionen sind nur ein erster und funktional spezieller Typ von Satzwörtern. Wir verwenden sie, um in komprimierter Weise satzintern deskriptive Feststellungen zu dem in diesen Sätzen Gesagten zum Ausdruck zu bringen. Entsprechende Feststellungen können aber auch satzextern mit zusätzlichen Sätzen bzw. Sprechakten gemacht werden. Mit Bindeadverbien, Konjunktionen und Subjunktionen werden in Kurzform und mit Wahrheitsanspruch Zusammenhänge zwischen Sachverhalten festgestellt. Mit weil bedeutet man, dass man etwas in irgendeiner Weise als Grund für eine im Hauptsatz festgestellte Tatsache ansieht. Man kann anschließend nicht behaupten: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wenn jemand mit weil ein Argument einleitet wie in Er ist ein intelligenter Mensch, weil er die FAZ liest. kann er die Rückfrage Du glaubst also, dass FAZ‐Leser intelligent sind? nicht sinnvoll verneinen. Was man mit Satzwörtern bedeutet, kann man also gut bestimmen als das, was man anschließend nicht widerspruchsfrei bestreiten kann. Satzwörter werden auf der Grundlage von Regeln verwendet und verstanden. Weil wird – wie seine Entspre‐ chung denn ‐ nur verwendet, wenn man einen bestimmten Zusammenhang für wahr hält, und genau das drückt man durch weil bzw. denn aus. Wer B weil A oder B, denn Vgl. Kap 4. 30 39 A sagt, kann nicht sinnvoll bestreiten, dass seiner Meinung nach A der Grund für B ist. Dass bei der Verwendung von Satzwörtern etwas mit Wahrheitsanspruch zum Aus‐ druck gebracht wird, zeigen auch die Beispiele von obwohl und trotzdem: Obwohl er klein ist, springt er über zwei Meter hoch. Er ist klein. Trotzdem springt er über zwei Meter hoch. Mit obwohl oder trotzdem gibt S zu verstehen, dass seiner Ansicht nach das Erste er‐ fahrungsgemäß das Zweite unwahrscheinlich macht. S kann hinterher nicht sagen: Es ist ganz normal, dass jemand, der klein ist, diese Höhe springt. Täte er das, hätte er die Regel von obwohl oder trotzdem nicht recht verstanden. An dieser Stelle kann die Hypothese noch einmal klarer formuliert werden: Nicht flektierbare Lexeme werden zu einem Teil prädikativ verwendet (z.B. sehr, oft, nie), zum anderen als Satzwörter. Mit Satzwörtern werden innerhalb von Sätzen Feststel‐ lungen zu Sachverhalten gemacht. Eine zweite und geradezu idealtypische Gruppe von Satzwörtern sind die Satzad‐ verbien. Repräsentativ für sie sind Ausdrücke wie hoffentlich, zweifellos, natürlich, selbstverständlich, wahrscheinlich, vielleicht, angeblich, klugerweise oder bekanntlich. „Satzadverbien bringen die subjektive Einschätzung eines Sachverhalts durch den Sprecher zum Ausdruck; diese Einschätzung kann entweder den Realitätsgrad des Sachverhalts betreffen (kaum, wahrscheinlich, vermutlich, sicher) oder aber die emotio‐ nelle Einstellung des Sprechers ausdrücken (leider, hoffentlich) […].“31 Satzadverbien sind ‐ im Gegensatz zu echten Adverbien – meist nicht erfragbar. Man kann wahrscheinlich nicht fragen: Wirst du das natürlich noch einmal machen? Die meisten Satzadverbien sind nicht in Wunschsätzen oder Aufforderungssätzen zu verwenden. Nur wenige (wirklich, tatsächlich, bestimmt, möglicherweise) finden sich auch in Fragesätzen. Das liegt wohl daran, dass die mit ihnen festgestellten Qualitä‐ ten des Wissens (sicher, vermutlich, wahrscheinlich) ebenso wie Bewertungen (leider) nur im Hinblick auf für wahr gehaltene Sachverhalte sinnvoll sind. Damit sind Satzadverbien handlungstheoretisch relativ klar zu bestimmen. Mit Satz‐ adverbien werden satzintern bestimmte Feststellungen oder Einschätzungen mit Wahrheitsanspruch zum Ausdruck gebracht. Diese Feststellungen beziehen sich auf als wahr vorausgesetzte Sachverhalte. Bei einer Feststellung, verbunden mit den Satzwörtern natürlich und wieder wie in Der Club hat natürlich wieder nicht gewonnen. Thurmaier 1989, 15. 31 40 wird zuerst einmal festgestellt, dass „der Club“ nicht gewonnen hat. Zusätzlich wird mit wieder ausgedrückt, dass die gemachte Feststellung nicht zum ersten Mal zutrifft. Und mit natürlich wird auf regelhafte Weise ausgedrückt, dass die Wahrheit der ge‐ machten Feststellung niemanden überraschen kann, dass die Wahrheit dieser Fest‐ stellung vorhersehbar war. Deshalb wäre es widersinnig, anschließend zu sagen: Das ist sehr überraschend. So sind also Konjunktionen, Subjunktionen, Bindeadverbien und Satzadverbien pro‐ totypische Beispiele von Satzwörtern. Mit ihnen machen wir satzintern Feststellun‐ gen verschiedener Art über das in Sätzen Gesagte. Wir machen mit ihnen satzinterne Kommentare, die wir auch anschließend in expliziten Sätzen zum Ausdruck bringen könnten. Satzwörter sind also Formen komprimierten Sprechens und dienen offen‐ sichtlich der kommunikativen Effizienz. Gilt diese Charakterisierung analog auch für die verschiedenen Arten von Partikeln? Werden also auch mit Partikeln satzintern komprimierte Feststellungen gemacht? Nicht immer ist es einfach, Gradpartikel‐ und Modalpartikelfunktionen zu unter‐ scheiden. Gradpartikeln stehen normalerweise vor kontrastiv betonten Wörtern oder Phrasen, auf die sie sich beziehen. Mit ihnen werden quantifizierende Beziehungen ausgedrückt. Sie haben eine fokussierende Funktion. In der Regel steht die Gradpar‐ tikel unmittelbar vor demjenigen Satzteil, dem sie zugeordnet ist. Die Satzbetonung liegt auf der jeweiligen Zuordnungskonstituente. Auch mit Gradpartikeln werden sprachliche Handlungen gemacht. Es wird mit ihnen etwas bedeutet. Während man im Bereich konversationeller Implikaturen häu‐ fig die Möglichkeit zum Rückzug hat32, kann man sich hinsichtlich des mit Satzwör‐ tern zum Ausdruck Gebrachten hinterher nicht dumm stellen: Das gilt genauso bei Gradpartikeln. Eine der Verwendungen von nur als Gradpartikel besteht darin, eine Aussage als Einschränkung gegenüber einer Erwartung oder einer Möglichkeit zum Ausdruck zu bringen. Es ergibt einen Unterschied, ob eine Gradpartikel zum Satz hinzugesagt wird oder nicht: Kurt hat vier Punkte erreicht. ‐ Kurt hat nur vier Punkte erreicht. Hans hat die Prüfung bestanden. ‐ Auch (selbst) Hans hat die Prüfung bestanden. Vor kurzem lernten sie sich kennen. ‐ Erst vor kurzem lernten sie sich kennen. Zwar ändert sich der Wahrheitswert des Satzes durch das Hinzutreten der Partikel nicht. Aber es wird zusätzlich zum Satz noch etwas feststellend hinzugefügt. Wer in einem Laden auf eine Hose zeigt mit der Bemerkung „Die würde gut an dir aussehen!“ muss noch lange nicht zu der konversationellen Implikatur „Du solltest sie kaufen“ stehen. 32 41 Wer die Partikel nur in einem Satz verwendet wie Kurt hat nur vier Punkte erreicht. bringt damit wohl zum Ausdruck, dass das für ihn wenig ist im Vergleich zum Er‐ warteten. Somit bringt er mit nur eine bestimmte Einschätzung zum Ausdruck. Er kann anschließend wahrscheinlich nicht sinnvoll feststellen: Das ist mehr als zu erwar‐ ten war. Betrachten wir einige Gradpartikeln aus den obigen Beispielsätzen. In Klammern stehen Paraphrasen, die man nach der Verwendung der Gradpartikel nicht sinnvoll verneinen kann. Damit ist etwas von dem beschrieben, was man mit der Verwen‐ dung der Gradpartikel feststellt: Auch (selbst) Hans hat die Prüfung bestanden. (Andere haben die Prüfung bestanden. Hans ist nicht der Einzige, der bestanden hat.‐ Nicht möglich: Niemand anders hat die Prüfung bestanden. Hans ist der Einzige, der bestanden hat.) Sogar (selbst) Otto hat die Prüfung bestanden. (Otto ist nicht der einzige. Aber bei ihm war es vorher unsicher. Nicht möglich: Aber das konnte man ja erwarten.) Ausgerechnet Ida ist durchgefallen. (Das konnte man nicht erwarten. Nicht möglich: Das war von vorneherein klar.) Nur Hans ist durchgefallen. (Sonst keiner. Nicht möglich: Viele andere auch.) Erst vor kurzem lernten sie sich kennen. (Das war später als erwartbar. Nicht möglich: Das war früher als erwartet. Mit den oben angeführten Partikeln wird also ähnlich wie mit Satzadverbien satzin‐ tern eine Feststellung hinzugefügt, die man auch durch eine zusätzliche Prädikati‐ onshandlung in einem externen Satz machen könnte. Auch Gradpartikeln erweisen sich somit als hochkomprimierte Formen des sprachlichen Handelns. Wie bei anderen Satzwörtern wurde auch hinsichtlich Modalpartikeln lange Zeit diskutiert, ob sie überhaupt eigene Bedeutung haben. Vor allem seitens normativer Stilistiken wurden sie in völliger Verkennung der Tatsachen vielfach als „Flickwör‐ ter“33 oder als „Füllwörter“ abqualifiziert, auf die man im Sinne eines guten Stils bes‐ ser zu verzichten habe. Dabei wurde nicht erkannt, dass Modalpartikeln wie andere Satzwörter bedeutsam verwendet werden. Dies gilt heute in den zahlreichen Unter‐ suchungen zu Partikeln als Konsens. So werden Modalpartikeln als Ausdrücke cha‐ rakterisiert, mit denen Einstellungen oder Haltungen der Sprecher zum Gesagten zum Ausdruck gebracht werden. „Im Wesentlichen dienen Modalpartikeln dazu, ei‐ 33 Reiners 1944, 282f. 42 ne Äußerung in den Interaktionszusammenhang einzubinden. Mit ihnen kann auf den Gesprächspartnern gemeinsames Wissen verwiesen werden, auf Annahmen o‐ der Erwartungen von Sprecher oder Hörer, es kann ein bestimmter Bezug zu einer vorangegangenen Äußerung angezeigt werden, oder es kann der Stellenwert, den der Sprecher der Äußerung beimisst, gekennzeichnet werden.“34 Auch Partikeln sind also Satzwörter, mit denen satzintern Feststellungen über das in den Sätzen Gesagte gemacht werden. Viele Lexeme lassen sich sowohl als Modalpartikeln wie Gradpartikeln verwenden. Die Unterschiede der beiden Verwendungsweisen werden bei kontrastiver Gegen‐ überstellung deutlich: Gradpartikel Modalpartikel Schon für wenig Geld kann man heute zum Wer fliegt schon zum Ballermann! Ballermann fliegen. Auch die letzte Prüfung war nicht leicht. So schlimm war sie auch nicht. Deutsch ist auch schwer zu lernen. (Nicht nur Das liegt ja auch auf der Hand. Chinesisch.) Das hat etwa dreißig Euro gekostet. Hast du etwa deinen Geldbeutel verloren? Er sieht immer nur das Negative. Wieso nur habe ich das gesagt? Ungarisch ist schwierig, aber Deutsch ist auch Ich tu mich schwer mit Russisch. ‐ Das ist (ebenfalls) keine einfache Sprache. ja auch keine einfache Sprache. Eines der vielen Beispiele für die Polysemie von Partikeln ist aber. Es wird einerseits als Konjunktion verwendet, um einen Gegensatz anzuzeigen, andererseits als Mo‐ dalpartikel. In dieser Funktion tritt aber ausschließlich in Ausrufesätzen auf, ansons‐ ten hat es die Funktion einer Konjunktion. Du hast aber ein gutes Gedächtnis! Bist du aber schon groß! Durch den Gebrauch der Modalpartikel aber bringt der Sprecher seine Überra‐ schung zum Ausdruck, er bedeutet, dass der jeweilige Sachverhalt – zumindest in seinem Ausmaß ‐ für ihn unerwartet ist. Was man mit dem komprimierten aber be‐ Thurmaier 1989, 2. 34 43 deutet, könnte man in Bezug auf die obigen Beispiele explizit als Feststellung formu‐ lieren: Ich bin erstaunt, dass du ein so gutes Gedächtnis hast. Ich bin erstaunt, dass du schon so groß bist. Wer aber in diesem Sinn verwendet, kann demzufolge auf die Rückfrage Bist du darüber erstaunt? sinnvollerweise nicht mit nein antworten. Die Modalpartikel ja wird in Prädikationshandlungen mit deskriptiver, expressiver und appellativer Bewirkungsabsicht verwendet ‐ in behaupteten und exklamatori‐ schen Sätzen unbetont, in imperativischen betont: a) Damals war ich ja noch nicht einmal zwanzig Jahre alt. b) Sie haben ja ganz schön viel gearbeitet. c) Erna kann ja singen! d) Du bist ja ganz blass! e) Kommen sie ja nicht mehr hierher! f) Machen Sie ja ihre Arbeit gut! Würde etwa bei a) und b) das ja nicht hinzugefügt, würden mit den Sätzen ganz normale Feststellungen gemacht. Dabei geht der Sprecher nach dem Relevanzprinzip davon aus, dass der Partner das Festgestellte noch nicht weiß und dass ihm das hiermit mitgeteilt wird. Anders ist die Bewirkungsabsicht, wenn zusätzlich die Mo‐ dalpartikel ja hinzutritt. Zwar wird immer noch so etwas wie eine Feststellung ge‐ macht, aber es wird durch ja in Kurzform zusätzlich festgestellt, dass der Gesprächs‐ partner den festgestellten Sachverhalt schon kennt. Mit ja wird also so viel bedeutet wie mit wie du schon weißt … oder Du weißt ja schon, dass… oder Das brauche ich dir (ja) nicht extra zu sagen. So kann man sich im Hinblick auf den weiteren Gesprächsverlauf eines gemeinsamen Wissens versichern. Ein kurzes ja ersetzt also eine relativ kom‐ plizierte Feststellung. Eine zweite Verwendungsweise von ja erfolgt in emphatischen Aussagen wie c) und d). Hier drückt der Sprecher aus, dass er selbst die festgestellte Tatsache bisher nicht gekannt hat und von ihr überrascht ist. Man kann anschließend zwar sagen: Das hätte ich nicht gedacht. Aber nicht: Das habe ich schon lange gewusst. Mit der Verwendung von ja in Aufforderungssätzen wird die Dringlichkeit der Auf‐ forderung unterstrichen. Ja dient hier als illokutiver Indikator, mit dem eine Dro‐ hung oder Warnung angezeigt wird. Zusätzlich zur Aufforderung Kommen Sie nicht mehr hierher! wird so etwas festgestellt wie: 44 Andernfalls wird etwas für Sie Unangenehmes geschehen. (Warnung) oder Andernfalls werde ich dafür sorgen, dass etwas für Sie Unangenehmes geschieht. (Drohung) Auch bei der im Deutsche sehr häufig verwendeten Partikel doch lassen sich ver‐ schiedene Verwendungsweisen unterscheiden, z.B. die als ‐ Konjunktion: Sein Zustand hat sich stabilisiert. Doch er ist noch nicht aus dem Schlimmsten heraus. ‐ Bindeadverb: Sein Zustand hat sich stabilisiert, doch weiß man noch nichts Genaues. ‐ betonte Gliederungspartikel zur Zurückweisung einer verneinten Feststellung: Es ist doch so, wie ich gesagt habe. Als Modalpartikel wird doch manchmal ähnlich wie ja verwendet, um zu bedeuten, dass ein Sachverhalt dem Hörer bekannt ist oder dass er allgemein für wahr gehalten wird: Man kann doch dort nicht ohne Anzug auftauchen. Das geht doch nicht. Auch wird mit doch hinsichtlich der gemachten Feststellung ausgedrückt, dass das jeder wisse oder wissen solle: Das ist doch phantastisch! Im nächsten Beispiel wird durch doch dem Hörer bedeutet, dass eine Feststellung als Argument gültig ist aufgrund allgemein bekannter Tatsachen: Müller ist für diese Aufgabe nicht der richtige Mann. Er hat so etwas doch noch nie gemacht. Auch mit der Modalpartikel doch wird also satzintern in komprimierter Form eine Feststellung zu einem Satz hinzugefügt, die eine ausführlichere Hinzufügung in ei‐ nem weiteren Satz ersetzt. Partikeln werden also ebenso wie Konjunktionen, Sub‐ junktionen, Bindeadverbien oder Satzadverbien als Satzwörter verwendet. 45 Fazit und Ausblick Wir sind von einer gut begründeten Liste von Lexemarten ausgegangen und haben nach den mit ihnen möglichen Handlungen gefragt. Zum Teil quer zur morphologi‐ schen Unterscheidung in flektierbare und nicht flektierbare Lexeme stellten sich zwei grundsätzliche wahrheitsfunktionale Verwendungsweisen von Lexemen heraus: die prädikative Verwendung und die Verwendung als Satzwörter. Prädikatoren werden für Prädikationshandlungen verwendet, die Basishandlungen allen sprachlichen Handelns. Deren grammatische Form ist der Satz. Prototypisch sind Verben, Adjektive und Nomen. Prädikatoren werden unabhängig von wech‐ selnden Sprechakten entsprechend ihren Wahrheitsbedingungen verwendet. Mit nicht prädizierbaren Lexemen wie Konjunktionen oder Partikeln werden in Kurzform satzintern zusätzliche Feststellungen zu dem mit einem Satz Gesagten zum Ausdruck gebracht. Um sie von den nicht flektierbaren Lexemen zu unterschei‐ den, die prädikativ verwendet werden, habe ich für sie die Bezeichnung Satzwörter vorgeschlagen und ihre Verwendung exemplarisch beschrieben. Mit Satzwörtern werden Feststellungen etwa über den Zusammenhang von Sachverhalten ausge‐ drückt, aber auch Vorannahmen oder ein bestimmtes Hintergrundwissen, ebenso auch Wertungen oder emotionale Einstellungen zu dem mit dem zugehörigen Satz Gesagten. Vorläufig lässt sich ein großer Teil des lexematischen Inventars in einer offenen Liste funktional so unterscheiden:35 Prädikativ verwendet werden z.B. 35 ‐ Nomen, ‐ Adjektive, ‐ Verben, ‐ prädikatsbezogene Adverbien (rückwärts, abseits), ‐ bestimmte Gradadverbien (kaum, ein bisschen, sehr), ‐ bestimmte Präpositionen (auf, unter, neben, mit, ohne), ‐ Quantifizierende Artikel (jeder, mancher…), ‐ negierende Artikel (keine …), Funktional nicht unterschieden sind hier die Pronomina und Determinierer. Auch bei diesen Wort‐ klassen dürften sich wohl die beiden grundsätzlichen Verwendungsweisen zeigen: So sind etwa quan‐ tifizierende und negierende Artikel Kandidaten für prädikative Verwendung, definite und indefinite Determinierer werden wohl für metaprädikative Handlungen verwendet. Sie verweisen darauf, ob im Gesprächs‐ und Wissenskontext ein Gegenstand der Bezugnahme als neu oder bereits eingeführt gilt. (vgl. Kap. 4.) 46 ‐ possessive Artikel (mein, ihr). Als Satzwörter werden verwendet: ‐ Konjunktionen und Subjunktionen (aber, denn, doch deshalb; obwohl, weil, wenn, falls), ‐ Bindeadverbien (nämlich, mithin, immerhin, dennoch, allerdings, freilich …) ‐ Satzadverbien (vielleicht, wahrscheinlich, angeblich, bekanntlich, hoffentlich, er‐ staunlicherweise, natürlich), ‐ Gliederungspartikeln (nämlich, also, aber, doch); ‐ Fokuspartikeln bzw. Gradpartikeln (nur, bloß, allein, selbst, lediglich, auch, eben‐ so, sogar, gerade, eben), ‐ Modalpartikeln bzw. Abtönungspartikeln (aber, ja, auch, doch, wohl, halt, ja, bloß, etwa, eigentlich, wohl). Die obige Betrachtung der verschiedenen Satzwörter hat nicht das Ziel einer syste‐ matischen handlungstheoretischen Beschreibung. Schon gar nicht wird der An‐ spruch erhoben, die nahezu unüberschaubaren Befunde zur Partikelforschung an‐ gemessen zu repräsentieren. Das Ziel war trotz der gebotenen Kürze allein eine eini‐ germaßen plausible Darlegung der Funktionen von Satzwörtern im sprachlichen Handeln. Es zeigte sich, dass mit ihnen in komprimierter Form satzintern zusätzliche Feststellungen zu Sachverhalten gemacht werden. Immer werden mit Satzwörtern Feststellungen zu Behauptungen, Appellen, Versprechungen usw. hinzugefügt. Wie Prädikatoren werden auch Satzwörter wahrheitsfunktional verwendet. Man kann sie nicht verwenden und anschließend ihre Wahrheitsbedingungen widerrufen – ohne sich selbst zu widersprechen. Wenn wir einen Prädikator mit Wahrheitsan‐ spruch zusprechen, bringen wir zum Ausdruck, dass wir die Wahrheitsbedingungen für erfüllt halten. Wenn wir ein Satzwort zu einem Satz hinzufügen, machen wir in Kurzform eine Feststellung mit Wahrheitsanspruch zum Inhalt des Satzes. Wir kön‐ nen anschließend nicht ihre explizite Formulierung widerspruchsfrei verneinen. 47 Teil II: Sprachliche Bedeutungshandlungen 3. Die „unzähligen“ Verwendungen der Sprache ‐ Was sind Sprechakte? Der Paragraph 23 der „Philosophischen Untersuchungen“ dürfte zu den am häufigs‐ ten zitierten Bemerkungen Wittgensteins zählen. In ihm werden zwei Grundgedan‐ ken der Gebrauchstheorie thematisiert und miteinander verwoben. Zum einen wird auf den instrumentellen Charakter der Sprache abgehoben, indem im Unterschied zum Frühwerk auf die „Mannigfaltigkeit der Werkzeuge der Sprache und ihrer Ver‐ wendungsweisen“ hingewiesen wird: „Wie viele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? Es gibt unzählige verschiedene Arten der Verwen‐ dungen alles dessen, was wir „Zeichen“, „Worte“, „Sätze“ nennen.“ Als Beispiele für diese Verwendungen werden u.a. aufgezählt: „Befehlen und nach Befehlen handeln, Beschreiben eines Gegenstandes, Berichten, Vermutungen anstellen, Theater spielen, einen Witz machen, Bitten, Danken, Fluchen, Grüßen, Beten.“ Zum anderen bezeichnet Wittgenstein diese vielfältigen instrumentellen Verwen‐ dungen als „Sprachspiele“. Da er auch an anderen Stellen Sprache und Sprechen mit Spielen vergleicht, man denke nur an das Schachbeispiel, wird der Eindruck erweckt, die vielfältigen Verwendungen der Sprache seien wie Spiele, die nach Regeln gespielt werden. Damit wird die instrumentelle Auffassung der Sprache mit einer konventio‐ nalistischen verknüpft, so als wären Handlungen wie Bitten, Fragen oder Befehle Spielhandlungen. Die Sprechakttheorie ist dieser These vom Zusammenhang von Sprechakten und Re‐ geln gefolgt. Aber sind Sprechakte wirklich symbolische Handlungen wie Spielhand‐ lungen? Ich möchte in diesem Kapitel zeigen, dass sie es nicht sind. Aber was sind sie dann? 48 Sprechakte sind keine Sprachspiele Die handlungstheoretische Semantik lehnt aus zwingenden Gründen die Annahme der Vorstellungstheorie ab, dass sprachliche Kommunikation darin bestehe, mentale Inhalte zu übermitteln. Sie beschreibt vielmehr sprachliches Bedeutungshandeln, das mit dem Ziel gemacht wird, verstanden zu werden, um dadurch Wirkungen zu er‐ reichen. Von welcher Art sind nun sprachliche Handlungen? Sind sie im Sinne der im Vo‐ rausgehenden eingeführten Unterscheidungen symbolische, strategische oder gar in‐ strumentelle Handlungen? Auf den ersten Blick liegt es nahe, sie im Sinne von Witt‐ gensteins Sprachspielmetapher als symbolische Handlungen zu sehen, also als Handlungen, die wie Spielhandlungen auf der Grundlage gemeinsamer Regeln ge‐ macht und verstanden werden. Aber ein solcher generalisierender Blick reicht nicht aus. Man kann nicht allgemein über sprachliche oder gar über kommunikative Handlungen reden und gleichzeitig zu angemessenen Aussagen kommen. Allgemein über kommunikative Handlungen kann man eben nur allgemeine Aussagen machen, etwa, dass sie Handlungen sind, mit denen man etwas zu verstehen gibt. Und über sprachliche Handlungen allge‐ mein lässt sich nur sagen, dass sie kommunikative Handlungen sind, die durch sprachliche Äußerungen gemacht werden. Für eine angemessene Beschreibung sprachlichen Handelns muss man zuerst einmal zwischen den verschiedenen Arten sprachlicher Handlungen unterscheiden und deren strukturellen Zusammenhang be‐ trachten. Bei dieser Unterscheidung der verschiedenen sprachlichen Handlungen finden wir auf der obersten Ebene der Beschreibung die Sprechakte. Sprachliche Handlungen sind letztlich immer Sprechakte. Wann immer wir sprachlich kommunizieren, ma‐ chen wir Sprechakte. Aber wir machen sie nicht einfach als solche, sondern indem wir andere sprachliche Handlungen machen. In der überwältigenden Mehrzahl der Fälle werden Sprechakte durch Prädikationshandlungen über Gegenstände der Be‐ zugnahme gemacht, also durch die Handlungen der Referenz und der Prädikation. Wie die Termini Bezugnahme und Prädikation ist auch der Ausdruck Sprechakt alltags‐ sprachlich eher ungebräuchlich. Trotzdem gehören die konkreten Bezeichnungen für Sprechakte zum alltagssprachlichen Vokabular. Schon Grundschüler werden, wenn sie ihre ersten Aufsätze schreiben, dazu angehalten, statt des Verbs sagen genauere Bezeichnungen zu verwenden. Die Kinder sollen also beispielsweise nach Möglich‐ keit nicht schreiben: Die Lehrerin sagte: Hast Du das Lesebuch dabei?, sondern besser Die Lehrerin fragte: Hast du das Lesebuch dabei? 49 Solche Sprechaktverben wie feststellen, fragen oder bitten sind aussagekräftiger als das Verb sagen, weil durch sie ausgedrückt werden kann, welche Absichten der Spre‐ cher mit dem, was er sagt, verfolgt. Nicht nur für Kinder ist die Verwendung solcher Verben anspruchsvoll, denn es müssen dabei die nicht immer leicht unterscheidba‐ ren Absichten und Annahmen, die zu einem Sprechakt gehören, bedacht werden. Nicht zu den Sprechakten gehören die sprachlichen Handlungen, die in einer Wenn‐ dann‐Beschreibungskette links oder rechts von den Sprechaktbezeichnungen stehen. Das sind also die sprachlichen Handlungen, die wir ausführen, um dadurch Sprech‐ akte zu machen, in der Regel Bezugnahmen und Prädikationen. Ebenfalls nicht zu den Sprechakten gehören auch die sog. perlokutiven Handlungen, die sich auf die angestrebten Folgen von Sprechakten beziehen, wie etwa Überzeugen (mögliche Folge von Argumentieren) oder Besänftigen (als Folge z.B. von Versprechen). Sprechaktverben verwenden wir wie alle prädizierbaren Ausdrücke regelhaft. So wie ein Baum bestimmte Kriterien erfüllen muss, um als Lärche zu gelten, so muss ein Handeln bestimmte Kriterien erfüllen, damit wir es z.B. als Warnung oder Ratschlag bezeichnen können. In den Sechziger‐ und Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts beherrschte die Be‐ schäftigung mit dem Thema „Sprechakte“ einen beträchtlichen Teil des linguisti‐ schen und philosophischen Diskurses. Im Wesentlichen wurde die sprechakttheore‐ tische Arbeit darin gesehen, Bedingungen für das Zustandekommen von Sprechak‐ ten zu beschreiben. Dies geschah auf dem Hintergrund der Vermutung, Sprechakte seien symbolische Handlungen, die wie alle symbolischen Handlungen ihr Gelingen Regeln verdankten. Wie für Spielhandlungen seien auch für das Gelingen solcher Sprachspielhandlungen wie Loben, Warnen, Vorwerfen oder Versprechen Regeln konstitutiv. Die Sprechakttheorie wurde oft als konkrete Ausarbeitung von Wittgensteins Sprachspiel‐Konzept verstanden. Wittgenstein hatte ja in seiner späteren Philosophie auf die Vielfalt der sprachlichen Funktionen abgehoben und diese Vielfalt von Sprachspielen beispielhaft gezeigt. Die von ihm eingeführte Metapher Sprachspiele legte eine Analogie von Sprechakten und Spielen mit deren impliziten spielkonstitu‐ ierenden Regeln nahe. Jedenfalls dürfte Wittgensteins Wortwahl eine Rolle für eine konventionalistische Betrachtung von Sprechakten gespielt haben.36 Bevor wir uns zur Überprüfung dieser konventionalistischen Auffassung mit den Einzelheiten der Sprechakttheorie und der Frage, wie Sprechakte gemacht werden, 36 Wittgensteins Verwendung des Ausdrucks Sprachspiel ist durchaus unsystematisch. Aber bei den in Abschnitt 23 der Philosophischen Untersuchungen aufgeführten Beispielen handelt es sich vorwie‐ gend um Sprechakte. 50 genauer beschäftigen, können wir das grundsätzlich Unstrittige schon einmal vorab festhalten: Wenn wir sprachlich kommunizieren, machen wir Sprechakte. Sprechakte sind die intentionalen Sinneinheiten der sprachlichen Kommunikation. Einen Sprechakt zu machen heißt immer auch, eine Absicht zum Ausdruck zu bringen. Wer eine Frage stellt, will zu verstehen geben, dass er etwas nicht weiß, aber vom Partner wissen möchte. Grundsätzlich sollen mit Sprechakten Wirkungen erreicht werden. Der Fragende will ja nicht nur seine Absicht, etwas wissen zu wollen, zu verstehen geben, sondern auch erreichen, dass der Partner die gewünschte Informa‐ tion liefert. Voraussetzung dafür ist, dass der Partner diese Absicht erkennt, dass er die Äußerung im Sinne einer Frage versteht. Bei Sprechakten bringen wir also Ab‐ sichten zum Ausdruck, die verstanden bzw. erkannt werden müssen, damit die be‐ absichtigten Wirkungen durch das kooperative Zutun unserer Partner eintreten kön‐ nen. Nur wenn die Absicht des Sprechenden erfasst wird, kann das zur Verwirkli‐ chung der Bewirkungsabsichten führen. Hinsichtlich der Frage, ob Sprechakte wirklich von der Art symbolischer Handlun‐ gen sind, sind die Meinungen weniger einheitlich. Machen und verstehen wir Sprechakte wirklich auf der Grundlage gemeinsamer Regeln, wie Austin und Searle meinten? Oder kommen sie auf andere Weise zustande? Im Folgenden möchte ich zeigen, dass die erste Auffassung falsch ist und dass die zweite uns auf den richtigen Weg führt. Betrachten wir die prominenteste Version der Sprechakttheorie, die von John R. Se‐ arle. Er bestimmte Sprechakte bzw. die sog. illokutiven Akte wie Behaupten, Fragen, Befehlen usw. im Anschluss an Austin als Handlungen, die wir machen, indem wir auf etwas Bezug nehmen und darüber etwas prädizieren.37 Diese sogenannten propositionalen Akte wiederum machen wir, indem wir entsprechende Wörter, Morpheme oder Sätze äußern, also Äußerungsakte machen. Mit einem Beispiel zeigte Searle, dass ein und derselbe propositionale Akt verschie‐ dene Sprechakte ergeben kann. So sind die Bezugnahmen und Prädikationen in (1) – (4) identisch, während die damit gemachten Sprechakte ganz unterschiedlich sind: „1. Sam raucht gewohnheitsmäßig. 2. Raucht Sam gewohnheitsmäßig? 3. Sam, rauche gewohnheitsmäßig! 4. Würde Sam doch gewohnheitsmäßig rauchen!“38 Es ergibt sich die Frage, wodurch bei identischer Proposition unterschiedliche Sprechakte zustande kommen. Searle und andere nahmen an, dass die sogenannten 37 Searle 1971, 40. Searle 1971, 39. 38 51 propositionalen Akte ihre jeweilige „illokutive Kraft“ durch die Gültigkeit von Re‐ geln erhielten. Das ist zentrale Konventionalitätsthese der Sprechakttheorie. Es scheinen gute Gründe für die Annahme zu sprechen, Sprechakte seien symboli‐ sche Handlungen, kämen also auf der Grundlage gemeinsamer Regeln zustande. Da wir mit sprachlichen Handlungen unsere Ziele nur erreichen, wenn wir verstanden werden, erscheint es unter ökonomischen Aspekten erfolgversprechend, dass wir uns dabei auch auf konventionelle Vereinbarungen stützen. Schon Austin hatte zahl‐ reiche Beispiele angeführt, wonach durch die Äußerung einer bestimmten Formel unter bestimmten situativen Voraussetzungen konventionellerweise ein Sprechakt vollzogen wird. Typisch sind hierfür sogenannte deklarative Sprechakte wie Trauen, Eröffnen, Taufen und dergleichen. Die Äußerung einer Formel wie „Ich erkläre Sie hiermit vor dem Gesetz zu Mann und Frau“ gilt unter bestimmten Voraussetzungen per Konvention als Trauung, die Äußerung der Taufformel als Taufe, usw. Die Beispiele für derartige Regeln stammen aus institutionellen Bereichen, in denen bestimmte Vereinbarungen gelten, etwa bei Taufen, Heiratszeremonien, bei Ge‐ richtsurteilen, Ernennungen, oder sie betreffen besonders einfache sprachliche Hand‐ lungen wie Grüßen, bei denen im Unterschied zu den üblichen Sprechakten nicht re‐ feriert und prädiziert wird. Kennzeichnend für symbolische Handlungen wie Ernen‐ nen, Exkommunizieren, Trauen, Taufen oder die Olympiade Eröffnen ist, dass dabei von bestimmten befugten Personen in bestimmten Situationen durch eine bestimmte, oft formelhafte Äußerung ein bestimmter Teil der Wirklichkeit verändert wird. Die Funktion solcher deklarativen Sprechakte ist es, Übereinstimmung zwischen einer Absicht und der sozialen Wirklichkeit herbeizuführen. In gewisser Weise sind sie wie Zaubersprüche in Märchen. Während die Wirkung von Zaubersprüchen auf der Substitution physikalischer Kräfte durch magische beruht, funktionieren solche Sprechakte durch die Kraft sozialer Vereinbarungen. Die Annahme, wonach alle Sprechakte nach dem Muster der deklarativen durch die Gültigkeit von Konventionen zustande kämen, wurde allerdings schon früh als un‐ haltbar eingestuft: „Akte, die konventionellen Prozeduren angehören, … bilden ei‐ nen wichtigen Teil menschlicher Kommunikation. Doch bilden sie weder das Ganze noch, so können wir annehmen, den fundamentalen Teil. Es wäre falsch, sie als Mo‐ dell für das Verstehen des Begriffs der illokutionären Kraft im Allgemeinen zu‐ grundezulegen“.39 Das sprachliche Handeln im normalen Leben funktioniert nämlich Strawson 1974 (engl. 1964), S. 80. Strawson schlug stattdessen eine intentionale Erklärung vor: „Die illokutionäre Kraft einer Äußerung ist nämlich wesentlich etwas, dessen Verstehen beabsichtigt ist, und das Verstehen der Kraft einer Äußerung schließt in allen Fällen die Erkenntnis einer Absicht ein, die man allgemein als an eine Hörerschaft gerichtet bezeichnen könnte; es involviert auch die Er‐ kenntnis, dass diese Intention völlig offenkundig ist, also zu erkennen gegeben werden soll.“ (a.a.O.) 39 52 nicht nach dem Modell von Zaubersprüchen. Besondere Konventionen, wonach das Äußern bestimmter Sätze als Vollzug bestimmter Sprechakte zählt, lassen sich nur für den kleinen und nicht repräsentativen Teil der deklarativen Sprechakte feststel‐ len. Ungeachtet solcher Einwände legte sich Searle auf die konventionalistische Position fest, dass Sprechakte von der Art symbolischer Handlungen seien. In „Sprechakte“ formulierte er diese These programmatisch: „Die Hypothese dieses Buches ist also, dass eine Sprache sprechen eine regelgeleitete Form des Verhaltens darstellt. Um es deutlicher auszudrücken: Sprechen bedeutet, in Übereinstimmung mit Regeln Akte zu vollziehen.“40 Und: „Die semantische Struktur einer Sprache lässt sich als eine auf Konventionen beruhende Realisierung einer Serie von Gruppen zugrundeliegender konstitutiver Regeln begreifen; Sprechakte sind Akte, für die charakteristisch ist, dass sie dadurch vollzogen werden, dass in Übereinstimmung mit solchen Gruppen kon‐ stitutiver Regeln Ausdrücke geäußert werden.“41 Solche von ihm als konstitutiv be‐ zeichnete Regeln beschrieb Searle beispielhaft an einer Reihe von Sprechakten. Er be‐ stimmte lebenspraktische situative Bedingungen, deren Erfülltheit für den Vollzug eines Sprechaktes notwendig ist. Im Unterschied zu deklarativen Sprechakten gibt es dabei keine Festlegung auf bestimmte Formeln oder eine Begrenzung auf bestimmte Personen. Searles konstitutive Regeln sind durch Merkmale der jeweiligen interpersonalen Konstellation charakterisiert. Dazu gehören v.a. sprecherseitige Absichten und damit einhergehende Annahmen sowie damit verbundene Satzinhalte, die für das Zustan‐ dekommen eines bestimmten Sprechaktes notwendig sind. Für eine mit der Äuße‐ rung von Mach das Fenster zu! gemachte Aufforderung gelten nach Searle folgende Regeln: „Regeln des propositionalen Gehalts: Zukünftige Handlung A von H. Einleitungsregeln: 1. H ist in der Lage, A zu tun. S glaubt, dass H in der Lage ist, A zu tun. 2. Es ist sowohl für S als auch für H nicht offensichtlich, dass H bei normalem Ver‐ lauf der Ereignisse A aus eigenem Antrieb tun wird. Regeln der Aufrichtigkeit: S wünscht, dass H A tut. Wesentliche Regeln: Gilt als ein Versuch, H dazu zu bringen, A zu tun.“42 Searle 1971, 38. a.a.O., 59. 42 a.a.O., 100 40 41 53 Was Searle hier beschreibt, ist zweifellos konstitutiv für den Sprechakt des Auffor‐ derns. Aber handelt es sich bei dem Beschriebenen wirklich um Regeln? Hier werden ja vor allem Absichten, Wünsche oder Annahmen eines Sprechers bei einer Hand‐ lung des Aufforderns beschrieben. Die „Wesentliche Regel“ beispielsweise entpuppt sich wie die „Regel der Aufrichtigkeit“ als Beschreibung einer Bewirkungsabsicht: H will, dass S etwas Bestimmtes tut und er soll dazu gebracht werden, das zu tun. Die‐ se Bewirkungsabsicht ist mit Annahmen („Einleitungsregeln“: H kann das tun und er würde es nicht von sich aus tun) verbunden. Unklar bleibt also vorerst, wieso Searle diese sprechaktkonstituierenden Absichten, Wünsche und Annahmen als Regeln bezeichnet. Dagegen wird eine für Sprechakte weitere konstitutive Bedingung nicht recht klar: Die angestrebten Wirkungen können ja normalerweise nur eintreten, wenn der Partner versteht, was S bewirken will. Wenn S eine Aufforderung formuliert, dann hat er nicht nur den Wunsch, dass H etwas Bestimmtes tut, sondern er möchte auch, dass H seinen Wunsch, er möge et‐ was Bestimmtes tun, erkennt. Das Erkennen dieses Wunsches durch den Partner ist eine Voraussetzung, dass die mit dem Sprechakt angestrebte Wirkung eintreten kann. Deshalb gehört zu Sprechakten immer auch die Absicht, etwas zu verstehen zu geben. H soll dazu gebracht werden, zu verstehen, dass S will, dass er die Handlung A macht. H soll also verstehen, dass S eine bestimmte Bewirkungsabsicht verfolgt. Sprechakte werden gemacht, um Wirkungen zu erreichen. Dass ich einen Sprechakt mache, hat seinen Grund darin, dass ich beim Partner etwas bewirken will. Ich will z.B. erreichen, dass er etwas tut oder dass er über eine bestimmte Information ver‐ fügt. Appelle sollen andere zum Handeln bewegen, mit Feststellungen wollen wir bewirken, dass andere wissen, was wir für wahr halten oder sie dazu zu bringen, ebenfalls bestimmte Sätze für wahr zu halten. Wer fragt, will erreichen, dass der an‐ dere eine Auskunft gibt. Sprechakte sind also wesentlich definiert durch Bewir‐ kungsabsichten. Damit die erwünschten Wirkungen eintreten, muss H zum einen verstehen, dass S eine bestimmte Bewirkungsabsicht hat, zum anderen muss er bereit sein, diese Wirkung eintreten zu lassen, etwa dadurch, dass er die gewünschte Handlung macht oder dass er S glaubt usw. Somit gilt aus der Perspektive des Han‐ delnden für jeden Sprechakt: Ich will etwas bei dir bewirken (Bewirkungsabsicht). Das geht nur, wenn du mich entsprechend verstehst. Deshalb will ich zuerst einmal erreichen, dass du verstehst, was ich bewirken will (Verstehensziel)43. S gibt H zu verstehen, was er bewirken will. Er will dadurch erreichen, dass H das versteht. Die Ab‐ sicht, das Verstehen von H zu erreichen, nenne ich Verstehensziel. Logischerweise kann S nicht die Absicht haben, dass H versteht. Beabsichtigen kann man nur, was man selbst tun kann. Alternativ könnte man auch zwei Bewirkungsabsichten unterscheiden: 1. Bewirkungsabsicht: H soll verstehen, dass S eine bestimmte Bewirkungsabsicht hat. 2. Bewirkungsabsicht: S will bewirken, dass diese Wir‐ 43 54 Ein Problem bringt allerdings die unscharfe Verwendung des Wortes wollen mit sich: Es kann im Deutschen sowohl im Sinn von beabsichtigen wie im auch Sinn von wün‐ schen verwendet werden. Zwischen beiden besteht aber ein Unterschied. Wenn ich als Fernsehzuschauer sage: Ich will, dass Deutschland Weltmeister wird. dann ist das ein Wunsch, denn ich kann aktiv nichts tun, damit es so kommt. Wenn aber der Trainer dies sagt, kann es auch anders gemeint sein. Er übt ja mit seiner Mannschaft, er arbeitet auf ein Ziel hin. Und dieses Ziel kann sein, dass die Mann‐ schaft tatsächlich Weltmeister wird. Dann wird er den Satz nicht als bloß Wünschen‐ der, sondern als absichtsvoll Handelnder meinen, etwas so: Ich will (mit meiner Arbeit erreichen), dass Deutschland Weltmeister wird. oder Ich tue meine Arbeit mit dem Ziel, dass Deutschland Weltmeister wird. Bezogen auf Handlungen meint man mit wollen also, dass man beabsichtigt, durch eigenes Tun ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Die mögliche Doppeldeutigkeit von wollen kann man vermeiden, wenn man beabsichtigen oder wünschen verwendet. Das sieht bei den verschiedenen Arten von Handlungen dann so aus: Beim symbolischen Handeln: Mit dem Hochhalten der roten Karte beabsichtigt der Schiedsrichter, einen Platzverweis auszusprechen. (Das funktioniert in bestimmten Umgebungen per dort geltender Konvention.) Beim instrumentellen Handeln: Mit dem Drehen des Zündschlüssels beabsichtigt je‐ mand, den Motor zu starten. (Das funktioniert unter bestimmten Bedingungen durch physikalische Wirkungsgesetze.) Bei sozialen Handlungen: Mit dem Lärmen beabsichtigt jemand, den Nachbarn zu vertreiben. (Das funktioniert unter bestimmten Umständen dadurch, dass der andere weggeht, also vorhersehbar zweckrational handelt.) Auch Sprechakte werden gemacht, um Wirkungen bzw. Ziele zu erreichen. Wir ma‐ chen sie ja, weil wir uns das Eintreten der Effekte nicht nur wünschen, sondern es anstreben. Wer einen Sprechakt macht, ist nicht mehr ein passiv Wünschender, son‐ dern einer, der etwas tut, damit das Ziel erreicht wird. Sein sprachliches Handeln ist absichtsvoll. Wer auffordert: Mach das Fenster zu! meint nicht: Ich wünsche mir, dass du das Fenster zumachst (also nicht wie: Ich wünsche mir, dass es aufhört zu regnen). Wollen ist beim Handeln, auch beim sprach‐ kung auf der Grundlage des Verstehens von H eintritt. Ich unterscheide der Einfachheit halber zwi‐ schen Verstehensziel und Bewirkungsabsicht. 55 lichen, im Sinn von beabsichtigen zu verstehen. Statt bezogen auf eine Aufforderung zu sagen: Ich will, dass du das Fenster zumachst. könnte man klarer sagen: Ich will mit dem, was ich sage, erreichen, dass du das Fenster zumachst. oder: Ich beabsichtige mit dem, was ich sage, dich zu veranlassen, das Fenster zuzumachen. Im Hinblick auf eine Feststellung zu sagen: Ich will, dass du das weißt. heißt im Sinne intentionalen Handelns genaugenommen: Ich will durch das, was ich sage, bewirken, dass du das weißt. oder: Ich beabsichtige durch das, was ich sage, zu bewirken, dass du das weißt. Man kann in diesem intentionalen Sinn die Searle’schen Bedingungen bezogen auf das Beispiel des Aufforderns übersichtlicher formulieren: Auffordern heißt, dem Partner zu bedeuten: Ich beabsichtige zu erreichen, dass du etwas Bestimmtes tust. Bei einer Aufforderung gelten entsprechend folgende konstitutiven Bedingungen: a) Ziele und Absichten: S beabsichtigt, H dazu zu bringen, zu verstehen, dass S ihm bedeutet: Ich be‐ absichtige mit dem, was ich sage, zu bewirken, dass du das, was ich sage, tust oder nicht tust. (Verstehensziel) S beabsichtigt zu bewirken, dass H als Folge seines Verstehens etwas Be‐ stimmtes tut oder nicht tut. (Bewirkungsabsicht) b) Annahmen: Partnereinschätzung: S nimmt an, dass H in der Lage ist, die Handlung A zu machen. S nimmt an, dass H die Handlung A noch nicht ausgeführt hat. S nimmt an, dass H die Handlung nicht ohne Verstehen der Äußerung von S ausführen würde. Selbsteinschätzung: S nimmt an, dass er H gegenüber zu Aufforderungen (Befehlen) berechtigt ist. Sprechakte haben also immer zwei Ziele: Eine Wirkung hervorzurufen, z.B. dass das Gegenüber etwas tut (Bewirkungsabsicht). Und dazu muss erreicht werden, dass das Gegenüber versteht, dass diese Wirkung angestrebt wird (Verstehensziel). Ohne das Erreichen des Verstehens bliebe die Aufforderung nur ein monologischer Auf‐ forderungsversuch. 56 Damit zeigt sich eine Eigenschaft sprachlicher Kommunikation, die vor allem H. P. Grice herausgestellt hat: Sprechakte dienen dazu, bestimmte Zwecke zu erreichen. Und man kann diese Zwecke erreichen, indem man zu verstehen gibt, dass man sie anstrebt. Wenn der Partner versteht, welche Ziele man anstrebt und kooperativ ist, kann das funktionieren.44 Wenn wir die verschiedenen Grundtypen von Sprechakten betrachten, so erkennen wir für jeden grundlegende Verstehensziele und Bewirkungsabsichten: 1. Appellative oder direktive Sprechakte (z.B. Bitten, Beantragen, Empfehlen, Bestellen, Warnen, Befehlen, Fragen, Abraten usw.): Einen appellativen Sprechakt machen heißt: S bedeutet dem H: Ich beabsich‐ tige mit dem, was ich sage, zu bewirken, dass du das, was ich sage, tust oder nicht tust. Verstehensziel: S beabsichtigt, H dazu zu bringen, zu verstehen, dass S ihm bedeutet: Ich beabsichtige mit dem, was ich sage, zu bewirken, dass du das, was ich sage, tust oder nicht tust. Bewirkungsabsicht: S beabsichtig zu bewirken, dass H als Folge seines Ver‐ stehens etwas Bestimmtes tut oder nicht tut. Welcher appellative Sprechakt genau gemacht wird, hängt von den jeweili‐ gen Annahmen (Selbst‐ und Fremdeinschätzungen) ab. 2. Expressive Sprechakte (z.B. Danken, Begrüßen, Klagen usw.): Einen expressiven Sprechakt machen heißt: S bedeutet dem H: Ich beabsichti‐ ge mit dem, was ich sage, zu bewirken, dass du weißt, wie ich mich fühle. Verstehensziel: S beabsichtigt H dazu bringen, zu verstehen, dass S ihm be‐ deutet: Ich beabsichtige mit dem, was ich sage, zu bewirken, dass du weißt, wie ich mich fühle. Bewirkungsabsicht: S beabsichtig zu bewirken, dass H als Folge seines Ver‐ stehens weiß, wie S sich fühlt. Welcher expressive Sprechakt genau gemacht wird, hängt von den jeweiligen Annahmen (Selbst‐ und Fremdeinschätzungen) ab. 3. Deskriptive oder assertive Sprechakte (z.B. Behaupten, Mitteilen, Berichten, Klassifizieren, Bestreiten, Melden, Beschuldigen usw.): Einen deskriptiven Sprechakt machen heißt: S bedeutet dem H: Ich beabsich‐ tige mit dem, was ich sage, zu bewirken, dass du weißt, was ich für wahr hal‐ te. (Oft auch noch: … und dass du das auch für wahr hältst.) Verstehensziel: S beabsichtigt H dazu bringen, zu verstehen, dass S ihm be‐ Aber ganz so einfach – ohne Konventionen ‐ geht’s dann doch nicht. Vgl. unten in diesem Kapitel den Abschnitt „Intentionen und Regeln“. 44 57 deutet: Ich beabsichtige mit dem, was ich sage, zu bewirken dass du weißt, was ich für wahr halte. (Oft auch noch: … und dass du das auch für wahr hältst.) Bewirkungsabsicht: S beabsichtigt zu bewirken, dass H als Folge seines Ver‐ stehens weiß, was S für wahr hält (oft auch noch: … und dass er das Gesagte selbst auch für wahr hält.)45 Welcher deskriptive Sprechakt genau gemacht wird, hängt von den jeweili‐ gen Annahmen (Selbst‐ und Fremdeinschätzungen) ab. 4. Kommissive Sprechakte (z.B. Versprechen, Vereinbaren, Anbieten, Drohen, Geloben, Garantieren usw.): Einen kommissiven Sprechakt machen heißt: S bedeutet dem H: Ich beabsich‐ tige mit dem, was ich sage, zu bewirken, dass du für wahr hältst: Ich werde in bestimmter Weise handeln. Verstehensziel: S beabsichtigt, H dazu zu bringen, zu verstehen, dass S ihm bedeutet: Ich beabsichtige mit dem, was ich sage, zu bewirken, dass du für wahr hältst: Ich werde in bestimmter Weise handeln. Bewirkungsabsicht: S will bewirken: H hält als Folge seines Verstehens für wahr, dass S in bestimmter Weise handeln wird. Welcher kommissive Sprechakt genau gemacht wird, hängt von den jeweili‐ gen Annahmen (Selbst‐ und Fremdeinschätzungen) ab. Mit den oben beschriebenen primären Bewirkungsabsichten können noch weiterge‐ hende Bewirkungsabsichten verbunden sein: Wenn S etwas verspricht, soll H zuerst einmal für wahr halten, dass S etwas Bestimmtes im Interesse von H Liegendes tun wird. Dadurch sollen eventuell weitere Wirkungen erreicht werden. So soll H auf der Grundlage dieses Wissens oder Glaubens z.B. abwarten, nicht gleich mit Sanktionen reagieren etc. Wenn S etwas behauptet, möchte er zumindest bewirken, dass H weiß, dass er etwas für wahr hält. Vielleicht beabsichtigt er auch zu bewirken, dass H das ebenfalls glaubt und mit diesem Wissen etwas Bestimmtes tut (‐ aber darüber hat er keine Macht). Vielleicht strebt er auch das Ziel an, dass H nun auf der Grundlage dieses Wissens mehr Handlungsmöglichkeiten hat oder in einer bestimmten Weise handelt. Natürlich können die weitergehenden Wirkungen faktisch auch ganz andere sein als die von S beabsichtigten. Und ebenso können Wirkungen eintreten, an die S gar nicht denkt oder die er sich gar nicht vorstellen kann. Kommen wir zurück zu der Frage, ob die Konventionalitätsthese der Sprechakttheo‐ rie zutrifft. An dem oben beschriebenen Beispiel des Aufforderns und an den ande‐ 45 Zum Unterschied der bei deskriptiven Sprechakten mögliche Bewirkungsabsichten vgl. Kap. 3. 58 ren Beispielen sieht man: Die von Searle aufgeführten und von mir reformulierten Bedingungen sind offensichtlich wirklich konstitutiv für Aufforderungen. Wenn S bei einer Aufforderung nicht will bzw. nicht bedeuten will, H möge etwas Bestimm‐ tes tun, kann man auch nicht von einer Aufforderung sprechen. Und ebenso ist die Aufforderung nicht ernsthaft zu machen, wenn S nicht bestimmte Einschätzungen im Hinblick auf H hat. Wenn er etwa annähme, H habe die Handlung schon gemacht oder sei gar nicht in der Lage, sie zu machen, kann er ihn nicht wirklich aufrichtig auffordern. Wenn wir Sprechakte handlungstheoretisch betrachten, wird jedoch schnell klar, dass die Konventionalitätsthese nicht zutreffen kann. Gehen wir einmal davon aus, dass es so etwas wie propositionale Akte tatsächlich gäbe46, dann ließe sich ausge‐ hend von Austin und in Übereinstimmung mit Searles Darstellung sprecherseitig der Zusammenhang zwischen dem propositionalen und dem illokutiven Akt in einfa‐ cher Form so beschreiben: propositionaler Akt Aufforderung Bedingungen: S will a) und nimmt b) an Es sind also sprecherseitige Absichten und Annahmen, wie sie oben jeweils unter a) und b) beschrieben sind, die den sogenannten propositionalen Akt zu einem be‐ stimmten Sprechakt werden lassen, und diese Absichten müssen vom Gesprächs‐ partner erfasst werden. Um den illokutiven Sinn zu verstehen, den ein propositiona‐ ler Akt haben soll, genügt es, die Absicht des Sprechers zu verstehen. Eine Handlung z.B. als Frage zu verstehen heißt, bei einer Äußerung von S entspre‐ chende Bewirkungsabsichten und Verstehensziele zu erkennen oder anzunehmen: S möchte, dass H ihm eine Information gibt und er möchte, dass H versteht, dass er das will. Das setzt voraus, dass S ein bestimmtes Wissen nicht besitzt, und geht mit der Annahme einher, dass er eine Antwort auf seine Frage für möglich hält und dass H die Antwort kennt oder kennen könnte und bereit ist, sie ihm zu geben usw. Und nur wenn H diese Absichten unter Berücksichtigung der damit verbundenen An‐ nahmen für plausibel hält, versteht er die Äußerung als eine Handlung, die er gege‐ benenfalls metasprachlich mit dem Prädikator „fragen“ beschreiben könnte. 46 Es könnte sie nur dann geben, wenn es Prädikationshandlungen getrennt von Bewirkungsabsichten gäbe. Aber Prädikationshandlungen dienen ja gerade dazu, solche Bewirkungsabsichten auszudrü‐ cken. Vgl. dazu unten den Abschnitt „Absicht vs. Bedeutung“. 59 Es ist also auszuschließen, dass Sprechakte symbolische Handlungen sind, die wie Spielhandlungen durch die Gültigkeit von Regeln zustande kommen. Searle hat selbst gezeigt, dass es Absichten und Annahmen sind, welche den sogenannten propositionalen Akten ihre illokutive Kraft verleihen. Er hat Absichten und damit verbundene Annahmen des Sprechers über sich selbst und den Partner beschrieben. Nur wenn diese Annahmen und Absichten sprecherseitig vorliegen, kann man von Behauptungen, Aufforderungen oder Fragen sprechen. Es gehört demnach zu den Wahrheitsbedingungen des Verbs auffordern, dass der Sprechende bestimmte Absich‐ ten hat und bestimmte Annahmen macht. Sonst wäre die Bezeichnung auffordern für sein Handeln nicht zutreffend. Searle hat also tatsächlich Regeln beschrieben, aber sie sind – entgegen seiner Interpretation ‐ ganz eindeutig nichts anderes als die Prädika‐ tionsregeln von Sprechaktverben. Somit hat Searle durch die Bestimmung der Wahrheitsbedingungen von Sprechakt‐ verben beschrieben, wann wir ein bestimmtes sprachliches Handeln als einen Sprechakt wie Auffordern, Fragen oder Feststellen interpretieren können. Das ist dann der Fall, wenn bestimmte redebegleitende Absichten und Annahmen vorliegen. Genau diese Absichten und Annahmen sind es, die aus propositionalen Akten Sprechakte machen und nicht irgendwelche Konventionen. Entgegen seiner Selbstin‐ terpretation hat Searle also nicht gezeigt, dass Sprechakte durch Regeln zustande kommen, sondern er hat lediglich Regeln für Wörter beschrieben, mit denen wir Sprechakte, die durch Absichten und Annahmen zustande kommen, bezeichnen oder unterscheiden. Jemand macht Sprechakte, wenn er Prädikationshandlungen über Gegenstände der Bezugnahme mit bestimmten Absichten und damit verbunde‐ nen Annahmen macht. Solche Absichten hat er oder er hat sie nicht. Mit Regeln hat das nichts zu tun. Searle hat selbst mehrfach darauf hingewiesen, dass jede Formulierung konstitutiver Regeln definitorischen oder tautologischen Charakter trage47. Damit hat er seine Be‐ schreibungen bereits als Beschreibungen der impliziten Wahrheitsbedingungen von Sprechaktverben charakterisiert. Logischerweise müssen bestimmte Bedingungen er‐ füllt sein, damit wir sagen können, etwas sei eine Frage, eine Bitte usw. In demselben Sinne gibt es Wahrheitsbedingungen für alle Prädikatoren. Aus der Tatsache, dass das Ereignis vor meinem Fenster die konventionellen Bedingungen für das Zuspre‐ chen des Prädikators „Gewitter“ erfüllt, wird man aber nicht die Schlussfolgerung ziehen können, dieses Gewitter sei aufgrund einer konventionellen Vereinbarung zu‐ stande gekommen. Und aus der Tatsache, dass der Ausdruck Autofahren konventio‐ 47 a.a.O., 55: Konstitutive Regeln „sind ihrem Wesen nach fast tautologisch … Dass solche Aussagen sich als tautologisch auffassen lassen, ist ein Anhaltspunkt dafür, dass die betreffende Regel konstitu‐ tiver Art ist.“ 60 nell verwendet wird, wird niemand den Fehlschluss ableiten, dass die instrumentelle Handlung des Autofahrens durch die Gültigkeit von Regeln zustande komme. Ent‐ sprechendes gilt auch für Sprechakte. Das Reden über sie mit konventionellen Aus‐ drücken macht ihr faktisches Zustandekommen – aufgrund von Absichten und An‐ nahmen ‐ nicht im Geringsten zu einer Sache von Konventionen.48 Dass mit Bezug‐ nahmen und Prädikationen gleichzeitig auch Feststellungen oder Appelle gemacht werden können, liegt nicht an Regeln, sondern an den redebegleitenden Absichten und damit verbundenen Annahmen. Mit Sprechaktverben können wir unsere sprachlichen Handlungen auf der obersten Ebene der Beschreibung unterscheiden. Für unser Verstehen sprachlicher Handlun‐ gen ist allerdings eine solche metasprachliche Typisierung meist gar nicht nötig. Wie wir leicht an uns selbst beobachten können, aktivieren wir für unser Verstehen nur selten Sprechaktverben. Wir sichern unser Verstehen nur sehr selten durch Gedan‐ ken folgender Art: „Das ist jetzt eine Empfehlung. Das ist als Ratschlag gemeint. Das ist eine Warnung.“ Es fiele uns wahrscheinlich sogar ausgesprochen schwer, die Un‐ terschiede zwischen solchen Sprechakten zu beschreiben. Auch wenn wir unsere ei‐ gene aktive Redepraxis betrachten, werden wir feststellen, dass wir uns nur sehr sel‐ ten durch Benutzung von Handlungsverben allgemein oder von Sprechaktverben im Besonderen bewusstmachen, was wir oder andere tun. Natürlich können wir mit verba dicendi metasprachlich über das reden, was wir sprachlich machen, vorausge‐ setzt, es gäbe für alle Sprechakte entsprechende Verben oder Bezeichnungen. Aber solche metasprachliche Explikationen machen wir meist nur, wenn wir Missver‐ ständnisse aufklären wollen, etwa nach dem Art: „Ich habe das doch nur als Rat ge‐ meint, nicht als Aufforderung.“ In den allermeisten Fällen besteht unser sprachliches Handeln darin, dass wir über Gegenstände der Bezugnahme prädizieren. Dies machen wir aber nicht als Bürger von Platons Reich der Ideen in Form propositionaler Akte, sondern immer mit hö‐ rerbezogenen Absichten. Und deshalb sind diese Referenz‐ und Prädikationsakte immer gleichzeitig schon Sprechakte wie Behaupten, Fragen, Befehlen etc. Sprechak‐ te sind nichts anderes als Prädikationshandlungen – unterschieden nach Bewir‐ kungsabsichten. Umgekehrt heißt einen Sprechakt zu machen, eine Bewirkungsab‐ sicht zu verstehen zu geben. Dies gelingt meist nicht ohne propositionale Differen‐ 48 Damit gilt Strawsons Kritik an Austin auch im Hinblick auf Searles Konventionalitätsthese: „Zwei‐ tens müssen wir die Tatsache als irrelevant verwerfen, dass man mit Recht sagen kann, es sei eine Sa‐ che der Konvention, dass man zum Beispiel einen Akt des Warnens korrekterweise so bezeichnet. Denn würde man dies als Grund dafür anerkennen, illokutionäre Akte als konventionell zu bezeich‐ nen, wäre jeder korrekt beschriebene Akt, den man überhaupt korrekt beschreiben kann, ein konven‐ tioneller Akt.ʺ (Strawson 1974, 60.) Man könnte hinzufügen: Dann wäre alles Beschreibbare ein Ergeb‐ nis von Konventionen. 61 zierung bzw. ohne Prädikationshandlung. Wenn S eine appellative Intention hat, z.B. wenn er H um etwas bittet, so muss er ihm natürlich auch verdeutlichen, worum er ihn bittet. Das wird in der Mehrzahl der Fälle nicht ohne die Nennung der ge‐ wünschten Handlung gehen. Dieselbe Handlungsbezeichnung kann auch Bestandteil eines propositionalen Aktes sein, der mit kommissiver Intention gemacht wird. Es gehört einfach zur Absicht bei einem Versprechen, auch zu sagen, was man tun wer‐ de. Man kann im Prinzip gar nichts versprechen, ohne die Handlungsabsicht im Me‐ dium eines Satzes zu formulieren. Wie schon angesprochen, kann ‐ in der Terminologie von Philosophen ‐ ein und der‐ selbe propositionale Akt Kern unterschiedlicher Sprechakte sein. Entscheidend für die illokutionäre Kraft ist die Intention, mit der der propositionale Akt verbunden ist. Betrachten wir die Feststellung Unsere Mannschaft hat gewonnen. Hier wird über den mit der Nominalphrase in einem bestimmten Kontext identifi‐ zierten Gegenstand behauptend prädiziert, wenn - S voraussetzt, dass H nicht weiß, dass der gemeinte Sachverhalt wahr ist; - S selbst seine Aussage für wahr hält; - S (zumindest) beabsichtigt, zu bewirken, dass H erkennt, dass er das Gesagte für wahr hält. Der mit diesem Satz gemachte propositionale Akt erfolgt im lebenspraktischen Kon‐ text dieser Absichten und Annahmen und kann deshalb als Behauptung bezeichnet werden. Entsprechend erfolgt bei Hat unsere Mannschaft gewonnen? über den mit der Nominalphrase unsere Mannschaft identifizierten Gegenstand eine fragende Prädikation, wenn sie unter den Intentionen und Annahmen, die eine Frage kennzeichnen, gemacht wird. Entsprechend kann man für natürliche Sprachen all‐ gemein zwischen appellativ, kommissiv, deskriptiv oder deklarativ intendierten Prädikationen unterscheiden. Dass man eine in einem Satz gemachte Prädikation als Frage oder Bitte bezeichnen kann, liegt an Absichten und Annahmen, die diese Prä‐ dikation bestimmen. Dann sind auch die Wahrheitsbedingungen für fragen, verspre‐ chen, feststellen usw. erfüllt. Die große Vielfalt der Sprechakte ergibt sich aus der großen Vielfalt der intentionalen Kontexte von Referenz‐ und Prädikationsakten und nicht durch konventionelle Ver‐ einbarungen. Deshalb geht Wittgensteins ohnehin unscharfe Sprachspielmetapher 62 in Bezug auf Sprechakte, auch auf die von ihm selbst genannten49, ins Leere. Die „unzähligen“ Arten der Verwendung sprachlicher Ausdrücke haben nichts von Spielhandlungen, sondern sie beruhen auf der Vielfalt kommunikativer Absichten. Allenfalls bestimmte deklarative Sprechakte wie Segnen oder Freisprechen können als symbolische Spielhandlungen angesehen werden. Wenn im Folgenden das Wort Sprechakt verwendet wird, ist damit also keine symbo‐ lische Handlung (bzw. ein symbolisches Handlungsmuster) gemeint. Wenn gesagt wird, jemand behaupte etwas, dann heißt das nur, dass die Sprecherintention und die damit verbundenen Annahmen von der Art sind, dass seinem sprachlichen Han‐ deln der Prädikator behaupten mit Wahrheit zugesprochen werden kann. Das heißt, dass der Betreffende das, was er sagt, mit bestimmten für Behauptungen konstituti‐ ven Annahmen und Absichten verbindet. Wittgenstein 1953, 23. Die Bezeichnung „Sprachspiele“ ist zwar nicht im Zusammenhang mit Sprechakten verwendbar, wohl aber in Bezug auf Prädikationshandlungen. Vgl. Kap. 4. 49 63 Sprechakte und Regeln: Illokutive Indikatoren Wenn ich einen Sprechakt mache, habe ich einen Grund dazu. Ich will etwas beim Partner bewirken. Ich will z.B., dass er etwas tut oder dass er etwas weiß. Somit sind Sprechakte Mittel, um etwas zu verstehen zu geben und dadurch etwas zu erreichen, im Allgemeinen soziale Folgen wie Handlungen der Partner oder oft auch ein be‐ stimmtes Wissen des anderen. Einen Sprechakt zu machen heißt in der Terminologie der Sprechakttheorie, einen „propositionalen Akt“ mit bestimmten Absichten zu machen. Solche propositionalen Akte bestehen aus Referenzakten und Prädikationen, also aus Prädikationshandlun‐ gen über Gegenstände der Bezugnahme. Prädikationshandlungen sind wegen der mit ihnen verbundenen Bewirkungsabsichten immer gleichzeitig Sprechakte. Propo‐ sitionale Akte als reine und absichtsfreie Prädikationshandlungen sind lediglich theo‐ retische Konstrukte zu bestimmten Zwecken. Man darf davon ausgehen, dass noch nie ein Mensch einen propositionalen Akt gemacht hat, der nicht dem Ausdruck ei‐ ner bestimmten Bewirkungsabsicht diente. Ich werde, um Probleme im Zusammen‐ hang mit dem Ausdruck Proposition zu vermeiden, im Folgenden der Einfachheit halber von Prädikationshandlungen sprechen. Damit sind immer Prädikationshand‐ lungen über Gegenstände der Bezugnahme gemeint. Wenn wir Prädikationshand‐ lungen machen, dann machen wir de facto gleichzeitig Sprechakte. Diese ergeben sich durch die begleitenden Absichten und Annahmen. Man kann aber genauso sa‐ gen: Die Prädikationshandlungen stehen im Dienste dieser Absichten. Das eine geht nicht ohne das andere. Bewirkungsabsichten sind gleichsam die intentionalen Vor‐ zeichen von Prädikationshandlungen. Bei Sprechakten will man dem Partner zu ver‐ stehen geben, was man bei ihm bewirken will. Und der Sprechakt gelingt, wenn der Partner versteht, dass ihm diese Absicht zu verstehen gegeben wird. Erst dann kön‐ nen die angestrebten Wirkungen eintreten. Bei appellativen Sprechakten will S bewirken, dass sein Partner H etwas Bestimmtes tut. Und H soll verstehen, dass S das bewirken will. Bei kommissiven Sprechakten verpflichtet sich S, selbst etwas Bestimmtes zu tun. Und er will mit dem, was er sagt, erreichen, dass H versteht, dass er das zu tun beabsichtigt. Bei deskriptiven Sprech‐ akten will S zum Ausdruck bringen, dass er etwas Bestimmtes für wahr hält. Und er will bewirken, dass H versteht, dass er das tut. 50 Nur durch das hörerseitige Erken‐ nen dieser Absichten kommt der Sprechakt zustande. Nur dann kann S sagen „Ich habe S gewarnt.“, und nicht nur: „Ich wollte S warnen, aber er hat mich nicht ver‐ 50 Dieses „Bestimmte“ kann nur durch Prädikationshandlungen in der Form grammatischer Sätze dif‐ ferenziert zum Ausdruck gebracht werden. Im Unterschied zu den mit ihnen gemachten Sprechakten sind Prädikationshandlungen symbolische Handlungen, vgl. nachfolgend Kap. 4. 64 standen.“ Nur dann können angestrebte und weitergehende „perlokutionäre“ Folgen bei H oder durch das Handeln von H eintreten. Nur wenn H versteht, dass S ihn da‐ vor warnt, etwas Bestimmtes zu tun, kann als nichtkausale Folge z.B. eintreten, dass H die Handlung unterlässt. Nur wenn H versteht, dass S etwas für wahr hält – es demnach behauptet ‐, kann er daraus weitergehende Schlüsse für sein eigenes Han‐ deln ziehen. Die Bewirkungsabsichten sind immer mit bestimmten Selbst‐ und Partnereinschät‐ zungen verbunden. Bei Fragen können sie beispielsweise folgendermaßen beschrie‐ ben werden: a) Annahmen: S nimmt an, dass er etwas Bestimmtes nicht weiß. S hält es für möglich (wahrscheinlich, sicher) dass H die gewünschte Information hat. S nimmt an, das H willens und in der Lage ist, ihm die gewünschte Information zu geben. b) Absichten: S will: H soll verstehen, dass S ihm bedeutet: Ich will, dass du mir die fehlende Infor‐ mation gibst. (Verstehensziel) S will: H gibt ihm als Folge seines Verstehens die gewünschte Information. (Bewir‐ kungsabsicht.) Nur wenn H erfasst, was S von ihm will, ist das kommunikative Primärziel Verste‐ hen bzw. Verstandenwerden (Verstehensziel) erreicht und es besteht die Möglich‐ keit, dass die Bewirkungsabsicht, dass H die Information liefert, auch tatsächlich er‐ reicht wird. Aus der Sicht des Handelnden gehören zwei Absichten zu Sprechakten: „Ich will, dass du …“ und „Ich will, dass du verstehst, dass ich will, dass du …“. Damit der Sprechakt kommunikativ erfolgreich ist bzw. gelingt, sollte der Partner sagen kön‐ nen: „Ich verstehe, dass du willst, dass ich …“ oder „Ich verstehe, dass du bei mir bewirken willst, dass ich….“ Der Hörer muss also verstehen, welche Bewirkungsab‐ sicht S hat und zu verstehen geben will. Wie aber kann man Absichten erkennen? Muss man über hellseherische Fähigkeiten verfügen? Auch wenn man annähme, dass Absichten etwas im Inneren der Men‐ schen sind, bliebe einem nur, nach äußeren Kriterien für sie zu suchen. Oft kann man Absichten aus dem anschließenden, vor allem aber aus dem begleitenden Verhalten des Sprechenden erschließen. Nonverbale und v.a. paraverbale Mittel wie Prosodie, Intonation, Stimmlage, Stimmfärbung, Tempo, Rhythmus, Akzent, Intensität, Ton‐ höhe, Lautstärke bieten natürliche und konventionelle Hinweise. 65 Auch vieles andere spielt eine Rolle. Am wichtigsten beim Erschließen der Absichten ist das Wissen der Partner übereinander: Wie stehen wir zueinander? Was hat der andere bisher gemacht? Ist er auf meiner Seite? Ist das ein Rat oder will er mich rein‐ legen? Aber ein ständiger Zwang zum Nachdenken und Schlussfolgern macht das kommu‐ nikative Geschäft nicht nur mühsam, sondern auch unsicher. Weil es so wichtig ist, dass die Absichten schnell, einigermaßen sicher und möglichst unkompliziert erfasst werden, liegt es nahe, konventionelle Mittel einzusetzen, um zu bedeuten, welche Ziele man verfolgt. Diese konventionellen Mittel werden in der Sprechakttheorie als illokutive Indikatoren bezeichnet. Die kommunikative Funktion illokutiver Indikatoren lässt sich mit einem kleinen Gedankenexperiment illustrieren: Was wäre, wenn Prädikationshandlungen immer nur in ein und derselben grammatischen Form und immer nur mit derselben ‐ sozu‐ sagen neutralen ‐ Betonung gemacht werden könnten, wenn also in Searles o.g. Bei‐ spiel immer nur gleichtönend so formuliert werden könnte: Sam rauchen. Es wäre wohl schon schwierig, die Prädikationshandlung in dieser Einheitsform in‐ tentional überhaupt unterschiedlich zu meinen. Noch schwieriger wäre es wohl, hö‐ rerseitig herauszufinden, ob sie mit den Absichten einer Feststellung, Frage, Auffor‐ derung oder eines Wunsches gemacht ist. Unsere sprachlichen Kommunikationsver‐ suche wären mühselige Unternehmungen, wenn Prädikationshandlungen nicht we‐ nigstens ansatzweise konventionelle Formen hätten, welche die Bewirkungsabsich‐ ten erkennbar werden lassen. Im Hinblick auf die Frage nach der Konventionalität von Sprechakten bedeutet das: Regeln, die Sprechakte konstituieren, sind zwar ein Mythos. Aber dennoch spielen Regeln bei Sprechakten eine Rolle – auch wenn diese nicht konstitutiv ist. Denn Prädikationshandlungen werden in konventionellen For‐ men und in Verbindung mit konventionell gebrauchten Ausdrücken gemacht, durch welche die mit ihnen verbundenen Absichten zum Ausdruck gebracht werden sol‐ len. Und teilweise sind diese Formen und Ausdrücke obligatorisch. Als IFIDs – illocutionary force indicators – gelten neben den performativen Formeln vor allem grammatische Satzformen und Intonation. Daneben werden auch be‐ stimmte Verbformen (Imperativ, Konjunktiv I und II, Futur II), Satzadverbien wie vielleicht, möglicherweise, sicherlich und Modalverben wie müssen, dürfen, können als wichtig angesehen. Häufig werden Indikatoren miteinander kombiniert. In der mündlichen Kommunikation greifen wir außerdem neben Varianten der Intonation auch auf ein erhebliches nonverbales Inventar von Gesten und Mimik zur Inten‐ tionsübermittlung zurück. Von manchen Anthropologen wird es teilweise bis auf die 66 mimetische Kommunikation früher menschheitsgeschichtlicher Epochen zurückge‐ führt.51 In der schriftlichen Kommunikation steht das gestisch–mimetische und in‐ tonatorische Arsenal nicht zur Verfügung, dafür werden als rudimentäre Substitute Satzzeichen verwendet. Weil es für den kommunikativen Erfolg zentral ist, dass die Bewirkungsabsicht er‐ kannt wird, sind in allen Sprachen konventionelle Mittel entwickelt worden, mit de‐ nen Absichten bei Feststellungen, Fragen oder Aufforderungen zu verstehen gegeben werden. In vielen Sprachen sind noch genauere Indikatoren verbindlich. Wenn die Bewirkungsabsicht durch die Satzform angezeigt wird, wird im Allgemeinen von Behauptungssätzen, Fragesätzen oder Aufforderungssätzen gesprochen. Im Deut‐ schen werden die unterschiedlichen Absichten v.a. durch die Satzgliedfolge ausge‐ drückt, im Türkischen (wie auch im Lateinischen) durch entsprechende Verbformen oder Fragepartikel. Die unterschiedlichen grammatischen Satzarten sind auch mit bestimmten Intonationen verbunden. Im Deutschen ist die Fragesatzintonation sogar ohne die Fragesatzform wirksam. Behauptungssätze werden als Fragen verstanden, wenn die Intonation am Ende nach oben geht. In manchen südostasiatischen Spra‐ chen geht die Fragesatzintonation am Satzende nach unten. Das kann zu interkultu‐ rellen Missverständnissen führen, wenn Asiaten englisch sprechen und dabei die ihnen vertraute Fragesatzintonation beibehalten. Illokutive Indikatoren sind in ihrer Funktion nicht immer richtig gedeutet worden. Das größte Missverständnis bestand darin, ihnen illokutionäre Kraft zuzuschreiben, also die Funktion, Prädikationshandlungen zu Sprechakten zu machen. Einfache Bei‐ spiele scheinen durchaus nahezulegen, dass bestimmte Eigenschaften von Sätzen, etwa die Satzform, konventionell festlegen, welcher Sprechakt damit vollzogen wird. So scheint die Fragesatzform zu bestimmen, dass mit einer Äußerung eine Frage ge‐ macht wird. Immer wieder hat man deshalb – häufig unter der Überschrift „Gram‐ matik und sprachliches Handeln“ – nach systematischen Zusammenhängen zwi‐ schen Satzformen und Sprechakten gesucht. Genauere Untersuchungen zum Ver‐ hältnis von Satzform und Sprechakten zeigen aber, dass solche Zusammenhänge nicht bestehen. „Entgegen aller scheinbaren Plausibilität führt die Annahme deter‐ ministischer Bezüge zwischen Satztypen und Sprechakt‐Typen früher oder später zu absurden Konsequenzen.“52 Eine solche Annahme stellt die Verhältnisse sogar gera‐ dezu auf den Kopf. Illokutive Indikatoren sollen ja Absichten zum Ausdruck brin‐ gen. Nur wenn ich zu verstehen geben will, dass ich etwas wissen will, wähle ich die 51 vgl. Donald 2008. 52 Liedtke 1998, 9. 67 Fragesatzform – wenn überhaupt. Jedenfalls kann die Fragesatzform nicht Absichten erzeugen, sondern sie lediglich anzeigen. Die Satzform ist zudem indikatorisch nicht besonders zuverlässig. Sie zeigt meist nicht genau an, welchen Sprechakt man macht, sondern schränkt nur die Menge der infrage kommenden Sprechakte ein und bietet insoweit nur eine grobe Verstehens‐ hilfe. Ein Aufforderungssatz wie Geh weg! ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit appellativ gemeint, aber er kann als Bitte, Auf‐ forderung, Befehl, Warnung oder Ratschlag usw. gemeint sein. Immerhin sind de‐ skriptive Intentionen hier unwahrscheinlich. Die Fragesatzform allerdings dürfte zu‐ erst einmal wirklich exklusiv für Fragen reserviert sein. Der Zusammenhang zwischen Satzform und illokutiver Intention lockert sich bei den sogenannten indirekten Sprechakten noch weiter. So können als deskriptiv indizierte Äußerungen ihrer Intention nach appellativ oder kommissiv sein. So wird bei der Äußerung von Das Medikament X hilft gegen Schlaflosigkeit. zunächst einmal durch die Satzform eine feststellende Absicht angezeigt: S will zu verstehen geben, dass er diese Aussage für wahr hält. Darüber hinaus kann aber je nach Kontext diese Feststellung auch als Ratschlag oder Empfehlung und auch noch anders intendiert sein. In ähnlicher Weise kann die Behauptung Das war die letzte Zigarette meines Lebens. je nach den Umständen auch ein Versprechen oder ein Schwur oder anderes sein. Satzformen bieten also erste Orientierungshilfen, nicht mehr. In keinem Fall aber haben die Satzform oder irgendein anderer Indikator „illokutio‐ näre Kraft“ oder bestimmen diese. Will man überhaupt metaphorisch von illokutio‐ närer Kraft reden, dann besteht diese immer und ausschließlich in den Sprecherin‐ tentionen und den sprecherseitigen Annahmen, die der Partner vor dem Hinter‐ grund der Situation und der gemeinsamen Vorgeschichte für sein Verstehen berück‐ sichtigen muss. Die „illokutionäre Kraft“ besteht darin, dass Prädikationshandlun‐ gen mit bestimmten Bewirkungsabsichten gemacht werden, sodass ein Indikator auf‐ richtig verwendet werden kann. „Die Tatsache, dass ein geäußerter Satz bestimmte Indikatoren enthält, ist nicht die Ursache dafür, dass der Äußerung eine bestimmte illokutionäre Kraft zukommt. Eine solche Behauptung resultiert aus dem gleichen Fehlschluss wie die Auffassung, ein Hinweisschild in einer Stadt mit der Aufschrift 68 „Amphitheater“ sei die Ursache dafür, dass das Amphitheater tatsächlich in der an‐ gewiesenen Richtung steht.“53 Auch wenn die Satzform und andere Anzeigemittel in vielen Fällen hilfreiche Hin‐ weise geben, gibt es meist keine eineindeutigen Korrelationen von Indikatoren und Absichten. Obwohl also mit illokutiven Indikatoren Absichten auf regelhafte Weise angezeigt werden, bleibt dieses indikatorische Unternehmen oft vage. Eine solche konventionelle Unterbestimmtheit ist keine Spezialität von illokutiven Indikatoren, sondern sie ist tendenziell allen regelhaften Ausdrucksmitteln natürlicher Sprachen eigen. Sie zeigt sich z.B. in Fällen von lexikalischer Mehrdeutigkeit, bei strukturellen grammatischen Mehrdeutigkeiten oder bei deiktischen Ausdrücken. Obwohl es Re‐ geln gibt, muss in solchen Fällen auf der Basis des Kooperationsprinzips durch Re‐ kurs auf Kontext‐ und Weltwissen „pragmatisch“ erschlossen werden, was der Spre‐ cher genau meint. Eine wichtige Rolle für das Erschließen der Bewirkungsabsicht spielt natürlich auch der Inhalt des Gesagten. Sätze ohne entsprechende Handlungs‐ verben können nur schwer Aufforderungen oder Versprechungen sein. Und genauso wichtig ist das Wissen der Partner, wie sie zueinander stehen. Wenn ein Kind zu ei‐ nem Erwachsenen sagt Komm! dann ist das normalerweise kein Befehl, sondern eine Bitte. In jedem Fall können bei Unklarheiten metasprachliche Explikationen erfolgen: Das ist eine Aufforderung oder Ich will, dass du das machst. Mit illokutiven Indikatoren wird also auf regelhafte Weise angedeutet, mit welcher Bewirkungsabsicht und mit welchen damit verbundenen Annahmen eine Prädikati‐ onshandlung gemacht wird. Der Sprecher bedeutet also seinen Partnern durch die Verwendung illokutiver Indikatoren, dass er bestimmte Ziele hat, die mit bestimm‐ ten Annahmen verbunden sind. Und der Hörer benutzt diese Indikatoren als kon‐ ventionelle Verstehenshinweise. So wird beispielsweise mit der Fragesatzform aus‐ gedrückt, dass man von bestimmten Annahmen ausgeht und bestimmte Absichten verfolgt. Wer also die Frage Hat Bayern gestern das Spiel gewonnen? in der Fragesatzform und der entsprechenden Betonung stellt, kann anschließend nicht sinnvoll widerrufen, was er damit zum Ausdruck gebracht hat. Es wäre ein Widerspruch, zum Antwortenden anschließend zu sagen: Das weiß ich doch längst selbst. oder 53 Liedtke 1998, 14. 69 Das will ich doch gar nicht wissen. Mit illokutiven Indikatoren kommen wir unseren Gesprächspartnern also den halben Verstehensweg mit konventionellen Mitteln entgegen. Wegen der relativen Unterbe‐ stimmtheit dieser Anzeigemittel müssen sie den Rest aber „konversationell“ er‐ schließen. Was alles zu den illokutiven Indikatoren gezählt werden soll, ist nicht völlig klar. Manchmal werden auch bestimmte Modalpartikeln (modale Satzadverbien) dazuge‐ zählt wie gewiss, wirklich, tatsächlich, zweifellos, wahrscheinlich, vermutlich, vielleicht, möglicherweise, sicherlich, angeblich, offenbar, in der Tat, anscheinend, selbstverständlich. Diese Satzadverbien werden fast ausschließlich bei deskriptiven Sprechakten ver‐ wendet und mit ihnen wird in gewisser Weise die für Behauptungen konstitutive Absicht modifiziert, dass H wissen soll, dass er seine Behauptung für wahr hält. Mit solchen Satzadverbien wird also ebenfalls auf regelhafte Weise etwas zum Ausdruck gebracht. Entsprechend gibt S bei Barça hat wahrscheinlich gewonnen. mit wahrscheinlich zu verstehen, dass die Annahme, die normalerweise beim Behaup‐ ten gilt (S hält den Satz für wahr), hier nur abgeschwächt zutrifft. Mit wahrscheinlich gibt S auf konventionelle Weise in etwa zu verstehen: Ich glaube, dass die Feststellung wahr ist, aber die Möglichkeit, dass sie falsch ist, kann ich nicht vollständig ausschließen. Deshalb kann er anschließend weder sinnvoll sagen: Ich glaube nicht, dass Barça nicht gewonnen hat. noch Ich bin mir sicher, dass Barça gewonnen hat. Entsprechendes gilt für zweifellos, offenbar, angeblich, vielleicht usw. Auch mit diesen Ausdrücken wird auf regelhafte Weise etwas zu verstehen gegeben, und es wäre wi‐ dersprüchlich, das Ausgedrückte anschließend zu bestreiten. Allerdings ist fraglich, ob solche modalen Satzadverbien wirklich als illokutive Indikatoren angesehen wer‐ den dürfen. Jedenfalls haben wir für Handlungen, die durch Verwendung solcher Satzadverbien wie zweifellos oder selbstverständlich gemacht werden, im Deutschen keine spezifischen Sprechaktverben. Illokutive Indikatoren sind eine Teilmenge aller Ausdrücke und Ausdrucksmittel, mit denen konventionell etwas angezeigt oder zum Ausdruck gebracht wird. Mit ihnen wird so etwas wie ein zusätzlicher Kommentar zum „Gesagten“ zu verstehen gegeben. Als illokutive Indikatoren können aber nur die Ausdrucksmittel gelten, mit denen sprechaktkonstituierende Bewirkungsabsichten angezeigt werden. Vielleicht 70 werden wir sogar nur diejenigen als illokutive Indikatoren anerkennen, für die wir entsprechende Sprachaktverben oder Handlungsbeschreibungen haben. Auch mit der Satzadverbien wie leider, überraschenderweise, klugerweise, natürlich gibt man etwas zu verstehen. Aber eine Bewirkungsabsicht wird dadurch wohl nicht zum Ausdruck gebracht. Eher wird zum Gesagten in Kurzform ein zusätzlicher Kommen‐ tar abgegeben, etwa mit natürlich in dem Sinn von: Das war zu erwarten. Dagegen kann der Verbalmodus als illokutiver Indikator interpretiert werden, mit dem eine Bewirkungsabsicht konventionell ausgedrückt wird. Vergleichen wir die Funktion der indikativischen und konjunktivischen Verbform in folgenden beiden Sätzen. Griechenland ist zahlungsunfähig. Griechenland sei zahlungsunfähig. Durch die Verwendung der indikativischen Verbform (mit behauptender Intonation bzw. ohne Fragezeichen) bringt der Sprechende sozusagen metaprädikativ zum Ausdruck, dass seine Prädikation von ist zahlungsunfähig mit Wahrheitsanspruch er‐ folgt. Er kann anschließend nicht sinnvoll sagen: „Das glaube ich nicht“. Mit der Verwendung der Indikativform zeigt er also an, dass er den Satz als Behauptung ver‐ standen haben will. Mit der Verwendung von Konjunktiv I gibt er hingegen auf regelhafte Weise zu ver‐ stehen, dass er lediglich die Feststellung eines anderen wiedergeben und zum Wahr‐ heitsgehalt der Behauptung nicht selbst Stellung nehmen will. Auch hier kann der Sprecher hinterher nicht sinnvoll widerrufen, was er damit zu verstehen gegeben hat, dass nämlich ein anderer diese Feststellung gemacht hat. Konjunktiv I ist ein il‐ lokutiver Indikator, weil damit eine Bewirkungsabsicht ausgedrückt wird und weil damit der Sprechakt der Redewiedergabe angezeigt wird. Ähnlich sieht es bei Konjunktiv II als Anzeigemittel für nur vorgestellte oder potenti‐ elle Wahrheit aus. Andererseits könnten auch Futur I und II illokutive Indikatoren sein. Mit Spanien wird (wohl) zahlungsunfähig sein. und Spanien wird zahlungsunfähig geworden sein. gibt S zu verstehen, dass er die Wahrheit des Satzes im Sinne einer Vermutung für wahrscheinlich hält. Ist Vermuten ein Sprechakt? An dieser Stelle ist jedenfalls festzuhalten, dass es indikatorische Ausdrücke und Ausdrucksformen gibt, mit denen auf regelhafte Weise etwas zu verstehen gegeben 71 wird. Illokutive Indikatoren gehören dazu– auch wenn im Einzelnen strittig bleiben mag, was zur Teilmenge der illokutiven Indikatoren gezählt werden soll. Die Regeln des Gebrauchs indikatorischer Ausdrücke müssen jedenfalls gelernt werden. Zwar gibt es keine einfachen Wahrheitsbedingungen für die Fragesatzform oder für zwei‐ fellos, offenbar, bitte oder die Imperativform des Verbs. Aber die Regeln für solche in‐ dikatorischen Ausdrucksformen können so ähnlich wie die für Prädikatoren gelernt werden. Ihre regelhafte Anwendung beruht ja auf dem Vorliegen bestimmter Ab‐ sichten, Annahmen oder Einstellungen. Nur wer die eine Frage bestimmenden Ab‐ sichten hat, kann die entsprechenden indikatorischen Mittel – hier die Fragesatzform – wahrhaftig anwenden. Wir lernen Prädikationsregeln wie die von rot an Beispielen wahren Zusprechens, die Bedingungen für die Verwendung indikatorischer Mittel an wahrhaftigen Beispielen ihrer Anwendung. Indikatorische Mittel für Sprechakte lassen sich nur wahrhaftig verwenden, wenn entsprechende Absichten und Annah‐ men vorliegen. Wer eine Frage anzeigt, obwohl er die Antwort schon kennt, begeht eine Täuschung – es sei denn, er spielt Lehrer. Und entsprechend sagt jemand die Unwahrheit, wenn er eine Feststellung mit angeblich kommentiert, aber nicht für wahr hält, dass jemand diese Feststellung gemacht hat. 72 Sprechakte und konversationelles Erschließen Die Sprachspielmetapher war im Hinblick auf Sprechakte irreführend. Dass Prädika‐ tionshandlungen durch Konventionen zu illokutiven Akten würden, hat sich als My‐ thos erwiesen. Und ebenso ist es ein Mythos, dass irgendwelche Ausdrücke oder Ausdrucksweisen eine illokutionäre Kraft besitzen. Einen Sprechakt zu machen heißt, in der Form von Sätzen differenzierte Absichten zum Ausdruck zu bringen. Diese Absichten können mit nicht immer zuverlässigen oder eindeutigen konventio‐ nellen Mitteln angezeigt werden. Häufig ist deshalb das Erfassen von Absichten eine Angelegenheit konversationellen Erschließens. Das zeigt sich besonders bei den so‐ genannten indirekten Sprechakten, für die konventionelle Anzeigen fehlen, wo also die sinnbestimmenden Absichten des Sprechenden lediglich aus dem Kontext er‐ schlossen werden können. So gibt S mit Hast du deine Medikamente genommen? zu verstehen, was er von H wissen möchte. Über die angezeigte Frageintention hin‐ aus kann er aber auch zusätzlich ein erinnerndes Auffordern beabsichtigen. Mit der Feststellung Das Fenster ist offen. will S wahrscheinlich nicht nur bewirken, dass H erfährt, dass S das weiß. Es könnte zusätzlich und gleichzeitig noch eine Aufforderung sein, das Fernster zu schließen oder hinauszuspringen. Und die Behauptung Schwimmen hilft gegen Muskelverspannung. kann unter Umständen auch eine Empfehlung oder ein Ratschlag sein. Eine knappe handlungstheoretische Beschreibung sieht hier etwa folgendermaßen aus (PH = Prädikationshandlung): PH Behaupten Ratschlag geben wenn Bedingungen wenn Bedingungen für „Behaupten“ für „Ratschlag geben“ erfüllt sind erfüllt sind In der Wenn‐dann‐Kette treffen in einem solchen Beispiel mehrere Beschreibungen zu. Der direkte Sprechakt ist derjenige, dessen Intention mehr oder weniger klar an‐ gezeigt sein kann, hier das Behaupten. Für den indirekten Sprechakt sind zusätzlich ebenfalls die „konstitutiven“ Bedingungen erfüllt. Aber die ihn bestimmende Inten‐ tion wird nicht mit konventionellen Mitteln verdeutlicht. H hat einiges zu tun, diese weitergehende Absicht zu erschließen – und zu entscheiden, ob sie überhaupt vor‐ 73 liegt. Im obigen Beispiel wird lediglich indiziert, dass die Prädikationshandlung mit behauptender Absicht gemacht wird. Das heißt z.B.: S nimmt an, dass seine Feststellung p wahr ist; S nimmt an, dass für H die Wahrheit der Feststellung p nicht offensichtlich ist; S will, dass H glaubt, dass p oder dass H zumindest erfährt, dass S p für wahr hält. Normalerweise wird S seine Feststellung über das Schwimmen nicht ohne Grund machen. Vielleicht hat H über seine Muskelverspannungen in der Schulter geklagt. S darf annehmen, dass H daran interessiert ist, seine Schmerzen loszuwerden. Im Sin‐ ne der Konversationsmaximen wird S wohl nicht nur eine Feststellung machen wol‐ len. Er könnte sie auch als Ratschlag meinen, wenn er annimmt, ‐ dass H ein bestimmtes Ziel oder Interesse hat (hier: die Schmerzen loszuwerden); ‐ dass H dieses Ziel noch nicht erreicht hat; ‐ dass H nicht weiß, mit welcher Handlungsweise er dieses Ziel erreichen kann; ‐ dass die genannte Handlungsweise gut ist in Bezug auf H’s Ziel; ‐ dass H die genannte Handlung ausführen kann. Zudem will S bewirken ‐ dass H glaubt, dass p oder zumindest erfährt, dass S p für wahr hält (dass Schwimmen zum Erreichen des Zieles führen kann); ‐ dass H seinen Zustand verbessert. H versteht, dass S nicht nur etwas behauptet, sondern ihm einen Ratschlag geben will, wenn er erfasst, dass S ihm zu verstehen geben will, dass die genannte Hand‐ lungsweise (Schwimmen) seinem Ziel, gesund zu werden, dienlich sein könnte. Es ist wohl kein Zufall, dass H. P. Grice sein Konzept der konversationellen Implika‐ turen in Logic and Conversation am Beispiel indirekter Sprechakte vorgestellt hat. Denn hier ist eine Äußerung konventionell unterbestimmt, insofern die weiterge‐ hende Bewirkungsabsicht (also der indirekte Sprechakt) nicht nur – wie bei Sprech‐ akten üblich – nicht ganz eindeutig, sondern überhaupt nicht angezeigt wird. Des‐ halb muss H allein aus seinem Kontext‐ und Hintergrundwissen erschließen, was S ihm z.B. mit seiner Feststellung zusätzlich zu verstehen geben will. Eine konversationelle Implikatur liegt nach Grice vor, wenn der Hörer sich beim Versuch, eine Äußerung zu verstehen, vor die Frage gestellt sieht: „Wie kann der Umstand, dass er sagt, was er sagt, mit der Annahme in Einklang gebracht werden, dass er das umfassende KP [Kooperationsprinzip, J.H.] beachtet?“54 Um das, was S gemeint haben könnte, herauszufinden, muss H Überlegungen anstellen, bei denen er unter der Annahme, dass S das KP beachtet, über die konventionelle Bedeutung Grice, H.P. Logik und Konversation (Logic and Conversation), in: Meggle (Hrsg.) 1979, 254 f. 54 74 der verwendeten Ausdrücke hinaus sein Wissen über den Kontext der Äußerung und anderes Hintergrundwissen einbezieht.55 Bei indirekten Sprechakten müssen die wesentlichen Bewirkungsabsichten als Impli‐ katuren erschlossen werden. Denn die Absichten, die S konventionell andeutet, erge‐ ben offensichtlich noch keinen ausreichenden Sinn. Da Regeln hier nicht mehr helfen, muss v.a. auf Kontextwissen und Weltwissen zurückgegriffen werden. Das Verste‐ hen bleibt oft vage. Ob S mit der Feststellung Mir ist übel. wirklich noch mehr will, als H genau diese Information zu geben, ist unsicher. Jeden‐ falls kann sich S häufig darauf zurückziehen, nicht mehr gemeint zu haben, als er ge‐ sagt hat, oder etwas anderes gemeint zu haben, als H vermutet. Vielleicht will S wirklich nur feststellen, dass ihm übel ist, und H die Möglichkeit geben, zu tun, was dieser für richtig hält, ohne selbst eine Idee zu haben. Die Ermittlung konversationel‐ ler Implikaturen ist ein unsicheres und manchmal riskantes Geschäft. Ehe‐ und Ge‐ sprächstherapeuten können ein Lied davon singen. Wie unsicher das kooperative Erschließungsgeschäft sein kann, zeigt sich auch an Grice’ klassischem Beispiel von dem Mann, der bei seinem Auto steht: „A steht vor einem Auto, das sich offensichtlich nicht mehr von der Stelle rührt; B kommt hinzu, und folgender Dialog findet statt: A: »Ich habe kein Benzin mehr. « (“I am out of petrol.”) B: »Um die Ecke ist eine Werkstatt. « (“There is a garage round the corner.”)56 An diesem Beispiel zeigen sich exemplarisch die Schwierigkeiten bei der Erschlie‐ ßung verstehensnotwendiger Implikaturen. Was hat A gemeint? Wie hat B ihn ver‐ standen (, wenn er antwortet, wie er antwortet)? Wie könnte A die Äußerung von B verstehen? Liegt hier eine gelungene sprachliche Kommunikation vor oder das Bei‐ spiel einer typischen Verwirrung? Wahrscheinlich will A, dass B seine Absicht erfasst und anschließend etwas tut, was A will. Sowohl A als auch B gehen wechselseitig davon aus, dass sie sich an das KP halten. Aus der Äußerung von A kann B im Kontext der Szene schließen, dass das Auto steht, weil das Benzin aufgebraucht ist. Mit der Aussagesatzform bringt A eine bestimmte Bewirkungsabsicht zum Aus‐ druck. A will erreichen, dass B glaubt, dass A kein Benzin mehr hat, oder A will zu‐ mindest, dass B erfährt, A glaube, kein Benzin mehr zu haben. A’s Äußerung wäre 55 a.a.O., 255. Die deutsche Übersetzung von Kemmerling ist auch an dieser Stelle etwas unglücklich. Denn Werk‐ statt schafft weitere Verstehensprobleme. Die mögliche und plausible Übersetzung mit Tankstelle er‐ leichtert jedenfalls die Durchsichtigkeit und entspräche wohl eher der Maxime der Klarheit. 56 75 wahrscheinlich nicht relevant, wenn er B nicht noch etwas anderes zu verstehen ge‐ ben wollte. Welche weitergehende Intention hat er, wenn er eine hat? Man könnte sich nun die verrücktesten Vorgeschichten und Kontexte ausdenken, innerhalb derer die Feststellung von A allerhand Zusätzliches sein könnte, falls A und B sich schon vorher gesehen haben oder schon länger kennen. Aber A und B sehen sich vermut‐ lich zum ersten Mal. B nimmt nun offensichtlich an: A beabsichtigt weiterzufahren. Dazu braucht er Benzin. A weiß nicht, wo er Benzin bekommen kann (bzw. wo eine Tankstelle ist). A will aber erfahren, woher er Benzin bekommen kann. A nimmt an, dass B möglicherweise weiß, was A wissen will. A nimmt an, dass B bereit ist, ihm die erwünschte Auskunft zu geben. B rekonstruiert also die nach seiner Einschätzung der Situation wahrscheinlichste Bewirkungsabsicht, er interpretiert die Äußerung in dem Sinn, dass A wissen möch‐ te, wo er Benzin bekommen könnte. Vielleicht ist das wirklich die Absicht von A, vielleicht auch nicht, vielleicht weiß A selbst nicht einmal, was er mit seiner Feststel‐ lung außerdem noch wollte. Sollte A humpeln oder eine offensichtliche Verletzung haben, könnte er seine Feststellung auch als Bitte an B gemeint haben, dass dieser ihm Benzin besorgen solle. Alle möglichen Umstände sind zu berücksichtigen, wenn ohne ausreichende konventionelle Hilfen herausgefunden werden soll, was bzw. welche Bewirkungsabsicht A zu verstehen geben möchte. Angesichts dessen ergibt sich eine interessante Pointe. Die zentrale Konventionali‐ tätsthese der Sprechakttheorie hat sich zwar als Mythos erwiesen. Aber sobald man sie in die konversationelle Erklärung integriert, kann sie ihre Trümpfe ausspielen. Ganz offensichtlich müssen beim obigen Beispiel die Bewirkungsabsichten als kon‐ versationelle Implikaturen erschlossen werden. Dazu müssen vom Gesprächspartner die von der Sprechakttheorie beschriebenen konstitutiven Bedingungen „abgeklopft“ bzw. mit der interpersonalen Situation abgeglichen werden. B versucht unter Be‐ rücksichtigung der ihm zugänglichen Informationen zu einem Schluss zu kommen, z.B. dass A wohl bestimmte Annahmen macht und bestimmte Absichten hat, spezi‐ ell, dass A wissen möchte, wo er Benzin bekommen kann. Die hier konversationell erschlossene Absichten und Annahmen sind für Fragen typisch. Die Sprechakttheo‐ rie bietet hier also präzise Hilfsmittel für die Rekonstruktion konversationellen Er‐ schließens. Sie kann explizit zeigen, welche Annahmen und Absichten unterstellt werden müssen, wenn bestimmte Absichten als Implikaturen erschlossen werden. Sie legt also die Kriterien offen, nach denen solche Intentionen erschlossen werden können. Damit bietet sie der konversationellen Theorie des Meinens und Verstehens, 76 die sich in diesem Bereich eher im Intuitiven bewegt, eine praktikable Beschrei‐ bungsbasis. Das pragmatische Erschließen beschränkt sich aber – wie schon gesagt – nicht auf die Ermittlung von sprechaktspezifischen Verstehensintentionen. Es ist in allen Fällen konventioneller Unterbestimmtheit verstehensnotwendig. Und damit ist es wahr‐ scheinlich an den meisten Fällen sprachlicher Kommunikation beteiligt. Das sehen wir auch, wenn wir zu Grice’ obigem Beispiel zurückkehren. Betrachten wir die Antwort, die B auf A‘s Äußerung (I am out of petrol) gibt: There is a garage round the corner. Diese Entgegnung ist konventionell reichlich unterbestimmt, denn garage ist nicht unbedingt klar. Auch hier muss A erschließen, dass B diesen Ausdruck im Sinne von Tankstelle und nicht von Werkstatt meint. Dann ist die Sache einfach. A hat die gewünschte Auskunft indirekt bekommen. Aus B’s Behauptung kann A erschließen: An der Tankstelle um die Ecke kann er Benzin bekommen. Viel‐ leicht meint B aber wirklich Werkstatt. Vielleicht weiß er nicht, wo eine Tankstelle ist. Aber er vermutet, dass die Leute in der Werkstatt eine Antwort auf A’s Frage haben könnten. Dann wäre seine Replik nicht als Antwort auf die Frage gedacht, sondern als Aufforderung, die Frage anderswo zu stellen. Ähnliches gälte, wenn B antworten würde: Um die Ecke ist eine Kirche! Vielleicht dächte B dann, Pfarrer wüssten mehr, wenn es um Tankstellen geht. Oder vielleicht, dass in dieser Angelegenheit Beten oder nur noch Beten helfen könnte. Das Ausdrücken von Sprecherabsichten ist also, wie man am Beispiel der sogenann‐ ten indirekten Sprechakte ganz besonders deutlich sieht, einer der vielen konventio‐ nell unterbestimmten Bereiche sprachlichen Handelns. Meist sind mehr oder weniger aufwendige Schlussfolgerungen nötig, um zu plausiblen Verstehenshypothesen zu gelangen. Wenn man nicht manchmal nachfragen könnte, wäre es schwierig. Noch besser wäre es, in der Kommunikation die Indirektheit zu vermeiden. In der Praxis wollen oder können das die Gesprächspartner oft nicht. 77 Bewirkungsziele bei Sprechakten Beim Kommunizieren geht es zuerst einmal darum, verstanden zu werden. Das Ver‐ standenwerden ist die Voraussetzung dafür, dass weitergehende Wirkungen eintre‐ ten können, es ist sozusagen das Mittel zum Ziel. Die angestrebten Zwecke sprachli‐ cher Handlungen sind allerdings von ganz unterschiedlicher Art. Auch Anthropolo‐ gen und Psychologen interessieren sich dafür. Sprechakttheoretiker haben solche weitergehenden Ziele als sogenannte perlokutive Akte oder perlokutive Effekte interpretiert. Durch das Ausführen illokutiver Akte können wir bestimmte Effekte auslösen und in diesem Sinne perlokutive Akte ma‐ chen. Wenn also der Hörer versteht, welche Bewirkungsabsicht ihm bedeutet wird, können infolge seines Verstehens anschließend bestimmte Folgen eintreten. Sie kön‐ nen darin bestehen, dass er etwas Bestimmtes tut oder unterlässt oder dass sich sein mentaler oder psychischer Zustand ändert, etwa, dass er nun etwas weiß oder glaubt oder dass er sich aufregt oder zu etwas motiviert wird, usw. Allerdings ist strittig, ob solche Folgen als perlokutive „Handlungen“ des Sprechenden interpretiert werden dürfen. Das Erfassen von sprechakttypischen Absichten kann also hörerseitig verschiedene Wirkungen hervorrufen. Wie wir gesehen haben, sind solche (perlokutiven) Bewir‐ kungsabsichten konstitutiv für Sprechakte. Entsprechend wird auch in intentionalen Handlungstheorien davon ausgegangen, dass zu den Bewirkungsabsichten von Prä‐ dikationshandlungen notwendigerweise immer auch eine angestrebte perlokutive Bewirkungsabsicht gehöre. „Die ein kommunikatives Handeln definierenden Ab‐ sichten sind durch und durch perlokutionäre. Das ist der Kern des Instrumentalis‐ mus. Hier gibt es keine Versöhnung.“57 Dies trifft bei appellativen Sprechakten offensichtlich zu. Wer an jemanden appel‐ liert, etwas Bestimmtes zu tun, will logischerweise, dass er es tut. Es gehört eben zur Bedeutung des Wortes auffordern, dass S will, dass H etwas macht. Und S will, dass H diese Bewirkungsabsicht erkennt (Verstehensziel) und als Folge dieses Verstehens entsprechend handelt. Ähnlich ist es beim Bitten. Von einer Bitte kann man nur reden, wenn S bewirken will, dass H etwas für ihn macht, und wenn er will, dass H diesen Wunsch erkennt und ihn als Folge dieses Verstehens auch erfüllt. Zur Bedeutung von fragen gehört es, dass S etwas nicht weiß, aber bewirken will, dass H ihm das sagt, und dass er will, dass H dies erkennt und dann die entsprechende Information liefert. 57 Meggle 1997, 21. 78 Die für appellative Sprechakte wesentlichen Verstehensziele sind also notwendig mit entsprechenden Bewirkungsabsichten verknüpft. S möchte bewirken, dass H et‐ was macht, und er will, dass H das versteht (Verstehensziel) und es dann macht. Je nach den Beziehungen zwischen den beiden kann der Appell eine Bitte, eine Auffor‐ derung oder ein Befehl usw. sein. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei kommissiven Sprechakten. Bei einem Verspre‐ chen teilt S mit, dass er die Absicht hat, etwas Bestimmtes zu tun, was H will (z.B. seine Schulden zurückzuzahlen). Dies soll H verstehen. Und S will zusätzlich, dass H das glaubt (perlokutiver Effekt). Weitergehende Bewirkungsabsichten bleiben offen. Soll H sich nur beruhigen? Soll er von bestimmten Handlungen abgehalten werden? Unübersichtlich und entsprechend strittig sind die Verhältnisse bei deskriptiven (konstativen) Sprechakten. Einigkeit besteht darüber, dass zum Behaupten folgende Intention gehört: S will bewirken, dass H erkennt, dass S etwas Bestimmtes für wahr hält. Umstritten ist aber, ob auch die folgende weitergehende Bewirkungsabsicht dazuge‐ hört: S will bewirken, dass H das Behauptete (ebenfalls) für wahr hält. Ohne Betrachtung verschiedener Kontexte ist die Frage nicht zu entscheiden. a) Manche deskriptiven Sprechakte sind indirekt appellativ gemeint. Die Feststellung Diese Pilze sind giftig. könnte zusätzlich als Warnung gemeint sein. Dann gehören natürlich auch die Be‐ wirkungsintentionen, dass H einerseits das für wahr halten und deshalb andererseits etwas Bestimmtes nicht tun soll, zwingend dazu. b) Manchmal sind feststellende Äußerungen im kommunikativen Zusammenhang als Begründungen gemeint, z.B. als Argumente. Ein Argument muss aber geglaubt werden, um zu wirken. Eine Feststellung kann nur als Argument (Begründung) ge‐ meint sein, wenn S auch die Bewirkungsabsicht hat, dass H dieses Argument für wahr hält. Denn nur dann kann bewirkt werden, dass H auch die zu beweisende These für wahr hält. c) Auch für viele andere Fälle des Behauptens darf man von der weitergehenden Be‐ wirkungsabsicht ausgehen, auch H möge die Aussage seinerseits für wahr halten. Dafür spricht schon die Relevanzmaxime. S würde seine Feststellung nicht machen, wenn er nicht glauben würde, dass Sie für H wichtig ist. Und das kann sie nur sein, wenn auch H sie glauben soll. d) Allerdings gibt es viele Ausnahmen. Grundsätzlich weiß man ja, dass man nie‐ manden zwingen kann, einem zu glauben. In diesem Sinn kann eine Feststellung 79 auch eher als ein Informationsangebot gemeint sein. Dann sind deskriptive Äuße‐ rungen eher wie expressive gemeint. Sie dienen lediglich dazu, eine eigene Überzeu‐ gung oder Meinung zum Ausdruck zu bringen. Wer Sätze behauptet wie Mein Leben ist so reich. oder Unser Finanzminister hat doch schon längst den Durchblick verloren. tut wohl in erster Linie seine Überzeugung kund. Er könnte jeweils hinzufügen: So sehe ich das, das ist meine Einschätzung. Und immer, wenn ein derartiger Zusatz hintergründig mitgedacht werden kann, ge‐ hört es eben nicht zur Bewirkungsabsicht, dass auch der Gesprächspartner etwas glauben soll. Es kommt dem Sprechenden in diesen Fällen nicht darauf an, dass die anderen seine Überzeugungen teilen. Es genügt ihm, dass sie erfahren, was er selbst für wahr hält. Perlokutive Bewirkungsabsichten sind also jeweils typisch bzw. konstitutiv für Sprechakte. Sie können mit noch weitergehenden, aber nicht konstitutiven Bewir‐ kungsabsichten verbunden sein. Wer ein Argument bringt, tut dies in der Absicht, den Partner von der Wahrheit einer bestimmten These zu überzeugen. Das geschieht häufig mit weitergehenden Absichten. Wenn H überzeugt wird, dass die Kurse sei‐ ner Aktien demnächst fallen werden, könnte er dazu gebracht werden, diese Aktien zu verkaufen und den Erlös auf andere Weise gewinnbringend zu investieren. Dann könnte S sagen, er habe H geholfen, sein Vermögen zu bewahren oder zu vermehren. Allerdings könnte S sich mit seinen Informationen auch geirrt und damit zum Ruin von H beigetragen haben. Man muss also unterscheiden zwischen den konstitutiven Bewirkungsabsichten von Sprechakten und möglicherweise zusätzlich angestrebten Folgen. In Bezug auf Letz‐ tere könnte man sich mit ein wenig Phantasie zahllose mögliche Effekte ausdenken. Wichtiger erscheint mir, abschließend auf etwas anderes hinzuweisen: In der kommunikativen Interaktion allgemein und im sprachlichen Handeln im Be‐ sonderen spielen weitere, bisher nur am Rande gestreifte, aber grundsätzlich viel‐ leicht noch bedeutsamere Bewirkungsabsichten eine wesentliche Rolle. Psycholo‐ gen und Anthropologen weisen seit langem darauf hin, dass ein fundamentales Ziel kommunikativer Interaktionen darin bestehen dürfte, Subjektivität, Bewusstsein bzw. das, was man das Selbst nennt, hervorzubringen und zu stabilisieren. In neue‐ ren konstruktivistischen Ansätzen wird argumentiert, dass der Einzelne in sozialen Interaktionen Fremdzuschreibungen erfährt, die er zu Selbstzuschreibung transfor‐ mieren kann: „Wenn nun soziale Akteure ihre wechselseitige Kommunikation und In‐ teraktion […] so organisieren, dass sie bei allen Ko‐Akteuren ein mentales Selbst vo‐ 80 raussetzen, trifft jeder Akteur – auch jeder neu hinzutretende – auf eine Diskurssituati‐ on, die auch für ihn eine selbst‐förmige Rolle bereithält. Die Wahrnehmung der auf ihn gerichteten Fremdzuschreibungen erzeugt dann Selbstzuschreibung, und der Akteur macht sich schließlich die ihm zugeschriebene Selbst‐Rolle zu Eigen. Er konstituiert sich selbst im Spiegel der anderen und versteht sich schließlich so, wie die anderen ihn ver‐ stehen.“58 Die Auffassung, dass die Selbstbilder jedes Einzelnen soziale Konstrukte sind, ist im Grundsatz nicht neu. So wird beispielsweise schon in Adam Smith’ Theory of Mo‐ ral Sentments (1759) ausgesprochen, dass wir uns selbst ohne den Spiegel der anderen überhaupt nicht wahrnehmen könnten und dass wir erst in diesem Spiegel unser Bild von uns selbst erschaffen. In kommunikativen Interaktionen bringen wir also nicht nur unsere Verstehens‐ und Bewirkungsabsichten zum Ausdruck, sondern wir bedeuten unseren Partnern immer auch direkt oder hintergründig, welches „Bild“ wir von ihnen und uns selbst haben. Und umgekehrt tun dies die anderen auch im Hinblick auf uns. Es ist ein wesentlicher Zweck unserer Kommunikation, vielleicht der wichtigste, unsere eigenen Selbstdefinitionen zu vermitteln, überprüfen zu lassen, zu festigen oder gege‐ benenfalls zu korrigieren und anderen unsere Sicht auf sie vermitteln. Unsere Kommu‐ nikation dient also immer auch dem grundlegenden Zweck, unser Selbstbild in Anpas‐ sung an die soziale Umgebung zu formen und aufrecht zu erhalten. Deshalb kann der Entzug sozialer Kontakte die persönliche Identität gefährden. Selbst‐ und Fremddefinitionen sind ganz offensichtlich integrale Ziele unserer Sprechak‐ te. Um zu bedeuten, wer wir sind oder sein möchten und wie wir die anderen sehen oder sehen möchten, benutzen wir neben den verbalen auch alle Kanäle der nonverba‐ len Kommunikation. Solche mehr oder weniger absichtsvollen nonverbalen Selbstdefinitionen beginnen be‐ kanntlich bei der Gestaltung des eigenen Erscheinungsbilds durch Kleidung, Frisur usw. bis hin zur Wohnungseinrichtung oder der Wahl des Autos, wodurch im Rahmen der eigenen Maßstäbe eine Statusbestimmung oder eine milieuspezifische Gruppenzugehö‐ rigkeit zum Ausdruck gebracht wird. Die beabsichtigte Botschaft soll und kann er‐ schlossen werden. Kommunikativ bedeutsam sind auch sogenannte Körpercodes (z.B. Körperkontakt, Nä‐ he, Blick, Haltung). Sie sind weitgehend konventionell, wie interkulturelle Differenzen zeigen. Je nach Kultur kann mit dem Halten des Blickkontaktes Geringschätzung des Partners, eigenes Selbstbewusstsein oder Respekt und Aufmerksamkeit dem anderen gegenüber bedeutet werden. In jedem Fall werden Selbst‐ und Fremddefinitionen zum 58 Prinz 2004,14. 81 Ausdruck gebracht. Das kann man z.B. gut an Personen beobachten, die mit ihren Chefs im Gespräch sind. Auch mit nonverbalen Handlungen können Selbst‐ und Fremdeinschätzungen bedeutet werden. Wer z.B. dem anderen ständig die Arbeit abnimmt, definiert ihn unter Um‐ ständen als übergeordnet. Man möchte ihm eine solche Arbeit nicht zumuten. Möglich‐ erweise bringt man dadurch aber auch zum Ausdruck, dass man ihn für nicht fähig hält, diese Aufgaben selbst zu erledigen. Sowohl verbales wie nonverbales Kommunizieren kann zu Beziehungskonflikten füh‐ ren, wenn die andere Seite die impliziten Beziehungsdefinitionen nicht versteht oder nicht akzeptieren will. Ein bekanntes lustiges Beispiel ist der Streit darüber, wer im Res‐ taurant bezahlen darf. Jede Seite will sich durch die Übernahme der Rechnung als wohlhabender und damit auch als beruflich erfolgreicher usw. definieren. Diese Zu‐ rückstufung will aber der andere nicht hinnehmen. Typisch für solche Beziehungskon‐ flikte sind natürlich auch die Rebellionsakte von Jugendlichen gegenüber Eltern oder Erwachsenen, mit denen sie deren Überlegenheitsdefinitionen aufzukündigen versu‐ chen. Beziehungskonflikte haben bekanntlich die Tendenz, zu eskalieren. Wer beim ers‐ ten Mal unterlegen ist, versucht bei nächster Gelegenheit, Symmetrie wiederherzustel‐ len.59 In der sprachlichen Kommunikation können positive und negative Selbst‐ und Fremd‐ definitionen explizit erfolgen. Man kann jemanden loben, herabsetzen usw. Gute Ver‐ käufer wissen, wie sie ihre potentiellen Kunden durch Komplimente geneigt machen. Wichtiger jedoch sind die impliziten Definitionen, die bei Sprechakten hintergründig immer eine Rolle spielen, und immer heißt hier notwendigerweise immer. Wie solche Be‐ ziehungsdefinitionen integrative Teile dessen sind, was wir einander bedeuten (zu ver‐ stehen geben), lässt sich am Beispiel von Behauptungen und Fragen exemplarisch zei‐ gen. Wenn ich Sprechakte mache, strebe ich bestimmte Wirkungen bei den Partnern an. Ei‐ nen Sprechakt machen heißt zuerst einmal, dem Partner zu bedeuten, was man bei ihm erreichen will. Bei Fragen will S, dass H ihm eine Information gibt. Er will, dass H ver‐ steht, dass er will, dass H ihm die Information gibt. Und er will, dass H ihm diese In‐ formation als Folge seines Verstehens gibt. Wer fragt, weiß etwas nicht, nimmt aber an, dass sein Gegenüber es weiß oder wissen könnte. Er fragt ihn zudem nur, wenn er annimmt, dass sein Partner auch willens ist, ihm die gewünschte Information zu geben. Sobald der Partner die Äußerung als Frage versteht, hat er nicht nur die Bewirkungsabsicht der Äußerung verstanden, sondern schon mehrere implizite personale Definitionen zur Kenntnis genommen: So hat sich 59 Ausführliche Beispiele bietet Watzlawick 1969. 82 der Fragende hinsichtlich eines bestimmten Wissens als unterlegen definiert. Er nimmt aber an, dass sein Partner dieses Wissen hat oder haben könnte. Und eine weitere posi‐ tive Definition kommt noch dazu: Der befragte Partner wird als grundsätzlich koopera‐ tiv definiert. Wie angenehm diese im Zusammenhang mit Fragen vermittelten positiven Fremdzu‐ schreibungen sind, kann jeder erfahren, der in einer fremden Stadt nach dem Weg fragt. Es wird selten passieren, dass die Befragten abweisend reagieren. Selbst wenn jemand nicht Auskunft geben kann, dürfte seine Reaktion selten unfreundlich sein. Oft eilen noch weitere Personen hinzu, die sich die Chance zur positiven Selbstdefinition nicht entgehen lassen wollen und nach getanem Werk mit erfreutem Lächeln weitergehen. Dass wir bei Sprechakten nicht nur bedeuten, was wir von den Partnern wollen, son‐ dern ihnen notwendigerweise auch bestimmte Rollen zuweisen, sieht man z.B. beim Be‐ haupten. Wer eine Behauptung macht, hält eine bestimmte Feststellung p für wahr. Er nimmt außerdem an, dass für H die Wahrheit der Feststellung p nicht offensichtlich ist. Und er will, dass H versteht, dass S p für wahr hält. Oft will er auch zu verstehen geben, dass er will, dass H p ebenfalls für wahr halten soll. Es ist beim Behaupten unvermeid‐ lich, dass der Behauptende sich selbst bezüglich seines Wissens als überlegen, den Part‐ ner entsprechend als unterlegen definiert. Ähnlich verhält es sich bei Ratschlägen, von denen es ja zuweilen heißt, sie seien oftmals wie Schläge. Wer dem anderen sagt, was er im eigenen Interesse zu tun habe, sagt auch: Ich weiß besser als du selbst, was gut für dich ist. Man kann erkennen, dass sprachliche Handlungen nicht nur bestimmten konstitutiven Bewirkungsabsichten dienen. Oft scheinen ja die Inhalte austauschbar. Wichtig ist für den Sprechenden oft ganz besonders, sich selbst zu definieren. So will jemand, der Neu‐ igkeiten berichtet, vielleicht bewundert werden, will sich aufwerten oder einfach beach‐ tet werden. Viele Gespräche dienen noch ganz anderen Zwecken als der Übermittlung von konsti‐ tutiven Bewirkungsabsichten sowie Selbst‐ und Fremddefinitionen. Ein bekanntes Bei‐ spiel ist der Klatsch. Eine Person, die sich empört oder abfällig über das Handeln Drit‐ ter äußert, stellt zwar einerseits im Dienste der Selbstaufwertung ihre überlegene Kenntnis von Fakten und Normen dar. Gleichzeitig erfahren aber die Gesprächs‐ partner, welche Normen in einer Gruppe gelten und bekommen eine Verhaltensorien‐ tierung. Solche Gespräche dienen also – und das nicht immer bewusst – dazu, soziale Normen zu festigen. 83 Absichten bedeuten Der Fehler traditioneller Semantiktheorien war, sprachliche Ausdrücke erklären zu wollen durch Zuordnung zu etwas Nichtsprachlichem, beispielsweise zu Gegenstän‐ den oder zu Vorstellungen von Gegenständen. Dem haben wir mit guten Gründen ei‐ ne handlungstheoretische Sicht der Dinge entgegengestellt: Nicht Ausdrücke bedeuten etwas, sondern wir bedeuten etwas mit ihnen. Sprechakte sind die fundamentalen Einheiten sprachlicher Kommunikation. Sprechak‐ te zu machen heißt, Bewirkungsabsichten durch Prädikationshandlungen zu verstehen zu geben. Mit der grammatischen Satzform solcher Prädikationshandlungen kann wie mit anderen indikatorischen Mitteln auf die grundsätzliche Art der Bewirkungsabsicht hingewiesen werden. Solche Absichten sind z.B. appellativer oder deskriptiver Art. Im ersten Fall will jemand zu verstehen geben, was der Partner tun möge, im zweiten Fall, was er wissen soll. Wenn aber einen Sprechakt zu machen darin besteht, Bewirkungsabsichten zum Aus‐ druck zu bringen, dann liegen ernstzunehmende Einwände nahe: Worin soll eigentlich der Fortschritt einer handlungstheoretischen Semantik gegenüber mentalistischen An‐ sätzen bestehen? Besteht denn sprachliches Handeln nach der bisherigen Darstellung nicht ebenfalls in der Übermittlung mentaler oder psychischer Entitäten? Sind die be‐ deutungstragenden mentalen Konzepte der Vorstellungstheorie in der Handlungsthe‐ orie nicht lediglich gegen psychische Dispositionen wie Absichten, Wünsche oder Zie‐ le ausgetauscht? Ist damit nicht die handlungstheoretische Semantik in einer ähnlichen Situation wie die vermeintlich überwundene Vorstellungstheorie? Tatsächlich müssen wir anerkennen, dass das, was Menschen anstreben, nicht voll‐ ständig in den Bereich handlungstheoretischer oder linguistischer Erklärungsmöglich‐ keiten fällt. Welche Absichten jemand bei seinem Handeln hat, kann man natürlich durch die Angabe von Gründen erklären. Aber solche Erklärungen haben ihre Gren‐ zen. Warum jemand ein bestimmtes Ziel hat, kann man zwar durch Verweis auf ein weitergehendes Ziel erklären usw. Als letzte Erklärung erfolgt ein Verweis auf nicht weiter erklärbare menschliche Bedürfnisse. Sind Absichten oder Ziele überhaupt innerpsychische Entitäten ähnlich den mentalen Konzepten der Vorstellungstheorie? Tatsächlich gibt es gute Gründe, die vermeintlich psychologischen Begriffe Wollen oder Absicht gar nicht psychologisch zu interpretieren. Sprachanalytische Untersuchungen haben überzeugende Argumente geliefert, dass solche Ausdrücke als Attribute von Handlungen und nicht als Beschreibungen psychi‐ scher oder physischer Zustände verwendet werden.60 Ich meine damit vor allem Gilbert Ryles Jahrhundertwerk Concept of Mind (1949). Dieses Buch ist in einer deutschen Übersetzung leider nicht mehr im regulären Handel erhältlich. 60 84 Um einem möglichen Missverständnis vorzubeugen: Natürlich gibt es Absichten vor‐ sprachlicher Art. Und natürlich können Bedürfnisse auch nonverbal durch Körperges‐ ten, insbesondere manuelle Gesten ausgedrückt werden. Absichten und absichtsvolles Handeln gibt es ganz sicher nicht erst, seit die Menschen zu sprechen gelernt haben. Auch vorsprachlich gab und gibt es Möglichkeiten, Absichten zu bilden und zu ver‐ stehen zu geben. Unsere menschlichen Vorfahren haben durch ihre verkörperten Aus‐ drucksformen Absichten in ihr Bewusstsein gerückt und ausgedrückt. Unsere Sprache wird von Anthropologen als eine späte „Erfindung“ des Menschen betrachtet, die erst seit vierzig‐ bis einhunderttausend Jahren wirksam ist. Sie setzte wohl auf der bereits vorher entwickelten kognitiven Architektur auf, steigerte aber das Potential der vor‐ sprachlich möglichen kognitiven und kommunikativen Leistungen in gewaltigem Ma‐ ße. Im Hinblick auf die Kognition erfolgte durch die Sprache der Übergang vom asso‐ ziativen zum begrifflichen Wissen, im Hinblick auf die kommunikativen Möglichkei‐ ten die weitgehende Verdrängung verkörperter symbolischer Interaktion durch lautli‐ che symbolische Kommunikation. Insbesondere hat die verbale Sprache gegenüber ih‐ ren Vorläufern enorme Vorteile bei der sozialen Verhaltenssteuerung: So kann sprach‐ lich etwas nicht Anwesendes gegenwärtig gemacht werden. Es ist möglich, über Er‐ eignisse und Handlungen zu sprechen, die außerhalb der laufenden Interaktion sind. Vor allem aber können aus einem begrenzten Inventar von Ausdrücken und Regeln unbegrenzt viele Sätze gebildet werden, wodurch die Möglichkeit gegeben ist, unbe‐ grenzt viele wirkliche oder bloß vorgestellte oder gewünschte Sachverhalte zu reprä‐ sentieren. Was das für deskriptive, appellative, kommissive, expressive oder auch de‐ klarative Sprechhandlungen bedeutet, liegt auf der Hand. Bei allen unseren Sprechakten handelt es sich um absichtsvolle sprachliche Handlun‐ gen. Die bei Sprechakten zum Ausdruck gebrachten Absichten sind jedoch nicht ir‐ gendwie psychisch und sprachlos, sondern erst durch das mit Prädikationshandlun‐ gen Gesagte gegeben, traditionell gesagt: sie sind erst möglich und ausdrückbar als sprachliche Inhalte. Erst im Hinblick auf das, was jeweils durch Bezugnahme und Prä‐ dikation mittels regelhaft verwendeter Ausdrücke gesagt wird, kann es deskriptive, appellative oder kommissive Absichten geben. Was jeweils mit sprechakttypischen Absichten zum Ausdruck gebracht wird, ist erst im Medium der Sprache möglich. Sol‐ che für Sprechakte konstitutiven Absichten lassen sich metaphorisch charakterisieren als intentionale „Vorzeichen“ von Prädikationshandlungen. Vorzeichen ohne Ausdrü‐ cke, auf die sie bezogen sind, sind sinnlos. Am Beispiel des Behauptens können die Verhältnisse veranschaulicht werden. Wer etwas behauptet, will erreichen, dass der Zuhörer erkennt, dass er eine Aussage bzw. einen Satz für wahr hält. Etwas für wahr zu halten ist aber nur möglich in folgendem Sinn: Ein Prädikator ist nach Ansicht des Sprechers einem Gegenstand der Bezugnah‐ 85 me nach den Regeln der Sprachgemeinschaft zu Recht zugesprochen, weil der Spre‐ cher die für ihn konventionell geltenden Wahrheitsbedingungen für erfüllt hält. Der Behauptende gibt dem Partner durch seine Äußerung zu verstehen, dass er seine Prä‐ diktion für wahr hält, dass der Ausdruck, so wie er ihn gelernt hat, zu Recht zugespro‐ chen wird. Er gibt zu verstehen, dass er dessen konventionelle Wahrheitsbedingungen für erfüllt hält. Die eine Behauptung ausmachenden Absichten sind überhaupt erst im Medium der Sprache möglich. Ich kenne meine Behauptungsabsicht nur, wenn ich sie sprachlich ausdrücken kann. Ich kann nur etwas zu verstehen geben wollen, was ich ausdrücken kann. Kommunikative Bewirkungsabsichten beziehen sich also immer auf einen „sprachlichen Gehalt“, der außerhalb regelgeleiteter Verwendung von Ausdrücken gar nicht möglich ist. Das ist nicht nur beim Behaupten so, sondern bei allen Sprechak‐ ten. Erst auf der Grundlage eines konventionsgebundenen „Satzinhaltes“61 werden beispielweise appellative Absichten möglich – als Wunsch, der Satz möge durch das Handeln eines anderen wahr werden. Die Bewirkungsabsicht bezieht sich immer auf das in Sätzen Ausdrückbare. Man kann nicht etwas versprechen, androhen, garantie‐ ren, mitteilen, fragen usw., was man nicht sagen kann. Bei Sprechakten wird die jeweilige (appellative, deskriptive usw.) Absicht immer sprachlich durch die jeweilige Prädikationshandlung differenziert. Wird die sprachli‐ che Ausformung weggenommen, entfällt auch die Absicht. In der handlungstheoreti‐ schen Semantik bleibt am Ende kein mentalistischer Rest übrig. 61 Sprachlicher Gehalt oder Satzinhalt sind offensichtlich Termini der traditionellen Semantik, nicht der semantischen Handlungstheorie. 86 Intentionen und Regeln Sprachlich zu handeln heißt immer, Sprechakte zu machen. Obwohl dazu im Voraus‐ gehenden bereits einiges Wichtige festgestellt wurde, ist bisher über den „Kern“ sprachlichen Handelns noch fast nichts gesagt, nämlich darüber, auf welche Weise Sprechakte eigentlich gemacht werden. Wir haben uns bisher mit der einfachen Fest‐ stellung begnügt, dass wir Sprechakte durch Prädikationshandlungen machen, die mit Bewirkungsabsichten verbunden sind. Wie diese Prädikationshandlungen im Einzel‐ nen aufgebaut sind, blieb bisher ebenso offen wie die Frage, welche Rolle Regeln, ins‐ besondere grammatische Regeln, bei diesen Prädikationshandlungen spielen. Nach der intentionalistischen Version, die sich an Grice anlehnt, gehen Sprechakte so: Wir streben mit sprachlichen Handlungen bestimmte Zwecke an. „Um die Erfüllung dieser Zwecke zu erlangen, reicht es aus, zum Ausdruck zu bringen, dass man ihre Er‐ füllung anstrebt.“62 Das klingt geradezu wie ein Märchen: Man braucht nur anzuzei‐ gen, was man will, dann geschieht es. Ist das auch wahr? Natürlich werden in der intentionalistischen Erklärung kooperative Partner vorausge‐ setzt, die sich zum einen erfolgreich bemühen, die Absichten zu erkennen, was nicht immer so einfach ist. Und diese Partner müssen zum anderen zusätzlich auch bereit sein, die angestrebten Wirkungen eintreten zu lassen. Es liegt ja in ihrer Entscheidung, ob sie z.B. eine Bitte erfüllen. Ein Automatismus ist das bekanntlich nicht. Damit die angestrebten Ziele nach der Erfüllung dieser Vorbedingungen tatsächlich erreicht werden, sind außerdem auch noch ein paar nicht ganz unwichtige konventio‐ nelle Zutaten nötig. Damit unsere kooperationsbereiten Partner beim Erkennen unse‐ rer Absichten nicht nur im Nebel stochern, markieren wir das, was wir sagen, meist mit regelhaften Hinweisen und geben dadurch zu verstehen, von welcher grundsätzli‐ chen Art unsere Absichten sind. Illokutive Indikatoren sind konventionelle Mittel, de‐ ren regelhafte Verwendung nach äußeren Kriterien gelernt werden muss. Ohne Hin‐ weise durch solche konventionellen Mittel stünde auch der kooperationswilligste Partner vor nahezu unlösbaren Verständnisproblemen. Und umgekehrt wäre ohne solche Anzeigemittel der Weg zum bewussten Ausdrücken angestrebter Zwecke schwer, wenn nicht sogar unmöglich. Zu guter Letzt ist noch eine ganz besonders gewichtige konventionelle Zutat erforder‐ lich: Man bringt seine Absichten nicht sprachlos zum Ausdruck, man kann sie ja nicht als solche vorzeigen. Man braucht eine Sprache. Manche sind davon überzeugt, dass man die meisten Absichten ohne sprachliche Ausdrücke gar nicht haben kann. Somit muss vom Partner verstanden werden, was gesagt wird, will er verstehen, was gewollt wird. Wenn mir jemand seine Absichten auf Türkisch zu verstehen gibt, habe ich Prob‐ 62 Kemmerling 1992, 120. 87 leme. Die hätte ich nicht, wenn ich die türkische Sprache gelernt hätte. Das heißt: Die Regeln der türkischen Sprache. Oder genauer: Die Regeln, nach denen einzelne Le‐ xeme und Morpheme bei Prädikationshandlungen im Türkischen verwendet werden. Und dann natürlich auch noch die Regeln der türkischen Grammatik. Wenn es aber so ist, dass man bei Sprechakten Absichten nur auf der Grundlage regel‐ haft verwendeter Wörter und grammatischer Regeln ausdrücken und verstehen (und vielleicht auch erst haben) kann, dann ist das Fundament des intentionalistischen Er‐ klärungsansatzes ein ganz und gar konventionales. Fazit: Was also sind Sprechakte? Sieht man von wenigen (nicht‐prädikativen) Beispielen wie Grüßen (Hallo) ab, sind Sprechakte immer Prädikationshandlungen mit bestimmten Bewirkungsabsichten. Umgekehrt sind Prädikationshandlungen wegen der mit ihnen verbundenen Bewir‐ kungsabsichten immer gleichzeitig Sprechakte. Propositionale Akte als reine und ab‐ sichtsfreie Prädikationshandlungen sind lediglich theoretische Konstrukte. Niemals hat jemand in der sprachlichen Wirklichkeit einen reinen propositionalen Akt ge‐ macht. (Und wenn vermeintlich doch, dann war es uneingestanden ein deskriptiver bzw. konstativer Sprechakt.) Deshalb können wir sagen: Sprechakte sind symbolische Prädikationshandlungen mit strategischen Bewirkungsabsichten. Sie zielen auf der Grundlage gemeinsamer Re‐ geln primär darauf ab, dass diese Bewirkungsabsichten erkannt bzw. verstanden werden. Das Verstehen bzw. Verstandenwerden ist die primär angestrebte soziale Folge. Nur durch dieses Verstehen können bei entsprechender Kooperationsbereit‐ schaft der Partner auch noch weitergehende Bewirkungszwecke realisiert werden, etwa, dass der Partner etwas Bestimmtes tut oder für wahr hält. Das ist aber kein De‐ terminismus, sondern im oben bestimmten Sinn eine angestrebte soziale Folge. Und damit sind die sogenannten perlokutiven Handlungen strategische Handlungen. Sprechakte sind also symbolische Prädikationshandlungen mit dem Ziel, verstanden zu werden und damit weitergehende Wirkungen zu erreichen. Diese Wirkungen sind normalerweise soziale Folgen. Treten sie ein, hat der Sprecher eine symbolische und eine strategische Handlung gemacht. 89 4. Das Prädikationsspiel und die Grammatik des sprachlichen Handelns Wittgenstein war von unzähligen verschiedenen Arten der Verwendung von Sätzen ausgegangen und hatte sie Sprachspiele genannt. In diesem Kapitel möchte ich zei‐ gen, dass es im Wesentlichen nur ein einziges Sprachspiel im Sinne symbolischen Handelns gibt. Ich nenne es das Prädikationsspiel. Es gibt aber sehr viele verschiede‐ ne Arten von Bewirkungszielen, die mit diesem Spiel angestrebt und erreicht werden können. Die Sprechakte, die wir mit Prädikationshandlungen machen, sind zwar nicht „unzählig“, aber zumindest „mannigfaltig“. Wer kommuniziert, macht Sprechakte. Diese werden mit wenigen Ausnahmen durch Prädikationshandlungen gemacht. Prädikationshandlungen sind so etwas wie die Basishandlungen der Kommunikation. Ihre Ausdrucksformen sind Sätze. Das Ver‐ stehen von Satzäußerungen besteht darin, zu erkennen, welche Prädikationen wo‐ rüber mit welchen Bewirkungsabsichten gemacht werden. Dieser verstehende Nach‐ vollzug wird durch die regelhafte Form des Prädikationsspiels möglich. Im Unterschied etwa zu instrumentellen Handlungen wie Autofahren oder Holzha‐ cken sind nämlich kommunikative Handlungen allgemein und sprachliche Hand‐ lungen im Besonderen Bedeutungshandlungen. Sie werden nicht nur gemacht, son‐ dern sie werden so gemacht, dass mit ihnen gleichzeitig auch bedeutet wird, dass sie gemacht werden. Das Prädikationsspiel, das Prädizieren über Gegenstände der Be‐ zugnahme zum Ausdruck einer Bewirkungsabsicht, wird also in einzelsprachlichen konventionellen Formen so gemacht, dass gleichzeitig nachvollziehbar wird, was worüber mit welcher Bewirkungsabsicht prädiziert wird. 90 Die kommunikative Funktion grammatischer Regeln Wenn man Sätze lediglich mit grammatischen Kategorien beschreibt, beschäftigt man sich im wahrsten Sinne des Wortes oberflächlich mit ihnen. Für Sinn und Ver‐ stehen entscheidend ist aber, sie als Ausdruck von Prädikationshandlungen zu inter‐ pretieren – also zu verstehen, über welche Gegenstände der Bezugnahme was mit welcher Bewirkungsabsicht prädiziert wird. In den grammatischen Oberflächen der Sätze kommen diese Handlungen und Absichten regelhaft zum Ausdruck, wenn auch oft nur abgekürzt. Spezifisch für unser sprachliches Handeln ist, dass wir nicht nur sprachliche Hand‐ lungen machen, sondern dass wir durch deren konventionelle Formen gleichzeitig bedeuten, dass wir sie machen. Dementsprechend werden im Folgenden grammati‐ sche Regeln als Regeln des Bedeutungshandelns beschrieben. In einer derartigen handlungstheoretischen Interpretation ist Syntax nicht mehr etwas „neben“ der Semantik, sondern deren integraler Bestandteil. Dabei werden Sätze als „Oberflä‐ chen“ von Prädikationshandlungen mit Bewirkungsabsichten interpretiert. In diesem Verständnis sind Sätze die regelhaften Ausdrucksformen von Sprechakten und den ihnen zugrundeliegenden Prädikationshandlungen, durch deren teilnehmenden Nachvollzug Verstehen gelingt. Welche Funktionen haben nun grammatische Regeln beim Bedeutungshandeln? In der mündlichen Kommunikation werden die Ausdrücke notwendigerweise in zeitli‐ cher Abfolge produziert, in der schriftlichen bei uns in einer linearen Reihung von links nach rechts. Ein Hörer/Leser muss also durch Auswertung bestimmter Merk‐ male der Sätze und häufig unter zusätzlicher Einbeziehung von Kontext‐ und Welt‐ wissen die sprachlichen Handlungen ‐ seien sie referentiell, prädikativ oder indikato‐ risch ‐ in ihrem strukturellen Zusammenhang nachvollziehen. Es besteht Grund zu der Annahme, dass grammatische Regeln ihren Beitrag dazu leisten, diese sprachli‐ chen Handlungen in ihrem Zusammenhang anzuzeigen und deren Nachvollzug für den Rezipienten zu ermöglichen. Im Allgemeinen wird unter der Grammatik einer Sprache die Gesamtheit ihrer Re‐ geln verstanden, nach denen Wörter oder Morpheme zu größeren Einheiten verbun‐ den werden können. Vorrangige grammatische Konventionen sind im Deutschen neben den Regeln der Satzglied‐ und Wortstellung die Verwendungsregeln für En‐ dungsmorpheme von Verben, Substantiven, Adjektiven und Pronomina mit ihren Dimensionen von Kasus, Genus und Numerus, aber auch allgemein Tempus‐ und Modalformen von Verben. Meine These ist: Diese regelhaften grammatischen Formen fungieren als metaprädi‐ kative Ausdrucksmittel. Sie sind – im Deutschen weitgehend synthetische ‐ Indikato‐ 91 ren zur Verdeutlichung von Prädikationshandlungen, die das nachvollziehende Ver‐ stehen dieser Handlungen ermöglichen. Die an der „Oberfläche“ der Sätze erscheinenden Ausdrücke korrespondieren also mit bestimmten auf einander bezogenen sprachlichen Handlungen. Mit diesen wol‐ len wir in den meisten Fällen zu verstehen geben, was wir worüber bedeuten – und dies nicht nur feststellend, sondern mit allen denkbaren Bewirkungsabsichten. Zu deren Anzeige werden in allen Sprachen illokutive Indikatoren verwendet, im Deut‐ schen u.a. das grammatische Mittel der Satzgliedfolge. Für die Prädikationshandlungen selbst, durch die wir die Sprechakte machen, brau‐ chen wir keine Verdeutlichungsmittel von der Art illokutiver Indikatoren. Das liegt daran, dass wir, wenn wir Sprechakte machen, nahezu nichts anderes als Prädikati‐ onshandlungen machen. Unser sprachliches Handeln in der Vielfalt seiner Sprechak‐ te besteht im Wesentlichen nur in der Wiederkehr dieses einen Handlungsmusters. Diese Handlung bzw. Handlungsabsicht ist prädikativ in dem Sinne: „Ich sage“ oder „Ich sage (darüber) aus“. Deshalb werden die prädikativen Handlungen innerhalb eines Satzes in konventionellen grammatischen Formen gemacht, durch welche an‐ gezeigt wird, worauf die prädizierten Ausdrücke jeweils bezogen sind. Durch die ob‐ ligatorischen grammatischen Formen unserer Prädikationshandlungen geben wir al‐ so zu verstehen, worüber wie sie machen, in welchem Zusammenhang sie gemeint sind (und darüber hinaus noch, was wir mit ihnen bewirken wollen). Adjektivische Attribuierungen sind anschauliche Beispiele. Wir haben sie in einer be‐ stimmten Form gelernt und müssen sie so machen und können sie nur so verstehen. Im Deutschen ist das prädizierte Adjektiv zur Anzeige seines strukturellen Bezuges direkt vor dem Nomen platziert bzw. es steht links von ihm und muss in Numerus, Kasus und Genus kongruent zu diesem sein. Die Prädikation des adjektivischen Ausdrucks erfolgt also formal so, dass sein Bezug nachvollziehbar ist. Grammatische Regeln wie die der Satzgliedstellung, Wortstellung und Kongruenz dienen neben der Anzeige von Bewirkungsabsichten also v.a. der Anzeige des struk‐ turellen Zusammenhangs von Prädikationshandlungen. Wir prädizieren also nach grammatischen Regeln, die in der Sprachgemeinschaft verbindlich sind. Da ihre Mit‐ glieder das Prädizieren in Sätzen so und nicht anders gelernt haben und es deshalb so machen, können die „Spielzüge“ von den Rezipienten verstanden werden – so wie von den Spielern selbst. Jedenfalls setzen die Kommunizierenden das voraus. In den folgenden Abschnitten dieses Kapitels wird die Grammatik des prädikativen Handelns genauer dargestellt. 93 Prädizieren: Der einfache Satz Die grammatische Form von Prädikationshandlungen, den Basishandlungen sprach‐ licher Kommunikation, zeigt zum einen an, worüber sie gemacht werden. Zum ande‐ ren dient sie der Anzeige der mit ihnen jeweils verbundenen Bewirkungsabsichten. Kernsätze sind optimale Anschauungsobjekte für die Funktion der beim prädikati‐ ven Handeln befolgten grammatischen Regeln. Als Kernsätze werden einfache Sätze bezeichnet, die nur aus dem syntaktischen Prädikat und nicht erweiterten Ergänzun‐ gen (Argumenten, Komplementen) bestehen. Erweitert nennt man Sätze, die durch das Hinzufügen von Attributen oder adverbialen Bestimmungen entstehen. Von komplexen Sätzen wird gesprochen, wenn Ergänzungen oder attributive oder ad‐ verbiale Erweiterungen durch Nebensätze realisiert sind. Entsprechend wird ein Kernsatz wie Der Vorstand entließ den Trainer. durch attributive und adverbiale Hinzufügungen zu dem erweiterten Satz: Der Vorstand des Tabellenletzten entließ den langjährigen Trainer nach einer Serie von Nie‐ derlagen. Ein komplexer Satz wäre z.B. Nachdem eine Reihe von Spielen verloren worden war, entließ der Vorstand des Tabellenletz‐ ten den Trainer, der die Mannschaft viele Jahre betreut hatte. Erweiterte oder komplexe Sätze repräsentieren mehrere Prädikationshandlungen, einfache Sätze oder Kernsätze dagegen genau eine. Diese wird meist explizit, das heißt mit unverkürztem Ausdruck, über Gegenstände der Bezugnahme gemacht. Es treten noch keine Ellipsen auf, wie das für viele attributive und adverbiale Fügungen typisch ist. Das gilt zumindest, solange nicht durch Nominalisierungen in den Sub‐ jekt‐ und Objektstellen elliptische Komprimierungs‐ und Verdeckungseffekte entste‐ hen. Deshalb sollen in diesem Abschnitt ausschließlich einfache Sätze ohne Nomina‐ lisierungen betrachtet werden. Erweiterte und komplexe Sätze werden weiter unten handlungstheoretisch interpre‐ tiert. Sie kommen durch Einbettung externer Sätze zustande. Die „Tiefenstruktur“ erweiterter und komplexer Sätze besteht aus verschiedenen, auf einander bezogenen einfachen Sätzen. Das heißt, sie sind Ausdruck von mehreren auf einander bezoge‐ nen Prädikationshandlungen. Entgegen ihren Bezeichnungen sind es nicht die kom‐ plexen, sondern eher die erweiterten Sätze, die komplex bzw. unübersichtlich sind. Im Vergleich zu ihnen sind die komplexen Sätze mit ihren Nebensätzen recht trans‐ parent. Denn sie sind als rekursive Einfügungen durch das Vorkommen finiter Ver‐ ben selbst explizite und unverkürzte Sätze. Im Unterschied dazu sind die nicht satz‐ 94 förmigen Erweiterungen Einbettungen von elliptischen Sätzen. Die dahinter liegende Handlungsstruktur ist rezeptionsseitig meist nur durch Rekurs auf Hintergrundwis‐ sen zugänglich. So sind z.B. viele attributive Erweiterungen elliptische Verkürzun‐ gen zugrundeliegender Sätze bzw. verkürzte Prädikationshandlungen und damit auf der Rezeptionsseite nur mit einem gewissen Erschließungsaufwand nachzuvollzie‐ hen. Die Prädikation des finiten Verbs über Gegenstände der Bezugnahme ist die zentra‐ le Bedeutungshandlung, die in einem Satz zum Ausdruck gebracht wird. Sie wird auf regelhafte Weise so gemacht, dass erkennbar ist, worüber sie mit welcher Bewir‐ kungsabsicht gemacht wird. Der Rezipient kann das finite Verb als obersten prädika‐ tiven Ausdruck gut erkennen. Kennzeichnend sind die Endungsmorpheme, von de‐ nen es im Deutschen nur wenige gibt: ‐t, ‐en, ‐e, ‐st (gibt, heben, bitte, schläfst). Der verbale Prädikator wird obligatorisch in fünf funktional bedeutsamen grammati‐ schen Dimensionen zugesprochen, nämlich in einer Personal‐, Numerus‐ und Genus‐ Form, dazu immer auch in einer bestimmten Tempus‐ und Modalform. Dabei erfül‐ len Personalform und Numerus gemeinsam die strukturindikatorische Funktion, das Subjekt zu identifizieren (siehe unten). In der kommunikativen Wirklichkeit wird die verbale Prädikation immer zum Aus‐ druck einer bestimmten Bewirkungsabsicht gemacht, sie erfolgt beispielsweise in de‐ skriptiver oder appellativer Absicht. Diese Absicht wird obligatorisch durch einen formalen Aspekt des Verbalmodus (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ) in Verbindung mit der Satzgliedstellung angezeigt. Mit der verbalen Prädikation ist also obligato‐ risch auf synthetische Weise eine metaprädikative Handlung verbunden: die Anzei‐ ge der generellen Bewirkungsabsicht. Es ist nicht möglich, auf diese Anzeige zu verzichten. Es gibt keine gleichsam neutrale oder propositionale Prädikationshand‐ lung. Insofern sind propositionale Akte theoretische Konstrukte ohne reale Entspre‐ chungen. Jede verbale Prädikation über Gegenstände der Bezugnahme bringt Bewir‐ kungsabsichten zum Ausdruck und ist dadurch immer gleichzeitig ein Sprechakt. In dem Satz Der Vorstand entließ den Trainer bedeutet der Sprecher durch die indikativische Form (und die Satzgliedfolge), dass er die Prädikation von entlassen behauptend meint, dass er dem Partner also bedeu‐ tet, dass er sie für wahr hält. In der gleichen Weise sind auch die Konjunktive I und II sowie die Imperativform (Er komme, er käme, kommt!) synthetische illokutive Indikatoren, mit deren Verwen‐ dung metaprädikative Bedeutungshandlungen gemacht werden. Die Form des Kon‐ junktivs I dient der Anzeige, dass das Gesagte keine eigene Behauptung ist, sondern 95 dass lediglich die Aussage eines anderen ohne Kommentierung ihres Wahrheitsge‐ haltes wiedergegeben wird. Auch durch die Form des Konjunktivs II wird eine me‐ taprädikative Anzeige gemacht in dem Sinne, dass die (temporal spezifizierte) Aus‐ sage zwar als wahr vorstellbar, aber faktisch für nicht zutreffend gehalten wird: Ich wäre jetzt gern allein. Mir wäre beinahe der Kopf explodiert. Hätte er nichts gesagt, wäre alles noch gut. Neben dem obligatorischen Verbalmodus dient im Deutschen auch die regelhafte Stellung des finiten Verbs als illokutiver Indikator. So wird mit der Erststellung (in sog. Aufforderungs‐ oder Fragesätzen) eine appellative Absicht angezeigt. Zur An‐ zeige einer deskriptiven Intention wird das oberste finite Verb in Zweitstellung ge‐ bracht. Die verbale Prädikation wird nicht nur in einem bestimmten Modus, sondern obliga‐ torisch immer auch in einer bestimmten Temporalform gemacht. Es wird nicht nur nach den generellen Wahrheitsbedingungen, sondern immer auch temporal spezifi‐ ziert „ausgesagt“. Bei den sog. starken Verben wird die Temporalform durch Ablau‐ tung gebildet, bei den sog. schwachen Verben wird sie durch Endungsmorpheme ausgedrückt. Durch die Temporalform des Verbs wird also an der „Satzoberfläche“ ‐ neben der Anzeige der Bewirkungsabsicht ‐ eine zweite metaprädikative Handlung repräsentiert, die Temporaldeixis. So wird in Sie ging nach Hause. mittels der Temporalform angezeigt, in welchem zeitlichen Verhältnis das Behaupte‐ te zur Sprechsituation steht, dass nämlich – vereinfacht gesagt ‐ das Ereignis vor dem Sprechzeitpunkt stattfand. Die obligatorische Temporalform ist also die synthetische Ausdrucksform einer metaprädikativen Feststellung über die temporalen Verhält‐ nisse. So erfolgt durch die Präteritumsform ein Hinweis etwa in dem Sinn: Das war zeitlich vor dem Zeitpunkt meines Sprechens.63 Entsprechend wird mit der Prädikation in der Form des Plusquamperfekts in Sie war nach Hause gegangen. zum Ausdruck gebracht, dass nach Ansicht des Sprechers das Geschehen in der Ver‐ gangenheit vor einem anderen vergangenen liegt. Häufig erfolgt die an die Verbal‐ form gekoppelte synthetische Temporaldeixis in Verbindung mit entsprechenden Die mit den Tempusformen zum Ausdruck gebrachten Feststellungen sind relativ unbestimmt, so dass noch ziemlich viel Schlussfolgerungsaufwand nötig sein kann. So kann etwa die präsentische Form nicht nur als Gegenwart („wie Bezugszeit“) gemeint sein, sondern auch als Zukunft („nach Be‐ zugszeit“), Vergangenheit (historisches Präsens) oder als zeitlos. 63 96 temporaldeiktischen Wörtern wie jetzt, gestern, morgen, bald usw. Manchmal wird die temporaldeiktische Funktion der verbalen Tempusformen durch solche Wörter er‐ setzt ‐ wie in Er reist morgen ab. Wir gehen da gestern in die Kneipe. Da…. Wenn der verbale Ausdruck prädiziert wird – und das geschieht immer mit einer be‐ stimmten Bewirkungsabsicht ‐ wird also nicht nur ein Sprechakt gemacht, sondern es werden unter dem „Zwang“ der grammatischen Konventionen damit regelhaft ver‐ bunden gleichzeitig auch metaprädikative Handlungen gemacht, nämlich die An‐ zeige der Bewirkungsabsicht und die Anzeige der temporalen Verhältnisse des Fest‐ gestellten zum Sprechzeitpunkt. Mit ihnen wird also auf regelhafte Weise etwas über die zugrundeliegende Prädikationshandlung angezeigt. Die Prädikation des finiten Vollverbs ragt auch noch in einer anderen Hinsicht her‐ aus: Mit ihr wird eine Beziehung zwischen Gegenständen der Bezugnahme explizit ausgedrückt.64 Verbale Ausdrücke werden meist über mehrere Gegenstände der Be‐ zugnahme prädiziert, im Unterschied zu Adjektiven und Substantiven, die überwie‐ gend einstellige Prädikatoren sind.65 Zur Gebrauchsregel eines Verbs wie schenken gehört, dass man es über drei „Gegenstände“ prädiziert. Für seinen regelhaften Ge‐ brauch müssen also die Wahrheitsbedingungen des dreistelligen Relationsausdrucks schenken an Beispielen wahren Zusprechens gelernt worden sein und gleichzeitig auch die asymmetrische Richtung der Relation. Für das Verständnis der verbalen Prädikation ist es von entscheidender Wichtigkeit, die Argumente bzw. Komplemen‐ te im richtigen relationalen Bezug zu erfassen. Es macht ja einen Unterschied, ob der Lehrer den Schüler mobbt oder der Schüler den Lehrer. Angesichts dessen nutzt jede Sprache (auch jede formale) konventionelle metaprädi‐ kative Mittel synthetischer oder analytischer Art, mit denen verbindlich angezeigt wird, worüber prädiziert wird. Es geht dabei ‐ traditionell ausgedrückt ‐ um die An‐ zeige des Prädikats, des Subjektes und der Objekte. Das heißt, die oberste Prädikati‐ on wird in regelhafter Weise so gemacht, dass die Verhältnisse möglichst klar wer‐ den, dass also nicht geraten werden muss, was worüber mit welcher Absicht gesagt wird. Nicht nur im Deutschen ist die oberste Prädikation an den Merkmalen des 64 Das ist ein Unterschied zu prädikativen Fügungen, die ohne finiten Verbausdruck gemacht werden. In einer attributiven Fügung wie Das Geld von Hans ist die Attribuierung für sich genommen vage. Das wird bei der Entkomprimierung sichtbar: Das Geld, das Hans besitzt / besaß / verloren hat / bekommen wird usw. Vgl. dazu den weiter unten folgenden Abschnitt „Attributive Prädikationshandlungen“. 65 Bekannte Beispiele mehrwertiger Substantive sind Vater von…, Tochter von … und besonders Nomi‐ nalisierungen wie die Wahl von …, die Bestätigung von …. durch …, die Freude über … Beispiele für mehrwertige Adjektive sind etwa teilhaftig, hörig, abhängig, verwandt oder ähnlich. 97 Verbs gut zu erkennen. Das wichtigste ist seine Funktion als „Zeitwort“, insofern die Handlung der Temporaldeixis synthetisch an den verbalen Prädikator gekoppelt er‐ folgt. Für die strukturelle Anzeige, worüber in welchem relationalen Sinn prädiziert wird, verwenden die unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Mittel. Die wichtigsten sind Satzgliedfolge (wie im Englischen) oder Kasusmarkierungen (wie im Deutschen oder Lateinischen). Auch formalsprachliche Darstellungen von der Art P (c, a, b) kommen nicht ohne metaprädikative, indikatorisch wirksame Konventionen aus. Die Reihenfolge der in der Klammer aufgeführten Argumente hat dieselbe Funktion wie die Satzgliedstellung oder die Kasusformen. Ja, sie ist davon abgeleitet und imitiert sie. Mit den meisten verbalen Prädikatoren werden mehrstellige asymmetrische Bezie‐ hungen ausgesagt, für deren Wahrheit die Richtung der Relation entscheidend ist. So muss etwa beim Prädizieren von lieben angezeigt werden, wer der Liebende und wer der Geliebte ist. Zur Fixierung der Argumentstellen, die besonders bei asymmetri‐ schen Relationen wichtig ist, wird im Deutschen die Subjektposition in manchen Fällen sogar auf vierfache Weise hervorgehoben: Subjekte stehen meist in der ersten Position im Satz, in deskriptiv markierten Sätzen also direkt vor dem finiten Verb. Außerdem muss der verbale Ausdruck in Numerus und Personalform kongruent zum Subjekt prädiziert werden und dieses damit identifizieren. Des Weiteren ist das Subjekt bei nominalen Ausdrücken zusätzlich noch obligatorisch mit der nominativi‐ schen Form gekennzeichnet. Somit ist durch Satzgliedstellung, kasuelle Markierung und die numerische und personale Kongruenz des Verbs mit dem Subjekt in vielen Fällen die Richtung der prädizierten asymmetrischen Relation für den verstehenden Nachvollzug ausreichend bestimmt. Beim Prädizieren von finiten Verbalausdrücken werden im Deutschen bei den nominalen Komplementen obligatorisch Kasusmar‐ kierungen gesetzt. (In anderen Sprachen erfüllen z.B. Satzgliedstellung oder Postpo‐ sitionen diese Funktion.) Es gab häufig Versuche, eine allgemeine wahrheitsfunktionale Bedeutung der Kasus anhand inhaltsbezogener Kriterien zu bestimmen. So wurde das direkte Akkusativ‐ objekt als „Zielgröße“ charakterisiert, im Unterschied zum Dativobjekt, das als „Zu‐ wendgröße“ bezeichnet wurde. Das Subjekt wurde beispielsweise als „Grundgröße“, das Genitivobjekt als „Anteilsgröße“ umschrieben66. Andernorts wurde das Akkusa‐ tivobjekt als „Ziel“ der Verbalhandlung oder als „direktes intentionales Objekt“ der mit dem Verb ausgedrückten Tätigkeit angesehen. Wieder andere sahen als Kernbe‐ 66 Glinz, 1962, 157 ff. 98 deutung des Akkusativs die Kohärenzstiftung, wohingegen die Funktion des Dativs als Stiftung der Inkohärenz definiert wurde.67 Die Problematik solcher Charakterisierungen lässt sich einfach zeigen. Vergleichen wir die Rolle des Dativs bei schenken mit dem Dativ bei anderen Verben. Die Regel‐ hypothese für eine bestimmte Verwendungsweise von schenken wird an Beispielen wahren Zusprechens gebildet wie in Seinen Kindern schenkte er immer Computerspiele. Paul schenkte seinen Eltern ein Wellness‐Wochenende. Auch bei anderen Verben ist ein Komplement mit Dativ gekennzeichnet, etwa in Die Jünger folgten dem Herrn. Sie fehlte ihm. Worin aber soll nun die vermutete wesensmäßige Übereinstimmung in der Bezie‐ hung der Dativobjekte zu den Subjekten und anderen Objekten oder zu den Satzprä‐ dikaten bestehen? Dass auch bei anderen Verben jeweils ein Komplement mit Dativ markiert ist, heißt nicht, dass eine inhaltlich, kognitiv oder ontologisch gleiche Bezie‐ hung zwischen den mit Dativ markierten Objekten zu den Verben oder den Subjek‐ ten besteht. Die jeweilige und jeweils andere Beziehung zwischen Prädikat und Komplementen bzw. den Komplementen ist einzig und allein durch den jeweils prä‐ dizierten verbalen Relationsausdruck definiert: schenken oder folgen oder fehlen. Eine irgendwie durchgängige Gemeinsamkeit aller Beziehungen von Dativobjekten zu syntaktischen Prädikatsausdrücken oder Subjekten erscheint von vorneherein unrea‐ listisch und wurde auch nie nachgewiesen. Alle angenommenen „Inhalte“ der Kasus erwiesen sich empirisch betrachtet als entweder zu allgemein oder als zu eng defi‐ niert.68 Selbst wenn man grundlegende semantische Rollen annimmt, so werden sie durch unterschiedliche Kasus realisiert. Zumindest für die Kasus bei syntaktischen Ergänzungen (Komplementen) kann so‐ mit festgestellt werden: „Der Kasus einer Nominalphrase hat rein grammatische Funktion. Er ist das ausgezeichnete Mittel für grammatische Zusammenhänge.“69 Die 67 Willems 1997, 196 ff. vgl. Willems 1997. Zumindest bei präpositionalen Anschlüssen wie in Er ging hinter das Haus vs. Er ging hinter dem Haus lassen sich aber prädikative Qualitäten der Kasus erkennen. Hier macht die Ver‐ wendung des Akkusativs oder Dativs im Zusammenhang mit Präpositionen einen direkten Unter‐ schied in den Wahrheitsbedingungen. 69 Heringer 2001, 141. Die kasuelle Komponente von Endungsmorphemen ist im Allgemeinen konven‐ tionell erheblich unterbestimmt: Keine Flexionsklasse kennt für jeden Kasus unterschiedliche Endun‐ gen, manche Substantivgruppen haben im Singular gar keine Flexive, im Plural für alle dieselben (z.B. Vorstellung, Vorstellungen). Die Strukturindikation allein durch substantivische Endungsmorpheme ist durch diese geringe Differenzierung oft vage. Vereindeutigend wirken z.T. die Endungsmorpheme von Artikeln und Adjektiven in Nominalphrasen. 68 99 Funktion der Kasus ist es also, anzuzeigen, an welcher Position in einer mehrstelli‐ gen asymmetrischen Relation eine kasuell markierte Ergänzung (ein Referent) wahr‐ heitsfunktional gemeint ist. Das Prädikationsspiel wird einzelsprachlich unterschiedlich gespielt. Die Kasus ha‐ ben kein Monopol bei der Anzeige von Subjekt und Objekten. Die verschiedenen Sprachen lösen die Erfordernisse der strukturellen Indizierung mit unterschiedli‐ chen Konventionen. Wortstellungs‐ bzw. Satzgliedstellungsregeln sind ein grundle‐ gendes und vermutlich das älteste Mittel der Strukturindikation. Obwohl keine Satz‐ gliedfolge universell ist, zeigen Häufigkeitsverteilungen gewisse funktional erklärba‐ re Präferenzen. In den meisten Sprachen (etwa 90 Prozent) wird der Akteur vor der Aktion genannt, das Thema vor der Aussage. Weniger „natürlich“ ist die Stellung der Objekte. So setzen Sprachen wie das Englische, das Französische, Arabisch, Thai und viele andere das Verb vor das Objekt. Das Baskische, Japanische, Türkische und viele andere Sprachen ordnen die Satzglieder dagegen andersherum an. Sie lassen das Verb auf das Objekt folgen. Das Deutsche nutzt beide Varianten. Mit den Hauptsätzen gesellt es sich zur englischen Gruppe, mit seinen Nebensätzen bekennt es sich zur türkischen Variante und stellt das Verb ans Ende. Der Vorteil ist, dass durch Endstellung des Verbs indiziert wird, dass das von ihm dominierte Prädikati‐ onsgefüge Teil eines größeren ist. Auch innerhalb einer Sprache verändern sich die Wortstellungsregeln im Laufe der Zeit – wie man beispielsweise beim Vergleich heutiger Sätze des Deutschen mit Sät‐ zen Luthers erkennen kann. Alle diese konventionellen Varianten erfüllen ihre Zwe‐ cke. Entscheidend ist allein, dass sie als konventionelle metaprädikative Formen ob‐ ligatorisch sind und als regelhafte Hinweise verstanden werden. Die Relevanz und Rigidität von Regeln der Satzgliedstellung nimmt ab, wenn andere Strukturindikatoren entwickelt sind wie bei eher synthetischen Sprachen. Viele Spra‐ chen benutzen Kasusmarkierungen, beispielsweise das Lateinische oder abge‐ schwächt das Deutsche. Das Russische benutzt bestimmte Substantivendungen. Das Japanische, das wiederum Kasus nicht kennt, benutzt zur Kennzeichnung von Sub‐ jekt‐ und Objektposition Postpositionen wie ga oder o. Andere Sprachen markieren die Strukturpositionen am Verb. Isolierende Sprachen wie die heutigen chinesischen kennen weder Kasus noch Kongruenz, die strukturelle Indikation wird deshalb von einer relativ strikten Satzgliedstellung übernommen. Dagegen herrschen im Lateini‐ schen feste Kasusregulierungen für die Prädikation des Verbs. Deshalb lässt sich dort die Stellung der Satzteile sehr variabel gestalten und für zusätzliche Zwecke nutzen. Nichtmuttersprachler, die Kasus nicht richtig oder gar nicht verwenden, werden trotzdem meist verstanden. Für den Zuhörer ist ohne die hinweisende Kraft der Ka‐ 100 sus lediglich schwerer zu erkennen, wie der Sprecher verstanden werden will. Weil die Kasus nicht prädikativ, sondern metaprädikativ verwendet werden, und dabei nur ein Mittel der Strukturindizierung unter anderen sind, ist ihr Status sprachge‐ schichtlich entsprechend labil. Einzelne Regeln, die funktional nicht mehr nötig sind, werden nach den Gesetzen der Sprachökonomie nach und nach abgeworfen. Die ur‐ sprünglich acht verschiedenen Kasus, die noch das sogenannte Proto‐Indoeuro‐ päische kannte, sind heute nur noch im Sanskrit erhalten. Schon das Lateinische kannte nur noch sechs Kasus, deren verschiedene Endungen in den verschiedenen Deklinationsklassen zudem nach und nach immer mehr reduziert wurden. Ein be‐ sonders markantes und bekanntes Beispiel für das Absterben der Kasus bietet das Englische, das seit dem 12. Jahrhundert seine Kasus weitgehend eingebüßt hat. Aber auch im Deutschen passierte Ähnliches. Hatten im Althochdeutschen Nomina im Singular noch bis zu vier verschiedene Kasusendungen, verwenden wir heute nur noch zweieinhalb: (Der) Mann, (des) Mann‐es, (dem) Mann‐e. Und selbst diese Restbestände erscheinen bedroht, wenn man beispielsweise an den im heutigen Deutschen beobachtbaren „Kasus Verschwindibus“70 denkt, womit der bedrohte Genitiv gemeint ist. So findet man „Wir gedenken dem 180. Todestag Goe‐ thes“ oder – mit völliger Genitivauslöschung „Wir gedenken dem 180. Todestag von Goethe“. Innerhalb der deutschen Sprache wurden die Kasus immer schon in uneinheitlicher Regelhaftigkeit verwendet. Dass Berliner „Ick liebe dir“ bekennen, Gelsenkirchener „Gib mich mal das Messer“ sagen, macht nichts aus, da sie lieben bzw. geben immer so prädizieren, weshalb die Indizierung für sie stimmig ist. Für Vertreter des Hoch‐ deutschen erscheint sie abweichend, durch kurzes „Rechnen“ aber erschließbar. Wie viele Konventionen, so ist auch die, wie das finite Verb prädiziert wird, tenden‐ ziell unvollkommen. In Fällen, wo der Numerus des Subjekts und Objekts derselbe ist und auch die Kasusendungen nicht eindeutig sind, könnte noch die Satzgliedstel‐ lung helfen. Da auch diese nicht obligatorisch ist, kann bei der folgenden Pressemel‐ dung nur noch unser Alltagswissen helfen: Elterngeld: Nur jedes fünfte Kind wickelt Papa.71 Beispiele nach Sick 2008. Aus dem Anzeigenblatt „Illertissener Extra“, zitiert nach Spiegel 39/2001, S. 154 („Hohlspiegel“). 70 71 101 Zwischenfazit: Unsere Betrachtung von einfachen Sätzen zeigte: Grammatische Regeln sind Hand‐ lungsregeln. Prädikative Handlungen über Gegenstände der Bezugnahme sind un‐ sere sprachlichen Basishandlungen. Sie werden in jeder Sprache in jeweils verbindli‐ chen konventionellen Formen gemacht. Durch diese jeweils obligatorischen gramma‐ tischen Formen der verbalen Prädikation werden gleichzeitig und unvermeidlich metaprädikative Anzeigehandlungen gemacht. Einerseits wird z.B. durch obligatori‐ sche Kasus der relationale Zusammenhang einer Prädikation angezeigt (Was ist Sub‐ jekt, Objekt? ‐ Strukturindikation). Gleichzeitig werden durch die konventionelle Form der Prädikationshandlung auch die temporale Situierung (Temporaldeixis) und die Anzeige der mit der Prädikationshandlung verbundenen Bewirkungsab‐ sicht (illokutive Intention) zum Ausdruck gebracht. 72 Wir können also explizite Prädikationshandlungen bzw. Sprechakte nicht machen, ohne gleichzeitig unter dem Zwang grammatischer Regeln die metaprädikativen Handlungen der Strukturanzeige, der Temporaldeixis und der Anzeige der Bewir‐ kungsabsicht auszuführen. Wir haben von Anfang an gelernt, sie automatisiert mit‐ zumachen, mit der Folge, dass uns dieser Teil des sprachlichen Handelns kaum be‐ wusst ist. Hier mag einer der Gründe liegen, warum die Explikation des mit gram‐ matischen Regeln verbundenen sprachlichen Handelns teilweise so schwierig ist. Fraglich ist, ob wir wirklich alle drei bisher genannten metaprädikativen Handlun‐ gen als Handlungen im Sinne von Willenshandlungen bezeichnen dürfen. Zwar ent‐ spricht zumindest unser bewusster wahrheitsfunktionaler Gebrauch der Tempus‐ formen den Kriterien von „Handeln“. Auch bei der Anzeige der Bewirkungsabsich‐ ten haben wir über die grundsätzlich unvermeidlichen grammatischen Satzformen hinaus Spielräume. Wir können den Indikationszwang sogar unterlaufen, wie das Beispiel der indirekten Sprechakte zeigt. Dagegen können wir die strukturindikatori‐ schen Formen unserer Prädikationshandlungen (etwa Numeruskongruenz, Kasus, Genuskongruenz etc.) weder variieren noch vermeiden. Wir haben von Anfang an gelernt, bei unseren Sprechakten bzw. Prädikationshandlungen Strukturanzeigen au‐ tomatisiert in der regelhaften Form mitzumachen. Die Sprachgemeinschaft hat uns die Entscheidung diesbezüglich vollständig abgenommen. Funktional ist das Anzei‐ gen der Prädikationsstruktur zwar unser Handeln, aber wir können es weder unter‐ Bei einem ersten Blick auf die Bezugnahmen zeigen sich noch weitere indikatorische Handlungen. So kann etwa der Gebrauch der bestimmten und unbestimmten Artikel als kontextuelle Kommentie‐ rung betrachtet werden: Mit dem unbestimmten Artikel wird signalisiert, dass ein Gegenstand der Bezugnahme im Gesprächskontext neu ist, mit dem bestimmten, dass er im Gesprächskontext schon 72 eingeführt wurde. 102 lassen noch variieren, wenn wir kommunizieren wollen. Das Motto heißt hier: „So und nicht anders!“ 103 Referieren Die kommunikativen Basishandlungen von Sprechakten sind Prädikationshandlun‐ gen. Aber wie man einen Haken oder etwas Ähnliches braucht, um etwas daran auf‐ zuhängen, so gehören zum Prädizieren immer Gegenstände der Bezugnahme. Be‐ zugnahmen sind integrale und notwendige Bestandteile von Prädikationshandlun‐ gen. Wenn hier von Prädikationshandlungen die Rede ist, sind also immer Prädika‐ tionshandlungen über Gegenstände der Bezugnahme gemeint. Deshalb soll hier in aller Kürze die Rolle des Referierens als Teil des Prädikationsspiels skizziert wer‐ den.73 Mit bezugnehmenden Teilen unserer Satzäußerungen bestimmen wir Gegenstände, über die wir prädizieren. Gegenstand von Bezugnahmen kann alles sein, worüber sich etwas sagen (prädizieren) lässt. Mögliche Referenten sind Personen, Orte, Hand‐ lungen, Sachverhalte, Ausdrücke, Zeitpunkte oder „abstrakte“ Gegenstände wie Freiheit, Unschuld, Marktwirtschaft usw. Bezugnahmen erfolgen mittels Eigennamen (a) oder Titeln (b), Pronomina (c), De‐ monstrativa (d), definiten und indefiniten Kennzeichnungen (e, f) oder Quantoren‐ phrasen (g, h). a) Karl der Vierte b) der Papst c) er, sie, es, welcher, welche, welches, ... d) Diese da … e) das rote Auto in der Tiefgarage ... f) ein amerikanischer Freund … g) manche Amerikaner … h) alle Studenten der LMU ... Bei Bezugnahmen wird in der Regel angenommen, dass der Bezugsgegenstand exis‐ tiert, existiert hat oder existieren wird. Insofern sind Bezugnahmen Ausdruck von Existenzannahmen. Diese können allerdings auch fiktional sein wie bei literarischen Gegenständen Gustav Aschenbach betrachtete den Jungen Tadzio. oder hypothetisch wie in Ein Sieg von Nazideutschland hätte schreckliche Auswirkungen für die Menschheit gehabt. Dieser Abschnitt ist in keiner Weise als Beitrag zu einer Theorie des Referierens gedacht. Es geht nur um die Formulierung eines minimalen Sets von Annahmen, um Bezugnahmen als Teile des Prädikati‐ onsspiels zu veranschaulichen. 73 104 oder bei Martha sucht einen Märchenprinzen zum Heiraten.74 Hypothetisch ist die Existenzannahme vielleicht auch in Wir brauchen für Karl ein wirksames Medikament. Auch wenn der Sprecher nicht annähme, dass es ein solches Medikament gibt, refe‐ riert er mit der Phrase ein wirksames Medikament. Der entweder reale, fiktive oder hy‐ pothetische Gegenstand der Bezugnahme wäre zu beschreiben als etwas, was ein wirk‐ sames Medikament (gegen Karls Krankheit) ist. Bezugnahmen erfolgen also nach dem Muster Etwas, das ein x ist,… oder Etwas, das a heißt, … Welche Art von Existenz für den Bezugsgegenstand dabei angenommen wird, ist zweitrangig und gehört zum jeweiligen Hintergrundwissen. Eine ontologische Theo‐ rie ist jedenfalls nicht Voraussetzung für Bezugnahmen. Selbst auf nicht für existent Gehaltenes kann Bezug genommen werden – mit entsprechenden Einschränkungen für mögliche Aussagen darüber. Über solche Gegenstände der Bezugnahme sind keine empirischen Feststellungen möglich ‐ außer die Existenzverneinung: Etwas, was ein Z ist (was Z heißt), existiert nicht. Eine wichtige Form der Bezugnahme erfolgt mit den Mitteln des Prädizierens. In dem Satz Im Wartezimmer saß ein junger Mann mit besorgtem Gesicht. kommt z.B. die Phrase ein junger Mann mit besorgtem Gesicht für eine referentielle Verwendung in Frage. Vielleicht sind im kommunikativen Kontext die Attribute jun‐ ger und mit besorgtem Gesicht nicht referenznotwendig, sodass allein mit ein Mann re‐ feriert wird. Worüber etwas gesagt wird, wird hier mit den Mitteln der Prädikation in etwa folgendem Sinn bestimmt: Da ist ein x und dieses x ist ein Mann. Oder: Da ist ein x, insofern es ein Mann ist. Oder: Etwas, das ein Mann ist … 74 Dazu Reicher 2005, 232 f.: „Es ist eine empirische Tatsache, dass es Märchenprinzen, fiktive Roman‐ figuren und Filmheldinnen gibt, weil es Märchen, Romane und Filme gibt, in denen Figuren vorkom‐ men, die frei erfunden sind. (…) Es ist falsch, dass fiktive Gegenstände nicht existieren. Wahr ist vielmehr: Fiktive Gegenstande sind keine raum‐zeitlichen Gegenstände. Falsch ist auch, dass Pegasus nicht existiert. Wahr ist aber: Pegasus ist kein raumzeitlicher Gegenstand.“ 105 oder etwas, das als Mann zählt … Hier wird also mit einer prädikativen Kennzeichnung in Verbindung mit einer Exis‐ tenzannahme ein Bezugsgegenstand für Prädikationen geschaffen. Weil dabei die Bezugnahme mit Mitteln der Prädikation erfolgt, wurde Referenz in solchen Fällen als eine spezifische Form der Prädikation betrachtet.75 Eine prädikative Bezugnahme erfolgt verbunden mit Artikelwörtern, durch welche zum Ausdruck gebracht wird, dass der mit Mann prädikativ bestimmte Gegenstand im Gesprächskontext entweder noch nicht eingeführt (ein Mann) oder schon einge‐ führt ist (der Mann). Artikelwörter werden hier also regelhaft zum Ausdruck entspre‐ chender Annahmen verwendet. Nach der Einführung des Mannes in den Gesprächskontext kann im Folgenden z.B. mittels Pronomina wie er oder sein auf ihn Bezug genommen werden, z.B. in Er saß in gekrümmter Haltung. Seine Augen bewegten sich unruhig. Referenz mit Pronomina erfolgt auf einen vorher schon – nicht pronominal ‐ einge‐ führten Referenten. Pronomina ersetzen ‐ oft aus Stil‐ oder Effizienzgründen ‐ Eigen‐ namen oder Kennzeichnungen. Das gemeinte Objekt der pronominalen Bezugnahme wird durch Kongruenz von Genus und Numerus ‐ hier von er und seine mit Mann ‐ verdeutlicht. Eine dritte Form der Referenz sind Bezugnahmen mittels Eigennamen. Sie erfolgen nach dem Muster Etwas, das a heißt oder Da ist etwas, was a heißt. Wie u.a. Kripke76 ge‐ zeigt hat, ist es nicht möglich, für Eigennamen so etwas wie eine Bedeutung oder Wahrheitsbedingungen zu bestimmen, auch nicht mittels einer Kennzeichnung oder eines Bündels von Kennzeichnungen. Ein Eigenname kann deshalb nicht Subjekt ei‐ nes analytischen Satzes sein. Es gibt keine Wahrheitsbedingungen, die Eigennamen mit Notwendigkeit zukommen. Wenn wir das erste Mal einen Eigennamen hören, ist er potentiell noch Subjekt aller möglichen synthetischen Sätze. Eigennamen funktio‐ nieren „nicht als Beschreibungen, sondern als Nägel, an denen Beschreibungen auf‐ gehängt werden“77. Mit Eigennamen nehmen wir Bezug, wir prädizieren sie nicht. Auch in einem referenzfixierenden „Taufakt“ wie mit Das ist Paul. wird Paul nicht prädiziert (nicht: Das ist ein Paul). Es wird nur festgelegt: Das da nennen wir (als einziges) Paul. vgl. Searle 1971, 182. Kripke 1981. 77 Searle 1971, S. 258 75 76 106 Voraussetzung für das Gelingen einer solchen Namenseinführung ist, dass das zu Benennende bereits als einzelnes Objekt unterschieden ist. Manchmal genügt unsere biologische Ausstattung, dass wir ein Gesicht oder einen Ort einmal gesehen, eine Melodie einmal gehört haben, um den damit verknüpften Namen danach wahrheits‐ gemäß verwenden zu können. Manchmal brauchen wir auch Wiederholungen, also die Wiederkehr Desselben (und nicht wie beim Lernen von Prädikationsregeln die Wiederkehr des Gleichen), um die empirische Verbindung zwischen Namen und Gegenstand dauerhaft zu fixieren. Nach einer oder mehreren „Tauf“‐ oder Einfüh‐ rungssituationen ist mit einem Namen eine visuelle oder sonstige sinnliche Erinne‐ rung verbunden. Das mit einem Namen Verbundene muss sprachlich nicht ausge‐ drückt werden können. Meist kann über den Namensträger aber etwas gesagt wer‐ den, weil man ihn prädikativ charakterisieren kann. Außer mit Referenzfixierungsakten auf der Grundlage sinnlich‐empirischer Erfah‐ rungen können Eigennamen auch mit Tatsachenbehauptungen eingeführt werden, wie z.B. John Kerry in John Kerry ist ein ehemaliger amerikanischer Präsidentschaftskandidat. John Kerry ist der amerikanische Außenminister. John Kerry ist Ehemann von Theresa Heinz, einer Erbin des Heinz‐Ketchup‐Imperiums. Weder sind diese Sätze als einzelne analytisch noch sind sie es als ein Bündel kenn‐ zeichnender Aussagen.78 Wenn einer der Sätze über J. Kerry für wahr gehalten wird, sind allerdings bestimmte weitere Aussagen über John Kerry per Weltwissen ausge‐ schlossen. Wird der erste der drei Sätze für wahr gehalten, kann die Wahrheit des folgenden Satzes durch allgemeines Wissen ausgeschlossen werden: John Kerry ist Russe. Sowohl für S als auch für H gelingt eine Bezugnahme mittels Eigennamen nur, wenn mit dem Namen ein wie immer geartetes Tatsachenwissen (oder sinnliches Erinne‐ rungswissen) verbunden ist. Das führt zu Redewendungen wie Ich weiß, wer John Kerry ist. Ich habe ihn schon gesehen. (Ich würde ihn also wiedererken‐ nen.) oder Ich kenne John Kerry als Außenminister der Vereinigten Staaten. Manchmal ist das nötige Wissen allein schon aus der Form des Namens zu gewin‐ nen. Die Bezugnahme in Rachel Weisz wird unterschätzt. Searle nahm an, dass aus einer Reihe von identifizierenden Beschreibungen „die Disjunktion dieser Beschreibungen mit dem Namen Aristoteles analytisch verknüpft“ sei. Searle 1971, S. 253. 78 107 kann verstanden werden, auch wenn der Name Rachel Weisz noch unbekannt ist. Denn aus dem Namen lässt sich hier für die meisten erschließen, dass Rachel der Name einer Frau, evtl. aus einem bestimmten Sprachraum sein dürfte. Insofern kann ein Namen auch eine Art Indikator sein, ob er für eine Person, ein Land usw. ver‐ wendet wird. Das für den Gebrauch eines Namens nötige Wissen muss nicht identifizierend sein. Man kann über Rachel Weisz reden, wenn man nur weiß Rachel Weisz ist eine englische Schauspielerin. Eine identifizierende Kennzeichnung wie mit Rachel Weisz ist die weibliche Hauptdarstellerin in „The Fountain“. macht in der Kommunikation nur unter bestimmen Bedingungen einen Unterschied, etwa wenn H sich an die Hauptdarstellerin in diesem Film erinnert, ohne den Na‐ men zu kennen. Auch wenn Eigennamen selbst nicht prädiziert werden, sind sie doch Teile des Prä‐ dikationsspiels. Mit ihnen wird, ebenso wie mit prädikativen Kennzeichnungen, Pronomina, Titeln usw. ein Prädikationsspiel gleichsam eröffnet und ermöglicht: Etwas, das X heißt,… Bei der Verwendung eines Eigennamens nehmen S und H an, dass der Namensträger im relevanten Kontext als Einziger so genannt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob seine Existenz als real, fiktiv oder hypothetisch angesehen wird. Darüber hinaus können S und H ähnliches oder unterschiedliches Wissen über den Referenten ha‐ ben. Dieses Wissen kann, muss aber nicht identifizierend sein. Bei der Interpretation von Sätzen als Ausdrucks‐Oberflächen sprachlicher Handlun‐ gen können Eigennamen und Pronomina überwiegend Referenzhandlungen zug‐ ordnet werden. Für Nominalphrasen ist die Entscheidung manchmal schwierig. Die Diskussion zu diesem Thema in der umfangreichen Literatur leidet darunter, dass selten ein tragfähiges Kriterium, wann ein Ausdruck referentiell verwendet ist, ex‐ pliziert wird.79 Immerhin lassen sich einige typische Beispiele nicht‐referentieller Verwendung von Nominalphrasen erkennen: Bei sogenannten kopulativen Verben wie sein, werden, bleiben, nennen, ansehen, betrach‐ ten usw. werden Nominalphrasen oft beschreibend als Prädikative verwendet: Er ist (bleibt) ein Idiot. Exemplarisch dafür ist die zirkuläre Definition bei Blühdorn 2008: „Unter Referenz wird die Bezug‐ nahme auf Referenten verstanden, also auf konkrete oder abstrakte Entitäten in der äußeren Situation und/oder in der Vorstellung der Kommunikationspartner.“ Was das Kriterium für Referenz bzw. Be‐ zugnahme ist, wird nicht expliziert. Ist es die Existenzannahme? Und wenn ja: von welcher Art? 79 108 Viele sehen in ihm einen Guru. Sie betrachtet das als lässliche Sünde. Nicht referentiell verwendet sind Nominalphrasen z.B. auch in Phraseologismen bzw. metaphorischen Ausdrucksweisen wie in Er haute seinen Partner übers Ohr. Sie hatten wieder einmal Schwein. Wie auch immer man die Kriterien für referentiellen Gebrauch fasst, eine Entschei‐ dung über die Handlungen „unterhalb“ der Satzoberflächen kann immer nur im Hinblick auf entkomprimierte Satzformen erfolgen. Ein einfaches Beispiel ist Der Untergang der Titanic erschütterte die Welt. Das grammatische Subjekt besteht aus einer Nominalphrase mit Genitivattribut. Die referentiellen und prädikativen Verhältnisse werden aber erst in der entkomprimier‐ ten Version erkennbar: Die Titanic ging unter. Das (diese Tatsache) erschütterte die Welt. In den entkomprimierten Sätzen zeigen sich folgende Referenzobjekte: die Titanic, die Tatsache, dass sie unterging und die Welt (, die erschüttert wurde). Bezugnahmen sind also integrale Teile von Prädikationshandlungen, den Basishand‐ lungen sprachlicher Kommunikation. Mit ihnen werden Existenzannahmen hinsicht‐ lich von Gegenständen ausgedrückt, die durch prädikative Kennzeichnungen (etwas, das ein x ist) oder mit Eigennamen (etwas, das a heißt) geschaffen oder fixiert wer‐ den. Insofern sind Bezugnahmen Voraussetzungen von Prädikationen. 109 Konventionelle Unterbestimmtheit und Pragmatik Wir machen sprachliche Handlungen und wir machen sie regelhaft so, dass nach‐ vollziehbar ist, dass wir sie machen. Die Aufgabe einer handlungstheoretischen Semantik ist die Beschreibung dieses Bedeutungshandelns. Ihr Gegenstand ist zum einen das sprachliche Handeln nach Regeln. Dabei geht es um Prädikationshandlun‐ gen, aber auch um metaprädikative Handlungen wie Strukturanzeige, die Anzeige von Bewirkungsabsichten oder Temporaldeixis. Für diese symbolischen Bedeu‐ tungshandlungen werden Regeln benötigt, etwa die regelhaften Bedingungen für die wahrheitsfunktionale Anwendung von Prädikatoren und Satzwörtern, aber auch die grammatischen Regeln. In diesem Sinn ist die Grammatik Teil der Semantik. Regeln bestimmen die einzelsprachlich obligatorischen Formen des Prädikationsspiels und ermöglichen das Bedeutungshandeln und dessen verstehenden Nachvollzug. Auch die Pragmatik ist integraler Teil einer Theorie des sprachlichen Handelns. Sie beschreibt das beabsichtigte Bedeutungshandeln, soweit es konventionell nicht aus‐ gedrückt oder ausdrückbar ist. Oder von der Seite des Rezipienten her: Gegen‐ standsbereich der Pragmatik ist, wie wir über das hinaus, was (regelhaft) gesagt wird, mithilfe unseres Hintergrundwissens rekonstruieren, was gemeint ist, also was der Sprecher zum Ausdruck bringen will. Obwohl also das Prädikationsspiel sowohl lexematisch als auch grammatisch relativ strikt konventionalisiert ist, ist für den verstehenden Nachvollzug nahezu ständig konversationeller „Rechenaufwand“ nötig. Für die Differenz zwischen dem Gemein‐ ten und dem konventionell Bedeuteten gibt es verschiedene Ursachen: Jede Konversation erfolgt mit der Annahme, dass auch der Partner schon manches weiß. So nimmt man meist an, dass der Partner weiß, was im vorausgegangenen Ge‐ spräch bereits gesagt wurde. Auch wird ihm ein bestimmtes Wissen über die Welt unterstellt. Es ist nicht nötig, immer bei Adam und Eva anzufangen. Und dieses an‐ genommene Wissen des Partners können wir nutzen. Wir sagen im Sinne der Öko‐ nomie das, was wir als bekannt voraussetzen, oft nicht mehr explizit. Damit sparen wir Zeit und Aufwand. Somit ist das, was wir explizit bedeuten, tendenziell weniger als das, was wir insgesamt bedeuten wollen. Bei allen Formen solchen elliptischen Sprechens muss aber das Weggelassene vom Rezipienten als Mitgemeintes bekannt sein oder erschlossen werden können. Ein Grund für Differenzen zwischen dem Gemeinten und dem konventionell Bedeu‐ teten sind auch mögliche Unterschiede zwischen den Regelkenntnissen der Kommu‐ nikationspartner, etwa wenn dem Zuhörer Ausdrücke oder bestimmte Verwen‐ dungsweisen von Ausdrücken nicht geläufig sind. In solchen Fällen kann dieser das Bedeutungshandeln des Gegenübers nicht nachvollziehen, weil er bestimmte Regeln 110 nicht kennt. Oder er vollzieht es nach seinen eigenen Regelkenntnissen nach. Das kann zu unbemerkten Missverständnissen führen oder dazu, dass das Gesagte für den Rezipienten keinen nachvollziehbaren Sinn ergibt. Dann muss dieser, wenn er annimmt, dass der Partner das Kooperationsprinzip befolgt, Erschließungsarbeit leis‐ ten, um die vom Partner vorausgesetzten Regeln herauszubekommen. Dazu kommt noch die tendenzielle konventionelle Unterbestimmtheit des Bedeu‐ tungshandelns. Zwar wählen wir manchmal nicht eindeutige konventionelle For‐ men. Aber oft sind die Regeln auch schlicht nicht ausreichend. In beiden Fällen müs‐ sen Unterbestimmtheiten auf der Basis des Kooperationsprinzips und der Maximen durch Rekurs auf Kontext‐ und Weltwissen „pragmatisch“ kompensiert werden. Ein Beispiel für eine konventionelle Unterbestimmtheit ist die Anzeige von Bewir‐ kungsabsichten. Die jeweilige Bewirkungsabsicht kann durch illokutive Indikatoren immer nur verallgemeinert bedeutet werden, etwa als appellativ oder kommissiv. Ob eine als appellativ angezeigte Bewirkungsabsicht aber als Rat, als Befehl oder als Bit‐ te verstanden werden soll, ist nur auf der Grundlage hintergründigen Wissens oder bestimmter Annahmen – in diesem Fall über das Verhältnis zum Gesprächspartner – zu erschließen. Noch stärker fällt die Unterkonventionalisierung bei den sogenann‐ ten indirekten Sprechakten ins Gewicht. Hier ist eine regelhafte Anzeige der Bewir‐ kungsabsicht überhaupt nicht möglich. Ob eine regelhaft als Feststellung angezeigte Satzäußerung evtl. als Empfehlung, als Warnung oder als Versprechen gemeint sein könnte, kann nur durch Nutzung des Wissens über den Gesprächspartner und die bisherige Kommunikation sowie durch zusätzliches Weltwissen „errechnet“ werden. Auch die strukturellen Indikatoren der Grammatik sind nicht immer eindeutig. Weil die kasuelle Komponente der Endungsmorpheme unterbestimmt ist, ergeben sich im Deutschen manchmal bereits bei einfachen Sätzen Verständnisprobleme we‐ gen struktureller Mehrdeutigkeiten. Und diese Unterbestimmtheiten nehmen bei er‐ weiterten und komplexen Sätzen noch zu. Deiktische Ausdrücke sind immer konventionell unterbestimmt. Sie sind so etwas wie Variablen, deren prinzipielle Vagheit nur durch den Rekurs auf den Zusammen‐ hang der Äußerung bzw. das gemeinsame Wissen beseitigt werden kann. Diese kon‐ ventionelle Unterbestimmtheit zeigt sich z.B. an Ausdrucksformen der Tempo‐ raldeixis. Man denke nur an die vierfache Verwendung der präsentischen Verbal‐ form zum Anzeigen der Gegenwart („wie Bezugszeit“), der Zukunft („nach Bezugs‐ zeit“) oder der Vergangenheit (historisches Präsens) oder als Anzeige für zeitlos gül‐ tige Aussagen. Entsprechendes gilt für präpositionale Zeitangaben wie vor zehn Jah‐ ren oder für deiktische Ausdrücke wie jetzt, gestern, bald, letztes Jahr usw. 111 Weitere Beispiele bieten die Bezugnahmen. Sowohl personaldeiktische Ausdrücke (z.B. ich, du, er …) müssen jeweils kontextuell fixiert werden, wie auch prädikative Kennzeichnungen wie das rote Auto. Auch Ort und Zeit müssen häufig aus dem Kontext bestimmt werden, damit eine Aussage einen Wahrheitswert haben kann. Ähnliches ist der Fall bei lokaler Deixis wie mit dort, hier, hinter dem nächsten Haus, bei Partikeln wie herein oder hinaus oder bei Verben wie kommen und gehen. Wir ver‐ fügen über kein genetisch fundiertes GPS, mit dem wir jedem Platz im Universum einen unverwechselbaren Namen geben könnten. So helfen wir uns mit relationalen Angaben in Bezug auf unsere raumzeitliche Position. Auch bei Quantifikationen ist eine kontextuelle Bestimmung erforderlich wie z.B. bei Alle wurden krank. Alle Formen elliptischen Sprechens bedingen einen Erschließungsaufwand. So wer‐ den etwa graduelle Adjektive meist elliptisch verwendet: Karlchen ist groß (für einen Jungen seines Alters). Wir sind reich (im Vergleich zu …). Das ist gut (im Vergleich mit … und im Hinblick auf …). Bei der Prädikation solcher Gradadjektive verlassen wir uns darauf, dass die Partner das Weggelassene aus ihrem Kontext‐ und Weltwissen heraus ergänzen oder erset‐ zen. Die Tasche ist zu klein. heißt eben zu klein für den hier vorgesehenen Zweck. Der pragmatische Ergänzungsaufwand nimmt selbst bei einfachen Sätzen schon zu, wenn Subjekte oder Objekte Nominalisierungen von Verben enthalten. Solche kom‐ primierten Nominalphrasen enthalten keine syntaktischen Prädikate, aber sie treten oft an die Stelle ganzer expliziter Sätze: Er bereute sein Bleiben. (Er bereute, dass er geblieben war. ‐ Er war (wo?) geblieben. Das bereute er.) Immerhin sind elliptische Ausdrucksweisen wie etwa Nominalisierungen vermeid‐ bar. Komprimierte Ausdrucksweisen sind eine grundsätzliche Eigenschaft unserer Spra‐ che. Das sieht man besonders an erweiterten Sätzen. Die Grammatik bietet hier nicht nur die Möglichkeit für komprimierte Ausdrucksweisen, sie scheint dafür geradezu geschaffen worden zu sein. Erweiterte Sätze bieten die Möglichkeit zur Steigerung der kommunikativen Effizienz. Dabei werden in erweiterten Sätzen häufig Teile 112 weggelassen. Die durch derartige Ellipsen entstandenen Latenzen müssen pragma‐ tisch gefüllt werden. Wie die Grammatik die Möglichkeiten elliptischen Sprechens geradezu schafft und somit pragmatischen Ergänzungsaufwand gleichsam voraussetzt, soll in den folgen‐ den Kapiteln an verschiedenen Formen von Satzerweiterungen gezeigt werden. Zu‐ vor sind aber in aller Kürze noch einige Vorüberlegungen zur handlungstheoreti‐ schen Interpretation erweiterter Sätze nötig. 113 Bedeutungshandlungen als „Tiefenstruktur“ von Sätzen Sprechakte werden durch Prädikationshandlungen gemacht, und diese gehen über Gegenstände der Bezugnahme. Als Bedeutungshandlungen werden Prädikations‐ handlungen in konventionellen Formen gemacht, so dass sie als solche verstanden werden können. Die obligatorischen grammatischen Formen der Prädikationshand‐ lungen dienen der Strukturindikation, der Temporaldeixis sowie der Anzeige der Bewirkungsabsicht. Die gemeinsamen grammatischen Regeln helfen beim verste‐ henden Nachvollzug. Das alles erkennt man sehr gut an einfachen Sätzen. Was aber ist mit erweiterten und komplexen Sätzen? Der Standardauskunft der Sprechakttheorie zufolge machen wir Sprechakte, indem wir auf bestimmte „Gegenstände“ sprachlich Bezug nehmen (referieren) und dar‐ über etwas sagen (prädizieren). Je nach quantitativer Valenz des finiten Verbs wird ein‐ oder mehrfache Referenz angenommen: (1) Der letzte Sonntag verlief überraschend friedlich. (einfache Bezugnahme) (2) Die besorgten Nachbarn des Randalierers riefen wahrscheinlich die Polizei. (zweifache Bezugnahme) (3) Sie schenkte mir nur Großvaters Taschenuhr. (dreifache Bezugnahme) Nach dieser Auffassung wären die fettgedruckten verbalen Ausdrücke in der Positi‐ on des syntaktischen Prädikats prädikativ, die unterstrichenen Ausdrücke referenti‐ ell verwendet. Berücksichtigt man die für Sprechakte konstitutive Rolle von Bewir‐ kungsabsichten, ließe sich eine zweiwertige Prädikation sprechakttheoretisch fol‐ gendermaßen darstellen: P (a,b) Sprechakt Bedingung: konstitutive Bewirkungsabsicht Allerdings erweist sich die mit dieser Darstellung ausgedrückte Auffassung als gro‐ be Vereinfachung. Zum ersten wird die jeweilige Prädikationshandlung P (a, b) nicht als propositionaler Akt gemacht, der erst durch das zusätzliche Hinzutreten einer Bewirkungsabsicht zum Sprechakt wird. Vielmehr ist die Bewirkungsabsicht selbst nur durch die Prädikationshandlung möglich und ausdrückbar. Zweitens übersieht das Modell der Sprechakttheorie schon bei der Beschreibung ein‐ facher Kernsätze die metaprädikativen Handlungen der Strukturindikation, der Temporaldeixis, sowie der Anzeige der Bewirkungsabsichten. Wir können ja Prädi‐ kationshandlungen nicht machen, ohne gleichzeitig durch ihre obligatorische kon‐ 114 ventionelle Form ihre innere Struktur (Was ist Subjekt, Objekt?), die temporale Situ‐ ierung und die Bewirkungsabsicht zum Ausdruck zu bringen. Drittens werden mit der obigen Standarderklärung die mit Satzwörtern gemachten Handlungen nicht erfasst. Man bedenke nur, was in (1) – (3) mit überraschend, wahr‐ scheinlich und nur bedeutet wird. Viertens bleibt die Beschreibung des Referierens ungenügend. Worauf wird etwa mit der Nominalphrase Die besorgten Nachbarn des Randalierers in (2) Bezug genommen? Auf die Nachbarn, auf den Randalierer oder auf beide? Ähnliches fragt man sich bei (3): Wird nur auf eine Taschenuhr Bezug genommen oder auch auf einen bestimmten Großvater oder auf beides? Und fünftens bleibt besonders die Beschreibung des Prädizierens unklar. Das wird an erweiterten und komplexen Sätzen deutlich. Nach der obigen Darstellung könnte man annehmen, dass nur verbale Lexeme prädiziert würden. Dies widerspricht aber sowohl der Definition von Prädikatoren, wie auch der Tatsache, dass auch in bezug‐ nehmenden Satzteilen Prädikatoren verschiedener Art auftauchen – oft in komplexen Häufungen. Der vereinfachende Charakter des Standardmodells wird schon an je‐ dem halbwegs komplexen Satz deutlich, aber ganz besonders, wenn man ein literari‐ sches Beispiel wie das folgende heranzieht: (4) In einer höhlenartigen, künstlich erleuchteten Koje des inneren Raumes, wohin Aschen‐ bach sofort nach Betreten des Schiffes von einem buckligen und unreinlichen Matrosen mit grinsender Höflichkeit genötigt wurde, saß hinter einem Tische, den Hut schief in der Stirn und einen Zigarettenstummel im Mundwinkel, ein ziegenbärtiger Mann von der Physiog‐ nomie eines altmodischen Zirkusdirektors, der mit grimassenhaft leichtem Geschäftsgebaren die Personalien der Reisenden aufnahm und ihnen die Fahrscheine ausstellte.80 In der restriktiven Lesart wäre von allen 66 Lexemen dieses Satzes allein der einstel‐ lige verbale Prädikator saß (bzw. sitzen) prädiziert und zwar ‐ nach der Valenz des Verbs sitzen ‐ über einen einzigen Referenten in grammatischer Subjektposition, der in dieser als „ein ziegenbärtiger Mann von der Physiognomie eines altmodischen Zirkusdirektors“ eingeführt wird. Diese Subjektphrase enthält jedoch zahlreiche Prädikatoren, von denen die meisten attributiv über Mann prädiziert zu sein schei‐ nen. So wird wohl mittels des Prädikators Mann bezugnehmend ein Gegenstand be‐ stimmt, über den prädiziert wird, er sei ziegenbärtig (Adjektivattribut) und er habe eine bestimmte Physiognomie (präpositionales Attribut), über die wiederum gesagt wird, sie sei die eines Zirkusdirektors (Genitivattribut), über den gesagt wird, er sei altmodisch (Adjektivattribut). Und mit dem unbestimmten Artikel ein bei Mann wird der indikatorische Hinweis ausgedrückt, dass dieser Mann im bisherigen Kontext Thomas Mann, Der Tod in Venedig, S. 23. 80 115 noch nicht erwähnt wurde. So erweist sich diese Subjektphrase als „Oberfläche“ ei‐ nes auch grammatisch genau beschreibbaren Gefüges sprachlicher Handlungen, ins‐ besondere als Ausdruck von relativ komplex auf einander bezogenen Prädikations‐ handlungen. Auch in dem nachgeführten Relativsatz, der syntaktisch betrachtet noch zum grammatischen Subjekt gehört, (der mit grimassenhaft leichtem Geschäftsgebaren die Personalien der Reisenden aufnahm und ihnen die Fahrscheine ausstellte) werden offen‐ kundig zahlreiche prädikative Aussagen gemacht, die sich auf dasselbe Subjekt, den schon eingeführten Mann, beziehen. Was aber ist mit dem einleitenden lokalen Adverbiale In einer höhlenartigen, künstlich erleuchteten Koje des inneren Raumes, wohin Aschenbach sofort nach Betreten des Schiffes von einem buckligen und unreinlichen Matrosen mit grinsender Höflichkeit genötigt wurde? Es ist wohl auf saß bezogen und ist wiederum Ausdruck verschiedener in einem be‐ stimmten strukturellen Zusammenhang gemachten Prädikationen. So werden über eine bestimmte Koje verschiedene attributive Aussagen gemacht, wie etwa, dass sie höhlenartig und künstlich erleuchtet ist etc. Prädikationshandlungen können also nicht nur durch das syntaktische Prädikat von Sätzen repräsentiert werden, sondern grundsätzlich von allen Satzteilen, auch sol‐ chen, die der Bezugnahme dienen. Damit ist die Standardauskunft, Sprechakte würden durch Referenz‐ und Prädikati‐ onsakte gemacht, zur Erklärung der grammatischen Wirklichkeit des sprachlichen Handelns nicht ausreichend. Zum einen werden in dieser Auffassung verschiedene metaprädikative Handlungen nicht zur Kenntnis genommen. Zum anderen wird keine Erklärung geliefert, wie viele Referenz‐ und Prädikationsakte („propositiona‐ len Akte“) in erweiterten und komplexen Sätzen jeweils tatsächlich zum Ausdruck gebracht werden und in welchem Zusammenhang sie stehen. Wenn wir die tatsäch‐ lichen sprachlichen Handlungen „hinter“ oder „unter“ den Satzoberflächen erfassen wollen, müssen wir uns um eine differenziertere Beschreibung bemühen. Bei der Of‐ fenlegung der „Tiefenstrukturen“ von „Oberflächensätzen“ kann es aber ausschließ‐ lich um die Beschreibung von Handlungen gehen. Das ist der wesentliche Unter‐ schied zu Theorien, wo Sätze und Lexeme der Tiefenstruktur letztlich auf kognitive Kategorien bezogen werden.81 81 Es war ein großes Verdienst der transformationellen Grammatik, Regeln zu formulieren, wonach erweiterte und komplexe Sätze auf einfache Sätze der bedeutungs‐ und verstehensrelevanten Tiefen‐ struktur zurückgeführt werden konnten. Allerdings wurden diese Sätze nicht als Ausdruck von re‐ gelhaften Handlungen interpretiert. Stattdessen wurden in der semantischen Komponente tiefenstruk‐ turelle Lexeme auf atomare Bedeutungsteile zurückgeführt. Deren Gesamtheit sollte ‐ meist in Form syntaktischer Fügungen ‐ die Bedeutung des Lexems beschreiben. Dabei galten die atomaren Lexeme als Beschreibungen angeborener mentaler Entitäten. Allerdings kann über mentale Konzepte nichts gesagt werden ‐ außer mit den Ausdrücken, die ihnen angeblich entsprechen. Zur Beschreibung der 116 In der kommunikativen Praxis ist die Handlungsstruktur von Sätzen durch ellipti‐ sche oder komprimierte Ausdrucksweisen häufig verdeckt. Es gilt demzufolge, die potentiell inexplizite grammatische „Oberflächenstruktur“ so zu interpretieren, dass die zugrundeliegenden sprachlichen Handlungsverhältnisse klar werden. Dabei darf der bewährten Annahme gefolgt werden, dass komplexe und erweiterte Sätze so‐ weit auf einfache Sätze zurückgeführt werden können, bis die Struktur der diesen zugrundeliegenden Handlungen transparent wird. Wo das sprachliche Handeln in der Praxis aus ökonomischen Gründen gleichsam stenografisch verkürzt oder komprimiert erfolgt, gelingt ein vollständiges Verstehen nur durch entkomprimierenden Nachvollzug. Verstehensseitig geht es darum, die in „Kurzform“ gemachten Handlungen möglichst explizit nachzuvollziehen. Andern‐ falls bleibt das Verstehen im Ungefähren – und das ist wahrscheinlich in der fakti‐ schen Kommunikation öfters der Fall. Die Auflösung erweiterter und komplexer Sätze in aufeinander bezogene elementare Sätze kann im Prinzip sowohl durch umgangssprachliche Paraphrasen wie auch mit Hilfe formaler Darstellungen erfolgen, wie sie aus der Transformationsgrammatik oder aus logischen Grammatiken bekannt sind. Solche formalen Darstellungen zei‐ gen uns aber nicht wirklich, auf welche Weise wir Sätze verstehen, sondern sie be‐ schreiben ex post das Ergebnis eines auf der Basis der Umgangssprache bereits er‐ folgten Verstehensprozesses. Niemand versteht Sätze einer Sprache A dadurch, dass er eine Sprache B beherrscht, in die er sie übersetzen kann. Niemand versteht z.B. Deutsch, weil er auch Japanisch kann. Vielmehr kann man Sätze der Sprache A erst nach B übersetzen, wenn man sie als Rezipient innerhalb der Sprache A verstanden hat. Und das für unsere Zwecke nötige explizierende Übersetzen heißt: Dieselben Handlungen, die in der Sprache A gemacht werden, in der Sprache B zu machen, wobei in der Sprache B die Verhältnisse möglichst nicht mehr verdeckt sind. Dabei kann die Sprache B mit Sprache A identisch sein. In diesem Kapitel sollen Sätze als Ausdruck sprachlicher Handlungen beschrieben und die Funktionen grammatischer Regeln für diese Handlungen skizziert werden. Zur Bestimmung der grammatischen „Oberfläche“ werde ich mich an einer linguisti‐ schen („Oberflächen“‐) Grammatik der deutschen Sprache orientieren82. Solche Bedeutung von sprachlichen Ausdrücken ist der Verweis auf solche kognitiven Entitäten wirkungslos. Tatsächlich setzte sich die Transformationsgrammatik mit dieser semantischen Konzeption allen Kri‐ tikpunkten der Vorstellungstheorie aus – und wenn ich es recht sehe, trifft diese Kritik heute vielleicht auch auf die sog. Kognitive Semantik zu. Unter den linguistischen Grammatiken des Deutschen erscheint mir für diesen Zweck am besten ge‐ eignet Hans Jürgen Heringers „Lesen lehren lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen.“ Ihrer Intention und dem ganzen Vorgehen nach kommt sie von allen mir bekannten grammatischen Dar‐ stellungen einer handlungstheoretischen Beschreibung am nächsten. 82 117 Grammatiken beschreiben die tatsächlichen Satzoberflächen sprachlicher Handlun‐ gen in ihren häufig verkürzten und komprimierten Formen. Denn an der grammati‐ schen Oberfläche werden sprachliche Handlungen oftmals nur elliptisch zum Aus‐ druck gebracht. In solchen Fällen besteht die Arbeit des Rezipienten oder Interpreten darin, solche komprimierten Ausdrucksformen soweit auf explizite Sätze zurückzu‐ führen, dass die Struktur der zugrundeliegenden Prädikationshandlungen wieder nachvollziehbar wird. Die Darstellung der den Sätzen zugrundeliegenden Handlungen und der Funktionen grammatischer Regeln geschieht im Folgenden an der Umgangssprache orientiert und weitgehend nichtformal. Denn das Ziel ist eine Beschreibung des Bedeutungs‐ handelns des normalen Sprachteilhabers. Und dieser sollte nach guten hermeneuti‐ schen Prinzipien seine eigene sprachliche Praxis darin wiedererkennen können. Zwar ermöglichen formale Darstellungen nicht das Verstehen von Sätzen der Um‐ gangssprache, wohl aber sind sie in bestimmten Fällen besonders geeignet, dieses Verständnis klar darzustellen. Sie erklären aber nicht, wie sprachliches Handeln und Verstehen gelingen, sondern mit ihnen wäre lediglich ex post entkomprimiert in eine formale Sprache übersetzt, was vorher innerhalb der natürlichen Sprache bereits ver‐ standen sein muss. Dieses Verstehen muss auf der Basis der Umgangssprache ge‐ schehen, es kann nur umgangssprachlich geschehen. Das Spiel kann nur gespielt werden, indem es gespielt wird, nicht, indem man ein anderes spielt. Aber man kann es zum Zwecke der Erläuterung auch explizit bzw. entkomprimiert spielen – und zwar in derselben Sprache. Und wenn man es dann im Hinblick auf bestimmte Zwe‐ cke für sinnvoll hält, kann man das Spiel nachträglich übersetzend auch in einer an‐ deren Sprache spielen, also die Handlungen in einer anderen, vielleicht auch forma‐ len Sprache machen, mit dem Ziel, dass dann auch dort die Handlungen klar wer‐ den. Um die an den grammatischen Satzoberflächen zum Ausdruck kommenden Bedeu‐ tungshandlungen zu bestimmen, habe ich bei einfachen Sätzen (Kernsätzen) des Deutschen begonnen, in denen die Handlungsverhältnisse und die Funktion gram‐ matischer Konventionen unmittelbar erkennbar sind. Schon in diesen einfachen Sät‐ zen können sich erste Verdeckungseffekte zeigen, etwa durch Nominalisierungen. Sie werden noch verstärkt bei Attributen oder adverbialen Erweiterungen auftreten. Dort wird die elliptische Komprimierung zum gestalterischen Prinzip, zur gleichsam stenografischen Standardform der Grammatik sprachlichen Handelns. 118 Attributive Prädikationshandlungen Prädikationshandlungen sind die Basishandlungen der Kommunikation. Sie dienen dem Ausdruck von Bewirkungsabsichten und sind dadurch gleichzeitig Sprechakte. Ihre Ausdrucksformen sind Sätze. Oft wollen wir mehr sagen als das, was wir in ei‐ ner einzigen Prädikationshandlung ausdrücken können. So entstehen textuelle Rei‐ hen von Sätzen. Sie repräsentieren Ketten von Prädikationshandlungen. Aber dieses kleinschrittige Nacheinander ist umständlich. Wir möchten es beschleunigen und mehrere Prädikationshandlungen zusammen machen. Dazu nutzen wir die gramma‐ tischen Regeln der erweiterten oder komplexen Sätze. Die einfachsten Texte sind Ketten von einfachen, nicht erweiterten Sätzen. Warum wir meist nicht in solchen simplen Texten reden, verdeutlicht folgendes Beispiel: Stellen wir uns einen Kellner vor, der jede Tasse und jedes Glas einzeln zu den Gäs‐ ten trägt oder jeweils nur die Bestellungen eines einzigen Gastes bringt. Er würde schnell die Geduld der Kundschaft überstrapazieren. Es gibt für ihn aber eine einfa‐ che Möglichkeit, seine Arbeit effizienter zu machen und Zeit zu sparen. Mithilfe ei‐ nes Tabletts könnte er mehrere Gedecke, Gerichte und Getränke auf einmal transpor‐ tieren. Bezogen auf das sprachliche Handeln wäre unser ungeübter Kellner mit einem Men‐ schen vergleichbar, der jede seiner prädikativen Handlungen in einem einfachen Satz eins zu eins zum Ausdruck bringt. Er würde etwa so reden: (5) Da saß ein Mann. Das tat er im Wartezimmer. Er war jung. Er war nervös. Sein Gesicht sah besorgt aus. In allen Sätzen wird auf denselben Mann referiert und etwas über ihn ausgesagt. Diese einzelnen Sätze werden durch Mittel der Kohärenz, in diesem Fall rückverwei‐ sende Pronomina, miteinander verbunden. Nun gibt es auch in der Sprache eine Art Tablett, so dass nicht mehr nur relativ umständlich jeweils einzelne mit einander verbundene Kernsätze geliefert werden können, sondern mehrere auf einmal. Unser sprechender „Kellner“ könnte, statt in so kurzschrittigen Sätzen wie in (5) zu reden, mithilfe grammatischer Konventionen die vier letzten Aussagesätze attributiv in den Ausgangssatz integrieren und sie alle zusammen in zeitsparender Form „auf dem Tablett“ servieren: (6) Im Wartezimmer saß ein nervöser junger Mann mit besorgtem Gesicht. Der Gedanke, dass erweiterte und komplexe Sätze aus elementaren Sätzen aufgebaut sind, hat eine lange Tradition. Dementsprechend können die Attribute in (6) als Ein‐ fügungen externer Sätze wie in (5) interpretiert werden. An dieser Stelle wird sicht‐ bar, dass unser Kellnerbeispiel ein wenig hinkt. Während der echte Kellner die be‐ stellten Speisen und Getränke auf seinem Tablett hoffentlich vollständig transpor‐ 119 tiert, werden die zu einem erweiterten Satz verschmolzenen Kernsätze meist etwas verkürzt geliefert. So wurden von den in (5) noch expliziten und vollständigen Aus‐ gangssätzen bei der Integration in (6) die finiten Verben gelöscht. Hier setzt die grammatische Formulierung bereits pragmatischen Ergänzungsaufwand voraus. Bei einer in solcher Weise verkürzten Ausdrucksweise wird von der Annahme ausge‐ gangen, dass das Weggelassene auf der Seite des Rezipienten bei Bedarf wieder er‐ gänzt werden kann – wenn es nicht im Detail unerheblich ist. Alle grammatisch beschreibbaren Sätze sind einzelsprachliche Formen von Prädika‐ tionshandlungen über Gegenstände der Bezugnahme im Dienste von Bewirkungsab‐ sichten. Erweiterte oder komplexe Sätze sind Oberflächen mehrerer verbundener Prädikationshandlungen. Erweitert oder komplex sind diese Sätze, weil in ihnen re‐ kursiv weitere Sätze bzw. Prädikationshandlungen in meist verkürzter Form einge‐ bettet sind. Zur Effizienzsteigerung werden also mehrere Prädikationshandlungen miteinander verbunden gemacht. Zu einem erheblichen Teil erfolgen diese Satzein‐ bettungen im Dienste der Zeitökonomie elliptisch, das heißt, Teile der eingebetteten Sätze verschwinden. Nur so ist ja Zeit zu sparen. Bei der rezeptionsseitigen Erfas‐ sung der Prädikationshandlungen müssen zur Rekonstruktion Kontext‐ und Welt‐ wissen genutzt werden. Ein Sprecher setzt also bei seinem Bedeutungshandeln in der gewählten elliptischen Form pragmatische Erschließungsarbeit voraus – oder er stuft ein gewisses Maß an Ungenauigkeit als irrelevant ein. Jedenfalls werden an den grammatischen Oberflächen von attributiv erweiterten Sät‐ zen die prädikativen Handlungen, die bei Kernsätzen meist noch klar erkennbar sind, nicht mehr in allen Fällen vollständig explizit ausgedrückt. Solche elliptischen Ausdrucksweisen müssen aber kein Problem sein. Kompetente Sprecher berücksich‐ tigen das Wissen ihrer Partner und komprimieren nur dann, wenn sie die Vestehens‐ voraussetzungen für erfüllt halten. Für ökonomisches Sprechen sind Attribuierungen jedenfalls ziemlich effektiv. Grammatikalisch werden die verschiedenen Attribuierungen gewöhnlich so unter‐ schieden. Satzförmige Attribute: Relativsätze: der Mann, der vom Himmel fiel; Attributsätze: die Annahme, er sei ein Genie; Infinitivkonstruktionen: alle Bemühungen, den Brand zu löschen. Nominalphrasen: Präpositionalattribute: der Flug über den Nordpol; Genitivattribute: die Stunden eines Schulvormittags; 120 Appositionen: seine Tochter, ein heißer Feger. Außerdem: Adjektiv – Attribute: eiserne Disziplin und große Hingabe; Partizipien: der grimassierende Entertainer; Adverbien: der Vorfall neulich. Grad und Effizienz der Kompression sind bei den verschiedenen Arten von Attribu‐ ierungen unterschiedlich. Relativ‐ und Attributsätze sind vollständige Einbettungen ursprünglich selbständiger Sätze. Die dadurch entstehenden komplexen Sätze sind nicht elliptisch, sie bieten daher kaum größere zeitökonomischen Vorteile, erfordern aber andererseits auch keinen besonderen Erschließungsaufwand. Auch alle anderen Attribuierungen sind rekursive Einbettungen von Sätzen, aber in elliptischer Form. Sie sind komprimierte Ableitungen aus vollständigen einzelnen Sätzen. Infinitivkonstruktionen fehlt das Subjekt, den anderen fehlt das im Aus‐ gangssatz vorhandene finite Verb. Solche elliptischen attributiven Prädikationen werden deshalb im Folgenden als prädikative Fügungen bezeichnet – in Abgren‐ zung zu expliziten Prädikationen in kompletter Satzform. Sie werden zwar, wie alle Attribute, über einen Bezugsgegenstand prädiziert. In ihrer elliptischen Form ge‐ schieht das aber nicht mehr explizit, denn das finite Verb bzw. das Subjekt wird weggelassen. Das bringt den Zeitgewinn – letztendlich aber nur, wenn der anfallen‐ de Erschließungsaufwand vom Rezipienten geleistet werden kann. Bei allen Prädikationen, egal, ob nun elliptisch oder explizit, muss metaprädikativ bedeutet werden, worüber sie gehen. Auch bei attributiven Fügungen müssen durch grammatische Konventionen die strukturellen Zusammenhänge angezeigt werden. Anders gesagt: Es muss durch die regelhafte Form bedeutet werden, über welche Be‐ zugsgegenstände die attributiven Prädikationen gehen. Das heißt, bei der Einbettung externer Sätze in der Form von Attributen machen wir dem Zwang grammatischer Konventionen folgend immer gleichzeitig und automatisiert auch metaprädikative Handlungen der Strukturanzeige. Die indikatorische grammatische Form Attribute sind als Teile von Nominalphrasen über den nominalen Kern, meist ein Substantiv, prädiziert – entweder restriktiv im Dienste der Bezugnahme oder expli‐ kativ, etwa im Sinne zusätzlichen Behauptens. Wie alle anderen werden auch die at‐ tributiven Prädikationen in bestimmten verbindlichen Formen gemacht, gelehrt und gelernt. So haben wir als Mitglieder einer Sprachgemeinschaft nicht die Wahl, sie an‐ 121 ders zu machen. Das bietet den kommunikativen Vorteil, dass ihre Bezüge vom Hö‐ rer unmittelbar an der Form erkannt und nachvollzogen werden können. Denn er macht sie als Mitglied derselben Sprachgemeinschaft genauso. Die strukturindikato‐ risch wirksame Form der attributiven Prädikation wirkt als ein metaprädikativer Hinweis des Inhalts: „Was ich sage, sage ich über dieses.“ Das einfachste strukturindikatorisch wirksame konventionelle Mittel ist die Positio‐ nierung im linearen Gefüge. So stehen satzförmige Attribute im Deutschen unmit‐ telbar rechts vom Bezugswort: Die Annahme, dass die Menschen vernünftig werden .... Der Mann, der niemals krank war … Bei Appositionen wird der strukturelle Zusammenhang nicht allein durch Rechtsstel‐ lung, sondern zusätzlich durch Kasuskongruenz angezeigt: Er pflegte seinen Sohn, einen stürmischen Jungen, streng zu erziehen.83 Bei adjektivischen und partizipialen Attributen wird der prädikative Bezug kon‐ ventionell durch ihre Linksstellung bedeutet und zusätzlich noch durch obligatori‐ sche Kasus‐, Numerus‐ und Genuskongruenz mit dem Bezugswort: Mit interessierten Blicken nahm sie das silberne Kettchen in die Hand. Durch die Regeln der Wortstellung und Kongruenz wird gesichert, dass die Attribu‐ te interessiert und silbern jeweils als Prädikationen in Bezug auf Blicke bzw. Kettchen gemeint und verstanden werden. Entsprechende Regeln sind auch für die anderen attributiven Fügungen verbindlich. Die genitivische Attribuierung beispielsweise hat grammatisch in Rechtsstellung zu erfolgen – bei Eigennamen oft in Linksstellung – und mit genitivischer Markierung: Lexikon der Rechtsirrtümer, die Entdeckung des Himmels, Deutschlands wechselhafte Geschichte. Präpositionale Attribute sind den Regeln entsprechend – eingeleitet durch eine Prä‐ position ‐ direkt rechts an Substantive anzuschließen, wodurch ihr Zusammenhang relativ eindeutig angezeigt wird: Das Haus ohne Hüter, 83 Diese Kasuskongruenz wird im heutigen Deutschen, auch im Journalismus, allzu oft vernachlässigt. Ihre funktionale Wichtigkeit kann an folgendem Beispiel demonstriert werden: Xavi Hernandez, den Mann der tausend Pässe, Barςas Gehirn der letzten Dekade, hat Rakitić auf die Bank verdrängt. (Zeit online, 5.6. 2015) Nach der heute häufigen falschen Praxis würde man den Satz mit falschem Kasus sinnwidrig so for‐ mulieren: Xavi Hernandez, der Mann der tausend Pässe, Barςas Gehirn der letzten Dekade, hat Rakitić auf die Bank verdrängt. 122 Drei Männer aus Texas, Ein Mann für gewisse Stunden, Die Liebe in Gedanken usw. Attribute sind also als Einbettungen von externen Sätzen bzw. Prädikationshandlun‐ gen zu interpretieren, die sich auf einen Referenten des aufnehmenden Satzes bezie‐ hen. Durch ihre obligatorischen grammatischen Formen wird der Bezug solcher at‐ tributiven Einbettungen angezeigt. Satzförmige Attribute stehen beispielsweise un‐ mittelbar rechts vom Bezugswort, adjektivische und partizipiale links davon, usw. Handlungstheoretisch gesehen macht also der Sprecher unvermeidlich gleichzeitig und automatisiert mit jeder attributiven Prädikation die metaprädiktive Handlung der Strukturindikation. Bei satzförmigen Attributen wie Relativsätzen wird die Strukturindikation sogar doppelt gemacht. Einmal wird die innere Struktur des Re‐ lativsatzes angezeigt (Was ist worüber in welcher Richtung prädiziert?), zum ande‐ ren wird durch die Stellung des Relativsatzes dessen prädikativer Bezug angezeigt. Darüber hinaus kann bei satzförmigen Attributen das finite Verb nur verbunden mit gleichzeitiger Temporaldeixis prädiziert werden. Dabei wird allerdings im Unter‐ schied zu Hauptsätzen nicht der zeitliche Zusammenhang zum Sprecherzeitpunkt angezeigt, sondern der zeitliche Zusammenhang zu dem im Hauptsatz ausgedrück‐ ten Sachverhalt, also v.a. Gleichzeitigkeit oder Vorzeitigkeit. Man kann also auch bei Attribuierungen feststellen, dass der metaprädikative Teil des sprachlichen Handelns unter dem Zwang grammatischer Konventionen weitgehend automatisiert und inso‐ fern mehr oder weniger unbewusst erfolgt. 123 Konventionelle Unterbestimmtheit beim attributiven Prädizieren Die grammatische Form attributiver Prädikationen verdeutlicht also ihren strukturel‐ len Bezug. Handlungstheoretisch sind die verbindlichen grammatischen Formen der Attribuierungen also als metaprädikative Hinweise zu interpretieren, worauf der Sprecher sich mit ihnen jeweils bezieht. Das funktioniert weitgehend zuverlässig. Dennoch kann sich bei Attribuierungen eine grundsätzliche konventionelle Lücke auftun, was die Verdeutlichung der zugrundeliegenden Handlungen betrifft. Restriktiv werden Attribuierungen genannt, wenn sie zur einschränkenden Bestim‐ mung des Bezugsgegenstandes verwendet werden. In derselben grammatischen Form werden bestimmte Attribuierungen allerdings auch explikativ gemacht, das heißt, sie dienen der Aussage über Gegenstände der Bezugnahme, die bereits hinrei‐ chend unterschieden sind. Die grammatische Form gibt im Deutschen bei Adjektiv‐ attributen, Relativsätzen und Partizipien keine diesbezüglichen Verstehenshinweise. Das heißt, dass an der Oberfläche der Sätze mit solchen Attributen durch deren Form nicht angezeigt wird, welche Handlungen genau mit ihnen verbunden sind. Es ist unbestimmt, ob die attributiven Prädikationen der Bezugnahme dienen oder der Aussage über Gegenstände der Bezugnahme. Denn zur Unterscheidung dieser inten‐ tionalen Doppelsinnigkeit gibt es bei bestimmten Formen von Attribuierungen im Deutschen keine konventionellen Ausdrucksmittel.84 So ist schön wahrscheinlich restriktiv gemeint in: (7) Schöne Frauen sind als Lehrerinnen für Jungenklassen problematisch. Wenn allerdings ganz allgemein (8) Frauen sind als Lehrerinnen für Jungenklassen problematisch. geglaubt würde, wäre schön eine Art zusätzliche Aussage in feststellender Absicht. Die Unterscheidung restriktiver (bezugnehmender) und explikativer (deskriptiver) Absichten ist nur pragmatisch möglich. Da es allgemein zum Wissen gehört, dass nicht alle Frauen schön sind, dürfte schön in (7) restriktiv gemeint sein und der Be‐ zugnahme dienen. Ähnlich liegen die Verhältnisse bei Die fleißigen Chinesen erobern die Weltmärkte. Wird nur auf die Chinesen allgemein Bezug genommen und über sie gesagt, dass sie fleißig sind und (deshalb?) die Weltmärkte erobern? Oder wird auf die fleißigen Chi‐ nesen Bezug genommen und nur über diese eine Aussage gemacht? Das Englische kennt zumindest im Schriftlichen Mittel der Verdeutlichung: Non‐restrictive clauses werden mit Komma markiert: My dad, who is 60 years old, ..... Dagegen: The man whom I met today...... In der Tendenz leitet that restriktiv gemeinte Relativsätze ein, which dagegen nicht restriktive. Allerdings ist auch diese Unterscheidung nicht zuverlässig. 84 124 Die Prädikation von tüchtig in Die tüchtigen deutschen Fußballer haben wieder einmal gewonnen. ist explikativ gemeint, wenn die Referenz auch ohne tüchtig gelingt. Solche explikati‐ ven Attribuierungen sind als Attribute „maskierte“ zusätzliche Aussagen, deren de‐ skriptive Intention in getrennten Sätzen wie diesen deutlicher würde: Die deutschen Fußballer sind tüchtig. Sie haben wieder einmal gewonnen. Während Attribuierungen in Form von Relativsätzen, Adjektiven und Partizipien sowohl für Bezugnahmen als auch für explikative Aussagen verwendet sein können, sind Appositionen in der Regel explikativ gemeint: Sie redeten über Griechenland, den hoffnungslosesten Fall unter allen Krisenländern. Alle anderen Formen von Attributen werden dagegen wohl als Teile bezugnehmen‐ der Phrasen, also restriktiv, verwendet: adverbiale Attribute: der Junge dort; Genitivattribute: die Vorzüge meines Bruders; präpositionale Attribute: die Brücke über die Drina; Attributsätze: die Ansicht, Griechenland sei ein hoffnungsloser Fall, … Zusammenfassend lassen sich folgende typische intentionale Verwendungsweisen der verschiedenen Attribuierungen unterscheiden: bezugnehmende Ver‐ deskriptive Verwendung bezugnehmende oder de‐ wendung (restriktiv) (explikativ) skriptive Verwendung adverbiale Attribute Appositionen Adjektivattribute Genitivattribute Relativsätze Präpositionale Attribute Attributsätze Partizipien 125 Attributive Ellipsen Bei bestimmten Attribuierungen ist im Deutschen also an der grammatischen Form nicht erkennbar, ob mit ihnen einschränkende Bezugnahmen oder deskriptive Prädi‐ kationen gemacht werden. Wer sie verwendet, setzt voraus, dass der Partner die dem Attribut zuzuordnende Handlung erschließen kann. Dieser Erschließungsaufwand ist der Preis der ökonomischen Effizienz. Er dürfte in den meisten Fällen aber un‐ problematisch sein. Zu dieser grundsätzlichen konventionellen Unterbestimmtheit kommen nun aber bei den verschiedenen grammatischen Arten attributiver Fügungen noch weitere, jeweils spezifische hinzu. Präpositionale Attribuierungen erscheinen handlungstheoretisch als unproblema‐ tisch. Ihr prädikativer Bezug ist weitestgehend klar durch ihre Stellung rechts vom Bezugswort. Zudem sind sie restriktiv, also bezugnehmend verwendet. Dass sie als attributive Fügungen elliptisch sind, dürfte in den seltensten Fällen zu Verstehens‐ probleme führen. Obwohl bei den attributiven Fügungen in Das Mädchen mit den langen Haaren singt im Chor. oder Die Flugroute über den Nordpol ist die kürzeste. die syntaktischen Prädikate der Ausgangssätze fehlen, bereiten diese Verkürzungen selbst ohne Kontextwissen kaum Schwierigkeiten. Gemeint ist eben: Das Mädchen trägt lange Haare. Es singt im Chor. (Das Mädchen, das lange Haare trägt, singt im Chor.) Und es wird auf eine Flugroute Bezug genommen und über sie ausgesagt: Die Flugroute führt über den Nordpol. Sie ist die kürzeste. (Die Flugroute, die über den Nordpol verläuft, ist die kürzeste.) Im Allgemeinen ist also der elliptische Cha‐ rakter präpositionaler Attribuierungen relativ leicht kompensierbar. Allerdings sind präpositionale Phrasen nicht nur das Gewand von Attribuierungen. In derselben Form können auch (frei hinzufügbare) adverbiale Bestimmungen auftre‐ ten. Manchmal kommt es deshalb zu Doppelsinnigkeiten wie in den folgenden Bei‐ spielen: (9) Sie betrachteten die Explosion im Weltall. (10) Er zählte die Personen im Wald. (11) Polizei tötet Mann mit Machete. Die Rechtsstellung signalisiert zuerst einmal den prädikativen Bezug auf eine Explo‐ sion, bestimmte Personen bzw. einen Mann. In diesem Verständnis könnten mit den präpositionalen Phrasen referentiell notwendige attributive Aussagen gemacht sein: 126 (9a) Sie betrachteten die Explosion, die sich im Weltall ereignete. (Die Explosion ereignete sich im Weltall. Diese betrachteten sie.) (10a) Er zählte die Personen, die im Wald waren. (Personen lebten im Wald. Diese zählte er.) (11a) Polizei tötet einen Mann, der eine Machete trägt / herzeigt usw. Die präpositionalen Phrasen wären in dieser Interpretation also restriktiv verwende‐ te Attribute und dienten der Bezugnahme. Allerdings bleibt durch den Wegfall des finiten Verbs eine nicht unerhebliche elliptische Offenheit. Die in den paraphrasie‐ renden Sätzen gewählten verbalen Ausdrücke könnten auch andere sein. Zudem können die präpositionalen Phrasen auch als adverbiale Bestimmungen verstanden werden, etwa in folgendem Sinne: (9b) Sie betrachteten die Explosion. Das taten sie im Weltall (vom Weltall aus, als sie im Weltall waren usw.). (10b) Er zählte die Personen. Das tat er im Wald (als er im Wald war / lebte usw.). (11b) Polizei tötete einen Mann. Das tat sie mit einer Machete. Die Doppeldeutigkeit entsteht bei solchen Beispielen vor allem durch Isolation von Kontexten. Bei (11) ist sogar ohne Kontextbezug die richtige Zuordnung erschließbar. Für Linguisten mögen solche Sätze interessante theoretische Anschauungsbeispiele sein. In der praktischen Kommunikation dürften damit wohl eher selten Probleme auftreten. Überschriften sind dagegen Beispiele, wo ein Kontext im Moment, in dem man sie liest, häufig noch fehlt. Deshalb irritiert eine Zeitungsüberschrift wie diese: (12) Obama begrüßt die ersten Menschen auf dem Mond. Hier können der präpositionalen Phrase – besonders durch das Attribut erste bedingt ‐ gleich mehrere mögliche Handlungen zugeordnet werden: (12a) Obama begrüßte die ersten Menschen. Diese waren/sind auf dem Mond. (Sie leben/ leb‐ ten auf dem Mond, werden/wurden auf dem Mond gefangen gehalten usw.). Bei dieser Interpretation wird die präpositionale Phrase als explikatives Attribut be‐ trachtet. Über die ersten Menschen wird gesagt, dass sie auf dem Mond leben bzw. lebten. Diese Interpretation muss als nicht plausibel verworfen werden, wenn man annimmt, dass die ersten Menschen wohl nicht mehr leben. (12b) Obama begrüßte die ersten Menschen. Das tat er auf dem Mond. (Das war auf dem Mond. Da war er auf dem Mond.) (Adverbiale Interpretation: Elliptische Aussage über Obamas Begrüßen.) Auch diese Rezeptionshypothese (präpositionale Phrase als adverbiale Bestimmung) muss bei einem Mindestmaß an Weltwissen verworfen werden. So bleibt am Ende nur die Möglichkeit, die sehr spezielle Komprimierung im Sinne folgender Paraphra‐ se aufzulösen: 127 (12c) Obama begrüßte die Menschen, die als erste auf dem Mond waren. In der kommunikativen Praxis stehen Sätze aber nicht als solcherart isolierte Über‐ schriften, sondern in einem diskursiven Zusammenhang, wodurch derartige Mehr‐ deutigkeiten meist auflösbar sind. Besondere Doppelsinnigkeiten, die nur kontextuell aufzulösen sind, können bei prä‐ positionalen Attribuierungen auch durch Nominalisierungen mehrstelliger Verben entstehen: (13) Die gezielten Tötungen von Polizisten in brasilianischen Slums erregte die Öffentlich‐ keit. (14) „Der Spiegel“ berichtet über die sensationelle Entdeckung von drei deutschen Forschern in der Arktis. Die zugrundeliegende Handlungs‐ bzw. Prädikationsstruktur ist hier an der gram‐ matischen Form nicht eindeutig erkennbar. Was worüber gesagt ist, muss zum Teil erschlossen werden: (13a) Polizisten haben in brasilianischen Slums gezielt (Menschen?) getötet. Das erregte die Öffentlichkeit. (13b) In brasilianischen Slums wurden Polizisten gezielt (von ?) getötet. Das erregte die Öf‐ fentlichkeit. (14a) Drei deutsche Forscher wurden in der Arktis entdeckt. Der Spiegel berichtete über diese sensationelle Entdeckung. (14b) Drei deutsche Forscher haben in der Arktis eine sensationelle Entdeckung gemacht. Das berichtet der Spiegel. Explizite Prädikationen wie auch die komprimierenden prädikativen Fügungen er‐ folgen zum Zweck der Strukturindikation in verbindlichen grammatischen Formen, so dass erkennbar wird, worüber sie jeweils gemacht sind. Die genitivische Attribu‐ ierung ist an ihrer Rechtsstellung– bei Eigennamen der Linksstellung ‐ und der geni‐ tivischen Flexionsform erkennbar. In dieser Form machen und erkennen wir sie und erkennen daran ihren Bezug: a) Peters Geld; b) Peters Hund; c) Peters Krankheit; d) der Begriff der Semantik; e) Esmas Geheimnis; f) die Opfer des Anschlags; g) der Betrachter des Bildes; 128 h) Thailands Touristen sind besorgt. Genitivische Attribuierungen sind elliptische Einbettungen von ursprünglich selb‐ ständigen Sätzen. So bleibt beispielsweise in a) – c) der jeweilige Zusammenhang von Peter mit seinem Hund, seinem Geld oder seiner Aufmerksamkeitsstörung hinter der attributiven Gleichförmigkeit offen. Erst die expliziten Ausgangssätze oder Relativs‐ ätze mit finiten Verben würden Licht in die Verhältnisse bringen: Das Geld, das Peter besitzt / besaß / angelegt hat / verloren hat/ verbraucht hat usw. Die Krankheit, an der Peter leidet / litt / die bei ihm festgestellt wurde / die er vorgibt usw. An der Vielfalt der in den entkomprimieren Ausgangssätzen denkbaren verbalen Prädikatoren wird der elliptische Charakter der genitivischen Attribuierung offen‐ kundig. Was der Sprechende hier voraussetzt, muss der Rezipient aus seinem Wissen ergänzen oder offen lassen. Allerdings erfolgt elliptisches Sprechen normalerweise vor dem Hintergrund eines angenommenen gemeinsamen Hintergrundwissens. Das heißt, die bei der genitivischen Attribuierung im Vergleich zum Ausgangssatz weg‐ gelassene verbale Prädikationshandlung wird vor dem kontextuellen Hintergrund als bekannt vorausgesetzt. Nur dann erzielt man den Vorteil der Kürze, ohne ihn durch Verstehensprobleme und Zusatzerklärungen wieder einzubüßen. Die hintergründige pragmatische Substitution des finiten Verbs gelingt bei d) nur schwer. Unmöglich ist jedenfalls eine Interpretation des Genitivattributs als Subjekt eines entkomprimierten Satzes analog den Beispielen a) bis d): *Der Begriff, den die Semantik hat. So bleibt nur der Verdacht, dass hier eine „entgleiste“ Formulierung vorliegt, deren vermeintliche philosophische Tiefe verschwindet, wenn man sprachtherapeutisch zu „der Begriff Semantik“ nachbessert. Elliptisch sind auch die attributiven Fügungen in e) bis g). Sie lassen sich gut, aber nicht immer eindeutig auflösen: das Geheimnis, das um Esma besteht, das Esma hütet, das Esma verbirgt usw.; diejenigen, die einem Anschlag zum Opfer fallen, fielen, fallen werden; derjenige, der das Bild betrachtet, betrachtete, betrachtet hat, betrachten wird usw. Nur durch Rekurs auf Weltwissen ist die genitivische Attribuierung in h) aufzulösen: In Thailand sind Touristen aus anderen Ländern. Sie sind besorgt. / Aus Thailand sind viele Touristen (anderswo) unterwegs. Sie sind besorgt. Besondere Komprimierungseffekte können auftreten, wenn elliptische Genitivattri‐ bute auf nominalisierte Verben bezogen sind: Die Ankunft der S‐Bahn verzögert sich. Die Reparatur der S‐Bahn verzögert sich. 129 Hier muss erschlossen werden, wer was tut. In der Praxis macht aber die erschlie‐ ßende Entkomprimierung bei diesen Beispielen keine Probleme. Es ist klar, dass im ersten Beispiel gemeint sein muss, dass die Bahn ankommt („Genitivus subjectivus“). Etwas anders liegt der Fall im zweiten Beispiel, wo das zweiwertige Verb reparieren nominalisiert wird, so dass hinter dem Gefüge ein passiver oder aktiver Satz stecken kann. Da die aktive Variante Die S‐Bahn repariert etwas. ausgeschlossen werden kann, bleibt hier für den Ausgangssatz nur die passive Vari‐ ante, dass die Bahn repariert werden soll („Genitivus objectivus“). Wenn aber das Genitivattribut aus einer Bezeichnung für einen Menschen besteht und sich auf ein nominalisiertes Handlungsverb bezieht, kann es schwierig werden: Die Entdeckung des Studenten erregte weltweites Aufsehen. Das Täuschen des Professors fiel nicht auf. Das Schlagen des Lehrers hatte Konsequenzen. Durch die Überwachung der NSA wurde nichts erreicht. Was wird hier worüber gesagt? Wurde der Student irgendwo bei irgendwas entdeckt oder hat er etwas entdeckt? Wurde der Professor hereingelegt oder hat er selbst be‐ trogen? Wurde der Lehrer tätlich angegangen oder hat er selbst geprügelt? Hat die NSA überwacht oder wurde sie selbst überwacht? Die grammatischen Konventionen bieten keine Anhaltspunkte für die Entkomprimierung. Unsere grammatischen Re‐ geln sind hier nicht so weit ausgebaut, dass ohne ein zusätzliches Wissen klar wird, was worüber gesagt wird. Da aber jeder halbwegs kompetente Sprecher solche elliptischen Formulierungen normalerweise nur in vereindeutigenden Kontexten oder unter der Voraussetzung eines entsprechenden hörerseitigen Wissens verwendet, ergeben sich auch bei sol‐ chen Beispielen wohl nur selten Verständnisprobleme. Dennoch ist bei allen Formen komprimierten Sprechens das Verstehen tendenziell vage, und es erfordert einen gewissen „Rechenaufwand“, die elliptische Ausdrucks‐ weise in die verstehbare „Heimat“ des expliziten Prädikationsspiels zu überführen. Das sind, wie gesagt, die Kosten der Zeitersparnis. Angesichts der Summe der Mög‐ lichkeiten komprimierten Sprechens kann der verstehensnotwendige Rechenauf‐ wand manchmal nicht mehr geleistet werden. Dann kann ‐ wie in wissenschaftlichen Texten manchmal zu besichtigen ist ‐ komprimiertes Sprechen zu einem Mittel blen‐ dender „Einschüchterungsprosa“ werden. Ebenfalls elliptisch sind attributive Infinitivsätze von der Art der Wunsch, einen Porsche zu besitzen, (…) 130 der Versuch, Italien zu immunisieren, (…). Auf den ersten Blick scheint offenzubleiben, wer hier eine Porsche besitzen will oder wer mit welchen Mitteln was an Italien wogegen zu immunisieren versucht. Aber auch hier ergeben sich die Unsicherheiten nur, wenn solche Sätze aus ihrem Kontext isoliert werden. In einem realen Gesprächskontext bestehen die Latenzen wahr‐ scheinlich nicht. Andernfalls wären die prädikativen Handlungen wohl in explizite‐ rer Form gemacht worden: Eddie wünscht sich, einen Porsche zu besitzen. Dieser Wunsch …. Die EZB versucht, Italien gegen Zinserhöhungen zu immunisieren. Das … Auch die adjektivischen Attribuierungen sind elliptische Ausdrucksformen von Prädikationshandlungen. Die Struktur der zugrundeliegenden Prädikationshand‐ lung ist durch die elliptische Form verdeckt. Wie unterschiedlich sie sein kann, zei‐ gen schon einige wenige Beispiele adjektivischer Prädikationen wie a. ein philosophisches Buch; b. ein philosophischer Mensch; c. ein glücklicher Moment; d. ein spannendes Buch; e. ein unbekanntes Buch; f. der vermutliche Täter; g. ein eiserner Beschlag; h. ein tödlicher Verkehrsunfall. Was hier in Kurzform bedeutet wird, ist zuerst einmal jeweils ziemlich verschwom‐ men. Die mit den attributiven Fügungen ausgedrückten Prädikationshandlungen würden erst in einer entkomprimierten Form deutlich. Es ist unsicher, ob sie immer erschlossen werden können. Versteht jemand, dem ein Buch mit dem Satz Das ist ein philosophisches Buch vorgestellt wird, wirklich, was gemeint ist? Was denn soll ein philosophisches Buch sein? Ein Buch, in dem philosophische Themen (Fragen) behandelt werden? das philosophische Fragestellungen beschreibt? das eine Lösung zu einer philosophischen Frage vorschlägt? in dem über Sinnfragen nachgedacht wird? in dem auf der Grundlage einer Romanhandlung über Fragen des Lebens nachgedacht wird? Und was wird über jemanden gesagt, der als philosophischer Mensch charakterisiert wird? Ein Mensch, 131 der philosophiert? der über grundsätzliche Fragen nachdenkt? Und was ist ein glücklicher Moment? Ein Augenblick, in dem jemand glücklich ist? in dem jemand Glück hat? in dem etwas glückt? Weniger offen sind die möglichen Explikationen bei d. bis f.: d. ein Buch, dessen Inhalt bei Lesern Spannung erzeugt; (Bei welchen Lesern?) e. ein Buch, das niemandem (nur wenigen?) bekannt ist; f. derjenige, der nach der Vermutung von ... der Täter sein könnte (müsste); g. ein Beschlag, der aus Eisen besteht, (bestand ...); h. ein Verkehrsunfall, der zum Tod (von?) geführt hat. Wie unterschiedlich die Verhältnisse hinter adjektivischen Ellipsen sein können, zeigt die Redensart Der frühe Vogel fängt den Wurm. Gemeint ist damit natürlich, dass man möglichst früh anfangen sollte, Dinge zu erle‐ digen, denn dann sind die Erfolgsaussichten wesentlich besser. Das Sprichwort spielt darauf an, dass ein Vogel im Morgengrauen größere Chancen hat, einen Wurm zu fangen, denn dieser wagt sich besonders in den frühen Morgenstunden an die Ober‐ fläche, wenn die Böden vom Tau noch feucht sind. Was hier als Adjektivattribut auf‐ tritt, ist aber nicht ein komprimierter Relativsatz, sondern eher ein konditionales Ge‐ füge: Der Vogel fängt den Wurm, wenn er früh dran ist. Angesichts der Vielfalt hintergründiger Verhältnisse bei Adjektivattributen erscheint der Wunsch nach Systematisierung verständlich. So wurde der Versuch unternom‐ men, hinter den adjektivischen Prädikationen grundlegende und wiederkehrende Inhaltbeziehungen (semantische Rollen) zu bestimmen, etwa von der Art der folgen‐ den: „FORM halbelliptischer Spiegel – hat die Form einer halben Ellipse ZUGEHÖRIGKEIT mathematische Begriffsbildung – in der Mathematik HERKUNFT renale Ausscheidung – aus den Nieren GRAD hohe Ausbeute – die Ausbeute ist hoch KRITERIUM/BEZUG alphabetische Ordnung – nach dem Alphabet ZEIT der neuere Positivismus – in neuerer Zeit ORT die äußeren Elektronen – die sich außen befinden 132 THEMA außenpolitische Debatte – über Außenpolitik INSTRUMENT mikroskopische Untersuchung – mit dem Mikroskop AGENS Cantorsche Mengenlehre – von Cantor SUBJEKT einfallender Elektronenstrahl – der einfällt OBJEKT parabolisch gestaltete Einzelsegmente – die jemand parabolisch ge‐ staltet hat.“ 85 Allerdings gelten diese „semantischen Rollen“ nur für adjektivische Fügungen. Für präpositionale Attribute müssen einige dieser und noch weitere semantische Rollen angenommen werden86, und derartige Bestimmungsversuche können auch auf ande‐ re Attributarten und insbesondere adverbiale Satzteile ausgedehnt werden87. Möglicherweise ist es sinnvoller, semantische Rollen nicht an komprimierten prädi‐ kativen Fügungen, sondern – falls das Unterfangen überhaupt erfolgreich sein kann ‐ an den entkomprimierten Formulierungen mit finitem Prädikat zu bestimmen. Viel‐ leicht ließen sich auf diese Weise grundsätzliche kognitive Konzepte hinter der Viel‐ falt der verbalen Prädiktionen herausfiltern. Generell sind aber solche Versuche wohl eher mit Skepsis zu betrachten.88 Beispiele nach Heringer 2001, 203 ff. a.a.O., 214 f. 87 Für Anschlüsse von Supplementen (Adverbialen) werden noch 25 weitere Inhaltsbeziehungen for‐ muliert, wobei die Einteilung immer tendenziell vage und umstritten bleibt. Vgl. Heringer 2001, 166 f. 88 Vgl. etwa Dowty 1991, S. 549. 85 86 133 Zwischenbetrachtung Betrachtet man attributiv erweiterte Sätze, wird ein grammatisches Grundprinzip er‐ kennbar: Satzerweiterungen im Allgemeinen und attributive Satzerweiterungen im Besonderen kommen durch Einbettung externer Sätze bzw. der ihnen zugrundelie‐ genden Prädikationshandlungen zustande. Die konventionellen Formen, in denen z.B. die attributiven Einbettungen gemacht werden, stehen im Dienste der Struktur‐ indikation. Die Integration externer Sätze steigert in der Regel die zeitökonomische Effizienz, erhöht aber rezeptionsseitig den Erschließungsaufwand. Das liegt zum ei‐ nen daran, dass die grammatischen Regeln nicht ausreichen, um strukturelle Mehr‐ deutigkeiten auszuschließen. Es bleibt also manchmal offen, worauf sich eine Prädi‐ kationshandlung genau bezieht. Zudem bleibt im Deutschen manchmal konventio‐ nell unbestimmt, ob eine Attribuierung als zusätzliche Feststellung – also explikativ – gemeint ist oder ob sie der restriktiven Bezugnahme dient. Darüber hinaus erfolgt die Integration externer Ausgangssätze in den meisten Fällen verkürzt. So ergeben sich Latenzen, die der Rezipient aus seinem hintergründigen Wissen füllen muss. Als Preis für den Zeitgewinn ist also rezeptionsseitig ein erhöhter Erschließungsaufwand zu leisten – mit all den dadurch entstehenden kommunikativen Unsicherheiten. Satzerweiterungen sind also eine Art Gratwanderung. Auf der einen Seite werden die knappen Ressourcen Zeit und Aufmerksamkeit besser genutzt als mit langen Reihen einfacher Sätze, auf der anderen Seite besteht ein kommunikatives Risiko. Ein kompetenter Sprecher kann dieses Risiko einschätzen und das Maß seiner Explizit‐ heit und Raffung anpassen. 134 Adverbiale und das Reden über Sachverhalte Wenn wir kommunizieren, machen wir Sprechakte. Dazu machen wir Prädikations‐ handlungen, vielleicht mit Ausnahme weniger Handlungen wie etwa Grüßen. Das Prädikationsspiel ist das entscheidende Sprachspiel. Wir setzen Gegenstände der Be‐ zugnahme und prädizieren über diese, um Bewirkungsabsichten zum Ausdruck zu bringen. Das gilt auch für erweiterte und komplexe Sätze, bei denen wir zur Effi‐ zienzsteigerung mehrere Prädikationshandlungen ineinander integriert machen. Gegenstand von Bezugnahmen kann alles Mögliche sein. Das heißt hier: alles, wo‐ rüber sich etwas sagen (prädizieren) lässt. Mögliche Referenten sind Personen, Orte, Handlungen usw., aber auch Sachverhalte, die wir mit Sätzen konstituieren. Ob die‐ se Personen, Orte, Handlungen oder Sachverhalte für real existent, fiktiv oder für hypothetisch gehalten werden, ist dabei zweitrangig. Wir können das Prädikationsspiel in hochkomplexen syntaktischen Formen spielen, aber auch in Leichter Sprache, indem wir mit einfachen, also nicht erweiterten Sät‐ zen Gegenstände der Bezugnahme setzen und über diese prädizieren: 1.) Ich habe einen Schulfreund getroffen. 2a) Das war gestern nach der Arbeit. 2b) Das war eine Überraschung. 2c) Er arbeitet bei X. Die Sätze 2a) bis 2c) sind in jeweils spezifischen Zusammenhängen zum ersten Satz gemeint: ‐ Mit der Feststellung 2a wird der mit 1 festgestellte Sachverhalt hinsichtlich des Zeitpunktes näher bestimmt. Der Sachverhalt wird dadurch präzisiert und in diesem Sinne verändert. ‐ Mit 2b wird eine Feststellung zu dem mit 1 grob und mit 2a näher bestimmten Sachverhalt gemacht. Mit 2b wird dieser Sachverhalt aber nicht näher be‐ stimmt oder verändert. ‐ Mit 2c wird eine zusätzliche Feststellung über einen Referenten des ersten Sat‐ zes (Schulfreund) gemacht. Wenn wir diese Feststellungen statt in „Leichter Sprache“ knapper formulieren wol‐ len, können wir aus den obigen vier Sätzen einen einzigen machen, der nun alle vier Prädikationshandlungen auf einmal repräsentiert: 3) Gestern nach der Arbeit habe ich überraschenderweise einen Schulfreund getroffen, der bei X arbeitet. Die Grammatik bietet uns also die Möglichkeit, Sätze bzw. die von ihnen repräsen‐ tierten Sprechakte, die in Texten linear aufeinander folgen würden, im Dienste 135 kommunikativer Effizienz ineinander einzufügen. So wird im obigen Beispiel aus vier Sätzen mit zwanzig Wörtern ein einziger Satz mit vierzehn Wörtern. In einem solchen erweiterten Satz sind mit gewissen Verkürzungen drei weitere Sätze enthal‐ ten bzw. drei weitere Sprechakte repräsentiert. Mit einfachen Sätzen wird also je‐ weils eine Prädikationshandlung bzw. ein Sprechakt zum Ausdruck gebracht, erwei‐ terte oder komplexe Sätze repräsentieren mehrere Prädikationshandlungen bzw. Sprechakte. Je stärker ein Satz erweitert ist, desto mehr Prädikationshandlungen oder Sprechakte repräsentiert er. Der oben zitierte Satz aus Thomas‘ Manns „Tod in Venedig“ mit seinen 66 Wörtern ist Ausdruck von insgesamt zweiundzwanzig einzelnen Prädika‐ tionshandlungen – er könnte also in eine textuelle Reihe von ebenso vielen einfachen, miteinander zusammenhängenden Sätzen mit nahezu der doppelten Zahl an Wör‐ tern entkomprimiert werden (vgl. Anhang). Das heißt, er ist in der vorliegenden Fas‐ sung als erweiterter bzw. komplexer einzelner Satz der komprimierte Ausdruck von diesen zweiundzwanzig Prädikationshandlungen. Die Integration externer Sätze er‐ folgt v.a. attributiv oder adverbial, aber auch in Form von Subjekt‐ oder Objektsät‐ zen. In Leichter Sprache kann man auf einen Referenten eines einfachen Satzes in weite‐ ren einfachen Sätzen nochmals Bezug nehmen und über ihn Zusätzliches prädizie‐ ren: Da saß ein Kind. Es war blond. Es war sehr dünn. Es sah traurig aus. Wir haben einen großen Garten. Er verlangt allerdings viel Pflege. Solche externen Sätze können wir in den jeweiligen Ausgangssatz integrieren: Wir haben einen großen Garten, der allerdings viel Pflege verlangt. Da saß ein sehr dünnes, blondes Kind, das traurig aussah. Wenn externe Sätze in die entsprechenden Ergänzungen (Komplemente, Argumente) mit identischem Referenten integriert werden, werden sie zu grammatischen Attri‐ buten. Als Attribute integrierbar sind nur Sätze mit deskriptiver Bewirkungsabsicht. Sie repräsentieren Feststellungen über Referenten des aufnehmenden Satzes. Sind sie für die Bezugnahme nötig, insofern sie den Gegenstandsbereich einschränken bzw. näher bestimmen, entstehen restriktive Attribute. Erfolgen diese Feststellungen über bereits hinreichend bestimmte Gegenstände, dann entstehen explikative Attribute. Die attributive Integration kann satzförmig erfolgen, etwa in Form von Relativsätzen, aber auch elliptisch bzw. komprimiert, etwa mit präpositionalen Attributen. Bei at‐ tributiver Integration werden die deskriptiven Bewirkungsabsichten aus den exter‐ nen Sätzen mitgenommen. Sie sind deshalb auch in Sätzen mit appellativer oder kommissiver Bewirkungsabsicht immer deskriptiv. 136 Wie schon gesagt, kann alles Mögliche Gegenstand von Bezugnahmen sein. Bezug‐ nahmen auf Sachverhalte oder Tatsachen erfolgen am einfachsten mit pronominalen Ausdrücken wie das, aber auch mit dass‐Sätzen, also mit Subjekt‐ und Objektsätzen: Wir haben einen Garten. Das ist einerseits schön, andererseits mit viel Mühe verbunden. Dass wir einen Garten haben, ist einerseits schön, andererseits mit viel Mühe verbunden. Aber insgesamt freuen wir uns, dass wir einen Garten haben. Am einfachsten erfolgen Bezugnahmen auf Sachverhalte mit das, etwa mit einer Fest‐ stellung wie Das ist eine Überraschung. Hier wird vom Sprecher angenommen, dass die Partner aus dem Kontext wüssten, auf welchen Sachverhalt er mit das Bezug nimmt. Da muss schon manchmal nachge‐ fragt werden: Was meinst du mit „das“? Die Antwort kann dann mit einem dass‐Satz gegeben werden in der Art: Na, dass … Das Reden über Sachverhalte ist in der Kommunikation allgegenwärtig. Feststel‐ lungen oder Fragen zu Sachverhalten sind keine Sprechakte einer besonderen Art oder höheren Ordnung. Zu einer Feststellung wie Viele der modernen Flachbildschirme gehen ziemlich schnell kaputt. lässt sich alles Mögliche in zusätzlichen Sätzen sagen: Das passiert sehr häufig. Das ist ärgerlich. Das ist allseits bekannt. Der Grund ist, dass die Hersteller Teile mit geplantem Verschleiß einbauen. usw. Man kann auf Sachverhalte natürlich nicht nur in zusätzlichen Sätzen Bezug neh‐ men. Häufig erfolgen Feststellungen zu Sachverhalten satzintern über Subjekt‐ oder Objektsätze als Referenten: Dass viele der modernen Flachbildschirme ziemlich schnell kaputtgehen, passiert sehr häufig. Dass viele der modernen Flachbildschirme ziemlich schnell kaputtgehen, liegt daran, dass die Hersteller Teile mit geplantem Verschleiß einbauen. Man darf annehmen, dass viele der modernen Flachbildschirme ziemlich schnell kaputtgehen Besonders effizient können sachverhaltsbezogenen Sprechakte gemacht werden, wenn sie als Adverbiale (Supplemente, Angaben) in die Bezugssätze integriert wer‐ den. Sie treten dann als freie Erweiterungen auf der obersten Satzebene zu gramma‐ tisch bereits vollständigen Sätzen hinzu. Sehr häufig gehen viele der modernen Flachbildschirme ziemlich schnell kaputt. 137 Viele der modernen Flachbildschirme gehen ärgerlicherweise ziemlich schnell kaputt. Wie allseits bekannt ist, gehen viele der modernen Flachbildschirme ziemlich schnell kaputt. Viele der modernen Flachbildschirme gehen ziemlich schnell kaputt, weil die Hersteller Teile mit geplantem Verschleiß einbauen. Adverbiale sind aus grammatischer Sicht nicht notwendig. Das heißt aber nur, dass das, was mit ihnen gesagt wird, nicht innerhalb eines Satzes zum Ausdruck gebracht werden muss. Dennoch sind sie nicht unwichtig. Über die kommunikative Relevanz entscheidet allein der Sprecher. Was er mit einem Adverbiale sagen kann, könnte er ebenso mit einem zusätzlichen Satz sagen. Entscheidend ist, ob er es sagen will. Die grammatische Form ist zweitrangig. Der grammatikalische Terminus Adverbiale ist zuerst einmal ein reiner Sammelbegriff für alle Satzteile der obersten Ebene, die zum Prädikat und dessen Ergänzungen hin‐ zugefügt werden können. Alle Adverbiale in all ihren grammatischen Ausprägungen repräsentieren Prädikationshandlungen. Kann man noch Genaueres über diese Prä‐ dikationshandlungen sagen? Wie des Öfteren fehlen uns auch hier passende umgangssprachliche Handlungsbe‐ zeichnungen. Immerhin haben wir die Sprechaktverben. Aber für die Handlungen, durch welche wir diese Sprechakte machen, haben wir bereits den künstlichen Ter‐ minus Prädikationshandlungen benötigt. Dazu gehören auch solche, die eingebettet in andere erfolgen, wie etwa die attributiven Prädikationshandlungen. Mit ihnen be‐ stimmen wir Gegenstände der Bezugnahme näher oder machen Aussagen über be‐ reits ausreichend bestimmte Referenten. Welche Handlungen stecken nun hinter grammatischen Adverbialen? 138 Drei Arten adverbialer Handlungen Mit Adverbialen fügen wir etwas zu Sätzen hinzu und sagen damit etwas Zusätzli‐ ches zu den Sachverhalten, die in diesen Sätzen formuliert sind. Das lässt sich auch mit externen Sätzen bzw. Sprechakten machen, meist sogar genauer, meist aber nicht in solcher Kürze. Mit Adverbialen (und ihren externen Entsprechungen) können wir zum einen Sach‐ verhalte näher bestimmen wie in Das Wetter schlug plötzlich um. Solche Verwendungen von Adverbialen nenne ich Sachverhaltsbestimmungen. In den meisten Fällen bringen wir mit Adverbialen aber etwas anderes zum Aus‐ druck, nämlich wie nach unserer Ansicht ein bestimmter Sachverhalt mit einem an‐ deren zusammenhängt, etwa in zeitlicher oder kausaler Hinsicht: Weil das Frühjahr sehr trocken war, fiel die Getreideernte spärlich aus. Solche adverbialen Bestimmungen nenne ich Umstandsbestimmungen. Sehr häufig bringen wir mit Adverbialen auch zum Ausdruck, wie wir oder unsere Partner zu bestimmten Sachverhalten stehen. Wir stellen Sachverhalte in Zusam‐ menhang zu unserem Wissen oder dem unserer Partner, wir bestimmen sie im Ver‐ hältnis zu unseren Vorannahmen oder unseren Gefühlen: Überraschenderweise trat der Ministerpräsident zurück. Derartige grammatische Adverbiale repräsentieren Sachverhaltskommentierungen. Was wir mit grammatischen Adverbialen zum Ausdruck bringen, könnten wir auch mit zusätzlichen Sätzen sagen. Aber mit den adverbialen Formen haben wir unter‐ schiedliche Möglichkeiten des komprimierten Sprechens. Die am stärksten kompri‐ mierten Ausdrucksformen sind Satzwörter wie obwohl, gewiss usw. Wenn man von Adverbialen redet, denkt man meist an den ersten Handlungstyp, an Sachverhaltsbestimmung in ihren unterschiedlichen grammatischen Ausführungen: a) Er rannte schnell. b) Fast hätte ich den Termin vergessen. c) Hans läuft die hundert Meter in 11 Sekunden. d) Er schlug wütend mit der Faust auf den Tisch. e) Die Katze schlägt mit ihren scharfen Krallen zu. Die adverbialen Teile in a) bis e) repräsentieren Sachverhaltsbestimmungen, nicht aber Umstandsbestimmungen. Wenn ich sage, dass jemand schnell läuft, dann be‐ stimme ich mit schnell nicht die Umstände seines Laufens. Und dass jemand wütend mit der Faust auf den Tisch schlägt, beschreibt auch keinen zusätzlichen Umstand zu 139 diesem Schlagen. Vielmehr wird hier das, was gesagt wird, näher bestimmt. Das heißt, die Prädikationshandlung über den Gegenstand der Bezugnahme wird durch die Hinzufügung spezifiziert. Sachverhaltsbestimmungen lassen sich entweder ad‐ verbial realisieren oder – umständlich – durch zusätzliche Sätze: Er schlug auf den Tisch. Das machte er wütend. Die zweite Art von adverbialen Handlungen sind die Umstandsbestimmung oder Umstandsangaben. Ihre explizitesten Repräsentanten sind Adverbialsätze: f) Nachdem er sich umgezogen hatte, verließen sie das Haus. g) Sie bestiegen den Dreitausender, während sich ein Gewitter zusammenbraute. h) Weil die Märkte das Vertrauen zurückgewannen, sank die Rendite griechischer Staatsanleihen. Hier wird jeweils ein Sachverhalt durch Bezug auf einen weiteren Sachverhaltes nä‐ her bestimmt. Im ersten Beispiel wird ein Sachverhalt in einen zeitlichen Folgezu‐ sammenhang zu einem anderen gebracht. Im zweiten wird der Sachverhalt, dass je‐ mand einen Dreitausender bestiegen hat, in einen zeitlichen Zusammenhang zu ei‐ nem anderen gestellt, nämlich, dass gleichzeitig ein Gewitter aufzog. Im dritten Bei‐ spiel wird ein Sachverhalt näher bestimmt, indem ein zweiter als dessen Ursache festgestellt wird. Umstandsbestimmungen können auch anders als in adverbialen Formen erfolgen: Sie bestiegen den Dreitausender. Gleichzeitig braute sich ein Gewitter zusammen. Dass die Rendite griechischer Staatsanleihen sank, lag daran, dass die Märkte das Vertrauen zurückgewannen. Sowohl mit Sachverhaltsbestimmungen wie mit Umstandsbestimmungen können Antworten auf Fragen mit wo, wann, warum, wie usw. gegeben werden. Der Unter‐ schied zwischen beiden kann durch die Frage entschieden werden, ob durch das Adverbiale ein zusätzlicher Sachverhalt ins Spiel gebracht wird oder nicht. Das ist bei den Umstandsbestimmungen in f) bis h) der Fall. Mit den jeweiligen Satzpaaren werden unterschiedliche Sachverhalte festgestellt. Die Adverbiale der Sätze a) bis e) können dagegen nicht in Adverbialsätze umge‐ formt werden, denn sie repräsentieren keine weiteren Sachverhalte. Auch externe Paraphrasen beschreiben keine zusätzlichen Sachverhalte: Er rannte. Das tat er schnell. Ich hätte den Termin vergessen. Das wäre beinahe passiert. Hans läuft die hundert Meter. Das kann er in 11 Sekunden. Er schlug mit der Faust auf den Tisch. Das tat er wütend. 140 Die Katze schlägt zu. Das tut sie mit ihren scharfen Krallen. Man kann die externen Paraphrasen wie die entsprechenden Adverbiale selbst intui‐ tiv entweder als prädikatsbezogen oder als satzbezogen betrachten. In jedem Fall sa‐ gen wir mit ihnen etwas Näheres zu einem Sachverhalt, wir bringen aber keinen zweiten ins Spiel. Sie sind also Sachverhaltsbestimmungen. Mit Umstandsbestim‐ mungen setzen wir dagegen Sachverhalte bzw. Tatsachen zu anderen Sachverhalten in Beziehung, z.B. temporal, lokal, kausal oder modal. Nun treten aber in grammatischen Adverbialpositionen auch Ausdrücke und Phra‐ sen auf, mit denen wir Sachverhalte auf keine dieser beiden Weisen näher bestim‐ men, sondern gleichsam kommentieren. Mit solchen Sachverhaltskommentaren werden bestimmte Positionen der Gesprächspartner zu Sachverhalten ausgedrückt. Typisch für derartige personalen Kommentare sind die Satzadverbien wie natürlich, gewiss, erstaunlicherweise oder Partikeln wie auch, sogar, ja, doch. Mit ihnen werden im Hinblick auf Sachverhalte kommentierende Feststellungen gemacht – und zwar satz‐ intern und in Kurzform. Dabei werden oft Wertungen oder emotionale Einstellungen zum Ausdruck gebracht. Oder es wird ein Sachverhalt in Bezug gesetzt zu bestimm‐ ten Vorannahmen oder einem bestimmten Hintergrundwissen, entweder zum eige‐ nen (natürlich) oder zum Wissen des Partners (ja, doch) oder zum gemeinsamen Wis‐ sen. In keinem Fall wird dabei aber der Sachverhalt selbst näher bestimmt. Auch die adverbialen Sachverhaltskommentierungen lassen sich als mehr oder we‐ niger komprimierte Versionen ursprünglich externer Sätze betrachten. Deshalb wer‐ den solche Kommentare auch mit externen Sätzen gemacht, wie etwa mit Das war nicht anders zu erwarten (für natürlich). Das überrascht mich (für erstaunlicherweise), usw. Durch die zusätzlichen Feststellungen wird ein Sachverhalt zu einem zweiten in Be‐ ziehung gesetzt, etwa zu dem, was jemand weiß, denkt, voraussetzt oder fühlt. Sachverhaltskommentare können auch über Sachverhalte gehen, die als grammati‐ sche Subjekt‐ oder Objektsätze formuliert sind: Dass die Kurse griechischer Aktien sanken, war nicht anders zu erwarten. Grundsätzlich eröffnen aber adverbiale Formulierungen die Möglichkeit kompri‐ mierten und zeitsparenden Sprechens: Die Kurse griechischer Aktien sanken natürlich. Adverbiale Kommentierungen und adverbiale Sachverhaltsbestimmungen sind verschiedene Handlungen. Der grundsätzliche Unterschied kann in den folgenden Beispielsätzen verdeutlicht werden. Die Ausdrücke in sachverhaltsbestimmender 141 Verwendung sind jeweils unterstrichen, in personenbezogener kommentierender Verwendung fettgedruckt. Das Gemüse ist natürlich gezüchtet. (auf natürliche Weise) Das Gemüse ist natürlich gezüchtet. (Es ist mir/uns/allen klar, dass es nicht einfach so wächst.) Tante Ursula fährt trotz ihrer achtzig Jahre noch sicher Auto. (auf sichere Art und Weise) Sicher fährt Tante Ursula trotz ihrer achtzig Jahre noch Auto. / Tante Ursula fährt trotz ih‐ rer achtzig Jahre sicher noch Auto. (Von dieser Tatsache gehe ich aus.) Sicher fährt Tante Ursula trotz ihrer achtzig Jahre noch sicher Auto. / Tante Ursula fährt trotz ihrer achtzig Jahre sicher noch sicher Auto. (Ich gehe davon aus, dass sie noch si‐ cher Auto fährt.) Er hat sie schnell vergessen. (Er hat sie vergessen. Das ging schnell.) Er hat sie leider vergessen. (Er hat sie vergessen. Das ist für mich (und andere?) bedau‐ erlich.) Er hat gestern ein neues Auto gekauft. (Er hat ein neues Auto gekauft. Das machte er gestern.) Er hat unvernünftiger Weise ein neues Auto gekauft. (Er hat ein neues Auto gekauft. Das war m.E. unvernünftig.) Er hat gestern unvernünftiger Weise ein neues Auto gekauft. (Er hat ein neues Auto ge‐ kauft. Das machte er gestern. Der Kauf war aus meiner Sicht unvernünftig.) Wie Sachverhalts‐ oder Umstandsbestimmungen sind auch adverbiale Kommentare meist Kurzformen expliziter Phrasen oder Sätze: Die Erfindung der Schrift gehört zweifelsohne zu den größten Kulturleistungen der Menschheit. Die Erfindung der Schrift gehört ohne jeden Zweifel zu den größten Kulturleistungen der Menschheit. Die Erfindung der Schrift gehört zu den größten Kulturleistungen der Menschheit. Daran besteht kein Zweifel. Hinter der grammatischen Kategorie „Adverbiale“ können also drei verschiedene Handlungstypen stecken: einerseits Sachverhalts‐ oder Umstandsbestimmungen, andererseits Sachverhaltskommentierungen. In allen Fällen handelt es sich um de‐ skriptive Prädikationshandlungen – auch wenn man das den komprimierten Varian‐ ten nicht immer gleich ansieht. Alle diese Handlungen lassen sich prinzipiell auch in nichtadverbialen Formen machen, meist aber weniger effizient. 142 Sachverhalts‐ und Umstandsbestimmungen Betrachten wir zuerst die verschiedenen grammatischen Formen von Sachverhalts‐ und Umstandsbestimmungen. Wie schon Attribute lassen sich auch Adverbiale als integrierte Formen ursprünglich externer Sätze betrachten. Und wie bei den attribu‐ tiven Einfügungen gibt es auch bei Adverbialen einerseits satzförmige und anderer‐ seits mehr oder weniger komprimierende Formen der Integration. Betrachten wir die verschiedenen grammatischen Formen mit ihren unterschiedlichen Graden von Ex‐ plizitheit: ‐ Präpositionalphrasen (im Deutschen häufig) : Wegen des schlechten Wetters blie‐ ben wir zu Hause. ‐ Kasuelle Nominalphrasen: Eines Morgens war die Katze verschwunden. ‐ Adjektivphrasen: Beide Medikamente wirken rasch. ‐ Adverbien: Nachmittags kamen wir zurück. ‐ Adverbiale Nebensätze: Nachdem wir zuhause waren, begann der Stress erst rich‐ tig. ‐ Satzwertige Infinitive: Um besser einschlafen zu können, trank er warmes Bier. ‐ Partizipien (im heutigen Deutschen selten): Ein Lied singend, beruhigten sie sich wieder. Sowohl mit Sachverhaltsbestimmungen wie auch mit Umstandsbestimmungen wer‐ den wahrheitsfunktionale Aussagen über Sachverhalte gemacht, beispielsweise hin‐ sichtlich des Ortes, der Zeit, des Grundes usw. Entsprechend können diese deskrip‐ tiven Sprechakte bestritten werden nach dem Muster: Der Ober kam rasch. ‐ Das stimmt nicht: Er kam erst nach einer halben Stunde! Das Spiel wurde abgesagt, weil das Wetter zu schlecht war. – Das stimmt nicht: Es wurde abgesagt, weil die halbe Mannschaft erkrankt war! Inhaltlich wird meist zwischen lokalen, temporalen, kausalen, finalen oder modalen Adverbialen unterschieden. Innerhalb dieser Gruppen lassen sich noch feinere Ab‐ stufungen finden: Beispielsweise werden mit temporalen Adverbialen nicht nur Aus‐ sagen über den Zeitpunkt (wann?) gemacht, sondern auch solche über die Zeitdauer (wie lange?), die Häufigkeit (wie oft?) oder den Zeitbeginn (seit wann?). Sachverhalts‐ und Umstandsbestimmungen können im Gegensatz zu Sachverhalts‐ kommentierungen als Antworten auf Fragen interpretiert werden. Entsprechend kann man sie klassifizieren als Adverbiale ‐ des Ortes (Wo? Wohin? Woher?) ‐ der Zeit (Wann? Wie lange? Seit wann?) 143 ‐ der Art und Weise (Wie? Womit? Wie sehr? Wodurch?) ‐ des Grundes (Warum?) ‐ des Zwecks (Wozu?) ‐ der Bedingung (Wann? Unter welcher Bedingung?) ‐ der Folge (Was folgt daraus?) Meist gibt es passende Fragewörter. Vor allem bei konsekutiven und adversativen Adverbialen muss man aber etwas anders fragen: Welche Folge hatte das? Trotz welcher Handicaps wurde N. N. Judomeisterin? In ihrer explizitesten Form sind Adverbiale als Nebensätze formuliert. Üblicherweise werden neun inhaltliche Arten von Adverbialsätzen unterschieden: a) Kausalsätze: Wir konnten nicht im Meer schnorcheln, weil es stürmisch war. b) Finalsätze: Er spart Geld, um den nächsten Urlaub bezahlen zu können. c) Konditionalsätze: Wenn der Regen aufhört, starten wir mit der Wanderung d) Konsekutivsätze: Der Prediger nuschelt so sehr, dass ihn keiner verstehen kann. e) Konzessivsätze: Obwohl er schon Schulden hatte, kaufte er ein neues Auto. f) Temporalsätze: Als sie ihren Mann kennenlernte, hatte er noch keine Glatze. g) Modalsätze: Der Konzern will die Bilanz verbessern, indem er Unternehmensteile verkauft. h) Adversativsätze: Er ist ein Pessimist, während sie eine Frohnatur zu sein scheint. i) Lokalsätze: Er wollte leben, wo seine Freundin lebt.89 Mit Adverbialsätzen werden in der Regel Umstandsbestimmungen gemacht, es wer‐ den also Sachverhalte in Zusammenhänge zu anderen Sachverhalten gesetzt. Diese Zusammenhänge werden mit Subjunktionen wie weil, als, nachdem usw. bestimmt, bei getrennten Sätzen durch entsprechende Konjunktionen (deshalb, zuvor), Bin‐ deadverbien (somit) oder durch zusätzliche Sätze (der Grund war, dass ….). In Adverbialsätzen zeigen wir durch die Endstellung des Verbs an, dass der Satz als „Nebensatz“ einen Bezug zu einem Hauptsatz hat. Und wir bestimmen diesen Bezug mit spezifischen Subjunktionen explizit und mit Wahrheitsanspruch, z.B. mit a) weil, da; b) damit, dass, (ersatzweise um zu); Das Deutsche kennt keine lokalen Subjunktionen, weshalb die Bezeichnung Lokalsätze strittig ist. Die Alternative wäre, sie als Relativsätze zu sehen nach dem Muster „Ich verbringe den Sommer (dort), wo die Sonne scheint.“ Vgl. Engelen 1986, S.52 ff. 89 144 c) wenn, falls, sofern, bevor nicht; d) so dass, dass; e) obwohl, obgleich, wenngleich, wenn auch; f) bevor, ehe, bis, nachdem, seit; als, während, solange; g) indem, ohne dass (ersatzweise ohne oder anstatt mit Infinitivkonstruktion); h) während, wohingegen. Obwohl mit Subjunktionen Feststellungen erfolgen, tragen sie nichts zum Wahr‐ heitswert der durch sie verbundenen Sätze bei, und auch nicht die entsprechenden Hauptsatzkonjunktionen wie da, trotzdem, denn oder aber. Wenn der Zusammenhang zwischen zwei Sachverhalten für klar oder zumindest für erschließbar gehalten wird, wird er manchmal nicht explizit ausgedrückt. Allerdings wird in solchen Fällen den Partnern ein gewisser Schlussfolgerungsaufwand zuge‐ mutet: Das Getreide wuchs schlecht. Das Frühjahr war sehr trocken gewesen. Meine Katze ist besonders intelligent. Sie frisst kein Dosenfutter. Sie kaufte ein, er verdiente kein Geld. Der Rezipient muss hier die fehlenden Satzwörter bzw. das mit ihnen Ausdrückbare konversationell als Implikatur rekonstruieren. Deswegen schlug Grice vor, solche weglassbaren Konjunktionen und Bindeadverbien als Ausdrücke für konventionelle Implikaturen zu betrachten. Entsprechendes müsste auch für Subjunktionen gelten. Allerdings führt eine solche Annahme, wie schon in Kap. 2 gezeigt, zu einer selbst‐ widersprüchlichen Verwendung des Terminus Implikatur, unter der ja das verstan‐ den wird, was zwar gemeint, aber nicht explizit gesagt wird. Dagegen wird mit Kon‐ junktionen, Subjunktionen und Bindeadverbien das, was gemeint ist, ja explizit ge‐ sagt. Unklar ist außerdem die Reichweite des Terminus konventionelle Implikatur. Wenn Weglassbarkeit und Erschließbarkeit die Kriterien dafür wären, dass Ausdrücke für konventionelle Implikaturen stehen, dann müsste man wohl sehr viele Wörter als Ausdrücke für konventionelle Implikaturen ansehen. Deshalb erscheint es sinnvoller, den Gebrauch von Wörtern nicht über Implikaturen zu beschreiben, sondern einfach die jeweiligen Regeln des Gebrauchs der Ausdrücke über ihre Wahrheitsbedingun‐ gen zu bestimmen. Und das muss hier heißen, über das, was mit solchen Ausdrü‐ cken festgestellt und anschließend nicht mehr widerspruchsfrei zurückgenommen werden kann. Plausibler erscheint zumindest auf den ersten Blick der alternative Vorschlag, Kon‐ junktionen, Subjunktionen und Bindeadverbien – und wohl auch Satzadverbien und 145 evtl. Partikeln ‐ als Ausdrücke für Sprechakte zweiter Ordnung zu interpretieren. Nehmen wir als Beispiel die Subjunktion weil im folgenden Satz: Die Getreideernte fiel schlecht aus, weil das Frühjahr zu trocken war. Mit Haupt‐ und Nebensatz wird zuerst einmal jeweils ein Sachverhalt behauptet bzw. als wahr vorausgesetzt. Zusätzlich wird mit der Subjunktion weil die Feststel‐ lung gemacht, dass das trockene Frühjahr der Grund für die schlechte Getreideernte ist. Man kann anschließend nicht sinnvoll behaupten: Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Jedenfalls würde man sich selbst widersprechen, wenn man die Frage Du glaubst also, dass das trockene Frühjahr die Ursache für die schlechte Ernte war? verneinen würde. Man kann nicht sinnvoll einen bestimmten Tatsachenzusammen‐ hang bestreiten, den man gerade mit weil behauptet hat. Analog zu weil liegen die Verhältnisse bei damit, dass, falls, sofern, obwohl, bevor, ehe, bis, nachdem, seit usw. Und Entsprechendes gilt bei Konjunktionen wie deshalb, dadurch usw. und auch bei Bin‐ deadverbien wie dennoch, somit usw. An der Grammatik kann man sehen, welche Vielfalt komprimierter Ausdrucksfor‐ men wir im Dienste der Sprachökonomie entwickelt haben. Weil Feststellungen zeit‐ licher, räumlicher und kausaler Zusammenhänge in unserer Interpretation der Wirk‐ lichkeit besonders wichtig und entsprechend häufig sind, ist es naheliegend, derarti‐ ge wiederkehrende Feststellungen mit effizienzsteigernden „short cuts“ zu machen. Subjunktionen, Konjunktionen usw. sind solche besonders komprimierten Formen von Prädikationshandlungen. Was mit ihnen auf die kürzest mögliche Weise gesagt wird, ließe sich auch weniger komprimiert sagen. Statt mit weil könnte der Zusam‐ menhang auch mit einem entsprechenden Hauptsatz festgestellt werden: Der Grund dafür ist, dass … oder Das ist der Grund dafür, dass … Was mit einem Satzwort festgestellt wird, gehört natürlich nicht zu dem Satz bzw. Sachverhalt, über den es gesagt wird, und trägt folglich nichts zu dessen Wahrheits‐ wert bei. Aber es wird damit innerhalb desselben Satzes eine Feststellung zu derjeni‐ gen des Bezugssatzes gemacht, die man als Feststellung zweiter Ordnung betrachten könnte. In Kap. 2 habe ich dargelegt, warum ich auf diesen Terminus verzichte. Zum einen müssten nämlich nicht nur Satzwörter als Ausdrücke für solche Sprechakte gelten, sondern auch entsprechende Phrasen, die Hauptsätze bestimmter Subjekt‐ und Objektsätze und auch entsprechende satzexterne Paraphrasen von Satzwörtern. Zudem müssten auch Sprechakte dritter, vierter Ordnung usw. angenommen wer‐ den. Abgesehen von der Schwierigkeit, die man da mit dem Zählen hätte, scheint die Annahme von Sprechakten höherer Ordnung ganz einfach die Tatsache der grund‐ sätzlichen Rekursivität des sprachlichen Handelns zu verkennen. Wir stellen eben zum einen beispielsweise Sachverhalte fest und wir machen zum anderen zusätzli‐ 146 che Feststellungen über diese Sachverhalte oder Feststellungen über Referenten von Feststellungen usw. Es erscheint nicht plausibel, den letzteren einen höheren Status zuzubilligen, wenn sie satzintern gemacht werden. Bleiben wir also beim Unstrittigen: Mit Bindeadverbien, Konjunktionen und Sub‐ junktionen werden in Kurzform Zusammenhänge zwischen Sachverhalten festge‐ stellt, und zwar im Sinne von Umstandsbestimmungen – und dies mit Wahrheitsan‐ spruch. Das zeigen auch die Beispiele von obwohl und trotzdem: Obwohl Oskar zuhause alles gekonnt hatte, versagte er bei der Klassenarbeit. Zuhause hatte Oskar alles gekonnt. Trotzdem versagte er bei der Klassenarbeit. Mit obwohl oder trotzdem gibt S zu verstehen, dass seiner Ansicht nach das eine erfah‐ rungsgemäß das andere unwahrscheinlich macht. S kann hinterher nicht sagen: Es ist die Regel, dass jemand, der zuhause alles kann, in der Klassenarbeit versagt. Würde er es trotzdem tun, hätte er wohl den Gebrauch von obwohl oder trotzdem nicht recht verstanden. Die gleichen Verhältnisse zeigen sich bei nachdem oder seitdem: Nachdem er zwei Jahre geübt hatte, gewann er den Wettbewerb. Mit diesem Satz wird behauptet bzw. als wahr vorausgesetzt: Er hatte zwei Jahre geübt. Er gewann den Wettbewerb. Zusätzlich wird mit der Subjunktion nachdem zu verstehen gegeben: Das eine war zeitlich vor dem anderen. Mit dem Satz Seitdem er sich glutenfrei ernährt, ist er wesentlich leistungsstärker geworden. wird festgestellt: Er ernährt sich glutenfrei. Er ist wesentlich leistungsstärker geworden. Und mit seitdem wird zum Ausdruck gebracht, dass das Zweite ab dem Zeitpunkt des Ersten gilt. Selbst wenn die Zusammenhänge mit Subjunktionen explizit ausgedrückt werden, kann doch noch Rechnen nötig werden. Denn zahlreiche Subjunktionen und Kon‐ junktionen sind mehrdeutig, wie während in Während sie das Geld ausgab, musste er schauen, wie er es hereinbekam. Soll hier mit während ein temporaler oder adversativer Zusammenhang festgestellt werden? Auch andere Subjunktionen sind mehrdeutig. Dass wird sowohl final als auch konsekutiv verwendet ‐ außerdem auch zur Einleitung eines Inhaltssatzes (Sub‐ jekt‐ oder Objektsatzes), wenn sowohl konditional wie temporal. Auch die Subjunkti‐ on weil ist – wie die entsprechende Konjunktion denn ‐ mehrdeutig. Sie kann zum 147 Ausdruck kausaler, finaler oder argumentativer Begründungszusammenhänge ver‐ wendet werden: Das Getreide wuchs schlecht, weil das Frühjahr sehr trocken war. (Das Frühjahr war sehr trocken. Das Getreide wuchs schlecht. Das Erste war der Grund für das Zweite. Das Zweite war die kausale Folge des Ersten.) Er beendete die Arbeit an diesem Tag vorzeitig, weil er das Spiel sehen wollte. (Er beendete die Arbeit an diesem Tag vorzeitig. Er wollte das Spiel sehen. Das Erste ist die Voraussetzung für das Erreichen des Ziels, das Spiel zu sehen.) Meine Katze ist besonders intelligent, weil sie fünf deutsche Ausdrücke versteht. (Meine Katze ist besonders intelligent. Sie versteht fünf deutsche Ausdrücke. Das Letztere ist der Beweis für die Richtigkeit der ersten Behauptung.) 148 Adverbiale Komprimierungen Grammatische Adverbiale sind die Ergebnisse der Integration externer Sätze. Wenn Umstandsbestimmungen in Form von Adverbialsätzen integriert werden, ist der Ef‐ fizienzgewinn allerdings gering. Deshalb nutzen wir auch kürzere Formen, insbe‐ sondere präpositionale Phrasen. Ein Adverbialsatz mit weil lässt sich oftmals mit Vorteil durch eine präpositionale Phrase mit wegen ersetzen. Dass durch komprimierte Varianten von Adverbialen die Kooperationsfähigkeit der Partner erheblich beansprucht werden kann, zeigt das Beispiel des lateinischen Abla‐ tivus absolutus. Er bietet ein besonders anschauliches Beispiel konventioneller Un‐ terbestimmtheit, weil nicht ausgedrückt wird, ob das ablativische Adverbiale tem‐ poral, kausal oder modal gemeint ist. Die lateinische Sprache bietet natürlich auch die Möglichkeit, dies alles explizit zu sagen. Aber aus Effizienzgründen kann die komprimierte Kurzform gewählt werden, wobei vorausgesetzt wird, dass die richti‐ ge Lesart für den Rezipienten naheliegend ist. So lässt sich die adverbiale Bestim‐ mung bello confecto in Bello confecto Caesar statuit …. sowohl temporal als auch kausal interpretieren: Nachdem der Krieg beendet worden war, beschloss Caesar … Nach Beendigung des Krieges beschloss Caesar … Der Krieg wurde beendet und danach beschloss Caesar … Weil der Krieg beendet worden war, beschloss Caesar … Der Krieg wurde beendet und daher beschloss Caesar … Wegen des Kriegsendes beschloss Cäsar … Auch im Deutschen entstehen adverbiale Komprimierungen durch elliptische Ver‐ kürzungen adverbialer Sätze. Sie sind im Hinblick auf den Zeitgewinn potentiell ef‐ fizienter, in Bezug auf den rezeptiven Rekonstruktionsaufwand natürlich anspruchs‐ voller. Das zeigt sich beispielhaft an den im heutigen Deutschen eher seltenen ad‐ verbialen Partizipien wie in Den Schlüssel drehend, öffnete er das Schloss. Den Schlüssel drehend, pfiff er ein Lied. Bei adverbialen Partizipien wird zum einen das Subjekt weggelassen, und Subjunkti‐ onen wie indem, als oder während sind getilgt. Hier muss sich der Rezipient zwischen der modalen und der temporalen Deutung entscheiden. Beim ersten Beispiel ist bei‐ des möglich, beim zweiten ist die modale Interpretation auszuschließen: 149 Indem er den Schlüssel drehte, öffnete er das Schloss. Während er den Schlüssel drehte, öffnete er das Schloss. Während er den Schlüssel drehte, pfiff er ein Lied. * Indem er den Schlüssel drehte, pfiff er ein Lied. Adverbiale Partizipien repräsentieren Prädikationshandlungen. Denn sie sind ver‐ kürzte Adverbialsätze oder verkürzte externe Sätze wie: Er öffnete das Schloss. Dazu drehte er den Schlüssel. Er öffnete das Schloss. Dabei pfiff er ein Lied. Nach der Vorkommenshäufigkeit sind im Deutschen aber vor allem Adverbiale mit präpositionalen Anschlüssen typisch. Auch diese präpositionalen Adverbiale sind Kurzformen entsprechender Adverbialsätze oder externer Sätze und somit Ausdruck von Prädikationshandlungen: Wegen des stürmischen Wetters konnten wir nicht im Meer schnorcheln. (… weil das Wetter stürmisch war.) Er spart Geld für den nächsten Urlaub. (…, damit er den nächsten Urlaub bezahlen kann.) Infolge seines Nuschelns konnte niemand den Prediger verstehen. (…, so dass niemand …) Trotz seiner Schulden kaufte er ein neues Auto. (Obwohl er schon Schulden hatte, …) Durch den Verkauf einiger Töchter will der Konzern seine Bilanz verbessern. (Indem der Konzern einige Töchter verkauft, …) Im Gegensatz zu ihm ist sie eine Frohnatur. (Während er ... , ist sie ...) Wegen der guten Qualität der deutschen Kliniken lassen sich viele reiche Araber in Deutsch‐ land behandeln. (Weil die deutschen Kliniken eine gute Qualität haben, …) Sie kommen nach Deutschland der fachgerechten Behandlung wegen. (… weil sie dort fachgerechte Behandlung erwarten / bekommen usw.) Diese Beispiele bieten auf den ersten Blick keine größeren Verständnisschwierigkei‐ ten. Dennoch geben präpositionale Adverbiale häufig Anlass dazu. Manchmal ist bei präpositional angeschlossenen Phrasen nicht einmal der prädikative Bezug klar. Es ist nicht angezeigt, ob sie als Adverbiale, Attribute oder als Objekte gemeint sind, wie die bekannten Standardbeispiele struktureller Unbestimmtheiten zeigen: Er probierte den Anzug im Schaufenster an. (Attribut oder Lokaladverbiale.) 150 In Heidelberg haben sich schon viele verliebt. (Lokaladverbiale oder präpositionales Ob‐ jekt.) Hier ist also die prädikative Struktur des Satzes konventionell unterbestimmt. Solche Unbestimmtheiten lassen sich aber durch Kontext‐ und Weltwissen meist auflösen oder durch explizitere Formulierungen vermeiden. Kommunikative Probleme sind hier wohl eher selten und lassen sich schnell aufklären. Wenn allerdings besondere Kürze geboten ist, können bei Verwendung präpositio‐ naler Phrasen komische Mehrdeutigkeiten auftreten, wie z.B. in dieser Zeitungsüber‐ schrift: Busfahrer mit Schülern am Steuer eingenickt. Wenn man diese Prädikationshandlung versteht, hat man sich schon nach dem Wahrscheinlichkeitsgrad für eine der möglichen Deutungen entschieden und die La‐ tenzen entsprechend gefüllt. Welche der folgenden entkomprimierten Varianten hat wohl den höchsten empirischen Wahrscheinlichkeitsgrad? Ein Busfahrer saß zusammen mit Schülern am Steuer und nickte ein. Ein Busfahrer, der Schüler beförderte, ist am Steuer eingenickt. Ein Busfahrer saß mit Schülern am Steuer und alle nickten zusammen ein. Ein (evtl. übermüdeter) Busfahrer ließ Schüler ans Steuer und nickte ein. Dass die Auflösung präpositionaler Phrasen eine generelle Aufgabe des Rezipienten sein kann, sieht man auch an Beispielen modaler Adverbiale wie in den folgenden Beispielen: Mit einem Kumpel brach er das Tor auf. Mit einem Bohrhammer brach er das Tor auf. Mit einem Lied auf den Lippen brach er das Tor auf. Die unterschiedlichen Entkomprimierungen hinter den präpositionalen Phrasen sind aber relativ leicht zu erschließen: Er brach das Tor auf. Ein Kumpel half ihm. Er brach das Tor auf. Dazu benutzte er einen Bohrhammer. Er brach das Tor auf. Währenddessen sang er ein Lied. Eine kleine Prise Weltwissen genügt hier jeweils für die Herstellung von Eindeutig‐ keit: Kumpel lassen sich ebenso wenig wie Lieder als Instrumente zum Aufbrechen von Toren benutzen. Und Bohrhämmer taugen nicht als Begleiter oder handelnde Helfer. Weil das alle wissen, sind Verkürzungen in Form präpositionaler Adverbiale rationale Mittel zur Steigerung der kommunikativen Effizienz. 151 Neben den temporalen und lokalen Bestimmungen sind die kausalen Adverbiale mit ihren finalen und argumentativen Varianten besonders häufig. Der Adverbialsatz in Er trainiert täglich, weil er im Wettbewerb gut abschneiden will. lässt sich verkürzen in einen Infinitivsatz oder eine präpositionale Phrase – mit un‐ terschiedlichen Graden von Weglassungen: Er trainiert täglich, um im Wettbewerb gut abzuschneiden. Er trainiert täglich für den Wettbewerb. Man sieht, dass präpositionale Anschlüsse unterschiedliche Grade von Weglassun‐ gen erlauben. Anschlüsse mit wegen sind besonders häufig, in der folgenden Verkür‐ zung aber auch sehr vage: Er kam wegen ihr. Verstanden wird eine solche Begründung nur durch schlussfolgernde „Auffüllun‐ gen“ wie Er kam, um mit ihr zu reden. Er kam, um sie zu sehen. Er kam, weil er ihr etwas sagen wollte. Er kam. Denn er wollte ihr seine Meinung sagen. Hier wird also sehr viel vorausgesetzt oder es muss viel nachgefragt werden. Aber vielleicht genügt hier im Hinblick auf unser Wissen über das Verhältnis der Ge‐ schlechter auch die Unbestimmtheit. Schwierigkeiten mit präpositionalen Adverbialen entstehen oft dadurch, dass Präpo‐ sitionen nominale Anschlüsse erfordern, und damit häufig Anschlüsse an Nominali‐ sierungen wie in Der Minister sagte seine Teilnahme wegen einer Erkrankung ab. Bei Substantivierungen fallen Satzteile weg. Nicht gesagt ist hier, wer erkrankt ist: der Minister selbst oder jemand ihm Nahestehender? Die Antwort ist nicht immer si‐ cher zu erschließen. Das gilt auch im nächsten Beispiel: Der griechische Pensionär V. S. hat sich wegen der europäischen Sparmaßnahmen umge‐ bracht. Hier kann zwar ein mögliches Subjekt der Sparmaßnahmen erschlossen werden: Eu‐ ropa. Aber vielleicht sind auch nur europaweite Sparmaßnahmen gemeint, deren Akteur ungenannt bleibt. Wie aber das präpositionale Adverbiale insgesamt ent‐ komprimiert aussähe, kann nur vermutet werden: Er hatte sich umgebracht, weil …? 152 Was könnte nach weil kommen? War er wegen seiner knappen Finanzlage verzwei‐ felt? Wollte er dem Hungertod entgehen? Wollte er gegen die Sparpolitik (wessen?) protestieren? Es bleiben Fragen offen. Adverbiale präpositionale Bestimmungen finden sich besonders oft auch in der Amtssprache und sorgen dort regelmäßig für Schwierigkeiten: Wegen ihrer eingeschränkten Alltagskompetenz stehen ihr in Pflegestufe 0 monatlich 225 Eu‐ ro zu. Nur mit einem gewissen Maß an sozialpolitischem Wissen lassen sich die Ellipsen der präpositionalen Phrase in Sätze umformen, bei denen die Latenzen versuchswei‐ se geschlossen sind: Ihre Alltagskompetenz ist eingeschränkt. Deshalb ist sie in Pflegestufe 0 eingeordnet. Deshalb stehen ihr monatlich 225 Euro zu. Präpositionale Adverbiale sind also elliptische Formen von Umstandsbestimmungen. Zwischen den Präpositionen und Subjunktionen, Konjunktionen und Bindeadverbi‐ en in entkomprimierten Sätzen bestehen feste Korrespondenzen: Präposition Subjunktionen; Konjunktionen wegen, aufgrund, infolge weil, da; deshalb, somit trotz obwohl, obgleich; dennoch mittels, mithilfe von indem seit nachdem; danach während als; gleichzeitig, zugleich zum, für damit; denn 153 Adverbiale Kommentare Erwartungsgemäß erweisen sich adverbiale Bestimmungen in ihren verschiedenen grammatischen Formen als Wiederkehr des Prädikationsspiels – selbst in ihrer kür‐ zesten Form, den Satzwörtern. Gilt das auch für Satzkommentierungen? Bei Kommentierungen werden Sachverhalte in Bezug zu subjektiven Faktoren wie Wissen, Vorannahmen oder Gefühlen des Sprechers oder seiner Gesprächspartner gesetzt. Umstandsbestimmungen hingegen betreffen die Verhältnisse zwischen Sachverhalten selbst. Natürlich ist auch die Feststellung eines kausalen Zusammen‐ hangs mit weil oder eines Gegensatzes mit aber eine gewissermaßen subjektive Fest‐ stellung. In diesem Sinn sind ja alle Behauptungen subjektiv. Der Gesprächspartner soll wissen, was der Sprecher (!) für wahr hält. Sachverhaltskommentare sind in die‐ sem Sinn subjektive Behauptungen über das persönliche Verhältnis der Partner zu Sachverhalten. Natürlich sind auch Kommentare zu Sachverhalten in mehr oder weniger expliziten Formen möglich: Unverständlicherweise hat Martha ihren Mann verlassen. Ich verstehe nicht, warum Martha ihren Mann verlassen hat. Niemand versteht, warum Martha ihren Mann verlassen hat. Martha hat ihren Mann verlassen. Das versteht niemand. Die adverbiale Form ist für Kommentierungen nicht exklusiv, allerdings verspricht sie meist den Vorteil der höheren Geschwindigkeit. Der ist am höchsten, wenn wir die für besonders häufige Kommentare entwickelten Satzwörter verwenden. In allen Formen repräsentieren die Kommentierungen aber prädikative Handlungen, selbst wenn ihre adverbialen Kurzformen das nicht auf den ersten Blick erkennen lassen. Satzwörter in Form von Satzadverbien und Partikeln sind die am stärksten kompri‐ mierten Ausdrucksformen von Sprechakten. Sie spielen für Sachverhaltskommentie‐ rungen in vielerlei Hinsicht eine wichtige Rolle. Wir bestimmen mit ihnen beispiels‐ weise unser Wissen in Bezug auf Sachverhalte (gewiss, angeblich, wirklich, tatsächlich, natürlich) oder wir setzen Sachverhalte in Bezug zu unserem Vorwissen oder unseren Vorannahmen (schon, erst, auch, sogar, endlich). Ebenso können wir Einstellungen und Wertungen zu Sachverhalten ausdrücken (leider, bloß, wenigstens, immerhin). Sachverhaltskommentare erfolgen in adverbialer Form meist mittels Satzwörtern (a) und präpositionalen Phrasen (b), aber auch nicht adverbial durch Sätze, in denen Subjekt‐ oder Objektsätze eingebettet sind (c), und natürlich durch externe Sätze (d). 154 a) Das umstrittene Sponsoring der Telekom für den VfL Wolfsburg kommt möglicherweise doch nicht vor Gericht. b) Entgegen den bisherigen Annahmen kommt das umstrittene Sponsoring der Telekom für den VfL Wolfsburg möglicherweise nicht vor Gericht. c) Es ist möglich, dass das umstrittene Sponsoring der Telekom für den VfL Wolfsburg entge‐ gen den bisherigen Annahmen nicht vor Gericht kommt. d) Das widerspricht den bisherigen Annahmen: Es ist möglich, dass das umstrittene Sponso‐ ring der Telekom für den VfL Wolfsburg nicht vor Gericht kommt. Beispiele für hochkomprimierte Sachverhaltskommentare sind Satzadverbien wie möglicherweise und Partikeln wie doch. Eine vergleichbare Verknappung ist mit ande‐ ren Ausdrucksformen nicht erreichbar. Wenn man einen Sachverhalt kommentieren will, muss man das immer explizit zum Ausdruck bringen, denn Kommentierungen sind nicht erschließbar. Das unterschei‐ det kommentierende Satzwörter von manchen sachverhaltsbezogenen Konjunktio‐ nen und Bindeadverbien, mit denen Zusammenhänge zwischen Sachverhalten be‐ stimmt werden. Diese sind – wie weil, deshalb, mithin ‐ manchmal weglassbar und können der rezeptiven Erschließung überlassen werden. Sprachliche Kommentie‐ rungen müssen dagegen immer explizit gemacht werden ‐ der Partner kann ja nicht in den Sprecher „hineinsehen“ und dessen Einstellungen erschließen, auch wenn dessen Minenspiel manchmal beredt sein kann. Satzadverbien wie sicherlich, natür‐ lich, doch, sogar oder Partikeln wie auch muss man schon explizit verwenden. Jeden‐ falls lässt sich bei einem Satz wie Konventionelle Implikaturen sind wahrscheinlich Blödsinn. das mit wahrscheinlich Gesagte wohl nicht erschließen, wenn man dieses Wort weg‐ ließe und lediglich sagte: Konventionelle Implikaturen sind Blödsinn. Kommentierungen können zusätzlich zu Sachverhalts‐ und Umstandsbestimmungen erfolgen und sich auf dadurch schon näher bestimmte Sachverhalte beziehen. In den folgenden Beispielsätzen sind Sachverhalts‐ und Umstandsbestimmungen unterstri‐ chen, Kommentierungen fettgedruckt: ‐ Schon bei Tagesanbruch gingen wir los. ‐ Beide Medikamente wirken natürlich verschieden. ‐ Selbstverständlich marschierten sie los, obwohl sie natürlich noch nicht gesund waren. ‐ Es ist klar, dass beide Medikamente verschieden wirken. ‐ Man braucht nicht extra feststellen, dass beide Medikamente verschieden wirken. 155 ‐ Erst nachmittags kamen wir zurück. ‐ Wohl um besser einschlafen zu können, trank er warmes Bier. ‐ Leider erkrankte Günthers Hund, nachdem er überraschenderweise von einer Feld‐ maus erschreckt worden war. Die prominenteste Gruppe der kommentierenden Satzwörter sind Satzadverbien wie zweifellos, natürlich, wahrscheinlich, vielleicht, angeblich, wirklich. Mit ihnen werden innerhalb eines Satzes bestimmte Feststellungen oder Einschätzungen mit Wahr‐ heitsanspruch zu dem in diesem Satz formulierten Sachverhalt zum Ausdruck ge‐ bracht. So wird mit natürlich in Er hat es natürlich geschafft. so etwas gesagt wie: Er hat es erwartungsgemäß geschafft. Er hat es geschafft. Das war zu erwarten. Dass er es geschafft hat, war zu erwarten. Entsprechendes gilt für zweifellos und wahrscheinlich: Unsere Renten sind zweifellos sicher. (Unsere Renten sind sicher. Daran besteht kein Zweifel.) Von unseren Renten werden wir im Alter wahrscheinlich nicht leben können. (Von unseren Renten werden wir im Alter nicht leben können. Das wird sich aller Voraus‐ sicht nach bewahrheiten.) Satzadverbien wurden schon im Zusammenhang mit illokutiven Indikatoren be‐ schrieben. Oft wird mit ihnen eine deskriptive Intention im Hinblick auf den Wahr‐ heitsgehalt des Gesagten kommentiert oder modifiziert. Wer sagt Prinz Charles ist angeblich dement. will nicht bedeuten, dass er das selbst glaubt. Aber er stellt fest, dass es Menschen gibt, die diesen Sachverhalt als wahr betrachten. Insofern würde er sich selbst wider‐ sprechen, wenn er anschließend behaupten würde: Es gibt aber niemanden, der so etwas gesagt hat. Denn mit angeblich wird ja zum Ausdruck gebracht, dass diese Feststellung von je‐ mandem gemacht wurde. In komprimierten Satzformen können Satzadverbien auch innerhalb von Subjekten oder Objekten vorkommen. Der offensichtlich betrunkene Gast wankte zum Ausgang. 156 Die Polizei entlarvte den angeblich blinden Mann als Betrüger. Die kommentierende Verwendung bleibt aber erhalten. Obwohl sie hier Teile von Nominalphrasen sind, werden mit diesen Ausdrücken Feststellungen zu Sachverhal‐ ten gemacht. Wenn man die elliptischen Subjekte bzw. Objekte entkomprimiert, er‐ scheinen die Satzadverbien wieder in ihrer ursprünglichen Positionen: Der Gast wankte zum Ausgang. Er war offensichtlich betrunken. Der Mann war angeblich blind. Er wurde von der Polizei als Betrüger entlarvt. Wie sehr die grammatische Oberfläche die tatsächliche Verwendung verdecken kann, zeigt sich auch, wenn einige der dafür geeigneten Satzwörter in attributiver Position stehen: Die angeblichen Wunderkinder versagten an der ersten ernsthaften Herausforderung. … Der eigentliche Chef war seine Frau. Auch hier zeigt sich die kommentierende Verwendung hinter der elliptischen attri‐ butiven Oberfläche erst in der entkomprimierten Form: Sie waren angeblich Wunderkinder, (aber) sie versagten an der ersten ernsthaften Herausfor‐ derung. Eigentlich war seine Frau der Chef. Eine besondere Rolle beim komprimierenden Kommentieren spielen die Partikeln. Diesen sog. Füllwörtern wurde lange Zeit keine bedeutsame Verwendung zugebil‐ ligt. Diese Wörter haben zwar keine sogenannte lexikalische Bedeutung, sie können also nicht prädiziert werden. Aber wenn sie weggelassen werden, tritt eben doch ein Informationsverlust auf. Auch Partikeln werden regelhaft verwendet, das bedeutet, sie haben einen Wahrheitsbezug. Machte es keinen Unterschied, ob man sie verwen‐ det oder weglässt, dann wären sie so tatsächlich etwas wie Füllwörter. In den letzten Jahrzehnten ist allerdings eine umfangreiche Literatur entstanden, die das Gegenteil beweist. Im Folgenden einige Beispiele bedeutsamer Verwendungen von Partikeln. Dass wir mit Partikeln etwas bedeuten, zeigt sich schon allein an den Unterschieden, die sich durch ihre Weglassung oder Hinzufügung ergeben. So wird mit Gradparti‐ keln ähnlich wie mit Satzadverbien satzintern in Kurzform eine Feststellung hinzu‐ gefügt, die man auch durch eine zusätzliche Prädikationshandlung in einem exter‐ nen Satz machen könnte. Wer sagt: Ich habe nur drei Bier getrunken. der sagt so etwas wie: Ich habe drei Bier getrunken. Das ist nicht viel im Vergleich zu den Möglichkeiten bzw. Er‐ wartungen. 157 Die Gradpartikel nur kann in adverbialer Position je nach Fokussierung an verschie‐ dene Stellen gesetzt werden: Joe hat nur Köln besucht. Joe hat Köln nur besucht. Nur Joe hat Köln besucht. Bei allen drei Feststellungen bleibt trotz der wechselnden Fokussierung die Qualität und die Verwendung gleich. Mit nur werden jeweils zusätzlich erwartete oder für möglich gehaltene Sachverhalte ausgeschlossen: Joe hat auch noch andere Städte besucht. Joe hat sich dauerhaft in Köln aufgehalten. Es haben noch andere aus einem bestimmten Personenkreis, zu dem Joe gehört, Köln besucht. So werden auch mit Gradpartikeln Sachverhalte in Kurzform kommentiert. Mit nur wird eine Einschränkung gegenüber Annahmen der Gesprächspartner festgestellt, aber es erfolgt damit keine nähere Bestimmung des Sachverhalts, dass Joe Köln be‐ sucht hat. Mit Modalpartikeln wie aber oder ja werden Sachverhalte oft im Hinblick auf das ei‐ gene oder das gemeinsame Wissen kommentiert: Du bist aber schlank geworden. heißt Du bist schlank geworden. Darüber bin ich erstaunt. Das überrascht mich. Mit der kurzen Modalpartikel ja wird der Charakter einer Feststellung völlig verän‐ dert. Betrachten wir drei Feststellungen – zuerst ohne ja, dann mit ja: Du bist noch rüstig. Die Kinder haben viel geübt. Erna kann singen! Hier handelt es sich um ganz normale Feststellungen, deren Bewirkungsabsicht es nach dem Relevanzprinzip ist, dass der Partner wissen soll, dass der Sprecher das Gesagte für wahr hält. Fügen wir aber die Modalpartikel ja ein, ändern sich Bezie‐ hungsaspekt und Bewirkungsabsicht: Du bist ja noch rüstig. Die Kinder haben ja viel geübt. Erna kann ja singen! Zwar werden immer noch Feststellungen gemacht, aber durch ja wird in Kurzform zusätzlich zum Ausdruck gebracht, dass auch der Gesprächspartner den festgestell‐ 158 ten Sachverhalt schon kenne. Mit ja wird also in bestimmten Kontexten so viel be‐ deutet wie mit Wie du schon weißt … oder Du weißt ja schon, dass… oder Das brauche ich dir nicht extra zu sagen. Je nach Kontext kann mit ja in den obigen Sätzen aber auch die eigene Überraschung über die jeweils angesprochene Tatsache zum Ausdruck gebracht werden, etwa in dem Sinne: Erna kann singen. Das ist ja nicht zu fassen! Ich bin überrascht, wieviel die Kinder geübt haben. usw. So können sich die Gesprächspartner mit der Partikel ja im Hinblick auf den weiteren Gesprächsverlauf ihres Wissens versichern. Mit Modalpartikeln wie ja geht diese Rückversicherung auf das gemeinsame und evtl. unterschiedliche Wissen besonders schnell. Partikeln sind so etwas wie die Turboversionen von Kommentaren. 159 Fazit: Die Grammatik des sprachlichen Handelns Bedeutungstheorie ist nur als Handlungstheorie möglich. Die zentrale sprachliche Handlung ist das Prädizieren über Gegenstände der Bezugnahme. Damit machen wir alles. Prädikationshandlungen, die Basishandlungen sprachlicher Kommunikati‐ on, werden zum Ausdruck von Bewirkungsabsichten gemacht und sind insofern identisch mit Sprechakten. Wir machen sie immer wieder, auch in rekursiven Ein‐ bettungen. Ihre konventionellen Formen sind einfache, erweiterte oder komplexe Sätze, aber auch deren komprimierte Formen. Prädikationshandlungen als die fundamentalen Bedeutungshandlungen sind symbo‐ lische Handlungen. Das heißt, sie beruhen auf Regeln. Anders kann es nicht sein, auch wenn Regeln nicht alles sind. In Anlehnung an Wittgensteins Spielemetapher habe ich sie Prädikationsspiele genannt. Prädikationsspiele sind Bedeutungshand‐ lungen. Wir machen sie so, dass deutlich wird, dass wir sie machen. Durch ihre obli‐ gatorischen grammatischen Formen wird deutlich, über welche Gegenstände der Be‐ zugnahme wir was in welchem relationalen Sinn prädizieren (Strukturanzeige). Mit der temporalen Form des verbalen Prädikators wird immer die metaprädikative Handlung der Temporaldeixis gemacht. Gleichzeitig wird mit einer der obligatori‐ schen modalen Formen des Verbs (Indikativ, Konjunktiv, Imperativ) in Verbindung mit der Satzgliedstellung die Bewirkungsabsicht der Prädikationshandlung angezeigt. Mit der Art der Bezugnahme durch bestimmten oder unbestimmten Artikel bringen wir darüber hinaus zum Ausdruck, ob wir einen Gegenstand im Diskurszusammen‐ hang neu einführen oder uns auf einen schon eingeführten Gegenstand beziehen. Prädikationshandlungen sind nur gemäß den grammatischen Regeln der jeweiligen Sprachgemeinschaft möglich. Die regelhaften grammatischen Formen fungieren als metaprädikative Ausdrucksmittel mit indikatorischen Funktionen. Ob es sich um die Satzgliedstellung, die kasuelle Markierung oder Kongruenz von Numerus, Kasus oder Genus handelt – die Entscheidung über die Anwendung all dieser regelhaften grammatischen Mittel hat uns die Sprachgemeinschaft, in die wir hineingewachsen sind, abgenommen. Die Syntax ist also nicht etwas neben der Semantik, sondern ein integraler Teil einer konventionalen Handlungstheorie. Die Pragmatik beschreibt den wegen konventioneller Unterbestimmtheiten rezeptionsseitig anfallenden Er‐ schließungsaufwand. Oft wollen wir mehr sagen, als das, was wir mit einer einzigen Prädikationshand‐ lung ausdrücken können. Dann entstehen textuelle Reihen von Sätzen. Aber dieses kleinschrittige Nacheinander von Sprechakten bzw. Sätzen ist umständlich. Wir möchten es beschleunigen und mehrere Prädikationshandlungen schneller und mög‐ lichst auf einmal machen. Die Mittel dazu bieten die grammatischen Regeln der er‐ 160 weiterten oder komplexen Sätze. Eine bedeutsame Funktion grammatischer Regeln ist also die Ermöglichung komprimierter zeitökonomischer Kommunikation. Wir machen zwar immer Prädikationshandlungen – wir können nichts anderes machen. Aber wir müssen sie nicht in einfacher expliziter Form kohärent nacheinander ma‐ chen, sondern wir können sie komprimierend ineinander integrieren. Die Beschleunigung erfolgt insbesondere durch attributive oder adverbiale Integra‐ tion. Attribute entstehen durch Integration von Sätzen, die über denselben Referen‐ ten gehen. Dabei werden die referentiellen Bezüge der integrierten Prädikations‐ handlungen durch grammatische Mittel wie Stellungs‐ und Kongruenzregeln ausge‐ drückt. Allerdings erhöht sich bei den elliptischen, also nicht satzförmigen Attribu‐ ten der pragmatische Substitutionsaufwand. Auch adverbiale Erweiterungen entstehen durch Integration von ursprünglich ex‐ ternen Sätzen. Adverbiale Erweiterungen sind Ausdruck integrierter Sachverhalts‐ und Umstandsbestimmungen oder integrierter Sachverhaltskommentare. Alle nicht satzförmigen Adverbiale sind elliptisch, so dass auf der Rezeptionsseite pragmati‐ sches Füllen der Leerstellen erforderlich wird. Auch die Prädikationshandlungen in Form von attributiven oder adverbialen Erwei‐ terungen werden unvermeidlich in Verbindung mit metaprädikativen Strukturan‐ zeigen gemacht, sodass nachvollziehbar wird, worauf sie sich beziehen. Bei den satz‐ förmigen Attributen und Adverbialen erfolgt zusätzlich mit der jeweiligen verbalen Prädikation die obligatorische Temporaldeixis. Dabei wird der zeitliche Zusammen‐ hang zu dem im Hauptsatz ausgedrückten Sachverhalt, also v.a. Gleichzeitigkeit o‐ der Vorzeitigkeit angezeigt. Prädikationshandlungen machen wir also in verschiedenen Komplexitätsgraden: ‐ als explizite Prädikationshandlungen mit einfachen Sätzen; ‐ als eingebettete Prädikationshandlungen: a) mit vollständigen Sätzen, z.B. in der Form von Relativsätzen, Subjekt‐ und Ob‐ jektsätzen, Attributsätzen und Adverbialsätzen; b) mit elliptisch verkürzten Sätzen, z.B. in der Form von adjektivischen Attributen oder Genitivattributen, ebenso in der Form von präpositionalen Adverbialen; c) in der Kurzform von Satzwörtern, mit denen satzintern hochgradig komprimierte Feststellungen zu dem mit dem Satz Gesagten ausgedrückt werden. Beispiele sind Konjunktionen, Bindeadverbien oder Partikeln; d) mit Nominalsierungen als Ausdruck elliptisch verkürzter Sätze. Das sprachliche Handeln ist eigentlich immer nur prädikatives Handeln zum Aus‐ druck von Bewirkungsabsichten, wodurch wir eben diese Wirkungen erreichen wol‐ 161 len. Wir können aber dieses prädikative Handeln in verschiedenen Graden von Ex‐ plizitheit und mit unterschiedlichem Zeitaufwand machen. Ein erheblicher Teil des grammatischen Regelapparates dient dem zeitökonomischen Prädikationshandeln. Wie wir es unter Berücksichtigung dessen, was wir bei unseren Partnern vorausset‐ zen, auch machen – explizit oder komprimiert bzw. elliptisch ‐ wir machen es nach lebenslangem Üben hochgradig automatisiert. 163 Teil III: Schlussfolgerungen 5. Die vielen Wege zum kommunikativen Misserfolg Es gibt Fälle sprachlicher Kommunikation, bei denen es vor allem um die Demonst‐ ration von Überlegenheit geht, um Einschüchterung oder Manipulation. Grundsätz‐ lich aber ist sprachliche Kommunikation ein kooperatives Unterfangen. Sprechakte zu machen heißt ja, Bewirkungsabsichten zum Ausdruck zu bringen, um entspre‐ chende Wirkungen zu erreichen. Das aber gelingt nur, wenn die Zuhörer verstehen, worauf Bezug genommen und was darüber mit welcher Bewirkungsabsicht gesagt wird. Nur wenn der Partner versteht, kann er eine Frage beantworten oder eine Bitte erfüllen – oder die Kooperation verweigern. Selbst die absichtsvolle Verweigerung der Kooperation ist nur möglich, wenn verstanden wird. Ohne Verstehen schlägt jede Kommunikation fehl. Das erste Ziel muss also immer sein, das Prädikationsspiel so zu spielen, dass das Gegenüber die damit zum Aus‐ druck gebrachte Bewirkungsabsicht erkennen kann. Leider kann beim Versuch, das Spiel nachvollziehbar zu spielen, ziemlich viel schiefgehen. Es gibt viele Möglichkei‐ ten, das sprachliche Können und das Wissen der Partner übermäßig zu beanspru‐ chen. Das ist schon gegenüber sprachkompetenten Menschen häufig der Fall und noch stärker bei Menschen mit Einschränkungen. In den letzten Jahren gab es diesbezüglich Bemühungen um eine sogenannte Leichte oder Einfache Sprache. Leichte Sprache soll Menschen mit kognitiven Behinderun‐ gen oder Lernschwierigkeiten den verstehenden Nachvollzug ermöglichen, Einfache Sprache richtet sich an Menschen mit geringer Lese‐ und Schreibkompetenz. Der Komplexitätsgrad Leichter Sprache ist geringer als derjenige Einfacher Sprache. So wird z.B. für die Leichte Sprache eine Begrenzung der Satzlänge auf acht Wörter empfohlen, bei Einfacher Sprache auf 15 Wörter. Weitere Grundsätze der Leichten Sprache sind zum Beispiel: ‐ Es werden kurze Sätze verwendet. ‐ Jeder Satz enthält nur eine Aussage. ‐ Es werden Aktivsätze eingesetzt. ‐ Ein verständlicher Satz besteht aus Subjekt + Prädikat + Objekt, z. B. Das Kind streichelt den Hund. ‐ Der Konjunktiv wird vermieden. ‐ Abstrakte Begriffe werden vermieden; wo sie notwendig sind, werden sie durch anschauliche Beispiele oder Vergleiche erklärt. 164 ‐ Bildhafte Sprache wird vermieden, z. B. „Kahlschlag“. ‐ Wenn Fremdwörter oder Fachwörter vorkommen, werden sie erklärt. ‐ Bei langen Zusammensetzungen wird durch Bindestriche deutlich gemacht, aus welchen Wörtern die Zusammensetzungen bestehen. Mittlerweile bieten viele Behörden Texte in Leichter Sprache an. Auf der Seite der Bundesregierung wird das Amt des Bundeskanzlers folgendermaßen erklärt: „Die Bundes‐Kanzlerin bestimmt, welche Politik in Deutschland gemacht wird. Die Bundes‐Kanzlerin sucht aus, wer Ministerin oder Minister wird. Die Bundes‐Kanzlerin und die Ministerinnen und Minister sind die Bundes‐Regierung. Die Bundes‐Kanzlerin ist die Chefin der Bundes‐Regierung.“90 Auf „stadt‐koeln.de“ führt ein Versuch, das Wort Sterbeurkunde in Leichter Sprache zu erklären, zu folgendem Resultat: „Wenn jemand tot ist, bescheinigen wir seinen Tod durch eine Urkunde. Diese Urkunde nennt man Sterbe‐Urkunde.“91 Natürlich muss auch den Rezipienten Leichter Sprache ein bestimmtes Vorwissen unterstellt werden. Bei der obigen Erklärung wird angenommen, dass der Leser die Wahrheitsbedingungen für bescheinigen und Urkunde gelernt hat. Auch diese Prädika‐ toren könnten wiederum vorab eingeführt werden, aber vielleicht müssten manche der zur Erklärung verwendeten Ausdrücke wiederum vorher selbst erklärt werden usw. Auch Leichte Sprache hat also in der Praxis ihre Grenzen, will sie sich nicht in einem infiniten Regress von Versuchen, das Vorverständnis zu sichern, selbst blo‐ ckieren. Auch die folgende Nachricht des Deutschlandfunks bemüht sich um Leichte Spra‐ che: „Wer wegen einer Krankheit nicht mehr arbeiten kann, soll auch mehr Rente be‐ kommen. Die Rente wegen Krankheit oder Behinderung heißt Erwerbs‐Minderungs‐ Rente. Diese Rentner sollen ungefähr 45 Euro im Monat mehr bekommen. 90 http://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Leichte Sprache/leichte‐sprache‐wahl‐ bundeskanzlerin.html. 91 http://www.stadt‐koeln.de/leben‐in‐koeln/soziales/sterbe‐urkunde‐beantragen. 165 Eine weitere Änderung gilt für Menschen, die 45 Jahre lang gearbeitet haben. Sie sol‐ len schon mit 63 Jahren in Rente gehen dürfen. Bisher darf man normalerweise erst mit 65 Jahren in Rente gehen.“92 Hier scheint die Verstehensfähigkeit der angesprochenen Zielgruppe relativ hoch eingeschätzt worden zu sein. Jedenfalls werden einige Grundsätze Leichter Sprache nicht beachtet. Im Unterschied dazu ist bei den Verfassern des folgenden Bibeltextes der Erwartungslevel sehr niedrig angesetzt. Sogar Personalpronomina werden we‐ gen ihrer potentiellen Mehrdeutigkeit vermieden: „Joh. 20,19‐23 Jesus war schon von den Toten auferstanden. Aber die Jünger von Jesus konnten das nicht glauben. Die Jünger hatten Angst. Weil die Menschen Jesus umgebracht hatten. Darum versteckten sich die Jünger in einem Haus. Die Jünger schlossen alle Türen ab. Aber auf einmal am Sonntag war Jesus bei seinen Jüngern im Haus. Obwohl alle Türen abgeschlossen waren. Und obwohl Jesus keinen Schlüssel hatte. Jesus war mitten unter den Jüngern. Jesus sagte: Friede sei mit euch. Jesus zeigte den Jüngern seine Hände. Jesus zeigte auch seine Seite. Die Jünger freuten sich. Weil die Jünger Jesus sahen. Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch.93“ Bei Leichter Sprache geht es nicht nur um die Vermeidung von möglicherweise un‐ bekannten oder metaphorisch verwendeten Wörtern. Wie die oben zitierten Grund‐ sätze erkennen lassen, geht es auch darum, auf die im Dienste der Beschleunigung benutzten grammatischen Komprimierungsmöglichkeiten weitgehend zu verzichten. Dadurch sollen die Rezipienten zum einen nicht zu viele Sachverhalte gleichzeitig im Kurzzeitgedächtnis halten müssen und es soll andererseits ihr Erschließungsauf‐ wand reduziert werden. Die Adressaten sollen nicht zu sehr auf Welt‐ und Kontext‐ wissen zurückgreifen müssen, um die Latenzen hinter komprimierten Ausdrucks‐ http://www.nachrichtenleicht.de/nachrichten/neue‐regeln‐fuer‐die‐rente/. https://www.bibelwerk.de/Sonntagslesungen.39460.html/Bibel+in+Leichter+Sprache.102163.html. 92 93 166 weisen zu füllen. Kurz: Der Gedächtnis‐ und Rechenaufwand soll nicht zu groß wer‐ den. Im kommunikativen Alltag sind Einfache und Leichte Sprache oft unangemessen. Hier geht es nämlich auch um Effizienz und Geschwindigkeit. Und dazu kann und soll das hintergründige Wissen der Partner genutzt werden. Aber die auf bestimmte Zielgruppen angelegten Ausdrucksformen Einfacher und Leichter Sprache können uns die grundsätzliche Wichtigkeit kooperativer Ausdrucksformen bewusst machen. Zur kommunikativen Kompetenz eines Menschen gehört auch, das eigene Prädikati‐ onsspiel auf das sprachliche Vermögen des Gegenübers und dessen Hintergrundwis‐ sen abzustimmen zu können. Weder sollte man zu explizit sein und den Partner dadurch vor den Kopf stoßen, noch sollte man das eigene Können und Wissen unre‐ flektiert immer auch dem Gegenüber unterstellen. Adressatenbezogen kann auch ei‐ ne hochkomplexe, hochgradig komprimierte und mit allen Kunstgriffen der Rhetorik gespickte Sprache angemessen sein. Das kommunikative Vergnügen und die Erfah‐ rungen des gegenseitigen Verstehens und gemeinsamen Wissens können dadurch gesteigert werden – allerdings muss die Sprache kooperativ sein. Der Rezipient muss das Spiel mitspielen können. Ein kooperativer Sprecher spielt das Prädikationsspiel so, dass der Partner es mit‐ spielen kann, ohne dass sein Erschließungsaufwand zu groß wird. Auf der Seite des Sprechenden ist dazu ein hohes Maß an sozialer Kompetenz nötig. Denn das Prädi‐ kationsspiel soll so gestaltet werden, dass es dem Wissen des Partners angemessen ist. Das wird nicht immer ohne laufende Korrekturen im kommunikativen Verfahren gelingen. Kooperative Sprache beginnt mit klarer Artikulation (oder lesbarer Schrift). Wenn die Aussprache schlampig oder zu leise ist, entsteht die erste Belastung: Akustisch nicht ganz verstandene Wörter müssen im Kontext erschlossen werden. Wenn auf dieser Ebene schon Rechenkapazität verbraucht wird, kann Kommunikation schwie‐ rig werden. Das ist auch der Fall, wenn die Sprechgeschwindigkeit für den Partner unangemessen schnell wird. Auch wenn deutlich, in angemessener Geschwindigkeit und in einfachen Sätzen gesprochen wird, gibt es für den verstehenden Nachvollzug noch genügend Herausforderungen. Selbst beim Reden in einfachen Kernsätzen – einer Grundforderung für Leichte Sprache ‐ sind bereits elliptische Verkürzungen möglich, die vom Rezipienten kom‐ pensiert werden müssen. Ellipsen liegen vor, wenn bestimmte Teile eines Satzes un‐ ausgesprochen bleiben, obwohl sie für das, was wir zu verstehen geben wollen, not‐ wendig sind. Wer elliptisch redet, setzt normalerweise beim Partner das Mitzuver‐ 167 stehende oder Hinzuzufügende als bekannt voraus oder hält es für unwichtig. Un‐ problematisch sind z. B. Antworten auf Fragen von der Art: Wer fehlt heute? Martina (fehlt heute). Typisch sind Ellipsen auch bei Aufzählungen: Wir besuchten Florenz, Rom und Neapel. Ellipsen entstehen oft auch bei Passivsätzen, wenn das Aktiv‐Subjekt weggelassen wird: Die Schüler wurden informiert. Das weggelassene Subjekt wird hier entweder als bekannt bzw. als erschließbar vo‐ rausgesetzt oder es wird einfach für unwichtig erachtet. Auch bei Verwendung so‐ genannter gradueller Adjektive wie groß, klein, reich, gut müssen rezeptionsseitig La‐ tenzen geschlossen werden: Karlchen ist groß. (für einen Jungen seines Alters) Wir sind reich. (im Vergleich zu …) Das ist gut! (im Vergleich mit … und im Hinblick auf …). Eine solche „zweckmäßige Ungenauigkeit“ ist unproblematisch, solange der Rezipi‐ ent das Weggelassene aus seinem Hintergrundwissen rekonstruieren kann. Immer geht es um einen vernünftigen Ausgleich zwischen ökonomischer Kürze und Ver‐ ständlichkeit. Schon Kernsätze ziehen nicht nur wegen Ellipsen, sondern auch wegen der nahezu allgegenwärtigen deiktischen Ausdrücke Erschließungsaufwand nach sich. Deikti‐ sche Ausdrücke bedürfen der „pragmatischen“ Ergänzung, sie werden erst unter Einbezug bestimmter Kontextannahmen sinnvoll. Beispiele sind Artikel (dieser, jener, mein, dein, alle, jeder), Demonstrativa (hier, dort, da) und deiktische Adverbien (hin, her, hinunter, herunter, jetzt, später, heute, morgen, gestern, rechts, links). Diese oft auch als indexikalisch bezeichneten Ausdrücke sind Standardbeispiele für die sogenannte Pragmatik. Sie werden zwar regelhaft verwendet, sind aber hinsichtlich ihrer Wahr‐ heitsbedingungen konventionell unterbestimmt und bedürfen zum Verstehen der pragmatischen Kompensation. Ebenfalls Beispiele für konventionelle Unterbe‐ stimmtheit sind die Ausdrucksformen der Temporaldeixis. Man denke nur an die vierfache Verwendungsweise der präsentischen Verbalform zum Anzeigen der Ge‐ genwart („wie Bezugszeit“), der Zukunft („nach Bezugszeit“), der Vergangenheit (historisches Präsens) oder als Anzeige für zeitlos gültige Aussagen. Vor allem in schriftsprachlichen Texten gilt Ähnliches auch für präpositionale Zeitangaben wie vor zehn Jahren oder für deiktische Ausdrücke wie jetzt, gestern, bald, letztes Jahr usw. 168 Generell sind auch personaldeiktische Ausdrücke (z.B. ich, du, er …) jeweils kontex‐ tuell zu bestimmen, ebenso prädikative Kennzeichnungen wie das blaue Fahrrad. Auch lokaldeiktische Ausdrücke wie dort, hier, hinter dem nächsten Haus, herein oder hinaus oder Verben wie kommen und gehen müssen kontextuell fixiert werden. Schließlich ist auch bei Quantifikationen eine kontextuelle Bestimmung erforderlich wie z.B. bei Alle kamen ins Ziel. Neben Ellipsen, deiktischen Ausdrücken und graduellen Adjektiven müssen selbst schon bei einfachen Sätzen noch zusätzliche, ganz grundsätzliche Verstehensklip‐ pen bedacht werden wie z.B. ‐ Sind die verwendeten Prädikatoren und Satzwörter dem Gegenüber geläufig? Ist ihre potentielle Mehrdeutigkeit auflösbar? ‐ Sind eventuelle metaphorische Wortschöpfungen auf die Möglichkeiten des Rezipienten abgeglichen? ‐ Ist die Bewirkungsabsicht nachvollziehbar ausgedrückt? Die jeweilige Bewir‐ kungsabsicht kann ja durch illokutive Indikatoren bestenfalls immer nur ver‐ allgemeinert bedeutet werden, etwa als appellativ oder kommissiv. Meist bleibt für den Rezipienten eine pragmatische Ergänzungsaufgabe. Das Verstehensziel kann also schon beim prädikativen Handeln mit einfachen Sätzen verfehlt werden. Das Reden in einfachen Sätzen reduziert zwar für den Rezipienten die Komplexität, ist aber umständlich und zeitaufwendig, und es nutzt nicht das Wissen und Können der Partner. In der kommunikativen Praxis werden die verschiedenen Mittel der Beschleunigung natürlich mehr oder weniger genutzt. Sie alle erhöhen den rezeptionsseitigen Er‐ schließungsaufwand und widersprechen insofern den Grundsätzen Einfacher oder Leichter Sprache. Wie in den vorausgehenden Kapiteln gezeigt, bietet die Grammatik z.B. mit der Möglichkeit attributiver und adverbialer Fügungen ein ganzes Arsenal miteinander kombinierbarer Mittel der Sprachbeschleunigung durch Komprimie‐ rung. Attributive und adverbiale Fügungen sind elliptische Ausdrucksformen, bei denen im Sinne effizienter Kommunikation weggelassen wird, was die Partner ver‐ mutlich schon wissen oder erschließen können. Attributive und adverbiale Ellipsen sind als verkürzte Formen von Sätzen grammatischer Standard. Sie fordern aber re‐ zeptionsseitig kompensatorischen Erschließungsaufwand. Wenn derartige Ellipsen – evtl. zusätzlich zu anderen pragmatischen Herausforderungen – gehäuft auftreten, kann das kooperative Unternehmen an seine Grenzen geraten, weil der Erschlie‐ ßungsaufwand für den verstehenden Nachvollzug „in Echtzeit“ nicht mehr zu leis‐ ten ist. 169 Die an der grammatischen Oberfläche auftretenden attributiven und adverbialen El‐ lipsen sind im Kapitel „Das Prädikationsspiel“ bereits schwerpunktartig skizziert worden. Man erinnere sich nur daran, dass zumindest bei Attributen in der Form von Adjektiven, Relativsätzen und Partizipien jeweils erschlossen werden muss, ob sie restriktiv oder explikativ gemeint sind. Bei präpositionalen Phrasen ist manch‐ mal nicht ausgedrückt, ob sie als Attribute oder adverbiale Bestimmungen interpre‐ tiert werden sollen. Manchmal kommt es deshalb zu Doppelsinnigkeiten wie in Polizei erschießt Mann mit Pfeil und Bogen. Die im Deutschen ebenfalls häufigen genitivischen Attribuierungen sind das Resul‐ tat elliptischer Einbettungen von ursprünglich selbständigen Sätzen. In vielen Fällen ist aber der zugrundliegende Satz nicht sicher zu erschließen. Man denke nur an ein simples Beispiel wie Das Mobben des Lehrers hatte Konsequenzen. So zwingen erweiterte Sätze den Rezipienten häufig zu hintergründigem, im Resultat oft hypothetischem Entkomprimieren. Die potentielle Problematik komprimierten Sprechens liegt nicht nur auf der Seite von möglicherweise überforderten Rezipien‐ ten. Es ist auch nicht auszuschließen, dass die Redenden selbst das Spiel einfach oberflächlich und fehlerhaft spielen, dass sie sich ihrer eigenen kommunikativen In‐ tentionen nicht recht bewusst sind. Möglicherweise wählt jemand Formulierungen, bei denen er selbst nicht überblickt, was genau er worüber sagen will. Oder es wer‐ den zu Verschleierungs‐ und Manipulationszwecken absichtlich Ausdrucksformen gewählt, die das Gegenüber wegen des dadurch angezeigten Wissensgefälles ein‐ schüchtern sollen. Komprimierte Sätze müssen nicht generell schwerer verständlich sein als unkom‐ primierte. Aber Komprimierungen führen hörerseitig dazu, dass der rezeptionsseiti‐ ge Aufwand beim Mitspielen des Prädikationsspiels erhöht wird. Denn der Hörer muss für einen angemessenen Nachvollzug oder Mitvollzug neben dem ohnehin an‐ fallenden konversationellen Geschäft eine zusätzliche entsprechende Entkomprimie‐ rung leisten, er muss „die unterdrückten grammatischen Teile und Kennzeichnun‐ gen wieder ans Licht holen. Er muss die Komprimierungen – wenigstens im Geiste – in vollständige Sätze reformulieren.“94 Macht er das nicht oder kann er das nicht, bleibt sein Nachvollzug im Ungefähren. Und vielleicht ist das auch die überwiegen‐ de kommunikative Wirklichkeit. Zusätzlich zu den grammatischen Ellipsen sind Satzwörter sehr wirkungsvolle Mit‐ tel der Beschleunigung. Mit ihnen werden ja in kürzest möglicher Form zusätzliche Feststellungen zum Ausdruck gebracht. Stärker noch als viele andere Arten von Heringer 2001, 299. 94 170 Komprimierungen werden sie dazu verwendet, „Zeit und Raum zu sparen oder um die Hörer/Leser nicht zu langweilen oder sie zu provozieren oder um etwas zu ver‐ schleiern.“95 Mit Sachverhaltskommentaren bestimmen wir unser Wissen in Bezug auf Sachverhalte (gewiss, angeblich, wirklich, tatsächlich, natürlich) oder setzen Sachver‐ halte in Bezug zu unserem Vorwissen oder unseren Vorannahmen (schon, erst, auch, sogar, endlich). Ebenso können wir Einstellungen oder Wertungen zu Sachverhalten ausdrücken (leider, bloß, wenigstens, immerhin…). Das alles geschieht in komprimierter Form gleichsam in höchster Geschwindigkeit nebenbei und zusätzlich zum eigentli‐ chen Sprechakt. Somit eignen sich die inexpliziten Ausdrucksformen von Sachver‐ haltskommentierungen tendenziell zur Manipulation. Wer etwa seine Behauptung mit dem Satzadverb natürlich kommentiert, gibt zu verstehen, dass an der gemachten Feststellung kein vernünftiger Zweifel bestehe. Da dies in indirekter Kurzform und mit hoher Geschwindigkeit zusätzlich zur eigentlichen Feststellung geschieht, fällt es dem Gesprächspartner schwer, einzuhaken oder Einspruch zu erheben. Die bisher genannten Formen komprimierten Bedeutens dienen der Effizienzerhö‐ hung und sind dafür entwickelt worden. Mit Nominalisierungen wird zusätzlich zu all diesen Mitteln der Sprachbeschleunigung ein weiterer, sehr wirkungsvoller, aber auch oft problematischer Turbo gezündet. Nominalisierungen sind auch schon in einfachen Sätzen möglich. Dort machen sie aus harmlos aussehenden einfachen Sät‐ zen komprimierte Sätze. Denn Nominalsierungen sind verkürzte Sätze, bei denen das Weggelassene erschlossen werden muss.96 Nominalsierungen sind typisch für moderne Sach‐ und Fachprosa. Dort haben sie teilweise die früher als Ideal angese‐ hene explizite, oft hypotaktische Ausdrucksweise abgelöst. Nominalphrasen mit nominalisierten Verben oder Adjektiven enthalten keine syntaktischen Prädikate, aber sie treten oft an die Stelle ganzer expliziter Sätze. Sie sind überwiegend aus Ver‐ ben und Adjektiven abgeleitet, die ja wesentlich prädiziert werden. Typische Formen sind: 1. Substantivierte Infinitive: das Zurückbauen, das Entfernen… 2. Verb + ung: Neugestaltung (des Föderalismus), Anerkennung (von Ansprüchen) ... 3. Ableitung aus Verb: Versuch, Verhalten, Umbau, Argumentation, Veränderung … a.a.O., 25. Nominalsierungen führen bekanntlich zu nicht unerheblichen erkenntnistheoretischen Problemen. Denn durch sie werden analog zu materiellen Gegenständen metaphorische Gegenstände geschaffen. Das Laufen, das Schöne oder gar das Sein werden zu Gegenständen der Bezugnahme, sodass man über sie prädizieren kann. Sprachtherapeutisch empfiehlt es sich, diese Erscheinungen „feiernder“ Sprache durch Entkomprimierung auf den Boden der Vernunft zurückzuholen. Wenn das nicht geht, sollte man wissen, was man davon zu halten hat. Auch der Ausdruck Bedeutung ist übrigens ein ein‐ drucksvolles Beispiel für die Probleme, die durch Substantivierungen das Licht der Welt erblicken können. 95 96 171 4. Ableitung aus Adjektiv: Schönheit, Einsamkeit, Möglichkeit … Nominalisierungen finden wir häufig in der Sprache der Öffentlichkeit, beispielswei‐ se bei Sätzen wie 1) Die Neugestaltung des Schulwesens bringt erhebliche Kosten mit sich. Was wird damit zu verstehen gegeben? Gehen wir einmal im Sinne der Satzform von einer deskriptiven Bewirkungsabsicht aus, also davon, dass die Prädikation von bringt mit sich behauptend oder im Sinne einer Vorhersage gemacht wird. Was genau wird nun worüber festgestellt? Entsprechend der grammatisch zum Ausdruck gebrachten Zusammenhänge (meta‐ phorisch: der „grammatischen Oberfläche“) wird etwas ausgesagt in Bezug auf eine bestimmte Neugestaltung eines bestimmten Schulwesens. Es wird also vorausge‐ setzt, dass es ein bestimmtes – im Kontext wohl bereits näher bestimmtes ‐ Schulwe‐ sen gebe, das neu gestaltet wird (neu gestaltet worden ist oder neu gestaltet werden wird). Über diesen mit den Mitteln prädikativer Ausdrücke plus Existenzannahme gesetzten Gegenstand wird eine Aussage gemacht. In dem nominalisierten Subjekt Neugestaltung des Schulwesens kann offensichtlich wegen des Fehlens eines finiten Verbs die temporale Deixis nicht ausgedrückt wer‐ den. Zusätzlich lässt die Nominalisierung das Subjekt verschwinden. Es bleibt unge‐ sagt, wer das Schulwesen neu gestaltet, neu gestaltet hat oder neu gestalten wird. Dies führt zu einer doppelten Vagheit, die nur durch empirisches Wissen behoben werden kann. Weniger problematisch ist das Genitivattribut. Es muss bei der regel‐ geleiteten verstehenden Explikation als Akkusativobjekt zu neu gestalten interpretiert werden. Der Rezipient H muss also einerseits die Nominalisierung in die Form des ausge‐ führten Standardsatzes entkomprimieren (X gestaltet / hat gestaltet/ wird gestalten/ ein bestimmtes Schulwesen) und zusätzlich die so als latent erkennbar werdende Subjekt‐ stelle aus seinem Wissen füllen. Dementsprechend nimmt der Sprecher S, wenn er mit 1) etwas zu verstehen geben will, in kooperativer Erwartung wohl an, dass H das kann. Im Sinne kooperativen Kommunizierens kann S allerdings den Ergänzungsaufwand von H reduzieren. So kann er das in der Nominalisierung weggelassene Subjekt leicht durch ein präpositionales Adverbiale zurückholen: 1a) Die Neugestaltung des Schulwesens durch die grün‐rote Koalition … Auch die temporale Prädikation, die innerhalb der Nominalisierung verschwindet, lässt sich attributiv ersetzen: 172 1b) Die derzeitige (soeben abgeschlossene, geplante) Neugestaltung des Schulwesens durch die grün‐rote Koalition … Weitere durch Komprimierung erzeugten Vagheiten würden verschwinden bei 1c) Die grün‐rote Koalition gestaltet (hat gestaltet, wird gestalten, plant zu gestalten usw.) das Schulwesen neu. Dies … Auch die Vagheit der Referenz ließe sich reduzieren: 1d) Die grün‐rote Koalition in Baden‐Württemberg gestaltet (hat gestaltet, wird gestalten, plant zu gestalten usw.) das Schulwesen neu. Dies … 1e) Die grün‐rote Koalition gestaltet (hat gestaltet, wird gestalten, plant zu gestalten usw.) das Schulwesen Baden‐Württembergs neu. Dies… Damit wären zwar kompressionsbedingte Vagheiten beseitigt, durch die Explizie‐ rungen wäre allerdings der Effizienzvorteil komprimierten Sprechens wieder dahin. Es ist – wie immer – eine Sache der adressatenbezogenen Abwägung, welchen Grad an Explizitheit der Sprecher wählt. Immerhin zeigt das Beispiel, dass bei Komprimierungen die Zahl der Latenzen je nach Einschätzung des Partnerwissens variabel gehalten werden kann. Der kommu‐ nikative Erfolg hängt ja auch davon ab, ob die Verkürzungen im Hinblick auf den Gesprächspartner H gerechtfertigt sind. Was aber ist, wenn H das unterstellte Vor‐ wissen gar nicht hat, wenn er also nicht weiß, wer ein bestimmtes Schulwesen neu gestaltet (gestaltet hat oder gestalten wird)? In diesem Fall kann H die Existenzprä‐ supposition (Es gibt eine Neugestaltung eines bestimmten Schulwesens) erschließen und erkennen, dass S darüber etwas mit deskriptiver Intention sagt. Auch kann er die Entkomprimierung leisten (Jemand gestaltet das Schulwesen neu), aber das vorausge‐ setzte Wissen über das Subjekt und über den temporalen Kontext fehlt ihm und in‐ soweit bleibt sein Mitvollzug der Bezugnahme vage. Nichtwissen kann einschüchtern. H könnte es bei seinem vagen Nachvollzug belas‐ sen, um sich nicht als unwissend zu exponieren. Es würde ein gewisses Sprach‐ und Selbstbewusstsein voraussetzen, um zu fragen Was meinst du damit? oder Was meinst du mit „Neugestaltung des Schulwesens“? Komplizierter wird die hintergründig zu leistende Transformations‐ und Ergän‐ zungsarbeit bei Kombination verschiedener Kompressionen wie in 2) Immer häufiger wird eine verstärkte finanzielle Unterstützung der Trainerausbildung ge‐ fordert. 173 Hier tun sich z.B. hinter der Adjektivphrase (verstärkte finanzielle), der Nominalisie‐ rung (Unterstützung), dem Kompositum (Trainerausbildung) sowie der passivischen Formulierung (wird gefordert) erhebliche Latenzen auf. Davon lassen sich durch re‐ zeptive Entkomprimierungsroutinen einige in die Standardform explizieren: ‐ wer oder was wird ausgebildet? (die Trainer) ‐ was wird unterstützt? (die Ausbildung der Trainer) ‐ wie wird unterstützt? (finanziell) ‐ was wird verstärkt? (die finanzielle Unterstützung) Aber folgende Fragen lassen sich allenfalls aus dem Redekontext oder per allgemei‐ nes Faktenwissen beantworten. ‐ wer fordert? * ‐ von wem? * ‐ wer unterstützt?* ‐ wer verstärkt?* ‐ wer bildet aus?* Beim Nachvollzug des mit der Äußerung von 2) gemachten Sprechaktes gibt es meh‐ rere Möglichkeiten: ‐ Im Extremfall spielt H das Prädikationsspiel nur im Sinne der grammatisch indi‐ zierten Oberflächenstruktur mit, also komprimiert, ohne dass die Latenzen aus dem Wissen gefüllt werden. Ein derartig vager Nachvollzug ist durchaus wahrscheinlich, z.B. wenn der Satz Teil eines größeren kontinuierlich gesprochenen Textes ist, so dass keine Zeit für einen explizierenden Nachvollzug bleibt. Das Mitspielen gelingt zwar, aber nur an der ausgedrückten Oberfläche. ‐ Vielleicht gelingen H die Entkomprimierungen, aber er hat dann nicht das nötige Faktenwissen zu der besprochenen Materie, das S voraussetzt. Er kann die nach der Entkomprimierung leer bleibenden Stellen nicht füllen, da er die mit (*) gekenn‐ zeichneten Fragen nicht oder nicht vollständig beantworten kann. ‐ Im Idealfall transformiert H die komprimierten Ausdrücke nach grammatischen Routinen in die explizite Form und ersetzt dann die offenen Stellen aus seinem Hin‐ tergrundwissen. Dem entsprechend kann er allerdings zu verschiedenen Deutungen kommen, z.B.: 2a) Immer häufiger fordern die Vereine, dass die Ausbildung der Trainer durch die Deutsche Sporthochschule Köln stärker durch den Deutschen Fußballbund mit finanziellen Beiträgen unterstützt wird. Es wären immer noch zusätzliche Explikationen möglich, beispielsweise von der Art: 174 2b) Die Deutsche Sporthochschule Köln bildet die Trainer aus. Dies (diese Ausbildung) wird durch den Deutschen Fußballbund finanziell unterstützt. Die Vereine der Amateurligen for‐ dern, dass dies (diese finanzielle Unterstützung) verstärkt wird. Das haben die Vereine schon früher gefordert, aber sie tun es immer häufiger. Aber auch hier bliebe noch manches unbestimmt, wie etwa die Trainer oder die Me‐ tapher finanziell unterstützen. Ein Hauptproblem des komprimierten Spiels zeigt sich hier allerdings exemplarisch: Dies sind nur Beispiele möglicher Explikationen und es bleibt oft unsicher, ob die Füllung der Latenzen durch H aus dessen empirischem Wissen den von S selbst gemachten Annahmen entspricht. Wie weit auch immer man die Entkomprimierung treiben will – eine Formulierung, die ohne pragmatische Ergänzungen funktioniert, wird man wohl schwer finden, vor allem keine, die dann auch noch zeitökonomisch vertretbar wäre. Verstehensprobleme treten also auf, wenn der grammatische Entkomprimierungs‐ aufwand und der aus Kontext‐ und Weltwissen erfolgende Ergänzungsaufwand vom Hörer nicht mehr zu leisten sind. Der Zuhörer steigt entweder ganz aus oder spielt das Spiel lediglich an der grammatischen Oberfläche mit. Die Erfahrung sagt uns, dass Letzteres in der Praxis wohl nicht die Ausnahme sein dürfte. Meist bleibt ein‐ fach zu wenig Zeit zum Entkomprimieren und zum Füllen der Leerstellen aus dem Wissen. Selbst wenn beides gelingt, bleibt immer unsicher, ob das, was S voraussetzt, mit dem übereinstimmt, was H aus seinem Wissen heraus ergänzt. Damit sind die Hauptgefahren komprimierten Kommunizierens benannt: Vagheit, Missverständnis‐ se und Manipulation. Eine weitere Beschleunigungsmöglichkeit des Prädikationsspiels bieten Wortzu‐ sammensetzungen, z.B. Zusammensetzungen von Substantiven. Nicht jede substan‐ tivische Zusammensetzung erregt eine solche Aufmerksamkeit wie jene, bei der im Amtsblatt einer deutschen Gemeinde unter der Bezeichnung Rentnerschlachtfest zu geselligem Beieinander eingeladen wurde97. Doch auch andere Komposita verlangen teilweise längeres Nachdenken: Elchtest, Wutbürger, Stresstest, Weltladen, Herdprämie, Menschenmaterial, Gotteskrieger, Jägerschnitzel, Bierflasche, Flaschenbier. Substantivische Zusammensetzungen können nämlich ein jeweils sehr unterschiedli‐ ches Verhältnis der Teile zueinander ausdrücken. Grundsätzlich gilt: Ein XY ist ein Y. In den gutartigen Fällen kann in der entkomprimierten Version der zweite Bestand‐ teil die Subjekt‐, Objekt‐ oder Attributposition einnehmen: Subjekt: Lebe ‐ wesen: Wesen, das lebt; Anzeige aus dem Amtsblatt der Stadt Herrenhut: „Rentnerschlachtfest am 2.10.2012, ab 16 Uhr, mit Schlachtbüffet, 12 EUR/pro Person. Noch freie Plätze.“ Zit. nach Spiegel. 42, 2012, S. 170. 97 175 Bestands ‐ schutz: Die Geltung einer Regelung wird vor Veränderung geschützt. Objekt: Pflege ‐ kind: Kind, das jemand pflegt; Fahr ‐ erlaubnis: Erlaubnis zum Fahren; jemand erlaubt das Fahren; Umwelt ‐ schutz: Vorkehrungen, durch welche die Umwelt geschützt wird; Lärm ‐ schutz: vor Lärm schützen; Selbst – schutz: Jemand schützt sich selbst vor negativen Einwirkungen. Attribut: Weg ‐ länge: Länge des Weges; Sommer ‐ urlaub: Urlaub im Sommer; Sorgen ‐ falten: Falten wegen Sorgen; Adverbiale: Impf ‐ schutz: Ein Schutz durch Impfen / mittels Impfen; Begleitschutz: Ein Schutz durch Begleiten. Die meisten solcher Komposita sind als ganze konventionalisiert und damit unprob‐ lematisch, aber bei Neuschöpfungen kann anfangs ein erheblicher und nicht immer von Erfolg gekrönter Entkomprimierungsaufwand anfallen. Bei Zusammensetzun‐ gen wie Elchtest, Frauenbeauftragte oder Stresstest helfen grammatische Entkompri‐ mierungsroutinen nicht wirklich. Das gilt auch für den Ausdruck Missbrauchsbeauf‐ tragter. Offensichtlich ist hier jemand beauftragt. Aber von wem? Aus verschiedenen Quellen oder einer erweiterten Bezeichnung (Der Missbrauchsbeauftragte der Erzdiözese München und Freising) kann man das möglicherweise erschließen. Aber womit oder wozu ist er beauftragt? Sein Auftrag scheint in irgendeiner Weise mit Missbrauch zu tun zu haben. Unklar ist, für welche Arten von Missbrauch sein Auftrag gilt. Wer missbraucht wen? Es könnte ja vielleicht um den Missbrauch von Spenden oder Steuergeldern oder sonst etwas gehen. Dass es um Fälle sexuellen Missbrauchs ge‐ hen könnte, und dabei wiederum um den an Kindern und Jugendlichen, kann man mit entsprechendem Alltagswissen allenfalls vermuten. Unbestimmt bleibt auch dann immer noch, für welche Subjekte des Missbrauchs sein Auftrag gilt. Nur für Personen aus dem Zuständigkeitsbereich der Erzdiözese München und Freising? Nur für deutsche Täter, nur für Täter auf deutschem Staatsgebiet? Selbst nach Klä‐ rung dieser Fragen bleibt immer noch unbestimmt, was Missbrauch ist, wo er be‐ ginnt? Und selbst wenn das klar bestimmt wäre ‐ wofür gilt der Auftrag? Wozu ist der Beauftragte denn beauftragt? Für welche Ziele? Für welche Handlungen? Soll Missbrauch verhindert werden? Soll der Beauftragte Meldungen entgegennehmen über Missbrauchsfälle? Soll der Beauftragte Täter verfolgen lassen? Soll er den Op‐ 176 fern helfen? Immerhin legt der gesunde Menschenverstand nahe, auszuschließen, dass der Bezeichnete zu einem Missbrauch beauftragt ist. Am Ende bleibt einem ohne eingehende Beschäftigung mit dem Thema bestenfalls ein ungefähres Verständnis etwa der Art: Als Missbrauchsbeauftragter wird jemand bezeichnet, der von einer Stelle den Auftrag hat, etwas zu unternehmen, wenn ein Kind oder Jugendlicher sexuell missbraucht wird. Vielleicht auch nur: jemand, der etwas tun soll, wenn irgendjemand etwas bestimmtes Unerlaubtes macht. So entsteht der Eindruck, dass das kommunikative Geschäft generell und bei den allgegenwärtigen komprimierten Ausdrucksweisen ganz besonders auf unsicherem Grund steht ‐ und das in dem Maß zunehmend, in dem die verschiedenen Möglich‐ keiten verkürzter Ausdrucksweisen miteinander kombiniert werden, sodass in der Summe der Erschließungsaufwand zu hoch wird. Sind wir uns immer selbst klar, was wir worüber zu verstehen geben wollen? Und wenn ja: Kann der Partner unser verkürzt gespieltes Spiel wirklich mitspielen? Wir setzen ja voraus, dass er die kom‐ primierten Ausdrucksformen nach grammatischen Routinen in die Standardform transformieren und die dann sichtbar werdenden Latenzen aus seinem Wissen füllen kann. Je weniger explizit wir sprechen, desto mehr muss der Partner entkomprimieren und ergänzen. Desto größer ist auch die Gefahr, dass einerseits unser eigenes Reden für uns selbst nur ungefähr ist, dass aber auch hörerseitig das angestrebte „commune“ in der versuchten Kommunikation lediglich fragmentarisch oder nebulös bleibt. Wie groß diese Gefahr gerade auch in der wissenschaftlichen Kommunikation sein kann, zeigen die vielzitierten ersten Sätze aus dem Vorwort eines bekannten sozial‐ philosophischen Werkes, dessen hochgradig komprimierte Ausdrucksweise bereits andernorts in kritischer Ausführlichkeit thematisiert wurde: „Ich unternehme den historisch gerichteten Versuch einer Rekonstruktion der Vorgeschichte des neueren Positivismus in der systematischen Absicht einer Analyse des Zusammenhangs von Erkenntnis und Interesse. Wer dem Auflösungsprozess der Erkenntnistheorie, der an ih‐ rer Stelle Wissenschaftstheorie zurücklässt, nachgeht, steigt über verlassene Stufen der Refle‐ xion. Diesen Weg aus einer auf den Ausgangspunkt zurückgewendeten Perspektive wieder zu beschreiten, mag helfen, die vergessene Erfahrung der Reflexion zurückzubringen.“98 Will man das Ganze nicht bloß wie hermetische Chiffren moderner Lyrik auf sich wirken lassen, sieht man sich als gutwilliger und diskursethisch wohlgestimmter Le‐ ser vor erhebliche Probleme gestellt. Was soll hier worüber zu verstehen gegeben werden? Das Ausmaß des Verstehensaufwands verdeutlicht der im Folgenden ver‐ Habermas, Erkenntnis und Interesse. Frankfurt 1968, Taschenbuchausgabe 1973, S. 9. 98 177 kürzt dargestellte, mehrstufige linguistische Versuch, allein den ersten Satz in eine explizitere und dadurch eher nachvollziehbare Ausdrucksweise zu transkribieren: a) „Ich versuche die Vorgeschichte des neueren Positivismus zu rekonstruieren, wobei ich mich mit einer historischen Methode (?) auf sie richte. Diesen Versuch unternehme ich, weil ich die systematische Absicht habe, zu analysieren, auf welche Weise Erkenntnis und Interes‐ se zusammenhängen.“ 99 Allerdings sind damit die Kompressionen nur zum Teil aufgelöst. Beispielsweise bleiben Latenzen beim Infinitivsatz (zu rekonstruieren), den Attributen (neueren; histo‐ rischen, systematische) sowie den Kennzeichnungen Positivismus, Erkenntnis, Interesse) bestehen. In Annäherung an eine prädikatenlogische Formulierung ergibt sich als ei‐ ne mögliche weitergehende Entkomprimierung: b) „Ich versuche, dass ich etwas rekonstruiere, das die Vorgeschichte von etwas ist, das dieje‐ nige Phase, die die neuere ist, darstellt von etwas, das Positivismus heißt, wobei ich mich auf sie richte, indem ich eine Methode anwende, die historisch ist. Dies tue ich, weil ich die Ab‐ sicht habe, die systematisch ist, dass ich etwas analysiere, das die Weise ist, wie etwas, das Erkenntnis heißt, und etwas, das Interesse heißt, zusammenhängen.“100 Allerdings ist das nur eine von verschiedenen möglichen Deutungen. So ist Methode nur eine der möglichen Übersetzungen von historisch gerichtet. Darüber hinaus sind die Latenzen bei Positivismus, historisch, systematisch, Erkenntnis und Interesse immer noch nicht gefüllt. Bereits auf dieser unvollkommenen Stufe der Rekonstruktion wird zweierlei an‐ schaulich: zum einen, wie schwierig es für den Rezipienten ist, die Transformation komprimierter Sätze in Sätze mit nachvollziehbarer Prädikationsstruktur zu leisten, zum anderen, wie unsicher das kommunikative Ergebnis bleiben kann, wenn ‐ wie hier ‐ die zahlreichen dann sich zeigenden Latenzen aus dem Vorwissen gefüllt wer‐ den sollen. Das kommunikative Problem dieser komprimierten Formen des Prädikationsspiels muss auch noch vor dem Hintergrund gesehen werden, dass neben dem zu leisten‐ den Entkomprimierungs‐ und Ergänzungsaufwand ja noch zahlreiche weitere kon‐ versationelle Prozeduren zu erledigen sind. Dazu gehört das Erfassen der Existenz‐ präsuppositionen, die ja „durch die Hintertür“ mitbehauptet werden. So wird u.a. mitbehauptet, dass es einen neueren Positivismus gegeben hat oder gibt sowie dass dieser eine Vorgeschichte hatte oder hat sowie dass es zwischen Erkenntnis und Interes‐ se einen Zusammenhang gebe. Vgl. von Polenz 2008, 93f. a.a.O., S. 94. 99 100 178 Leser oder Hörer müssen also während ihres Mitvollzugs nicht nur die komprimierte Prädikationsstruktur explizieren und versuchen, die entstehenden grammatischen Leerstellen aus ihrem Wissen zu füllen, sondern auch noch die vorausgesetzten Sätze mitdenken. Das ist aber bekanntlich noch längst nicht alles. So wird man den Ver‐ dacht nicht los, dass bei der hier gepflegten wissenschaftlichen Ausdruckspraxis das Kooperationsprinzip nicht genügend beachtet ist – aus welchen Motiven auch im‐ mer. Dass angesichts einer solchen „Einschüchterungsprosa“ der vom Autor nach ei‐ genen Worten grundsätzlich anzustrebende rationale und symmetrische Diskurs ent‐ stehen kann, erscheint unwahrscheinlich, zumindest unsicher. Natürlich ist eine vollständig explizite Ausdrucksweise nicht nötig und meist auch gar nicht möglich. Und möglicherweise würde sie nur zu neuen Missverständnissen führen. Zwischen den beiden Extremen höchstmöglicher Explizitheit und höchst‐ möglicher Ökonomie sollte der Sprecher aber eine angemessen kooperative Form finden. Wenn man sich über das gemeinsame Wissen sicher sein kann, bewirken Komprimierungen sinnvolle Zeit‐ und Raumersparnisse. Aber wann kann man sich schon sicher sein? Wenn die Annahmen über das gemeinsame Wissen nicht zutref‐ fen, bleibt der verstehende Nachvollzug vage oder es werden unzutreffende Verste‐ hensabsichten rekonstruiert. Im schlechtesten Fall macht sich der Sprecher oder Au‐ tor die „Chancen“ der Komprimierung zur Demonstration überlegenen Wissens zunutze oder für eine absichtliche Manipulation, denn das hintergründig Vorausge‐ setzte ist schwerer angreifbar als das explizit Formulierte. Die Redlichkeit gebietet im Zweifel ein tendenziell eher explizites, unkomprimiertes Sprechen. Es muss ja nicht in Leichter Sprache erfolgen. Aber ohne Verstehen schlägt jede Kommunikation fehl. 179 6. Sprachliches Verstehen Ohne Verstehen schlägt jede Kommunikation fehl. Aber was ist das, was wir Verste‐ hen nennen? Wie kommt es zustande? Ist es ein Geschehen? Ist es ein Handeln? Was ist eigentlich das Objekt des Verstehens? Gewiss bezeichnen bestimmte Verwendungsweisen des Verbs verstehen keine Hand‐ lungen, etwa in folgenden Beispielen: Menschen verstehen (Verständnis haben); Ein Phänomen verstehen (Ursachen kennen); Verstehen, wie etwas gemacht wird; Eine Sprache verstehen. Wenn man von jemandem sagt, er verstehe eine Sprache, nimmt man nicht an, dass der Betreffende etwas Bestimmtes tue. Hier geht es nicht um ein konkretes Handeln, sondern eher um ein dispositionelles Wissen bzw. Können im Sinne von Ryles dispo‐ sition words. Wenn von jemandem gesagt wird, er verstehe Chinesisch, so wird über ihn nicht behauptet, er mache etwas, sondern er könne etwas machen. Niemand kann im Hinblick auf dessen Chinesischkenntnisse Fragen stellen, die bei Handlun‐ gen gestellt werden können: Wie lange oder um welche Uhrzeit versteht er Chine‐ sisch? Kann er es tun oder unterlassen, dass er Chinesisch versteht? Mit dieser Ver‐ wendungsweise von verstehen bezeichnen wir also Fähigkeiten, die sich allerdings im Handeln zeigen müssen, etwa, dass jemand sich mit Chinesen unterhalten oder die sprachlichen Handlungen eines Chinesen nachvollziehen und evtl. übersetzen, also in einer anderen Sprache nachmachen kann, usw. Nur dann werden wir von ihm sa‐ gen, er verstehe Chinesisch. Im Hinblick auf konkrete sprachliche Handlungen geht es um einen bestimmten Ge‐ brauch von verstehen wie in: verstehen, was jemand sagt; verstehen, was jemand meint; verstehen, was jemand macht. Will man ein solches Verstehen nicht nur als eine Art neuronales Ereignis hinter dem Rücken und unterhalb des Bewusstseins des Rezipienten betrachten, muss man sich fragen, was dieser selbst zum Verstehen beiträgt. Das Verstehen scheint auf den ersten Blick ausschließlich zur Rolle des Rezipienten zu gehören. Freilich versteht auch der Sprecher seine eigene Äußerung. Wer kom‐ muniziert, muss auch selbst verstehen, worüber er was sagt und mit welcher Bewir‐ kungsabsicht er es tut. Wir bezeichnen ein solches Verstehen aus dieser Perspektive 180 als Meinen. Für den Redenden sind sein sprachliches Handeln und dessen Verstehen eins. Worin aber besteht nun das rezeptive Verstehen? Wie gelingt es uns? Passiert es uns einfach oder machen wir etwas dabei? Erstaunlicherweise findet man auf diese wich‐ tigen Fragen meist nur allgemeine und eher vage Antworten ‐ wie etwa diese: „Ei‐ gentlich bedarf es zum Verstehen keiner Anstrengung. Es geht leicht, automatisch und sehr schnell. Es passiert uns sozusagen. Wir können es nicht einmal vermeiden. Anstrengend wird es erst, wenn wir nicht verstehen. Dann müssen wir etwas tun. Wir müssen zum Beispiel das Interpretieren anfangen. Das Verstehen ist kein Akt.“101 Diese Charakterisierung des Verstehens dürfte ziemlich gut unserer Selbstwahrneh‐ mung entsprechen: Das Verstehen wird wie ein mehr oder weniger selbstverständli‐ ches, ja geradezu unvermeidliches Geschehen erlebt, bei dem wir nichts tun müssen. Aber ist das wirklich der Fall? Die bloße Feststellung, Verstehen sei keine Handlung, ist natürlich noch keine Erklä‐ rung. Wenn das Verstehen uns sozusagen unvermeidlich passierte, würde man gerne wissen, wie und warum. Wenn es schon nicht auf unserem Handeln beruhen soll, wodurch kommt es dann zustande? Ist es etwa ein determiniertes Ereignis im Gehirn oder eine himmlische Eingebung? Zudem bleibt bei alledem das Objekt des Verste‐ hens unbestimmt: Wen oder was verstehen wir? Sind es Menschen, Wörter, Sätze, Äußerungen, ist es Sinn oder was sonst? Die oben wiedergegebene Annahme, Verstehen sei keine Handlung, wird einge‐ schränkt durch die Feststellung, dass wir in Fällen des Nichtverstehens interpretieren müssten. Wie wir wissen, ist Erschließungsarbeit nahezu ständig eine Voraussetzung für das Verstehen. Oft ergibt ja das, was der andere sagt, für uns zunächst keinen Sinn. Wir unterstellen aber, dass er das Kooperationsprinzip beachtet und nicht ab‐ sichtlich Unsinn redet. Also überlegen wir, wie das Gesagte gemeint sein könnte, und beziehen dafür unser Wissen über den Kontext der Äußerung, den Sprechenden und anderes Hintergrundwissen ein. Wir müssen also fast immer etwas dafür tun, dass uns das Verstehen schließlich gelingt. Die Feststellung, dass Verstehen ohne un‐ ser handelndes Zutun gelingt, ist also zumindest irreführend. Aber ist das, was schließlich durch entsprechenden Handlungsaufwand möglich wird, nämlich das Verstehen selbst, wirklich kein Handeln? Die Behauptung, dass dieses – meist erst nach konversationeller Arbeit mögliche ‐ Verstehen kein Akt sei, wird im Wesentlichen durch zwei miteinander verbundene Argumente gestützt: 1. Verstehen erfolge leicht, schnell und automatisch. 2. Man könne das Verstehen nicht, wie das bei Handlungen der Fall wäre, absichtlich machen oder unterlassen. Ehrhardt, Heringer 2011, S. 86. 101 181 Das Argument, Verstehen gehe automatisch, ist aber unbrauchbar, solange unklar ist, was „automatisch“ hier heißen soll. Sind damit etwa kausaldeterministische Pro‐ zesse gemeint, die sozusagen „hinter unserem Rücken“ ablaufen? Ist etwa zeitgeist‐ konform gemeint, das Gehirn übernehme für uns das Verstehen? Dieses Argument folgt offensichtlich einem Muster der Art: „Das Verstehen ist kein Handeln. Denn es gelingt, ohne dass wir wissen wie.“ Wahrscheinlich beruht das Argument einfach auf einer schlichten Vertauschung von automatisch und automatisiert. Betrachtet man das Verstehen sprachlichen Han‐ delns wie das sprachliche Handeln selbst als automatisiertes Handeln, ist es kein un‐ erklärbares Geschehen mehr in einer Black Box. Automatisiert sein kann sowohl das sprachliche Handeln wie dessen verstehender Nachvollzug, weil wir beides von Ge‐ burt an wie nichts anderes geübt haben. Mit dieser sprachlichen Übung verbunden erfolgt bis ins junge Erwachsenenalter die Reifung des Gehirns. Im Ergebnis sind wir schließlich in der Lage, sprachliche Handlungen selbst in komplexen Ausdrucksfor‐ men innerhalb von Millisekunden automatisiert und insoweit unserem Bewusstsein entzogen zu machen und rezeptiv zu verarbeiten. Das Automatisierte ist aber kein Argument gegen den Handlungscharakter des Ver‐ stehens. Handlungen können generell automatisiert sein. So ist bezeichnenderweise der Handlungscharakter unseres aktiven sprachlichen Kommunizierens unstrittig, obwohl uns auch dieses genauso schnell, leicht und „gleichsam“ automatisch er‐ scheint. Das gilt, wie wir gesehen haben, ganz besonders für metaprädikative Hand‐ lungen, die durch den Zwang grammatischer Konventionen unvermeidlich sind, wie Strukturindikation, Temporaldeixis und die Anzeige der Bewirkungsabsicht. Denkt man an alltägliche Handlungen wie das Autofahren oder an Handlungsabläu‐ fe im Sport, wird klar, dass Automatismen das Ergebnis häufig geübter Handlungen sind, dass sie eben automatisierte Handlungen sind. Kein Tischtennisspieler, der in höchster Geschwindigkeit einen scharfen und angeschnittenen Ball retourniert, wird daran zweifeln, dass er das selbst macht, nur weil er jahrelang üben musste, damit ihm das in dieser Geschwindigkeit und ohne Nachdenken gelingt. Auch automati‐ sierte Handlungen oder Handlungsroutinen sind Handlungen. Was aber ist mit dem zweiten Argument gegen den Handlungscharakter des Verste‐ hens? Handlungen kann man absichtsvoll machen, das heißt, man kann sie auch un‐ terlassen. Wir können eben meist kontrollieren, ob wir das, was wir sagen wollen, auch wirklich sagen. Aber auch bei unseren bewussten Sprechakten ist ein Teil unse‐ rer sprachlichen Handlungen automatisiert, man denke nur an die metaprädikativen indikatorischen Handlungen. Illokutive Indikatoren verwenden wir automatisiert und ebenso automatisiert setzen wir Kasusmarkierungen und befolgen Wortstel‐ 182 lungsregeln, mit denen wir die strukturellen Zusammenhänge unserer Prädikations‐ handlungen verdeutlichen. Wir können zwar sprachliche Handlungen unterlassen. Aber wenn wir sprachlich handeln, können wir unsere metaprädikativen sprach‐ lichen Handlungen nicht bewusst vermeiden. Im Unterschied zu Sprechakten kann man das Verstehen meist nicht absichtsvoll un‐ terlassen. Das spricht zuerst einmal gegen seinen Handlungscharakter. Mit dem gleichsam automatischen Verstehen ist es allerdings vorbei, wenn wir eine Sprache hören, die wir nicht gelernt haben. Wir können diese Sprache nicht nur nicht verste‐ hen und wir können darin auch nicht handeln. Würden wir sie aktiv beherrschen, verständen wir sie auch – und im Normalfall auch umgekehrt. Das heißt, man muss gelernt haben, das Prädikationsspiel in der betreffenden Sprache zu spielen, damit man es auch verstehend nachvollziehen kann. Und wenn wir es spielen können, wis‐ sen wir auch, was gespielt wird. Was unsere Muttersprache betrifft, haben wir von Geburt an (und schon vorher) geübt, sie automatisiert zu benutzten. Und damit ver‐ bunden sind wir von klein auf darauf trainiert, vielleicht schon konditioniert, sprach‐ liches Handeln anderer automatisiert nachzuvollziehen. Das gelingt, weil es nach Regeln gemacht wird. Durch den regelgeleiteten automatisierten Nachvollzug sprachlicher Handlungen bleiben Kapazitäten frei für das nahezu immer notwendige Erschließen und Interpretieren. Die antrainierten Verstehensroutinen gelingen uns nach unserem lebenslangen Trai‐ ning auf der dabei herausgebildeten neurophysiologischen Basis in Millisekunden und damit auch ohne bewusste Kontrolle. Wir haben sozusagen an den Autopiloten übergeben. Es braucht große Mühe und Übung, um diese lebenslang antrainierten Mitspielroutinen blockieren zu können. Es gibt Menschen, denen es gelingt, sich dem antrainierten Verstehenszwang zu entziehen, sozusagen innerlich auf Durchzug zu schalten und sich dem inneren Nachvollzug zu verweigern. Und wir selbst könnten das mit einer gewissen Übung auch lernen, wenn es für uns nützlich wäre. Die meis‐ ten von uns müssen, um den Zwang zum verstehenden Nachvollzug zu überwin‐ den, sich aber bereits der auditiven Rezeption entziehen, indem sie nicht zuhören. Die Feststellung, dass Verstehen kein Akt sei, ist vor allem unbefriedigend, weil sie nicht im Geringsten eine Erklärung bietet. Auch das Objekt es Verstehens bleibt un‐ bestimmt. Worauf richtet sich das Verstehen? Wer oder was wird denn eigentlich verstanden? Es bleibt meist bei Annäherungen wie, dass es um das Verstehen von Äußerungen oder von Sätzen gehe. Eine angemessene Klärung der Frage, was Verstehen eigentlich ist, wird erst mög‐ lich, wenn man sich die grundlegende Tatsache bewusst macht, dass sprachliches Kommunizieren Handeln ist und dass es beim sprachlichen Verstehen demnach um 183 nichts anderes geht als um das Verstehen sprachlicher Handlungen. Folglich ist zu klären, was geschieht oder was wir machen, wenn wir sprachliche Handlungen ver‐ stehen. Jede Erklärung des Verstehens muss sich an der Struktur sprachlicher Handlungen orientieren. Allgemein gesagt, verstehen wir eine Handlung, wenn wir sie als Hand‐ lung eines bestimmten Typs erkennen. Wir erkennen oder verstehen z.B., dass je‐ mand singt, rennt oder isst. Das heißt, wir erkennen, dass die Prädikationsbedingun‐ gen für singen, rennen oder essen erfüllt sind. Wenn wir ein konkretes raumzeitliches Handeln nicht derart typisieren können, ist es uns nicht verständlich. Das heißt nicht, dass wir uns innerlich die Bezeichnungen für derartige Handlungen vorsagen müs‐ sen. Es genügt, dass wir sie als Handlungstypen entsprechend ihren unterschiedli‐ chen konstitutiven Bewirkungsabsichten unterscheiden gelernt haben und sie inso‐ weit erkennen bzw. wiedererkennen. Wie in Kap. 1 gezeigt, kann das Verstehen verschieden tief gehen. Man kann verste‐ hen, was jemand macht, aber auch, wie er es macht und wozu er es macht. Wenn man von einem bestimmten Handlungsmuster in einer möglichen Wenn‐dann‐ Beschreibungskette ausgeht, zielt die Frage wie? auf das Erkennen der Muster links davon, die Frage wozu? auf das Erkennen der Muster rechts davon. Ausgehend von einem bestimmten Handlungsmuster in einer Beschreibungskette bezeichnen die Be‐ schreibungen links davon also die Mittel, rechts davon die Ziele. Wahrscheinlich ist es oft unnötig, das genaue Wie zu verstehen. Man versteht, dass jemand strickt, auch wenn man es selbst nicht kann bzw. das Wie nicht beschreiben kann. Bei Bedarf kann man sich das Wie ja erklären oder ‐ wo Worte nicht reichen ‐ zeigen lassen. Dann versteht man vielleicht, wie man strickt. Für das Verstehen sprachlicher Handlungen ist es sicher nicht nötig, zu erfassen, wie der Sprecher mit seinem Stimmapparat Laute erzeugt. Mit der Beschreibung des Wozu? verhält es sich analog. Natürlich weiß der Handelnde oft mehr über seine Ziele als der Betrachter. Aber kennt er selbst wirklich immer die ganze Kette? Und muss der Verstehende die ganze Kette kennen? Reicht es nicht, zumindest eine Be‐ wirkungsabsicht zu erkennen? Das Verstehen von Handlungen bezieht sich also meist nur auf einen Ausschnitt einer möglichen Beschreibungskette. Was ist nun der relevante Teil der Wenn‐dann‐Kette, der beim Verstehen sprachli‐ cher Handlungen erfasst werden muss? Wenn wir sprachlich handeln, machen wir Sprechakte. Was wir sprachlich zu verstehen geben, ist immer eine Bewirkungsab‐ sicht, die der Partner erkennen soll, z.B. dass wir möchten, dass er etwas Bestimmtes tut. In diesem Sinn kann man sagen, dass wir eine Äußerung etwa als Bitte meinen. Diese Absicht im Sinne von Bitten bedarf aber der Differenzierung in der Form einer 184 Prädikationshandlung. Man kann nicht nur bitten, ohne zu sagen, worum man bittet. Ebenso wenig kann man behaupten, ohne zu verstehen zu geben, was man worüber mit Wahrheitsanspruch feststellt, usw. Sprachliches Handeln besteht darin, Prädika‐ tionshandlungen zum Ausdruck von Bewirkungsabsichten zu machen. Diese zu ver‐ stehen heißt also, nachvollziehend zu erkennen, worauf ein Sprecher sich bezieht, was er darüber sagt und mit welcher Bewirkungsabsicht er das tut. Das Erkennen von Zielen, die über diese Bewirkungsabsicht hinausgehen, wie z.B. die Stabilisie‐ rung von Beziehungsdefinitionen, geht über das eigentliche sprachliche Verstehen hinaus und soll im Folgenden nicht thematisiert werden. Umgekehrt ist es ebenfalls nicht nötig zu verstehen, wie Prädikationshandlungen lautlich realisiert werden. Verstehen besteht also darin, zu erkennen, worauf ein Sprecher sich bezieht, was er darüber sagt und mit welcher Bewirkungsabsicht er das tut. Kommt das wirklich einfach so und unvermeidlich zustande? Oder ist Verstehen nicht doch ein Handeln? 185 Interpretieren und Erschließen Auch wer annimmt, dass das Verstehen sprachlicher Handlungen selbst keine Hand‐ lung sei, gibt zu, dass es meist nicht gelingt, ohne dass wir etwas dafür tun. Sehr oft müssen durch Interpretieren die Voraussetzungen für das Verstehen geschaffen werden. Man betrachte nur einmal, wie uns das Verstehen der generellen Bewirkungsabsich‐ ten gelingt. Das Verstehen der Bewirkungsabsichten ist ja für das Gelingen einer Kommunikation unabdingbar. Bewirkungsabsichten, z.B. deskriptive, appellative usw., sind so etwas wie intentionale Vorzeichen von Prädikationshandlungen. We‐ gen ihrer Wichtigkeit benutzen wir zur Verdeutlichung dieser Absichten verschiede‐ ne konventionelle Anzeigemittel, sogenannte illokutive Indikatoren. Mit ihnen ma‐ chen wir metaprädikative Handlungen. Wir geben z.B. mit Satzform oder Intonation auf regelhafte Weise zu verstehen, in welcher Bewirkungsabsicht wir eine Prädikati‐ onshandlung machen, mit welcher Absicht im Hinblick auf die Partner wir also Be‐ zug nehmen und Prädizieren. Dieses Ausdrücken von Bewirkungsabsichten ist na‐ türlich weitgehend automatisiert. Wir müssen uns nicht immer wieder neu entschei‐ den, welche grammatische Satzform oder Intonation wir wählen. Umgekehrt wird auch das Deuten der illokutiven Indikatoren im kommunikativen Alltag automati‐ siert. Das heißt allerdings nicht, dass der Rezipient nicht mehr selbst interpretiert und dass die Deutung gleichsam determiniert als prinzipiell subpersonaler Prozess abläuft. Nun sind die Indikatoren zur Anzeige der Bewirkungsabsicht recht offen und mehr‐ deutig. Mit Satzformen beispielsweise grenzen wir die möglichen Absichten, die wir mit ihnen bedeuten, nur allgemein ein. Mit der Aufforderungssatzform kann immer noch außerordentlich Verschiedenes angezeigt sein. Wegen dieser Vieldeutigkeit muss der Rezipient im Allgemeinen seine Verstehenshypothesen durch Abgleich mit den interpersonalen Gegebenheiten sichern. Mit welcher Absicht und mit welchen Annahmen ist etwa die Äußerung von Nehmen Sie Urlaub! verbunden? Wie ist das gemeint? Als Bitte, Rat, Aufforderung, Warnung? Auch wenn mit Indikatoren Hinweise gegeben werden, bleibt das genaue Verstehen der Bewirkungsabsicht im Wesentlichen eine Angelegenheit konversationellen Er‐ schließens. Das zeigt sich ganz besonders bei den sogenannten indirekten Sprechak‐ ten, wo die konventionellen Anzeigen fehlen, wo also die Intentionen und Annah‐ men v.a. aus dem Kontext erschlossen werden müssen. So wird mit der durch die Satzform konventionell angezeigten Frageabsicht bei Hast du deine Medikamente genommen? 186 zwar zu verstehen gegeben, dass der Sprecher etwas wissen will. Warum aber sollte er das wissen wollen? Vielleicht weiß er’s schon. Die Äußerung wäre vielleicht nicht relevant, wenn nicht etwas anderes oder noch etwas anderes zu verstehen gegeben werden sollte. Welche weitergehenden Intentionen liegen vor? Vielleicht soll erinnert oder ermahnt werden usw. Das Verstehen der Bewirkungsabsichten beruht hier vor‐ rangig auf einem Erschließen von Annahmen und Absichten des Gegenübers, auch wenn man sich zur Entlastung teilweise auf automatisierte Deutungsroutinen verlas‐ sen kann. Der Rezipient muss also aus bestimmten formalen Eigenschaften der Prädikations‐ handlung und aus seinem Wissen die Bewirkungsabsicht erschließen, mit der eine Prädikationshandlung vermutlich gemacht wird. Das ist nichts, was ohne sein Zutun in einer Black Box passiert. Aber nicht nur Bewirkungsabsichten müssen erschlossen werden. Wie wir gesehen haben, ergeben sich im Prädikationsspiel ständig und unvermeidlich konventionelle Unterbestimmtheiten. So gibt es viele mögliche Gründe, dass für den Rezipienten unbestimmt bleibt, worauf ein Sprecher sich bezieht oder was er darüber mit welcher Bewirkungsabsicht zum Ausdruck bringt. Wie groß der Aufwand fürs Verstehen wird, hängt auch davon ab, wie weit es dem Sprechenden gelingt, im Hinblick auf den Partner angemessene und kooperative Ausdrucksformen zu finden. Ein Vorteil von Regeln ist, dass sprachliches Handeln und damit auch dessen Verstehen durch ständiges Üben weitgehend automatisiert werden können. Das ist gut so, denn wenn das nicht so wäre, könnten wir den für das Verstehen nahezu ständig nötigen Er‐ schließungsaufwand gar nicht leisten. Wer ein sprachliches Handeln nicht nachzuvollziehen vermag, kann mit einer immer passenden Standardfrage Hilfe einfordern: „Wie meinst du das (, was du gesagt hast)?ʺ „Was meinst du damit?“ Im Alltag funktionieren diese Fragen erstaunlich gut. Wenn wir sie ernsthaft stellen, wird der Gesprächspartner fast immer darauf eingehen und eine Erklärung oder eine alternative Formulierung versuchen. Das weist auf die Verbreitung der Erfahrung hin, dass es nicht immer gleich gelingt, zu verstehen zu geben, was man zu verstehen geben will. Denn es gibt tausend Mög‐ lichkeiten, durch Unachtsamkeit oder Fehleinschätzungen des Gegenübers das Ver‐ stehensziel zu verfehlen bzw. sich unangemessen auszudrücken. Die Frage, wie etwas gemeint ist, tritt immer auf, wenn H nicht oder nicht vollstän‐ dig nachvollziehen kann, was S worüber mit welcher Absicht sagt. H kann dann das Prädikationsspiel nicht vollständig nachvollziehen oder er kann nicht erkennen, was S damit bewirken will. In diesem Fall ist die Ausdrucksweise im Hinblick auf den Adressaten nicht angemessen klar oder der Zuhörer ist aus bei ihm liegenden Grün‐ 187 den am Nachvollziehen oder Erschließen gehindert. Da man nicht ständig nachfra‐ gen kann, wie etwas gemeint ist, und weil auch Erläuterungen nicht grundsätzlich zu mehr Klarheit führen müssen, ist man fast ständig auf pragmatisches Erschließen an‐ gewiesen. Was bei einem optischen Datenlaufwerk die Fehlerkorrektur ist, ist beim sprachlichen Kommunizieren das konversationelle „Interpolieren“. Selbst dieses wird immer mehr automatisiert. Das gilt nicht nur im Hinblick auf die Bewirkungs‐ absichten, sondern ebenso in Bezug auf das prädikative Handeln selbst. So kann man das Prädikationsspiel z.B. nicht ohne weiteres nachvollziehen, wenn unbekannte Ausdrücke oder bekannte Ausdrücke auf unbekannte Art verwendet werden wie das möglicherweise für manchen Zuhörer der Fall sein könnte bei Guttenbergen ist echt uncool. Wenn H unterstellt, dass S nicht einfach Unsinn redet, wird er zuerst einmal unter Beachtung des Kontextes und unter Einbeziehung seines Weltwissens versuchen, auf die von S benutzten Regeln für Guttenbergen und uncool zu kommen. Solch konversa‐ tionelles Erschließen ist angesichts der Verbreitung von Polysemien, aber auch we‐ gen metaphorischer oder ironischer Verwendungen von Ausdrücken oder Ad‐hoc‐ Verwendungen nahezu allgegenwärtig. Wäre das nachvollziehende Verstehen nicht durch das konventionelle Grundgerüst des Prädikationsspiels großenteils automatisiert, wären wir ständig überlastet. Trotzdem bleiben, wie bereits beschrieben, noch genügend Auslöser für pragmati‐ sche Erschließungsarbeit auf der Rezeptionsseite, beispielsweise: ‐ unklare oder unangemessen leise oder schnelle Artikulation. Ein daraus schon in diesem „Vorfeld“ anfallender Rechenaufwand macht das restliche Geschäft nicht leichter. ‐ deiktische Ausdrücke: Konversationelles Rechnen ist z.B. nötig beim Nachvollzug von Bezugnahmen mit sogenannten personaldeiktischen Ausdrücken wie ich, du, er, die ebenso kontextuell fixiert werden müssen wie prädikative Kennzeichnungen von der Art das rote Auto. Ähnliche pragmatische Operationen sind nötig bei lokal‐ und temporaldeiktischen Ausdrücken wie hier, hinter, vor und jetzt, morgen, in einer Woche usw. Auch die Temporaldeixis wird meist nur durch Erschließungsarbeit nachvoll‐ ziehbar. ‐ elliptische Verkürzungen: Ein weites Feld für Verstehensprobleme sind natürlich die nahezu allgegenwärtigen grammatischen Ellipsen. Man denke beispielsweise nur noch einmal an die attributiven Ellipsen bei genitivischen oder präpositionalen At‐ tributen. Die prädikativen Handlungen hinter solchen elliptischen Ausdrucksformen lassen sich rezeptionsseitig oft nicht zuverlässig und manchmal gar nicht rekonstru‐ ieren. 188 ‐ Nominalisierungen: Neben den grammatischen Ellipsen durch attributive oder ad‐ verbiale Fügungen können selbst schon in einfachen Sätzen durch Nominalisierun‐ gen und Wortzusammensetzungen erhebliche Verstehensprobleme entstehen. Immer müssen dann die prädikativen Strukturen hinter den Nominalisierungen und Kom‐ posita entkomprimiert und die sich dann offenbarenden Latenzen aus dem Kontext‐ und Weltwissen gefüllt werden. In der Summe kann das pragmatische Geschäft zur Überlastung führen. In der faktischen Kommunikation dürfte das auch oft der Fall sein. Vielleicht ist das fragmentarische oder oberflächliche Verstehen sogar der Nor‐ malfall. 189 Das Verstehen des Prädikationsspiels Es ist also eine Menge Interpretationsaufwand zu leisten, damit Verstehen möglich wird. Was aber ist nun dieses Verstehen? Ist es wirklich kein Handeln? Es ist das primäre Ziel bei unseren Sprechakten, dass die Partner erkennen, welche Bewirkungsabsichten wir ihnen zu verstehen geben wollen. Dazu gehört, dass die Zuhörer verstehen, worauf wir Bezug nehmen und was wir über die Gegenstände der Bezugnahme prädizieren. Bewirkungsabsichten sind wie intentionale Vorzeichen von Referenz und Prädikation. Wir geben nicht nur zu verstehen, dass wir etwas für wahr halten, sondern müssen immer auch sagen, was wir für wahr halten. Eine Auf‐ forderung machen, heißt nicht nur, zum Ausdruck zu bringen, dass der Partner et‐ was tun möge. Wir müssen schon sagen, was er tun soll. Wir würden nicht sprachlich kommunizieren, wenn wir nicht begründeten Anlass für die Annahme hätten, dass die Partner uns verstehen können. Wieso aber können wir davon ausgehen, dass unsere Partner verstehen, worauf wir jeweils Bezug neh‐ men und was wir darüber mit welchen Absichten prädizieren? Die Antwort ist: Wir spielen das Prädikationsspiel nach Regeln und wir nehmen an, dass unsere Partner dies nach weitgehend gleichen Regeln tun. Beim behauptenden Prädizieren bei‐ spielsweise wird einerseits durch illokutive Indikatoren zum Ausdruck gebracht, dass die Wahrheitsbedingungen der prädizierten Ausdrücke hinsichtlich der Be‐ zugsgegenstände für erfüllt gehalten werden. Daneben wird durch Nutzung gram‐ matischer Konventionen – etwa Kasusmarkierungen ‐ regelhaft zu verstehen gege‐ ben, mit welchem Bezug eine Prädikation jeweils gemeint ist. Weiterhin werden im Deutschen durch bestimmte Verbformen die Zeitverhältnisse mitgeteilt usw. Es wer‐ den also beim Bedeutungshandeln prädikative und metaprädikative Handlungen nach den Regeln der jeweiligen Sprache gemacht, so dass erkennbar wird, dass sie gemacht werden. Wenn nun die Gesprächspartner S und H miteinander sprechen, kommunizieren sie unter der Annahme, dass sie beide dieselbe Sprache gelernt haben. Das heißt, beide setzen z.B. als unproblematisch voraus, dass sie Prädikatoren nach zumindest ähnli‐ chen Wahrheitsbedingungen verwenden. Und sie setzen voraus, dass beide das Prä‐ dikationsspiel nach zumindest sehr ähnlichen Regeln spielen. Prädikationshandlun‐ gen ‐ ob in einfachen, erweiterten oder komplexen Sätzen ‐ werden in jeder Sprache auf jeweils spezifische Weisen gemacht, welche die Mitglieder der jeweiligen Sprachgemeinschaft nur so kennen und deshalb als Rezipienten wiedererkennen.102 102 Als einfaches Beispiel sei nochmals auf die Prädikationen adjektivischer Attribute hingewiesen: Im Deutschen haben wir sie in einer bestimmten Form gelernt und müssen sie so machen und können sie nur so verstehen. So ist im Deutschen das Adjektiv vor und nicht wie im Französischen meist hinter 190 Wenn S also das Wort an H richtet, nimmt er an, dass H seine Prädikationshandlun‐ gen im Prinzip genauso macht, wie er selbst sie macht. Im Vertrauen auf die Gültig‐ keit gemeinsamer Regeln, das durch die gemeinsame Praxis begründet ist, nimmt er an, dass H erkennt, was er macht. Oder anders gesagt: Er nimmt an, dass H versteht, was er macht, dass H ihm folgen kann. Und das kann hier nur heißen, dass H das Spiel nachvollziehend mitspielt. Dieses nachvollziehende Verstehen des Spiels gelingt nur, wenn man gelernt hat, es selbst zu spielen. H kann die sprachlichen Handlungen von S nachvollziehen, weil S sie so macht, wie er sie selbst auch macht. Verstehen ist demzufolge nicht als analyti‐ sches Erkennen zu sehen, sondern als eine Art inneren Mitspielens. Zwar ist oft eine Menge Erschließungsaufwand zu leisten, damit Verstehen möglich wird. Aber dieses dann mögliche Verstehen kommt nur als ein aktives inneres Mitspielen zustande. Durch den hohen Konventionalisierungsgrad der Prädikationshandlungen gelingt es mehr oder weniger „automatisiert“. Verstehen des Prädikationsspiels besteht jenseits aller mentalistischen Annahmen al‐ so in einem nachvollziehenden inneren Mithandeln mit dem sprechenden Partner. Wer erkennen will, worauf der andere sich bezieht und was er darüber sagt, muss mit ihm gleichsam mitgehen und seine Handlungen mitmachen. Der Verstehende vollzieht die Bezugnahmen und Prädikationshandlungen des Sprechenden mit – und dies nach seinen eigenen und in seinem Bewusstsein gemeinsamen Regeln. Diese Erklärung des Verstehens sprachlicher Handlungen entspricht einer grund‐ sätzlichen gebrauchstheoretischen Prämisse. Bedeutung kann ja nicht verstanden werden als etwas, was dem sprachlichen Ausdruck gegenübergestellt ist, etwa als Gegenstand, Vorstellung oder Gedanke. Wenn aber das, was wir Sinn, Bedeutung, Gedanke usw. nennen, sich nur im Gebrauch, genauer gesagt: im prädikativen Han‐ deln konstituiert, dann kann Verstehen nicht außerhalb davon gelingen. Sinn, Geist, und Inhalt sind nur im „Spiel“ gegeben. Das Verstehen von Prädikationshandlungen kann nur mitspielend und in diesem Sinne symbolisch mithandelnd gelingen. An‐ dernfalls müsste Verstehen eine Art Übersetzungsleistung sein in ein Sinnmedium außerhalb des Spiels oder des Handelns. Aber diese Grundannahme mentalistischer Bedeutungstheorien hat bereits Wittgenstein zu Grabe getragen. Wenn wir sprachlich kommunizieren, sind wir im Prädikationsspiel, egal, ob agie‐ rend oder rezeptiv. Auch das, was wir Gedanken nennen, haben wir nur im Spiel, aktiv handelnd oder im verstehenden Nachvollzug. Wer etwas denken oder zu ver‐ stehen geben will, muss sich in das Prädikationsspiel begeben, ebenso wie der Ver‐ dem Nomen platziert bzw. es steht links von ihm und es muss in Numerus, Kasus und Genus kon‐ gruent zu diesem sein. 191 stehende. Es gibt kein Kodieren und Dekodieren. Es gibt nur das Spiel und den Nachvollzug des Spiels. Es gibt keine Bedeutung außerhalb. Der Gedanke existiert nicht außerhalb des Prädikationsspiels, er existiert immer nur im konkreten prädika‐ tiven Handeln und in dessen inneren Nachvollzug. Es gibt ihn nur als unser eigenes sprachliches Tun, nicht im Reich der Ideen. Außerhalb dieses sprachlichen Handelns ist er nicht da, allenfalls als Erinnerung an sprachliches Handeln. Wollen wir ihn wiederherstellen, müssen wir uns erneut in das Prädikationsspiel begeben, indem wir es noch einmal spielen ‐ zumindest in den wesentlichen Zügen. Diese handlungstheoretische Auffassung vom Verstehen sprachlichen Handelns als inneren Mithandelns wird seit längerem durch Beobachtungen von Hirnforschern im Zusammenhang mit den sogenannten und mittlerweile häufig thematisierten Spie‐ gelneuronen gestützt. Dabei handelt es sich um Nervenzellen im Gehirn von Men‐ schen (und anderen Primaten), die aktiviert werden, wenn diese bestimmte Hand‐ lungen ausführen, aber auch dann, wenn sie andere bei diesen Handlungen beobach‐ ten.103 Das geht mit unserer eigenen handlungstheoretisch gebotenen Erklärung kon‐ form, dass Verstehen von Handlungen allgemein, und speziell das Verstehen sprach‐ licher Handlungen als innerer Nachvollzug zu interpretieren ist. In diesem Sinn for‐ mulierte bereits Ryle: „Die Fähigkeit, eine Handlung einzuschätzen, [ist] von dersel‐ ben Art wie die Fähigkeit, sie auszuführen“ und „Handeln und Verstehen sind grob gesagt bloß verschiedene Ausübungen desselben Handwerks.“104 Diese Feststellung gilt zumindest für das prädikative Handeln und dessen Verstehen uneingeschränkt. Sowohl das verstehensnotwendige Interpretieren wie auch das mitspielende Verste‐ hen selbst passieren also nicht automatisch im Inneren einer Black Box und hinter unserem Rücken einfach so. Verstehen ist auch nichts, wozu naturwissenschaftliche Beobachtungen etwas Erhellendes beitragen können. Die Beschreibung dessen, was auch immer im Gehirn passiert, kann nichts zur Erklärung beitragen, was wir ver‐ stehen. Genauso wenig kann eine Untersuchung des Stoffwechsels in der Wade der Tänzerin ihren Ausdruckstanz erklären. Verstehen besteht idealerweise darin zu erkennen, wie ein Sprecher seine Äußerung selbst versteht, das heißt: wie er sie meint. Dazu müssen wir sein Prädikationsspiel innerlich mitspielen. Es ist im Großen und Ganzen ja auch unser Spiel. Wir üben es ein Leben lang gemeinschaftlich, Tag für Tag. Auch wenn wir beim Verstehen inner‐ lich zum Teil automatisiert mitspielen, so ist es doch Handeln. Soweit das Mitspielen nicht automatisiert gelingt, also fast ständig, müssen wir nebenbei durch konversati‐ onelles Rechnen die Voraussetzungen fürs Mitspielen schaffen. Auch das machen 103 Giacomo Rizzolatti u. Corrado Sinigaglia 2008. Ryle 1969, 68 f. 104 192 wir großenteils automatisiert und insoweit unserer bewussten Beobachtung entzo‐ gen. Manchmal gelingt das Verstehen, manchmal nicht. Wenn wir nicht verstehen, bemerken wir das. Über das Gelingen täuschen wir uns manchmal. Mitunter bemer‐ ken wir den Irrtum erst im Nachhinein oder sogar nie. Jedenfalls ist sprachliches Verstehen nichts, was uns einfach so passiert. Nach allem notwendigen Erschließungsaufwand besteht es letztlich in innerem Mitspielen unse‐ rer gemeinsamen Prädikationsspiele. Nur in diesen Prädikationsspielen – „im Ge‐ brauch“ – existiert das, was Bedeutung, Inhalt oder Gedanke genannt wird. 193 7. Sprachliche Universalien Es erscheint überaus bemerkenswert, dass kleine Kinder die grundsätzliche Fähigkeit besitzen, sich jede Sprache anzueignen. Es sind keine menschlichen Sprachen be‐ kannt, die im Prinzip nicht jeder von uns lernen könnte. Der Spracherwerb wäre nicht zu erklären, wenn es nicht in unserer natürlichen Ausstattung läge, Regelmä‐ ßigkeiten erfassen und Regeln lernen zu können. Bildlich gesprochen muss die Fä‐ higkeit, Regelmäßigkeiten ‐ und insbesondere sprachliche Regeln ‐ zu erkennen und anzuwenden, als „Hardware“ im neuronalen System angelegt sein. Das darf als eine genetisch verankerte Voraussetzung des Spracherwerbs angesehen werden. Von den verschiedenen generativen Theorien aus der Schule Noam Chomskys wur‐ de diese minimalistische Hypothese über angeborene Fähigkeiten allerdings als nicht hinreichend betrachtet. Ein Hauptargument war, der kindliche Spracherwerb wäre gar nicht möglich, wenn nicht bereits fundamentale grammatische Regeln und Kategorien angeboren wären. Das beim primären Spracherwerb zur Verfügung ste‐ hende Sprachmaterial sei für diesen nämlich nicht zureichend und zu unsystema‐ tisch, als dass daraus ‐ im Sinne der minimalistischen Annahme – die benötigten sprachlichen Regeln gewonnen werden könnten, schon gar nicht von Kleinkindern. Für Chomsky ist der Spracherwerb nicht zu erklären ohne die Annahmen einer an‐ geborenen Grammatik, die allen Einzelsprachen zugrunde liegt. Die Unterschiede der mehr als 6000 menschlichen Sprachen auf der Erde – falls man sie überhaupt sinnvoll zählen kann ‐ existierten nur an der Oberfläche, dahinter oder darunter ste‐ cke in der Tiefenstruktur eine einzige angeborene Grammatik. Beim Kommunizieren würden die universalsprachlich gegebenen Satzstrukturen nach den von der genera‐ tiven Grammatik beschriebenen Transformationsregeln in die jeweilige Einzelspra‐ che übersetzt, egal, ob es sich dabei um Deutsch, Suaheli oder die taktile Sprache von taubblinden Menschen handelt. Die im Einzelnen verschiedenen, auf zum Teil unterschiedlichen grammatischen Modellen beruhenden nativistischen Thesen der generativen Linguistik wurden von vielen Seiten kritisiert, nicht nur von Linguisten und Philosophen, sondern auch von Biologen und Hirnforschern. Aus biologischer Sicht erschien die Annahme angeborener grammatischer Katego‐ rien von Anfang an problematisch. Da die menschlichen Sprachen sich nach gegen‐ wärtigem Kenntnisstand erst im Lauf der letzten vierzig‐ bis maximal hunderttau‐ send Jahre entwickelt haben, erscheint es unwahrscheinlich, dass grammatische Ka‐ tegorien bereits im Gehirn verankert sein könnten. Die minimalistische Hypothese von der angeborenen Fähigkeit zum Erkennen von Regelmäßigkeiten und zum Ler‐ nen von Regeln ist dagegen philosophisch und biologisch unumstritten. 194 Auch aus der Sicht der empirischen Linguistik spricht mittlerweile viel gegen die Annahmen einer Universalgrammatik. Je größer der Kreis untersuchter menschlicher Sprachen wurde und je mehr ethnolinguistische Befunde gesammelt werden konn‐ ten, umso weniger blieb von den vermuteten universellen grammatischen Kategorien und Regeln übrig. Der Großteil der in den verschiedenen Fassungen der transforma‐ tionellen Theorie angenommenen sprachlichen Universalien erwies sich im Lichte ethnolinguistischer Forschungen als nicht universell.105 Einiges blieb übrig: Alle Sprachen verwenden Eigennamen und Prädikatoren und in allen Sprachen werden Regeln rekursiv angewandt. Schließlich machen Erkenntnisse von Entwicklungspsychologie und Neurobiologie die weitreichenden nativistischen Annahmen der transformationellen Theorie obso‐ let. Die auf den ersten Blick plausibel erscheinende Annahme, grammatische Kennt‐ nisse müssten angeboren sein, weil sonst der Spracherwerb nicht erklärbar wäre, be‐ ruhte auf – sicherlich zeitbedingter ‐ Unkenntnis über die neurobiologischen Grund‐ lagen des Spracherwerbs. Tatsächlich erscheint es nur schwer vorstellbar, wie ein kleines Kind die komplexen sprachlichen Regeln einer Sprache induktiv erlernen kann. Diese Rätselhaftigkeit des frühkindlichen Spracherwerbs verschwindet aber, wenn man aufhört, sich das Gehirn von Kleinkindern als etwas Fertiges zu denken. Es ist eine biologisch gesicherte Erkenntnis, dass das Gehirn von Kleinkindern wäh‐ rend des Spracherwerbs noch reift und dass gerade die sich schrittweise verringern‐ de Unreife des Gehirns die Aneignung der Sprache ermöglicht. Umgekehrt erscheint es zweifelhaft, ob Menschen Sprachen erlernen könnten, wenn sie bereits von An‐ fang an ausgereifte Gehirne hätten. Für die verschiedenen Phasen des Spracherwerbs ist die jeweilige Phase der Unreife des Gehirns geradezu eine Voraussetzung. Dadurch müssen und können die kom‐ plexen sprachlichen Konventionen nicht auf einmal und gleichzeitig gelernt werden, sondern dies geschieht schrittweise und dem jeweiligen Entwicklungsstand entspre‐ chend. Die erst nach und nach erfolgende Reife des Gehirns wirkt dabei wie ein suk‐ zessiv verringerter Filter. In einer ersten Reifephase werden nur die akustischen Rei‐ ze schrittweise zu Musterwahrnehmungen verarbeitet und im Gehirn synaptisch ab‐ gelegt. Melodische Aspekte einer Sprache, die sogenannte Prosodie, werden dabei schon sehr früh gelernt. Da das Hörsystem bereits vor der Geburt ausgereift ist, kann der Fötus schon in den letzten Wochen vor der Geburt durch das Fruchtwasser hin‐ durch die wiederkehrenden Betonungsmuster von Wörtern und Sätzen wahrnehmen und lernen. Im Deutschen werden zweisilbige Wörter auf der ersten Silbe betont (Máma, Pápa, Kátze), während im Französischen die Betonung auf der zweiten Silbe Vgl. z.B. Evans 2009. 105 195 liegt (mamàn, papà, enfànt). Dieser Unterschied zwischen den Betonungsmustern der beiden Sprachen zeigt sich auch in den Schreien von Neugeborenen: Deutsche Säug‐ linge schreien „deutschʺ, und französische Säuglinge schreien „französischʺ, indem sie die jeweiligen Betonungsmuster von zweisilbigen Wörtern in ihrer Muttersprache nachahmen. Spracherwerb beginnt also schon vorgeburtlich.106 Nach der Geburt werden anfangs sprachliche Äußerungen von Geräuschen unter‐ schieden, dann wiederkehrende Lautmuster als relevant unterschieden. Im Alter von einem Monat können Babys noch alle möglichen Laute aller Sprachen zu unterschei‐ den lernen, im Alter von zehn Monaten gelingt ihnen dies nicht mehr, denn sie ha‐ ben nun bereits alle für ihre jeweiligen Sprachen relevanten Laute unterscheiden ge‐ lernt, das heißt: synaptisch verankert. So haben beispielsweise japanische Babys zu diesem Zeitpunkt die Konsonanten „r“ und „l“ zu einem einzigen Lautmuster zu‐ sammengefasst.107 Regeln für einzelne Wörter können nachweislich schon ab dem vierten Lebensmonat gelernt werden. Dies geschieht durch Assoziation zwischen Objekt und Wort, wobei für das Erkennen einer Regel mindestens vier Lernbeispiele nötig sein sollen. In be‐ grenztem Umfang gelingt dieses Wörter‐Lernen auch nichtmenschlichen Primaten, sogar Hunden. Allerdings sind Tiere unfähig, syntaktische Regeln zu erwerben, die denen einer menschlichen Sprache vergleichbar wären. Die Nervenfaserverbindung zwischen verschiedenen Hirnarealen, die für die Verarbeitung syntaktischer Regeln „zustän‐ dig“ ist, kann bei Neugeborenen nicht nachgewiesen werden. Sie bildet sich beim Menschen relativ spät, bei Tieren nie. Dementsprechend erfolgt der Erwerb syntakti‐ scher Regeln relativ spät, nämlich vor allem im zweiten und dritten Lebensjahr. Nach langem Üben erreicht der Mensch im jungen Erwachsenenalter eine Sprachkompe‐ tenz, die es ihm ermöglicht, auch komplexe Sprache schnell, automatisiert und gleichsam unbewusst innerhalb von Millisekunden zu verarbeiten. Auch für das Lernen von syntaktischen Regeln ist ein bestimmtes Zeitfenster im Rei‐ feprozess des Gehirns anzunehmen. Dies zeigt das Schicksal der Amerikanerin, die unter dem Namen Genie bekannt wurde. Obwohl sie nach dreizehnjähriger isolierter Gefangenschaft den Gebrauch englischer Wörter nach und nach lernen konnte, blie‐ ben die von ihr gebildeten Sätze reine Wortreihen ohne syntaktische Kombinatorik. Der sukzessive Reifeprozess des Gehirns bewerkstelligt also, was im Fremdspra‐ chenunterricht ein guter Lehrer machen würde: Er sorgt dafür, dass beim Lernen mit 106 Friederici 2014. Alison Gopnik/Patricia Kuhl/ Andrew Meltzoff: Forschergeist in Windeln. Wie Ihr Kind die Welt begreift. München 2000. 107 196 dem Einfachen begonnen wird. Erst danach folgen komplexere Aufgaben, die auf dem bis dahin Gelernten aufbauen. Somit ist es gar nicht nötig, dass dem Kind ein didaktisch präpariertes Sample von Beispielen präsentiert wird, aus denen es Regeln ableiten kann. Die sprachliche Umgebung des Kindes braucht nicht gezielt auf sys‐ tematischen Regelinput angelegt sein. Die jeweilige Unreifestufe des Gehirns wirkt wie ein Filter, der die Komplexität sprachlicher Konventionen auf das reduziert, was für das Kind zum jeweiligen Zeitpunkt seiner Entwicklung erlernbar ist. Das Ganze geschieht natürlich in einem personalen und intentionalen Bezug, ohne den der Spracherwerb nicht möglich wäre und um dessentwillen er ja erfolgt. Wenn man die neurobiologischen Tatsachen berücksichtigt, ist der Spracherwerb von kleinen Kindern kein so großes Rätsel mehr. Die Annahme von angeborenen gram‐ matischen Universalien wird auch durch eine weitere physiologische Tatsache in Frage gestellt: Gerade die für die Verarbeitung syntaktischer Regeln nötigen neura‐ len Grundlagen werden erst durch den mit dem Spracherwerb verknüpften Rei‐ fungsprozess herausgebildet. Sie sind nicht angeboren. Würden die Lernprozesse fehlen, würden beim Erwachsenen auch die entsprechenden Sprachzentren nicht ausgebildet werden.108 Für die Erklärung des Spracherwerbs ist also – wie Entwicklungspsychologie und Neurobiologie zeigen – die Annahme angeborener Grammatikkenntnisse unnötig. Ethnolinguistische Untersuchungen entlarvten einen Großteil der angenommenen sprachlichen Universalien als ethnozentristische Verallgemeinerungen. In ihrer Stu‐ die über den „Mythos der sprachlichen Universalien“109 zeigten Evans und Levinson, dass es in den untersuchten Sprachen kaum durchgängige Gemeinsamkeiten gibt. Von den einstmals vier als universell postulierten Wortarten Verb, Nomen, Adjektiv und Adverb bleiben nach empirischer Prüfung neben den Eigennamen bestenfalls die ersten beiden übrig. In manchen Sprachen werden die prädikativen Informatio‐ nen, die bei uns durch einzelne Adverbien und Adjektive ausgedrückt werden, syn‐ thetisch durch bestimmte Formen der Verb‐ und Nominalformen zum Ausdruck ge‐ bracht. In den Sprachen ohne Adjektive wird das Attribut anders ausgedrückt, z.B. durch ein Verb: Die Blume, die blaut. Obwohl viele Annahmen zu Gemeinsamkeiten menschlicher Sprachen widerlegt wurden, ist die Annahme sprachlichen Universalien dadurch aber nicht völlig über‐ holt. Die Tatsache, dass wir alle menschlichen Sprachen lernen können, ist ohne die Annahme von Gemeinsamkeiten aller menschlichen Sprachen wohl kaum erklärbar. Vgl. Spitzer 2000, 2002. Evans, Levinson 2009. 108 109 197 Dass die meisten grammatischen Phänomene nicht universell sind, heißt lediglich, dass die meisten grammatischen Phänomene einzelsprachlich sind. Wenn man sich fragt, ob es Gemeinsamkeiten aller Sprachen gibt und ob dahinter unsere genetische Ausstattung stehen könnte, käme niemand auf die Idee, angebore‐ ne phonologische Universalien zu postulieren. Wir haben eben einen biologisch vor‐ gebenen Stimmapparat, der es uns ermöglicht, in den unterschiedlichen Sprachen ei‐ ne beeindruckende Vielzahl verschiedener kommunikativ relevanter Lautmuster zu bilden. Ebenso wie die phonologischen Muster sind auch die grammatischen Regeln zuerst einmal einzelsprachlich. Wo aber sind dann die Gemeinsamkeiten aller Spra‐ chen zu finden, wenn sie nicht phonologischer, morphologischer oder grammati‐ scher Art sind? Begibt man sich auf die handlungstheoretische Ebene der Sprachbeschreibung, lässt sich das allen Sprachen Gemeinsame als empirisch überprüfbare Hypothese formu‐ lieren. Die allen Sprachen gemeinsamen Handlungen werden zwar in unterschied‐ lichsten einzelsprachlichen Formen gemacht. Dennoch werden durchgängige Ge‐ meinsamkeiten erkennbar. 198 1. Sprechakte Menschen machen in allen Sprachen Sprechakte, das heißt, sie bedeuten in allen Sprachen ihre Bewirkungsabsichten. Sie wollen, dass ihre Gegenüber diese Absichten erkennen und dass in der Folge dieses hörerseitigen Verstehens die angestrebten Wirkungen eintreten. Höchstwahrscheinlich sind die grundsätzlichen Bewirkungsabsichten in allen Kultu‐ ren dieselben. Es dürfte in allen Sprachen deskriptive, appellative, expressive, kom‐ missive und deklarative Sprechakte geben. Innerhalb dieser grundsätzlichen Grup‐ pen dürfte es wohl kulturell unterschiedliche Handlungstypen geben, ganz beson‐ ders im Bereich der deklarativen Handlungen, zu denen ja verschiedenste institutio‐ nell gebundene und auch kultische Handlungen gehören. 2. Das Prädikationsspiel In allen Sprachen wird die überwältigende Mehrzahl der Sprechakte durch das Spie‐ len des Prädikationsspiels gemacht, das heißt durch Prädikationen über Gegenstän‐ de der Bezugnahme nach dem Muster P (a,b,c). Das Prädikationsspiel erfolgt jeweils in einzelsprachlichen Formen. Zum Prädizieren gehört das Referieren, also das Set‐ zen von Gegenständen der Bezugnahme mit Eigennamen, prädikativen Kennzeich‐ nungen (in Verbindung mit Artikeln oder Quantoren) sowie mit pronominalen bzw. deiktischen Kurzformen. Sprechakte werden nahezu ausschließlich durch Prädikationshandlungen gemacht, weil die Vielzahl möglicher absichtsvoller Inhalte nur im Medium von Sätzen gege‐ ben und vermittelbar ist. Man kann nicht viel behaupten, versprechen, empfehlen usw., wenn man keine Sätze bilden kann. Prädikationshandlungen werden ausschließlich mit einzelsprachlichen Mitteln ge‐ macht, seien sie phonetischer, morphologischer oder grammatischer Art. Aber trotz dieser einzelsprachlichen Verschiedenheit sind strukturelle Gemeinsamkeiten offen‐ sichtlich: Das Prädikationsspiel erfolgt durch Prädikationen über Gegenstände der Bezugnahme. Es gibt in allen Sprachen so etwas wie Prädikate und Argumente oder Prädikate, Subjekte und Objekte. Obwohl das Prädikationsspiel jeweils nach einzel‐ sprachlichen Regeln gespielt wird, ist seine Grundstruktur universell. Das dürfte ein starker Hinweis auf angeborene Voraussetzungen sein, die über die minimalistische These hinausgehen. Allerdings lassen sich auch diese Grundstrukturen nicht in einer „Sprache des Geistes“, sondern nur einzelsprachlich beschreiben. Eine der möglichen konventionellen Beschreibungen solcher Grundstrukturen sieht so aus: P (a), P (a, b) oder P (a, b, c). 199 Universalität finden wir also eher auf der Ebene der Handlungen und eher nicht in der Phonetik, Morphologie oder Grammatik. Auch die beim Prädizieren anzuwen‐ denden grammatischen Regeln sind ausschließlich einzelsprachlich. Aber in allen Sprachen schaffen wir sprachliche Gegenstände der Bezugnahme und prädizieren über diese mit ein‐ oder mehrwertigen Prädikatoren. Menschliche Sprachen ohne Prädikationen über Argumente sind nicht bekannt. Sie sind nicht einmal vorstellbar. Das ist ein Hinweis auf biologische Gegebenheiten. 3. Metaprädikative Handlungen Prädikationshandlungen sind in allen Sprachen jeweils verbunden mit verschiedenen metaprädikativen Handlungen: ‐ der Anzeige der Bewirkungsabsichten, ‐ der Anzeige der Prädikationsstrukturen, ‐ der Anzeige der zeitlichen Verhältnisse. Die Anzeige der Bewirkungsabsichten Faktisch erfolgen Prädikationshandlungen nie als reine propositionale Akte, sondern immer im Dienste von Bewirkungsabsichten. Insofern sind Prädikationshandlungen immer gleichzeitig auch Sprechakte. Die kommunikativ angestrebten Ziele können nur erreicht werden, wenn die Gegenüber verstehen, dass sie angestrebt werden. Zur Erleichterung dieses Verstehens sind in allen Sprachen illokutive Indikatoren ent‐ wickelt worden. Mit ihrer Verwendung machen wir metaprädikative Handlungen, die unser Prädikationsspiel begleiten. Wir geben z.B. mit Satzform oder Intonation auf regelhafte Weise zu verstehen, in welcher Bewirkungsabsicht wir eine Prädikati‐ onshandlung machen, mit welcher Absicht im Hinblick auf die Partner wir also Be‐ zug nehmen und prädizieren. Entsprechend den in den einzelnen Sprachen mit verschiedensten synthetischen oder analytischen Indikatoren bedeutbaren Absichten lassen sich Aussage‐, Frage‐ und Aufforderungssätze usw. unterscheiden. Im Deutschen wird der generelle Typ der Verstehensintention vor allem synthetisch durch die Satzgliedfolge, genauer durch die Stellung des verbalen Prädikats angezeigt. Zweitstellung zeigt pauschal eine de‐ skriptive, Erststellung eine appellative oder – bei Ja‐Nein‐Fragen ‐ interrogative Ab‐ sicht an. Das Lateinische verwendet entsprechende Verbformen und Fragepartikel: Dicit linguam germanicam. / Dic linguam germanicam / Dicisne linguam germanicam? Ähnlich verfährt das Türkische: 200 Aussageabsicht Ayşe kommt. Ayşe geliyor. Frageabsicht Kommt Ayşe? Ayşe geliyor mu? Aufforderungsabsicht Komm Ayşe! Ayşe gel! Im Chinesischen kann durch das Anhängen der Partikel ma (吗) hinter einem Aussagesatz eine Fragsatz gebildet werden: 你看这本小说吗?ni kan zhe ben xiao shuo ma? Liest du dieses Buch? 你有两辆汽车吗?ni you liang liang qiche ma? Hast du zwei Autos? Aussagesätze können allein durch entsprechende Intonation in Aufforderungssätze verwandelt werden. Die Zahl der in einzelnen Sprachen solcherart unterscheidbaren Satzformen ist aller‐ dings zu gering, um die Vielzahl von Verstehensabsichten bzw. Sprechakten mit ih‐ ren vielfältigen Varianten und Abschattungen unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. Theoretisch wäre zwar denkbar, z.B. die verschiedenen Arten appellativer Sprechakte wie Bitten, Auffordern, Befehlen, Warnen, Empfehlen, Raten usw. durch besondere Verbformen oder entsprechende analytische Ausdrucksmittel differen‐ ziert anzuzeigen. Faktisch verbleibt aber in allen Sprachen trotz der jeweiligen illoku‐ tiven Indikatoren ein mehr oder weniger großer Erschließungsspielraum hinsichtlich der Bewirkungsabsichten, der durch Mittel der Intonation, Gestik, Mimik usw. etwas verringert werden kann. Die Anzeige der Prädikationsstrukturen Sprecher aller Sprachen spielen das Prädikationsspiel. Sie prädizieren mit ein‐ oder mehrwertigen Prädikatoren über Gegenstände der Bezugnahme. Obwohl dieses Prä‐ dikationsspiel universell ist, sind nicht nur die dabei verwendeten Wörter einzel‐ sprachlich, sondern ebenso die metaprädikativen Anzeigemittel der Prädikations‐ struktur. Die Prädikation über Gegenstände der Bezugnahme wird in allen Sprachen so gemacht, dass für den Rezipienten ersichtlich wird, was worüber prädiziert wird. So muss dazu insbesondere bei asymmetrischen Prädikatoren wie verlassen die Posi‐ tion der Argumente bzw. Satzergänzungen gekennzeichnet werden, denn es macht einen Unterschied, ob die Person A die Person B verlässt oder umgekehrt. Alle Spra‐ chen nutzen Mittel, um die Struktur von Prädikationshandlungen konventionell zu verdeutlichen und somit den Erschließungsaufwand einigermaßen erfolgverspre‐ chend zu begrenzen. Hinter all den kulturellen „Moden“ der einzelsprachlichen Grammatiken finden wir tatsächlich diese universelle Handlung der Strukturanzei‐ ge. 201 Je nachdem, ob die Mittel der Strukturindikation morphologisch an Wörter gebun‐ den ist oder nicht, werden Sprachen als eher synthetisch oder als eher isolierend (analytisch) bezeichnet. So ist das Chinesische prototypisch isolierend, das Altsume‐ rische oder das Lateinische eher synthetisch. In eher isolierenden Sprachen wie den chinesischen wird ‐ ähnlich dem Englischen – allein durch die Position im Satz ange‐ zeigt, was Subjekt und was Objekt ist. In dem Satz The boy hits the girl. ist das einzige, was uns mitteilt, wer der Schläger ist und wer geschlagen wird, die Stellung der Substantive im Satz. Ähnlich verfahren auch formale Sprachen nach dem Muster P (a, b). Wird die Position der Argumente vertauscht, ergibt sich eine völlig andere Aussage: P (b, a). Im Lateinischen erfolgt die Anzeige der relationalen Position über die synthetischen Kasusmorpheme. Das erlaubt eine weitgehend freie Satzgliedfolge. Das Japanische verwendet statt gebundener Kasusendungen isolierte Postpositionen, um Subjekte (ga), Objekte (o) oder indirekte Objekte (ni) anzuzeigen. In sog. polysynthetischen Sprachen wird die relationale Position von Subjekten und Objekten durch die Stellung innerhalb von „Slots“ in der übergreifenden Verbform ausgedrückt. Diese synthetische Variante treiben arabische Sprachen auf die Spitze, wenn die in die Verbformen integrierten Subjekte auch noch nach männlichem oder weiblichem Geschlecht unterschieden werden. Die Indianersprache Straits Salish bietet eine besonders minimalistische Variante der Strukturindikation. Zwar ist Vorsicht angebracht, wenn über Sprachen berichtet wird, die nur noch von einigen älteren – möglicherweise inzwischen schon verstor‐ benen ‐ Stammesangehörigen gesprochen wird. Aber wenn es die Sprache Straits Sa‐ lish nicht gäbe, müsste man sie sich wegen ihrer geradezu idealtypischen Schlichtheit ausdenken. Nach Jelinek (1995) gibt es in Straits keine Unterscheidung zwischen strukturindikatorisch wirksamen Wortarten wie Verben oder Substantiven. Alle wichtigen Ausdrücke fungieren als Prädikatoren der Art „rennt /rennen“, „ist klein /sind klein“ oder „ist eine Frau /sind Frauen“. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit den prädikativen Ausdrücken Ereignisse, Gegenstände, Gegenstandsklassen oder einzel‐ ne Personen bezeichnet werden. Durch spezielle Artikel wird jedoch angezeigt, ob durch die Ausdrücke auf einen Vorgang, einen materiellen Gegenstand oder den Träger eines Eigennamens Bezug genommen wird. Stehen Ausdrücke am Satzan‐ fang, so ist ihre Rolle die des syntaktischen Prädikats. Ihnen folgen Subjekt und Ob‐ jekte nach dem Muster P (a, b). Wenn Ausdrücke als syntaktische Ergänzungen bzw. Argumente verwendet sind, werden sie in Kombination mit Artikeln zu Relativsät‐ zen folgender Art umgeformt: 202 Das[, was] singt (bzw. derjenige, diejenige [der, die] singt), das [, was] ein Haus ist, der [, der] Johannes ist. Ein Satz könnte also ungefähr lauten: Sehen/ was John heißt / was Fisch ist. Strukturanzeigen sind immer einzelsprachliche metaprädikative Ausdrucksweisen. Im Deutschen kann man die Satzglieder oft ohne Nachteil vertauschen, weil Kasus‐ markierungen, ähnlich wie im Lateinischen, die Position zuverlässig markieren: Den Jungen bewundert das Mädchen. Das Mädchen bewundert den Jungen. Das Mädchen bewundert der Junge. Der Junge bewundert das Mädchen. Wo Kasusendungen der nominalen Ausdrücke die relationalen Positionen nicht ein‐ deutig markieren, wird im Deutschen die Position der Ergänzungsausdrücke manchmal allein durch die Numeruskongruenz des Verbs mit dem Subjekt ange‐ zeigt: Diese Lehrerin lieben die Schüler. Diese Lehrerin liebt die Schüler. Im modernen Aramäischen werden die relationalen Rollen grundsätzlich nur am Verb markiert, wo geschlechtsspezifisch modifizierte Endungen zur Angabe der rela‐ tionalen Richtung verwendet werden müssen (sie ihn oder er sie). So wird auch ohne Kasus oder feste Wortstellung klar, ob der Junge das Mädchen sieht oder umgekehrt. Wenn ein Junge ein Mädchen gesehen hat, lautet das Verb kemxaz‐ya‐le (sah‐sie‐ihn), wenn umgekehrt das Mädchen den Jungen sah, heißt es kemxaz‐e‐la (sah‐er‐sie).110 Auch formallogische Darstellungen nutzen konventionelle Formen der Strukturan‐ zeige. Ihren besonderen Nutzen haben sie, wenn die prädikativen Verhältnisse in ei‐ ner natürlichen Sprache nicht klar genug indiziert sind, etwa bei Mehrdeutigkeiten. Allerdings können zur Klärung sowohl Paraphrasen innerhalb derselben Sprache wie auch in jeder anderen natürlichen Sprache verwendet werden, die an dieser Stel‐ le nicht unterkonventionalisiert ist. Die nahezu unüberschaubare Vielfalt der strukturindikatorischen Mittel in den ver‐ schiedenen Sprachen sollte uns nicht den Blick dafür verstellen, dass sie immer dem verstehenden Nachvollzug der in diesen Sprachen gemachten Prädikationshandlun‐ gen dienen. 110 Zitiert nach Deutscher 2008, 47. 203 Die Anzeige der zeitlichen Verhältnisse In allen Sprachen wird das Prädikationsspiel mit temporaldeiktischen Hinweisen ge‐ spielt. Mit der Prädikationshandlung ist immer eine wahrheitsfunktionale Feststel‐ lung über den zeitlichen Bezug des Gesagten zum Sprecherzeitpunkt verbunden. Das kann sowohl durch analytische wie synthetische Mittel auf die verschiedensten grammatischen Arten realisiert werden. Unter den Möglichkeiten der synthetischen Anzeige der zeitlichen Verhältnisse bietet sich die Nutzung der syntaktischen Prädikatsausdrücke als „Zeitwörter“ an. In den indoeuropäischen Sprachen werden die Zeitstufen weitgehend durch synthetische Verbformen oder durch Hilfsverben (wir haben gesehen, wir werden gehen) zum Aus‐ druck gebracht. Durch die Temporalform des Verbs wird also an der „Satzoberflä‐ che“ ‐ neben der Anzeige der Bewirkungsabsicht durch den Verbalmodus und der Strukturanzeige ‐ die Temporaldeixis als dritte metaprädikative Handlung repräsen‐ tiert. So wird in Sie ging nach Hause. mit der Temporalform angezeigt, dass – vereinfacht gesagt ‐ das Ereignis vor dem Sprechzeitpunkt stattfand. Die obligatorische Temporalform ist also die synthetische Ausdrucksform einer metaprädikativen Feststellung über die temporalen Verhältnis‐ se. So erfolgt durch die Präteritumsform ein Hinweis etwa in dem Sinn: „Das war zeitlich vor dem Zeitpunkt des Sprechens.“ – oder: „Der Satz Sie geht nach Hause. war vor dem Zeitpunkt dieser Feststellung wahr.“ Entsprechend wird mit der Prädikation in der Form des Plusquamperfekts in Sie war nach Hause gegangen. zum Ausdruck gebracht, dass nach Ansicht des Sprechers das Geschehen in der Ver‐ gangenheit vor einem anderen im Kontext bereits bekannten vergangenen liegt. Häu‐ fig erfolgt die an die Verbalform gekoppelte synthetische Temporaldeixis in Verbin‐ dung mit entsprechenden temporaldeiktischen Wörtern wie jetzt, gestern, morgen, bald usw. Manchmal wird die temporaldeiktische Funktion der verbalen Tempusformen einfach durch solche Wörter ersetzt ‐ wie in Er reist morgen ab. In eben dieser Weise, nämlich mit Zeitadverbien wie jetzt, heute oder damals oder mit Adverbialsätzen werden in isolierenden Sprachen wie dem Chinesischen die zeitli‐ chen Verhältnisse bedeutet. Der zeitliche Bezug zum Sprecherzeitpunkt wird dort al‐ 204 so nicht durch grammatische Formeigenschaften des Verbs oder anderer Wortarten ausgedrückt. Auch wenn in allen Sprachen grundsätzlich eine Anzeige der temporalen Verhältnis‐ se stattfindet, so sind im Bereich der synthetischen Anzeigen die Unterschiede er‐ staunlich groß. Neben der uns geläufigen Unterscheidung „Gegenwart, Vergangen‐ heit, Vorzeitigkeit der Gegenwart, Vorzeitigkeit der Vergangenheit, Zukunft, vollen‐ dete Zukunft“ verwenden eine Reihe von Sprachen noch synthetische Distanzunter‐ scheidungen, also etwa „nahe Vergangenheit, ferne Vergangenheit“. Möglich sind auch synthetische Tempora, die sich auf spezifische Tage beziehen, also z.B. „heute, vor heute, gestern, vorgesternʺ. Einzigartig ist das Tempussystem im Kiksht, einer Sprache in Oregon. Dort gibt es eine synthetische verbale Tempusunterscheidung zwischen „dieses Jahr“ und „letztes Jahr“. Aus alledem ergibt sich, dass über die grundsätzliche Anzeige der Gleichzeitigkeit, Vorzeitigkeit und Nachzeitigkeit im Verhältnis zum Sprecherzeitpunkt keine weite‐ ren universellen Handlungen der Temporaldeixis auffindbar sind. Natürlich wären für alle möglichen feineren analytisch ausdrückbaren Zeitabstufungen wie im Sinne von übermorgen oder im nächsten Jahr auch synthetische Formen denkbar. So könnte man auch synthetische Tempusformen für „morgen in acht Tagen“ oder „letzten Monat“ erfinden oder für „letzten Dienstag“ oder „vorletzten Montag“. So etwas wurde bisher aber noch in keiner Sprache gefunden.111 Derartige synthetische Lösun‐ gen wären wahrscheinlich auch im Kosten – Nutzen‐Verhältnis nicht mehr vertret‐ bar. So etwas lässt sich effizienter auf analytische Art sagen. 4. Rekursivität In allen Sprachen werden Prädikationshandlungen rekursiv gemacht ‐ entweder durch Einbettungen von Nebensätzen, elliptischen Kurzformen von Sätzen oder durch externe Sätze. Trotz gewisser Korrekturen an früheren Positionen betrachtet Chomsky bis heute Rekursivität als das wichtigste universelle Merkmal menschlicher Sprachen. Dem kann man aus handlungstheoretischer Sicht nur zustimmen. Einfache Sätze finden sich natürlich in jeder bisher untersuchten Sprache. Solche ein‐ fachen Sätze bzw. die durch sie repräsentierten Prädikationshandlungen lassen sich in allen Sprachen wieder auf sich selbst oder Teile von sich selbst anwenden. So kön‐ nen über die Referenten einer Prädikationshandlung, die großenteils selbst durch prädikative Kennzeichnungen gesetzt werden, weitere Prädikationshandlungen ge‐ 111 Vgl. Haspelmath, in: Krämer und andere, Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen? 205 macht werden, entweder durch externe zusätzliche Sätze oder satzintern als attribu‐ tive Prädikationen in Form von Relativsätzen, präpositionalen Attributen usw. Aber auch die durch Prädikationshandlungen ausgedrückten Sachverhalte selbst können Gegenstände der Bezugnahme werden, über die prädiziert werden kann, entweder im Sinne von Sachverhaltskommentaren oder im Sinn von Sachverhalts‐ oder Um‐ standsbestimmungen.112 In allen Sprachen werden rekursive Prädikationshandlungen im Dienste von Ge‐ schwindigkeits‐ und Effizienzgewinnen überwiegend durch Einbettungen gemacht. Wenn es weniger auf Zeitgewinn ankommt, können sie aber auch außerhalb von Satzgrenzen in externen Sätzen gemacht werden. So lassen sich etwa Sachverhalts‐ kommentare sowohl durch externe Sätze machen wie auch durch satzinterne Kurz‐ formen im Sinne von Bachs Sprechakten zweiter Ordnung. Eine Sprache, die aus den verschiedenen Realisierungsformen rekursiver Prädikationshandlungen etwa die satzförmigen Einbettungen wie Relativsätze, Subjekt‐ oder Objektsätze oder Adver‐ bialsätze nicht verwendet, kann trotzdem noch auf verschiedene andere Formen re‐ kursiver Prädikationen zurückgreifen. Vor diesem Hintergrund ist Everetts Behauptung zu bewerten, es gäbe Sprachen, denen das Merkmal der Rekursivität fehle113. Der frühere Missionar und ehemalige Chomsky‐Schüler Daniel Everett berichtet, das kleine Amazonas‐Volk der Pirahã, ei‐ ne Gesellschaft von Jägern und Sammlern, verfüge nur über eine stark reduzierte Sprache, vor allem benutze es, wie angeblich auch ein Volk in Neu Guinea, keine Nebensätze. Damit, so folgert Everett, fehle seiner Sprache das Merkmal der Rekur‐ sivität, so dass dieses nicht mehr als universell angesehen werden könne. Nun sind Behauptungen über Pirahã empirisch schlecht zu überprüfen, solange die Zahl von Pirahã sprechenden Linguisten sehr gering ist. Allerdings beruht selbst dann, wenn Everett die Tatsachen korrekt beschreibt, seine Schlussfolgerung auf ei‐ nem offensichtlich verengten Begriff von Rekursivität. Das Fehlen von Nebensätzen ist jedenfalls kein hinreichender Beweis für das grundsätzliche Fehlen von Rekursivi‐ tät. Denn rekursive Prädikationshandlungen finden ja nicht nur in vollständigen Ne‐ bensätzen statt. In natürlichen Sprachen werden Satzeinbettungen auch in den grammatischen Kurzformen der attributiven und adverbialen Fügungen gemacht. Dabei werden nicht syntaktisch komplette Nebensätze eingebettet, sondern deren el‐ liptische Kurzformen, im Deutschen z.B. präpositionale Attribute, präpositionale Adverbiale oder adjektivische Attribute. Dass aber Adjektive und Adverbien im Pi‐ rahã verwendet werden, stellt Everett ausdrücklich fest, auch wenn sie angeblich 112 113 Vgl. Kap 4. Everett 2005, 2007. 206 nicht sehr zahlreich seien. Darüber hinaus ist rekursives Handeln nicht nur satzin‐ tern möglich. So können, wie gezeigt, Prädikationen über Sätze bzw. über Argumen‐ te von Sätzen ja nicht nur eingebettet, sondern auch satzextern gemacht werden. Das Merkmal der Rekursivität zeigt sich nicht nur an eingebetteten Nebensätzen Zuletzt ist zu bedenken, dass in allen Sprachen Prädikatoren wahrheitsfunktional verwendet werden. Nur so können sie, wie alle regelhaft verwendeten Ausdrücke, ja gelernt werden. Daraus ergibt sich die Möglichkeit, dass ein Satz wahr oder falsch sein kann. Es besteht deshalb in allen Sprachen die Möglichkeit, einen Satz als wahr oder falsch zu bezeichnen – oder eine Frage mit ja oder nein zu beantworten. In bei‐ den Fällen handelt es sich um Prädikationen über Prädikationen, im ersten Fall ex‐ plizit in Satzform, im zweiten in Kurzform. Oder anders ausgedrückt: In beiden Fäl‐ len wird mit Sätzen etwas über Sätze gesagt. Somit ist eine Sprache mit Prädikatoren, welche die Eigenschaft der Rekursivität nicht kennt, gar nicht denkbar. Und Spra‐ chen ohne Prädikatoren sind nicht nur nicht bekannt – wir können sie uns nicht ein‐ mal vorstellen. Zwei Anmerkungen zum Schluss: Man darf erstens davon ausgehen, dass Sprecher des Pirahã auch in ihrem nichtsprachlichen Tun rekursive Handlungen ausführen, etwa beim Herstellen von einfachen Werkzeugen durch Behauen. Rekursivität ist ja nicht nur eine Eigenschaft des sprachlichen Handelns. Zweitens: Würde man ein Ba‐ by der Pirahã in eine sprachliche Umgebung bringen, in der auch satzförmige rekur‐ sive Einbettungen benutzt werden, würde es aller Wahrscheinlichkeit nach auch sol‐ che grammatischen Formen rekursiver Prädikation lernen, nicht nur die im Pirahã gebräuchlichen. Das Prinzip ist ja dasselbe. 207 8. Fazit: Der Ausgangspunkt war: Sprachliche Ausdrücke können keine Bedeutung haben, die in etwas Außersprachlichem besteht, das ihnen zur Erklärung zugeordnet wer‐ den könnte. An die Stelle der unhaltbaren semantischen Korrespondenztheorien tritt im Sinne Wittgensteins eine handlungstheoretische Semantik. Was wir Sinn, Bedeutung oder Inhalt nennen, gibt es nicht außerhalb des sprachlichen Handelns, sondern nur in den Handlungen selbst, mit denen wir etwas bedeuten. Was wir bedeuten, kann nichts sein, was als Bedeutung „im Kopf“ vorab mental gegeben ist. Was also wird bedeutet? Eine handlungstheoretische Semantik ist eine Theorie des Bedeutungshandelns: Wir machen sprachliche Handlungen auf der Basis gemeinsamer Regeln so, dass wir da‐ bei zum Ausdruck bringen, dass wir sie machen. Unser sprachliches Handeln lässt sich auf der obersten Ebene als das Ausführen von Sprechakten beschreiben. Sprech‐ akte zu machen heißt, Bewirkungsabsichten zum Ausdruck zu bringen. Dies ge‐ schieht durch Prädikationshandlungen, also durch Prädikationen über Gegenstände der Bezugnahme. Wir machen diese Prädikationshandlungen regelhaft so, dass wir dadurch nachvollziehbar bedeuten, was wir worüber sagen und mit welcher Bewir‐ kungsabsicht wir das machen. Was traditionell Bedeutung, Inhalt, Gedanke oder Sinn genannt wird, ist also nur im prädikativen Handeln gegeben sowie in dessen verstehendem Nachvollzug. Verstehen besteht im Wesentlichen darin, diese auf der Grundlage gemeinsamer Re‐ geln gemachten und dadurch erkennbaren sprachlichen Handlungen mitspielend nachzuvollziehen. Obwohl das Prädikationsspiel hochgradig geregelt ist, tun sich für den verstehenden Nachvollzug erhebliche konventionelle Lücken auf, die durch ständigen pragmatischen Aufwand kompensiert werden müssen. In der dargestellten handlungstheoretischen Semantik sind Syntax, Semantik und Pragmatik nicht mehr alternative und voneinander unabhängige Ansätze der Sprachbeschreibung. Gegenstandsbereich der Semantik sind die Regeln des sprachli‐ chen Handelns. Die syntaktischen Regeln sind ein wesentlicher Teil dieser Hand‐ lungsregeln. Die Pragmatik beschreibt den verstehensrelevanten, aber konventionell nicht ausreichend zum Ausdruck gebrachten Teil des Bedeutungshandelns. Weil Zeit und Aufmerksamkeit kostbare Ressourcen sind, wird das Prädikationsspiel auf vielfältige Weisen beschleunigt. Mehrere Prädikationshandlungen werden dann nicht explizit und in einfachen Sätzen nacheinander gemacht, sondern gleichsam auf einmal durch rekursive Einbettungen in den verschiedensten attributiven und ad‐ verbialen Formen, oft in elliptischen Kurzformen und mit Satzwörtern. Zusätzlich 208 werden noch komprimierende Wortbildungen verwendet. Spiegelbildlich zum spre‐ cherseitig angestrebten Effizienzgewinn durch elliptische Einbettungen und andere komprimierte Ausdrucksformen erhöht sich rezeptionsseitig der Erschließungsauf‐ wand. In demselben Ausmaß erhöht sich die Gefahr von Verstehensproblemen und Missverständnissen. Wer das Prädikationsspiel spielen kann, weiß auch als Rezipient, was gespielt wird. Er ist deshalb prinzipiell in der Lage zu erkennen, was worüber mit welcher Bewir‐ kungsabsicht gesagt wird. Dennoch ist für dieses Verstehen fast immer ein mehr oder weniger großer pragmatischer Erschließungsaufwand Voraussetzung. Verste‐ hen geht nie automatisch, allenfalls automatisiert. Das Prädikationsspiel zum Ausdruck von Bewirkungsabsichten wird in allen Spra‐ chen gespielt, auch wenn seine phonologischen, morphologischen und grammati‐ schen Realisierungsformen einzelsprachlich völlig unterschiedlich sein können. Aber hinter der Vielfalt der einzelsprachlichen Varianten zeigen sich strukturelle Gemein‐ samkeiten der Prädikationsspiele, die zu Rückschlüssen auf gemeinsame kognitive Voraussetzungen Anlass geben könnten. 209 9. Von der traditionellen Semantik zur Gebrauchstheorie In diesem Anhang möchte ich – um den Ausgangspunkt dieser Arbeit zu erklären ‐ in aller Kürze die Gründe zusammenfassen, warum traditionellen Bedeutungstheorien aufgegeben werden mussten, und welche Vorschläge Wittgenstein für die von ihm geforderte Gebrauchs‐ theorie gemacht hat. Diese Vorschläge waren Ausgangspunkte für die oben entwickelte Theo‐ rie des Bedeutungshandelns. Man könnte annehmen, dass die Ausdrücke, die wir beim sprachlichen Kommuni‐ zieren verwenden, so etwas wie eine Bedeutung haben. Fragt man aber, worin denn genau die Bedeutungen von Sätzen oder sprachlichen Ausdrücken bestehen könnten, beginnen die Schwierigkeiten. Gibt es etwas, was als Bedeutung bezeichnet werden könnte, und wie ließe es sich beschreiben? Mit dieser Frage ist schon das Arbeitsfeld der herkömmlichen Semantik umrissen, die sich als Lehre von der Bedeutung sprachlicher Zeichen bzw. sprachlicher Aus‐ drücke versteht. Die traditionellen Semantiken oder semantischen Theorien geraten bei der Beantwortung dieser Fragen recht schnell in erhebliche Schwierigkeiten. Wenn man sagt, Ausdrücke, Sätze oder Äußerungen bedeuteten etwas, nimmt man an, dass es so etwas wie Bedeutung gebe und dass diese Bedeutung etwas anderes sei als der Ausdruck selbst. Seit der Mitte des 20. Jahrhunderts wurde jedoch immer klarer, dass alles, was man den sprachlichen Ausdrücken als vermeintliche Bedeu‐ tungen gegenüberstellte, seien es Gegenstände, Vorstellungen oder Gedanken usw., zu theoretischen Widersprüchlichkeiten und unhaltbaren Konsequenzen führt. Dass die Sprache einerseits und die Welt bzw. die Kognition auf der anderen Seite grundsätzlich getrennte Angelegenheiten seien, ist eine Grundannahme der traditio‐ nellen Bedeutungslehre. Seit der Antike galt als Zweck der Sprache vor allem, das Sprechen über die Dinge der Welt oder über unsere Vorstellungen von den Dingen der Welt zu ermöglichen. Die Bedeutung von Ausdrücken oder Sätzen sah man dementsprechend in Gegenständen, Tatsachen, Sachverhalten, Ideen oder mentalen Konzepten, als deren sprachliche Stellvertreter die Ausdrücke oder Sätze angesehen wurden. Sprachliche Ausdrücke haben demnach ihre Bedeutung dadurch, dass sie infolge gesellschaftlicher Übereinkunft materiellen oder mentalen Gegenständen zu‐ geordnet wären. Allen solchen Korrespondenz‐Theorien gemeinsam ist das Axiom, dass Ausdrücke etwas bedeuten, dass sie eine Bedeutung haben, und dass Bedeu‐ tungen und Ausdrücke einander irgendwie konventionsbedingt gegenüberstehen. Diese Auffassung wird durch einen bestimmten Gebrauch des zweiwertigen Verbs bedeuten nahegelegt: In der Formulierung 210 Ein Ausdruck bedeutet etwas. steht Ausdruck als Subjekt, das bedeutungsvolle etwas als Objekt. Entsprechend wird zwischen Ausdruck und Inhalt unterschieden. Und dieser Inhalt ist je nach Theorie z.B. eine Idee, eine Vorstellung, ein Gedanke usw. Traditionelle Bedeutungstheorien werden üblicherweise unterschieden in Refe‐ renztheorien (Gegenstandstheorien), Vorstellungstheorien und behavioristische The‐ orien. Referenztheorien gingen von der Tatsache aus, dass wir mit Wörtern über Gegenstände der Welt reden. Sie waren grundlegend für semantische Theorien, ins‐ besondere für logische Semantiken. Auf natürliche Sprachen bezogen führen sie in Schwierigkeiten. Eine davon ist beispielsweise: Wenn man annimmt, die Bedeutung von dieser Apfel sei ein bestimmter Apfel, dann könnte man die Bedeutung dieses Ausdrucks schneiden, reiben, essen oder wegwerfen. Zumindest diese Schwierigkeit kann man mit der weiter unten skizzierten Vorstellungstheorie umgehen, wenn man also statt der Gegenstände selbst Vorstellungen oder Ideen davon als Bedeutungen annimmt. Behavioristische Theorien wollten die problematischen Annahmen der Vorstel‐ lungstheorie, dass Bedeutungen mentale Entitäten seien, vermeiden und sprachliche Ausdrücke durch Beschreibung der durch sie hervorgerufenen Verhaltensreaktionen erklären. Diese Verhaltensweisen sollten streng naturwissenschaftlich beschrieben werden, also mit dem empirischen Beobachtungsvokabular der Physik, Chemie oder Biologie. Der Nachweis, dass bestimmte Ausdrücke bestimmte Reaktionen auslösen, scheitert aber schon im Ansatz: Oft führen sprachliche Äußerungen nicht zu be‐ obachtbaren Reaktionen. Und wo sie es tun, können die Reaktionen individuell sehr unterschiedlich sein. Es half wenig, dass zur Rettung des behavioristischen Ansatzes auch innere Prozesse als verursachte Reaktion bzw. Reaktionsdispositionen gelten sollten, also z.B. neuronale Ereignisse. Denn auch diese treten zum Teil gar nicht, zum Teil völlig unterschiedlich auf. Manche freuen sich über eine Aussage, andere bleiben ungerührt. Abgesehen von den nahezu unlösbaren Schwierigkeiten bei der differenzierten Erfassung neuronaler Ereignisse besteht ein grundsätzliches Problem: Selbst wenn es solche – nicht nur individuellen ‐ neuronalen Ereignisse gäbe und wenn sie durch moderne Hirnscans in eindeutiger Weise Ausdrucksäußerungen zu‐ geordnet werden könnten: Was wäre damit zur Erklärung der Bedeutung dieser Ausdrücke gewonnen? Abgesehen davon können bedeutungsrelevante beobachtbare äußere Reaktionen oder neuronale Ereignisse bei Personen, welche die betreffende Sprache nicht verste‐ hen, gar nicht eintreten. Daraus folgt zwingend, dass die Kenntnis und Anwendung sprachlicher, d.h. sozialer Regeln notwendige Voraussetzung für das Eintreten von 211 bedeutungsrelevanten Reaktionen ist, dass also ein naturwissenschaftlicher Determi‐ nismus für die Beschreibung von Sprache prinzipiell keine ausreichende Erklärung bieten kann. So erscheint denn das behavioristische Programm im Nachhinein eher als Science‐ Fiction denn als aussichtsreiches wissenschaftliches Projekt. Es war ja auch von sei‐ nen Vertretern eher als ein Zukunftsprojekt gedacht. Allerdings war der Grundge‐ danke richtig, dass sprachliche Handlungen wie allgemein kommunikative Hand‐ lungen auf das Erreichen von Folgen gerichtet sind. Irgendwelche Folgen von Äuße‐ rungen können aber – und das war der grundsätzliche Denkfehler im behavioristi‐ schen Ansatz – nur eintreten, wenn der Hörer die Regeln einer Sprache gelernt hat und dadurch die Äußerung in dieser Sprache verstehen kann. Von den traditionellen Bedeutungstheorien bleiben somit bis heute nur die mentalis‐ tischen Varianten erhalten, oft zusammenfassend auch als Vorstellungstheorie be‐ zeichnet. Auch diese geht von einem bestimmten Gebrauch des zweiwertigen Verbs bedeuten aus, dass nämlich sprachliche Ausdrücke in dem Sinne etwas bedeuten, dass den Ausdrücken – ob Wörtern oder Sätzen – etwas zugeordnet werden könne, worin ihre Bedeutung bestehe. Als dafür infrage kommende Entitäten werden bildli‐ che oder gedankliche Vorstellungen, Ideen, Begriffe, mentale Konzepte oder Proposi‐ tionen angesehen. Derartigen mentalen Entitäten würden in einer Sprachgemein‐ schaft nach einem dort zu erlernenden sozialen „Code“ sprachliche Ausdrücke zu‐ geordnet. Eine Sprache beherrschen hieße demzufolge, Zuordnungsregeln zwischen Ausdrücken und mentalen Einheiten zu kennen. Durch die gemeinsame Kenntnis solcher Zuordnungsregeln sei es möglich, Vorstellungen, Gedanken usw. in sprachli‐ che Ausdrücke zu „codieren“ und diese empfängerseitig in die gleichen Vorstellun‐ gen oder Gedanken zurück zu codieren. Sprache hätte in diesem Transportmodell lediglich kommunikative, nicht jedoch kognitive Funktion. Dass diese zum vorwissenschaftlichen Alltagsverständnis von Sprache gehörende Vorstellungstheorie so einleuchtend erscheint, liegt vielleicht auch an der Erfahrung, dass wir sprachliche Ausdrücke oft mit bildhaften Vorstellungen verbinden. Es ist oft so, dass wir ein Gesicht „vor uns sehen“, wenn wir einen Namen hören, und manchmal erinnern wir uns an das Bild irgendeines Bergsees, wenn wir „Bergsee“ hören. Trotzdem wurde in der philosophischen Diskussion seit Wittgenstein überzeugend nachgewiesen, dass die Vorstellungstheorie und das mit ihr verbundene Kommuni‐ kationsmodell nicht zutreffen können. Von den verschiedenen Einwänden lautet der erste, dass die fraglichen mentalen Einheiten in keinem Fall Bilder sein können. We‐ der beim Sehen noch beim Kommunizieren entstehen optische Bilder im Gehirn. 212 Denn sonst müsste eine zusätzliche Instanz, welche die Bilder im Gehirn sieht, ange‐ nommen werden. Diese müsste natürlich selbst wieder Augen haben und ein Gehirn, in dem sich die Problematik wiederholt.114 Bei vielen Wörtern und Sätzen sind bildliche (und unbildliche) Vorstellungen gar nicht möglich. Während man bei vielen Eigennamen, Substantiven und Verben si‐ cherlich individuelle Vorstellungen assoziieren kann, ist das bei Wörtern wie aber, in‐ zwischen oder nur nicht möglich. Und wie sähen wohl die Vorstellungen zu einem Satz wie Ehrlichkeit sollte selbstverständlich sein. aus? Hat irgendjemand eine Vorstellung zu Ehrlichkeit, sollen, selbstverständlich oder gar zu sein? Unter allen Einwänden gegen die Vorstellungstheorie ist aber der der gewichtigste Einwand der, dass sich der primäre Spracherwerb in ihrem Rahmen überhaupt nicht erklären lässt. Sprachen müssen ja gelernt werden. Das heißt, es müssen einzel‐ sprachliche Regeln ‐ z.B. für die Verwendung von Ausdrücken ‐ gelernt werden. In den mentalistischen Theorien wären das Regeln für die Zuordnung von Ausdrücken zu Vorstellungen, Ideen, mentalen Konzepten, Gedanken usw. Bisher konnte nie‐ mand erklären, wie solche Regeln gelernt werden könnten. Stellen wir uns einen Erwachsenen vor, der einen Ausdruck regelhaft verwendet. Wie sollte nun ein Lernender, etwa ein Kind, die zu der sprachlichen Äußerung ge‐ hörende Vorstellung „im Inneren“ des Sprechenden herausbekommen? Zum „Geist“ der Erwachsenen besteht ja kein unmittelbarer Zugang. Somit hat das Kind natürlich keine Möglichkeit, eine Regel für die Zuordnung des Ausdrucks zur angenommenen mentalen Bedeutung herauszufinden und zu lernen. Nun ist aber unbestritten, dass Kinder (und nicht nur sie) eine Sprache, ja sogar jede Sprache lernen können. Sie müssen es also offensichtlich ohne Zugang zu mentalen Entitäten bewerkstelligen. Wie sie das machen, hat bereits Wittgenstein relativ anschaulich gezeigt: Lernt ein Kind die Regel für den Gebrauch eines Ausdrucks, dann kann es nur nach äußeren Kriterien dafür suchen, wie Erwachsene den Ausdruck verwenden. Es lernt die Re‐ geln für Wörter wie rot oder stark eben nicht durch Zugang zu Vorstellungen, die Sprechende angeblich haben, sondern durch Beobachten der äußeren Bedingungen ihrer Verwendung und durch eigenes nachmachendes und erprobendes Anwenden. So lernt es beispielsweise, wann wir etwas als rot oder stark bezeichnen, ohne jemals Vorstellungen von Erwachsenen davon kennengelernt zu haben oder kennenlernen zu müssen. Eine „Vorstellung“ von Rot oder Stark zu haben, erweist sich somit als metaphorische Redeweise für „wissen, wann man etwas rot oder stark nennt“. 114 Vgl. Gerhard Roth, Das Gehirn und seine Wirklichkeit 1997, S. 92 ff. 213 Die Probleme der Vorstellungstheorie verschwinden auch nicht, wenn man als be‐ deutungstragende Gegenstücke sprachlicher Ausdrücke statt bildhafter Vorstellun‐ gen außersprachliche Gedanken annimmt. Gerade der Spracherwerb, also das Erler‐ nen von Bedeutungen, lässt sich weiterhin nicht erklären: Da Gedanken ebenso wie Vorstellungen von außen nicht zugänglich sind, muss das Lernen von Ausdrücken weiterhin ohne Bezug zu mentalen Elementen erfolgen. Das Kind kann nur auf äuße‐ re Kriterien der Verwendung von Ausdrücken achten, muss also Regeln des Ge‐ brauchs herauszufinden. Denn was ein Erwachsener angeblich außersprachlich denkt, wenn er von einer Tür redet oder wenn er eine Person als intelligent bezeich‐ net, kann man nicht herausfinden, wohl aber, wie er diese Ausdrücke verwendet, al‐ so die äußeren und beobachtbaren Kriterien der Anwendungen von Tür und intelli‐ gent. Das ist überhaupt der zentrale Punkt: Eine Sprache lernen kann niemals heißen: Ausdrücke für mentale Entitäten zu lernen. Selbst wer ein der Sprache vorgängiges Denken annehmen wollte, müsste einräumen: Eine Sprache lernen kann nur darin bestehen, an faktischen Verwendungen von Ausdrücken deren Anwendungsregeln zu erfassen. Irgendwelche mentalen Konzepte oder Unterscheidungen, und wären sie auch biologisch vorgegeben, sind für das induktive Lernen von Regeln prinzipiell irrelevant.115 Die Regeln müssen immer aus dem tatsächlichen Gebrauch der entspre‐ chenden Ausdrücke erschlossen und durch induktive Verallgemeinerung gelernt werden. Der Hauptfehler der Vorstellungstheorie ist ihre Prämisse, dass das, was in Sprache ausgedrückt wird, bereits außersprachlich, etwa im sprachunabhängigen Denken gegeben sei. Die Funktion der Sprache bestände nach dieser Auffassung also ledig‐ lich in der Übermittlung von Gedanken. Trotz ihrer Problematik ist ‐ wie schon ge‐ sagt ‐ die Auffassung, Denken sei generell etwas den natürlichen Sprachen Vorgän‐ giges und von ihnen Unabhängiges, nicht nur im Alltagsdenken weit verbreitet. In einer bestimmten kognitionswissenschaftlichen Richtung wird auch gegenwärtig ve‐ hement die Ansicht vertreten, dass unser Denken in einer universellen Sprache (auf „mentalesisch“) erfolge und erst anschließend in natürliche Einzelsprachen trans‐ formiert werde. Zum Beweis wird eine bestimmte alltägliche Situation beschrieben: „Die Vorstellung, Gedanken und Sprache seien ein und dasselbe, ist gewissermaßen eine konventionelle Absurdität. Eine Behauptung also, die dem gesunden Men‐ schenverstand völlig widerspricht, die aber alle für bare Münze nehmen (…) Denken Sie einmal darüber nach. Wir alle kennen die Situation, dass wir beim Schreiben oder Aussprechen eines Satzes plötzlich innehalten, weil wir merken, dass wir für das, was wir sagen wollten, nicht die richtigen Worte gefunden haben. Dieses Gefühl ist 115 Vgl. dazu die Ausführungen zum paradigmatischen Lernen in Kap. 2. 214 aber nur möglich, wenn der Gedanke und das Gesagte nicht identisch sind. Zuweilen ist es furchtbar schwierig, einen Gedanken überhaupt in Worte zu kleiden.“116 Eine erste Ahnung, warum diese dem Anschein nach durchaus plausibel wirkende Ansicht problematisch ist, bekommt man schon, wenn man sich die folgende, nicht ganz unbekannte Begebenheit vergegenwärtigt: Im 17. Jahrhundert suchten Gelehrte der Académie française nach einer Erklärung für das Rätsel, warum das Französische im Vergleich zu allen anderen Sprachen eine so erfreuliche und einzigartige gedank‐ liche Klarheit aufwies. 1669 fand Louis Le Laboureur endlich den Grund: In seinen grammatischen Untersuchungen führte er den Beweis, dass „wir Franzosen“, anders als die Sprecher anderer Sprachen, „in allen unseren Äußerungen genau der Ord‐ nung der Gedanken folgen, welche diejenige der Natur ist“.117 Le Laboureur ging al‐ so im Sinne der Vorstellungstheorie von der Tatsache eines natürlichen vorsprachli‐ chen Denkens aus, das durch Sprache lediglich kommunikativ nach außen übermit‐ telt wird. Die Überlegenheit des Französischen sah er darin, dass es auf verblüffende Weise eine einzigartige Isomorphie mit dem durch die Natur vorgegebenen Denken aufweise. Selbst ausgesprochen frankophile Menschen erkennen recht schnell den geradezu humoristisch anmutenden Denkfehler, der sich hier offenbart. Sie geben zu, dass z.B. auch Türken und Chinesen für ihre Sprachen in Anspruch nehmen könnten, dass diese in besonders gelungener Weise zum Denken passten. Umgekehrt könnten bestimmte Sprachen als besonders denkwidrig eingestuft werden: Wenn sie so dächten wie Le Laboureur, dann müsste beispielsweise aus der Sicht von Angel‐ sachsen die türkische Sprache in krassem Widerspruch zur natürlichen Ordnung des Denkens stehen, denn im Türkischen werden aus deren Sicht die Elemente im Satz nahezu vollkommen rückwärts angeordnet – also genau entgegengesetzt, wie „man“ denkt. Das Türkische müsste somit als ein ungemein wirksames Mittel zur Behinde‐ rung des Denkens eingestuft werden. Umgekehrt schiene auch für Türken die engli‐ sche Satzgliedfolge das Denken fast vollkommen auf den Kopf zu stellen. Offensicht‐ lich denken Türken und Amerikaner in einer unterschiedlichen sprachlichen Reihen‐ folge. Dass für jeden die eigene Sprache für das Denken so vorteilhaft erscheint, liegt ganz offensichtlich daran, dass das gewohnte und hier gemeinte Denken offensicht‐ lich in der jeweiligen Sprache erfolgt. 116 Pinker, 1996, 67 f. Grundsätzlich ist Pinkers Behauptung ebenso wenig wie jede andere Erklärung durch empirische Beobachtungen zu belegen. Denn wie Untersuchungen einsichtsvollen Denkens na‐ helegen, sind Menschen nicht in der Lage, die tatsächliche Qualität ihrer subpersonalen Prozesse zu beobachten. Wenn ein Wort, das wir suchen, plötzlich „auftaucht“, können wir nichts darüber sagen, wie wir es gesucht oder gefunden haben. Was wir letztlich darüber sagen können, ist eine Angelegen‐ heit theoretischen Schließens. Vgl. Prinz 2013, 53 ff. 117Le Laboureur, Avantages de langue françoise sur la langue latine. Paris Guillaume de Luyne. 1669. Zitiert nach Deutscher 2010, 13 215 Die obige kleine Geschichte bietet einen ersten Hinweis darauf, dass die Prämisse der Vorstellungstheorie nicht ganz richtig sein kann, dass wir also nicht so einfach sprachunabhängig denken und dies dann Sprache übersetzen, sondern dass das Ge‐ sagte und das Gedachte zumindest stark miteinander zusammenhängen. (Daraus sollte natürlich nicht gefolgert werden, dass jedes Denken sprachlicher Art ist.) Weil das mit Sprache zum Ausdruck Gebrachte nicht einfach schon außersprachlich gege‐ ben ist, wird auch das bekannte Kommunikationsmodell, das auf der Vorstellungs‐ theorie beruht, hinfällig. Es beruht ja auf der Annahme, es gebe vor‐ oder außer‐ sprachliche Gedanken und einen sozialen Code, wonach wir diese vorsprachlichen Gedanken in sprachliche Ausdrücke verschlüsselten und umgekehrt sprachliche Ausdrücke in Gedanken decodierten. Ein Code wäre nun aber eine Art genereller Regel, wonach die Elemente der einen Menge (Gedanken) den Elementen der ande‐ ren Menge (Wörter) zuzuordnen wären – und umgekehrt. Obwohl alle sprechenden Menschen angeblich einen solchen Code benutzen, wurde eine solche Zuordnungs‐ regel aber bisher nicht entdeckt. Für keine Sprache der Welt gibt es eine Formulie‐ rung oder Beschreibung davon, weder in linguistischen, philosophischen noch neu‐ robiologischen Werken. Und auch in Zukunft werden uns mit Sicherheit Schlagzei‐ len wie „Der Code des Deutschen ist entdeckt“ oder „Der Code des Chinesischen wurde entschlüsselt“ vorenthalten bleiben. Wahrscheinlich nehmen die Vertreter des fraglichen Kommunikationsmodells statt eines Codes eher die Möglichkeit einer Art von Übersetzungslexikon an, in dem in der einen „Spalte“ Gedanken oder die Elemente des mentalen Lexikons verzeichnet wären, in einer gegenüberliegenden Spalte die entsprechenden sprachlichen Ausdrü‐ cke – oder umgekehrt. Die Gedanken stünden vorsprachlich fest und ihnen würden in jeder Sprache eben andere Ausdrücke zugeordnet. Dass an diesem Kommunikationsmodell nicht viel stimmen kann, wird schnell deut‐ lich: Denn wie könnten Gedanken für Wörter der Art Globalisierung, Intoleranz, Tablet oder Flughafen angeboren oder sprachlos erworben sein? Sie müssten also gelernt werden. Könnte das ohne die zugehörigen Ausdrücke geschehen? Und was könnte denn in dem Übersetzungslexikon in der Spalte „Gedanken“ ste‐ hen? Was stünde dort etwa als Bedeutung des Wortes Sieger? Der Gedanke „Sieger“? Oder was stünde einem Satz wie Japan gewinnt sensationell den WM‐Titel. in der Gedankenspalte anderes gegenüber als „der Gedanke, dass Japan sensationell den WM‐Titel gewinnt“? Hier wird die tautologische bzw. zirkuläre Selbstbenebe‐ lung der mentalistischen Theorie überdeutlich: Um die Bedeutung sprachlicher Aus‐ drücke zu beschreiben, wird auf Gedanken verwiesen, die selbst wiederum nur mit 216 diesen Ausdrücken vorhanden oder mit ihnen beschreibbar sind. Der Vorstellungs‐ theorie nach müssten uns die Bedeutungen von Ausdrücken oder Sätzen ja auf Men‐ talesisch, also in der angeborenen Sprache des Denkens, zur Verfügung stehen. Dass dies nicht der Fall ist, liegt wohl daran, dass ein nicht unerheblicher Teil des Denkens nur in der jeweiligen gelernten Sprache möglich ist. Der Versuch, eine einfache Mul‐ tiplikation wie 8 x 12 einfach auf Mentalesisch ohne die entsprechenden Zahlwörter zu denken oder zu rechnen, ist ebenso zum Scheitern verurteilt wie derjenige, einen Satz wie Die EU‐Kommission will Agrarpreissubventionen senken. sprachunabhängig zu denken. Die von der Vorstellungstheorie zur Erklärung von Sprache bzw. Bedeutung ange‐ nommenen außersprachlichen Gedanken oder mentalen Einheiten sind also theore‐ tisch nicht plausibel und bis heute empirisch auch nicht beschreibbar, weder linguis‐ tisch noch philosophisch und auch nicht mit Methoden der Neurobiologie.118 Selbst wenn – in spätem Gefolge der behavioristischen Bedeutungstheorie ‐ den Verwen‐ dungen sprachlicher Ausdrücke verlässlich und eindeutig neuronale Ereignisse zu‐ geordnet werden könnten, wäre für die Bedeutungstheorie nichts gewonnen: Die „Sprache“ des Gehirns ist nämlich die „Sprache“ der Membran‐ und Aktionspotenti‐ ale, der Neurotransmitter und Neuropeptide. Sie ist lediglich erfassbar in quantitativ messbaren chemischen und elektrischen Signalen, die unspezifisch gegenüber ir‐ gendwelchen Inhalten und in diesem Sinn neutral sind.119 Unser Verständnis sprach‐ licher Ausdrücke würde in keiner Weise gewinnen, wenn ihnen beschreibbare oder messbare neuronale Zustände oder Ereignisse zugeordnet werden könnten. Um eine Äußerung zu verstehen, bringt der Blick ins Gehirn nichts. Dort ist nicht zu finden, was der Sprechende meint. Dieses Verständnis sprachlicher Ausdrücke beruht allein auf unseren Kenntnissen, wie wir sie verwenden. Auch die Annahme, es gäbe eine „Sprache“ des Denkens, ist nicht plausibel. Es drängt sich die Frage auf, warum wir eigentlich nicht gleich in der Sprache unseres Denkens sprechen. So könnten wir alle dieselbe kognitiv fundierte Sprache verwen‐ den, Übersetzungen in Einzelsprachen und zwischen diesen wären nicht mehr nötig. Aber noch nie hat jemand mentalesisch gesprochen oder jemanden mentalesisch sprechen gehört. Also wäre dieses Mentalesisch die einzige Sprache, die von nie‐ mandem gesprochen wird. Gesprochen werden ja dieser Theorie nach nur dessen jeweilige einzelsprachliche „Übersetzungen“. Und weil die Sprache des Denkens Führende Neurowissenschaftler vertreten derzeit die Meinung, dass nicht einmal einzelnen Wör‐ tern und erst recht nicht ganzen Sätzen eineindeutig neuronale Ereignisse zugeordnet werden können, derzeit nicht und wahrscheinlich prinzipiell nicht. Vgl. Friederici 2014. 119 Vgl. Roth 1997, S. 93, S. 100 ff. 118 217 nicht gesprochen wird, wäre sie auch die einzige Sprache, die folglich nicht gelernt werden kann. Kann aber eine „Sprache“, die niemand spricht und die deshalb nie‐ mand lehren oder lernen kann, sinnvoll als Sprache bezeichnet werden? Nach dem bisher Dargestellten sollte plausibel sein, dass die Erklärung von Bedeu‐ tung durch Verweis auf Außersprachliches nicht funktionieren kann: Niemand von uns kodiert seine Gedanken in Sprache. Jeder spricht in der Sprache, in der er auch denkt – und umgekehrt.120 Obwohl die Vorstellungstheorie längst ad acta gelegt sein sollte, führen sie und das auf ihr basierende Kommunikationsmodell, das so etwas wie kodierende „Sender“ und dekodierende „Empfänger“ annimmt, bis heute selbst im universitären Raum ein erstaunlich robustes Dasein. Warum? Ein wichtiger Grund für die nach wie vor bestehende Popularität mentalistischer Theorien könnte sein, dass die theoretische Alternative schwer zugänglich bzw. noch gar nicht zusammenhängend formuliert ist. Semantische Theorien, die die Fehler der traditionellen Bedeutungstheorien ver‐ meiden wollen, gehen überwiegend von der programmatischen Empfehlung des späten Wittgenstein aus, wonach statt der ominösen Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks im Allgemeinen sein tatsächlicher Gebrauch in der Sprache betrachtet werden sollte. Das heißt, dass hier der Sinn sprachlicher Ausdrücke nicht außerhalb der Sprache, etwa im Kopf, sondern allein im sprachlichen Handeln bestimmbar wird. Wie aber die sogenannte Gebrauchstheorie als ausgearbeitete Semantiktheorie aus‐ sehen könnte, blieb bei Wittgenstein weitgehend unbestimmt. Seine diesbezügliche Unzufriedenheit formulierte er 1945 im Vorwort seiner „Philosophischen Untersu‐ chungen“: „Ich hätte gerne ein gutes Buch hervorgebracht: Es ist nicht so ausgefallen; aber die Zeit ist vorbei, in der es von mir verbessert werden könnte.“ Seitdem ist oft genug festgestellt worden, dass Wittgenstein keine semantische Theorie entwickeln Natürlich lässt sich Pinkers eingangs zitiertes Gedankenexperiment auch ohne mentalesisches Pa‐ ralleluniversum erklären: Tatsächlich haben wir manchmal das Gefühl, dass wir noch nicht den pas‐ senden Ausdruck gefunden haben. Wie könnten wir nach erfolgreichem Suchen wissen, ob der Aus‐ druck passt, wenn wir nicht den entsprechenden Gedanken schon vorsprachlich hätten? Wenn man den Nebel der Vorstellungstheorie weggeblasen hat, wird erkennbar, dass uns in solchen Fällen nicht nur der Ausdruck, sondern genauso der Gedanke fehlt. Wir erinnern uns aber, dass wir zu dem für uns momentan gedanklich und sprachlich nicht klar bestimmbaren „Gegenstand“ einen Ausdruck gelernt haben. Dessen Auftauchen lässt uns schlagartig den diesem Gegenstand angemes‐ senen – zwangsläufig in Sprache formulierten ‐ Gedanken gewinnen. Wer den richtigen Ausdruck sucht, erinnert sich daran, einen momentan nicht präsenten sprachlichen Ausdruck oder sprachlich formulierten Gedanken zu kennen, welcher der Situation bzw. dem fraglichen Gegenstand gerecht wird. Es genügt auch, das Pinker‐Experiment einfach umzukehren: Man nehme einen klar verständlichen Satz und versuche ihn außersprachlich – also ohne jegliche sprachliche Ausdrücke ‐ zu denken. Das Suchen nach dem richtigen mentalesischen Ausdruck kann da ganz schön lange dauern. 120 218 konnte. Immerhin wurden verschiedene seiner Überlegungen für weiterführende Ansätze genutzt. Je nachdem, auf welche Hinweise Wittgensteins man sich stützte, haben sich mindestens drei verschiedene Lesarten von „Gebrauch“ herausgebildet: der wahrheitsfunktionale (Gebrauch I), der Gebrauch im Sinne regelgeleiteter Sprachspiele (Gebrauch II) und der Gebrauch im Sinne instrumenteller oder intenti‐ onaler Verwendung (Gebrauch III). Die in diesem Buch vorgestellte handlungstheo‐ retische Semantik ist der Versuch, die drei Ansätze systematisch zu verbinden. Wichtig ist, dass keiner dieser Ansätze nach Bedeutungen sucht oder solche be‐ schreiben will. Gemeinsam ist allen drei Richtungen vielmehr, dass der substantivi‐ sche Ausdruck Bedeutung aus der Theorie verschwindet. Das Verb bedeuten wird ja meist nur nach dem Muster Der Ausdruck A bedeutet X verwendet, wobei ein Ausdruck A etwas Nichtsprachliches bedeutet, etwa eine Idee oder Vorstellung X. Gebrauchstheorien verzichten auf diese Dopplung und die Kon‐ struktion eines außersprachlichen Universums zum Zweck der Sprachbeschreibung. Deshalb entfallen bei ihnen neben Bedeutung auch solche Termini wie Inhalt oder In‐ haltsstruktur. Zu Gebrauch I finden sich Bestimmungen bereits im Tractatus. Ausgehend von dem Sinnkriterium „Einen Satz verstehen, heißt, wissen was der Fall ist, wenn er wahr ist“121 wird dort der Gebrauch eines Ausdrucks im Hinblick auf die Wahrheitsbedin‐ gungen für das Zusprechen erläutert: „Um aber sagen zu können, ein Punkt sei schwarz oder weiß, muss ich vorerst wissen, wann man einen Punkt schwarz und wann man ihn weiß nennt“.122 Damit werden Prädikationsregeln als ein erster Typ von Gebrauchsregeln eingeführt. Einen prädizierbaren Ausdruck verwenden können heißt, die Bedingungen kennen, unter denen er mit Wahrheit zugesprochen werden kann. In den späteren Philosophischen Untersuchungen sind solche Prädikationsregeln am Beispiel von Farbadjektiven näher erläutert und es werden verschiedene Metho‐ den des Lehrens und Lernens solcher Regeln thematisiert. Gebrauch II beruht vor allem auf der im Spätwerk eingeführten Sprachspielmeta‐ pher: „Wie viele Arten der Sätze gibt es aber? Etwa Behauptung, Frage und Befehl? Es gibt unzählige verschiedene Arten der Verwendungen alles dessen, was wir „Zei‐ chen“, „Worte“, „Sätze“ nennen ... Das Wort „Sprachspiel“ soll hier hervorheben, dass das Sprechen einer Sprache ein Teil ist einer Tätigkeit, oder einer Lebens‐ form.“123 Als Beispiele für die Mannigfaltigkeit der Sprachspiele werden u.a. genannt: Wittgenstein 1922, 4.024. a.a.O., 4.063. 123 Wittgenstein 1953, 23. 121 122 219 Befehlen und nach Befehlen handeln, Beschreiben eines Gegenstandes, Berichten, Vermutungen anstellen, Theater spielen, einen Witz machen, Bitten, Danken, Flu‐ chen, Grüßen, Beten. Die Sprachspielmetapher beruhte auf der Vermutung, dass sprachliche Handlungen wie die oben genannten analog zu Spielhandlungen durch Regeln konstituiert seien. Gebrauch II wurde zur Ausgangshypothese der Sprechakt‐ theorie. Über Gebrauch II und das damit verbundene Thema Regeln wurde in der neueren Sprachphilosophie eine schier unüberschaubare Diskussion geführt. Im Vergleich dazu fanden erstaunlicherweise Wittgensteins Bemerkungen zu Gebrauch III lange Zeit weniger Beachtung. Andeutungen zu Gebrauch III finden sich in Stellen, in de‐ nen der zweckorientierte Charakter der Sprache hervorgehoben wird. Die Betonung des Werkzeugcharakters der Sprache kommt vor allem zum Ausdruck in der metho‐ dischen Aufforderungen „Sieh den Satz als ein Instrument an, und seinen Sinn als seine Verwendung“124. Gebrauch III hat einen assoziativen Bezug zu behavioristi‐ schen Theorien, wurde aber vor allem zur Ausgangshypothese intentionaler Hand‐ lungstheorien. Ihnen zufolge ist es der Verwendungszweck sprachlicher Ausdrücke, mit ihrer Äußerung etwas zu verstehen zu geben (to give someone to understand some‐ thing), ungefähr im Sinn des veralteten „jemandem etwas bedeuten“, ihm etwas deutlich zu machen, wie etwa in der Formulierung „er bedeutete ihm, zu gehen“. Der Partner soll aber nicht nur verstehen, was ihm bedeutet wird, sondern es soll auch etwas bei ihm bewirkt werden, etwa, dass er zu einer bestimmten Handlung veranlasst wird. Damit ist der entscheidende Ansatzpunkt der gebrauchstheoretischen Semantik an‐ gesprochen: Es sind nicht Ausdrücke, die etwas bedeuten, sondern es sind kommu‐ nizierende Menschen, die mit Ausdrücken etwas bedeuten. Und dieses Etwas sind keine mentalen Entitäten, sondern selbst wiederum sprachliche Handlungen, die wir so machen, dass diese als solche verstanden werden: Vereinfacht gesagt bedeuten wir als Sprecher immer auch, was wir sprachlich tun: Wir bedeuten, worauf wir Be‐ zug nehmen und was wir darüber sagen und mit welchen Absichten im Hinblick auf die Zuhörer wir das tun. Wir tun es auf regelhafte Weise so, dass die Partner nach‐ vollziehen können, dass wir es tun und erkennen, was wir damit bewirken wollen. Und nur durch dieses Verstehen können die angestrebten Wirkungen erreicht wer‐ den. Die entscheidende Wendung zum Programm einer handlungstheoretischen Semantik erfolgt also durch einen anderen Gebrauch des Verbs bedeuten: Bei dem traditionell verwendeten zweiwertigen bedeuten nach dem Muster Der Ausdruck A bedeutet X a.a.O. 421. 124 220 sind es Ausdrücke, denen Bedeutungen zugeschrieben werden. Diese Annahme ist, wie wir seit Wittgenstein wissen, mit unlösbaren Problemen verbunden. In einer handlungstheoretischen Semantik wird bedeuten dreistellig verwendet wie in dem Satz Claire bedeutet ihm, dass das Dorf jetzt leer sei.125 In derartiger Verwendung ist bedeuten ein Handlungsverb, etwa im Sinne von jeman‐ dem etwas zu verstehen geben. Semantik als Bedeutungstheorie ist in diesem Sinn die Lehre, wie wir mit sprachlichen Zeichen (Ausdrücken) einander etwas bedeuten, al‐ so zu verstehen geben. Genau in diesem Sinn ist der Titel dieses Buches gemeint. Eine solche absichtsvolle Verwendung des dreiwertigen bedeuten findet sich heute noch am ehesten in literarischen Werken, wie dieser Satz in Ursula Krechels Landgericht, S. 20. 125 221 10. Anhänge: Anhang 1: Pragmatische Aspekte des Verstehens – Analyse eines journalistischen Textes Das Geheimnis, ein Menschenrecht (Aus: DIE ZEIT vom 09.04.2015. Die folgenden Sätze sind der Anfang eines längeren Artikels der Journalistin Evelyn Finger, in dem es um die Frage geht, ob die Schweigepflicht für bestimmte Berufs‐ gruppen wie Ärzte oder Pfarrer aufgehoben werden darf.) Eigentlich hätte William Whitaker sofort aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Aber dann wären jene 102 Passagiere abgestürzt, die der Pilot durch ein halsbrecherisches Flug‐ manöver vor dem Absturz bewahrte. Jeder Therapeut hätte Whitaker als Sicherheitsrisiko ein‐ gestuft: Er trank vor dem Flug, er trank während des Fluges, er kokste und schlief kaum. Trotzdem rettete er, als seine Maschine in Turbulenzen geriet, geistesgegenwärtig Besatzung und Passagiere. Wie können die Sätze dieses Textes vom Leser verstanden werden? Genauer: Wie kann der Leser die mit diesem Text zum Ausdruck gebrachten Bedeutungshandlun‐ gen nachvollziehen? Sprachliche Bedeutungshandlungen zu verstehen heißt zu erkennen: ‐ worauf Bezug genommen wird, ‐ was darüber mit welcher Bewirkungsabsicht gesagt wird. Das wäre ohne die gemeinsamen Regeln des Prädikationsspiels gar nicht möglich. Unverzichtbar aber ist meist ein erheblicher pragmatischer Erschließungsaufwand, der für diesen Nachvollzug geleistet werden muss. Diesem pragmatischen Aspekt des Verstehens gilt in der folgenden Beschreibung das Augenmerk. Die konventionellen Aspekte des Bedeutungshandelns wie etwa die Strukturanzeige durch Kasus, Numerus, Genus usw. sowie die metaprädikativen Bedeutungshandlungen der Temporaldeixis und der Anzeige der Bewirkungsabsich‐ ten usw. werden ausgeblendet. 222 Der Text als Folge von Sprechakten Welche Bewirkungsabsichten will die Verfasserin zu verstehen geben? Im Wesentli‐ chen ist das Erkennen von Bewirkungsabsichten ein konversationelles Geschäft, auch wenn mit illokutiven Indikatoren grobe Hinweise gegeben werden (vgl. S. 63 ff.). Die im zitierten Abschnitt gewählten Satzformen legen eine feststellende Absicht nahe: ‐ Die Autorin hält wohl für wahr, was sie sagt. ‐ Sie möchte, dass der Leser dies erkennt. ‐ Sie möchte höchstwahrscheinlich bewirken, dass er die Sätze ebenfalls für wahr hält. Der Leser kann sich besonders an der indikativischen Form der Sätze 4 und 5 (siehe unten) orientieren. Auch der Konjunktiv II der Vergangenheit in 1‐3 ist im Kontext letztlich nur deskriptiv zu deuten. Andere Bewirkungsabsichten, wie etwa appellati‐ ve oder expressive, lassen sich nicht erschließen. Deshalb können, wenngleich nicht vollständig sicher, deskriptive Bewirkungsabsichten angenommen werden. Für die weitere Analyse des Abschnittes nummeriere ich die Sätze der besseren Übersichtlichkeit wegen. Satz 1 1. Eigentlich hätte William Whitaker sofort aus dem Verkehr gezogen werden müs‐ sen. (2. Aber dann wären jene 102 Passagiere abgestürzt, die der Pilot durch ein halsbrecherisches Flugmanöver vor dem Absturz bewahrte. 3. Jeder Therapeut hätte Whitaker als Sicherheitsrisiko eingestuft: 4. Er trank vor dem Flug, er trank während des Fluges, er kokste und schlief kaum. 5. Trotzdem rettete er, als seine Maschine in Turbulenzen geriet, geistesgegenwärtig Besatzung und Passagiere.) Spannend wird dieser erste Satz für den Leser vor allem durch den notwendig wer‐ denden pragmatischen Erschließungsaufwand. ‐ Bezugnahme: Wer ist William Whitaker? Eigennamen werden ja nicht nach Wahrheitsbedingungen gebraucht, sondern durch Verknüpfung mit empiri‐ schen Daten oder Aussagen (vgl. S. 103 ff.). Die Autorin hat ein wahrschein‐ lich nicht unerhebliches empirisches Wissen über William Whitaker. Einiges davon erwähnt sie in den anschließenden Sätzen. Der Leser aber, wenn er 223 nicht zufällig etwas über den Namensträger weiß ‐ etwa weil er den Film Flight gesehen hat ‐, kann die Bezugnahme allenfalls vage nachvollziehen. Wahrscheinlich kann er mithilfe seines Wissens zumindest aus dem Namen erschließen, dass es sich um einen Mann aus dem angelsächsischen Sprach‐ raum handeln dürfte. ‐ Prädikation: Die Prädikation von aus dem Verkehr ziehen über die mit William Whitaker bezeichnete Person ist deshalb nicht recht verständlich: Wenn der Le‐ ser noch nicht weiß, wer oder was William Whitaker war, ist nämlich auch unklar, was mit aus dem Verkehr ziehen gemeint ist. Offen bleibt, ob William Whitaker z.B. als Motorrad‐ oder Autofahrer usw. ein Fahrverbot oder ob er beispielsweise als Immobilienhändler, Kaninchenzüchter, Lehrer oder Arzt ein Berufsverbot hätte bekommen müssen. ‐ Die temporale Sachverhaltsbestimmung mit sofort bleibt ebenfalls vage, denn ein Zeitpunkt, auf den sich sofort bezieht, ist kontextuell nicht eingrenzbar. ‐ Ellipse: Eine weitere Verständnisschwierigkeit entsteht durch die passivische Formulierung, bei der das Subjekt des Aktivsatzes entfällt: Wer denn hätte Whitaker aus dem Verkehr ziehen müssen und in welcher Hinsicht? Etwa als Fahrradfahrer, als Pilot, als Hundehalter oder Arzt? Somit wird hier wohl eine eher vage Substitution der Latenz erfolgen, etwas im Sinne von „jemand, der dafür zuständig ist“. Somit dürfte der verstehende Nachvollzug von Referenz und Prädikation, also der gesamten mit 1 gemachten und regelhaft bedeuteten Prädikationshandlung, bei den meisten Lesern eher vage sein. Anders gesagt: Trotz erheblichen Erschließungsauf‐ wandes wird in vielen Fällen ein auch nur annähernd vollständiger Nachvollzug al‐ ler Wahrscheinlichkeit nicht gelingen. Für den ersten Satz eines längeren Artikels ist das aber eine optimale Ausgangssitua‐ tion: Der Leser ist sozusagen gezwungen weiterzulesen, in der Hoffnung, die Lücken füllen zu können. 224 Satz 2 (1. Eigentlich hätte William Whitaker sofort aus dem Verkehr gezogen werden müssen.) 2. Aber dann wären jene 102 Passagiere abgestürzt, die der Pilot durch ein halsbre‐ cherisches Flugmanöver vor dem Absturz bewahrte. (3. Jeder Therapeut hätte Whitaker als Sicherheitsrisiko eingestuft: 4. Er trank vor dem Flug, er trank während des Fluges, er kokste und schlief kaum. 5. Trotzdem rettete er, als seine Maschine in Turbulenzen geriet, geistesgegenwärtig Besatzung und Passagiere.) Auch hier ergibt sich für den Leser über den per Regeln nachvollziehbaren Bereich hinaus ein nicht unerheblicher Rechenaufwand: ‐ Satzwörter: Satz 2 wird durch zwei Sachverhaltskommentare mit aber und dann eingeleitet. Der Gebrauch solcher Satzwörter ist konventionell gesichert. Trotzdem entsteht zumindest bei dann eine Unklarheit: Mit dem Satzwort dann wird ein zeitlicher oder kausaler Folgezusammenhang festgestellt. Das hypothetisch Vorgestellte (der Absturz) wäre als Folge passiert. Aber als Folge wovon? Der Leser muss die Voraussetzung dieser hypothetischen Folge er‐ schließen. Dafür kommt nur das in Satz 1 als irreal erwähnte Geschehen in Frage, etwa in dem Sinn: „Wenn William Whitaker aus dem Verkehr gezogen worden wäre, dann …“. Erschließbar ist also: Wenn William Whitaker aus dem Verkehr gezogen worden wäre, wäre die Maschine mit ihren Passagieren abgestürzt. Nicht gesagt ist bisher, wieso dieser Folgezusammenhang besteht. Was hat William Whitaker mit der Vermeidung des Absturzes zu tun? War er ein helfender Passagier oder vielleicht ein Fluglotse? War er Copilot oder gar Pilot. William Whitaker muss jemand sein, der etwas mit der Vermeidung des Absturzes zu tun hatte – auf welche Weise auch immer. ‐ Bezugnahmen: Unklar ist zunächst die Kennzeichnung jene 102 Passagiere. Ist die Rede von Passagieren eines Zuges oder eines Busses? Nur durch den Kon‐ text innerhalb des Satzes (abgestürzt, Pilot, Flugmanöver) wird klar, das Passa‐ giere eines Flugzeuges gemeint sein müssen. Unklar ist auch die Bezugnahme mit der Pilot. Welcher Pilot ist gemeint? Der bestimmte Artikel wird hier verwendet, obwohl die betreffende Person im Kontext noch gar nicht eingeführt ist. Erschlossen werden muss also, dass es sich um den Piloten des Flugzeuges handelt, der die Passagiere vor dem Ab‐ sturz bewahrte. Da aber gesagt wurde, dass es der Pilot war, der die Passagie‐ re vor dem Absturz bewahrte, und dass ohne William Whitaker der Absturz passiert wäre, drängt sich dem Leser die Schlussfolgerung auf, dass es sich bei 225 dem Piloten um den schon im ersten Satz eingeführten William Whitaker handeln muss. ‐ Sachverhaltsbestimmung: Die in den Relativsatz (die der Pilot durch ein hals‐ brecherisches Flugmanöver vor dem Absturz bewahrte) eingebettete Sachverhalts‐ bestimmung durch ein halsbrecherisches Manöver ist doppelt unterbestimmt: Der Leser muss zuerst einmal entscheiden, ob mit durch eine räumliche (hindurch), kausale (weil) oder modale (indem) Bestimmung gemacht wird. Die Interpreta‐ tion von durch als räumliche Sachverhaltsbestimmung ist im Kontext nicht sinnvoll. Es bleibt aber offen, ob die kausale oder modale Lesart angemessen ist. Außerdem ist das in der Präpositionalphrase weggefallene Verb hypothe‐ tisch zu ersetzen. Dabei wird die verbleibende Vagheit offensichtlich: Dies gelang ihm, weil er ein halsbrecherisches Flugmanöver erfolgreich vollbrachte / vollführte, durchführte / wagte / beherrschte usw. Dies machte er, indem er ein halsbrecherisches Flugmanöver erfolgreich vollbrachte / vollführte, durchführte / wagte / beherrschte usw. Das Ergebnis bleibt wegen der elliptischen Form der präpositionalen Sachver‐ haltsbestimmung vage. Weder ist entscheidbar, welches Verb hintergründig zu substituieren ist, noch, ob die Sachverhaltsbestimmung kausal oder modal gemeint ist. Satz 3 (1. Eigentlich hätte William Whitaker sofort aus dem Verkehr gezogen werden müssen. 2. Aber dann wären jene 102 Passagiere abgestürzt, die der Pilot durch ein halsbrecherisches Flugmanöver vor dem Absturz bewahrte.) 3. Jeder Therapeut hätte Whitaker als Sicherheitsrisiko eingestuft: 4. Er trank vor dem Flug, er trank während des Fluges, er kokste und schlief kaum. (5. Trotzdem rettete er, als seine Maschine in Turbulenzen geriet, geistesgegenwärtig Besatzung und Passagie‐ re.) ‐ Bewirkungsabsichten: Die mit 3 (wie auch mit 4) gemachten Prädikations‐ handlungen bieten wieder einmal schöne Beispiele für die Relevanz konversa‐ tioneller Implikaturen. Zwar liegt nahe, die Sätze generell als deskriptiv zu verstehen. Aber in welchem Sinn genau? Wozu genau wird die Feststellung Jeder Therapeut hätte Whitaker als Sicherheits‐ risiko eingestuft gemacht? Sie ist nur dann im Kontext relevant, wenn sie als ar‐ 226 gumentative Begründung für die Feststellung 1 angesehen wird in folgendem Sinn: These: Eigentlich hätte William Whitaker sofort aus dem Verkehr gezogen werden müssen. Argument: (Denn) jeder Therapeut hätte Whitaker als Sicherheitsrisiko einge‐ stuft. Satz 4 ‐ Dieser Satz ist Ausdruck von vier Prädikationshandlungen: a) Er trank vor dem Flug. b) Er trank (außerdem) während des Flugs. c) Er kokste. d) Und er schlief kaum. ‐ Bezugnahme: Entgegen dem ersten Anschein ergibt sich auch hier ein prag‐ matischer Rechenaufwand. Das Pronomen er ist konventionell unterbestimmt: Es könnte nach Genus und Numerus sowohl für William Whitaker als auch für jeder Therapeut stehen. Aus dem Kontext ergibt sich aber mit hoher Wahr‐ scheinlichkeit, dass es als Stellvertreter von William Whitaker gemeint ist. ‐ Bewirkungsabsicht: Durch den Doppelpunkt zwischen Satz 3 und Satz 4 wird angedeutet, dass die Autorin diese beiden Sätze in einem bestimmten Zu‐ sammenhang sieht. Dieser Doppelpunkt kann als Hinweis auf die spezifische Art der mit 4 verbundenen deskriptiven Absicht gedeutet werden. So wie Feststellung 3 als Argument für 1 gemeint ist, dürfte 4 als Argument für 3 ge‐ dacht sein, etwa in dem Sinne: Jeder Therapeut hätte William Whitaker als Si‐ cherheitsrisiko eingestuft. Denn er trank, kokste usw. Der Doppelpunkt kann also als ein Signal angesehen werden des Inhalts: „Jetzt kommt die Begrün‐ dung.“ Der Leser muss also hintergründig nach dem Doppelpunkt z.B. die Konjunktion denn oder die Subjunktion weil mitdenken. Er muss erschließen, dass 4 als Begründung für die Wahrheit von 3 gemeint ist. ‐ Um aber zu dieser Deutung zu kommen, muss der Leser bei 4a) und4 b) aus seinem Weltwissen ergänzen, dass mit trinken hier Alkohol trinken gemeint sein muss. Nur dann kann diese Feststellung als Argument für die Behaup‐ 227 tung 3 (Sicherheitsrisiko William Whitaker) gemeint sein. Der Leser muss also die argumentative Bewirkungsabsicht der Feststellung kontextuell erschlie‐ ßen, etwa in dem Sinn: Jeder Therapeut hätte Whitaker als Sicherheitsrisiko eingestuft, weil er Alkohol trank usw. Satz 4 ist für den Leser aber nur dann ein nachvollziehbares Argument, wenn er die Prämisse teilt, dass Alkoholgenuss, Koksen und wenig Schlafen die Leistungsfähigkeit mindern und dadurch Sicherheitsrisiken nach sich ziehen. Hielte er diese Verhaltensweisen für leistungsfördernd, ergäbe sich für ihn kein argumentativer Zusammenhang. Satz 5 (1. Eigentlich hätte William Whitaker sofort aus dem Verkehr gezogen werden müssen. 2. Aber dann wären jene 102 Passagiere abgestürzt, die der Pilot durch ein halsbrecherisches Flugmanöver vor dem Absturz bewahrte. 3. Jeder Therapeut hätte Whitaker als Sicherheitsrisiko eingestuft: 4. Er trank vor dem Flug, er trank während des Fluges, er kokste und schlief kaum.) 5. Trotzdem rettete er, als seine Maschine in Turbulenzen geriet, geistesgegenwärtig Besatzung und Passagiere. Das Prädikationsspiel ist hoch konventionalisiert. Aber ohne Pragmatik kann es auch hier nicht nachvollzogen bzw. verstanden werden: ‐ Bezugnahmen: Auf wen wird mit er referiert? Da ein möglicher Bezug etwa auf den vorher genannten Therapeuten im Kontext als unwahrscheinlich er‐ scheint, wird ziemlich sicher auf William Whitaker bzw. den Piloten Bezug genommen. Weniger klar ist dagegen die Bezugnahme mit seine Maschine in der adverbia‐ len Umstandsbestimmung als seine Maschine in Turbulenzen geriet. Was ist mit seine Maschine gemeint? Der Rezipient muss entkomprimieren und sich für die plausibelste Lösung entscheiden: die Maschine, in der William Whitaker als Passagier mitflog? die Maschine, die William Whitaker gehört, gehörte? die Maschine, in der William Whitaker als Flugbegleiter arbeitete? die Maschine, die William Whitaker als Pilot flog?, usw. Weil aber schon in Satz 2 schon gesagt wurde, dass es der Pilot war, der die Maschine rettete, bleibt nur die letzte der oben genannten Deutungen übrig. 228 ‐ Sachverhaltskommentar: Mit dem einleitenden trotzdem wird bedeutet, dass die Rettungstat des Piloten in Anbetracht der Umstände als unwahrscheinlich anzusehen war. Was mit trotzdem bedeutet wird, ist konventionell gesichert und als Sachverhaltskommentar leicht nachvollziehbar. Nicht gesagt aber wird, in Bezug auf welche Umstände es unwahrscheinlich oder überraschend war, dass der Pilot die Maschine retten konnte. Erschlossen werden muss also, worauf sich dieser Sachverhaltskommentar bezieht: Es gibt für den Rezipien‐ ten zwar mehrere Möglichkeiten, aber im Hinblick auf den vorausgehenden Satz ist die wohl einzig plausible Deutung die im Sinne von: Obwohl er trank usw. rette er die Maschine usw. Das sprachliche Handeln und insbesondere dessen Verstehen sind äußerst komplex. Das Prädikationsspiel mit seinen Regeln ist zwar das konventionelle Gerüst für das Bedeutungshandeln und dessen verstehenden Nachvollzug. Aber wegen seiner kon‐ ventionellen Unterbestimmtheiten und fehlender Explizitheit ist rezeptionsseitig ein ständiger pragmatischer Aufwand verstehensnotwendig. Das sieht man an dieser si‐ cher nicht vollständigen Beschreibung wichtiger pragmatischer Operationen, die der Leser zum Nachvollzug einiger zusammenhängender Sätze eines Zeitungsartikels leisten muss. 229 Anhang 2: Rekursivität in einem Satz in Thomas Manns „Tod in Venedig“ – eine grammatische und handlungstheoretische Beschreibung Dieser Satz bietet ein schönes Beispiel für die hochgradige Konventionalität des Prä‐ dikationsspiels. Durch diese ist der verstehende Nachvollzug relativ unkompliziert. Dennoch sind auch hier einige pragmatische Erschließungen nötig. In voller Länge lautet der zitierte Satz (vgl. S. 114 ff.) „In einer höhlenartigen, künstlich erleuchteten Koje des inneren Raumes, wohin Aschenbach sofort nach Betreten des Schiffes von einem buckligen und unreinlichen Matrosen mit grinsender Höflichkeit genötigt wurde, saß hinter einem Tische, den Hut schief in der Stirn und einen Zigarettenstummel im Mundwinkel, ein ziegenbär‐ tiger Mann von der Physiognomie eines altmodischen Zirkusdirektors, der mit gri‐ massenhaft leichtem Geschäftsgebaren die Personalien der Reisenden aufnahm und ihnen die Fahrscheine ausstellte.“126 Dieser Satz ist hochgradig rekursiv erweitert bzw. komplex, er ist also Ausdruck zahlreicher rekursiv integrierter Prädikationshandlungen. Die folgende grammati‐ sche und handlungstheoretische Beschreibung ist eine von verschiedenen möglichen. Der nicht erweiterte Kernsatz lautet: 1) Ein Mann saß. Mit der zentralen Prädikation von saß über den Referenten Mann werden gleichzei‐ tig drei metaprädikative Handlungen gemacht: Mit dem unbestimmten Artikel wird bedeutet, dass der Referent im bisherigen Diskurs noch nicht eingeführt ist (Kon‐ textdeixis). Mit der Tempusform wird ausgedrückt, dass der geschilderte Sachverhalt chronologisch vor dem Erzählzeitpunkt liegt (Temporaldeixis). Durch die Satz‐ gliedfolge wird außerdem die grundsätzlich deskriptive Absicht des Erzählers zum Ausdruck gebracht (Anzeige der Bewirkungsabsicht). Der mit dem Kernsatz in deskriptiver Absicht ausgedrückte Sachverhalt wird adver‐ bial um zwei Sachverhaltsbestimmungen erweitert, die explizit beispielsweise so formuliert werden könnten: Das war in einer Koje. 126 Thomas Mann, Der Tod in Venedig, S. 23. 230 Das war hinter einem Tisch. Durch Einbettung dieser beiden Sachverhaltsbestimmungen in den Kernsatz wird daraus: 2. In einer Koje saß hinter einem Tische ein Mann. Dieser adverbial erweiterte Satz wird nun um insgesamt 15 Attribute erweitert. Das heißt, es werden innerhalb des Satzausdruckes 15 weitere Prädikationshandlungen eingebettet gemacht. Davon sind acht ‐ zum Teil umfängliche – attributive Einbet‐ tungen auf der obersten grammatisch beschreibbaren Satzebene zu finden. Sie sind alle explikativ, das heißt, sie repräsentieren zusätzliche Feststellungen über den je‐ weiligen Referenten. In diesen sind weitere sieben attributive Einbettungen enthal‐ ten, von denen wohl lediglich drei (inneren, altmodischen, der Reisenden) der Bezug‐ nahme dienen. Diese Attribute sind grammatisch von verschiedenster Art, von satzförmigen bis zu verkürzten attributiven Einfügungen. (Durch Einbettungen der Attribute ineinander ergeben sich Mehrfachnennungen.) Adjektivattribute: höhlenartigen, ziegenbärtiger, buckligen, unreinlichen, grinsender, gri‐ massenhaft, leichtem, altmodischen; Partizip‐Attribut (+ Adv.): künstlich erleuchteten; Genitivattribute: des inneren Raumes, eines altmodischen Zirkusdirektors, der Reisenden; Relativsatz –Attribute: wohin Aschenbach sofort nach Betreten des Schiffes von einem buckligen und unreinlichen Matrosen mit grinsender Höflichkeit genötigt wurde; der mit grimassenhaft leichtem Geschäftsgebaren die Personalien der Reisenden aufnahm und ihnen die Fahrscheine ausstellte. Apposition: den Hut schief in der Stirn und einen Zigarettenstummel im Mundwinkel; Präpositionales Attribut: von der Physiognomie eines altmodischen Zirkusdirektors. Neben den attributiven Einbettungen externer Sätze bzw. Prädikationshandlungen finden wir auch eine Reihe von Sachverhaltsbestimmungen, teilweise eingebettet in attributive Einbettungen. Umgekehrt sind auch attributive Einbettungen in Sachver‐ haltsbestimmungen eingebettet. Umstandsbestimmungen und Sachverhaltskommen‐ tare werden nicht gemacht. Die Sachverhaltsbestimmungen sind nachfolgend fett gedruckt. Sie werden hier danach unterschieden, ob sie sich auf die oberste Prädika‐ tionshandlung (den Hauptsatz) beziehen oder auf attributiv eingebettete Sachverhal‐ te (unterstrichen). 231 „In einer höhlenartigen, künstlich erleuchteten Koje des inneren Raumes, wohin Aschenbach sofort nach Betreten des Schiffes von einem buckligen und unreinli‐ chen Matrosen mit grinsender Höflichkeit genötigt wurde, saß hinter einem Tische, den Hut schief in der Stirn und einen Zigarettenstummel im Mundwinkel, ein zie‐ genbärtiger Mann von der Physiognomie eines altmodischen Zirkusdirektors, der mit grimassenhaft leichtem Geschäftsgebaren die Personalien der Reisenden auf‐ nahm und ihnen die Fahrscheine ausstellte.“127 Bei allen attributiven und adverbialen Einbettungen werden obligatorisch und gleichsam automatisiert auch metaprädikative Strukturanzeigen gemacht. Das heißt, die Einbettungen erfolgen so, dass klar wird, worauf sich die attributiv oder adverbi‐ al eingebetteten Prädikationshandlungen jeweils beziehen. So steht das präpositiona‐ le Attribut von der Physiognomie eines altmodischen Zirkusdirektors rechts vom Bezugs‐ wort, das adjektivische Attribut altmodischen links vom Bezugswort Zirkusdirektor(s) mit zusätzlicher Kasus‐, Genus‐ und Numeruskongruenz, usw. Bei satzförmigen At‐ tributen oder Adverbialen kommt zu einer solchen Strukturindikation jeweils auch noch die Handlung der Temporaldeixis hinzu. Alles in allem ist dieser Satz von Thomas Mann Ausdruck von zweiundzwanzig Prädikationshandlungen sowie der mit ihnen verbundenen metaprädikativen Hand‐ lungen. Wegen der relativ strikten Konventionen der deutschen Grammatik entste‐ hen trotz der Komplexität des prädikativen Gefüges rezeptionsseitig keine allzu gro‐ ßen Verstehensprobleme. Dennoch ergibt sich auf Seiten des Lesers für den verstehenden Nachvollzug ein ge‐ wisser pragmatischer Aufwand. Denn er muss ergänzen, was bei den vielen ellipti‐ schen Attributen und Adverbialen weggelassen ist. Er muss diese Attribute und Ad‐ verbialien in ganze Sätze zurücktransformieren, indem er die weggefallenen verba‐ len Ausdrücke substituiert. Wenn er die elliptischen Einbettungen in ganze Sätze ret‐ ransformiert, in denen die zugrundeliegenden Prädikationshandlungen explizit aus‐ gedrückt sind, könnte eine von verschiedenen möglichen entkomprimierten Fassun‐ gen des Satzes – also in Einfacher Sprache ‐ so lauten: 1. Ein Mann saß (da). 2. Das war hinter einem Tisch. 3. Dieser war (stand) in einer Koje. 4. Sie war höhlenartig. 127 Nach rein grammatischen Gesichtspunkten müsste man den mit wohin eingeleiteten Relativsatz ebenfalls zum grammatischen Adverbiale zählen. Es handelt sich hier aber nicht um ein referenznot‐ wendiges Attribut, das für diese Sachverhaltsbestimmung nötig ist. Deshalb ist der Relativsatz hier als zusätzliche, von der Sachverhaltsbestimmung unabhängige Feststellung interpretiert (vgl. unten Satz 6‐9). 232 5. Sie war (befand sich) im inneren Raum. 6. Sie war erleuchtet. 7. Dorthin wurde Aschenbach von einem Matrosen genötigt. 8. Das war nach Betreten des Schiffes. 9. Dieser Matrose grinste dabei höflich. 10. Er war bucklig und unreinlich. 11. Der Mann (hinter dem Tisch) trug einen Hut. 12. Der war schief in der Stirn. 13. Er hatte einen Zigarettenstummel im Mundwinkel. 14. Er war ziegenbärtig. 15. Seine Physiognomie war die eines Zirkusdirektors. 16. Dieser war altmodisch. 17. Er nahm Personalien auf. 18. Das waren die (Personalien) der Reisenden. 19. Das machte er mit Geschäftsgebaren. 20. Dieses zeigte Leichtigkeit (Dieses sollte Leichtigkeit vorführen.) 21. Diese war grimassenhaft. 22. Und er stellte den Reisenden die Fahrscheine aus. Die umfangreiche Entkomprimierungsarbeit, die bei diesem komplexen Satz anfällt, ist für den Leser aber nicht allzu riskant. Denn in der Mehrzahl der Fälle sind die zu substituierenden Verbalausdrücke die Hilfsverben sein und haben, wie etwa in den Sätzen 2‐ 6. Diese richtigerweise auch Hilfszeitworte genannten Ausdrücke sind so etwas wie „leere“ Prädikatoren, die lediglich zum Ausdruck der temporalen Deixis benötigt werden. Allerdings bleiben auch nach dieser Entkomprimierung noch einige pragmatische Aufgaben. Bei 5 muss zusätzlich ergänzt werden: (Im inneren Raum) des Schiffes. Bei 8 muss hinzugedacht werden, dass es sich um das Schiff handelt, das vor dieser Textstelle bereits vorgestellt wurde. Schließlich ist auch das Adjektivattribut altmo‐ disch zu bestimmen. Ist es referenznotwendig oder explikativ? Der fragliche Mann wird ja als Mann von der Physiognomie eines altmodischen Zirkusdirektors charak‐ terisiert. Und was ist damit gemeint? Die Physiognomie eines Zirkusdirektors, der altmodisch aussieht oder altmodisch gekleidet ist? Oder ist ein Zirkusdirektor ein‐ fach altmodisch, weil aus der Zeit gekommen? Dann wäre das Attribut nicht refe‐ renznotwendig, da ja alle Zirkusdirektoren altmodisch wären. Unabhängig davon, ob man die Entkomprimierung des Satzes so wie oben oder an‐ ders vornimmt, wird die besondere Eigenschaft des Originalsatzes deutlich: In die‐ sen sind einundzwanzig weitere Sätze – also einundzwanzig Prädikationshandlun‐ 233 gen – eingebettet. Da die meisten dieser Einbettungen elliptischer Art sind, werden die 107 Wörter der ausführlichen Version auf 66 Wörter reduziert. Welche Motive der Autor für seine Art des Erzählens auch gehabt haben mag – der Wunsch, mit den zahlreichen Einbettungen Zeit zu sparen, dürfte vermutlich nicht ausschlaggebend gewesen sein. 234 235 Literatur: Austin John L. Zur Theorie der Sprechakte. (How to do things with words.) Stuttgart (Reclam) 1972 Autenrieth Tanja Heterosemie und Grammatikalisie‐ rung bei Modalpartikeln. Tübingen 2002 Bach Kenneth: The Myth of Conventional Implica‐ ture. Mind & Language 9, 124 ‐ 162 1994 Bons Iris: Polysemie und Distribution. Gießen 2009 Blühdorn Hardarik Syntaktische, semantische und pragmatische Funktionen von No‐ minalgruppen im Deutschen. In: Convivium. Germanistisches Jahr‐ buch Polen. DAAD. Bonn 2008. Brooks David Das soziale Tier. München 2012 Bungarten Theo (Hrsg.) Wissenschaftssprache. Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fun‐ dierung und Deskription. München 1981 Deutscher Guy: Du Jane, ich Goethe. Eine Geschich‐ te der Sprache. München 2008 Deutscher Guy: Im Spiegel der Sprache. Warum die Welt in anderen Sprachen anders aussieht. München 2010 Doherty Monika Epistemische Bedeutung. Berlin 1985 Donald Merlin: Stuttgart Triumph des Bewusstseins. Die Evolution des menschlichen Geistes. 2008 Dowty David Thematic proto‐roles and argument selection. Language, 67‐3, 547‐619 1991 Engelen Bernhard: Einführung in die Syntax der deut‐ schen Sprache. Band II: Satzglieder und Satzbaupläne. Baltmanns‐ weiler 1986 Pragmatik. Tübingen 2011 The myth of language universals: Language diversity and its im‐ portance for cognitive science. Behavioral and Brain Sciences 32, 429–492 2009 Erhardt, C., Heringer H.J. Evans, N., Levinson, S. Everett Daniel Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pirahã. In: Current Anthropology. Bd. 46/4, S. 621–646. 2005 236 Everett Daniel Cultural Constraints on Grammar in Pirahã: A Reply to Nevins, Pesetsky, and Rodrigues. http://ling.auf.net/lingbuzz/000427 2007 Fritz Gerd: Historische Semantik. Stuttgart 2006 Friederici Angela D. Denn das Wort ist im großen Netz verborgen. FAZ, 21. Mai 2014, N2 2014 Gopnik u.a. Forschergeist in Windeln. Wie Ihr Kind die Welt begreift. München 2000 Grice Herbert Paul Sprecher‐Bedeutung und Intentio‐ nen. In: Meggle 1979, 16 ff. Grice Herbert Paul Intendieren, Meinen, Bedeuten (Meaning). In: Meggle 1979, 2 ff. Grice, Herbert Paul: Logik und Konversation. In: Meggle 1979, 243 ff. Grice Herbert Paul. Studies in the Way of Words. HUP, Cam‐ bridge MA. 1989 Haspelmath Martin Grammatikalisierung: Von der Per‐ formanz zur Kompetenz ohne ange‐ borene Grammatik. In: Krämer/ König 2002 Hegel G. W. F. Werke. Frankfurt 1979 Helbig, B. Buscha, J. Deutsche Grammatik: Ein Hand‐ buch für den Ausländerunterricht. München 2008 Hempfer Klaus W.: Präsuppositionen, Implikaturen und die Struktur wissenschaftlicher Ar‐ gumentation. In: Bungarten 1981 , 312 ff. 1981 Heringer Hans Jürgen Praktische Semantik. Stuttgart 1974 Heringer Hans Jürgen Grammatik und Stil. Praktische Grammatik des Deutschen. Frankfurt a. M. 1989 Heringer Hans Jürgen (Hrsg.): Sprachgeschichte und Sprachkritik. Berlin; New 1993 York Heringer Hans Jürgen: Lesen lehren lernen: Eine rezeptive Grammatik des Deutschen. 2. Aufl. Tübingen 2001 Heringer Hans Jürgen: Morphologie. Paderborn 2009 237 Hübl Philipp Folge dem weißen Kaninchen ... in die Welt der Philosophie. Hamburg 2012 Iacoboni Marco Woher wir wissen, was andere den‐ ken und fühlen: Die neue Wissen‐ schaft der Spiegelneuronen. DVA 2009 Jelinek Eloise Hingham, Quantification in Straits Salish. In: Quantification in natural languages, MA, USA ed. E. Bach, E. Jelinek, A. Kratzer & B. Partee, pp. 487–540. Kluwer Academic Publishers. Keller Rudi: Das epistemische weil. Bedeutungs‐ wandel einer Konjunktion. In: Heringer u.a. 1993 Keller, Kirschbaum Bedeutungswandel. Eine Einfüh‐ rung. Berlin; New 2003 York Kemmerling Andreas Bedeutung und der Zweck der Sprache. In: W. Vossenkuhl (Hrsg.), Von Wittgenstein lernen, 99‐120 Berlin 1992 Kompa Nikola Welchen Unterschied fängt die Semantik / Pragmatik ‐ Unterschei‐ dung ein? http://www.gap5.de/proceedings/p df/296‐308_kompa.pdf 2003 Krämer, S., König, E. Gibt es eine Sprache hinter dem Sprechen? Frankfurt a. M. 2002 Kripke Saul A.: Name und Notwendigkeit. Frankfurt a.M. 1981 Le Laboureur Louis : Avantages de langue françoise sur la langue latine Paris Guillaume de Luyne. 1669 Levinson S. C. Pragmatik. 2. Aufl. Tübingen 1994 Liedtke Frank: Grammatik der Illokution Tübingen 1998 Lueken G.‐L. (Hrsg.): Kommunikationsversuche – Theorien der Kommunikation, Leipziger Universitätsverlag Leipzig 1997 Mann Thomas: Der Tod in Venedig und andere Er‐ zählungen. Frankfurt (FTB) 1991 Meggle Georg: Regeltheoretische contra Intentiona‐ listische Semantik? In: Weingartner u.a., S. 109‐120. 1998 Meggle Georg: Theorien der Kommunikation – Ei‐ ne Einleitung. In: Lueken 1997, 14 ff. 1997 1995 238 Meggle Georg: Handlungstheoretische Semantik. Berlin, New 2010 York Meggle Georg (Hrsg.): Handlung, Kommunikation, Bedeu‐ tung. Frankfurt a. M. 1979 Morris Charles Grundlagen der Zeichentheorie. Frankfurt a. M. 1988 Pfister Jonas: Die Sprachphilosophie von Paul Grice. Information 2008 Philosophie 3, 66‐75. Pinker Steven: Der Sprachinstinkt. München 1996 Polenz Peter von Deutsche Satzsemantik. 3. Aufl. Berlin 2008 Prinz Wolfgang Selbst im Spiegel. Die soziale Kon‐ struktion von Subjektivität. Berlin 2013 Prinz Wolfgang Kritik des freien Willens: Bemer‐ kungen über eine soziale Institution. Psychologische Rundschau, Heft 4, Restak Richard The Naked Brain: How the Emerg‐ ing Neurosociety Is Changing How we live, Work, and Love. New York 2006 Reicher Maria Elisabeth Referenz, Quantifikation und onto‐ logische Festlegung. Frankfurt a. M. Ontos Verlag. 2005 2004 Rizzolatti, G. Sinigaglia, C. Empathie und Spiegelneurone. Frankfurt a.M. 2008 Roth, Gerhard: Das Gehirn und seine Wirklichkeit Frankfurt 1997 Ryle Gilbert Der Begriff des Geistes. Stuttgart 1969 Savigny Eike von Zum Begriff der Sprache. Stuttgart 1983 Spitzer Manfred Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens. Heidelberg, Berlin 2002 Spitzer Manfred Geist im Netz. Modelle für Lernen, Denken und Handeln. Heidelberg, Berlin 2000 Searle John R.: Sprechakte Frankfurt 1971 Searle (1987), John R.: Intentionalität Berlin 1987 Sick Sebasti‐ an: Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ein Wegweiser durch den Irrgarten der deutschen Sprache. Folge 1‐3. Köln 2008 Strawson Peter Frederic: Intention und Konvention in Sprechakten. In: Strawson, Logik und Linguistik. Aufsätze zur Sprachphilosophie. München 1974 239 Thurmaier Maria Modalpartikeln und ihre Kombina‐ tionen. Tübingen 1989 Tomasello Michael: Warum wir kooperieren. Frankfurt 2010 Tomasello Michael: Die Ursprünge der menschlichen Kommunikation. Frankfurt 2009 Ulfig Alexan‐ der: Lebenswelt‐ Reflexion – Sprache: zur reflexiven Thematisierung der Lebenswelt in Phänomenologie, Existenzialontologie und Diskurs‐ theorie. Würzburg 1997 Watzlawick Paul: Menschliche Kommunikation. Bern 1969 Weingartner, Schurz, Dorn (Hrsg.) The Role of Pragmatics in Contem‐ porary Philosophy. Wien 1998 Willems Klaas: Kasus, grammatische Bedeutung und kognitive Linguistik: Ein Bei‐ trag zur allgemeinen Sprachwissen‐ schaft. Tübingen 1997 Wittgenstein Ludwig: Philosophische Untersuchungen. Oxford 1953 Wittgenstein Ludwig: Tractatus Logico‐Philosophicus. London 1922